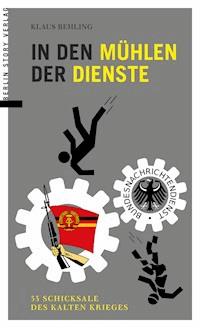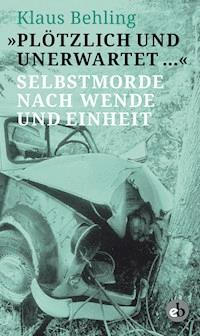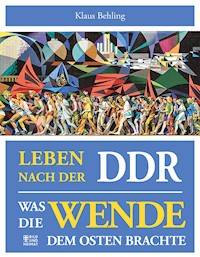Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition berolina
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Das schönste am Ruhestand ist der Weg dorthin, meint Klaus Behling. Doch auch danach muss kein großes, schwarzes Loch entstehen – obwohl es wahrlich manchmal schwerfällt, sich im neuen Lebensabschnitt zurechtzufinden. Unsere Gesellschaft wird älter. Was bedeutet das für den Alltag und die Familie? Weshalb gibt es noch immer unterschiedliche Renten in Ost und West? Warum droht vielen trotz Arbeit Armut im Alter? Was muss man für die private Vorsorge wissen? Darf man Autofahren, bis es kracht, und wie funktioniert das eigentlich mit der Gesundheit und dem Sex? Behling sucht nach einem Wegweiser zum Altwerden für Anfänger. Er fand Vergnügliches und Ernstes. Herausgekommen ist ein unterhaltsames sowie informatives Buch für alle, die sich mit dem Ruhestand auseinandersetzen wollen und müssen. Ein Ratgeber der besonderen Art, der manch heißes Eisen anpackt und zugleich Mut macht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaus Behling
Achtung
Rentner!
Alltag, Geld, Gesundheit – so gelingt der Ruhestand!
edition berolina
eISBN 978-3-95841-557-7
1. Auflage
© 2018 by BEBUG mbH / edition berolina, Berlin
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Umschlagabbildung: Mihalis A. / AdobeStock
Alexanderstraße 1
10178 Berlin
Tel. 01805/30 99 99
FAX 01805/35 35 42
(0,14 €/Min., Mobil max. 0,42 €/Min.)
www.buchredaktion.de
Geheimsache »Ruhestand«
Das Schönste am Ruhestand ist der Weg dorthin. Er ist mit Träumen gepflastert. Endlich wäre genug Zeit, um die alten Bekanntschaften zu pflegen, sich mit dem zu beschäftigen, was man schon immer gern wollte, mal an sich selbst zu denken und das Leben nicht nach den vielen alltäglichen Pflichten ausrichten zu müssen. All jene, die noch ein Stück dieses Weges vor sich haben, sprechen gern vom »wohlverdienten Ruhestand«. Die über alles und jedes salbadernden Politiker tun so, als sei es nun an der Zeit, mit der Rente so etwas wie eine »Prämie« für die »Lebensleistung« zu bekommen, und manch verheißungsvolle Werbung zeigt fröhliche braungebrannte Menschen mit silbernen Haaren, die allenfalls eine Kräuterpille gegen das Völlegefühl brauchen.
Die Erkenntnis, dass der »Ruhestand« kein ewiger Urlaub sein würde, ist meist schon der Gipfel des kritischen Blickes auf die Zukunft. Dennoch herrscht die Erwartung, es bleibe eigentlich alles so, wie es ist, nur mit viel Zeit und ausreichend Geld. Wer auf Letzteres keine fundierte Aussicht hat, tröstet sich damit, dass es schon irgendwie gehen wird, man hat ja schließlich im Leben schon ganz andere Dinge gemeistert.
Es fällt kaum auf, dass zwar unentwegt von allen, die noch nicht so weit sind, über das Alter und die Alten geredet wird, die Betroffenen meist jedoch eisern schweigen. Sie haben den auf Tag und Minute bestimmbaren Wechsel ihrer Lebensperspektive hinter sich.
Das wacklige Rentnerglück
Ob der Abschied von der Arbeitswelt ein Bruch oder der Einstieg in ein schöneres, selbstbestimmtes Leben wird, lässt sich vorab kaum klären. Lauthals verkündete Zustandsbeschreibungen Betroffener, wie »phantastisch« und »super« es ihnen nun plötzlich gehe, nähren die Vermutung, dass über keinen anderen Bereich des Lebens so viel gelogen wird wie über den Ruhestand. Ganz besonders Eifrige erklären ihn gern zum »Unruhestand«. Es scheint derweil ein Statussymbol für Rentner geworden zu sein, »Stress« zu haben.
Die euphorischen Berichte vom tollen Rentnerdasein müssen aber keine notorische Lüge sein. Viele Menschen fühlen sich wohl, haben befriedigende Aufgaben gefunden und empfinden die neuen Freiheiten als Bereicherung. Allerdings ist es auch ein wackliges Glück, denn es setzt voraus, dass alles genauso bleibt wie am Ende des Arbeitslebens. Das ist jedoch allenfalls für eine Weile der Fall. Ein probates Mittel, mit Veränderungen umzugehen, hat das Berufsleben tief eingeschliffen: Die meisten Menschen sind zu sich selbst nicht besonders ehrlich und glücklicherweise in der Lage, sich alles Mögliche »schönzugucken«. Wer seine Arbeit eher als Last empfand, hat in diesem Verhalten über Jahrzehnte seine Art der Problembewältigung eingeübt. War die Tätigkeit mehr Lust, mag auch niemand sonderlich gern zugeben, sich ausgerechnet im engen Korsett der tagtäglichen Pflichten wohlgefühlt zu haben. Doch es strukturierte nicht nur den Tagesablauf und gab die sozialen Kontakte vor, sondern garantierte auch Erfolgserlebnisse und den »Sinn des Lebens«.
Die eingeübten Verhaltensweisen beeinflussen auch Befragungen der Betroffenen. Dabei ist ohnehin Zurückhaltung geboten, denn schließlich hat jeder das Recht, sich so zu sehen, wie er es möchte. Eine große Rolle spielen Perspektivwechsel. Man kennt sie aus der Familie: Ist ein tyrannischer Vater oder eine bösartige Mutter erst einmal unter der Erde, mutiert er oder sie zum liebsten Menschen. Mit der Arbeit verhält es sich ähnlich: Klagten manche pauschal, »die Schufterei macht mich noch krank«, sieht es im Rückblick ganz anders aus. Kleine Verstimmungen, die aus der neuen Situation des Ruhestands erwachsen, werden nun plötzlich als dramatische Ereignisse empfunden.
Statistiken sind ebenfalls fragwürdig, denn sie belegen alles und nichts. Wer mit dem Kopf auf der Herdplatte und den Füßen im Kühlschrank liegt, genießt statistisch betrachtet eine angenehme Temperatur. Dass er sich tatsächlich dabei wohlfühlen würde, ist zu bezweifeln. Dessen ungeachtet zeigen große Tabellen, dass Ruheständler öfter zu Depressionen neigen, Alkoholismus und Beziehungskrisen zunehmen und sich die Gesundheit oft schlagartig verschlechtert. Erhebungen des Bundesverbands der Betriebskrankenkassen aus dem Jahr 2015 belegen, dass Rentner mit 16 Prozent mehr als Arbeitslose mit 13,5 Prozent und Berufstätige mit 8,7 Prozent unter Depressionen leiden. Männer scheinen dabei stärker betroffen als Frauen, denn deren Leben ist – den Umständen der immer noch männlich dominierten Gesellschaft geschuldet – fast vollständig auf Arbeit und Beruf ausgerichtet.
Demgegenüber stehen jedoch Befragungen nach Glück und Zufriedenheit. Sie belegen, dass es zwischen Älteren und Jüngeren kaum signifikante Unterschiede dabei gibt. Der Querschnitt verschiedener Erhebungen dazu lässt ein Verhältnis von etwa 70 Prozent Zufriedener zu 30 Prozent Unzufriedener erkennen. Ein wichtiger Unterschied zwischen den Generationen bleibt bei derartigen Betrachtungen jedoch auf der Strecke. Die Gruppe der resignierten jungen Leute unterliegt einem steten Wandel, weil sich deren Lebenslagen beständig verändern. Auf Verlust der Arbeit folgt eine neue Tätigkeit mit neuen – positiven oder negativen – Potentialen, Partnerschaften wechseln, und letztlich gilt das alte »Die Zeit heilt alle Wunden«-Sprichwort ohne Einschränkung. Dass Gram über und Hadern mit den Lebensverhältnissen bei Älteren tiefersitzen, haben amerikanische Wissenschaftler in Langzeitstudien entdeckt. Nach acht Jahren Ruhestand fühlten sich von den 30 Prozent Unglücklichen nur 5 Prozent besser, 25 Prozent jedoch noch schlechter. Dennoch gibt es dabei keine mechanisch wirkenden Hebel.
Altersforscher haben längst ein »Zufriedenheitsparadoxon« ausgemacht. Trotz nachlassender Gesundheit, Verlusten im sozialen Umfeld und finanziellen Einschränkungen wächst Unzufriedenheit nicht zwangsläufig mit dem Lebensalter. Ältere sind offenbar mit weniger zufrieden und messen sich an der als Lebenserfahrung gesammelten Demut vor dem Unausweichlichen und einer vom sozialen Status erzwungenen Bescheidenheit. Vor diesem Hintergrund stellt sich Glück als gelungene Balance zwischen Erwartungshaltung und Realität dar. Sie zu finden, ist ein schwieriger Prozess. Und natürlich fehlt auch der entsprechende Fachbegriff nicht, der in vielen Fragen zum Fühlen im Alter von jenen kommt, die davon – noch nicht – betroffen sind: »Erwartungsmanagement«.
Dahinter steckt eigentlich eine fatale Logik: Wer sich den Ruhestand nicht zu rosig ausmalt und bei seinem Eintritt nicht so tut, als sei alles wie früher, muss weniger Anfälligkeit befürchten. Damit drängt diese Betrachtung die gesellschaftliche Verantwortung für ihre Alten in den abgeschlossenen, persönlichen Bereich. Wer sich unwohl fühlt, ist eben nur ein schlechter Manager seiner Lebenssituation. Das wiederum eröffnet den Einstieg in die These: »Ruhestand kann krank machen.«
Tatsächlich bestätigen das medizinische Diagnosen, die die Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization,WHO) sammelt, um den wichtigsten »Krankmachern« auf die Spur zu kommen. Unter der Kennziffer F 43.2 verzeichnet sie »Anpassungsstörungen« und identifiziert als eine von deren Ursachen das Ruhestandsdasein. Es führe zu »depressiven Reaktionen« und »Störungen« im Sozialverhalten. Natürlich müssen sie nicht jeden treffen, aber sie belasten dennoch eine definierbare Gruppe, bei der es bis zur klinischen Auffälligkeit geht.
Hinweise auf Hintergründe lieferten bereits in den 1960er Jahren die amerikanischen Psychiater Thomas Holmes und Richard Rahe. Sie suchten nach großen und kleinen Einschnitten im Leben, vom Tod des Partners oder einer Scheidung bis hin zur Änderung der Ernährungsgewohnheiten und Folgen kleinerer Rechtsverstöße. Dann versahen sie das jeweilige Ereignis mit einem Punktewert, der die dadurch ausgelöste Stresswirkung illustrierte. Mit 45 Punkten gehörte danach der Eintritt in den Ruhestand zu den zehn wichtigsten Faktoren, die das Leben negativ beeinflussten. Er entsprach etwa dem einer unerwarteten Entlassung (47 Punkte) oder einer Verheiratung (50 Punkte) und lag über sexuellen Schwierigkeiten (39 Punkte) oder einer Veränderung der finanziellen Lage (38 Punkte). Holmes und Rahe gingen davon aus, dass sich die durch die Lebenseinschnitte verursachten Stressfaktoren addieren können, und sagten für Werte oberhalb von 150 Punkten für die Hälfte der Betroffenen innerhalb der kommenden zwei Jahre einen gesundheitlichen Zusammenbruch voraus. Ab 300 Punkten stieg diese Zahl auf 80 Prozent.
Man mag dem in Amerika oft zu beobachtenden Drang, alles in Zahlen fassen zu wollen, folgen oder auch nicht. Unstrittig bleibt, dass der Stellenwert der Arbeit in Deutschland im internationalen Vergleich sehr hoch liegt. Mit einer gewissen Verachtung wird auf jene Länder geblickt, in denen die Menschen arbeiten, um zu leben, und, im Gegensatz zu ihnen, das Arbeiten als Ideal des Lebens kultiviert. Praktisch drückt sich das in einer steigenden Zahl von Berufstätigen aus, die ihrerseits wiederum mehr Stunden arbeiten, als dies vor rund 25 Jahren der Fall war. Im ersten Quartal 2017 zählte das Statistische Bundesamt 43,7 Millionen Erwerbstätige mit insgesamt 15,3 Milliarden Arbeitsstunden. Jeder Erwerbstätige kam so auf durchschnittlich 350,7 Stunden in drei Monaten. Die wachsende Tendenz der geleisteten Arbeitszeit zeigt der Blick auf deren Entwicklung bei öffentlichen und privaten Dienstleistern. Wurden nur in diesem Bereich im Jahr 2000 noch 15,61 Milliarden Arbeitsstunden geleistet, waren es 2010 bereits 16,99 Milliarden Stunden.
Ein radikaler Umbruch steht bevor
All diese Zahlen illustrieren die zentrale Bedeutung der Erwerbstätigkeit und betreffen direkt den Ruhestand. Je intensiver die Arbeit zuvor die Menschen belastete und gleichzeitig befriedigte, umso größer ist die »Fallhöhe« auf null. Überdies hat die Lebensphase nach der aktiven Arbeit heute einige Besonderheiten, über die noch detailliert zu reden sein wird.
Die Eckpunkte: Der Ruhestand betrifft im Westen die voraussichtlich letzte Generation, ab Anfang der 1960er Jahre geboren, die noch auf eine nahezu ununterbrochene Berufslaufbahn zurückblickt. Bereits jetzt davon ausgeschlossen sind Frauen, die wegen der Kinder einen kürzeren Erwerbslebenslauf haben, dessen Lücken auch durch die anrechenbaren Erziehungszeiten nicht beseitigt werden. Im Osten streben jetzt jene in den Ruhestand, die von den Umbrüchen der Einheit, von oft langen Arbeitslosen- und Umschulungszeiten und selbst im günstigsten Fall von über längere Zeit erheblich schlechteren Verdienstmöglichkeiten betroffen waren.
Eine weitere bislang ungekannte Entwicklung besteht darin, dass es noch nie so viele kinderlose ältere Menschen gab wie bei denen, die nun in die Jahre kommen. Beim Absinken der Geburtenziffer – dem Durchschnittswert aller lebend geborenen Kinder pro Frau – um ungefähr ein Drittel waren Mitte der 1960er Jahre sehr ähnliche Entwicklungen in Ost und West festzustellen. Dann erhöhte sich die durchschnittliche Kinderzahl in der früheren DDR, brach aber nach der Einheit um rund die Hälfte ein. Das heißt, nach dem rapiden Anwachsen der Zahl kinderloser Alter mit dem Übergang in den Ruhestand der geburtenstarken Jahrgänge der 1960er Jahre wird es, um etwa zwanzig Jahre nach hinten versetzt, noch einmal eine besonders starke Belastung im Osten geben.
Der wichtigste und bislang am wenigsten mit neuen Überlegungen unterfütterte Punkt ist jedoch die sich wandelnde Haltung der Gesellschaft zum Ruhestand.
Vorläufer der heutigen Rentenversicherung war die 1889 von Reichskanzler Otto von Bismarck eingeführte Sozialversicherung unter dem im Sinne des Wortes zutreffenden Namen »Alters- und Invaliditätsversicherung«. Sie machte sich durch die industrielle Revolution nötig und ging davon aus, dass Lohnarbeiter so lange erwerbstätig sind, bis sie das wegen des Alters oder durch Invalidität nicht mehr können. Hohes Alter sah man als spezielle Form der Invalidität an. Das »Renteneintrittsalter« – das ohnehin nur von sehr wenigen erreicht wurde und in der Regel mit körperlicher Gebrechlichkeit einherging – lag demzufolge bei 70 Jahren.
Aus dieser Idee entwickelte sich die einer finanziellen Versorgung im Ruhestand. Sie war direkt an die Arbeit gebunden und basierte auf den Strukturen der seit der industriellen Revolution existierenden Arbeitswelt. Dazu gehörte, dass es für jeden Menschen mit jedem Bildungsgrad Erwerbsmöglichkeiten gab. Seit Beginn der massiven Globalisierung änderte sich das ökonomische Umfeld. In einem Industrieland wie Deutschland kann heute kaum jemand mehr seinen Lebensunterhalt mit dem Schneidern von Kleidung oder dem Schreinern von Möbeln sichern. Die Tendenz geht dahin, dass sich die Erwerbsmöglichkeiten bei »einfachen Arbeiten« beständig einschränken und sie in Bereiche höherer Bildung vordringen. Mit Reformen des verbleibenden Potentials, offenkundig im Entstehen eines wachsenden Dienstleistungsprekariats abgebildet, lässt sich das eine Weile beherrschen. In diesen Prozess greift jedoch mit massiver Intensität und atemberaubender Geschwindigkeit die Digitalisierung ein. Sie ist nichts anderes als eine grundlegende Veränderung der gesamten Arbeitswelt, allenfalls vergleichbar mit der Erfindung der Dampfmaschine oder des Beginns der Nutzung von Elektrizität. Erforderten diese Entwicklungen letztlich ein Heer von Lohnarbeitern, macht es die Digitalisierung zunehmend überflüssig. Das Stichwort dazu heißt: »Wissensgesellschaft«. Die körperlichen Belastungen verringern sich, die intellektuellen wachsen.
Die Länge der »richtigen« Arbeitszeit ist seit dem Beginn des industriellen Zeitalters umstritten. Das vorherrschende ökonomische Denken ging dabei von Anfang an davon aus, dass mehr Arbeit zu mehr gesellschaftlichem Reichtum führt. Demzufolge konzentrierte sich der Kampf um sozialen Fortschritt wesentlich auf die Verkürzung der Arbeitszeit. Das verlief sehr erfolgreich. Im 19. Jahrhundert wurden in Deutschland noch fast 4.000 Stunden im Jahr gearbeitet. Die Arbeitszeit sank von 3.920 Stunden im Jahr 1849 auf knapp 3.400 Stunden an der Schwelle des 20. Jahrhunderts. Dann dauerte es etwas mehr als weitere fünfzig Jahre, um die 2.500 Stunden zu unterschreiten. Noch im Jahr 1950 betrug die jährliche Arbeitszeit pro Person 2.640 Stunden, 1958 waren es dann 2.440 Stunden. Inzwischen werden hierzulande von Vollzeitbeschäftigten jährlich um die 1.650 Stunden gearbeitet.
Die soziale Errungenschaft einer »menschlicheren« Arbeitszeit veränderte in den Industriestaaten den Marktwert der Arbeit. Sie wurde kostbarer. Aber es entstand auch ein Verteilungsproblem. Wachstumskritiker fordern schon lange eine neue Balance zwischen Arbeiten und Leben. Andere vermuten in einer Abkehr vom rein ökonomistischen Denken den Schlüssel für mehr soziale Gerechtigkeit in der Gesellschaft.
All diese Überlegungen konzentrieren sich gegenwärtig noch auf die aktiv im Arbeitsprozess stehenden Frauen und Männer. Die Diskussionen akzeptieren weitgehend stillschweigend, dass es einen riesigen Bereich gesellschaftlich notwendiger Arbeit – zum Beispiel bei der Kindererziehung, der Pflege der Alten oder im ehrenamtlichen Engagement – gibt, der als nicht »geldwert« behandelt wird. Das werden sich die Gesellschaften zukünftig so nicht mehr leisten können.
Die anstehenden Umbrüche in der Arbeitswelt werden sich auch auf den Umgang mit dem Ruhestand auswirken. Keine Gesellschaft kann es sich erlauben, ihre Wissensträger so zu behandeln, als seien sie mit 65, 67, 70 oder 80 Jahren den Bismarckschen Arbeitsinvaliden gleichgestellt. Gleichzeitig ergibt sich aber das Problem einer zwanglosen, materiell abgesicherten Nutzung des angesammelten Wissens außerhalb der heute bekannten Strukturen der Arbeitswelt.
Und dann sind auch noch jene da – und es wird sie weiterhin geben –, die nicht mit dem Kopf, sondern mit den Händen ihr Geld verdienen. Ihr Anteil am Erarbeiten des gesellschaftlichen Reichtums sinkt. Dessen Verteilung läuft schon jetzt zu ihren Ungunsten. Ein riesiger Bereich für die Existenz der Gesellschaft notwendiger Arbeit, vor allem sichtbar in der tagtäglich erbrachten Leistung der Frauen, ist von der Erwerbstätigkeit abgekoppelt. Angesichts der sich wandelnden Arbeitswelt und der sich verändernden Formen des Familienlebens wird sich in wenigen Jahrzehnten die Frage nach einer neuen Verteilungsform des gesellschaftlichen Reichtums stellen. Das hätte dann direkte Wirkungen auf die Dauer und die materielle Absicherung der Lebensphase nach der Erwerbsarbeit.
Ein gesellschaftlicher Diskurs zu diesen Zukunftsproblemen steht noch aus. Die Spurensuche danach kann sich deshalb erst einmal nur auf eine Bestandsaufnahme konzentrieren. Für die in diesem Buch angeführten Zahlen- und Berechnungsbeispiele gilt der 31. Dezember 2017 als Redaktionsschluss.
Die Gesellschaft und ihre Alten
Für demokratisch verfasste Gesellschaften gilt seit jeher die Formel: Masse ist Macht. In Deutschland sind etwa 62 Millionen Menschen wahlberechtigt. Gut ein Fünftel von ihnen ist über 70 Jahre, ein weiteres knappes Fünftel zwischen 50 und 70 Jahren alt. Obwohl seit 1972 die Wahlbeteiligung insgesamt massiv sank, gehen drei Viertel der über 50-Jährigen an die Urnen.
Bei den Bundestagswahlen 2017 waren die über 60 Jahre alten Wahlberechtigten mit 36,1 Prozent erstmals die größte Gruppe. Die über viele Jahre dominierenden 40- bis 59-Jährigen wurden zur zweitstärksten Kraft. Auf Platz drei landeten die 18- bis 39-Jährigen mit 29,3 Prozent. Das heißt, eine aktive Beteiligung an demokratischen Prozessen vollziehen überwiegend jene, deren Werte von den langsam aussterbenden Strukturen der ihnen noch bekannten Arbeitswelt geprägt sind. So entsteht ein Konflikt zwischen tradierten Lebensansichten und sich wandelnder Lebensrealität. Bei der Abstimmung über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, »Brexit« genannt, hat er sich zum ersten Mal drastisch gezeigt: Die »Alten« bestimmten über die künftige Lebensform der »Jungen« und hemmten damit deren Entwicklung mit voraussichtlich langfristigen negativen Folgen.
Daneben gibt es auch einen ökonomischen Binneneffekt. Erfahrungsgemäß steigt mit wachsendem Alter die Wahlbeteiligung. Alt-Bundespräsident Roman Herzog fürchtete bereits 2008 das Entstehen einer »Rentnerdemokratie«. In ihr würden die Alten bestimmen, wie der gesellschaftliche Reichtum verteilt wird.
Bisher ist das noch nicht der Fall. Dafür gibt es verschiedene Gründe: Die erste im Frieden und Wohlstand der alten Bundesrepublik herangewachsene Generation steht gerade erst an der Schwelle zum Ruhestand. Ihr materieller Lebensstandard ist so hoch, dass noch keine Verteilungskonflikte entstehen. Sie hat das System der parlamentarischen Demokratie als Erfolgsmodel erlebt. Es machte die friedliche Vergrößerung des Landes durch den Beitritt der früheren DDR um ein Drittel möglich und war ökonomisch so robust, den Zuwachs von rund 15 Millionen Menschen zu verkraften. Der dadurch erweiterte Binnenmarkt verzögerte um nahezu ein Jahrzehnt die Notwendigkeit, sich einer engeren und längst überfälligen europäischen Integration und der Globalisierung zu stellen. Überdies verfestigten sich die sozialen Unterschiede sowohl innerhalb der Generation West als auch noch einmal mit einem deutlichen Abstand gegenüber der früheren Generation Ost. Beide stehen heute an der Schwelle zum Ruhestand. Trotz der Gemeinsamkeit der Masse der Seniorinnen und Senioren, in Abhängigkeit von sozialstaatlichen Leistungen zu leben, zu denen Renten ebenso wie Sozialversicherungen zählen, bilden die jetzt alt werdenden Frauen und Männer eine äußerst heterogene Gruppe ohne eine eigene politische Formation.
Die auf bedeutsamen Wohlstand der Älteren basierende Generationensolidarität verdeckt materielle Generationskonflikte. Seit dem Beginn der 1980er Jahre wandelten sich die Nachkommen der zuvor »jungen Wilden« zu »jungen Milden«. Der Spiegel konstatierte zur Jahrtausendwende: »Die gegenwärtig 15- bis 25-Jährigen gehören zur ersten Generation in der Bundesrepublik, die ohne Revolte, ja ohne irgendeinen deutlich artikulierten Widerspruch gegen die Älteren, zumal die leiblichen Eltern, aufzuwachsen scheint.«
Wissenschaftler sind sich längst darüber einig, dass ein Aufbegehren der Jugend gegen die Elterngeneration vor allem von der Ausgangslage abhängt. Materiell ist die Mehrheit der ab den 1970er Jahren Geborenen so saturiert, dass sie kaum Spannungen zu ihren Eltern provoziert. Politisch steht die Suche nach neuen Wegen in die Zukunft jenseits der Ende des 20. Jahrhunderts weggebrochenen linken Utopien gerade erst am Anfang. Was bleibt, charakterisiert Jugendforscher Klaus Hurrelmann von der Hertie School of Governance in Berlin so: »Der jungen Generation werden immer negative Attribute umgehängt in der breiten öffentlichen Diskussion, und das spiegelt auch die Einschätzung der älteren Generation wider, die junge Generation kann es den Älteren historisch gesehen, wenn man solche Einschätzungen mal verfolgt, nie recht machen.« Historiker Bodo Mrozek von der Humboldt-Universität zu Berlin macht das Problem als Überspitzung deutlich: »Es gibt geradezu … die Erwartung der Alten an die Jugend, dass sie sich ihnen gegenüber unhöflich verhält, weil sonst irgendwas im Aufwachsen und in der generationalen Selbstverständigung nicht richtig läuft. (…) Dass die Jugendlichen selbst eigentlich nur noch dagegen rebellieren, indem sie genau das nicht tun – also genau das ist dann ein konfliktuöses Verhalten, wenn der Konflikt als Normalfall erwartet wird, dann wird’s zum Konflikt, wenn der ausbleibt.«
Die politischen Akteure pflegen angesichts der positiv erscheinenden Beziehungen zwischen den Generationen noch die Illusion, dass sich dieses konfliktarme Verhältnis zwischen Alt und Jung auf ihr Handeln übertragen ließe. Das zeigen die Extremen ebenso wie die Traditionalisten. Am Alter orientierte Parteien, wie einstmals die Rentnerpartei »Graue Panther« oder die sich als Interessenvertreter der Jugend verstehenden »Piraten«, sind gescheitert. Mit jugendlichem Image gestartete, neue Parteien, bei denen die »Grünen« beispielhaft waren, sehen offenbar in einer möglichst schnellen Angleichung an die konservativen Strukturen der SPD, CDU, CSU und FDP ihre Überlebensmöglichkeit. DIE LINKE hat dem keine überzeugenden Alternativen entgegenzusetzen und konkurriert derweil mit Rechtspopulisten, die in der »Alternative für Deutschland« (AfD) am Beginn ihrer parteipolitischen Organisation stehen. Letztere setzen dabei gleich auf den Konservatismus aus der Welt von gestern und versinken systematisch in national-völkischen Perspektiven. Ihre Anhänger sind nicht – wie gern vermutet – die ökonomisch »Abgehängten«, sondern eher die ängstlichen Pessimisten. Gegenstand ihrer Angst ist eine zunehmend gefühlte Undurchlässigkeit der Gesellschaft: Wer »unten« ist, bleibt auch dort, Chancen sind ungleich verteilt. Damit bedient die AfD ein Problemfeld, das sich auch für alle anderen Parteien stellt.
Dieses in praktische Politik umzusetzen, ist für alle Parteien schwierig, denn das liefe auf eine Beschneidung der Privilegien der »Alten« hinaus. Die Parteien wissen aber sehr genau, dass bei mehr als 20 Millionen Wahlberechtigten im Ruhestand keiner regieren kann, der nicht mindestens die Hälfte dieser Gruppe auf seine Seite zieht. All das funktioniert noch, weil die großen Parteien CDU und SPD – bei massivem Sinken ihrer Mitgliederzahlen insgesamt – derweil von Mehrheiten, die über 60 Jahre alt sind, dominiert werden. Ihnen stehen nur um die 8 Prozent von unter 30-Jährigen gegenüber. Die Macht der Alten in den Parteien bleibt öffentlich weitgehend unbemerkt, denn sie agieren kaum noch auf den politischen Bühnen und sind in den führenden Gremien unterrepräsentiert. Ausgeübt wird sie aber über die innerparteilichen Strukturen. Kein Mandats- oder Amtsträger gelangt auf einen der gutdotierten politischen Posten, wenn er nicht die Unterstützung der Alten an der Parteibasis hat. Und die erlangt er, indem er deren Wünschen entgegenkommt.
Die Forschungen zu sozialpolitischen Verteilungsfragen mit Blick auf die alternde Gesellschaft stehen am Anfang. Sie deuten an, dass sich die Interessen in den nächsten Jahren verschieben werden und die Abgrenzung gegeneinander schärfer werden wird.
Gestritten wird darum, was genau das Wahlverhalten der Älteren bestimmt. Die einen betrachten dabei das Individuum und sehen einen direkten Zusammenhang zwischen der jeweiligen Lebenssituation und dem politischen Verhalten. Dabei rücken konservative Werte im Laufe des Lebens in den Fokus und begründen Differenzen zur jüngeren Generation. Die andere Betrachtung sieht Gruppenerfahrungen von im Alter, durch die Sozialisation und im sozialen Status, gleichgestellten Personen als bestimmendes Element. Daraus folgt die Vermutung, dass alternde Gesellschaften nicht zwangsläufig fortschrittsskeptischer und veränderungsunwillig werden müssen.
Beide Thesen artikulieren die Macht des materiellen Wohlstands nicht als zentralen Grund für die noch bestehende Balance in der Gesellschaft. Dennoch scheint gerade er es zu sein, der das weitere Hinauszögern dringend anstehender Veränderungen ermöglicht. Sie liegen vordergründig im Bereich der sozialen Sicherungssysteme. Da diese jedoch im Wesentlichen auf der angestellten Arbeit beruhen, ist dort auch die Wurzel notwendiger Reformen zu suchen. Dabei zeigten die im Herbst 2017 stattgefundenen Bundestagswahlen erneut das Bestreben, genauso weiterzumachen, wie es bisher ging. Die Parteien verhielten sich so, wie es die Politikwissenschaftlerin Bettina Munimus von der Universität Kassel bereits 2012 konstatierte: »Insbesondere die Volksparteien neigen zu einer seniorenfreundlichen Politik, welche die Gruppe der Älteren hinsichtlich finanzieller Sanierungsmaßnahmen verschont, um die wahlpolitische Macht einer numerisch wachsenden Wählerschicht nicht gegen sich aufzubringen.«
Eine Veränderung wird es dann geben, wenn sie sich einfach nicht mehr umgehen lässt. Die Uhr dazu tickt bereits.
Stirbt Deutschland aus?
Im Jahr 3705 wird Deutschland ausgestorben sein. Da wäre das Saarland schon einige Jahrhunderte lang verschwunden, und nur Sachsen würde noch bis ins Jahr 4044 überleben. Mit 1,57 Kindern pro Frau liegt dort die Geburtenrate am höchsten.
Das ist eine spekulative Berechnung. Sie beruht auf den Zahlen des Jahres 2014 und unterstellt, dass es keinerlei Zu- oder Abwanderung geben würde. Und natürlich wird es nicht so kommen, aber die statistische Größe der »zusammengefassten Geburtenziffer« zeigt, dass der deutsche Nachwuchs seit Jahren spärlich ist. Sie gibt an, wie viele Kinder eine Frau im Laufe ihres Lebens bekommen würde, verhielte sie sich genauso wie alle Frauen zwischen 15 und 49 Jahren eines bestimmten Jahrgangs.
Um die vorhandene Bevölkerungszahl zu halten, wären mindestens 2,1 Kinder pro Frau nötig. Dieser Wert wurde im Westen und im Osten in den 1960er Jahren und letztmalig Anfang der 1970er erreicht. In der früheren DDR sank er kontinuierlich seit 1964 und lag 1975 bei nur noch 1,54. Dann führte die gezielte Unterstützung von Familien zu einem Ansteigen bis 1990 auf 1,94. Nach der Einheit brach die Geburtenziffer Ost bis auf den historischen Tiefststand von 0,77 ein. In der alten Bundesrepublik begann der Weg nach unten 1967. Die Zahl der Geburten nahm stetig ab, 1975 lag sie dann im statistischen Durchschnitt bei 1,45 Kindern pro Frau. Der niedrigste Wert wurde mit 1,28 im Jahr 1985 verzeichnet.
Seit Mitte der 1990er Jahre nähern sich die Werte in Ost und West einander an, stagnierten aber bis weit nach der Jahrtausendwende auf einem niedrigen Niveau. Im Jahr 2009 lagen sie in Deutschland bei 1,36 Kindern pro Frau. Seither steigt die Geburtenziffer an. Die Anpassung zwischen beiden Teilen Deutschlands betraf vor allem das Alter der Mütter beim ersten Kind. Im Westen stieg es seit den 1970er Jahren und lag 2010 im Schnitt mit 29,2 Jahren um fünf Jahre höher als vierzig Jahre zuvor. Die frühere DDR holte diese Entwicklung innerhalb von zwanzig Jahren nach. Schwankte das Alter Erstgebärender bis zum Ende der 1980er Jahre noch zwischen 22 und 23 Jahren, betrug es 2010 bereits 27,4 Jahre. Als wesentliche Gründe dafür sieht das Statistische Bundesamt »die unsichere Arbeitsmarktsituation, den Wegfall von Familienförderungsprogrammen, die Notwendigkeit der Neuorientierung in der Gesellschaft sowie zum Teil längere Ausbildungszeiten und ausgedehnte Phasen der beruflichen Etablierung bei der jüngeren Frauengeneration«.
Diese Gründe stehen auch hinter dem Sinken der Kinderzahl insgesamt. Die Zwei-Kind-Norm – am besten Junge und Mädchen – gilt in Deutschland als ideal und wird als kulturell bedingt angesehen. Dass dadurch die Bevölkerungszahl tendenziell schrumpft, ist seit Jahrzehnten bekannt. Dafür verantwortlich ist seither jedoch nicht nur die geringer werdende Kinderzahl pro Frau, sondern auch die Zunahme der Zahl kinderloser Frauen.
In der alten Bundesrepublik betrug sie bei den zwischen 1944 und 1948 geborenen Frauen noch 13,3 Prozent, in der früheren DDR nur 7,2 Prozent. Während sie sich im Westen bei den Jahrgängen der 1959 bis 1963 geborenen Frauen auf 19 Prozent stark erhöhte, blieb sie im Osten zunächst mit 7,3 Prozent relativ konstant und stieg erst in den Jahrgängen 1964 bis 1968, also bei jenen Frauen, die zum Zeitpunkt der Einheit zwischen 22 und 26 Jahre alt waren, auf 10,7 Prozent. Bei den damals jungen Frauen im Alter zwischen 17 und 21 Jahren wuchs die Kinderlosigkeit bis 2008 auf 15,9 Prozent. Im Westen lag zu jener Zeit der Anteil kinderloser Frauen dieser Altersgruppen bereits bei 27,5 Prozent. Durch die derweil erfolgte Angleichung im Verhalten zum Nachwuchs ergibt sich die Schlussfolgerung, dass ihr Anteil in den alten Bundesländern in den kommenden Jahren höher als in den neuen Bundesländern bleiben wird. Das belegen auch die Zahlen der Frauen der Jahrgänge 1978 bis 1982. Hier liegt der Anteil der kinderlosen Frauen in Westdeutschland mit 43,8 Prozent deutlich höher, als es die 32,9 Prozent ostdeutscher Frauen betrifft.
Aktuell hat sich in Deutschland die Geburtenziffer in den letzten Jahren zwar erhöht, blieb aber mit 1,5 Kindern auch 2015 noch immer unter dem EU-Durchschnitt von 1,58. Die Reproduktion der Bevölkerung ist nirgendwo in Europa gewährleistet. Spitzenreiter beim Nachwuchs ist Frankreich mit durchschnittlich 1,96 Kindern, Schlusslicht bildet Portugal mit nur 1,31 Kindern pro Frau.
Als wichtigsten Grund für mehr oder weniger Kinder sehen die Bevölkerungsforscher derweil die Vereinbarkeit von Familie und Beruf an. Damit stellt sich die Familienpolitik als zentrales Problem der künftigen Bevölkerungsentwicklung dar. Sie dürfte in der Zukunft von den »neuen Alten« entscheidend beeinflusst werden.
Altersbilder zwischen Harley und Rollator
Wenn Frau F. vom Einkaufen kommt, schimpft sie: über die Rentner, die in den engen Gängen des Supermarkts herumstehen und sich krampfhaft am Einkaufswagen festhalten, über die älteren Damen, die lauthals ihre Ehemänner schikanieren, und auch über manche Waren. Das Brot ist nicht knusprig genug oder zu zäh … – irgendetwas gibt es immer zu bemängeln. Herrn G. regen dagegen ganz andere Dinge auf: Da zuckeln mit starrem Blick hinters Lenkrad geklemmte Fahrer in riesigen Geländewagen mit 78 Stundenkilometern auf der vierspurigen Straße, auf der doch 80 Kilometer pro Stunde erlaubt sind; andere wackeln auf ihren Fahrrädern hin und her wie ein Lämmerschwanz.
Frau F. ist 74, Herr G. 76 Jahre alt.
Das Bild vom eigenen Alter ist offenbar immer ein anderes als jenes, das Fremde auf die Betroffenen haben.
»Als damals die Lebensversicherung fällig wurde, war ich fest entschlossen, mir noch mal eine Harley zu kaufen, ich wollte unbedingt den ›Fat Boy‹ haben«, erzählt Herr G.: »Ich war schon immer dynamisch, unkonventionell und freiheitsliebend, auch wenn inzwischen die Bandscheiben nicht mehr so richtig mitmachen. Jetzt feixt mein Sohn, weil er das ja angeblich schon damals wusste!«
Frau F.s Wünsche waren nicht so groß. Sie hatte fest vor, sich ein modernes, elektrisches Fahrrad zu kaufen. »Nach meinem Sturz ist das nichts mehr für mich. Viel zu schnell. Inzwischen bin ich froh, wenn ich mit meinem Rollator wieder gut nach Hause komme.«
Der geplatzte Traum des früheren Finanzbeamten und der einstigen Bankkauffrau illustriert den Widerspruch zwischen dem eigenen Bild vom Alter und dem, das sich andere Menschen von dem Betroffenen machen. Wenn sich der Ruhestand nähert, gehen viele stillschweigend davon aus, dass sich das eigene Alter deutlich von den Problemen anderer unterscheiden wird. Redewendungen wie »Man ist so alt, wie man sich fühlt« zeigen, dass das subjektive Altersempfinden nicht an das kalendarische Alter gebunden ist. Altern ist ein individuell ablaufender und erlebter Prozess.
Ganz anders sieht die Sicht von Fremden darauf aus. Sie erleben »die Alten« als soziale Gruppe, der bestimmte Eigenschaften zugeschrieben werden. »Älterwerden geht in der Regel mit einem Abbau körperlicher Leistungsfähigkeit einher«, ist solch eine stereotype Einschätzung, an die sich emotionale Elemente knüpfen. Es werden positive oder negative Gefühle jeglicher »Alten« angenommen und daraus bestimmte Handlungsmuster abgeleitet. Andere möchten gern bestimmen, was einem bestimmten Alter »angemessen« ist und was nicht.
Unstrittig dürfte sein, dass sich das eigene Bild vom Altern und das Fremdbild gegenseitig beeinflussen. Hinzu kommt das gesamtgesellschaftliche Altersbild, das bis heute weithin noch defizitär ist und Grenzen betont. Es vernachlässigt Stärken und Potentiale des Alterns. Das kann sich eine Gesellschaft des langen Lebens, wie sie bereits existiert und zu der sie sich zunehmend entwickeln wird, auf Dauer nicht leisten.
Wie genau die unterschiedlichen Altersbilder aufeinander und miteinander wirken, hat die Wissenschaft bislang noch nicht eindeutig geklärt. Umfangreiche empirische Langzeitbeobachtungen lassen aber schon jetzt keinen Zweifel daran, dass alle Altenbilder einen großen Einfluss auf die persönliche Entwicklung haben. Der »Sechste Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland« hielt bereits Ende 2010 fest: »Wer dem Alter neugierig und optimistisch gegenübersteht, altert anders als Personen, die das Alter fürchten und den Prozess des Älterwerdens vor allem mit den Verlusten verbinden, die mit dem Alter einhergehen.«
Allerdings scheinen sich die Chancen auf ein positives Altersbild bei jenen, die heute noch im Erwerbsleben stehen, einzutrüben. Dabei konstatierte der »Sechste Altenbericht« einen Unterschied zwischen Ost und West: »Zudem ist festzustellen, dass im Jahr 2008 weniger Menschen in den neuen Bundesländern das Älterwerden als Chance zur Weiterentwicklung erachteten als noch 2002; diese rückläufige Entwicklung war nicht für die alten Bundesländer festzustellen. Hier spielt möglicherweise die Zunahme von unsicheren, prekären Beschäftigungsverhältnissen (befristete Arbeitsverträge, Leih- und Zeitarbeit, ›neue Selbstständigkeit‹) und Arbeitsplatzunsicherheit eine Rolle … Auch das steigende Rentenzugangsalter und Fragen bezüglich der Sicherheit der eigenen Rente tragen vielleicht dazu bei, dass die Altersbilder von Erwerbspersonen im Jahr 2008 etwas pessimistischer sind als noch im Jahr 2002.«
Recht ausgeglichen war hingegen die Einschätzung der eigenen Gesundheit. Nach den Erhebungen des Statistischen Bundesamts fühlen sich gut drei Viertel der über 65-Jährigen fit. Große Unterschiede zwischen Frauen und Männern ließen sich nicht feststellen: 2013 klagten 24 Prozent der weiblichen und 23 Prozent der männlichen Befragten über gesundheitliche Beeinträchtigungen, die zu Einschränkungen ihrer gewohnten Tätigkeiten führten.
Die positive Grundstimmung der Seniorinnen und Senioren führt zu intensiven Freizeitaktivitäten. Für sie werden mehr als 50 Stunden pro Woche aufgewandt, mit 28 Stunden steht dabei die Kultur im Mittelpunkt. Dazu zählt ein Fernsehkonsum von durchschnittlich 18,5 Stunden pro Woche – bei den 45- bis 64-Jährigen sind es nur 14,5 Stunden – und das Lesen von Büchern, für das die Statistik 6,75 Stunden ausweist. Viel Zeit wird auch dem Schlendern durch die Geschäfte und über Märkte und dem Einkaufen gewidmet.
»König Kunde« kommt in die Jahre
Dass Knoblauchpillen und Gummistrümpfe längst nicht mehr zu den bevorzugten Konsumgütern älterer Menschen gehören, wissen die Marketingexperten. Deshalb wird viel darüber nachgedacht, wie die Ruheständler als Konsumentengruppe am besten zu behandeln sind. Bis in die jüngste Vergangenheit erfreute sie sich weniger Aufmerksamkeit als jüngere Gruppen. Schon jetzt konzentriert sich jedoch die Kaufkraft zu 29 Prozent bei den über 60-Jährigen. Spätestens mit der Rente oder Pension wird das Einkaufen zu einem Kernbereich ihrer privaten Aktivitäten.
Dabei bleiben die Seniorinnen und Senioren eine sehr heterogene Gruppe. Ihr Konsumverhalten hängt nicht nur vom Einkommen oder dem Gesundheitszustand, sondern auch vom Wohnort und den familiären Verhältnissen ab. Überdurchschnittlicher Kaufkraft, der Neugier auf neue Produkte und der Bereitschaft vieler älterer Menschen, sie auch zu kaufen, stehen bei anderen materielle Sorgen und Einschränkungen gegenüber. Sie gehen inzwischen bis zur Angst, die Absicherung der täglichen Grundbedürfnisse vom Dach über dem Kopf bis zur angemessenen Ernährung nicht mehr garantiert zu haben.
Schon im Vorfeld des Ruhestands ändern sich die Wünsche und Bedürfnisse in Abständen von fünf bis höchstens zehn Jahren. Manches, was für viele Menschen ihr Leben lang wichtig war, wie zum Beispiel modische Kleidung, verliert an Bedeutung. Anderes beeinflussen oftmals nachlassende oder wechselnde Interessen. Auch sich verschlechternde Gesundheit und ein geschrumpftes Haushaltsbudget bedingen nachhaltige Wirkungen. So sinken im Alter zwischen über 50 und 75 Jahren die Ausgaben für Nahrungsmittel und Getränke um etwa 4 bis 5 Prozent, die für Kleidung und Schuhe sogar um 16 bis 19 Prozent. Demgegenüber verdoppeln sich fast die Kosten für die Gesundheit, die Ausgaben für Freizeit und Unterhaltung steigen, für Bildung vermindern sie sich auf ein Fünftel, und das Wohnen und die Instandhaltung der Wohnungen wird durch mehr notwendige Hilfe von außen um mehr als 20 Prozent teurer.