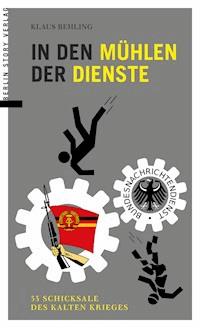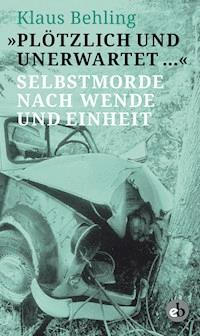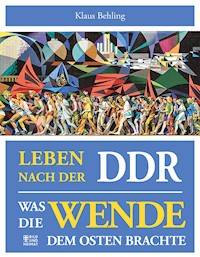Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition berolina
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Verschlussakte DDR
- Sprache: Deutsch
Das MfS setzte nicht nur Frauen auf Zielpersonen an, sondern manchmal wurden auch Frauen, die zu interessanten Personen Kontakt hatten abgeschöpft oder kooperierten mal mehr und mal weniger freiwillig mit dem DDR-Geheimdienst. Jan Eik und Klaus Behlung bringen in ihrem Buch Licht ins Dunkel der Stasivergangenheit, und decken durch das Auswerten alter DDR-Akten vielältige Verbrechen auf. Da wurden Terroristen versteckt oder Gelder in großem Stil unterschlagen. Nie drang davon etwas an die Öffentlichkeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Verschlußakte DDR
Fälle aus MfS, Polizei und NVA
Klaus Behling | Jan Eik
Mata Haris aus Ostberlin
Namen, die mit * versehen sind, sind den Autoren bekannt, wurden aber aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes geändert.
eISBN 978-3-86789-558-3
© 2013 BEBUG mbH, Berlin
© 2009 Militzke Verlag, Leipzig
Umschlaggestaltung: capa
Umschlagabbildung: Chris Keller / bobsairport
BEBUG mbH/Edition Berolina
Alexanderstraße 1, 10178 Berlin
Tel.: 0 18 05/30 99 99
Fax: 0 18 05/35 35 42
(0,14 €/Min., Mobil max. 0,42 €/Min.)
www.buchredaktion.de
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Stasi und Recht in der DDR
Menschenfallen
Zwischen allen Fronten
Der Fall Gladewitz
Lautloser Terror
Amis im Osten
Justitia wird vergewaltigt
Der fliegende Teppich
Familienbande – Familien-Bande?
Erfundene Verbrechen
Eine Tarnkappe für Susanne A.
Braune Schatten
Das Schicksal der Irene S.
Goebbels’ Tagebücher
Gestohlenes Leben
»Die Kommandeuse«
Frauengeschichten
Bär und Puma
Die geschenkte Braut
»Mädchen aus Ost-Berlin«
Erpresserbriefe aus Ost-Berlin
Jerry Cotton und die Stasi
Born in Bärenstein
»Fahren Sie mal rechts ran …«
Pressesprecher Neumann
Walt Disneys Zweitausgabe
Nachspiel
Untreue Genossen
Die Datsche am See
Schmierenkomödien
Millionen-Monopoly
Ganoven unter sich
Nasse Sachen
Spione im Rotlicht
Ein Mann fürs Grobe
Schwarzhändler
Falsche Freunde
Die Schlacht am Schkeuditzer Kreuz
Ein Stück Papier und 13 Kabeltrommeln
Tausend Mark Schweigegeld
Reichsbahnschreck Russen
Babyraub in Dresden
Schatzräuber und Kunstfälscher
Meißners Erbe
Die geheimnisvollen Stasi-Kisten
Hitler-Köpfe und Altaktien im Ausverkauf
Kehraus im Museum?
Fälscher im Stasi-Auftrag
Epilog
Geschlossene Akten
Prolog
Stasi und Recht in der DDR
Die Tat war eiskalt geplant.
Als drei MfS-Mitarbeiter am 2. September 1986 gegen 22.50 Uhr die Wohnungstür eines ihrer Genossen aufbrechen, finden sie zwei Leichen auf einer Doppelbettcouch. Die Köpfe sind mit jeweils einem Kissen bedeckt. Ein Bild des Grauens, glücklicherweise haben es die Kinder im Nachbarzimmer nicht gesehen. Die Große ist gerade einen Tag zuvor in die Schule gekommen.
Der Tote war Hauptmann bei einer Passkontrolleinheit.
Um 22.30 Uhr hatte er seinen Vorgesetzten in der Kontrollbaracke an der Grenze angerufen und dienstlich knapp gemeldet, er habe soeben seine Frau erschossen. Die Genossen möchten die Kinder aus der Wohnung holen. Dann sagt er noch leise »Macht’s gut«, und legt auf. Eigentlich ist der MfS-Hauptmann zu dieser Zeit in der Uniform der Grenztruppen der DDR im Dienst. Zehn Minuten vor Beginn seiner Nachtschicht um 22 Uhr war er auch erschienen und ließ sich seine »Makarow« und die Munition aushändigen. Dann erklärte er, er müsse noch einmal schnell nach Hause, weil er seinen Dienstausweis vergessen habe. Das gilt bei der Stasi normalerweise als schlimmes Versäumnis, aber der Chef drückt ein Auge zu. Zu Hause ist alles vorbereitet. Vier Abschiedsbriefe liegen bereit, an die Eltern, an die Verwandten und an die Genossen im MfS. Er würde weder seine Frau noch das Auto und die mühsam ersparte Wohnungseinrichtung einem anderen Mann überlassen, steht darin. Noch während die Stasi-Kollegen zur Wohnung des Hauptmanns rasen, legt der sich neben die von ihm gerade ermordete Frau auf die Couch und schießt sich in den Kopf.
Das Motiv für Mord und Selbstmord, Experten nennen solch einen Fall »erweiterten Suizid«, wird schnell klar: Die Frau hat seit mehr als einem Jahr einen Geliebten. Wie so oft, wissen alle im ausschließlich von Stasi-Mitarbeitern bewohnten Block bereits davon, nur der gehörnte Ehemann erfährt es erst, als er im August einmal vorzeitig von der Schicht kommt und die beiden in flagranti ertappt. Die Frau will nun die seit Monaten heimlich geplante Scheidung anschieben und vereinbart dafür einen Termin am 9. September. Für den Hauptmann bricht seine bis dahin heile Welt zusammen. An dem Fall wäre nichts Besonderes, spielte er sich nicht im geschlossenen sozialen Milieu der Stasi ab. Das macht nicht nur die Tat mit einer Schusswaffe möglich, im DDR-Mordgeschehen eine Ausnahme, sondern bestimmt auch den weiteren Umgang mit dem Fall. Er wird nach besten Kräften vertuscht. So, wie es oft geschieht, wenn Stasi-Mitarbeiter kriminell werden und so, wie es immer geschieht, wenn die Stasi mit kriminellen Methoden arbeitet. Der Grund dafür liegt im Innenleben des MfS.
Der kanadische Soziologe Erving Goffman (1922–1982) prägte Anfang der 50er Jahre für Gruppen mit ausgeprägten charakteristischen Gemeinsamkeiten den Begriff der »totalen Institution«. Mit ihrer Beschränkung der Freizügigkeit und der sozialen Kontakte in der ohnehin schon engen DDR und dem stets möglichen, umfassenden Zugriff auf die Mitarbeiter entspricht das Innere der Staatssicherheit durchaus einer solchen besonderen, homogenen Gruppe. Erving Goffman stellt fest: »Eine totale Institution lässt sich als Wohn- und Arbeitsstätte einer Vielzahl ähnlich gestellter Individuen definieren, die für längere Zeit von der übrigen Gesellschaft abgeschlossen sind und miteinander ein abgeschlossenes formal reglementiertes Leben führen. […] Sie sind Treibhäuser, in denen (die) Gesellschaft versucht, den Charakter eines Menschen zu verändern.« Diese Charakteristik der »sozialen Institution« trifft auch auf andere abgeschlossenen Gruppen der DDR-Gesellschaft zu, wie zum Beispiel die Führungsspitze. Kommt es hier zu strafrechtlich relevanten Verhaltensweisen, ist der Umgang damit genauso geheim und abgeschottet, wie innerhalb des MfS.
Ein Beispiel: Am 4. Mai 1980 schießt die Frau des damaligen DDR-Finanzministers Siegfried Böhm auf ihren Mann, damals 52, mit dessen Dienstpistole. Es ist der Höhepunkt eines Eifersuchtsdramas, das seit Monaten schwelt. Einen Tag zuvor hatte er seiner Frau eröffnet, dass er sich scheiden lassen möchte und auch nach einer längeren Auseinandersetzung – so die Stasi-Akten – darauf beharrt. Unmittelbar nach der Tat tötete die Frau sich selbst. Das Opfer überlebt zunächst schwer verletzt, stirbt dann aber nach einer Notoperation im Regierungskrankenhaus Berlin-Buch. Die DDR-Bevölkerung wird via Neues Deutschland über einen »tragischen Unglücksfall« (des)informiert. Der Tod der Frau des Ministers findet keine Erwähnung, die Beisetzungen erfolgen zu unterschiedlichen Terminen. Der MfS-Bericht über den Tod Siegfried Böhms ist um genau einen Monat vordatiert. All dass sieht nach der gezielten Vertuschung eines Verbrechens aus. Das muss jedoch nicht zwangsläufig der Fall sein. Die Untersuchung solcher Vorfälle innerhalb der DDR-Führung durch das MfS entsprach den geltenden Vorschriften. Die dabei einzuhaltende »Konspiration« führte zum Ausschluss der ohnehin schon eingeschränkten Öffentlichkeit sowie von Polizei und Justiz. Die Fehldatierung kann demnach auf einem einfachen Irrtum beruhen.
Diese Zusammenhänge sind vor dem Hintergrund des inzwischen herrschenden, transparenten Rechtsstaates kaum nachvollziehbar. Deshalb werden bis heute immer wieder Erklärungsmuster für kriminelle Delikte innerhalb der geschlossenen sozialen Gruppen der DDR-Gesellschaft gesucht. Im Fall Siegfried Böhm vermutet die Frankfurter Rundschau am 14. Oktober 2003, er »habe sich geweigert, weiterhin für geschönte DDR-Finanzen den Kopf hinzuhalten« und die Welt am Sonntag spekuliert am 12. Oktober 2003: »Er habe gedroht, den DDR-Bankrott öffentlich zu machen. Vier Tage vor seinem Tod sei die Sache so eskaliert, dass Böhm sogar den Maifeiern ferngeblieben sei.« Obwohl ihn Wochenschaubilder am 1. Mai 1980 auf der Tribüne zeigen, halten es beide Zeitungen für möglich, ein damals gerade durch die Medien geisternder »mutmaßlicher DDR-Auftragskiller« (der bald darauf wieder in der Versenkung verschwand) habe ihn auf SED-Befehl »liquidiert«.
Solche Vermutungen spiegeln letztlich nur eine gewisse Hilflosigkeit beim Erkennen dessen wieder, was denn nun tatsächlich die DDR »im Innersten zusammenhielt«. Der Umgang mit der »sozialistischen Gesetzlichkeit« bei kriminellen Entgleisungen von Angehörigen geschlossener sozialer Gruppen in der DDR-Gesellschaft hat im Laufe der Jahre typische Verhaltensweisen hervorgebracht, für die sich im Innenleben des MfS die eklatantesten Beispiele finden lassen. Er unterscheidet sich grundsätzlich vom Verhältnis der übrigen Gesellschaft zu Staat und Recht und reflektiert in seinen Grundstrukturen eine feudale Machtausübung. Das ruft in der Praxis immer wieder gleiche Abläufe hervor.
Scheitern die zunächst meist zu beobachtenden Versuche, die Kriminalität zu ignorieren oder unter den Teppich zu kehren, folgt darauf oft erst einmal schieres Unverständnis, denn jegliches Nachdenken über die »besonderen Vorkommnisse« führt automatisch in die eigenen Reihen. Das trifft auch für Taten gegen die eigene Person zu. Als Mitte der 80er Jahre in der MfS-Bezirksverwaltung Leipzig die Zahl der Selbstmorde drastisch steigt, vier Offiziere bringen sich um, zwei weitere drohen einen Suizid an und ein Versuch scheitert, geht der Chef der Behörde in einer Rede auf diese Fälle ein: »Genossen, analysiert man all die uns Schaden zufügenden Vorkommnisse der Vergangenheit, drängt sich die Frage auf, was sind denn das für Genossen, was sind das für Tschekisten, wie haben wir denn mit ihnen mit welchen Ergebnissen erzieherisch gearbeitet? Aus welchen Motiven und Lebensauffassungen erklären sich solche gesellschaftlichen Fehlverhaltensweisen?« Die Untersuchung der konkreten Fälle brachte nämlich ans Licht, dass dabei durchaus auch »Unzufriedenheit in der Arbeit, verbunden mit dem Gefühl des Alleinseins, das zum Teil fehlende Verständnis, Ausbleiben von Hilfe und Unterstützung durch Dienstvorgesetzte, das Stellen hoher Forderungen ohne ausreichende politisch-ideologische Motivierung, fehlende Kollektivbeziehungen und mangelndes Vertrauen zu Dienstvorgesetzten« eine wesentliche Rolle spielten. Natürlich kennt der General den Alltagsjob seiner Leute und vergisst deshalb nicht, zu betonen, dass das alles selbstverständlich gar nichts mit »Schnüffelei, primitiver Neugierde oder Eindringen in die persönliche Intimsphäre der Mitarbeiter« zu tun habe.
Als totale Institution möchte das MfS eben auch auf die Seelen seiner Leute zugreifen. Der Grund dafür ist auf der bereits zitierten Leipziger Dienstversammlung zu hören: »Schwankende, labile und unzuverlässige Mitarbeiter stellen Unsicherheitsfaktoren dar und beeinflussen die Gesamtstabilität und Zuverlässigkeit des Kaderbestandes«. Es ist die Aufgabe der Leitung des MfS, zu verhindern, »dass durch solche labilen und anfälligen Mitarbeiter der Gegner bei uns eindringen kann.« Dieses Denken erklärt den massiven Druck auf alle MfS-Bediensteten, die Regeln des Hauses zu verinnerlichen, natürlich auch im privaten Bereich. Die Stasi als soziale Gruppe fühlt sich in allen Jahren der Existenz der DDR an der Front eines imaginären Krieges. Das schweißt sie zusammen. Soziologe Goffman nennt dieses Gruppenverhalten »primäre Anpassung«. Sie wird von einer »sekundären Anpassung« ergänzt, die zu einem intern gepflegten Elitebewusstsein führt, zu dem durchaus auch die Herausbildung einer Stasi-spezifischen Subkultur gehört. Zwischen diesen beiden Polen entstehen Widersprüche.
So dichtet zum Beispiel ein Genosse in einem Lied, in dem er die »stolzen Tschekisten« als »dem Bürger strenger Gebieter« charakterisiert, im Refrain:
Wir beugen vor, wir klären auf
Wir greifen zu, wir hauen drauf
Wir dringen ein, wir schleichen an
Wir kennen weder Strafgesetz noch Angst …
Dieses interne »Rechtsverständnis« moniert im Dezember 1988 sogar die »Zentrale Parteikontrollkommission«, das oberste Überwachungsorgan innerhalb der »Firma«. Gerade weil sich ihre Genossen, so wie hier leicht kitschig bedichtet, als Kämpfer ohne Rücksicht auf Gesetze und Regeln fühlen, hat sie immer wieder Vorfälle intern zu ahnden und anschließend gründlich zu verschleiern, die innerhalb der Stasi eigentlich gar nicht vorkommen dürften.
Dazu gehören zum Beispiel zehn rechtsextreme Delikte in den Jahren 1965 bis 1980 im stasieignen Wachregiment »Feliks Dzierzynski« in Berlin-Adlershof.
Am schwerwiegendsten war dort die Gründung eines »Hitler-Fanclubs« in der Pionierkompanie des Regimentes. Vier Stabsgefreite und ein Gefreiter verliehen sich gegenseitig SS-Dienstgrade und malten Hakenkreuze an die Wände. Alle bekamen Parteistrafen, wurden zu Soldaten degradiert und entlassen. Abstoßen, rauswerfen, ausschließen – das sind dann auch die Verhaltensmuster, die immer wieder auch bei nichtpolitisch motivierter Kriminalität innerhalb der Stasi zu beobachten sind. Aus dem Gewirr von primärer und sekundärer Anpassung heraus gehen sie mit einer hohen Bereitschaft »des Organs« einher, nach außen alles zu vertuschen. Gelingt das nicht, wird der Delinquent zuerst aus dem MfS entlassen und erst dann verurteilt.
Ein Beispiel dafür ist der Umgang mit dem bis 1980 außerordentlich erfolgreichen Führungsoffizier aus der Hauptverwaltung Aufklärung (HVA), Referat X/3, Peter E. Bei MfS-internen Kontrollen wird Ende Juni 1980 entdeckt, dass für verschiedene Operationen im Westen 40 060 DM und 4 798,55 DDR-Mark zwar bewilligt, aber nicht verbraucht worden waren. Peter E. hatte sie unberechtigt vereinnahmt und das durch die Manipulation von Quittungen verschleiert. Dafür fliegt er am 2. Juli 1980 aus dem MfS. Erst ein dreiviertel Jahr später, am 6. März 1981 und nun als »ganz normaler DDR-Bürger«, wird er dann zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten verurteilt.
Ebenso wie das Vertuschen von Straftaten, über das noch zu reden sein wird, ist auch diese Verfahrensweise typisch. Sie dient dazu, das »Ansehen« der Stasi und »der Partei« – und das ist in der DDR trotz Vorhandenseins anderer Parteien ausschließlich die SED – nicht zu beschädigen. Im Selbstverständnis der Stasi wird damit keineswegs Recht gebrochen. Laut Strafprozessordnung der DDR (StPO) ist das MfS als eigenständiges Untersuchungsorgan an Strafverfahren beteiligt. Zuständigkeitsbeschränkungen sieht das Gesetz nicht vor. So kann Stasi-Minister Erich Mielke dann auch keiner in die Parade fahren, als er auf der Zentralen Dienstkonferenz seines Hauses am 24. Mai 1979 knapp formuliert: »Feinde bearbeiten wir!«
In der Praxis umfasst das auch den Anspruch zu bestimmen, wer ein Feind ist und wer nicht. Dazu muss eine wesentliche Regelung der DDR-Gesetzlichkeit umgangen werden, denn in der StPO steht auch, dass nicht ermittelt werden darf, wenn sich der Anfangsverdacht nicht bestätigt. Diesen Spagat schafft die Stasi mit der »Parteilichkeit«. Sie gehört in der DDR-Ideologie ebenso zum »sozialistischen Recht« wie die Gesetze. Die SED verlangt von ihrer Justiz jene so anzuwenden, dass ein größtmöglicher Beitrag zur Durchsetzung ihrer Politik geleistet wird. Dieses Anliegen verbirgt sich hinter dem Schlagwort von der »differenzierten Anwendung der sozialistischen Rechtsnormen«. Und »differenziert« schließt wiederum die Möglichkeit ein, die Anwendung der vorhandenen Gesetze auch ganz zu unterlassen – wenn es denn »der Partei« dient. Einen Widerspruch zur »sozialistischen Gesetzlichkeit« sehen die DDR-Rechtsgelehrten darin nicht, denn auch alle Gesetze haben ja die Parteipolitik zu unterstützen. Der Berliner Strafrechtsprofessor Klaus Marxen zieht daraus folgende Schlussfolgerung: »Gesetze (in der DDR) stehen unter dem Vorbehalt der politischen Nützlichkeit ihrer Anwendung.« Damit kann jedes Gesetz, je nach Bedarf, erlassen oder abgeschafft, geändert, angewandt oder auch ignoriert werden. Das schafft oftmals eine abstruse, für die Bürger meist völlig unverständliche Rechtspraxis. Auch hierzu ein Beispiel: Ende der siebziger Jahre schreibt Stefan Heym (1913–2001) seinen Roman »Collin«. Darin rechnet er kritisch mit dem Stalinismus ab. Deshalb darf das Buch in der DDR nicht erscheinen. Mit Hilfe seiner Schweizer Literaturagentur publiziert er es im Westen, bei Bertelsmann. Dafür gibt es natürlich das übliche Honorar in DM. Stefan Heym macht das angeblich zum Straftäter. Nach einem extra seinetwegen ins Strafgesetzbuch zusätzlich eingefügten Paragraphen über »Devisenvergehen« wird er 1979 zu 9 000 Mark Geldstrafe verurteilt.
Derartigen Unbill braucht eine Ost-Berliner Rechtsanwältin, die seit 1977 der Stasi unter dem Decknamen »Dolli« als »inoffizielle Mitarbeiterin« (IM) dient, nicht zu fürchten. Sie lässt 12 000 DM in den Osten schmuggeln, die auf dem Schwarzmarkt in 36 000 Ost-Mark umgetauscht werden. Mit dem Geld bezahlt ihr Mandant seine Schulden. Das bekommt dessen Freundin mit, die sich von ihm betrogen fühlt. Sie meldet das »Devisenvergehen« der Rechtsanwaltskammer. Wenn diese das Vergehen beweisen kann, wäre die Anwältin zumindest ihre Zulassung los. Das will die Stasi mit allen Mitteln verhindern. So wird in einem Geheimgespräch mit dem Stellvertreter des Generalstaatsanwaltes der DDR, Vertretern der Zollverwaltung und der SED-Bezirksleitung Berlin festgelegt, wie die Beweisführung zu verhindern ist. Am Ende steht dann nur noch Aussage gegen Aussage und »Dolli« ist als Rechtsanwältin und inoffizielle Mitarbeiterin der Stasi gerettet. Ihren letzen IM-Bericht an die Stasi liefert sie am 6. Oktober 1989 ab.
Dieses Verdrehen des Rechts nach den Bedürfnissen »der Partei« wird innerhalb der Stasi selbst als ganz normale Anwendung »sozialistischer Gesetzlichkeit« empfunden. Für den Rest der Welt ist es der Hauptgrund für die Vermutung, bei der Stasi sei schlichtweg alles möglich gewesen.
Die wahre Brisanz des permanenten Rechtsbruchs durch das MfS wird dadurch verschleiert. Was den DDR-Bürgern das Alltagsleben so schwer machte, war die Rechtsunsicherheit. Niemand konnte wissen, ob er nicht eines Tages für irgendeine Kleinigkeit kriminalisiert werden würde, die eigentlich ganz alltäglich war. Viele Menschen lebten mit dem Gefühl: »Wenn die da oben wollen, werden sie schon etwas finden!« Das hat viele Jahre zum Leben in gebückter Haltung beigetragen. Letztendlich hat aber gerade die Stasi mit ihrem Vertuschen von Unrecht im privaten Bereich ihrer Mitarbeiter und in ihrem dienstlichen Gefüge eine Menge Sargnägel für die DDR geschmiedet.
Quellen:
· Gespräche mit Zeitzeugen
· Baum, Karl-Heinz: Neue Anschuldigungen gegen Jürgen G. In: Frankfurter Rundschau, Frankfurt/Main 14.10.2003.
· BStU, MfS BV Leipzig, Leitung Nr. 01329, Blätter 18, 8, 3, 1 und 19. (Rechtschreibung wurde korrigiert)
· BStU, MfS HA IX, Nr. 12945, Blatt 18.
· BStU, MfS, ZA, ZAIG 47/83, Blatt 22f.
· Engelmann, Roger und Clemens Vollnhals (Hg.): Justiz im Dienste der Parteiherrschaft – Rechtspraxis und Staatssicherheit in der DDR. Berlin 2000.
· Goffman, Erving: Asyle. Über die soziale Situation psychiatrischer Patienten und anderer Insassen. Frankfurt a. M. 1973. (G. hat seine Theorie mit Bezug auf psychiatrische Anstalten entwickelt, hielt es aber ausdrücklich auch für legitim, sie auf andere geschlossene soziale Gruppen wie bspw. Kasernen und Arbeitslager zu übertragen.)
· Grashoff, Udo: Selbsttötungen in der DDR und das Wirken des Ministeriums für Staatssicherheit. Magdeburg 2004.
· Grashoff, Udo: Selbsttötung oder durch die Staatssicherheit verschleierter Mord. In: Susanne Muhle u. a.: Die DDR im Blick. Berlin 2008.
· Hecht, Jochen: Die Poesie als Magd des Staatssicherheitsdienstes. Vortrag, Weimar 2005. (www.BStU.de)
· Marxen, Klaus und Gerhard Werle (Hg.): Strafjustiz und DDR-Unrecht – Dokumentation. Band 4/1, Berlin 2004.
· Neubert, Erhart und Bernd Eisenfeld (Hg.): Macht, Ohnmacht, Gegenmacht – Grundfragen zur politischen Gegnerschaft in der DDR. Bremen 2001.
· Reuth, Ralf-Georg: Verdacht gegen DDR-Killer erhärtet. In: Welt am Sonntag, Hamburg 12.10.2003.
· Strafprozessordnung der DDR vom 12.1.1968, GBI I/68, Seite 49.
· o.V.: Lex Heym. In: Berliner Zeitung, Berlin 7.9.2005.
Menschenfallen
28 Jahre Mauer haben es vermocht, die Berliner Geschichte zwischen 1945 und 1961 weitgehend aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit zu verdrängen. Es war eine turbulente Zeit, in der es anfangs noch einen gemeinsamen, SPD-geführten Magistrat, eine Gesamtberliner Polizei unter dem von den Sowjets eingesetzten Ex-Hauptmann Paul Markgraf (SED) und eine einheitliche Währung gab, ein immerhin noch gemeinsames Verkehrssystem und kaum ernst zu nehmende Grenzkontrollen. Die Spaltung vertiefte sich nur schrittweise. Es ist heute schwer vorstellbar, eine Millionenstadt durch eine Grenzmauer in zwei höchst ungleiche Teile zu trennen. Doch das Beispiel Jerusalem beweist: Es geht immer wieder.
Nicht zu Unrecht galt die in mancherlei Hinsicht unübersichtliche Viersektorenstadt Berlin nach 1945 als eine Stadt der Spionage und des Menschenraubs. Die Angaben darüber, wie viele Menschen unfreiwillig und mehr oder weniger gewaltsam vom westlichen Teil der Stadt in den anderen verbracht wurden, differieren. Die meisten Quellen gehen von über 600 Menschen aus, die bis 1961 vom Westteil Berlins in den Ostteil verschleppt wurden. Die prominentesten Verschleppungs-Fälle sind die des Dr. Walter Linse, der im Juli 1952 am helllichten Morgen und mit Waffengewalt gekidnappt und anderthalb Jahre später in Moskau erschossen wurde, die des Ex-FDJ-Funktionärs und Generalinspekteurs der Volkspolizei Robert Bialek, der wahrscheinlich am Abend seiner Verschleppung in Hohenschönhausen starb, und des Journalisten Karl Wilhelm Fricke, der 1949 in den Westen geflohen war und im April 1955 gewaltsam aus West-Berlin entführt wurde. Das OG der DDR verurteilte ihn zu vier Jahren Zuchthaus. Dass sich die Stasi damit selber einen Bärendienst erwiesen hatte, wird ihr zu spät bewusst geworden sein: Fricke entwickelte sich zu einem der schärfsten und gründlichsten Kenner und Analytiker des DDR-Regimes und der Staatssicherheit. Ein Blick in die Literatur (z. B. Jan Valtin: »Tagebuch der Hölle«) lehrt, dass die Praxis des Menschenraubs schon in den 20er und 30er Jahren eine der üblichen Methoden der sowjetischen Geheimdienste und der ihnen hörigen internationalen kommunistischen Bewegung war, um »Verräter« zu bestrafen, sprich: zu töten. Selbst jene, die das stalinistische System durchschaut hatten, konnten sich kaum vorstellen, wie planmäßig und mit welchem Aufwand dieses Vorgehen in den Nachkriegsjahren vervollkommnet und angewendet wurde. Dabei bot sich Berlin ganz von selbst als Ausgangsbasis für derartige Aktionen an.
Zwischen allen Fronten
Als sich das Leben in der zerstörten deutschen Hauptstadt 1945 allmählich zu normalisieren begann, wirkten die Unterschiede in den äußeren Bedingungen zwischen Ost- und Westbezirken anfangs nur minimal. Zwar war die Großindustrie im Russischen Sektor, wie er anfangs wahrheitsgemäß hieß, demontiert worden oder in die Hände der Besatzungsmacht (oder des noch gar nicht wieder vorhandenen Staates) übergegangen, doch bildete der private Bereich der Wirtschaft neben dem Schwarzmarkt vorerst das Rückgrat der bescheidenen Entwicklung. Überall herrschten Hunger, Kälte und Mangel an nahezu allem, was die Menschen brauchten, doch es herrschte keineswegs das zu vermutende Chaos. Ämter und Behörden funktionierten mit der gewohnten Bürokratie, Polizei und Gerichte nahmen ihre Aufgaben so ernst wie zu jeder Zeit in Deutschland. Und über allem thronten drohend die Besatzungsmächte. Noch waren auch im Osten fast alle Strukturen der überkommenen bürgerlichen Gesellschaft vorhanden. Kaum jemand wunderte sich, als wenige Monate nach Kriegsende der Rechtsanwalt und Notar Dr. Hans Kemritz sein Büro in der Schadowstraße 1b wieder eröffnete, das er dort seit 1934 betrieb. Dass Kemritz dazu die Gunst der Besatzungsmacht brauchte, war seinen Klienten wahrscheinlich nur recht: Ohne die Russen ließ sich Grundsätzliches ohnehin nicht bewegen. Wusste tatsächlich niemand, dass Kemritz ein prominentes Mitglied der NSDAP und während des Krieges Major in der Spionageabwehr beim Generalkommando in Berlin bzw. beim Wehrbezirkskommando III in Berlin-Wilmersdorf gewesen war? Immerhin hatte sich seine Anwaltspraxis während der Nazi-Jahre so erfolgreich entwickelt, dass der Herr Doktor jur. – er hatte 1910 über »Ansprüche des elterlichen Gewalthabers bei Entführung oder Verletzung eines minderjährigen Kindes« promoviert und war später am Landgericht III tätig – sich das Büro in bester Zentrumslage leisten und aus seiner Mietwohnung in Charlottenburg in eine Villa nach Dahlem ziehen konnte. Auch dieses Haus hatte ihm nach dem Krieg niemand streitig gemacht. Angeblich traute Kemritz sich nur nachts dorthin, »denn die Amerikaner suchen mich«, wie er im Osten gerne behauptete. In diesen ersten Nachkriegsjahren war es keineswegs ungewöhnlich, dass jemand im Amerikanischen Sektor wohnte und seine Geschäfte im Russischen betrieb oder umgekehrt. Noch waren die Sektorengrenzen nur mit mehrsprachigen Schildern markierte symbolische Trennlinien zwischen den Trümmern.
Das änderte sich jedoch spätestens 1948. Da hatte Dr. Hans Kemritz längst über Nacht seine Ost-Berliner Praxis an der einstigen Prachtstraße Unter den Linden im Stich gelassen und sich gen Westen abgesetzt. Vor den Amerikanern brauchte er sich nämlich nicht zu fürchten – die hatten ihm zur Flucht geraten, wie sich Jahrzehnte später herausstellen sollte. Sie wussten, dass Berlin auf die Dauer ein zu heißes Pflaster für einen Mann wie Kemritz darstellte. Allzu leicht konnte man dort unfreiwillig in das falsche Besatzungsgebiet geraten.
In der Dahlemer Villa wohnte nun Kemritz’ ehemalige Sekretärin, er und seine Frau fanden in Bad Homburg ein Unterkommen, wo Kemritz bald wieder als Rechtsanwalt und Notar praktizierte. Und es reichte sogar für den Neubau einer schmucken Villa. Dann schließlich holte die Vergangenheit den umtriebigen Juristen ein. Es mehrten sich die Vorwürfe, er habe 1945/46 in Berlin in zahlreichen Fällen Beihilfe zum Menschenraub geleistet. Im November 1950 verhafteten ihn die hessischen Behörden und beschuldigten ihn, mehrfach Deutsche in sein Ost-Berliner Anwaltsbüro gelockt zu haben, um sie dem sowjetischen Geheimdienst NKWD auszuliefern. Wie sich herausstellte, war Kemritz bei den Kämpfen um Berlin in sowjetische Kriegsgefangenschaft geraten, als einziger Abwehroffizier jedoch überraschend schnell wieder aus dem Gefangenenlager Landsberg an der Warthe entlassen worden. Die Sowjets wussten genau, wem sie da im Oktober 1945 den »Neuanfang« ermöglichten. Sie hofften, durch ihn an ehemalige Abwehrspezialisten der Wehrmacht heranzukommen, deren Namen auf alliierten Verhaftungslisten für einen so genannten »automatischen Arrest« standen. Die westlichen Alliierten scheinen diesbezüglich in ihren Berliner Sektoren keine besonderen Aktivitäten an den Tag gelegt zu haben, unternahmen anfangs aber auch nichts dagegen, wenn sowjetische Dienststellen in diesen Sektoren Verhaftungen vornahmen. In direktem sowjetischem Auftrag begann Kemritz, der aus den Kriegsjahren über einen großen Bekanntenkreis unter den Abwehrleuten verfügte, Einladungen an die alten Kameraden zu verschicken. Darin bat er, sie mögen ihn gelegentlich zu geschäftlichen Besprechungen in seiner Praxis aufsuchen. Und sie kamen tatsächlich. Auf diese Weise lockte er u. a. einen alten Freund, den Ex-Bürgermeister und Gerichtsoffizier Dr. Reichenberg in den Osten. Der wurde verhaftet und starb 1947 im KZ Sachsenhausen. Dort landeten auch Elisabeth F. und Ilse G., die beide erst fünf Jahre später wieder frei kamen. Durch ihre Aussagen in West-Berlin erfuhr die Frau eines ehemaligen Zivilangestellten beim Wehrkreiskommando III endlich etwas über das Schicksal ihres im Januar 1946 verschwundenen Mannes, der wenig später in Hohenschönhausen an Tbc gestorben war. Kemritz hatte auch ihn in die Praxis bestellt und ihm eine Stellung versprochen. Als der Mann nach diesem Besuch die Straße überquerte, wurde er verhaftet und auf einem Lkw abtransportiert. Ähnlich war es auch dem Reserveleutnant Walter aus Moabit ergangen, der während des Krieges unter Kemritz bei der Abwehr gedient hatte. Nach einem Besuch in dessen Praxis nahm ihn in der Dorotheenstraße ein russischer Offizier fest und brachte ihn in den Keller der Zentralkommandantur in der nahen Luisenstraße – später das Gebäude der DDR-Volkskammer. Viele der mit Kemritz Hilfe Verhafteten überlebten die sowjetischen Lager nicht. Am 4. Juli 1950 starb in Luckau der ehemalige Kopenhagener UFA-Direktor und Hauptmann der Abwehr Hans Jürgen von Hake. Nach Aussagen eines Zeugen hatte Kemritz ihn schriftlich als Abwehroffizier und überzeugten Feind der Sowjetunion denunziert. Die (west-)deutsche Presse verschwieg allerdings den Kommentar des amerikanischen TIME-Magazins vom August 1951 zu dem Rekrutierungsoffizier und Agenten von Hake, »der von den Dänen für Kriegsverbrechen gehängt worden wäre, hätten ihn die Russen nicht zuerst gekriegt«. Es war von Hakes Frau, die Ende Mai 1951 bis zur Gattin des amerikanischen Hochkommissars John McCloy vordrang und anschließend den Skandal um Kemritz in die bundesdeutsche Öffentlichkeit trug. Sie schilderte ihren Mann als »entschiedenen Gegner des Nazi-Regimes« und versuchte zu verhindern, dass die US-Behörden dem »Mörder meines Mannes« einen Auslandspass ausstellten. Ein deutscher Pass wurde Kemritz des geltenden Haftbefehls wegen verweigert. »Ich möchte Ihnen raten, kein zu großes Geschrei zu erheben«, riet ihr Frau McCloy, »der Fall Kemritz liegt auf derselben hohen politischen Ebene wie Landsberg.« In Landsberg am Lech saßen zu jener Zeit die letzten Nazi-Kriegsverbrecher in Haft. Kemritz jedoch blieb trotz Haftbefehl, Geständnis und beschworener Aussagen der Belastungszeugen frei. Nach sechs Wochen Untersuchungshaft hatte ihn das Landgericht Frankfurt/Main gegen eine Kaution von 5 000 DM auf freien Fuß gesetzt. Zur gleichen Zeit erfuhr das Berliner Landgericht (wo die Angehörigen der verstorbenen und noch inhaftierten Kemritz-Opfer die Klage ursprünglich eingereicht hatten), vom Frankfurter Staatsanwalt, dass »der amerikanische Landeskommissar für Hessen […] das Verfahren Dr. Kemritz an sich gezogen und an das zuständige amerikanische Bezirksgericht abgegeben« hat. An das amerikanische Bezirksgericht in Berlin nämlich, dessen Oberstaatsanwalt schließlich Mitte Juni 1951 mitteilte, das Ermittlungsverfahren gegen Kemritz sei eingestellt worden. Es rauschte gewaltig im bundesdeutschen Blätterwald, ein internationaler Skandal bahnte sich an. Das Rechtsamt des amerikanischen Hochkommissars in Frankfurt/Main sah sich zu einer ergänzenden Verlautbarung gezwungen, in der es hieß, es gebe keinen Anlass, Kemritz zur Verantwortung zu ziehen, da die NKWD zu jener Zeit eine Dienststelle der Besatzungsbehörden und Kemritz’ Unterstützung von Verhaftungen den Bestimmungen und Gesetzen entsprechend legal gewesen sei. Außerdem habe er in den Nachkriegsjahren »einen wertvollen Beitrag zur Sicherung des Westens« geleistet. Es blieb dabei: Seine amerikanischen Auftraggeber ließen Dr. Kemritz nicht im Stich, mochten die deutschen Justizbehörden noch so sehr wettern. Nach gewalttätigen Ausschreitungen gegen Kemritz lebte der mit seiner Frau in einer Villa der Amerikaner in München und wartete auf seine Auswanderungspapiere. Als Rechtsvertreter stand ihm Robert M.W. Kempner zur Seite, US-Hauptankläger der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse. Und auch der schwieg.
»Auf meinem Buckel wird der Machtkampf zweier Weltnationen gegeneinander ausgetragen. Und ich muss den Mund halten [...]«, klagte Kemritz.
Die Spekulationen darüber, welchen großen Dienst er den Amerikanern erwiesen habe, schossen ins Kraut. Spätestens seit Mitte Dezember 1945 war er als Doppelagent im Dienste der Amerikaner tätig gewesen und hatte vermutlich, unbemerkt von den Sowjets, in deren Auftrag auf östlichem Gebiet ein Netz ehemaliger Abwehrleute installiert, um deren Sicherheit die Amerikaner nun fürchteten. Den aufgebrachten bundesdeutschen Behörden nützte es nichts, dass der hessische Ministerpräsident und Justizminister Zinn Dr. Kemritz das Betreten aller hessischen Justizgebäude verbot und ihn seines Amtes als Notar enthob. Nicht einmal das angestrebte Ehrengerichtsverfahren, um Kemritz aus der Frankfurter Anwaltskammer auszuschließen, durfte auf amerikanische Anweisung zu Ende geführt werden. So deutlich waren den Bundesdeutschen die Grenzen ihrer Souveränität selten aufgezeigt worden. Am 20. Juni 1951 beschäftigte sich der Bundestag einen ganzen Tag lang mit dem Fall Kemritz. Immerhin ging es um ein hohes Gut: um die Wiederherstellung der alleinigen Zuständigkeit deutscher Gerichte auf deutschem Hoheitsgebiet.
Die Politiker fanden starke Worte. Der ehemalige Berliner Bürgermeister und CDU-Abgeordnete Ferdinand Friedensburg (1886–1972) erklärte: »Es handelt sich um das Verhalten eines regelrechten Halunken, und ich beneide die Besatzungsmacht nicht, die sich vor einen solchen Halunken stellt!«
Eine Woche nach der Bundestagsdebatte tat Bundeskanzler Adenauer etwas sehr Ungewöhnliches. Er wandte sich in einem Brief an den Hohen Kommissar John McCloy, in dem es sowohl ausführlich als auch ausschließlich um den Fall Kemritz ging. »Die Bundesregierung«, so betonte der Kanzler, vermag die amerikanische »Rechtsauffassung nicht anzuerkennen und sieht sich daher veranlasst, gegen die Eingriffe in die deutsche Rechtspflege nachdrücklich Verwahrung einzulegen.« Diese Eingriffe »der amerikanischen Behörden in die deutsche Gerichtshoheit haben in der Öffentlichkeit eine außerordentliche Erregung hervorgerufen«. Die Amerikaner blieben stur und spielten den Fall herunter. Von den 23 Kemritz vorgeworfenen Entführungen erkannten sie ohnehin nur 17 an, 14 Männer – einer davon die »widerwärtige Figur namens von Hake« – und drei Frauen. Die wären eben der Preis gewesen, mit dem sich ihr Top-Agent Kemritz das Vertrauen der Russen gesichert habe. Die heftige deutsche Reaktion beunruhigte dennoch. Nach der erregten Bundestagsdebatte kabelte der Korrespondent der New York Times aufgeregt nach Hause: »Das gesamte Gebäude der deutschen Freundschaft und Sympathie für die Amerikaner […] ist zusammengebrochen!« So schlimm war es nun auch wieder nicht, fand Time, »obgleich eine Menge Deutsche mit Freude sehen, wie die Amerikaner hochnäsig einen Lockspitzel verteidigen«.
Die Bundesregierung, im Bezug auf Nazi-Verbrechen eher zurückhaltend, unternahm noch zweimal den Versuch, den Fall Kemritz in ihrem Sinne zu bereinigen. Die Protokolle über die diesbezüglichen Verhandlungen der deutsch-amerikanischen Kommission vom 9. September 1951 und vom 28. Februar 1952 entbehren nicht einer gewissen surrealen Note. Selten ist so ausgiebig aneinander vorbei geredet worden, wobei keine Seite von ihrem Standpunkt abrückte. Am Schluss erklärte der amerikanische Verhandlungsführer Mr. Lamb »nochmals, daß Kemritz aus Deutschland entfernt werde«. Und dabei blieb es. Ihren Agenten für die Auslieferung von 17 Nazis haftbar zu machen, die ohnehin verhaftet worden wären, lehnte die Besatzungsmacht kategorisch ab. Ein Versuch der deutschen Justiz, Kemritz wenigstens als Zeugen in einem Prozess aussagen zu lassen, den ein gewisser Aschwin Lippe gegen den Schriftsteller Dr. jur. Michael Graf Soltikow angestrengt hatte, scheiterte ebenfalls. Graf Soltikow, in Potsdam bürgerlich als Michael Brennecke geboren, hatte es bei der Abwehr nur bis zum Dienstrang eines Unteroffiziers gebracht, war jedoch während des Krieges für die Beobachtung des in Berlin akkreditierten diplomatische Korps zuständig gewesen. Und der Kläger hieß mit vollem Namen Prinz Aschwin zu Lippe-Biesterfeld und war der Bruder des niederländischen Prinzgemahls Bernhard. Worum es in dem Prozess zwischen Hoch- und adoptiertem Adel ging, ist schwer nachzuvollziehen. Kemritz jedenfalls sollte 1944 Soltikows Vorgesetzten, Oberstleutnant de Laporte, zu einem Meineid gedrängt haben, um die Todesstrafe für den Grafen durchzusetzen. Wieder griffen die Amerikaner ein und verhinderten Kemritz’ Auftritt vor der Münchner Hauptspruchkammer. Im Zusammenhang mit diesem Prozess tauchten zum ersten Mal Vermutungen auf, Kemritz habe den Amerikanern bereits während des Krieges wichtige Informationen geliefert. Einen Beweis dafür gibt es jedoch nicht.
In der Öffentlichkeit hatte die »Affäre Kemritz« ein dramatisches Nachspiel. Die West-Berliner Tribüne brachte 1954 »Die Karriere des Dr. Ritter« von Bodo Homberg zur Uraufführung, ein Stück, das sich eindeutig auf Kemritz bezog. RIAS-Reporter Rainer Höynck empörte sich im Namen seiner Hörer in der Zone: Der Fall des amerikanisch lizensierten Lockvogels Kemritz sei für den Menschenraub »äußerst atypisch. […] Damals, als Kemritz das machte, […] arbeiteten ja Amerikaner und Russen noch eng zusammen.« Das Stück erlebte keine weiteren Aufführungen. Der aus Mecklenburg stammende Autor ging 1967 zurück in die DDR. Und Kemritz lebte bis ans Ende seiner Tage in seiner neuen Heimat in den USA. Arthur L. Smith, der den Fall Kemritz gründlich aufgearbeitet und etliche der Dokumente ans Licht gebracht hat, ging auch der im Bundestag geäußerten Vermutung nach, Kemritz’ besonderer und »substantieller Wert« habe für die Amerikaner in Informationen über die russische Atomforschung und -produktion in Ost-Deutschland bestanden, über die spätere Wismut AG also. Einen Beweis dafür fand er nicht. Noch heute hüllen sich die amerikanischen Behörden im Fall Kemritz in auffälliges Schweigen.
Der Fall Gladewitz
Wie schon in der Affäre Kemritz erkennbar, waren manche Dinge und Zuständigkeiten in der Stadt mit den vier Besatzungsmächten auf seltsame Weise – mitunter auch gar nicht – geregelt. Weder in Jalta noch in Potsdam war jedes Detail bis ins einzelne geklärt worden und die Sowjets, die Berlin in verlustreichen Kämpfen befreit hatten, schufen in den zwei Monaten ihrer alleinigen Besatzungsmacht Realitäten, an denen später nicht mehr gerüttelt wurde. Die Berliner Wasserstraßen beispielsweise blieben unter sowjetischer Hoheit, ebenso die Reichsbahn samt allen Bahnhöfen und dem Schienennetz, mit ausgedehntem Flächenbesitz rechts und links der Trassen und mit der innerstädtischen S-Bahn – auch in den späteren West-Sektoren. Das Berliner Rundfunkhaus, bei seinem Bau 1929–31 das modernste Europas, ja der Welt, liegt außerhalb der westlichen Innenstadt in Witzleben. Dem einstigen preußischen Exerzierplatz gegenüber steht seit 1926 der Funkturm, und dort stand auch die hölzerne Funkhalle, die während der Funkausstellung 1935 abbrannte. Der Klinkerbau des Funkhauses, von Hans Poelzig für die Berliner Funk-Stunde AG entworfen und gebaut, ragt wie ein mächtiger Schiffsbug von der Masurenallee in die Bebauung von Westend. Von hier sendete der Großdeutsche Rundfunk bis in die letzten Kriegstage hinein sein Durchhalteprogramm. Die Kriegsschäden hielten sich in jener besseren Gegend Berlins in Grenzen; die im Bunker neben dem Funkhaus verbliebene Besatzung hatte den Befehl zur Sprengung des Hauses nicht ausgeführt. Die Rote Armee besetzte das unzerstörte und technisch intakte Gebäude in den ersten Maitagen 1945. Dabei spielte Major Popow eine Rolle, wenig später verantwortlich für den Transfer deutscher Wissenschaft und Technik gen Osten. Popow, Chef der sowjetischen Fernsehforschung, kannte das Haus. Er hatte hier 1931–33 als Volontär gearbeitet; sein letzter Besuch lag nur gut vier Jahre zurück.
Intendant des neuen »demokratischen Rundfunks«, wie er selbst ihn taufte, wurde der mit der Gruppe Ulbricht nach Berlin eingeflogene Kommunist Hans Mahle. Die Sowjets vertrauten ihm. Erst nach Protesten der westlichen Alliierten traten sowjetische Kontrolloffiziere ihr Amt als Zensoren an. Einer davon hieß Markus Wolf und nannte sich als Kommentator Michael Storm. Gegen alle Versuche, das im britischen Sektor arbeitende Radio Berlin zu einem Sprachrohr aller Besatzungsmächte zu machen, setzten sich die Sowjets und die deutschen Kommunisten hartnäckig zur Wehr. Bis zur Gründung des DIAS/RIAS blieb ihr Sender die einzige Radiostation in der Stadt; ein Berliner Ableger des Hamburg-Kölner NWDR erlangte u. a. der schwachen Sendeleistung wegen nie wirkliche Bedeutung. Einen eigenen Sender bekam West-Berlin erst 1954 mit dem Sender Freies Berlin (SFB).
Da weder eine Sprengung der im französischen Sektor stehenden Sendemasten noch eine vierzehntägige Stromunterbrechung die Ost-Berliner Propagandisten aus dem komfortablen West-Quartier vertrieben hatten, befand sich die ostdeutsche Rundfunkzentrale mit dem Berliner Rundfunk und dem Deutschlandsender nach Gründung der DDR noch für weitere drei Jahre in West-Berlin. Sehr zum Ärger der West-Berliner, denen dieser rote Splitter im Herzen ihrer Insel im Roten Meer aufs Höchste missfiel. Verwaltung und Generalintendanz des Deutschen Demokratischen Rundfunk waren längst in die Ost-Berliner Friedrichstraße umgezogen, und in den Redaktionen und der Technik in der Masurenallee arbeiteten inzwischen fast ausschließlich junge Ost-Berliner. Bei den Künstlern und Musikern war das nicht durchzusetzen. Sie wohnten traditionell im geografischen Berliner Westen; manche von den im Osten Beschäftigten auch noch nach dem Mauerbau. Die konkrete Situation war selbst für die Berliner schwer zu übersehen, auswärtigen Besuchern musste sie jedoch geradezu absurd erscheinen. Kein Wunder, dass es immer wieder zu Verwechslungen der Sender und der Funkhäuser kam. So erging es am 1. September 1950 auch einem etwa 25-jährigen jungen Mann aus Aue, der sich in West-Berlin die Industrieausstellung ansehen und sich außerdem über die Zustände bei der Wismut AG äußern wollte. In der Annahme, in dem repräsentativen Bau gegenüber dem Messegelände könne nur der RIAS residieren, meldete er sich beim Pförtner und bat darum, einen zuständigen Redakteur sprechen zu können. Er war ganz sicher nicht der erste Besucher, der sich hier an falscher Stelle befand. Dennoch machte ihn niemand auf seinen Irrtum aufmerksam. Der Empfangschef und Chef des Betriebsschutzes Hartmann telefonierte mit dem Chef vom Dienst und informierte ihn über den Besucher und dessen Anliegen. Seltsamerweise wurde dem Mann nicht einmal ein Passierschein ausgestellt – ein eindeutiger Verstoß gegen die geheiligten Regeln der Sicherheit.
Chef vom Dienst war an diesem Tag Richard Gladewitz, Hauptabteilungsleiter »Sowjetunion und Volksdemokratien«, dabei kein Kenner der Sowjetunion und kein Journalist mit großer Rundfunkerfahrung, wohl aber ein geschulter Propagandist und Klassenkämpfer. Gladewitz, 1898 in Zwickau geboren und seit 1920 Mitglied der KPD, 1922 Ortsgruppenvorsitzender in Cuxhaven und später Stadtverordneter und Vorsitzender des Mieterverbandes in Chemnitz, war nach 1933 mit Zustimmung der KPD nach Frankreich emigriert und hatte in den Internationalen Brigaden bei Teruel, Gandesa und am Ebro im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft. Danach hielt er sich illegal in Frankreich und Belgien auf und war in der französischen Résistance aktiv. Er nahm als Delegierter an der so genannten Brüsseler Konferenz der KPD (die im Oktober 1935 in Kunzewo bei Moskau stattfand) teil und wurde Ende 1943 Mitglied der KPD-Westleitung. Als Beauftragter des Nationalkomitees Freies Deutschland/West (NKFD/W, französisch CALPO) und Leiter des Frontbüros für Paris und Umgebung spielte er bei der Befreiung von Paris eine Rolle, die ihm in Frankreich hoch angerechnet wurde. Gladewitz war im Juni 1945 in seine sächsische Heimat zurückgekehrt und übernahm im Dezember die KPD-Kreisleitung in Plauen. Kaum ein Jahr später war er im Range eines Ministerialdirektors Leiter der Hauptabteilung »Allgemeine Volkserziehung« im Sächsischen Volksbildungsministerium. Bis Oktober 1948 unterstand ihm auch das zum Innenministerium gehörende Landesnachrichtenamt und er war außerdem Mitglied der Landeskommission für Staatliche Kontrolle. Dass er nun in relativ untergeordneter Funktion beim Rundfunk tätig war, verdankte er vermutlich seiner West-Emigration. Einige seiner Genossen aus Paris befanden sich in Haft, andere waren zumindest tiefer gefallen als er. Er stieg auch später in der DDR nicht höher auf als bis zum wissenschaftlichen Mitarbeiter am Institut für Marxismus-Leninismus und starb 1969 als »Arbeiterveteran«. Sein Porträt von Eva Schulze-Knabe zeigt einen hinfällig und verbittert wirkenden alten Mann.
An jenem 1. September 1950 bestellte Gladewitz, der zwei Tage zuvor 52 Jahre alt geworden war, den jungen Mann aus Aue in sein Zimmer. Um sich mit ihm über Aue zu unterhalten, wo er selbst kurz zuvor gewesen sei, wie er später vor Gericht offenherzig aussagte. Ganz unvorbereitet empfing er seinen Gast nicht, denn der Empfangschef Hartmann (KPD-Mitglied seit 1925), der den Mann begleitete, hatte ihn vorgewarnt. Das verräterische Stalin-Bild nahm Gladewitz vorsichtshalber von der Wand. Der Besucher bemerkte dann auch nicht, dass er sich beim falschen Sender befand. Nur als Gladewitz’ Sekretärin in seiner Gegenwart beim Kraftfahrpark einen Wagen in die Friedrichstraße bestellte, wurde er stutzig. »Liegt die nicht im Ost-Sektor?«, erkundigte er sich, wurde aber beruhigt: »Wo wir hinfahren, ist West-Sektor.« Es hielten sich noch drei weitere Personen in Gladewitz’ Dienstzimmer auf. Ein junger Regisseur, Dagobert Löwenberg (1929–2006), wollte unbedingt ein sendefertiges Manuskript von Gladewitz abzeichnen lassen. Der hatte gerade Dienstschluss und wollte angeblich auf dem Nachhauseweg bei der Ost-Berliner Generalintendanz sein Gehalt abholen; der neue Chef vom Dienst aber hatte sein Amt noch nicht angetreten. Die Unterhaltung mit dem Mann aus Aue fand also unter ungünstigen äußeren Umständen statt, die für den Rundfunkbetrieb jedoch als normal gelten müssen. Nach einem kurzen Gespräch verließ Gladewitz mit seinem Besucher das Zimmer und war zehn Minuten später zurück. Ein Pförtner sah angeblich, wie der Mann aus Aue das Haus verließ. Von da an fehlte jede Spur von ihm. »Name und Schicksal des Verschleppten sind bis heute ungeklärt«, schrieb die West-Berliner Presse ein Jahr später. Daran hat sich auch bis heute (Oktober 2008) nichts geändert. Im Prozess verweigerten Gladewitz und Hartmann jede Aussage zu den Personalien des Besuchers.
Der Redakteur Horst Ewald*, später Belastungszeuge der Anklage, vermutete sofort, man habe den Mann nach Ost-Berlin gebracht, doch alle widersprachen ihm, vor allem Gladewitz. »Wenn es richtig ist, dass die Personalien stimmen«, so soll sich Gladewitz geäußert haben, »dann kommt der junge Mensch wieder […].« Der junge Regisseur hatte das Zimmer schon während des Gesprächs verlassen, angeblich mit einem Zettel in der Hand, auf dem die Namen von Arbeitern aus Aue standen, die sich nach West-Berlin absetzen wollten. »Der Idiot wollte zum RIAS. Wenn dieses Schwein dorthin gegangen wäre, hätte er schön was anrichten können«, bemerkte Löwenberg. So jedenfalls kolportierte Der Abend am 9. März 1951 dessen angebliche Äußerung. Von vermeintlichen Straftaten war damals noch nicht die Rede. Es war Kalter Krieg, und auf beiden Seiten wurde mit harten Bandagen, sprich mit Übertreibungen und blanken Unwahrheiten gekämpft. Am 4. September 1950 erfuhr der RIAS durch Horst Ewald von dem Vorfall und meldete ihn der West-Berliner Polizei. Deren Ermittlungen dauerten ein Vierteljahr. Sie bezogen sich auch auf einen weiteren angeblichen Entführungsfall vom 7. September. Am 6. Dezember des gleichen Jahres wurden Hartmann, Gladewitz und dessen Chauffeur Schmidt »unter dem dringenden Verdacht, an zwei Entführungen maßgeblich beteiligt gewesen zu sein« nach Dienstschluss vor dem Funkhaus verhaftet. Sie bestritten, den oder die Männer aus Aue überhaupt zu kennen. Zu allen weiteren Vorwürfen schwiegen sie in der Folgezeit »um der Westpresse keine Möglichkeit zu geben, vor Beginn des Prozesses ihre Aussagen zu entstellen«. Löwenberg nahm man erst am 15. Dezember am S-Bahnhof Witzleben fest. Alle vier Männer blieben in Untersuchungshaft. Nach weiteren acht Monaten wurde die Verhandlung vor dem Moabiter Schwurgericht auf den 27. August 1951 angesetzt. »Ein gemeines Justizverbrechen ist geplant« titelte Neues Deutschland, während der West-Berliner Abend »Die Menschenräuber von der Masurenallee« vorverurteilte. Die Anklage vertrat der mehrfach in politischen Prozessen aktiv gewordene Oberstaatsanwalt Cantor, den Vorsitz führte Landgerichtsdirektor von Götze. Zur Empörung der West-Presse genehmigte dieser Tonaufnahmen im Gerichtssaal für RIAS, NWDR und für den Berliner Rundfunk.
Verteidiger der vier Angeklagten war Dr. Friedrich Karl Kaul, lange vor Wolfgang Vogel der prominenteste DDR-Anwalt, Verteidiger auch im westdeutschen KPD-Prozess und Prozessbeobachter im Eichmann-Prozess. Kaul (1906–1981) war ein wohlbeleibter und rhetorisch begabter kleiner Mann mit kräftig krähender Stimme, den die West-Berliner Justiz nicht zu Unrecht fürchtete. Seit 1946 war der ehemalige KZ-Häftling und Emigrant Justitiar des Berliner Rundfunks – eine Funktion, die er (für die späteren Staatlichen Komitees für Rundfunk und Fernsehen) bis zu seinem Tod wahrnahm. Dass er eine beeindruckende Persönlichkeit und ein genialer Selbstdarsteller war, wird jeder bestätigen, der ihn einmal erlebt hat. Eine »exzentrische Persönlichkeit«, der die DDR-Führung eine gewisse Narrenfreiheit einräumte, wie seine Biografin ihn zutreffend charakterisiert. Kaul hat in seinem Band »Ich fordere Freispruch. Westberliner Prozesse von 1949–1959« eine romanhafte Darstellung der Vorgeschichte – aus seiner Sicht – und eine ebenso einseitige Schilderung des Prozessverlaufs hinterlassen. Noch bevor die Angeklagten in Moabit zur Person vernommen wurden, gab er eine Erklärung ab: »Mit Rücksicht darauf, dass das Gebiet des Rundfunkhauses Masurenallee […] der Gebietshoheit weder der westlichen Polizei noch des westlichen Gerichts untersteht, besteht für die ›Angeklagten‹ an und für sich keine Pflicht, hier vor diesem Gericht irgendwelche Angaben über Vorfälle zu machen, die sich etwa auf diesem Gebiet abgespielt haben. Mit Rücksicht darauf aber, dass die gegen die ›Angeklagten‹ erhobenen Beschuldigungen eine gemeine Provokation darstellen, die von bestimmten Seiten der westlichen Öffentlichkeit zu den schlimmsten Hetzereien geführt hat, werden die ›Angeklagten‹ alles tun, die Findung der Wahrheit zu erleichtern, um auf diese Weise die Provokation am ehesten als solche zu entlarven.«
Was den ersten Teil dieser recht dreisten Erklärung anging, so bestätigte das Gericht in seinem Urteil drei Tage später tatsächlich und ohne eine eindeutige Grundlage dafür zu nennen, dass »der Gebäudekomplex des Berliner Rundfunks […] nach den Abmachungen der vier Besatzungsmächte von 1945 eine unter sowjetischer Besatzungshoheit stehende Enklave innerhalb des britischen Sektors von Berlin darstellt und insoweit nicht zu den Westsektoren zu rechnen ist«. Diese Formulierung blieb keineswegs die einzige Genugtuung in den »pöbelhaften Triumphgesängen des Ostrundfunks«. Bereits am ersten Verhandlungstag musste das Gericht den Kraftfahrer Schmidt und den Regisseur Löwenberg aus der Haft entlassen. Nach den vorgewiesenen Unterlagen hatte Schmidt am 1. September 1950 gar kein Kraftfahrzeug gefahren, und Löwenberg hatte den Mann aus Aue nur in Gladewitz’ Zimmer gesehen. Auf dessen Aussage kam es nun an. Natürlich habe ihn interessiert, was der junge Mann dem RIAS über die Verhältnisse in Aue mitzuteilen gehabt habe, doch wäre das nur belangloses Geschwätz gewesen und so olle Kamellen, da hätte nicht mal der RIAS etwas damit anfangen können. Deshalb habe er das Gespräch bald abgebrochen und den Mann aus dem Haus bringen lassen. Notizen habe er sich nicht gemacht. »Das hat nicht mal zehn Minuten gedauert, ich hatte erst mal Drang, dass ich wieder in die Sitzung kommen wollte, weil das wichtiger war […].« Von dieser Sitzung war bis dahin nie die Rede gewesen. Und auch sonst klingt Gladewitz’ Aussage nicht sehr glaubwürdig. Aue und die sowjetische Wismut AG gehörten im Osten zu den absoluten Tabuthemen. Schon aus Gründen des Geheimnisschutzes wäre eine gründliche Befragung notwendig und sicherlich auch vorgeschrieben gewesen. Die allerdings überstieg Gladewitz’ Kompetenz. Selbst wenn, wie behauptet, Hartmann den Mann wieder aus dem Haus gebracht hatte, war dessen Festnahme spätestens nach seiner Rückkehr in Aue zu erwarten gewesen. Beweisen ließ sich das nicht. Die Frage, ob es im »roten« Funkhaus nicht mindestens einen zuständigen Mitarbeiter des MfS (oder der Besatzungsmacht) mit einem eigenen Kraftfahrzeug gegeben hatte, jederzeit bereit zu einem Transport nach Ost-Berlin, wurde anscheinend gar nicht erst gestellt. Das Gericht klammerte sich hartnäckig an die Auskünfte der für den Kraftfahrzeugpark Zuständigen. Die hatten jedoch ein knappes Jahr Zeit gehabt, ihre Unterlagen zu bereinigen und ihre Aussagen mit Kaul abzustimmen.
Presse und Rundfunk berichteten in beiden Teilen der Stadt ausführlich über den ersten Prozesstag. In welchem Sinne das geschah, kann man sich denken. »Wegen falscher und tendenziöser Berichterstattung wurde der kommunistische Zonensender Ost heute in Moabit von den Verhandlungen gegen die Menschenräuber von der Masurenallee ausgeschlossen«, meldete die West-Presse am zweiten Verhandlungstag. Am gleichen Abend liefen auf Berliner Rundfunk und Deutschlandsender wiederum Sendungen mit Original-Ton aus dem Schwurgerichtssaal. Man habe die Original-Ausschnitte vom RIAS »gestohlen«, vermutete der West-Berliner Kurier, hatte aber nur die technischen Möglichkeiten der Ost-Journalisten unterschätzt, die in ihren voluminösen Aktentaschen erste mobile Reportage-Magnettongeräte mit sich herumschleppten und sich bei den Aufnahmen im Saal planmäßig ablösten. Personen- und Taschenkontrollen, heute vor vielen Gerichten üblich, fanden damals noch nicht statt. Die Zeugenaussagen der Gladewitz-Sekretärin und des inzwischen in Westdeutschland als politischer Flüchtling anerkannten Ewald waren wenig geeignet, die Darstellung des Gerichts zu stützen. Gnadenlos und unbeirrt von den lautstarken Protesten der West-Berliner Zuhörer, demontierte Kaul den einzig verbliebenen Belastungszeugen, der sich schließlich weigerte, einem »Ostanwalt« Rede und Antwort zu stehen. Dem wiederum widersprach das Gericht, und so kamen Ewalds Verbindungen zum RIAS und zur politischen Polizei zur Sprache, die seine Glaubwürdigkeit erheblich erschütterten. Als am dritten Verhandlungstag der Oberstaatsanwalt Cantor in seinem Schlussplädoyer für Hartmann und Gladewitz je sechs Jahre Zuchthaus forderte, schloss sich das Gericht diesem Vorschlag nicht an. Bereits während Kauls dreistündigem Plädoyer war es immer wieder zu Unruhe im Saal gekommen; zur Urteilsverkündung mussten Polizeikräfte die Ordnung sichern. Gladewitz, Hartmann und Löwenberg wurden mangels Beweises freigesprochen, Schmidt aufgrund erwiesener Unschuld. Der Osten feierte den Freispruch und die Heimkehr der Märtyrer und unterschlug die Formulierung »mangels Beweises«, der Westen tobte empört. Nur wenige vernünftige Stimmen sprachen von der Stärke des Rechtsstaates und einem »Beweis der inneren Sicherheit«. Andere forderten aufgeregt einen »Stacheldraht um Radio Berlin«. Ein Dreivierteljahr später zogen ihn die Briten. In Kauls Darstellung und im DDR-Rundfunk galt das Urteil bis 1990 als ein glänzender Sieg über den Klassenfeind. Nachlesen konnte man es jedoch nirgends, hieß es darin doch u. a.: »Die Angeklagten sind […] skrupellose Sadisten [! J.E.], denen die Vornahme einer Verschleppung ohne weiteres zuzutrauen ist. […] So blieb als Gesamteindruck der Hauptverhandlung ein erheblicher Verdacht gegen die Angeklagten, aber nicht der zu einer Verurteilung nötige Nachweis ihrer Schuld vor dem Gewissen der Richter.«
Eingeweihte Journalisten gaben Jahre später zu, manches an dem Fall und an dem Urteil sei nicht ausschließlich mit rechten Dingen zugegangen. Hinter den Kulissen, so die Fama, habe Kaul das Gericht auf gewisse im Osten vorhandene Akten über die Nazi-Vergangenheit der beteiligten Juristen hingewiesen, die man gerne veröffentlichen würde. Trotz der Unruhe in der Öffentlichkeit und trotz massiver Vorwürfe der West-Berliner Presse und etlicher Organisationen gegen ihn gab Generalstaatsanwalt Cantor übrigens am 4. September 1951 bekannt, »dass die Staatsanwaltschaft gegen die Freisprüche des Schwurgerichts im Gladewitz-Prozess keine Revision einlegen werde«.
Professor h.c. Dr. F. K. Kaul, im DDR-Straßenverkehr an seiner extravaganten Fahrweise im neuesten grünen Modell eines Ford Mustang zu erkennen und Stammgast im Prominententreff Ganymed am Schiffbauerdamm, war neben seiner umfangreichen juristischen Tätigkeit ein fleißiger Schriftsteller, Rundfunk- und Fernsehautor. »Funkhaus Masurenallee« hieß sein Hörspiel, das nur einen Monat nach dem spektakulären Prozess aus der Masurenallee gesendet wurde. Regisseur Gottfried Herrmann – später Direktor des Friedrichstadtpalastes – hatte ein erstklassiges Ensemble von Schauspielern aufgeboten, darunter Erwin Geschonnek, Willy A. Kleinau, Franz Kutschera, Wolfgang Langhoff, Wolf von Beneckendorff, Herwart Grosse und Herbert Köfer. In dieser Fassung der (angeblichen) Verschleppungsgeschichte liefen alle schmutzigen Fäden in der Hand einer (erfundenen) Figur zusammen: der des US-Captain Williams. Kaul hatte vier Jahre in einem texanischen Internierungslager verbracht; als Westemigrant, dessen Eltern in New York lebten, setzte er sich wiederholt dem Verdacht aus, Agent des amerikanischen Geheimdienstes zu sein. Zu seinem Glück gab es jedoch auch dafür keinen Beweis.
Lautloser Terror
Natürlich hat Rainer Bolko* damals bei der Stasi unterschrieben. Was hätte er auch sonst tun sollen? Immerhin ging es um weitere sechs Jahre Haft. Nur weil er unterschrieben hatte, fiel das Tor des Zuchthauses Brandenburg am 21. August 1961 hinter ihm ins Schloss. Eine Amnestie. Vergessen und vergeben heißt das griechische Wort »amnêstia« auf Deutsch. Doch die Stasi wollte Rainer Bolko weder vergeben noch vergessen. Er sollte vergessen. Das war die Bedingung. Dafür musste er unterschreiben. Zu niemandem ein Wort über das Gefängnis, und über die Monate davor im »U-Boot« schon gar nicht, dem unterirdischen Geheimgefängnis in Hohenschönhausen. Oder über die sechs Stunden in der Stehzelle, eng wie ein Besenschrank, die Verhöre bis nachts um drei oder vier, das Angebrülle, das grelle Licht – Rainer Bolko musste vergessen und er wollte es auch. Er ist 35 als er in die gerade eingemauerte DDR entlassen wird und er hat das Gefühl, nun endlich sein Leben packen zu können. Natürlich spürt Rainer Bolko, dass er auch außerhalb der engen Zuchthausmauern immer noch in der Falle sitzt. In seine Heimat Kassel kann er nicht zurück. Rainer Bolko wird Potsdam als Wohnort zugewiesen. Berlin darf er nicht betreten.
Berlin. Als er 1944 aus Kassel in die deutsche Hauptstadt kam, war Rainer Bolko im besten Kanonenfutter-Alter. Seine angenehme Stimme rettete ihn vor der Front. Durch die Vermittlung eines Freundes des Vaters wurde der junge Mann zum Großdeutschen Rundfunk kommandiert. Dort verlas er den Wehrmachtsbericht. Bis zum letzten Tag. »Der Führer ist tot, es lebe das Reich« war die letzte Ansage des 19-Jährigen. Gut neun Stunden später, am 2. Mai 1945, übernahm Major Popow von der Roten Armee mit seiner Truppe den Sender. So konnte der Sender schon am Morgen des 13. Mai 1945 als Berliner Rundfunk