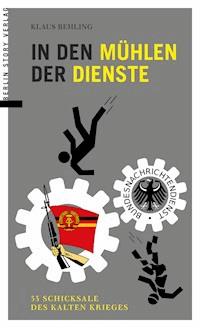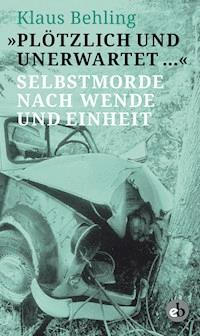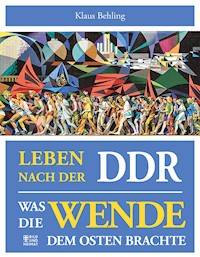Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Berlin Story Verlag GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Fesselnde Geschichten zwischen Ehre und Verrat: Von DDR-Bürgern, die für die Briten spionierten und herausfanden, wie kleine SED-Funktionäre die DDR ruinierten. Für Geld? Nein. »Ich will erleben, wie dieser Staat zusammenbricht.« Sie wurden von der Stasi nie enttarnt … Von Klaus Traube, Atomphysiker, der eine Rechtsanwältin kannte, die Hans-Joachim Klein kannte - ohne zu ahnen, dass dieser RAF-Terrorist war. Der Verfassungsschutz nahm Traube ins Visier, er verlor seine Stelle und wurde Kronzeuge der Anti-Atom-Bewegung … Von einer westdeutschen Diamantenhändlerin, die in einem Hotel in Conakry auf einen Mann stößt, der Diamanten erst testweise für 50 000 Dollar kaufen und dann alle vier Wochen für 100 000 Euro haben will. Das Geld stamme aus dem DDR-Parteivermögen … Klaus Behling hat Spuren gesucht und Zeitzeugen befragt. Wie gerieten sie ins Netz der Geheimdienste, wo liefen die Fäden, die Täter und Opfer oftmals unsichtbar miteinander verknüpften?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
KLAUS BEHLING
LICHT
INS DUNKEL
ZWANZIG SCHICKSALHAFTE GEHEIMDIENSTAKTIONEN AUS OST UND WEST
IMPRESSUM
Behling, Klaus:
Licht ins Dunkel –
Zwanzig schicksalhafte Geheimdienstaktionen aus Ost und West
1. Auflage — Berlin: Berlin Story Verlag 2014
ISBN 978-3-95723-701-9
© Berlin Story Verlag GmbH
Unter den Linden 40, 10117 Berlin
Tel.: (030) 20 91 17 80
Fax: (030) 69 20 40 059
www.BerlinStory-Verlag.de, E-Mail: [email protected]
Umschlag (© des verwendeten Bildes: Argus – Fotolia)
und Satz: Norman Bösch
WWW.BERLINSTORY-VERLAG.DE
INHALT
Vorwort
ZWISCHEN EHRE UND VERRAT
»DAS MACHT UNS KEINER NACH«
ZWICKMÜHLEN
EIN VERGESSENER SKANDAL
BUBE, DAME, KÖNIG, AS
DER STAATSFEIND
SOLDAT WIDER WILLEN
DER GEFÄLSCHTE FREUND
METAMORPHOSE EINES VERDACHTS
DER GESCHÄFTSFÜHRER
DER DOPPELTE DIETER
DER AUSREISSER
GEGEN DEN STROM
EIN HINTERZIMMER IN WIEN
DIE VERSCHWUNDENE WUNDERWAFFE
DIE FÄHRTE DES SCHAKALS
ABRECHNUNG
INSCHALLAH
GEHEIMKONTAKTE
DAS GEHEIMNIS DER BEICHTE
SPUR DER SCHEINE
Nachsatz
TÄTER UND OPFER – GEGENSATZ ODER SYMBIOSE?
ANHANG
Dank und Quellen
ZWISCHEN EHRE UND VERRAT
VORWORT
Der Verräter ist immer der Andere. Er wird aus jeder Gesellschaft ausgestoßen.
Aber der Verräter kann Einengendes hinter sich lassen und so Fesseln sprengen. Das macht den Verrat attraktiv. Er erscheint als Neubeginn mit der Kraft eines Jungbrunnens.
Doch der Brunnen ist vergiftet, denn es gibt ja immerhin die »Ehre«. Bei Homer ist sie noch ein Lebensgefühl, dessen Verletzung zu erbitterten Fehden führte. Gegenstück der Ehre ist die Schande, nicht der Verrat. Aristoteles verknüpft die eigene Vortrefflichkeit mit dieser Ehre und nennt sie als deren wichtigstes persönliches Motiv.
Da kann es nicht verwundern, dass Verrat als schlimmste Sünde der säkularen Welt gilt. Er bleibt Bindeglied einer Weltanschauung, in der Religion und Staat getrennt sind. Dass Verrat die Grundlage der erfolgreichsten Ideologie der Weltgeschichte, des Christentums, ist, und ihr Fundament – den Opfertod des Gründers – erst möglich machte, kann dadurch verschleiert werden.
Verrat als Loyalitätskonflikt bremst, wie er bewegt. Schiller war nicht nur Ehrenbürger der Französischen Revolution, er fürchtete auch, durch sie seine endlich begonnene Karriere zu gefährden. Goethe entfachte nicht nur mit aufrührerischen Werken Revolutionsfeuer, sondern zog, zum Geheimen Rat avanciert, mit seinem Herzog auch gegen die Revolution zu Felde.
Verrat hat wohl immer auch etwas mit Freiheit zu tun, und so stellt sich die Frage, ob es dann so etwas wie »ehrenhaften Verrat« gebe.
Preußens Friedrich II. hat ihn zur Staatsraison gemacht, weil sich die Volksmeinung änderte. Am Tag vor Silvester 1812 lief Yorck von Wartenburgs Heerschar zu den Russen über. Das war Hochverrat, denn eigentlich waren sie mit Napoleon verbündet und damit zum Kriegsdienst gegen den Zaren verpflichtet. Diese preußisch-pragmatisch begründete Ambivalenz von Ehre und Verrat hielt sich bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Es bedurfte des barbarischen Nationalsozialismus, um sie am 20. Juli 1944 in Frage zu stellen.
Und so erscheint für manche Verräter der Verrat tatsächlich als Schritt in die Freiheit. Sie zerstören Vertrauen, um anderes Vertrauen zu erringen. Entscheidend ist wohl das Zeitraster. Was gestern Verrat war, kann heute eine Heldentat sein. Dem französischen Diplomaten und Diener vieler unterschiedlichster Herren, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, wird der Ausspruch »Verrat, Sire, ist nur eine Frage des Datums« zugeschrieben. Er soll ihn als Lebensweiser im Alter Anfang der Sechzig 1815 beim Wiener Kongress gegenüber Russlands Zar Alexander I. geäußert haben. Der war damals 38 Jahre alt. Napoleon Bonaparte, mit 46 Jahren zwischen den beiden stehend und einer seiner vormaligen Dienstherren, hielt Talleyrand deshalb am Ende für »einen Haufen Scheiße in Seidenstrümpfen« – nach dem Verrat, nicht vorher oder in dessen Lauf.
Rund 200 Jahre zuvor hatte der englische Staatstheoretiker und Philosoph Thomas Hobbes mit der moralisch bestimmten Vorstellung von Ehre und Verrat gebrochen und einen radikalen Erklärungsansatz gesucht. Er brauchte ihn zur Begründung des aufgeklärten Absolutismus. Damit wurde Ehre zur äußerlichen Anerkennung der Macht durch andere. Das konnte nicht ohne Kritik bleiben und wenn Schopenhauer in einem »Aphorismus zur Lebensweisheit« auf die übertriebene Bedeutung, die oftmals der Macht dieser anderen beigemessen wird, hinwies, näherte er sich wieder dem »Verrat«. Dem folgten mehr oder weniger all die anderen »modernen« Auffassungen, die immer mehr das Ehrgefühl an das eigene Maß von Wert und Unwert knüpfen.
Verrat wird zum Motor, wenn Heiner Müller sagt, Brecht zu gebrauchen, ohne ihn zu kritisieren, sei Verrat. Gleiches ließe sich auch auf Karl Marx beziehen. Seine einstmals lebendig begonnene Wissenschaft konnte nicht vor dem Verfall ins Dogma geschützt werden, weil die Kritik ausblieb. Kategorien wie Ehre und Verrat verhindern bis heute die Suche nach Antworten auf die Frage, ob der Stalinismus in seinen vielen Spielarten Deformation oder Konsequenz des Marxismus war.
Stattdessen wird der Verräter gern mit dem Denunzianten gleichgesetzt. Der Grund dafür ist simpel: Verrat ist allgegenwärtig und hat viele Gesichter. Der Denunziant wird jedoch lediglich von ihm geboren und dient dann dazu, den Verräter vom potentiellen Helden zum Ganoven schrumpfen zu lassen. Geheimdienste versuchen gern, diesen Zusammenhang zu verschleiern. Dabei hilft wieder die imaginäre »Ehre«.
Das Ansinnen, für die Stasi zu spitzeln, verband sich mit einem angeblich »ehrenvollen Auftrag« und erreichte so den Gipfel der Perversion. Bei dessen Erfüllung – den Maßstab dazu setzten allein die Auftraggeber – wurden höchste Orden verliehen und nach der Feierstunde im »konspirativen Objekt« wieder vom Revers genommen, um sie im Panzerschrank zu verstecken. Die dazu gehörigen Urkunden trugen den Decknamen des »Ausgezeichneten«. Die vermeintliche Ehre war der Hebel, sie in ihrer Scheinexistenz zu fesseln.
Bei Diensten demokratischer Staaten überdeckt oft das Geld die Perfidie des Missbrauchs von Menschen, die zu Kriminellen im Auftrag des Staates gemacht werden. Deren euphemistische Bezeichnung als »V-Mann« – ausgeschrieben »Vertrauensmann«, abgemildert »Verbindungsmann« – weist auch hier auf die Deformation des Ehrbegriffs hin. Und wenn Heinz Fromm als Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz sagte: »Unsere V-Männer sind keine Pastorentöchter«, bestätigt sich dies in sonst unüblicher Transparenz.
Die Psychologie des Handwerks gleicht sich, dennoch sind östliche und westliche Geheimdienste nicht einfach gleichzusetzen. Der Grund dafür liegt in der Gewaltenteilung demokratisch verfasster Regimes. Als der Bundesgerichtshof zum Beispiel feststellte, dass etwa 30 von 200 Vorstandsmitgliedern der neonazistischen NPD gleichzeitig V-Männer des Verfassungsschutzes waren, platzte der Verbotsprozess.
Im Osten bedurfte es hingegen des Zusammenbruchs des gesamten politischen Systems, bis auch der Geheimdienst seine Grenzen fand.
August Heinrich Hoffmann von Fallerslebens mit Blick auf den Polizeistaat getroffene Feststellung: »Der größte Lump im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant«, führte sicher nicht ohne Grund zu seiner Bespitzelung und Verfolgung. Nach seinen 1840 erschienenen »Unpolitischen Liedern« wurde der Dichter des »Liedes der Deutschen« 39 Mal ausgewiesen, darunter dreimal aus seiner Heimatstadt – das gebrochene Verhältnis ist geblieben, wenn es um Ehre und Verrat geht.
So lässt es sich auch leichter übersehen, dass Verrat ebenso aus Revolte, wie aus Treue besteht und Gewissen braucht, um ihn zu begehen. Das leugnen meist nur jene, die gerade auf der jeweils anderen Seite stehen.
Auf ihrer Seite versuchen sie, ihre Geschichte zu machen. Honoré de Balzac meint, diese werde am häufigsten bei ihrer Entstehung gefälscht. Das mag wissentlich ebenso wie instinktiv erfolgen – die handelnden Personen möchten sich immer in einem günstigen Licht präsentieren. Dazu gehört es, ihre Verfehlungen zu vertuschen und unterschiedliche Standpunkte zu beziehen, ohne sich zu widersprechen. So verblassen die Geschehnisse mit der Zeit, Einbildungskraft zeichnet die Details der Ereignisse nach. Der Zeitzeuge glaubt an seine Wahrheit.
Diese Wahrheit soll hier im Mittelpunkt stehen. Sie wird manchmal durch Akten gestützt, ein anderes Mal von ihnen in Frage gestellt. Das ist dann zwar eine andere Sichtweise, kaum jedoch eine andere Faktenlage. Zwischen beiden zu gewichten, soll dem Leser überlassen bleiben. Er muss seine eigene Wahrheit finden.
»DAS MACHT UNS REINER NACH«
Wenn sich die Tachonadel langsam der Lampe für den Blinker näherte, wurden die Fahrgeräusche infernalisch. »Im Prinzip sollte jeder Fahrer während der Fahrt die Ohren ständig gespitzt halten und auf nicht fahrtypische Geräusche achten«, riet das Handbuch »Du und Dein Trabant«. Ein guter Rat, doch die beiden Männer im Auto befolgen ihn nicht.
Nach Verlassen des »Parken und Reisen«-Parkplatzes am Ost-Berliner S-Bahnhof Altglienicke schnurrte der kleine Wagen Richtung Autobahn. Der vor ein paar Minuten gebückt in den Trabant geschlüpfte Mitfahrer richtet sich aus seiner unbequemen, kauernden Haltung auf. Freudig begrüßt er den Mann am Steuer: »Mensch, dass wir uns so wiedersehen!« Die beiden kennen sich seit Jahren. Sie arbeiten als DDR-Bürger für den britischen Geheimdienst, Albert, der Kurier und Jan Weiß (Name geändert), der Informationssammler.
Dass es im Gebälk der DDR immer lauter kracht, wissen sie aus der tagtäglichen Praxis. Doch wohin das alles mal führen wird, ahnen sie nicht. Noch funktioniert die Stasi. Und sie ist den Männern auf den Fersen. Bei der Beerdigung der Chefin ihrer Gruppe waren drei unbekannte »Trauergäste« dabei, eine Kontaktfrau auf einem Berliner S-Bahnhof wurde schon eine Weile beschattet.
»Das Schiff hat Schlagseite, es dauert nicht mehr lange, und es beginnt zu sinken«, sagt Albert. »So kurz vor dem Ziel noch geschnappt zu werden, das wäre die größte Katastrophe.« Er hat seine Erfahrungen. Kurz vor dem Kriegsende 1945 erschoss die Gestapo Alberts Vater. Trotzdem fühlt er sich vom immer wieder betonten Antifaschismus der DDR nicht angenommen. Albert trug zu viele Erfahrungen mit deren Ungerechtigkeit und Despotismus mit sich herum. »Sowie die mit dem Rücken zur Wand stehen, ist ihnen alles zuzutrauen«, sagt er in das Dröhnen des Motors.
Auch Jan Weiß ist nicht ohne Angst: »Ja, es wird brenzlig. Überall Mobilmachungsübungen, die Alarmpläne werden vervollständigt und neuerdings bekommt sogar die Kampfgruppe Schlagstöcke.«
Trotzdem denken die Männer nicht daran, ihre Arbeit für die Engländer aufzugeben. Sie sind sogar stolz darauf. »Das macht uns keiner nach, glaub mir das, Jan«, sagt Albert. Die Männer schwiegen und hängen ihren Gedanken nach, während der Trabant über die Autobahn Richtung Magdeburg holpert.
Warum haben sie sich auf das jahrelange gefährliche Spiel überhaupt eingelassen? Da die Gruppe niemals von der Stasi enttarnt wurde, gibt es keine Akten, die darüber Auskunft geben könnten. Und die früheren Stasi-Offiziere sind nach dem Ende der DDR mit einer Erklärung schnell bei der Hand. Westspione? – Die haben doch alle nur für Geld gearbeitet. Charakterlos, ohne jedes politische Motiv. Mit unseren Kundschaftern für den Frieden nicht zu vergleichen.
Stimmt das? Auf der Suche nach Spuren.
Sie beginnt bei einer älteren Dame in Potsdam. Luise Walter (Name geändert) wohnt im Obergeschoss eines alten Hauses in der Nähe des Parks Sanssouci und ist seit Mitte der 50er-Jahre Witwe. Die mütterlich wirkende Frau bessert ihre karge Rente mit Putzen und gelegentlicher Zimmervermietung auf und hat wenig Bekannte. Einer von ihnen, Werner Buschmann (Name geändert), der auch Jan Weiß in Kontakt zu den Briten gebracht hatte, erzählt dem nach ihrem Tod 1987, dass Luise die Gruppe von den Informationsbeschaffern über die Kuriere bis hin zu einer konspirativen Wohnung in Ost-Berlin für ein »britisches Institut« aufgebaut habe: »Sie war ein Profi. Im Krieg war Luise Nachrichtenhelferin bei der Wehrmacht. Sie sprach fließend englisch, französisch und schwedisch. Abwehrchef Canaris holte sie in seinen Apparat und setzte sie zunächst in Schweden, dann in Großbritannien ein. Dort lief sie zum britischen Geheimdienst über.«
Hier enden zunächst die gesicherten Informationen.
Die Militärattachés im Ausland, damals »Waffenattaché« genannt, wurden ab 1. Juli 1938 der militärischen Abwehr unter Leitung von Wilhelm Canaris unterstellt. Bereits Anfang 1935 hatte Hitler dem Admiral sein Bild der Truppe erläutert: »Was ich mir vorstelle, ist etwas ähnliches wie der britische Geheimdienst – ein Orden, der seine Aufgaben hingebungsvoll erfüllt.«
Das bestimmte die Auswahl der militärischen und zivilen Mitarbeiter, zu denen auch Luise Walter gehörte. Da die junge Frau vorher in Schweden arbeitete, dürfte sie im Frühjahr oder Sommer 1939 erstmals an die Botschaft des Dritten Reiches nach London gekommen sein. Damals war sie Anfang Zwanzig.
Von 1936 bis 1938 residierte der spätere Nazi-Außenminister Joachim von Ribbentrop als Botschafter Hitlers in Großbritannien. Er reiste am 12. März 1938, dem Tag der Besetzung des Sudetenlandes, ab. Diesen Rechtsbruch akzeptierten die Briten gemeinsam mit den anderen Westmächten am 30. September 1938 mit dem Münchner Abkommen. Premier Neville Chamberlain ließ sich in London als »Friedensretter« feiern. Sein Kontaktmann zu Hitler war nach Ribbentrop nun Herbert von Dirksen. Der Gutsbesitzer, Jurist und Beamte im preußischen Staatsdienst hatte ab 1918 Karriere im Auswärtigen Amt gemacht und war ab 1933 Botschafter in Tokio. Dort spürte er, dass Hitler seinen Diplomaten wenig vertraute. Von den Verhandlungen zur »Achse Berlin – Tokio« blieb er ausgeschlossen und in die NSDAP trat von Dirksen erst 1936 ein. Bis zum Abbruch der Beziehungen am 1. September 1939 dürfte er die Vertretung ohne großes NS-Pathos geführt haben.
Das politische Klima im Apparat des Militärattachés, in dem Luise Walter tätig war, hatte Leo Freiherr Geyr von Schweppenburg geprägt. Der 1886 in Potsdam geborene Militär versah den Posten von 1933 bis 1937. Obwohl ihn Hitler am 1. September 1935 zum Generalmajor und am 1. Oktober 1937 zum Generalleutnant beförderte, sah der Militärattaché den »Führer« skeptisch. Bereits in der Rheinlandkrise 1936 hatte er davor gewarnt, die Engländer zu unterschätzen und Hitlers Politik als »abenteuerlich« bezeichnet. Das brachte ihm nicht nur eine Rüge des Kriegsministers Werner von Blomberg, sondern auch das Misstrauen der Reichskanzlei ein. Er übernahm 1937 das Kommando über die 3. Panzer-Division Berlin.
Vom 1. April 1936 bis zum 3. September 1939 arbeitete Generalmajor Ralph Wenninger, 1890 geboren, als Luftwaffenattaché in London. Der mit 97 versenkten Handelsschiffen im Ersten Weltkrieg gefeierte U-Boot-Held war inzwischen im Reichsluftfahrtministerium gelandet und machte später eine steile Karriere, zuletzt im Generalstab der Luftflotte 3. Ein Militär durch und durch, der meinte, die Politik rede ohnehin nur in die Angelegenheiten der Wehrmacht hinein.
In diesem Umfeld musste sich die junge Luise Walter, die ihren Berufsweg einmal mit einem Volontariat bei einer Berliner Zeitung begonnen hatte, ihre politische Meinung bilden. Dabei dürfte das militärische Milieu einen stärkeren Einfluss als das national-sozialistische gehabt haben. Die Widersprüche zwischen den altgedienten Militärs und den Nazi-Emporkömmlingen werden ihr kaum verborgen geblieben sein. Das Aufkommen eigener Fragen ist wahrscheinlich, die Suche nach einem Ausweg liegt nahe. Die Frau soll sie im Kontakt zum britischen Geheimdienst realisiert haben.
Sogenannten Selbstanbietern stehen Geheimdienste in aller Welt skeptisch gegenüber. Dennoch haben sich die Briten offenbar darauf eingelassen. Ihnen dürfte nicht entgangen sein, dass sich Abwehrchef Wilhelm Canaris, Jahrgang 1887, etwa ab 1937 vom begeisterten Gefolgsmann Hitlers wandelte und nun zu widerständischen Gruppen im Militär hingezogen fühlte. Auslöser war die international stark beachtete »Blomberg-Fritsch-Krise«, bei der Reichskriegsminister Werner von Blomberg und der Oberbefehlshaber des Heeres, Werner von Fritsch, von Hitler kaltgestellt wurden.
Doch es gab auch konkrete Signale für die Briten. Die deutschen Abwehroffiziere Josef Müller und Wilhelm Schmidthuber nahmen im Auftrag von Canaris Kontakt zu Papst Pius XII. über dessen Privatsekretär, den Jesuitenpater Robert Leiber auf. So sollte ein Kanal zu den Westmächten eröffnet werden. Nach London lief er über den britischen Gesandten Sir Francis d’Arcy Osborne in Rom. Bei der Regierung des Vereinigten Königreichs blieb das Echo reserviert. Dennoch flossen Informationen. So gelangten zum Beispiel Notizen von Canaris zu einer Hitler-Rede im kleinsten Kreis am 22. August 1939 auf dem Berghof über dessen Stabsoffizier Hans Oster bereits drei Tage später an die britische Botschaft.
Es gab also durchaus ein begründetes britisches Interesse, eigene Informationsquellen zu erschließen. Die daraus resultierende Vermutung der Engländer, innerhalb der Nazi-Abwehr gebe es Widerstand gegen das Regime, bestätigte sich viel später noch einmal, als Wilhelm Canaris und Hans Oster am 9. April 1945 im KZ Flossenbürg ermordet wurden.
Die Annahme, dass sich die persönliche Suche nach einem Ausweg bei Luise Walter mit den Interessen der Briten verband, und sie deshalb Kontakt zu ihnen fand, wäre somit nicht unbegründet.
Mit dem Sieg der Alliierten über Hitler 1945 legitimierte sie sich in überzeugender Weise. Luise Walter stand auf der »richtigen« Seite.
Sie war inzwischen verheiratet, ihr Mann hatte den Krieg überlebt und eigentlich schien nun alles erledigt zu sein. Vielleicht kehrte sie deshalb in ihre märkische Heimat und nicht in die Britische Zone zurück. Der Traum vom Frieden blühte überall in Deutschland.
Er zerbrach, als ihr Mann von den Russen verhaftet und in einem »Speziallager« interniert wurde. Einen Grund dafür erfuhr sie nicht. Der Mann überlebte, doch sieben Jahre nach der Haft – etwa 1953 – starb er an deren Folgen.
Luise Walter ist verzweifelt und wütend auf die Russen und deren ostdeutsche Handlanger. Wieder musste sie einen Ausweg finden. Und sie verhielt sich so, wie schon 15 Jahre zuvor, suchte und fand erneut Kontakt zum britischen Geheimdienst.
Der Secret Intelligence Service an der Vauxhall Cross, London SE 1-1 BD – volkstümlich MI 6 genannt und nur aus den James-Bond-Filmen bekannt – hielt seine pure Existenz bis 1992 geheim. Informationen über ihn oder gar den öffentlich nur »C« genannten Chef, standen in Großbritannien unter Strafe. Dennoch bestätigt George Bailey, im Krieg US-Verbindungsoffizier zur Roten Armee und später Chef von »Radio Liberty«, für die 50er-Jahre, dass »die SIS-Station in Berlin die größte des Dienstes in der ganzen Welt« war.
Die Briten haben die Sowjets als neuen Feind ausgemacht. Es geht um das militärische Potential der Roten Armee. Die ersten Quellen sprudeln reichlich, zwischen 1945 und 1951 laufen rund 500 sowjetische Soldaten und Offiziere zu den Briten über. Der wichtigste Deserteur für den Geheimdienst ist der KGB-Leutnant Alexej Myakow von der Spionageabwehr in Bernau. Doch auch aus den russischen Exil- und Emigrantenorganisationen fließen Informationen, bis KGB und Stasi sie infiltriert haben. Im Durchgangslager Friedland im Westen wurden rund 250 000 entlassene deutsche Kriegsgefangene systematisch befragt. Mit der SIS-Aktion »Dragon Return« sammelten die britischen Geheimdienstler überdies Nachrichten von Wissenschaftler, die zum Dienst in der Sowjetunion zwangsverpflichtet gewesen waren.
Längs der Bahnlinien wurden ostdeutsche Beobachter rekrutiert, bereits seit 1947 waren sie auch in allen Rüstungsbetrieben der Zone präsent. Der britische Geheimdienst-Experte Paul Maddrell erinnert sich: »Es gab kaum Probleme bei der Anwerbung Ostdeutscher, weil viele Vorbehalte gegen die Sowjets hatten. In der Regel handelten sie aus antikommunistischer Überzeugung ohne Bezahlung.«
Luise Walter gehörte inzwischen wieder dazu. Dass das eine gefährliche Sache war, konnte sie immer wieder in der Zeitung lesen. In der Aktion »Blitz« im November 1954 und der folgenden unter dem Decknamen »Frühling« verhaftete die Stasi 521 DDR-Bürger. 105 von Ihnen wurde eine Verbindung zum MI 6 vorgeworfen. Für Spionage drohte in der DDR die Todesstrafe. An dieser Front war auch der Kalte Krieg heiß. Am 12. März 1953 schossen die Sowjets in der DDR nach einem Feuergefecht einen britischen Avro-Lincoln-Bomber mit Spionageausrüstung bei Thomsdorf an der Elbe ab.
Und immer wieder erwischte es die geheimen Konfidenten der Briten im Osten. Durch Verrat des britischen KGB-Maulwurfs im SIS, George Blake, flog im Oktober 1959 Hans Möhring auf. Der Mann aus dem Ministerium für Schwermaschinenbau, u. a. für die Atomkraftplanungen der DDR zuständig, wurde 1960 zu lebenslanger Haft verurteilt. Seine Frau Irma bekam fünfeinhalb Jahre. Erst im Juli 1976 kaufte ihn die Bundesrepublik für 500 000 DM frei.
Die Frau aus Potsdam schreckte das alles offenbar nicht ab. Sie sagt Jahre später nach der Erinnerung von Zeitzeugen: »Ich will einfach noch erleben, wie dieser Staat zusammenbricht. Das bin ich meiner Familie schuldig.« Ihr Diabetes ließ sie das nicht mehr schaffen, aber genau hier lag wohl das Motiv für den gefährlichen Weg, den sie gewählt hatte.
Inzwischen zog sich die Mauer durch Berlin und für die Spione und Agenten jeglicher Couleur war alles viel schwieriger geworden. Geheimdienst-Experte Paul Maddrell: »Nach dem 13. August 1961 rissen viele der bis dahin funktionierenden Verbindungen ab. Es mussten neue Wege gefunden werden.«
Die Aufklärung des Militärpotentials im Osten erfolgte inzwischen sehr effektiv über die britische, französische und amerikanische Militärmission, stationiert in Potsdam. Doch neben den gesammelten Daten, Fotos und Proben musste vor allem eines in Erfahrung gebracht werden: Wie ist die Stimmung der Bevölkerung, wie steht sie zu der allenthalben zu beobachtenden Militarisierung der DDR?
Dazu waren Informanten vor Ort nötig und Wege zu finden, wie diese Nachrichten in den Westen gelangten. Luise Walter hatte das organisiert, doch als Frau, die auf die 50 zuging und nicht arbeitete, war sie auf Hilfe angewiesen.
Deshalb hatte sie sich schon in den 50er-Jahren mit Werner Buschmann verbündet. Der damals Mitte 30-Jährige war geschieden, hatte keine Kinder und lebte in Werder. Seinen Traum von einer Arbeit als Architekt hatte ihm die DDR längst zunichte gemacht. Nach außen schien sich Buschmann damit abgefunden zu haben: »Ich sitze bei einer Baubehörde und erteile Baugenehmigungen.« Aber insgeheim nutzte er seinen großen Bekanntenkreis, zu dem viele kleine Partei-Könige gehörten, die gern bei ihm am See feierten und dann unverblümt über ihre persönliche Wichtigkeit schwadronierten, um die Ohren zu spitzen.
Auch Werner Buschmann hatten die Verhältnisse zur Spionage für die Engländer gebracht. Er stammte aus einem kommunistisch geprägten Elternhaus. Auf Anweisung der KPD ging sein Vater ohne Familie Anfang der 30er-Jahre nach Moskau. Dort geriet er in Stalins Terrorapparat und wurde nach Sibirien verbannt. Nach dem Hitler-Stalin-Pakt vom 23. August 1939 lieferten ihn die Sowjets an die Nazis aus. Werners Vater landete im KZ Sachsenhausen. Er überlebte, aber dem Kommunismus schwor er für immer ab. 1949, also lange nach den großen Verhaftungswellen der Russen im Osten, holte ihn die Vergangenheit wieder ein. Er wurde des »Verrats« bezichtigt und wanderte ins Gefängnis nach Bautzen. Lange hörte die Familie nichts von ihm. Dann kam ein Totenschein: An Lungenentzündung gestorben, stand darauf.
Werner Buschmann hat an diesen Erfahrungen sein Leben ausgerichtet: »Ich habe es mir zur Maxime gemacht, nie wieder zu Unrecht zu schweigen.« Von der Entwicklung in der DDR ist er enttäuscht: »Vielleicht bin ich mehr Kommunist als diese ganzen Verbrecher in Berlin und anderswo«, sagt er bei Gelegenheit zu Jan Weiß. Doch auch die Bundesrepublik ist für ihn keine Alternative, die unbesehen zu akzeptieren ist: »Die Mörder meines Vaters und die der vielen anderen unschuldig Hingerichteten sind immer noch frei. Genauso sieht es drüben in Westdeutschland aus. Denken Sie, dort hätte man alle zur Verantwortung gezogen, die Schuld am großen Massenmorden in den KZs trugen? Wo ist nun die Gerechtigkeit?«
Da mag ihm das Angebot Luise Walters, für die Engländer zu arbeiten, gerade recht gekommen sein. Sie kannte seinen Vater und hatte Vertrauen zu dem damals noch jungen Mann. Und der verfolgt ein klares Ziel: »Ich will mit Hilfe unserer Arbeit den Verfechtern dieser verweichlichten Demokratie im Westen beweisen, dass von unserem Staat nichts Gutes kommen wird. Wenn diese Demokratie da drüben nicht aufpasst, kann sie eines Tages von den Ereignissen überrollt werden. Die Verharmlosung des Kommunismus und seiner Ideologie kann schwere Folgen haben.«
Werner Buschmann, im Herzen immer noch ein sozialistischer Träumer, sieht in seinem Umfeld die zahlreichen Misslichkeiten der DDR: »Seit vielen Jahren beobachte ich einen Sumpf von Bevorzugungen und Vorteilsnahmen von Parteifunktionären, ihre Heuchelei und Unehrlichkeit und damit auch ihr wachsendes Unrechtsbewusstsein. Von wegen glühende Patrioten, sozialistische Persönlichkeiten und was sie noch alles sein wollen. Egoisten und miese Karrieristen sind sie, gemeine Diebe, die das Volk bestehlen.« Er weiß aus eigener Erfahrung nur zu gut: »Zu den Phänomenen unserer Gesellschaftsordnung gehört, dass alle mitmachen und keiner es nachher gewesen sein will.« Dagegen wollte er etwas tun.
Doch die Jahre als Einzelkämpfer blieben nicht ohne Folgen. Das Herz. Werner Buschmann scheint die Last seines Lebens zu spüren, doch er will nicht aufhören, ohne das Haus bestellt zu haben. Die Briten boten ihm immer wieder die Ausschleusung an, aber der heimatverbundene Mann will sein Häuschen am See, in dem schon der Großvater als Fischer lebte, nicht aufgeben. Die örtlichen Bonzen drängten und intrigierten, denn es lag derweil in »ihrem« Datschen-Gebiet, Buschmann widerstand. Erst 1981 warf ihn ein Herzinfarkt um, wenig später ging er dann doch in den Westen. Der britische Geheimdienst versorgte ihn mit einer neuen Identität. Die deprimiert klingende Bilanz seines Lebens, die er seinem »Nachfolger« Jan Weiß in der DDR offenbart, kann auch das neue, unbeschwerte Leben nicht ändern: »Wir taugen weder für das Leben im Kommunismus, noch für das in einer westlichen Demokratie. Leute wie wir stehen immer auf der Verliererseite«.
Doch zurück in die Zeit Anfang der 60er-Jahre. Im Krankenhaus in Potsdam lernte Werner Buschmann den rund 20 Jahre jüngeren Jan Weiß kennen. Der hatte Industrieschmied gelernt und war ein Jahr nach Einführung der Wehrpflicht in der DDR am 24. Januar 1962 mit »freiwilligem Zwang« als dreijähriger »Dienetot« in die NVA geraten. Der junge Mann ist von dem Älteren beeindruckt: »Er war kein Guru, der es verstand, mir den Kopf zu verdrehen. Buschmann faszinierte mich durch sein Wissen, durch seine rationale Analyse und durch seine nur schlecht widerlegbare Kritik an den gesellschaftlichen Zuständen in der DDR.« Seine Gespräche mit ihm waren etwas anderes, als die platte Propaganda bei der Armee: »Allein wie er mir einige politische Vorgänge erklärte, wie sie damals von der DDR-Regierung praktiziert wurden, wie er sie regelrecht in Einzelteile zerlegte, ja geradezu sezierte, machte auf mich einen ungeheuren Eindruck.«
Die beiden befreunden sich nach und nach. Die Gespräche mit Buschmann fielen bei Jan Weiß auf fruchtbaren Boden: »Sie animierten mich geradezu, mehr für meine Bildung zu tun.« Als er aus den vorsichtigen Andeutungen des inzwischen väterlichen Freundes von dessen Arbeit »für ein britisches Institut« erfuhr, schien sich eine Alternative zu eröffnen. Jan Weiß: »Ich vermag heute nicht mehr zu beurteilen, ob es letztlich die despotische und keinen Widerspruch duldende Art meines Kompaniechefs und seiner Genossen, oder ob es ganz einfach meinem rebellischen Charakter zuzuschreiben war.« Er meint: »Meine Neugier auf Menschen war es auch, die mich immer mehr zum Gegner des DDR-Sozialismus werden ließ.«
Dabei sieht Jan Weiß heute sein damaliges Verhalten durchaus kritisch: »Natürlich muss ich auch zugeben, dass mich zu dem Zeitpunkt, als ich in Buschmanns Hand einschlug, auch das Abenteuer reizte. Ich ging einen vollkommen anderen Weg, scherte aus und unterschied mich damit von meinen Mitmenschen. Ich war so ein vollkommen Anderer.« Und: »Bestimmt spielte auch eine gehörige Portion Profilierungssucht und Neugier eine Rolle. Ich wollte ausbrechen aus den alltäglichen Zwängen. Ich war einfach nicht mehr irgendwer, sondern einer, der es wagte, ganz andere Wege zu gehen.« Dennoch resümiert er im Nachhinein: »Buschmann hatte mir die Chance gegeben, abzuspringen.«
Nach dem Dienst bei der NVA ging Jan Weiß zurück in seine Heimat in der Magdeburger Gegend. Auf Anraten des »Instituts« begann er eine kleine Karriere beim »Rat des Kreises«, wurde sogar »inoffizieller Mitarbeiter« der Stasi und saß auf allen möglichen Pöstchen, ob Zivilverteidigung oder in der Musterungskommission, bis er sich später – auch wegen der wachsenden physischen und psychischen Belastung – in einen Produktionsbetrieb zurück zog. Auch dort sammelte er wertvolle Informationen.
»Bei mir steht Gerechtigkeit ganz oben an«, sagt Weiß. Das bestärkte ihn in seiner geheimdienstlichen Tätigkeit, die er 1970 etwa so sah: »Wir haben erkannt, dass kleine und große Verbrecher unseren Staat regieren. Was ich im Staatsapparat und bei der Staatssicherheit täglich an Schwachsinn und auch an Gemeinheiten erlebte, das gab mir die Kraft, dieses System mit meinen Mittel zu bekämpfen. Nicht ihre vollen Schaufenster im Westen und ihre Politiker reizen mich zu diesem gefährlichen Spiel, nein, ich wollte nur meinem Volk helfen.«
Jan Weiß fühlte sich nicht als Spion. Werner Buschmann hatte ihm erklärt: »Bei unserer Tätigkeit interessiert uns nicht das neueste Geschütz oder eine geheime Waffe der Nationalen Volksarmee. Uns interessieren mehr die Menschen dort und anderswo. Unsere Arbeit fließt in die strategischen Studien der Politiker des Landes ein, für das wir tätig sind, und da sie in der NATO und auch in der EWG ein gehöriges Wörtchen mitzureden haben, hoffe ich, dass unsere Arbeit von Nutzen ist.«
Die sich Anfang der 80er-Jahre verschärfende Lage, schien dies zu bestätigen. Die NATO fasste am 12. Dezember 1979 ihren »Doppelbeschluss«, der die Stationierung von Pershing-Raketen und Cruise Missiles in Westeuropa festlegte, falls die Sowjets nicht ihre SS 20 zurückzögen. Am 23. März 1983 verkündete US-Präsident Ronald Reagan die »Strategic Defense Initiative«, SDI, an – der Weltraum würde in künftige Kriegsszenarien einbezogen. Moskau reagierte mit verstärkten Aktivitäten des KGB. Unter dem Codewort »Rjan« – Abkürzung für »Raketno-Jadernoje Napadenje«, auf deutsch »Atomraketenangriff« – wurden überall auf der Welt Informationen gesammelt, die auf einen angenommenen atomaren Erstschlag des Westens hinweisen könnten. Es herrschte eine hysterische Stimmung. Als am 29. September 1983 in der sowjetischen Kommandozentrale Serpuchowo-15 Atomalarm ausgelöst wurde, weil angeblich 5 US-Raketen anflogen – in Wahrheit handelte es sich um eine ungünstige Sonnenreflektion – stoppte Oberstleutnant Stanislaw Petrow in letzter Sekunde einen Gegenangriff. Das Manöver »Able Archer« im gleichen Jahr brachen die USA ab, weil die Sowjetunion wegen der Beteiligung der Staatschefs daran den unmittelbar bevorstehenden Kriegsausbruch befürchteten. Auf dem Flugplatz Groß Dölln in der DDR standen schon die Bomber mit Atomwaffen und vorgewärmten Triebwerken für den Gegenschlag bereit.
Der britische Geheimdienst wusste durch den Doppelagenten Oleg Gordijewski, 1938 in Moskau geboren und 1974 in Dänemark vom MI 6 angeworben, von der Gefahr. Der Russe diente seit 1982 als stellvertretender KGB-Resident in London.
Vor diesem großen Hintergrund gewannen auch die »kleinen« Mosaiksteinchen, wie sie die Gruppe um Luise Walter beschaffte, an Gewicht. Deren Arbeit wurde immer gefährlicher. Sie stand längst im Visier der Stasi, doch die hatte keine Beweise in der Hand.
Das war auch ein Verdienst der »stillen« Mitarbeiter, zum Beispiel des Kuriers Albert. Er lebte in Potsdam ein unauffälliges Leben, schwamm in der SED mit und erledigte die regelmäßigen Fahrten nach Berlin, wo weitere Helfer warteten.
Dass auch er von einem politischen Motiv für die Spionage getrieben war, erfuhr Jan Weiß erst nach mehr als 20 Jahren ihrer Bekanntschaft während der konspirativen Autofahrt. Wieder lagen die Gründe weit zurück. »Die Befreier haben mich damals wegen meiner HJ-Jacke fast totgeprügelt«, erzählte Albert. Doch das war nicht alles. Immer wieder wurde die Mutter auf der Kommandantur vergewaltigt. Sie starb früh. Albert: »Da hat sich was eingebrannt.«
Luise Walter war inzwischen verstorben. Nach dem Ende der DDR wurde ihre Urne in aller Stille nach England geschafft.
Werner Buschmann lebte derweil im Westen. Jan und Albert spürten, wie sich das Netz der Stasi langsam über ihnen zusammen zog. Dennoch machten sie weiter. Vielleicht hatte Jan Weiß einfach Glück. Schon vor Jahren erschoss sich ein hoher Funktionär seines Kreises, weil die Stasi seiner Spionage für den Westen auf die Spur gekommen war. Die meinte daraufhin, damit das »reaktionäre Nest« ausgerottet zu haben. Das vertraute ein Stasi-Offizier Jan Weiß an, der noch in der Wendezeit auf ihn baute und ihn als Spitzel in eine der sich gerade bildenden neuen politischen Organisationen einschleusen wollte: »Sie hatten einige Leute in ihrer näheren Umgebung, die stuften wir wirklich als gefährliche Gegner unserer gemeinsamen Sache ein.« Und unverblümt sagt er ihm auch: »Wir hatten sie lange im Verdacht, dass sie für eine feindliche Organisation arbeiten.« Über zehn Jahre dauerte die Beobachtung, doch Jan Weiß hatte sich nie eine Blöße gegeben, an der die Stasi einhaken konnte.
Mit der gewohnten Überheblichkeit erklärt ihm nun der Stasi-Mann: »Sie hätten auch nicht die Nerven dazu gehabt. Für irgendeinen ausländischen Nachrichtendienst zu arbeiten. Sie waren sie einfach zu klein, von der Funktion her gesehen, um denen dort Nachrichten von Interesse zu übermitteln.«
Es war die Arroganz der Macht, die die Stasi an der Agentengruppe von Luise Walter scheitern ließ. Sie erlaubte es ihr nicht, die politischen Motive zu erkennen. Die Stasi fahndete nach Söldnern. Das Ausgeben von ein paar Westmark im Intershop hätte sie vielleicht fündig werden lassen. Doch die Leute waren keine Söldner. Sie hatten ihre Gründe für das, was sie taten.
Das scheint nicht einmal Spionagechef Markus Wolf richtig begriffen zu haben. Lange nach dem Ende der DDR meinte er: »Wir haben nicht gegen Feindbilder gekämpft, wir haben Feinde gehabt.« Dass sich manche die DDR im Laufe ihrer Geschichte selbst herangezogen hatte, schien er vergessen zu haben.
ZWICKMÜHLEN
Mit jedem Schienenstoß drückt das Auto auf dem Bundesbahn-Rungenwagen dem unter ihm liegenden jungen Mann auf die Brust. Trotzdem traut der sich nicht, in Berlin-Wannsee den heimlich geenterten Autoreisezug zu verlassen. Die unbemerkt überquerte DDR-Grenze liegt gerade vier Kilometer hinter ihm. Er fährt weiter bis nach Grunewald. Mit einem Schotterstein in der Hand – »für alle Fälle« – rutscht er die Bahnböschung hinunter. Ringsum stehen gediegenen Villen, warmes Licht hinter den Fenstern. Der Mann wischt sich den Schweiß vom verdreckten Gesicht und schlägt einen Feuermelder ein. Er wagt es nicht, so schmutzig und abgerissen, an einem der Häuser zu klingeln. Wenig später bringt ihn ein Rettungswagen der Feuerwehr in ein Krankenhaus. Das Ende einer Flucht nach West-Berlin.
Günter Laudahn aus Bergholz-Rehbrücke ist 32 Jahre alt und möchte im Westen ein neues Leben beginnen. Dazu sah er in der DDR keine Chance mehr. Der junge Elektroingenieur arbeitete in der Projektierung des »Sonderbaubüros Potsdam«. Das erledigte Aufträge der sowjetischen Besatzer und der Nationalen Volksarmee und wollte den verlässlichen Mitarbeiter nicht so einfach gehen lassen. Aber Günter Laudahn musste weg, denn Ende 1962 war seine Ehe geschieden worden. Die beiden Kinder blieben bei der Frau. Laudahn: »In der DDR war es ja so: Wenn man nicht die Freistellung des Betriebes bekam, konnte man sich auch keine andere Arbeit suchen. Ohne Arbeit gab es aber keine eigene Wohnung und ich hätte noch ewig mit meiner geschiedenen Frau unter einem Dach leben müssen. Das hat mir gestunken.« Er hoffte, im anderen Teil Deutschlands einen neuen Anfang zu finden.
Da gab es nämlich noch etwas: Günter Laudahn wollte mit Politik eigentlich nichts zu tun haben. Doch das passte nicht in die Zeit, in der Bekenntnisse gefordert waren. Das Bekenntnis zur Mauer, die seit gut einem Jahr stand, das Bekenntnis zur DDR, die massiv aufrüstete und das Bekenntnis zum Frieden, dem die Militärbauten seines Betriebes angeblich dienten. Er mochte dazu nichts sagen: »Ich war da mehr so eine Art Außenseiter.« Das blieb »im Kollektiv« nicht verborgen. Ein wohlmeinender Kollege nahm den jungen Ingenieur beiseite. Laudahn: »Das war ein Mann, der auch mal ein offenes Wort sprach und nicht nur die SED-Propaganda vertrat. Er sagte mir eines Tages, ›Günter, das Schwein, das seinen Stempel aufgedrückt bekommen hat, geht auch zum Schlachthof. Früher oder später.‹ «
Günter Laudahn bekam es mit der Angst. Er sah nur noch in der Flucht einen Ausweg. Anfang Dezember 1962 beobachtete er, wie die Grenze um die West-Berliner Exklave Steinstücken mit einem Zaun und Scheinwerfern ausgebaut wurde. »Mir war klar, wenn du abhauen willst, musst du dich beeilen. Sonst ist alles dicht«, erinnert sich der Mann.
Eines Nachts schlich er sich an die Gleise: »Auf dem Kontrollweg lief eine Katze. Ich dachte mir, wo eine Katze ist, ist kein Hund und wo kein Hund ist, ist kein Posten. Dann kam der Zug, auf den ich aufgesprungen bin.« Es war der 10. Dezember 1962.
Nach einer heißen Dusche im Krankenhaus landete Günter Laudahn im Notaufnahmelager Marienfelde. Dort hatte er gleich nach der Röntgen-Untersuchung die »Sichtungsstellen« des amerikanischen, britischen und französischen Geheimdienstes zu passieren. Natürlich fiel den Profis die bisherige Arbeitsstelle des Jung-Ingenieurs auf: Das Sonderbaubüro Potsdam. Er erzählte auch freimütig, dass er mal eine Lehre als Metallflugzeugbauer begonnen habe, bevor er auf Elektroinstallationen umsattelte. Misstrauisch war Günter Laudahn nicht, schließlich wollte er im Westen ein neues Leben beginnen. Dann folgten die nächsten zehn, noch ausstehenden Stationen des Notaufnahmeverfahrens von der Zuständigkeitsprüfung bis zur Transportstelle.
Die karge Kantine mit ihrem Blechgeschirr, die schmucklosen Zimmer, nur mit drei oder vier Betten, Tisch und Stuhl möbliert und das endlose Warten vor Bürotüren, bei denen niemand wusste, was sich dahinter verbarg, dämpften den Traum von der großen Freiheit. »In der Stadt« glitzerten Weihnachtsdekorationen, das Tannengrün mit Kerze im neblig-nasskalten Lager machte alles nur noch schlimmer. Günter Laudahn war froh, als ihm jemand den Umzug in ein anderes Lager anbot. Oberursel im Taunus. »Dort werden sie betreut und verwöhnt, haben sie mir versprochen«, erzählt der Mann und das schien auch zu stimmen.
Dass der amerikanischen Geheimdienst CIA im Camp King in Oberursel seinen Nachwuchs ausbildete, ahnte Günter Laudahn damals nicht. Er nahm ohnehin sein Schicksal in die eigenen Hände. Beim Arbeitsamt fand er eine Stelle bei der »Starkstrom-Anlagen-Gemeinschaft«. Wenig später zog er nach Rendsburg in Schleswig-Holstein an den Nord-Ostsee-Kanal.
Dort tauchte bald ein Mann auf, der sich nach seinem Wohlbefinden erkundigte. »Er fragte, ob ich mich eingelebt habe, und lud mich ins Theater ein. Auch mal auf ein Bier. Durch die Trennung von der Familie fühlte ich mich ziemlich einsam.« Die beiden freundeten sich an. Laudahn: »Ich hatte ja niemanden. Er war großzügig, wir gingen essen und sahen uns die Gegend an.« Der neue Freund erzählte, dass er Briefmarken sammle, und Günter brachte ihm die bunten Bildchen von seinen DDR-Briefen mit.
Dann hatte der neue Kumpel eines Tages eine Bitte: »Er fragte mich, ob seine Bekannten im Osten nicht an meine Adresse schreiben und ich die Briefe dann weiterleiten könnte. So würden sie Ärger in der DDR vermeiden. Natürlich wollte ich helfen.« Günter Laudahn war froh, sich endlich mal bei seinem vermeintlichen Freund ein bisschen revanchieren zu können.
Dass das Ansinnen etwas merkwürdig war, fiel ihm nicht auf und er dachte nicht groß darüber nach. Erst Jahre später weiß er: »Da hätten mir schon die Ohren klingeln müssen. Aber ich war angespannt und habe mir keinen Kopf gemacht. So ging es dann weiter. Ich bekam hin und wieder kleine Aufträge und erledigte sie.«
Ohne es zu ahnen, steckte Günter Laudahn bereits in der Zwickmühle des amerikanischen Geheimdienstes CIA. Geschickt brachte sein »Freund« das Gespräch darauf, dass er sich doch auch für Flugzeuge interessiere. Er habe da eine Bitte: Ein anderer Bekannter von ihm, ein Pilot, sei auch aus der DDR geflohen. Natürlich habe der sehr schnell wieder einen gut bezahlten Flieger-Job bekommen, doch er fühle sich sehr einsam. Vielleicht könne Günter sich mal mit ihm treffen und ihn ein bisschen aufrichten, so von Landsmann zu Landsmann. Gleichzeitig würde man auf dem Flugplatz interessante Maschinen sehen und so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Natürlich sagte Laudahn zu. Der Pilot empfing ihn sogar in voller Montur und der Freund schoss jede Menge Erinnerungsfotos.
Inzwischen redete der mit Günter auch über die große Politik. Die Amerikaner kämpften für die Freiheit in Vietnam, Günter kenne das ja noch aus der DDR, wie die Kommunisten im geteilten Land die Menschen unterdrückten. Genauso sah es nun im Fernen Osten aus. Auch Korea und Vietnam waren geteilt. Aus Pjöngjang waren ständig Kriegsdrohungen zu hören und Hanoi wollte den Süden erobern. Die Freiheit war in Gefahr. In Deutschland könnte es von heute auf morgen genauso aussehen. Zum Glück waren ja die Amerikaner da. Aber deren Stärke lag in der Luft. Das hatten sie ja mit der Versorgung Berlins über die Luftbrücke bewiesen. Günter kenne sich doch aus mit Flugzeugen: Wenn der Russe da auf einmal die neue MiG 21 einsetzt, wird’s zappenduster. Dann wäre die Lufthoheit futsch. Dagegen müsse etwas getan werden. Laudahn: »Er sagte mir, die Amerikaner brauchten eine MiG 21, um Gegenmaßnahmen treffen zu können. Das habe ich eingesehen.« Fast schon feierlich verkündete der »Freund«: Du kannst dabei helfen! Du und kein anderer!
Natürlich würde ihn das nicht in Gefahr bringen, dafür stehe der Freund ein. Keine große Sache, nur eine Nachricht solle Günter nach Ost-Berlin bringen. Dort gebe es einen Mann bei der DDR-Fluggesellschaft »Interflug«, dessen Bruder bei den Luftstreitkräften der NVA arbeite. Diesen Interflug-Mann müsse jemand kontaktieren, alles weitere wäre dann nicht mehr seine Aufgabe. Passieren könne dabei überhaupt nichts, denn es würde nur die mündliche Botschaft geben und im Übrigen sei der Pass so präpariert, dass niemand im Osten merken würde, dass Günter Laudahn mal »Republikflüchtling« war.
Er sagte zu, machte ohne jegliche Probleme einen Probeausflug nach Ost-Berlin und nahm beim nächsten Besuch Kontakt zu dem Interflug-Piloten auf: »Ich habe ihm Grüße von seinem republikflüchtigen Freund aus dem Westen ausgerichtet und die Fotos gezeigt, auf dem ich mit ihm vor den Flugzeugen stand.« Ein weiteres Treffen wurde vereinbart, diesmal im Interflug-Wohnheim in Berlin-Grünau. Wieder schien alles gut zu klappen. Laudahn: »Mir war das schon ein bisschen unheimlich, denn es war ja militärisches Gelände. Ich bat den DDR-Piloten, mit mir in den Wald spazieren zu gehen. Dort machte ich ihm das Angebot, eine MiG 21 mit möglichst vielen Ausrüstungsgegenständen in den Westen zu bringen. Dafür würde es für ihn eine gute Aufwandsentschädigung geben.« Wie viel die Amerikaner zahlen wollten, wisse Günter Laudahn nicht, dass müsse der Pilot direkt verhandeln. »Ich sagte ihm, dass auf einem Müllhaufen in der Nähe ein Mauerstein liegen würde, darin war ein Funkgerät. Wenn man an den Stein klopfte, kam es zum Vorschein. Über dieses Gerät könne er alles selbst verhandeln. Um zu beweisen, dass mein Angebot sauber sei, bot ich ihm im Auftrag der Amerikaner an, Ort und Zeit festzulegen, zu der ein US-Hubschrauber dann dreimal über einer bestimmten Stelle kreisen würde oder ein amerikanisches Auto in einer bestimmten Ost-Berliner Straße kurz halten würde.«
Damit war Günter Laudahns Auftrag erledigt. »Der Pilot hat sich nicht groß geäußert, aber er hat mich auch nicht verpfiffen. Ich war heilfroh, als es vorbei war, ich war da schon auf heißer Sohle unterwegs.«
Erleichtert stieg er in die S-Bahn Richtung Friedrichstraße. Bei der Ausreise im »Tränenpalast« wurde Günter Laudahn von Mitarbeitern des Ministeriums für Staatssicherheit verhaftet. Er ahnte nicht, dass sie längst jeden seiner Schritte observiert hatten. Es ging ins Stasi-Gefängnis nach Hohenschönhausen.
»In gewisser Weise habe ich mich schuldbewusst gefühlt, weil ich illegal in die DDR eingereist war und weil ich diesen Piloten zum Verlassen der DDR mit der MiG verführen wollte. Da habe ich mich schon etwas schuldbewusst gefühlt«, erinnert sich Günter Laudahn: »Wie das alles ausgehen könnte, daran habe ich damals überhaupt nicht gedacht.«
Er erfuhr es ein paar Monate später vor dem Obersten Gericht der DDR. Im August 1966 begann sein Prozess, Anklage: Spionage im besonders schweren Fall. Bis dahin war Günter Laudahn für seine Verwandten verschollen, er bekam die Anklageschrift nicht zu Gesicht und erst kurz vor Verhandlungsbeginn tauchte ein von der Stasi bestellter Rechtsanwalt auf. Der teilte den Angeklagten lapidar mit, ihm seien ohnehin die Hände gebunden.
Erst im Gerichtssaal erfuhr Günter Laudahn, dass mit ihm zwei weitere Männer angeklagt waren. »Die standen wegen Zuhälterei vor dem Kadi. Warum dieser Prozess gemeinsam mit ihnen durchgeführt worden ist, war mir völlig unklar. Ich habe mir dann gedacht, alles solle wohl dazu dienen, noch einmal zu begründen, dass die Mauer nötig und rechtskräftig war.«
Der Vorsitzende Richter spannte den Bogen noch viel weiter: »Die von den Angeklagten begangenen Verbrechen stellen sich – ob es sich um den Spion Laudahn oder die Grenzprovokateure Hanke und Becker handelt – als unmittelbare Unterstützung der aggressiven Gewaltpolitik der revanchistischen und militaristischen Kreise der Bonner Regierung und des Westberliner Senats dar, die die Welt in die Katastrophe eines mit Atom- und Raketenwaffen geführten Dritten Weltkriegs zu stürzen droht.« Dem Angeklagten schwirrte der Kopf von den großen Worten. Er, der Elektro-Ingenieur aus Potsdam, der eigentlich nichts weiter wollte, als die kaputte Familie zu verlassen und im Westen ein neues Leben anzufangen, sollte nun plötzlich einen Krieg vom Zaun brechen? So wie 30 Jahre zuvor Hitler – Günter Laudahn verstand das alles nicht: »Mir ging alles durcheinander. Ich konnte nicht richtig denken. Die Einsamkeit in der Zelle und nun dieses große Theater, das hat mich ziemlich kaputt gemacht.«
Doch unerbittlich folgte das Spektakel einer vorgegebenen politischen Linie. Darüber war auch in der SED-Zeitung »Neues Deutschland« ausführlich zu lesen: »Alle ihre Taten – Spionage, Verrat, Provokation, Terror, Entführung, Grenzverletzung und mehr – stellen sich schon an diesem ersten Tag des Prozesses als Teile eines größeren Planes dar. Durch eine Anzahl vieler ›kleiner Schritte‹ die DDR zu unterminieren, sturmreif zu machen für die geplante Aggression. Der Prozess zeigt den Aggressoren die Grenzen ihrer Macht.«
Langsam begriff Günter Laudahn die ihm zugedachte Rolle in dem Spektakel: »Im Gericht wurde dargestellt, dass die beiden Mitangeklagten und ich eine Bande waren, die die DDR zerstören wollte.« Wie er das hätte tun sollen, weiß er nicht: »Die Anklage behauptete, ich wollte den Dritten Weltkrieg heraufbeschwören, aber das war mir völlig fremd. Es wurde erklärt, die MiG wäre in Richtung Westdeutschland geflogen und wäre dort in Kampfhandlungen verwickelt worden, die dann zu militärischen Großeinsätzen geführt hätten. Das wurde in den Reden der DDR-Staatsträger so langatmig dargestellt, dass es mir nicht in den Kopf hinein ging.« Irgendwann schaltete Günter Laudahn einfach ab.
Am Mittwoch, den 10. August 1966, wurde das Urteil für die zwar geplante, aber nicht zur Ausführung gekommene Tat gesprochen: Lebenslänglich für Günter Laudahn, zehn und sechs Jahre für die anderen beiden Angeklagten.
Der Mann war 36 Jahre alt und wusste nicht so recht, wie ihm geschah: »Beim Urteil ›lebenslänglich‹ ist man in so einer Leck-mich-am-Arsch-Stimmung, dass man darüber überhaupt nicht nachdenkt.« Nur das Gefühl sagte, dass irgendetwas nicht stimmen könne. Günter Laudahn: »Bei der Urteilsverkündung habe ich mich mit dem Rücken zum Gericht gedreht. Daraufhin wurde ich von den beiden Stasi-Leuten zurecht geboxt, mit der Aufforderung, die Richter anzusehen. Ich habe es trotzdem nicht getan – das war mein einziger Protest.«