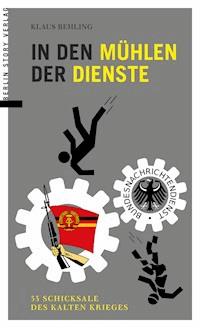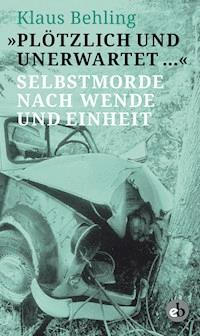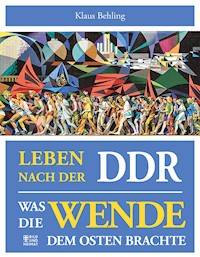Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition berolina
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Deutsche Demokratische Republik existiert seit bald 30 Jahren nicht mehr, aber die erregten Kämpfe um die Interpretation ihrer Geschichte halten unvermindert an. Kaum eine Stimme in den hitzigen Diskussionen, die dabei nicht für sich beansprucht, die Fakten "richtig" auszulegen. Doch wie war er denn nun beschaffen, dieser untergegangene deutsche Staat? Welche Bedingungen bestimmten das Leben der DDR-Bürger? Und warum war nach vier Jahrzehnten Schluss? Fernab jeden Anspruchs auf Deutungshoheit oder Vollständigkeit lotet Bestsellerautor Klaus Behling in einem umfangreich recherchierten und packend geschriebenen Kaleidoskop 40 Jahre DDR-Historie aus. 111 interessante, tiefgreifende, brisante, traurige, schaurige, witzige, in jedem Fall aber lehrreiche und neugierige Fragen stellt er sich und seinen Lesern zur Beschaffenheit der DDR, aus deren Beantwortung ein kundiges und im besten Wortsinne populäres Sachbuch entstanden ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaus Behling
Leben in der DDR
Vergessenes aus der Geschichte in 111 Fragen
edition berolina
eISBN 978-3-95841-551-5
1. Auflage
© 2017 by BEBUG mbH / edition berolina, Berlin
Umschlaggestaltung: BEBUG mbH, Berlin
Umschlagabbildung: © Gesine Wintsche / Fotolia
Alexanderstraße 1
10178 Berlin
Tel. 01805/30 99 99
FAX 01805/35 35 42
(0,14 €/Min., Mobil max. 0,42 €/Min.)
www.buchredaktion.de
Ein Wort voraus
Wie aus Mosaiksteinchen Bilder werden
Zeitungen von gestern sind das Papier, in das früher gern Fische eingewickelt wurden, manche Akten bekommen ihr Gewicht erst durch dicke Staubschichten, und Zeitzeugen müssen oft ertragen, als Besserwisser verspottet zu werden. An die Stelle von Informationen treten häufig Legenden.
Bilder, die sie illustrieren, werden zu Symbolen. Ist heute von der DDR die Rede, fehlen weder wogende Fahnenmeere über enthusiastischen Demonstranten, gereckte Fäuste und klirrende Militärparaden noch der Steinewerfer gegen einen sowjetischen Panzer 1953, der Mauer-Maurer aus dem August 1961 oder die verrotteten Straßenzüge in den kleinen und großen Städten. Alles endet mit den Bildern der Menschenmassen gegen Polizeiketten in Leipzig im Herbst 1989 und hämmernden »Mauerspechten« in Berlin.
Vierzig Jahre Geschichte im Zeitraffer – und ein jahrzehntelanges Nachspiel um deren Deutungshoheit. Argumente der einen wie der anderen Seite zählen da wenig. Wie schon oft in der Geschichte haben jene mehr Gewicht, die laut und grell oder auch leise und subtil ihre Standpunkte verbreiten können. Man könnte sie Sieger nennen. Mit Blick auf die DDR wäre es sogar legitim, denn sie hat den »Wettlauf der Systeme« ausgerufen und ihre Politik daran orientiert. Dennoch ist das Überwinden der Teilung eines durch Heißen und Kalten Krieg geteilten Landes kein »Sieg« des einen über den anderen. Trotzdem gibt es dieses Gefühl. Es lebt von einem offenbar neuentstandenen »Wir« und »Ihr« und findet gern im etwas trotzigen »Es war nicht alles schlecht« seinen Ausdruck. Fast dreißig Jahre Entwicklung genügen nicht, dem das sicher klügere »Es war nicht alles gut« entgegenzusetzen. Die Sichtweisen bleiben parteilich, und sie sind schwer zu verdauen, denn die eine wie die andere enthält Fakten und Argumente, die zum Geschehen gehören.
Vielleicht helfen da die Bilder doch ein wenig. Fotos und Filme lügen nicht. Aber sie können trügen. Sie fassen zusammen, was mit wenigen Worten kaum zu umreißen ist, öffnen den Blick hinter das Gezeigte und lassen der Phantasie freien Raum. Ihn auszufüllen, ist ein sehr persönlicher Vorgang. Waren für die einen die DDR-Jahre die schönste Zeit ihres Lebens, litten andere unter der Bedrückung zwischen Stasi und Schrankwand.
Allein schon deshalb scheint es recht kühn, einen Titel wie Leben in der DDR aufs Papier zu bringen. Es sollen doch nur ein paar Dinge festgehalten werden, die fast vergessen sind, sich erst nach dem Ableben des Staates herausstellten oder vielleicht sogar unwichtig waren. Müsste es nicht exakter heißen: »Einige Aspekte aus der Geschichte der Deutschen Demokratischen Republik unter Berücksichtigung ihrer damaligen Entwicklung im Nachkriegsdeutschland auf der Grundlage der von der sowjetischen Besatzungsmacht importierten Ideologie in ihrer Stalinschen Ausprägung des Marxismus-Leninismus«. – Unsinn.
Am 15. April 2017 starb Emma Morano mit 117 Jahren in ihrer Wohnung in Verbania am Lago Maggiore. Sie war die letzte bekannte Erdenbürgerin aus dem 19. Jahrhundert. Demnach könnte der letzte DDR-Geborene durchaus bis zum Jahr 2108 leben. Kleiner Tipp am Rande: Vor ihrem letzten Geburtstag verriet Emma einem Journalisten ihr Geheimnis: »Ich esse jeden Tag zwei Eier, und das ist es.« Und das ist dann schon wieder so eine Geschichte der Art, wie sie hier erzählt werden soll.
Also ein Vorschlag zur Güte: Alle, die vor dem 3. Oktober 1990 geboren wurden, sind Zeitzeugen, und jeder von ihnen hat ein Recht darauf, sich an genau das zu erinnern, was sich im Laufe der Zeit für ihn vergoldet oder ihn besonders bedrückt hat. Gleichzeitig kann und darf er jenes vergessen, was ihm schon damals nicht gefiel. Um die daraus zwangsläufig entstehenden Lücken zu füllen, gibt es ja die nicht als Einwickelpapier geendeten Zeitungen und die vergilbten Akten.
All diese Informationen zusammen sind Mosaiksteinchen, aber noch lange kein allumfassendes Bild. Wie es aus solchen Teilchen entsteht und wo seine Grenzen liegen, hat Walter Womacka demonstriert, als er Anfang der 1960er Jahre das Haus des Lehrers am Ostberliner Alexanderplatz mit einem 7 Meter hohen und 125 Meter langen Fries verzierte.
Bei einem Besuch in seinem Atelier am 4. Oktober 2004, fast genau vierzig Jahre nach Vollendung der »Bauchbinde«, erinnerte er sich: »Ja, das war damals der Traum, den ich träumte. Aber meine Vision entstand nicht im luftleeren Raum. Sie hatte ihre Wurzeln in fast 20 Jahren DDR-Geschichte. Der Auftrag hieß ›Unser Leben‹. Ich glaubte damals daran, meine Vorstellung davon noch zu erleben. Natürlich konnte ich auch auf den riesigen 875 Quadratmetern nur einen Ausschnitt darstellen, ein Bild des Bildes sozusagen.«
In Zeiten von Giga- bis Terabyte weiß jeder, dass Bilder umso deutlicher werden, je mehr Daten zur Verfügung stehen. Womacka fügte rund 800.000 Mosaiksteinchen zusammen. Eine ganze Menge, wie es scheint – aber ein Foto von 12 mal 15 Zentimetern hat heute mindestens zwei Millionen Pixel.
Ende 1989 lebten 7.873.300 männliche und 8.560.496 weibliche Personen in der DDR. Viele von ihnen hatten deren 14.970 Tage vom ersten bis zum letzten erlebt, manche nur einen Teil davon. Aber an jedem dieser Tage lebten sie und erlebten ihn immer wieder anders. Allein diese Zeit mit den Menschen multipliziert, ergäbe also schnell eine Unzahl von Informationen. Jede von ihnen wäre interpretierbar, denn was den einen erfreute, ärgerte den anderen, was gestern noch ein großer Traum war, schien bald nicht mehr genug. Es gab die einen, für die alles gut war, und die anderen, für die alles schlecht war. Ein pauschales »Wie war’s denn so in der DDR?« gibt es nicht.
Soll trotzdem eine Vorstellung der Vergangenheit entstehen, sind Kompromisse gefragt. »Wer«, »warum«, »wieso«, »weshalb« bilden dabei das Koordinatensystem. Um es auszufüllen, sind mitunter mehr Zahlen nötig, als sich gut lesen lassen, an anderer Stelle erfordert der kurze Sinn einer langen Rede schon einmal ein paar Punkte im Zitat.
Das alles endet im ebenso sprichwörtlichen wie praktisch unmöglichen »Sitzen zwischen den Stühlen«. Trotzdem bleibt es die Suche nach den Grautönen im allzu vielen Schwarz oder Weiß. Im Blick auf die Geschichte hat nicht der eine recht und der andere unrecht, sondern jeder sein eigenes Bild.
I. Politik und Überleben
Wie unterschieden sich DDR und Nazi-Diktatur?
Feldgrauer Stechschritt von Wehrmacht und NVA, trommelnde Jungen, erst in braunen, dann in blauen Hemden, Fackeln, Fahnenmeere und Parolen, Massenaufmärsche und eine Militarisierung von der Sprache bis zum Umgang der Behörden mit ihren Untertanen machen es leicht, die Diktatur in der DDR mit der vorangegangenen Diktatur der Nazis gleichzusetzen.
Dennoch wäre diese Klammer um die »beiden deutschen Diktaturen« nichts anderes als ein oberflächlicher Befund ohne Blick auf die Hintergründe. Die Gratwanderung zwischen Dramatisierung und Verharmlosung beider Systeme wäre von vornherein gescheitert. Wütende Reaktionen darauf auf beiden Seiten würden den Blick auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten verstellen – und so das Ziel eines jeden Vergleichs verwischen.
Die gravierenden Unterschiede begannen mit der Errichtung der jeweiligen Diktatur. Die Nazi-Herrschaft fußte auf einer Verachtung der Weimarer Demokratie, die auch unter deutschen Kommunisten verbreitet war. In rasantem Tempo konzentrierte sie sich auf die Herrschaft einer einzigen Partei, ihre Mitglieder besetzten alle wichtigen Stellen im öffentlichen Leben. Gleichschaltung ersetzte die bisherige Gewaltenteilung. Ministerien, Behörden und Verbände wurden der NSDAP unterstellt. Die Machtausübung war total und national orientiert.
Im Gegensatz zu diesem »Nationalsozialismus« als hausbackene deutsche Hervorbringung wurde die kommunistische Herrschaft nach der Zerschlagung des NS-Regimes aus der Sowjetunion importiert. Auch sie verfolgte den totalen Herrschaftsanspruch, beschränkte sich aber nicht auf nationale Grenzen. Der Export des sowjetischen Systems in seiner bereits durch Stalins Diktatur erfolgten Deformation des »Sozialismus« diente dem Aufstieg zu einer Weltmacht und der Sicherung der im Krieg erkämpften Expansion.
So hatten äußerlich gleiche Erscheinungsformen unterschiedliche politische Hintergründe.
Die wirtschaftliche Grundlage des NS-Regimes blieb – trotz heftiger antikapitalistischer Rhetorik und umfangreicher Zwänge der Kriegswirtschaft – stets das Privateigentum. Die wirtschaftlichen und sozialen Eliten Deutschlands ermöglichten und trugen die Herrschaft des »Führers«. Sein Ende ging mit der physischen Vernichtung riesiger Landesteile einher, wurde von Millionen alliierter Soldaten erzwungen, gegen die das eigene Volk die Nazi-Herrschaft erbittert verteidigte.
Ein radikaler ökonomischer und sozialer Umbruch nach sowjetischem Vorbild führte zur Gründung der DDR. Um neue Machtstrukturen zu errichten, wurden die alten beseitigt. Die Teilung Deutschlands erleichterte eine soziale Spaltung des Volkes, weil sie Alternativen für jene bot, die aus politischen Gründen nun zu unterdrücken waren. Viele von ihnen wanderten in den Westen ab. Am Ende erfolgte der Zusammenbruch des DDR-Regimes nahezu widerstandslos im tiefsten Frieden ohne die Bedrohung anderer Staaten.
Während ihrer gesamten Existenz blieb die DDR Teil der sowjetischen Globalpolitik. In dieser Rolle nahm sie an der Entspannungspolitik zwischen Ost und West teil. Das kostete sie letztlich ihre Existenz. Das NS-Regime trat dagegen als aggressive Großmacht an, die Eroberung und Unterwerfung ganzer Völker zu ihrem Ziel machte. Sein Untergang war die Folge.
Wer den Vergleich von NS- und DDR-Diktatur grundsätzlich ablehnt, setzt meist bei den ungeheuerlichen Verbrechen der Nazis gegen die Juden und andere Volksgruppen an. Diese Mordtaten sind nicht zu relativieren und bleiben ein barbarischer Zivilisationsbruch. Er darf nicht zur »Entschuldigung« anderer totalitärer Formen der Machtausübung dienen, egal, wo sie auf der Welt stattfinden. Vor diesem Hintergrund ist die NS-Diktatur mit nichts vergleichbar, auch nicht mit diktatorisch verursachtem Unrecht in der DDR.
Es gibt aber Wege in totalitäre Strukturen. Sie müssen erkannt werden, um gegen sie einen demokratischen Grundkonsens setzen zu können. Dabei ist es keineswegs eine Denunziation, die DDR als Diktatur zu bezeichnen. Sie selbst hat die »Diktatur des Proletariats« als Weg der Machtergreifung und -sicherung propagiert. Diese Politik stützte sich auf Lenin, der in Staat und Revolution darlegte, was er für die zeitlich nicht definierte »Übergangsperiode« darunter verstand: »Diktatur bedeutet … eine unbeschränkte, sich auf Gewalt und nicht auf Gesetze stützende Macht.«
NS- wie DDR-Diktatur fußten auf Ideologie. Allein das verleitet zum Vergleich. Ob Massenmobilisierungen oder Jugendkult, die Kontrolle und Instrumentalisierung sämtlicher Medien oder geheimpolizeiliche Aktivitäten, der mit Machtmitteln durchgesetzte Anspruch der Meinungsführerschaft in der Kultur und im gesamten geistigen Leben – das alles sah sehr ähnlich aus. Beide Diktaturen pflegten ihre Feindbilder und verlangten von ihren Untertanen Gefühlsäußerungen wie »Liebe«, »Fanatismus« oder »Hass«.
Auch bei der Machtausübung lassen sich Gemeinsamkeiten finden. Sie liegen in der Ablehnung der Gewaltenteilung und deren Ersatz durch ein »Führerprinzip«. In der DDR wurde dies als »kollektive Führung der Partei« propagiert und von einer relativ kleinen Elite praktiziert. Daraus folgte die Ablehnung einer unabhängigen Justiz und schließlich der Gebrauch der Sozialpolitik als Ersatz von Bürgerrechten.
Dafür, eine Diktatur jedoch einfach nur als Fortsetzung der vorangegangenen zu sehen, reichen diese Indizien nicht aus. Das Bindeglied zwischen beiden bilden die Menschen. Die Deutschen in West wie in Ost waren am Beginn ihrer Teilungsgeschichte von der NS-Diktatur sozialisiert. Dies hier wie dort weitgehend geleugnet und verwischt zu haben, ist eine Grundlage des heute wohlfeilen Vergleichs von DDR und NS-Regime. Historisch haltbar macht ihn das nicht.
Was waren Neulehrer und Volksrichter?
Als Alfred Wellm 1968 seinen Roman Pause für Wanzka vorlegte, rief er manch Diskussionen hervor. Sein Protagonist Gustav Wanzka begann als »Neulehrer«, hatte es bis zum Schulrat gebracht und glaubte nun plötzlich nicht mehr an die Unfehlbarkeit des DDR-Schulsystems, das auch Talente verkümmern ließ. Das sah die seit 1963 von Margot Honecker verwaltete offizielle Schulpolitik anders. »Der Mensch müsse erst bezwungen werden, … auf dass er für den Sozialismus passt …«, bemängelte Wanzka deren Credo.
Ob nun pro oder contra SED-Bildungspolitik interpretiert, der Roman belegte, wie jene in der DDR-Gesellschaft angekommen waren, die nach dem Krieg mit nicht viel mehr als gutem Willen begannen. Neulehrer und Volksrichter gehörten dazu.
Beide Berufsgruppen waren aus dem Bemühen um Entnazifizierung entstanden, die den Austausch einstiger Eliten einschloss.
Dass die Suche nach neuen Lehrern nach dem Krieg in allen vier Besatzungszonen begann, ist heute weitgehend vergessen. Im Rahmen der »Reeducation« sollte die Jugend von Anfang an eine demokratische Erziehung genießen.
Im Westen lief dazu ein umfangreiches Umschulungsprogramm für akademisch vorgebildete Bewerber an, die in maximal einjähriger Zusatzausbildung das für die Demokratie nötige Rüstzeug als Pädagogen erhielten. Ab 1947 traten nach sogenannten »Entbräunungskursen« auch frühere Lehrer mit fragwürdigem politischen Hintergrund wieder in den Schulen an.
Im Osten war die Lage prekärer und der politische Anspruch rigoroser. Durch die Entnazifizierungsmaßnahmen der Sowjetischen Militäradministration (SMAD) sank dort die Zahl der Lehrer bis 1948 von 39.348 auf 19.348. Im »Neulehrerprogramm« wurde in Vier- bis Acht-Monatskursen Ersatz geschaffen. Obwohl diese Neulehrer ihren Schülern manchmal nur um wenige Lektionen voraus waren, besetzten sie bereits 1949 etwa 67,8 Prozent aller Lehrerstellen. Knapp die Hälfte der Neulehrer, 47,7 Prozent, gehörte der SED an. Sie sicherten nicht nur die Durchsetzung der neuen politischen Linie, sondern auch den Einstieg in die spätere Reform des Schulwesens nach sowjetischem Vorbild. Die Mehrzahl der rund 40.000 bis zur Gründung der DDR ausgebildeten Lehrer blieb lebenslang im Beruf. Viele holten in jahrelangen Fernstudiengängen ihre Qualifizierung nach. Bis 1952 war der Lehrermangel in der DDR beseitigt.
Mit dem Beschluss des Parteivorstands der SED vom 24. August 1949, »Schulpolitische Richtlinien für die neue demokratische Schule«, wurde die künftige Lehrerausbildung geregelt.
Genauso wie Lehrer wurden nach dem Krieg auch neue Juristen gebraucht. Rund 80 Prozent der deutschen Richter und Staatsanwälte waren Mitglieder der Nazi-Partei oder einer ihrer Unterorganisationen gewesen.
Mit dem »Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der unter Artikel 131 des Grundgesetzes fallenden Personen« vom 11. Mai 1951 restaurierte sich im Westen das Berufsbeamtentum. In der Justiz führte das zu einer Dominanz NS-belasteter Juristen, die bis zur »biologischen Lösung« des Problems in den sechziger Jahren anhielt.
Im Osten waren bereits auf SMAD-Befehl vom September 1945 sämtliche NSDAP-nahen Justizbedienstete entlassen worden. Dadurch sollte nicht nur der traditionelle konservativ-autonome Korpsgeist des Justizapparats gebrochen, sondern auch der Einstieg in eine neue Rechtstauffassung ermöglicht werden. Die Justiz diente nun als Machtinstrument der herrschenden Klasse. Dennoch agierten die Sowjets entsprechend ihrer damaligen Deutschlandpolitik bis etwa 1947 zurückhaltend bei der politischen Einflussnahme. In den ab 1946 für die Ausbildung neuer Richter eröffneten Volksrichterschulen und den Zentralen Richterschulen der ostdeutschen Justizverwaltung auf Länderebene stand deshalb bis dahin die fachliche Qualifikation im Mittelpunkt. Mit Unterstützung der SMAD verlagerte sich später der Schwerpunkt auf die Politisierung der Unterrichtsinhalte. Die Ausbildungsdauer stieg von zunächst sechs Monaten schrittweise auf bis zu zwei Jahre. Die Unterordnung unter das neue Rechtsverständnis, ausgedrückt in der Bereitschaft, künftig Recht zur Herrschaftssicherung der Partei anzuwenden, bildete das Hauptanliegen der Volksrichter-Lehrgänge.
Parallel dazu etablierte sich erneut die Ausbildung von Juristen an den Hochschulen. Nachdem in der ersten Hälfte der fünfziger Jahre die Transformation der Juristischen Fakultäten im Sinne der SED-Politik erfolgt war, lieferten auch sie wieder Nachwuchs bei Richtern und Staatsanwälten. Damit galt das »Volksrichterprogramm« als abgeschlossen. Trotzdem blieb über viele Jahre das Spannungsfeld divergierender fachlicher und politischer Ambitionen erhalten. Die von führenden SED-Funktionären geforderte grundsätzliche Entakademisierung der Juristenausbildung setzte sich nicht durch.
Viele Neulehrer und Volksrichter starteten wegen der antifaschistischen Reformansätze nach dem Krieg in Ostdeutschland in den neuen Beruf. Manche verloren ihre Illusionen im Laufe der Jahre, andere wurden zu überzeugten Sozialisten, und etliche passten sich einfach an die Verhältnisse an. Im Westen wurde ihre Ausbildung nicht anerkannt.
Sie im Nachhinein lediglich als Erfüllungsgehilfen der SED-Politik zu sehen, ist ein Geschichte vergessender Blick, der nach 1990 die innere Einheit Deutschlands belastete.
Warum entstand Volkseigentum?
»Wald ist Volksgut«, stand früher oft auf Schildern neben der Straße, einfach einen Weihnachtsbaum absägen, durfte der »Eigentümer« Volk dort jedoch nicht. Warum gab es dann dieses seltsame Eigentum, und wer durfte darüber verfügen?
Dass es die Verbindung von Wirtschaft und Politik war, die 1945 das deutsche Volk in den Abgrund des Krieges geführt hatte, schien danach allen klar zu sein: »Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden. Nach dem furchtbaren politischen, wirtschaftlichen und sozialen Zusammenbruch als Folge einer verbrecherischen Machtpolitik kann nur eine Neuordnung von Grund aus erfolgen. Inhalt und Ziel dieser sozialen und wirtschaftlichen Neuordnung kann nicht mehr das kapitalistische Gewinn- und Machtstreben, sondern nur das Wohlergehen unseres Volkes sein.«
Das ist kein Propagandasatz der SED, sondern das »Ahlener Programm« der Christlich Demokratischen Union (CDU) für die britische Besatzungszone vom 3. Februar 1947. Die Politiker hatten in Düsseldorf einen radikalen Umbau ins Auge gefasst: »Die neue Struktur der deutschen Wirtschaft muss davon ausgehen, dass die Zeit der unumschränkten Herrschaft des privaten Kapitalismus vorbei ist. Es muss aber ebenso vermieden werden, dass der private Kapitalismus durch den Staatskapitalismus ersetzt wird, der noch gefährlicher für die politische und wirtschaftliche Freiheit des einzelnen sein würde.« Bereits am 15. Juli 1949 ruderten sie dann mit den »Düsseldorfer Leitsätzen« zurück.
Im Osten sah man die Verantwortlichkeit für das von den Nazis hinterlassene Desaster genauso. Die Suche nach dem Weg daraus gab die sowjetische Besatzungsmacht vor. Die Sowjetunion berief sich auf die Ideen von Karl Marx und Friedrich Engels als Leitlinien der künftigen gesellschaftlichen Entwicklung. Deren Kernpunkt war die Betrachtung der Produktionsverhältnisse als Eigentumsverhältnisse. Daraus ergab sich die Annahme, allein neue Formen des Eigentums würden den »Grundwiderspruch des Kapitalismus« – die Aneignung des gesellschaftlich erarbeiteten Produkts durch den Einzelkapitalisten – automatisch lösen.
Deshalb entstand, den »Ideen der Klassiker« folgend, neben dem privaten, persönlichen Eigentum der Bürger als Grundlage der künftigen Gesellschaft das »sozialistische Eigentum«. Es umfasste das Volkseigentum, genossenschaftliches Eigentum und Eigentum gesellschaftlicher Organisationen.
Wirtschaftlich unterschied sich Volkseigentum vom herkömmlichen Staatseigentum dadurch, dass eine geplante Fremdbewirtschaftung durch Dritte, also Bürger, Betriebe, Kombinate, »wirtschaftsleitende Organe« und gesellschaftliche Organisationen, angestrebt wurde. Das machte die Verleihung von dinglichen Nutzungsrechten nötig, die oftmals – zum Beispiel bei Grundstücken in der DDR – den gesamten wirtschaftlichen Wert verkörperten und so an die Stelle des privaten Eigentums traten. Die Überführung von Volkseigentum in Privateigentum war per Gesetz ausgeschlossen, es war unveräußerlich und unbeleihbar. In der Praxis hieß das, dem ostdeutschen Eigenheimbesitzer gehörte zwar das Haus, nicht aber das Grundstück, auf dem es stand, und der »volkseigene« Betrieb konnte sein »Eigentum« nur nach Maßgabe staatlicher Pläne nutzen.
Diese Belastung mit dinglichen Nutzungsrechten höhlte den wirtschaftlichen Wert des Volkseigentums aus. Seine Unverfügbarkeit und das Fehlen der Umlaufmöglichkeit beeinträchtigten die Kreditfähigkeit der Wirtschaft. Die mangelnde Identifizierung der Menschen mit »ihrem« Volkseigentum begründete sich in dessen Verwaltung durch den Staat. Da dieser laut Verfassung unter der Führung der SED stand, entstand für viele der Eindruck, nur eine kleine Gruppe von Leuten verfüge über das Eigentum aller.
Der Umgang des Volkes mit »seinem« Eigentum entsprach deshalb nie dem Umgang mit privatem Besitz. Überdies machten viele die Erfahrung, dass sich manche aus dem Volkseigentum schamlos bereicherten, andere jedoch für geringfügige Fehler schwer bestraft wurden. Seit dem 2. Oktober 1952 galt das »Gesetz zum Schutz des Volkseigentums und anderen gesellschaftlichen Eigentums«. Es sah bei Verstößen Strafen bis zu 25 Jahren Zuchthaus vor, schon Bagatelldelikte wurden mit einer Mindeststrafe von einem Jahr Haft geahndet. Doch das schien nicht für alle zu gelten. Hilflos mokierte sich das Volk über die »etwas Gleicheren unter den Gleichen«. Das Volkseigentum in der DDR trug bei manchen so dazu bei, Ungerechtigkeit und Hilflosigkeit bei der Gestaltung des eigenen Lebens zu empfinden.
Mit dem Ende der DDR betrachteten es nur wenige als erhaltenswert. Die mit dem ersten Treuhandgesetz zunächst eingeleiteten Bemühungen um die Aneignung des Volkseigentums durch deren Besitzer – all jene, die zum Zeitpunkt der Einheit in der bisherigen DDR lebten – fanden keine Mehrheit. Das belegten die ersten freien Wahlen am 18. März 1990. Die SPD, die für eine Verteilung dieses Eigentums plädierte, erlitt eine krachende Niederlage. Die Mehrheit der Wähler stimmte für einen schnellen Beitritt zur Bundesrepublik.
Damit setzte sich eine Neuverteilung des »Volkseigentums« durch. Es war eine Art von »herrenlosem Gut« geworden, denn das wenig später geltende Bürgerliche Gesetzbuch kannte diese Eigentumsform nicht.
Viele der eigentlichen Besitzer zogen dabei den Kürzeren.
Wurden NS-Verbrecher im Osten verschont?
Für die einen ist schon die Frage ein Sakrileg, für die anderen sind Beispiele von DDR-Karrieren ehemaliger NSDAP-Mitglieder inzwischen die liebste Entschuldigung für die braune Färbung im Westen des Wirtschaftswunders. Ein Aufrechnen nach dem Prinzip »eure Nazis, unsere Nazis« scheint ebenso wenig hilfreich wie das Absuchen der auf beiden Seiten vorhandenen Beispiele nach Trümpfen und Luschen.
In beiden Teilen Deutschlands begann am 8. Mai 1945 der Neuanfang mit genau dem Volk, dessen Mehrheit bis zum 7. Mai 1945 an den »Endsieg« glaubte. Zwangsläufig wurde aus der Kriegsgeneration in ganz Deutschland die Aufbaugeneration.
Unter den rund zwei Millionen der bis zum 13. August 1961 von Ost nach West gezogenen Deutschen waren überproportional viele frühere NSDAP-Mitglieder. Meist nicht, um im Westen wieder politisch aktiv zu werden, sondern deshalb, weil dort ihre, im Dritten Reich erworbenen Rechte – zum Beispiel Pensionen bei Beamten und deren Witwen – wieder auflebten.
Dadurch verminderte sich die Zahl potentieller NS-Täter in der DDR. Nach offiziellen Angaben wurden insgesamt 12.881 Personen wegen »Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit« zur Verantwortung gezogen. Dabei ist nicht auszuschließen, dass diese Zahl auch nicht ausreichend bewiesene Fälle, oder sogar Unschuldige, enthält. Im Zusammenhang mit den 3.482 Häftlingen, die die Sowjetunion 1950 der DDR-Justiz zur Aburteilung übergab, wurden nach der Einheit Verstöße gegen damals geltendes Recht festgestellt und sanktioniert.
In den drei Westzonen verurteilte man bis 1947 rechtskräftig 5.025 ehemalige Nazis, davon 806 zum Tode bei einer Vollstreckung von 456 Urteilen. Alles in allem mussten sich dort rund 6.500 Personen wegen ihrer Nazi-Vergangenheit den Richtern stellen. Umgerechnet auf die Bevölkerung ging der Osten also weitaus rigoroser gegen NS- und Kriegsverbrecher vor.
Ihre Verurteilung in der DDR war aber nie nur juristische Aufarbeitung, sondern immer auch Propaganda und »Klassenkampf«. In Abwesenheit geführte, aufwendige Schauprozesse vor dem Obersten Gericht der DDR gegen aktive Westpolitiker, wie Hans Globke oder Theodor Oberländer, belegen dies. Der Amsterdamer Strafrechtler Professor Christiaan F. Rüter geht davon aus, dass von den nach 1960 geführten 89 NS-Verfahren in der DDR immer noch etwa 10 einen »gesamtdeutschen Bezug« als wesentlichen Hintergrund hatten.
Nach der Einheit kolportierte Zahlen, nach denen bis zu 22.000 NS-Verbrecher in der DDR durch bewusstes politisches Handeln unbehelligt blieben, sind bislang wissenschaftlich nicht ausreichend belegt. Diese Zahl wird in der nachträglichen Auseinandersetzung gern mit der einstiger NSDAP-Mitglieder in meist mittleren Leitungsfunktionen der DDR – Ausnahme: Aufbau der NVA, bei dem auch ehemalige hohe Wehrmachtsoffiziere unverzichtbar schienen – vermischt. Damit soll suggeriert werden, dass die NS-Aufarbeitung in der DDR zumindest halbherzig erfolgte.
Das mag sein oder auch nicht – das Problem lag jedoch in ganz anderen Bereichen.
Erstens war der DDR-Umgang mit ehemaligen NSDAP-Mitgliedern zwiespältig. Passte es ins Konzept, integrierte die SED »kleine Nazis« in ihre Reihen. Im Februar 1954 ermittelte eine parteiinterne Statistik, dass sich ihr Anteil von 8,6 Prozent der Mitglieder bei den sich nun bewerbenden Kandidaten auf 9,3 Prozent erhöht hatte. Bei ehemaligen SA- und SS-Angehörigen stieg er von 6,1 auf 9,9 Prozent. Die Partei brauchte diese Leute jedoch, weil nach dem Aufstand von 1953 etwa die Hälfte aller Funktionäre ausgewechselt worden war. Unabhängig davon wurde die »Nazi-Keule« erhalten. In Personalfragebögen war Auskunft zu eigenen Dienstgraden in der Wehrmacht und zu Einsatzorten und denen von Verwandten ersten Grades zu geben. Eine besonders peinliche Ausprägung erfuhr dieser Pragmatismus in der gelegentlichen Nutzung NS-belasteter Personen durch das Ministerium für Staatssicherheit.
Zweitens war die Erklärung der Wurzeln des Faschismus in der DDR eindimensional. Sie interpretierte ihn ausschließlich sozialökonomisch als »offene terroristische Diktatur der reaktionärsten, chauvinistischsten, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals« mit dem politischen Ziel, durch einen Aggressionskrieg Maximalprofite zu erzielen. Diese Erklärung machte es den Menschen leichter, sich mit der »neuen Gesellschaft« zu identifizieren. Um gegen den Krieg zu sein, musste sich niemand automatisch für den Sozialismus engagieren. Die eindeutige Schuldzuweisung entlastete all jene, die kurz zuvor noch begeistert »Sieg Heil« gerufen hatten. Sie mutierten dadurch zu Verführten und Irregeleiteten und glitten so allmählich auf die Seite der »Sieger der Geschichte«, die aus dem Osten kamen.
Dieser Vorgang des kollektiven Vergessens fand im Westen ebenfalls statt. Er führte zur Personifizierung von einigen wenigen Verantwortlichen für die NS-Verbrechen. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung in der frühen Bundesrepublik sah sich dadurch als unbedeutende »Mitläufer« und wechselte ebenfalls schnell zu den Siegern, diesmal denen auf amerikanischer Seite.
Diese Politik mag in der Phase des Neubeginns in Ost und West notwendig gewesen sein, denn eine Dauerstimmung von Selbstanklage und Vergangenheitsbewältigung hätte hier wie dort gebremst. In der Tendenz führte sie jedoch im Westen zur Gleichgültigkeit gegenüber Schuld und Unrecht und zu sorglosem Umgang mit Demokratie und im Osten zur kritiklosen Übernahme diktatorisch geprägter Verhaltensweisen und zu mangelndem Verständnis von Totalitarismus.
War die Landwirtschaft ein Erfolgsmodell?
»Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein«, hieß es in der frühen DDR optimistisch, und tatsächlich schienen nach rund zwanzig Jahren viele Probleme auch endlich gelöst zu sein. 1968 fuhren Vollerntemaschinen fast das gesamte Getreide und die Zuckerrüben ein, die Anzahl der Traktoren hatte sich seit 1960 verdoppelt, der Viehbestand um die Hälfte erhöht, und die Hektarerträge waren zwischen 20 und 50 Prozent gestiegen. Rund zwei Drittel der LPG-Bauern verfügten über ein Facharbeiterzeugnis, über die Hälfte der Chefs hatte Hoch- oder Fachschulen absolviert. Mehr als 90 Prozent des Bedarfs der Bevölkerung an tierischen Produkten erwirtschafteten die einheimischen Landwirte.
Dabei hatte der Krieg die Landwirtschaft im Osten weit schwerer geschädigt als im Westen. Hier gab es bis zur Stunde Null die schwersten Kämpfe. Total zerstörte Dörfer ohne Vieh blieben übrig, letzte Reste requirierte die Rote Armee. Bei Kriegsende fehlten im Vergleich zu normalen Beständen 900.000 Rinder, 3,7 Millionen Schweine und 1,1 Millionen Schafe.
Hinzu kamen die politischen Veränderungen auf dem Lande, oft mit einer massiven Abwanderung gen Westen verbunden. Im Machtbereich der Roten Armee wurden rund 11.000 Güter und Bauernhöfe enteignet und zum kleineren Teil in Volkseigene Güter umgewandelt, zum größeren an etwa 232.000 landlose Familien von Flüchtlingen und Landarbeitern verteilt. Trotz Startkapitals von 2.500 Mark, Krediten und des Neubaus von über 50.000 kleinen Höfen führten die rigiden Ablieferungsregeln – bei denen größere Wirtschaften dreimal so viel zu liefern hatten wie die Neubauern – nach drei Jahren DDR in die erste große Krise. Wegen der schlechten Ernte 1952 konnten Zehntausende Bauern ihr Soll nicht erfüllen. Tausenden drohten deshalb Prozesse, mehr als 60.000 Bauern flüchteten in die Bundesrepublik. Zwischen 1953 und 1955 lag ein Fünftel des Bodens brach.
Der unmittelbar vor dem Aufstand vom 17. Juni 1953 eingeleitete »Neue Kurs« der SED brachte eine Entlastung. Das Ablieferungssoll wurde gesenkt, »freie Spitzen« durften auf Bauernmärkten verkauft werden und brachten zusätzliches Geld.
Bereits 1952 hatte die Bildung von Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG), zunächst noch völlig freiwillig, begonnen. Es gab sie in drei Formen, vom »Typ I«, bei dem nur der Acker gemeinschaftlich bewirtschaftet wurde, bis zum »Typ III«, bei dem die Bauern ihr gesamtes festes und bewegliches Eigentum in die Genossenschaft einbrachten. Wirtschaftlich blieb der Erfolg gering: Ende der fünfziger Jahre hatten rund 85 Prozent aller LPGs Schulden, obwohl 1958 erst knapp ein Drittel des Bodens kollektiviert war.
Trotzdem wurde der Weg in die Kollektivierung beschleunigt, denn »Produktionsmittel« in privater Hand widersprachen dem Sozialismus. Deshalb erfolgte 1960 die vollständige Vergenossenschaftlichung der Landwirtschaft. Dabei direkt und indirekt ausgeübter Zwang führte neben etwa 200 Selbstmorden zur »Republikflucht« von mehr als 15.000 Bauern über die damals noch offene Grenze. Überdies fanden rund 8.000 Schauprozesse statt. Die meisten Betroffenen arrangierten sich jedoch mit den neuen Verhältnissen. Am Ende des »Sozialistischen Frühlings« 1960 standen 19.313 Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften. Durch Zusammenschlüsse von kleineren Genossenschaften sank ihre Zahl bis 1970 auf 9.009, der »Typ III« setzte sich durch. Die Aufteilung in Tier- und Pflanzenproduktion ließ sie in den folgenden zehn Jahren auf 3.946 Betriebe schrumpfen, deren Zahl dann bis 1989 etwa konstant blieb.
Nach anfänglichen erheblichen Rückgängen in der Tier- und Pflanzenproduktion schien sich der Weg des gemeinsamen Wirtschaftens ab Mitte der sechziger Jahre zu bewähren. Dazu trug besonders die Verbesserung der sozialen Lage der LPG-Mitglieder bei. Der monatliche Lohn für Produktionsarbeiter und -arbeiterinnen in der Landwirtschaft verdoppelte sich von 1970 bis 1989 auf durchschnittlich 1.239 Mark. Zwischen rund 840.000 bis 920.000 Menschen fanden 1976 bis 1989 Jahr für Jahr auf dem Land Lohn und Brot. Die traditionellen Gegensätze zwischen Bauern und Landarbeitern bauten sich allmählich ab. Das Nettoprodukt der Land- und Forstwirtschaft stieg von 14.420 Millionen Mark 1970 auf 30.286 Millionen Mark 1989.
Dennoch reichte die Produktion ab Anfang der achtziger Jahre nicht mehr aus, um wachsende Exporte in den Westen zu Billigpreisen und die geplante Versorgung der Bevölkerung zu realisieren. Am 4. November 1982 stellte das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) zum Ansatz des Volkswirtschaftsplans 1983 fest: »Im 1. Halbjahr 1983 wird … mit einem Schlachtviehaufkommen von 0,9 bis 1,0 Mio t gerechnet. Das voraussichtliche Fehl zum geplanten Aufkommen wird 110 bis 180 kt betragen.« Das hieß, es war mit etwa 15 Prozent weniger Fleisch zu rechnen. Auch bei Milch ging die Produktion in gleicher Größe zurück: »Aus der voraussichtlichen Mindermenge ist eine geringere Bereitstellung von 5 bis 10 kt Butter im I. Quartal 1983 zu erwarten.« Es gab zu wenig Futter: »Zur Sicherung der für das IV. Quartal und für das I. Halbjahr 1983 geplanten Tierproduktion fehlt zur Zeit Futterenergie von rund 2 Mio t Getreideeinheiten.« Sie hätten importiert werden müssen. Aber: »In den Vorschlag für den Plan 1983 wurden diese Importe nicht eingeordnet, weil sie volkswirtschaftlich nicht realisierbar sind.«
Der Plan war zum Wunsch geworden, und die Stasi konstatierte: »Diese Planzielstellungen liegen um 90 kt Schlachtvieh, 150 kt Milch und um 90 Mio Stück Eier über den … Produktionsmöglichkeiten.«
Das spürten die Menschen trotz Jubel-»Berichterstattung« in den Zeitungen beim täglichen Einkauf und richteten sich darauf ein.
Wenn die Landwirtschaft dennoch im Rückblick als gut funktionierender Teil der DDR-Wirtschaft gilt, war das vor allem dem unbändigen Fleiß und der Bescheidenheit derer zu verdanken, die über Jahrzehnte und rund um die Uhr diese Arbeit verrichteten.
Weshalb scheiterte die Planwirtschaft?
Im Sommer 1963 veranlasste Alfred Neumann, Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der SED und Vorsitzender des Volkswirtschaftsrats der DDR, ein merkwürdiges Experiment. Er ließ einen Dieselmotor in alle seine Einzelteile zerlegen – es waren rund 12.000 – und versuchte, an diesem Beispiel seinen Genossen klarzumachen, dass die Herstellung solch eines komplexen Produkts ohne vorherige Planung jedes Schräubchens unmöglich sei.
Der Hintergrund waren Walter Ulbrichts Bemühungen, in der DDR ein »Neues ökonomisches System der Planung und Leitung der Volkswirtschaft« (NÖSPL) zu etablieren. Der Staatslenker hatte erkannt, dass die extensiven Wachstumsreserven des Landes aufgebraucht waren und nun ein Strukturwandel anstand. Dafür gab es Signale aus Moskau. Dort diskutierten Wirtschaftswissenschaftler seit Mitte der fünfziger Jahre über die Anerkennung von Rentabilität und Gewinn in der Produktion. Am 9. September 1962 fabulierte die Prawda über »Plan, Gewinn, Prämie«. Das laue, nach ein bisschen Marktwirtschaft riechende Lüftchen verflüchtigte sich 1964 mit der Absetzung Nikita Chruschtschows.
Bis dahin fühlte sich Walter Ulbricht jedoch in seinen Überlegungen bestärkt, denn über die Planwirtschaft reden, hieß, an Glaubensgrundsätzen des Kommunismus zu rütteln. Der Plan sollte den Menschen bessere Lebensumstände garantieren, ohne ökonomische Krisen und Arbeitslosigkeit. Das klang verlockend, verbarg aber den auf ewig angelegten und ohne demokratische Legitimation versehenen Machtanspruch »der Partei«. Nur sie sah sich auserkoren, eine »menschlichere Gesellschaft« zu schaffen. Dazu wurden Freiheiten beschnitten und Zwangsmaßnahmen begründet. Die Menschen hatten sich, ebenso wie die Wirtschaft, der Politik unterzuordnen.
Siegessicher verkündete Walter Ulbricht 1953 im DDR-Rundfunk: »Wenn ich durch die Straßen gehe und etwas Neues, Schönes sehe, weis ich stolz darauf: Das hat mein Freund getan! Mein Freund, der Plan!«
Und zunächst schienen historische Erfahrungen die Utopie vom Plan als Alternative zum Markt durchaus zu bestärken. Wirtschaftliche Erschütterungen zwischen den Kriegen hatten den Faschismus hervorgebracht und Verwüstungen und Tod hinterlassen. Demgegenüber stand eine erfolgreiche Industrialisierung in der Sowjetunion in den 1930er Jahren mit hohen Wachstumsraten. Die dafür durch Zwangsmaßnahmen und Unrecht geopferten Millionen von Menschen blieben bei den Lobeshymnen über den Erfolg der Planwirtschaft ausgeblendet.
In der DDR sollte sie sich als Alternative zur Marktwirtschaft in Westdeutschland beweisen. Das machte die Bundesrepublik zur Referenzgesellschaft, an der sich der kleinere deutsche Staat messen musste. Dessen Existenz hing jedoch direkt von der Sowjetunion ab. In der weiteren Entwicklung waren überdies die gemeinsamen Interessen des Ostblocks zu berücksichtigen. All das schränkte die Gestaltungsspielräume des eigenen Systems ein. Der Konflikt zwischen Machtsicherung und Wirtschaft zeigte das. Er offenbarte und überdeckte gleichzeitig die beiden grundlegenden Schwächen jeglicher Planung: den Verzicht auf die direkte Information aus der Produktion und das Fehlen von Anreizen, um sie zu steigern.
Ob ein Unternehmen erfolgreich ist, erfährt es über den erzielten Preis seiner Produkte. Entsteht er aus Angebot und Nachfrage, birgt er jene Krisenpotentiale, die die sozialistische Entwicklung eigentlich abschaffen wollte. Deshalb wurde der Preis politisch bestimmt. Die dafür notwendigen Informationen versuchte man, aus der Planung zu gewinnen. Preise wurden dadurch zu starren Rechengrößen, die die wirtschaftliche Dynamik behinderten und bremsten.
Dies mit echten wirtschaftlichen Anreizen zu kompensieren, verbot das politische Grundverständnis. Die »Arbeiter-und-Bauern-Macht« konnte gegenüber den Arbeitern und Bauern nicht wie ein Unternehmer auftreten und Leistungsdruck ausüben. Sie hätte damit ihre Legitimität gefährdet. Versuche, ökonomisch zu stimulieren, wie Wettbewerb und Prämien, konzentrierten sich auf quantitative, kaum jedoch auf qualitative Steigerungen. Die Erfüllung der zentralen Pläne schien wichtiger als das Risiko von Innovationen. Sie stellten sich oft als »Störung« von außen dar und wurden deshalb tunlichst vermieden.
In der Praxis führte das Planungssystem der DDR zum Interesse der Betriebe, mit möglichst »weichen Plänen« die Vorgaben »von oben« zu erwarten, viele Ressourcen zu erhalten und die tatsächliche Leistungskraft zu verschleiern. Deshalb wurden überdimensionierte Reserven gehalten und überall Arbeitskräfte gesucht. Da das Überleben nicht vom wirtschaftlichen Erfolg des Betriebs abhing, ging im Laufe der Jahre nicht nur die optimale Verteilung der Ressourcen verloren, sondern auch der Anreiz, sie intensiv zu nutzen.
Diese Schwächen waren den Verantwortlichen in der DDR durchaus bekannt. Sie galten jedoch als »Kinderkrankheiten« des Systems, die überwindbar seien. Je mehr sich die DDR an der weltweiten Arbeitsteilung beteiligte, umso hemmender wurden sie.
Traditionelle Exportzweige, wie etwa der einstmals international gefragte Maschinenbau, produzierten in den achtziger Jahren zwar noch die material- und arbeitsintensiven Teile, ohne moderne elektronische Steuerungen aus dem Westen ließen sie sich jedoch nicht mehr verkaufen. Diese machten aber mehr als drei Viertel des Wertes der Maschinen aus.
Am Ende stand ein bitteres Ergebnis der geplanten Wirtschaft in den Büchern: Je fleißiger in der DDR gearbeitet wurde, umso ärmer wurden die Produzenten.
Wieso schadete CoCom der ostdeutschen Wirtschaft?
Ob Stahl in den fünfziger, Transistoren in den sechziger oder Computer in den siebziger Jahren – während des Kalten Krieges unterlagen wichtige Waren einem Embargo und durften deshalb offiziell nicht über den Eisernen Vorhang hinweg und damit auch nicht in die DDR geliefert werden.
Die Wurzeln dieser Beschränkungen lagen in den Ergebnissen des Zweiten Weltkriegs. Das ab 1949 geltende US-Exportkontrollgesetz untersagte jedweden Handel, der zur Stärkung des militärischen oder ökonomischen Potentials der Sowjetunion oder ihrer Satelliten beitragen könnte. Um das durchzusetzen, nahm am 1. Januar 1950 das Coordinating Committee for East-West Trade Policy, kurz CoCom genannt, seine Arbeit auf. Diesem »Koordinierungskomitee für Ost-West-Handelspolitik« gehörten die USA, Großbritannien, Frankreich, Italien, die Niederlande, Belgien und Luxemburg an. Anfang 1950 kamen Norwegen, Dänemark, Kanada und die Bundesrepublik Deutschland dazu. Zwei Jahre später folgten Portugal, 1953 dann Japan, Griechenland und die Türkei. Am CoCom beteiligte sich später auch noch Australien, so dass schließlich alle NATO-Staaten, außer Island und Spanien, sowie weitere wichtige Exportländer bereit waren, Embargo-Güter festzulegen. Schweden, die Schweiz, Island, Österreich und Finnland traten dem CoCom nicht bei, sicherten aber Loyalität gegenüber dem Embargo zu.
Prinzipiell entschieden die CoCom-Partner einstimmig darüber, welche neuen Produkte und Technologien nicht in den Osten exportiert werden durften. In der Praxis hatten jedoch die USA als bedeutendste westliche Wirtschafts- und NATO-Führungsmacht das Sagen. Als Außenstelle ihrer Botschaft in Frankreich entstand in Paris, Rue La Boétie 58, das CoCom-Logistikzentrum.
Die CoCom-Festlegungen besaßen keine automatische rechtliche Verbindlichkeit. Die Teilnehmer hatten sich aber verpflichtet, die gemeinsam festgelegten Ausfuhrbeschränkungen und -kontrollen über ihre nationalen Rechtsordnungen sicherzustellen.
Die geheimen »CoCom-Listen« umfassten drei Hauptteile: die Internationale Kriegsmaterial-Liste, die Internationale Kernenergie-Liste und die Internationale Warenkontroll-Liste, auch Industrie-Liste genannt. Für die Wirtschaft war vor allem Letztere von Bedeutung. Sie verzeichnete alle strategischen Güter, die sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich nutzbar waren (»dual-use goods«).
Damit war CoCom ein Instrument, mit dem der West-Ost-Technologietransfer spürbar negativ beeinflusst werden konnte. Die USA, die die Embargopolitik als Waffe im Kalten Krieg initiiert hatten, sorgten auch dafür, dass sie wirksam blieb. Sie führten über Unternehmen, die bei Embargo-Geschäften erwischt wurden, schwarze Listen, »Denial Orders« genannt. So konnte über die internationalen Verflechtungen im Handel Druck ausgeübt werden. In einem Gutachten vom 3. Februar 1994 stellte das HWWA-Institut für Wirtschaftsforschung Hamburg fest, dass »die CoCom-Listen neben einem festen Kern strategischer Güter auch Produkte geringeren strategischen Werts umfassten, die von außenpolitischen Rahmenbedingungen abhingen und quasi eine ›politische Verfügungsmasse‹ darstellten«.
Genau gegen diese »politische Verfügungsmasse« versuchte sich die DDR zu wehren, die die Embargopolitik mit Hinweis auf das internationale Völkerrecht generell als rechtswidrig ansah.
Allerdings verfügte sie im Gegensatz zur Sowjetunion und den anderen sozialistischen Staaten mit dem »innerdeutschen Handel« über einen besonderen rechtlichen Rahmen, in dem Außenwirtschaftsgesetz (AWG) und Außenwirtschaftsverordnung (AWV) der Bundesrepublik nicht galten. Dieser innerdeutsche Handel war durch das Militärregierungsgesetz Nr. 53 und die Interzonenhandelsverordnung von 1951 reglementiert. Aus westdeutscher Sicht sollte er stets »als ökonomischer Hebel die eigenen politischen Ziele durchsetzen helfen«, so das Bundesministerium für Innerdeutsche Beziehungen im Jahr 1979. Trotzdem machten die Sonderregelungen manche Geschäfte möglich, die andere Ostblockstaaten nicht tätigen konnten. Das rief unter den »Bruderländern« immer wieder außenpolitischen Ärger hervor und setzte die SED-Führung dem Vorwurf mangelnder Bündnistreue aus.
Dennoch verließ sich die DDR beim Import strategisch wichtiger Waren nicht nur auf die mögliche Erteilung von Einzelgenehmigungen durch das Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft. Die Erfahrung hatte gezeigt, dass Bonn die Wirtschaft zum Erlangen politischer Zugeständnisse effektiv nutzte. Deshalb baute die DDR ein umfangreiches Netz von Tarnfirmen und von Wirtschaftsunternehmen, die direkt vom MfS geführt wurden, auf.
Damit ließen sich wichtige Waren und Know-how zwar besorgen, es wurde aber sehr teuer. Ein Bonner Aktenvermerk unter dem Zeichen IV 1 – 28 03 69 vom 3. November 1989 dazu: »Die DDR zahlt für illegal beschaffte Erzeugnisse in der Regel 70 % über dem Marktwert.« Von den illegal erzielten Gewinnen erfuhr der Fiskus natürlich nichts, so dass der Verkauf von Embargo-Waren auch für West-Partner lukrativ war.
Die politische Nutzung des Handels als Waffe im Kalten Krieg schadete somit unterm Strich dem Osten und dem Westen. Die einen zahlten Überpreise, die anderen verloren Steuereinnahmen.
Was veränderte Honeckers Machtantritt 1971?
Als die Welt am 4. Oktober 1957 das Piepsen des sowjetischen Sputniks hörte, schien der Kommunismus plötzlich ganz nah. Der XXI. Parteitag der KPdSU im Januar/Februar 1959 machte es konkret: bis 1965 Erhöhung der Produktion in der Schwerindustrie um 80 bis 85 Prozent, Verdopplung in den Zweigen Elektroindustrie, Maschinenbau und Erdöl, dreimal so viel in der Chemie und fünfmal mehr in der Gasproduktion. Die Arbeitszeit sollte ab 1962 auf 40 Stunden pro Woche sinken und der Lohn von 270 bis 350 Rubel, bis 1965 dann sogar auf 500 bis 600 Rubel steigen. Und auch an Kleinigkeiten wurde gedacht: »Die Sowjetmenschen werden hinreichend mit gediegener und gefälliger Kleidung und schönem Schuhwerk versorgt werden.«
Nur noch fünfzehn Jahre würde das alles dauern, und Neues Deutschland verkündete am 21. Februar 1959 die SED-Einschätzung dazu: »Mit dem Beschluss über den umfassenden Aufbau der kommunistischen Gesellschaft hat die KPdSU das größte Ziel, das bisher von Menschen gestellt wurde, in historisch greifbare Nähe gerückt.« Eine Broschüre der »Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft« (DSF) illustrierte das alles mit Grafiken und Diagrammen.
Wer in der DDR das »Überholen, ohne einzuholen« nicht abwarten wollte, ging in den Westen. Das erledigte sich mit dem Mauerbau am 13. August 1961, und danach herrschte eine Weile die Hoffnung, nun würde sich alles zum Guten wenden. Reformansätze in der Wirtschaft förderten sie, doch die große Verheißung des XXI. Parteitags der KPdSU blieb aus. Walter Ulbricht sprach plötzlich vom Sozialismus als »relativ selbständige Gesellschaftsformation«. Der Weg in die lichte Zukunft verlängerte sich also wieder.
Das sollte sich mit der Machtübernahme Erich Honeckers am 3. Mai 1971 ändern. Auf dem VIII. Parteitag der SED vom 15. bis 19. Juni des Jahres definierte er das Neue seiner Politik.
Der Sozialismus wurde erneut nur als Übergangsphase zum Kommunismus gesehen, die DDR betonte wieder stärker die unbedingte Gefolgschaft zur Sowjetunion. Auch von der »sozialistischen Menschengemeinschaft« war keine Rede mehr. Stattdessen bestimmte nun die »Hauptaufgabe« den weiteren Weg des Landes: »Die Hauptaufgabe … besteht in der weiteren Erhöhung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus des Volkes auf der Grundlage eines hohen Entwicklungstempos der sozialistischen Produktion, der Erhöhung der Effektivität, des wissenschaftlich-technischen Fortschritts und des Wachstums der Arbeitsproduktivität.«
Was nun begann, haben viele als so etwas wie die kurze Blütezeit der DDR in Erinnerung. Es ging spürbar voran, was die bereits in den sechziger Jahren gelegten Wurzeln der Stagnation für ein paar Jahre überdeckte. Dass alles Positive auch seine Schattenseite hatte, bedrückte nur wenige. Sicher, die DDR war derweil international anerkannt, aber in die Welt reisen, durfte kaum jemand. Natürlich musste man ein paar Jahre auf eine Wohnung warten, aber das traf andere auch, und die Hoffnung blieb berechenbar. Augenscheinlich ging es den Verwandten im Westen besser, aber dafür mussten sie sich auch krumm machen, und so riesig war der Unterschied meist nicht – sowohl die Aufbaugeneration als auch die bereits in der DDR Aufgewachsenen wussten mit alledem umzugehen.
Für sie alle zählte da mehr eine Art von Lebenssicherheit, die damals noch nicht als Stillstand empfunden wurde. Ihr Anker war die gleichberechtigte und gleichbezahlte Arbeit von Männern und Frauen. Hier konnte niemandem ernsthaft etwas passieren. Kinder bremsten weder die Karrierechancen, noch bargen sie ein Armutsrisiko in sich. Gescheiterte Partnerschaften wurden nicht automatisch zur existentiellen Bedrohung.
Das Geld spielte keine herausgehobene Rolle. Da in den Familien meist Mann und Frau arbeiteten, reichte in der Regel das Haushaltseinkommen für den in der DDR möglichen Lebensstandard. Rund eine Million Arbeiter, die bislang nur bis 500 Mark Bruttolohn bekamen, erhielten ab 1. Oktober 1976 eine Lohnerhöhung.
Konsumgüter, wie Kühlschrank, Waschmaschine oder Fernseher, waren teuer, aber erreichbar, die jahrelangen Wartezeiten aufs Auto unangenehm, doch es ließen sich Wege finden. Ebenso bei den Querelen des Alltags: »Beziehungen schaden nur dem, der keine hat«, kommentierte der Volksmund. Kam irgendwann die »Neubauwohnung«, erhöhte sich die Miete allenfalls von 20 bis 30 Mark für die alte Wohnung mit Ofen und kaltem Wasser auf 80 bis 100 Mark warm für »Vollkomfort«.
Rentner bekamen die Möglichkeit, eine bescheidene Alterssicherung anzusparen. Die Mindestrente stieg langsam an, erreichte aber erst ab dem 1. Dezember 1984 die Grenze von 300 Mark im Monat. Trotzdem baute sich die gravierende Rentnerarmut der frühen Jahre mit dem Aussterben dieser Generation langsam ab.
Die Schul- und Berufsausbildung der Kinder verlief streng nach Plan. Benachteiligungen – etwa durch Nichtzulassung zur Erweiterten Oberschule und damit zum Abitur – ließen sich über andere Bildungswege kompensieren. Die Wahl der künftigen Arbeitsstelle verlief manchmal nicht ganz nach Wunsch, doch niemand landete ohne Ausbildung auf der Straße.
»Es bleibt alles viel besser«, sagten die Leute und richteten sich ein. Das Leben von der Wiege bis zur Bahre schien geregelt zu sein, wer damals um die Dreißig war, wusste, was noch kommt. Und was nicht. Die Gesellschaft verfiel in ihre Midlifecrisis, ohne dass es jemandem auffiel. Es gab kaum Anreize, etwas zu verändern, viele zogen sich massiv ins Privatleben zurück.
Das braune Büchlein der »Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft«, das 1960 auf 34 Farbtafeln das Erreichen des Kommunismus bis 1985 illustrierte, war nur noch Erinnerung an eine ausgeträumte Illusion.
Was wusste die Stasi vom DDR-Absturz?
Mit dem Start in die achtziger Jahre schien es in der DDR bergab zu gehen. Die Menschen spürten es beim täglichen Einkauf, es hakte bei der Arbeit, und der Glaube an die Zukunft schwand.
Das Lexikon definiert Krisen als »deutlich negative Entwicklung des Wirtschaftswachstums«. Doch so etwas sollte es im Sozialismus eigentlich gar nicht geben. Die Stasi sprach wohl auch deshalb von »Maßnahmen, die zusätzlich erforderlich werden, um den Auswirkungen des Wirtschaftskrieges der aggressiven imperialistischen Kreise gegen unser Land zu begegnen«.
Es ging um die Existenz der DDR, und wieder einmal waren die anderen daran schuld. Am 4. November 1982 formulierte das MfS eine umfangreiche Analyse unter dem Titel: »Sicherheitspolitischer Standpunkt zum Ansatz des Volkswirtschaftsplanes 1983«. Als »entscheidende Veränderungen« zum bisherigen Wirtschaften wurde dort unter anderem festgestellt: »Die industrielle Warenproduktion wurde um 10 Mrd M reduziert. Das hat Auswirkungen auf das produzierte Nationaleinkommen, das um rund 4 Mrd M herabgesetzt wurde.« Und dann weiter: »Die Sicherung der Zahlungsbilanz mit dem NSW (›Nichtsozialistischem Wirtschaftsgebiet‹, K. B.) erfordert es, einen Exportüberschuss von 9,3 Mrd VM (›Valutamark‹, K. B.) zu erwirtschaften. Das ist mehr als das Doppelte im Jahr 1982. Der geplante Zuwachs im NSW-Export mit 3,7 Mrd VM ist der höchste, der jemals angesetzt wurde.« Es ging also bergab, und zwar ziemlich schnell.
Vom spürbaren Niedergang betroffen waren nach den Erkenntnissen der Stasi alle Bereiche der Volkswirtschaft. Trotzdem musste gegenüber dem Westen das Gesicht gewahrt werden. Deshalb sollten die eigenen Bürger den Gürtel noch enger schnallen: »Aus der Lage heraus müssen dann zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit Waren angeboten werden, die schnell zu verkaufen sind, und das sind erfahrungsgemäß in besonderem Maße Konsumgüter, die ursprünglich für die Versorgung der Bevölkerung bereitgestellt waren.« Das Angebot der Läden sollte also planmäßig noch knapper werden. Das Volk nahm es zwangsläufig mit Galgenhumor: »Warum haben wir so viele Schlaglöcher? – Weil man sie nicht exportieren kann.«
Insgesamt rechnete der Plan im Jahr 1983 mit einem Warenfonds von mindestens 103,4 Milliarden Mark. Die Stasi-Analyse: »Diese Zielstellung beinhaltet bereits einen Wertzuwachs von rund 2 Mrd M EVP (›Endverbraucherpreis‹, K. B.), der durch Verbesserung der Gebrauchswerte der Erzeugnisse realisiert werden soll.« Klartext: Knapp zwei Prozent der Erlöse sollten aus versteckten Preiserhöhungen kommen.
Trotzdem würde sich die Schere zwischen Kaufkraft der Bevölkerung und vorhandenen Waren weiter öffnen. Grund: Im November 1982 waren »erst für 102 Mrd M Erzeugnisse bilanziert«, und es würden »gleichzeitig die Nettogeldeinnahmen der Bevölkerung auf 102 % und damit um 2,6 Mrd M zunehmen«. Dabei war die Lage schon längst prekär, denn: »Die zunehmende Kaufkraft der Bevölkerung wird bereits im Jahr 1982 nicht mehr ausreichend durch den verfügbaren Warenfonds abgeschöpft … Besonders stark war in diesem Jahr die rückläufige Entwicklung beim Umsatz von Industriewaren, der unter dem Niveau von 1981 liegt.«
Nach einer Beratung der Staatlichen Plankommission im September 1982 zeichnete sogar die Stasi ein düsteres Bild: »Bei Strumpfwaren für Herren, Damen und Kinder lag der Aufkommensnachweis zwischen 54 und 78 %. Bei Untertrikotagen lag der Anteil bei 66 % und bei Bettwäsche für Erwachsene nur bei 19 %.«
Diese nüchternen Zahlen bedeuteten ganz praktisch: Von fünf Leuten, die Bettwäsche brauchten, hatte gerade einer die Chance, sie auch zu erwischen. Zumindest planmäßig. Wieder gab es Hohn und Spott vom Volk: »Warum soll Kosmonaut Sigmund Jähn Direktor des Centrum-Warenhauses werden? Er kennt sich am besten in leeren Räumen aus.«
Nach der Analyse der Stasi hätte er dort reichlich zu tun gehabt: »Bei vielen Erzeugnisgruppen werden mit den angebotenen Mengen die Versorgungsgrößen der staatlichen Aufgaben 1983 nicht erreicht. So u. a. bei Kindersportwagen, Trinkgläsern, Haushaltsgefrier- und Kälteschränken.« Und es würde noch schlimmer kommen, und zwar »durch die Wahrscheinlichkeit, dass beginnend im I. Quartal 1983 zur Sicherung der Zahlungsbilanz und des Bargeldaufkommens wie bisher auch außerplanmäßige Eingriffe in den Warenfonds vorgenommen werden«.
Das Volk stöhnte: »Ich wollt, ich wär ein Pflasterstein, ich könnte schon im Westen sein!« Die Devisenjäger verkauften sogar Leipzigs historisches Kopfsteinpflaster an die Stadt Aachen. Insgesamt brachten die alten DDR-Steine rund acht Millionen Mark ein.
Nicht einmal mehr bei den Staatsreserven war noch viel zu holen. Die Stasi-Analyse dazu: »Die verfügbaren Bestände wurden vom 1.1. bis 30.9.1982 um 1,3 Mrd M (55 %) reduziert. Für 770 Mio M sind Bestände der Staatsreserve im Jahr 1982 zur Erwirtschaftung von Valutamitteln eingesetzt worden … Charakteristisch für das Jahr 1982 ist, dass für die abverfügten Bestände im Gegensatz zu den Vorjahren keine Wiedereinlagerung erfolgte. Für wichtige Erzeugnisse, wie z. B. Kupfer, Blei, Zinn, Aluminium, Fleisch, Zucker, Getreide und Ölfrüchte, gibt es überhaupt keine Staatsreserve mehr. Für andere Erzeugnisse wie Benzin, Dieselkraftstoff, Butter und Reis wurden die Normen für die Sollbevorratung bedeutend herabgesetzt. Die Bestände sind zum Teil nur noch gering.«
Selbstredend unterlag die nüchterne Bestandsaufnahme durch das Ministerium für Staatssicherheit der DDR strengster Geheimhaltung. Die »Information« für das Volk kommunizierte Neues Deutschland am 15. Januar 1983. Sie trug die Überschrift: »1982 erbrachte erneut kräftiges Wachstum unserer Volkswirtschaft«.
Wie zerbrach die DDR?
Im Nachhinein scheint alles ganz einfach: Das DDR-Volk hatte die Nase voll von seiner Führung, ging eines Tages auf die Straße und jagte sie zum Teufel. Erst danach begann der Streit, wer denn dabei eigentlich die Häuptlinge waren. Er reichte von der gerade entstandenen Opposition und ging über das diffuse »Wir sind das Volk« bis zur im Herbst 1989 scheinbar noch felsenfest etablierten SED. Dennoch gab es erst einmal ein gemeinsames Ziel: Eine »bessere DDR« sollte entstehen. Wie sie aussehen könnte, wusste niemand, doch den Anstoß dazu reklamierten die verschiedensten gesellschaftlichen Kräfte für sich.
Erhart Neubert, Mitbegründer der Organisation »Demokratischer Aufbruch«, sagt, was viele Protagonisten der Bürgerbewegungen auch für ihre Aktivitäten sahen: Es sei »das historische Verdienst der DDR-Opposition gewesen, im Kampf gegen ein totalitäres Regime die gesellschaftliche Selbstbefreiung politisch ermöglicht zu haben«. Egon Krenz hingegen, letzter SED-Generalsekretär und gleichzeitig Vorsitzender des Staats- und des Nationalen Verteidigungsrates der DDR, ist stolz darauf, dass er eben dies nicht militärisch verhinderte und sogar noch die Grenze öffnete.
Mit dem schnellen Verblühen der DDR geriet diese Frage schließlich in die Schublade der Geschichte. Dennoch zeigt ein Blick auf die zeitlichen und inhaltlichen Entwicklungen, dass es verschiedene Strömungen waren, die sich im Laufe des Auflösungsprozesses der DDR isoliert voneinander bewegten und schließlich auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner, der Abschaffung der Alleinherrschaft der SED, vereinigten.
Ihre wesentlichsten Teile waren die allmähliche Herausbildung der Bürgerrechtsbewegung, die Fluchtwelle, die Massendemonstrationen und das Bemühen um Reformen innerhalb der SED infolge der veränderten sowjetischen Politik. Erst als diese vier Faktoren begannen, miteinander zu agieren, verstärkten sie sich wechselseitig und beschleunigten so den Umbruch. Professor Detlef Pollack von der Universität Münster, der in seinem Buch Politischer Protest diese These vertritt, verweist zu Recht auf die entscheidende Rolle der relativen Isolation zwischen diesen verschiedenen Segmenten des gesellschaftlichen Protestes: »Hätten die Flüchtlinge gewusst, dass sich die DDR in Kürze grundlegend verändern würde, dass es Demonstrationen und Veränderungen in der Parteispitze geben würde, so hätten sie möglicherweise darauf verzichtet, das Risiko einer Flucht mit ungewissem Ausgang einzugehen. Hätte die Opposition gewusst, dass ihnen die Revolution von den Volksmassen aus der Hand genommen würde, hätten sie sich möglicherweise gar nicht zu Führern der Volksbewegung machen lassen. Hätten umgekehrt die Volksmassen gewusst, dass die Oppositionellen ganz andere Ziele verfolgten als sie selbst, dass sie gegen eine Erfüllung von Konsumwünschen und für die Beibehaltung der Selbständigkeit der DDR eintreten würden, so hätten sie sie möglicherweise niemals an ihre Spitze geschoben. Hätte Egon Krenz gewusst, in welch politisch angespannter Situation er handelte, dann hätte er sich möglicherweise nicht zum Sturz Honeckers entschlossen.« Das klingt alles sehr spekulativ, illustriert aber die komplizierten Wechselbeziehungen.
Die entscheidende Kraft des gesellschaftlichen Umbruchs dürfte von dem seit Sommer 1989 stetig angeschwollenen Flüchtlingsstrom ausgegangen sein. Er zerstörte die Illusion der SED-Führung von einem weiterhin beherrschbaren »DDR-Volk« und stellte den »Sozialismus in den Farben der DDR« grundsätzlich in Frage.
In seiner Folge organisierte sich die Opposition. Das »Neue Forum« entstand am 9. und 10. September 1989 und wollte sich eigentlich erst Anfang Dezember erneut versammeln, »Demokratie Jetzt« wurde wenige Tage später gegründet und plante für Anfang 1990 ein erstes Vertretertreffen. Bis dahin war die Zahl der Protestler marginal und entwickelte sich nur innerhalb der Gruppenszenen. Bereits nach sechs Monaten, mit der ersten freien Wahl der DDR am 18. März 1990, verloren die Bürgerbewegungen ihre politische Anziehungskraft.
Die Massendemonstrationen der Bevölkerung begannen, ausgehend von Leipzig, nach Öffnung der ungarisch-österreichischen Grenze am 11. September 1989. Nach rund 250 ausreisewilligen Demonstranten am 4. September – Losung: »Wir wollen raus« – gingen ab Anfang Oktober Zehntausende auf die Straße. Ihre Rufe änderten sich in »Wir bleiben hier« und »Wir sind keine Rowdys«. Der Protest hatte die Mehrheit des Volkes erreicht. Aufrufe dazu durch die alternativen Gruppen gab es nicht. Deren Schwerpunkt lag in jenen Tagen darin, aus den Kirchen herauszutreten und sich öffentlich zu organisieren.
Mit der Erklärung des SED-Politbüros vom 11. Oktober 1989 deutete sich erstmals eine potentielle Bereitschaft zur Wandlung der erstarrten DDR-Politik an. Die Massenmedien begannen zaghaft, sich der erzwungenen, unabhängigen Öffentlichkeit zu öffnen. Damit wurde das Abbild der bis zum Mauerfall weitgehend isolierten Bewegungen möglich. In der zweiten Oktoberhälfte 1989 kanalisierten sich die politischen Forderungen auf die Abschaffung des Machtmonopols der SED.
Mit der Öffnung der Grenze am 9. November 1989 artikulierten sich erneut unterschiedliche Zielvorstellungen. Bärbel Bohley, die wichtigste Vertreterin der organisierten Opposition, kommentierte sie: »Die Leute sind verrückt, und die Regierung hat den Verstand verloren.« Dennoch setzte sich nun die Forderung »Wir sind ein Volk« durch. Das wirtschaftliche Gefälle zwischen Ost und West war dabei der wesentliche Auslöser.
Einfach gesagt, zerbrach die DDR genau so, wie immer und überall auf der Welt Regimes zerbrechen, wenn revolutionäre Situationen entstehen: Die Oben konnten nicht mehr so, wie sie wollten, und die Unten wollten nicht mehr so, wie sie sollten.
II. Leben und leben lassen
Was war die »sozialistische Menschengemeinschaft«?
In die Wände der Wohnung des Ostberliner Eisenbahners waren extra Löcher gebohrt worden, um den müden Mann nach der Schicht im Bett mit Kamera und Mikrophon beobachten zu können. Das hatte nicht die Stasi, sondern der Deutsche Fernsehfunk bewerkstelligt, und im Friedrichstadtpalast verfolgte ein Millionenpublikum, wie der ebenso verdienstvolle wie erstaunte Mann per fahrbarem Bett wenig später in die Show transportiert wurde, um ihn dort weiter zu ehren. Die Show hieß »Mit dem Herzen dabei«, und sie war die Umsetzung von Walter Ulbrichts Idee der »sozialistischen Menschengemeinschaft« in Bild und Ton. Das besorgte Moderator Hans-Georg Ponesky.
Er hatte die Überraschungsshow auf Beschluss des VI. Parteitags der SED im Januar 1963 im Rundfunk aus der Taufe gehoben, zum 15. Jahrestag der DDR lief sie dann auch im Fernsehen und erlebte dort 14 Folgen. Die Idee dahinter war simpel: Die Frau oder der Mann von nebenan »kamen durchs Fernsehen«, weil sie etwas Besonderes vollbracht hatten, und diese Vorstellung war mehr wert als eine der rund 10.000 staatlichen oder gesellschaftlichen Auszeichnungen. »Mit dem Herzen dabei« sorgte für ein heimlich renoviertes Haus, einen neuen Trabi oder sogar für einen auf der Bühne verliehenen Professoren-Titel.
All das hatte einen politischen Hintergrund: die »sozialistische Menschengemeinschaft«. Walter Ulbricht persönlich hatte sie erfunden. Am 22. März 1969 verkündete er: »Die sozialistische Menschengemeinschaft, die wir Schritt um Schritt verwirklichen, geht über das alte humanistische Ideal hinaus. Sie bedeutet nicht nur Hilfsbereitschaft, Güte, Brüderlichkeit, Liebe zu den Menschen. Sie umfasst sowohl die Entwicklung der einzelnen sozialistischen Persönlichkeiten als auch der vielen zur sozialistischen Gemeinschaft im Prozess der gemeinsamen Arbeit, des Lernens, der Teilnahme an der Planung und Leitung der gesellschaftlichen Entwicklung … und an einem vielfältigen, inhaltsreichen und kulturvollen Leben.« All das sollte sich im »entwickelten gesellschaftlichen System des Sozialismus« abspielen, das sich als »besonderer Gesellschaftstyp« bisher nur in der DDR etabliert habe.
Im Kern war diese Politik erstmals der Anspruch eines Sowjet-Satelliten auf einen »eigenen Weg« der gesellschaftlichen Entwicklung. Er unterschied sich vom Moskauer Dogma, das im Sozialismus nur eine kurze Übergangsphase sah und das Erreichen der lichten kommunistischen Zukunft bereits öffentlich für Mitte der achtziger Jahre angekündigt hatte. Walter Ulbricht hoffte, sich mit seinem Beitrag den Weg ins Pantheon der »Klassiker« an der Seite von Marx, Engels und Lenin zu öffnen.
Im Kreml kam das nicht so gut an. Unter der Hand hielten die Genossen dort ihren ostdeutschen Statthalter für größenwahnsinnig, denn die Unterordnung unter Moskaus Führung galt als erstes Gebot. Sie begannen, seine Absetzung zu forcieren.