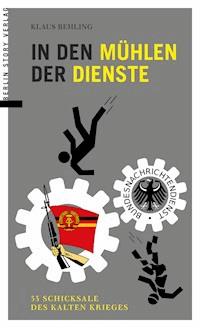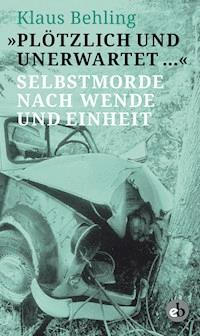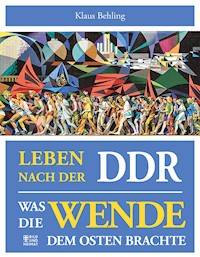Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition berolina
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Mit durchschnittlich nur 750 Straftaten pro 100.000 Einwohnern und Jahr gehörte die DDR zu den sichersten Ländern der Welt. Das Strafrecht wurde modernisiert, und es gab eine beispielhafte soziale Integration einstmals Gestrauchelter. Kriminalität galt "als dem Sozialismus wesensfremd". Doch daraus erwuchs auch die Schattenseite des DDR-Rechts: Es war Hebel, um die Macht der SED zu sichern, "Gummiparagraphen" dienten der politischen Unterdrückung und vor dem Gesetz waren längst nicht alle gleich. Klaus Behling beschreibt die politischen Hintergründe von Strafrecht und Kriminalität in vierzig Jahren DDR-Geschichte. Er illustriert den Umgang mit dem Recht als "Werkzeug im Klassenkampf" bis zur sozialistischen Alltagskriminalität, untersucht die Arbeit der Ermittlungsbehörden und erzählt von kleinen und großen Ganoven. Herausgekommen ist ein spannungsvolles Stück Geschichte aus einem untergegangenen Land, das sich wie ein fesselnder Krimi liest, aber auch die Ursachen fürs Scheitern und die Folgen der deutschen Einheit nicht außen vor lässt – ein packendes und zugleich informatives Buch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 662
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaus Behling
Die Kriminalgeschichte der DDR
Vom Umgang mit Recht und Gesetz im Sozialismus
Politische Prozesse, skurrile Taten, Alltagsdelikte
edition berolina
eISBN 978-3-95841-536-2
1. Auflage
Alexanderstraße 1
10178 Berlin
Tel. 01805/30 99 99
FAX 01805/35 35 42
(0,14 €/Min., Mobil max. 0,42 €/Min.)
© 2017 by BEBUG mbH / edition berolina, Berlin
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Umschlagabbildung: picture-alliance/chromorange
www.buchredaktion.de
Vorwort Die acht großen »W« auf dem Tatort DDR
Die DDR ist Geschichte, ihr Innenleben obduziert, die Erinnerungen sind selektiert und die Überreste archiviert. Da dürfte es eigentlich nicht besonders schwerfallen, einen Blick auf die Rechts- und Kriminalitätsgeschichte des versunkenen Landes zu werfen. Sie spielte sich in der Öffentlichkeit ab, hinterließ Tonnen von Akten, zog ihre Spuren durch manch aufsehenerregende Begebenheit, und noch gibt es Zeugen der einen wie der anderen Seite.
Also empfiehlt es sich, so vorzugehen, wie es jeder Kriminalist lernt: Die acht »W-Fragen« sollten beantwortet werden.
Die erste heißt »WANN« und macht keine Probleme: Die DDR existierte vom 7. Oktober 1949 bis zum 2. Oktober 1990. Davor gab es einen Weg dorthin, danach ein paar regelungsbedürftige Hinterlassenschaften, dennoch bleibt ein recht klarer Zeithorizont.
Beim »WER« wird es schon schwieriger, denn es verlangt Angaben zum Täter oder Tatverdächtigen. Sie zeigten sich nicht immer so eindeutig, wie es eigentlich anzunehmen wäre. Manche Täter ließen keinen Zweifel daran, Rechtsbrüche begangen zu haben, andere waren eher Opfer, einige wurden in diese Rolle gedrängt, und immer wieder einmal verhielten sich sogar der Staat selbst oder seine Diener kriminell.
Auch das »WO«, die »Angaben zum Ereignisort«, birgt Tücken. Natürlich spielte sich die Rechts- und Kriminalitätsgeschichte der DDR in deren Grenzen ab, die jeder Atlas zeigte. Aber die DDR war nicht allein in Deutschland. Die beiden nach dem Krieg entstandenen Teilstaaten hingen stets enger zusammen, als es dem einen wie dem anderen lieb sein konnte. Ihre »besonderen Beziehungen« – von der einen Seite gepflegt, von der anderen geleugnet – spielten immer eine Rolle.
Das wirkte sich auf das »WAS«, also die Straftat, aus. Ein Diebstahl konnte ebenso gut zum staatsfeindlichen Verbrechen mutieren wie ein Kavaliersdelikt bleiben. Die Gesetze garantierten Gleichheit, ihr Praktizieren brachte immer neue Unterschiede hervor, die ihrerseits wiederum mit den »Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung« begründet wurden.
Diese manchmal merkwürdige Logik mit all ihren Purzelbäumen erschwert die Suche nach dem »WIE«. Die Stichworte für den Kriminalisten dazu sind »Vorbereitung, Durchführung, Verschleierung, Mittel und Methoden«. Doch manche Tat wurde bestraft, obwohl sie gar nicht stattfand, und bei anderen bestand sie darin, gerade nicht »verschleiert« worden zu sein. Und bei den »Mitteln und Methoden« wurden sie dem einen als recht und billig zugestanden, brachten den anderen aber hinter Gitter.
All das hing mit dem »WOMIT« zusammen. Eigentlich meint das nichts anderes als die Art und Weise der Tatbegehung: Womit wurde das Fenster aufgehebelt, der Nebenbuhler niedergeschlagen oder vielleicht sogar der Staat geschmäht. In der DDR kamen jedoch weitere Faktoren hinzu. Mit wessen Hilfe geschah die Tat, wo wurden Augen schon mal zugedrückt und womit ließ sich die Kriminalität eigentlich erklären. Mit der Theorie darüber kaum, denn danach wäre sie ja längst ausgestorben.
Bliebe also das »WARUM«, die klassische Frage jedes Krimis nach dem Motiv. Klar, Geld und Liebe, große Gefühle und niedere Instinkte, das gab es auch auf dem Tatort DDR. Doch die Empfehlung an den Kriminalisten lautet, »Ursachen und Bedingungen der Straftat« zu berücksichtigen, und fordert: »Vermutungen kennzeichnen«. Und schon wird es wieder schwierig: Eine »Republikflucht« kann nur jemand begehen, den seine Republik nicht dorthin lässt, wo er hinwill, das Lesen eines Buches nur dann zum Delikt werden, wenn es andere dafür halten und die Bereitschaft besteht, es zu bestrafen.
Dabei spielt das letzte »W« eine Rolle – das »WEN«. Es ist die Frage nach dem Geschädigten, und eigentlich dürfte sie ganz leicht zu beantworten sein. Aber wer schädigt eigentlich wen, wenn er sich am »Volkseigentum« bedient und somit als »Miteigentümer« sich quasi selbst bestiehlt? Und warum wurde der eine dafür bestraft, der andere aber nicht?
Aristoteles meinte, dass die »Ausübung der Gerechtigkeit die Mitte ist zwischen Unrecht tun und Unrecht leiden«. Nach dieser Mitte soll gesucht werden.
1. Kapitel Das Recht im Dienst einer Partei
Seit Menschen in den verschiedensten Formen gesellschaftlicher Organisation miteinander leben, gibt es Verstöße gegen die allgemein akzeptierten Regeln. Betreffen sie den Bereich der juristisch definierten Straftaten, wird dies meist als »Kriminalität« umschrieben.
Über deren Ursachen und Hintergründe streiten die Gelehrten. Herrschafts- und gesellschaftskritische Theorien stehen neben Überlegungen zu biologischen Dispositionen, es gibt Ansichten, die kriminelles Handeln als lustbetonte Aktivität interpretieren, oder solche, die sie in Beziehung zu den verschiedenen Lebensetappen setzen. Andere sehen sie wiederum als Folge von Normbrüchen in der Gesellschaft, Ergebnis negativer Lernprozesse oder sozialer Desorganisation. Ob der Mensch böse oder gut ist, er durch ein Rechtssystem reglementiert werden muss und dieses Recht dann auch noch gerecht ist, wie Rechtsnormen entstehen, aus welchem Grund sie gelten und welche Rolle dabei das Rechtsgefühl spielt – all das ist umstritten. Trotzdem forderte das Leben Lösungen dafür. Sie ließen sich immer dann plausibel finden, wenn ein geschlossenes Weltbild dahinterstand.
War dieses nicht religiös geprägt, bestand ein breiter Konsens stets darin, kriminelles Verhalten in Bezug zu den jeweiligen gesellschaftlichen Zuständen und den sozialen Verhältnissen zu stellen. Die Gedanken dazu entwickelten sich über Jahrhunderte mit dem Streben, zu erkennen, »was die Welt im Innersten zusammenhält«. Mit den tiefgreifenden Umwälzungen der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert entstanden neue Denkansätze. Sie reflektierten die krasser gewordenen Gegensätze in der Gesellschaft. Die Frage, wer welches Recht wozu durchsetzen kann, trat in den Mittelpunkt. Die durch die althergebrachte, göttliche Ordnung bestehende Gerechtigkeit aus den Vorstellungen der griechischen Antike stand in Frage. Die strafende und rächende Justitia des christlichen Mittelalters und der Neuzeit war nicht mehr unantastbar.
Einen der modernen Denkansätze formulierte 1845 der damals 27-jährige Karl Marx in seiner ersten gemeinsamen Streitschrift mit Friedrich Engels, 25 Jahre alt, unter dem Titel Die heilige Familie. Die zornigen jungen Männer forderten: »… nicht das Verbrechen am Einzelnen (zu) strafen, sondern die antisozialen Geburtsstätten des Verbrechens (zu) zerstören und jedem den sozialen Raum für seine wesentliche Lebensäußerung (zu) geben.« Engels verkürzte das auf die Formel: »Wir legen die Axt an die Wurzel des Verbrechens.« Das verband sich mit der Hoffnung, in einer »gerechteren Gesellschaft« würde es keine Kriminalität geben. An die Bourgeoisie gewandt, bewerteten sie 1848 im Kommunistischen Manifest deshalb das Recht als Mittel der herrschenden Machtstruktur: »Eure Ideen selbst sind Erzeugnisse der bürgerlichen Produktions- und Eigentumsverhältnisse, wie euer Recht nur der zum Gesetz erhobene Wille eurer Klasse ist, ein Wille, dessen Inhalt gegeben ist in den materiellen Lebensbedingungen eurer Klasse.« Aus dem damit postulierten »Klassencharakter« jeglichen Rechtes folgte die Annahme, »die Muttermale der alten Gesellschaft« – so Karl Marx – dürften mit einer neuen sozialen Struktur von selbst verschwinden. Diese sollte die bislang Beherrschten zu Herrschenden machen und ihnen das Recht als Machtmittel, nun unter geänderten Vorzeichen als Instrument der »führenden Partei«, erhalten. Das bestimmte den Umgang mit Strafrecht und Kriminalität als Teil der »sozialistischen Revolution«, die sich nur gegen den Widerstand der alten Gesellschaft durchsetzen ließ.
»Schädlinge werden ausgemerzt«
Im Osten Deutschlands kam »der Sozialismus«, ebenso wie in den anderen Staaten Osteuropas, mit dem Sieg der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg. Die dort übliche Betrachtung des Rechtes als »Klassenfrage« und der daraus resultierende Umgang mit der Kriminalität war einer der Grundpfeiler der gesellschaftlichen Veränderungen. Wer an tradierten Rechtsvorstellungen festhielt oder sich den Umwandlungen entgegenstellte, galt schnell als »Schädling«, der »ausgemerzt« werden musste. Das aus der Landwirtschaft stammende Verb, das ursprünglich das Töten jener Schafe betraf, die zur weiteren Zucht der Herde ungeeignet schienen, beschrieb nun einen für »notwendig« erachteten Vorgang.
Angesichts der ungeheuerlichen Verbrechen der Nazis stieß er in Deutschland bei vielen auf Verständnis, denn über die Notwendigkeit eines Neuanfangs bestand in Ost und West Einigkeit. Das nicht nur physisch, sondern auch moralisch zerstörte Land hatte jegliche Maßstäbe verloren. Galten eben noch Kapitalverbrechen wie Mord und Raub als »Heldentaten«, musste nun fast eine ganze Generation zur Normalität zurückfinden. Gleichzeitig war strafwürdiges Verhalten, vom Diebstahl bis zum Schwarzmarktgeschäft, für die meisten Menschen die am ehesten realisierbare Überlebensstrategie. Die Kriminalität explodierte, deren Verfolgung stagnierte. In Art und Dimension glich sie sich in den verschiedenen Besatzungszonen und sank überall erst in den Jahren unmittelbar nach Gründung der deutschen Teilstaaten. Dann entwickelte sie sich entsprechend der unterschiedlichen gesellschaftlichen Verhältnisse.
In der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) wurde dazu mit Hilfe der Besatzungsmacht der radikale Ansatz einer Justizreform gewählt. Neben der Aufhebung der Gewaltenteilung ging es um ein »neues« Recht und ein »neues« Rechtsbewusstsein.
Dazu bedurfte es zunächst einmal neuen Personals. Im Osten waren bereits auf Befehl der Sowjetischen Militäradministration (SMAD) vom September 1945 sämtliche NSDAP-nahen Justizbedienstete entlassen worden. In den ab 1946 für die Ausbildung neuer Richter eröffneten Volksrichterschulen und den Zentralen Richterschulen der ostdeutschen Justizverwaltung auf Länderebene wurden in Lehrgängen von sechs Monaten, deren Dauer dann auf zwei Jahre anwuchs, neue Richter herangebildet. Das wichtigste Kriterium ihrer Auswahl war die Bereitschaft, das Recht künftig zur Herrschaftssicherung der Partei anzuwenden. Parallel dazu etablierte sich erneut die Ausbildung von Juristen an den Hochschulen. Als in der ersten Hälfte der fünfziger Jahre die Transformation der Juristischen Fakultäten im Sinne der Politik der SED abgeschlossen war, lieferten auch sie wieder Nachwuchs bei Richtern und Staatsanwälten. Damit galt das Volksrichterprogramm als abgeschlossen.
Die neue Funktion des Rechtes war derweil gesetzlich festgeschrieben. In den folgenden Jahren wurde sie in Etappen dem von der SED festgelegten, jeweiligen »Entwicklungsstand« der Gesellschaft angepasst. So bestimmte das erste Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) der DDR vom 2. Oktober 1952: »Die Rechtsprechung der Gerichte der Deutschen Demokratischen Republik dient dem Aufbau des Sozialismus, der Einheit Deutschlands und dem Frieden …« In der Neufassung vom 17. April 1963 stand dann die »Lösung der politischen, ökonomischen und kulturellen Aufgaben des Arbeiter-und-Bauern-Staates beim umfassenden Aufbau des Sozialismus« im Vordergrund. Ab dem 27. September 1974 forderte das GVG: »Die Rechtsprechung und die damit verbundene Tätigkeit der Gerichte haben zur Lösung der Aufgaben der sozialistischen Staatsmacht bei der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft beizutragen …«
Mit einem Verfassungsänderungsgesetz vom 5. Juli 1990 schafften die Volksvertreter der DDR diese Funktion des Rechtes ab. Damit war die mit der Justizreform eingeleitete Geschichte einer eigenen Rechtsprechung der DDR noch vor deren Auflösung als Staat beendet.
Bis dahin konnte im DDR-Recht alles kriminalisiert werden, was der von der SED vorgegebenen »politischen Linie« widersprach. Das war beileibe keine Geheimpolitik. Schon vor Gründung der DDR erklärte Rolf Helm, damals Generalstaatsanwalt des Landes Sachsen und später Direktor der Zentralen Richterschule in Potsdam-Babelsberg, in der Sächsischen Zeitung vom 12. Dezember 1947: »Ich werde als Generalstaatsanwalt alle mir zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um auf dem Boden der geschaffenen realen Demokratie die dunklen Kräfte der Reaktion, die faschistischen Elemente, die Saboteure des Aufbaus, die verbrecherischen Volksfeinde zu verfolgen und die Mehrheit, die Demokraten und Sozialisten, vor einer Minderheit politischer Wühler und Kapitalhöriger, Wucherer und Schieber zu schützen.«
Nur wenige Monate nach Gründung der DDR am 7. Oktober 1949 wurde damit mit grausamer Härte angefangen.
Die »Zeugen Jehovas« als erste Sündenböcke
Nachdem im April 1950 mit dem Prozess im Stadttheater Dessau gegen neun Führungskräfte der Deutschen Continental-Gas-Gesellschaft (DCGG) die Geschichte der »Ersten Instanz« am Obersten Gericht der DDR begonnen hatte und die Vorbereitung weiterer Wirtschaftsprozesse auf Hochtouren lief, schien es nun nötig, das »neue Recht« auch politisch anzuwenden.
Fand das Vorgehen gegen die großen Konzerne, deren Mitschuld am Krieg für viele außer Zweifel stand, breite Akzeptanz, sah es bei rein politischen Vorwürfen anders aus.
Vor der ersten Wahl in der DDR am 15. Oktober 1950, bei der es nur noch »Einheitslisten« zu bestätigen gab, protestierte der 18-jährige Schüler Hermann Joseph Flade aus Olbernhau im Erzgebirge mit rund 200 Flugblättern, die er mit einem Kinderdruckkasten fabriziert hatte. Als ihn eine VP-Streife beim Verteilen erwischte, stach er einem Polizisten eine nur wenige Zentimeter lange Klinge eines Taschenmessers in den Rücken. Daraus konstruierte der Staatsanwalt einen Mordanschlag, ein Exempel sollte statuiert werden. Im Saal der Gaststätte Tivoli fand ein Schauprozess statt, zu dem rund 1.200 Zuschauer aus den vorwiegend noch privaten Betrieben der Region entsandt wurden. Flade begriff offenbar überhaupt nicht den Ernst seiner Lage. Als Motiv gab er vor Gericht an: »Ich sagte mir, bei einer Wahl müsste auch eine andere Stimme gehört werden, da ich das nicht offen machen konnte, weil ich sonst von der Schule fliegen würde, musste ich das nachts im Geheimen tun.« Auftragsgemäß verurteilte das Gericht den Schüler am 10. Januar 1951 zum Tod unter dem Fallbeil.
Nun brach in ganz Deutschland ein Sturm der Entrüstung los. Flugblätter kursierten, an Hauswänden tauchten über Nacht Inschriften auf. Die noch nicht allzu fest im Sattel sitzende Staatsmacht reagierte. In der zweiten Instanz wandelte das Gericht das Todesurteil in fünfzehn Jahre Zuchthaus um. Hermann Joseph Flade verbüßte davon zwei Drittel in Bautzen, Torgau und Waldheim. 1960 wurde er amnestiert und ging in den Westen. 1980 starb er mit 48 Jahren an den Folgen der Haft.
Angesichts dieser und ähnlicher Erfahrungen konzentrierten sich nun die Bemühungen, den absoluten Machtanspruch der SED mit Hilfe der politischen Justiz zu demonstrieren, auf eine Gruppe von Leuten mit Westkontakten, die ohne besondere Ermittlungserfolge greifbar war, Überraschungen ausschloss und sich gegen den Inhalt jedweder Vorwürfe aus ihrem Selbstverständnis heraus kaum wehren würde.
Sie fand sich in den »Zeugen Jehovas« (Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania – Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft). Die »Zeugen Jehovas« erhielten in Deutschland 1921 die offizielle Rechtsfähigkeit und wurden ab 1922 als »gemeinnützig« anerkannt. Ein Jahr später errichteten sie ihr Büro in Magdeburg, 1926 wurde die »Internationale Bibelforscher-Vereinigung Deutscher Zweig« im Vereinsregister des dortigen Amtsgerichts eingetragen.
Wegen ihrer Totalverweigerung des Wehrdienstes und der Ablehnung des Führerkultes verboten die Nazis die »Zeugen Jehovas« und verfolgten die »Bibelforscher«. Da sich viele von ihnen weiter aktiv missionarisch und antimilitaristisch betätigten, folgten Strafen wegen »Wehrkraftzersetzung«. Die Krankenschwester Helene Gotthold aus Herne wurde Ende 1944 in Berlin-Plötzensee enthauptet.
Nach dem Krieg sah man die »Zeugen Jehovas« wegen des erlittenen Unrechts zunächst als NS-Opfer in der Sowjetischen Besatzungszone und erlaubte ihre »gottesdienstliche Betätigung«. Zusätzlich zu ihrem Büro in Magdeburg eröffneten die »Zeugen Jehovas« 1946 eine Zweigstelle in der amerikanischen Zone in Wiesbaden-Dotzheim.
Bereits vor Gründung der DDR geriet die Vereinigung in den Verdacht, Spionage zu betreiben. Ihre Mitglieder fertigten sogenannte »Gebietskarten« an, die Informationen über politische Entwicklungen, Adressen und besondere Vorkommnisse enthielten, und leiteten diese an ihre Zentrale in den USA weiter.
Walter Ulbricht entwickelte am 13. September 1949 ein Zehn-Punkte-Programm gegen die Aktivitäten der Gruppe. Innenminister Karl Steinhoff (SED) verbot die »Zeugen Jehovas«. Am 3. und 4. Oktober 1950 fand ein erster großer Schauprozess gegen sie statt.
Angeklagt waren neun führende Funktionäre des Vereins, darunter der hauptamtliche »Kreisdiener« für Westmecklenburg, Lothar W., und der Leiter der juristischen Abteilung der Wachtturmgesellschaft, Willi H., aus Magdeburg.
Den Kern der Anklage vor dem Obersten Gericht unter Leitung der späteren Justizministerin Hilde Benjamin (SED) bildete der Absatz 2 des Artikels 6 der DDR-Verfassung: »Boykotthetze gegen demokratische Einrichtungen …« Die Verfassung sagte, dass »Boykotthetze« ein Verbrechen sei, aber niemand wusste, worin es bestand und was sich dahinter verbarg. Im Prozess gegen die »Zeugen Jehovas« lieferte nun Hilde Benjamin eine folgenschwere Interpretation des Verfassungsartikels: »Artikel 6 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik ist ein unmittelbar anzuwendendes Strafgesetz. Die in ihm aufgezählten Handlungen stellen keine einzelnen Tatbestände, sondern Begehungsformen eines Tatbestandes dar.«
Mit dieser Formulierung war der Bruch zu den bisherigen, rechtsstaatlichen Auffassungen vollzogen. Der frühere Oberrichter am Obersten Gericht, Rudi Beckert, bewertete das so: »Das OG hat in seinen Urteilen Handlungen für strafbar erklärt, die in keinem Gesetz standen. Das traf vor allem auf den Verfassungsbegriff ›Boykotthetze‹ zu. Sie sollte alles erfassen, was die Grundlagen des Staates angreift, gefährdet oder zerstört … Wer also gegen den Staat auftrat, verletzte dessen Verfassung und konnte sich nicht darauf berufen, demokratische Rechte ausgeübt zu haben. Der Kreis war geschlossen; es war ein Teufelskreis.«
Die neun Angeklagten wurden wegen Verstoßes gegen Artikel 6 der Verfassung zu zweimal lebenslänglicher Strafe, dreimal fünfzehn Jahre, einmal zwölf Jahre, zweimal zehn Jahre und einmal acht Jahre Haft verurteilt.
Nach diesem »Pilotprozess« erhielten 21 weitere »Zeugen Jehovas« am 5. November 1950 vom Landgericht Dresden Haftstrafen von lebenslänglich (drei), zwölf Jahren (zwei), zehn Jahren (sieben), acht Jahren (vier), sieben Jahren (ein), fünf Jahren (zwei) und drei Jahren (zwei) wegen Spionage. Das Landgericht Magdeburg verurteilte am 18. Dezember 1950 sieben Mitglieder der Religionsgemeinschaft. Ein Angeklagter erhielt zehn Jahre Zuchthaus, zwei weitere je neun Jahre. Drei Urteile lauteten auf acht, eines auf fünf Jahre.
Wesentlich geringer fielen Verurteilungen Ende der fünfziger Jahre aus. Wegen seiner Betätigung für die »Zeugen Jehovas« schickte das Bezirksgericht Gera im Mai 1959 einen Bäcker für viereinviertel Jahre ins Zuchthaus. Das Bezirksgericht Cottbus verurteilte einen Bauern und eine Hausfrau im August 1959 zu einem beziehungsweise zweieinhalb Jahren Zuchthaus. Im November des Jahres sprach das Bezirksgericht Cottbus zwei Urteile von je zweieinhalb Jahren Zuchthaus aus.
Insgesamt kamen bis zum Ende der DDR fast 6.000 »Zeugen Jehovas« in Justizvollzugsanstalten und Haftarbeitslager. Mindestens 57 starben dort. Die makabre Dimension: Über 320 wegen ihres Glaubens Verfolgte saßen bereits unter den Nazis und dann in der DDR in Haft.
Als Religionsgemeinschaft staatlich anerkannt wurden die »Zeugen Jehovas« erst von der letzten SED-geführten DDR-Regierung am 14. März 1990, vier Tage vor deren Abwahl.
DDR-Minister vor Gericht
Die Prozesse gegen die »Zeugen Jehovas« zeigten die Bereitschaft des neuen Staates, mit härtesten Mitteln seinen Machtanspruch im Inneren zu sichern. Dazu diente die Strafe als Drohkulisse. Basierte die traditionelle Rechtsauffassung auf den Gedanken des italienischen Rechtsphilosophen und Aufklärers Cesare Beccaria (1738–1794), der nicht die »Grausamkeit der Strafe, sondern ihre Unfehlbarkeit« als entscheidend nannte, hatte Lenin daraus inzwischen deren »Unabwendbarkeit« gemacht.
Den historischen Umständen geschuldet, gelangte diese Meinung in Stalins Interpretation in die DDR. Sein Inquisitor Andrej Wyschinski (1883–1954), offiziell Generalstaatsanwalt der Sowjetunion, nannte die Rechtsprechung ein Instrument, »um die gesellschaftlichen Verhältnisse zu festigen und zu entwickeln, die der herrschenden Klasse (dem Proletariat) vorteilhaft und genehm sind«. Der daraus resultierende Justizterror hob nicht nur jede Bindung des Rechtes an vorgegebene, sittliche Grundsätze auf, sondern machte es zur Gewalt. Geständnisse der Angeklagten, oft mit Folter erzwungen, galten als die wichtigsten Beweismittel, jegliche Verhältnismäßigkeit von Tat und Strafe wurde ausgeblendet. Ein gewöhnlicher Dieb konnte ebenso zum »Staatsverbrecher« werden, wie er die Chance hatte, als »Opfer der alten Verhältnisse« glimpflich davonzukommen.
Schuldig waren immer die anderen, wenn es im eigenen Land nicht klappte. Als Ende 1952 in der DDR selbst die Marmelade knapp wurde, schlug SED-Chef Walter Ulbricht im November auf der 10. Tagung des Zentralkomitees der SED einen abstrusen politischen Purzelbaum und behauptete, dass »… anlässlich der kürzlich aufgetretenen Versorgungsschwierigkeiten die Vertreter der überlebten Kapitalkräfte versucht haben, mit allen Mitteln die ökonomischen Gesetze des Sozialismus im Kampf gegen die Schaffung der Grundlagen des Sozialismus auszunutzen«.
Als Sündenbock wurde Minister Karl Hamann (Liberal-Demokratische Partei Deutschlands, LDPD) am 11. Dezember 1952 verhaftet und mit ihm fünf weitere Personen, denn es musste ja eine »Schädlingsgruppe« her. Nach nächtelangen Verhören in Berlin-Hohenschönhausen schrieb der Agrarwissenschaftler, damals 49, am 30. Januar 1953 sein handschriftliches »Geständnis«: »Meine Arbeit als Minister für Handel und Versorgung war eine verbrecherische Tätigkeit. Sie bestand in der Sabotage der Gesetze und Beschlüsse des Ministerrates und in der Verletzung der notwendigen Wachsamkeit.« Im Urteil vom 24. Mai 1954 hieß es dann, er und seine Mittäter »schufen … eine entscheidende Voraussetzung für die Auslösung der faschistischen Provokation vom 17. Juni 1953 …«. Dafür bekam Hamann lebenslang Zuchthaus, zwei weitere Urteile lauteten auf je acht Jahre, eines auf vier und eines auf drei Jahre Zuchthaus. Sein Mitangeklagter und vormaliger SED-Staatssekretär im Handelsministerium, Paul Baender (dessen Ehefrau ebenfalls fast zwanzig Monate in U-Haft saß), wurde zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Neben der Belastung seines Chefs war ihm auch die Rolle des Kronzeugen gegen den SED-Funktionär Paul Merker zugedacht, über den noch zu berichten sein wird.
Nachdem sich die politischen Wellen nach dem Aufstand 1953 geglättet hatten, stellte der Generalstaatsanwalt am 16. Juni 1954 einen Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens. Die Urteilsbegründung schnurrte von fünfzig auf fünf Seiten zusammen, von der Schädigung der DDR-Wirtschaft war nun keine Rede mehr. Karl Hamann bekam mit einem neuen Urteil zehn Jahre, Paul Baender sechs Jahre, zwei Angeklagte wurden zu je vier, einer zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt. Am 11. Oktober 1956 wurden sie von Staatspräsident Wilhelm Pieck begnadigt. Hamann ging 1957 in den Westen, Baender wurde wieder in die SED aufgenommen und arbeitete in leitenden Funktionen der Handelsorganisation (HO).
Den DDR-Außenminister Georg Dertinger (CDU) erwischte es am 15. Januar 1953. Neues Deutschland meldete zwei Tage später: »Die Festnahme erfolgte auf Grund seiner feindlichen Tätigkeit gegen die Deutsche Demokratische Republik, die er im Auftrage imperialistischer Spionagedienste durchführte.« Am 6. Juli 1950 hatte der Mitbegründer der CDU im Osten noch mit Polen das Abkommen über die Oder-Neiße-Grenze unterzeichnet. Jetzt stand der Politiker, der sich stets für die Einheit Deutschlands engagierte, gemeinsam mit dem vormaligen Staatssekretär im Justizministerium, Helmut Brandt (CDU), und vier weiteren Angeklagten als angeblicher Spion vor Gericht. Der frühere OG-Oberrichter Rudi Beckert konstatierte 1991 nach Durchsicht der alten Akten zur angeblichen Spionage: »Die meisten Fakten standen in der Tagespresse … Die Beweisführung war verdächtig oberflächlich.« Am 4. Juni 1954 wurde Georg Dertinger zu fünfzehn Jahren Zuchthaus verurteilt. Brandt bekam wegen »staatsfeindlicher Arbeit« zehn Jahre Zuchthaus, wurde 1958 entlassen und zwei Tage danach, nun wegen »Republikflucht«, zu weiteren zehn Jahren verurteilt. 1964 kaufte ihn die Bundesrepublik als einen der ersten politischen Häftlinge frei. Die anderen Angeklagten erhielten Zuchthausstrafen zwischen drei und dreizehn Jahren.
Der einstige Außenminister Dertinger wurde im Mai 1964 begnadigt. Danach arbeitete der gebrochene Mann, inzwischen 62 Jahre alt, als Lektor für den katholischen St. Benno Verlag in Leipzig und bis zu seinem Tod im Januar 1968 bei der Caritas in Dresden. Seine Ehefrau wurde zu acht Jahren Zuchthaus verurteilt, die sie auch verbüßte. Der damals mit fünfzehn Jahren älteste Sohn Rudolf erhielt drei Jahre Zuchthaus. Zwei jüngere Kinder kamen zu Pflegeeltern.
Wie weit die Verbiegung des Rechtes in solchen politischen Fällen ging, beschreibt Rudi Beckert am Beispiel des Prozesses gegen eine ehemalige Mitarbeiterin Dertingers vor dem Bezirksgericht Rostock. Die Frau wurde am 15. Januar 1953 verhaftet, um gegen ihren vormaligen Chef auszusagen. Das konnte sie nicht, weil sie nichts wusste. Daraufhin warf man ihr vor, während der Untersuchungshaft »hetzerische Äußerungen« und damit »Boykotthetze« nach Artikel 6 der Verfassung begangen zu haben. Unter dem Druck der Anschuldigungen erlitt die Frau eine Haftpsychose, was ein psychiatrisches Gutachten vom 23. November 1953 belegte. Trotz der daraus resultierenden, zeitweiligen Unzurechnungsfähigkeit während der Ermittlungen verurteilte sie das Bezirksgericht am 19. Oktober 1954 zu drei Jahren Zuchthaus. Da sie nicht geständig war, wurde die U-Haft nicht angerechnet, so dass die Frau letztlich vier Jahre und neun Monate eingesperrt wurde, nur weil sie sich als willfährige Belastungszeugin verweigerte.
Hohe Strafen blieben keine Ausnahmen. Beispiele allein aus dem letzten Quartal 1954: In Halle wurden Else Bokanda und Felix Marbach am 4. Oktober wegen »Spionage« zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Sechs Mitangeklagte bekamen zwischen acht und fünfzehn Jahren Zuchthaus. Am 8. Oktober meldete die Volksstimme, dass in Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz) der frühere Sozialdemokrat Wilfried Arnold aus dem gleichen Grund zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt wurde, drei Mitangeklagte erhielten lange Freiheitsstrafen. Am 14. November verurteilte das Gericht in Magdeburg Manfred Naumann ebenfalls wegen »Spionage« zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe und vier Mitangeklagte zu Zuchthausstrafen. Das Bezirksgericht Cottbus verhängte am 1. Dezember gegen Regina Tietze eine lebenslange Strafe, vier weitere Angeklagte wurden zu Zuchthaus zwischen fünf und zwölf Jahren verurteilt.
Derartig drakonische Urteile waren nicht immer völlig aus der Luft gegriffen, aber in vielen Fällen unverhältnismäßig. Die Prozesse glichen inszenierten Propaganda-Spektakeln mit durchsichtigem politischen Hintergrund.
Das erfuhr Justizminister Max Fechner (SED), der für den Aufstand vom 17. Juni 1953 büßen sollte. Er hatte die Streiks für legal erklärt und war außerdem homosexuell. Das machte ihn nun zum »gefährlichen Staatsverbrecher«. Am 15. Juli 1953 wurde er verhaftet.
Der gelernte Werkzeugmacher, Jahrgang 1892, war seit 1921 Abgeordneter und Funktionär der SPD. Nach Widerstand gegen die Nazis und Haft im »Dritten Reich« engagierte er sich 1946 für die Einheit von KPD und SPD und arbeitete unter der Führung der Parteivorsitzenden Wilhelm Pieck (KPD) und Otto Grotewohl (SPD) gemeinsam mit Walter Ulbricht als gleichberechtigter stellvertretender Parteichef der SED. Das wurde Max Fechner nun zum Verhängnis, denn er geriet in die Machtkämpfe um die SED-Spitze.
Doch ihm war nichts nachzuweisen. Deshalb dauerte es zwei Jahre, bis der Generalstaatsanwalt in seiner Anklageschrift vom 15. März 1955 formulierte: »Er führte in seinem Ministerium einen hinterhältigen Kampf gegen die Funktionäre der ehemaligen KPD mit dem Ziel, sie aus leitenden Funktionen zu verdrängen …« Und: »Der Beschuldigte hat schwere Unzucht zwischen Männern betrieben.« Das reichte dann für ein Urteil von acht Jahren Zuchthaus am 24. Mai 1955.
Wenig später, nach dem XX. Parteitag der KPdSU 1956, war der Stalinsche Terror im Machtkampf nicht mehr opportun. Max Fechner wurde am 24. Juni 1956 per Begnadigung aus der Haft entlassen, jedoch nicht juristisch rehabilitiert. Für die PDS war das 1991 im Rückblick schon einmal der Beginn »einer ehrlichen und breiten Aufarbeitung stalinistischer Willkürmaßnahmen«. Diese dreiste Geschichtsklitterung der SED-Nachfolger blieb weitgehend unkommentiert, denn das Unrechtsurteil war ebenso vergessen wie die Rückkehr Max Fechners in den Schoß der »Genossen«. Sie gehörte zu den skurrilsten Ereignissen der DDR-Geschichte: Am 16. April 1966 nahm ihn Walter Ulbricht auf der Bühne in der Fernsehshow »Mit dem Herzen dabei« in die Arme, und alles schien – für beide Seiten – vergessen. Neun Jahre nach seinem Tod gab es 1982 eine Sonderbriefmarke.
Darüber konnte sich 1974 auch Paul Merker freuen. Bei ihm ging es zwanzig Jahre zuvor buchstäblich um Kopf und Kragen.
SED-Spitzenfunktionäre im Gefängnis
Paul Merker, Jahrgang 1894, war ein untadeliger Kommunist: KPD-Abgeordneter im Preußischen Landtag, 1934 bis 1945 Mitglied des Zentralkomitees und des Politbüros des ZK der KPD, illegale Parteiarbeit in den USA und in Nazi-Deutschland und schließlich bis Februar 1937 Mitglied des Sekretariats des ZK der KPD, das von Paris aus für die Anleitung der Partei in allen Emigrationsländern (mit Ausnahme der Sowjetunion) zuständig war. Nach der Internierung in Frankreich floh er in letzter Sekunde vor der Auslieferung an die Gestapo nach Mexiko.
Das wurde Paul Merker 1950 zum Verhängnis. Damals gehörte er zum 14-köpfigen Politbüro des ZK der SED und war Staatssekretär für Landwirtschaft der DDR. Dann kam aus Moskau der Befehl, in den neuen Latifundien nach »Verrätern« zu suchen. In Prag, Budapest und Sofia rollten bald Köpfe. Der Vorwurf war immer der gleiche: Kontakte zu Noel Field, einem Amerikaner, der die kommunistischen Emigranten unterstützte und nun als »Agent des Imperialismus« galt.
Walter Ulbricht wollte beweisen, dass auch er »revolutionäre Wachsamkeit« übte. Am 22. August 1950 wurde Paul Merker zusammen mit Reichsbahn-Chef Willi Kreikemeyer, der sich nach Stasi-Angaben wenig später mit drei Taschentüchern in der Zelle erhängte, dem Chefredakteur des »Deutschlandsenders«, Leo Bauer, dem stellvertretenden Pressechef der Regierung, Bruno Goldhammer, dem Chefredakteur des Neuen Deutschland, Adolf (Lex) Ende, und anderen aus der SED ausgeschlossen. Doch noch hielt Wilhelm Pieck seine Hand über Paul Merker. Er bekam einen Job als Gaststättenleiter in der Turmklause in Luckenwalde.
Als im November in Prag der Schauprozess gegen den Generalsekretär der tschechoslowakischen KP, Rudolf Slánský, begann, tauchte auch Paul Merkers Name auf. Nun ging es um eine angebliche »jüdisch-zionistische Verschwörung«. Slánský und zehn Mitangeklagte wurden gehenkt, Merker am 30. November 1952 in der DDR verhaftet. Er hatte sich für die Entschädigung der jüdischen Nazi-Opfer eingesetzt und begrüßte die Gründung Israels. Als Anklagepunkt fungierte jedoch seine West-Emigration. Am 30. März 1955 verurteilte ihn das Oberste Gericht nach einer geheimen Verhandlung als »französischen Agenten« zu acht Jahren Zuchthaus. Er wurde im Zuge der »Entstalinisierung« 1956 als körperliches Wrack entlassen. Auf seine Forderung nach Rehabilitierung ließ Walter Ulbricht verlauten, dass die »Freilassung von der Partei und von den staatlichen Organen als Rehabilitierung betrachtet« werde. 1957 wurde Merker wieder in die SED aufgenommen.
Für Walter Ulbricht galt damit der Stalinismus offiziell als überwunden, in der Praxis ging die Verfolgung unbotmäßiger Genossen weiter. Namen wie Walter Janka, Kurt Vieweg oder Heinz Brandt stehen für die nun folgenden Prozesse gegen in Ungnade gefallene Kommunisten.
Paul Merker arbeitete bis zu seinem Tod am 13. Mai 1969 als Fremdsprachenlektor beim Verlag Volk und Welt. Per Zentralorgan Neues Deutschland sandte ihm »die Partei« ein gutbürgerliches »Wir werden sein Andenken stets in Ehren halten« für »… seine Treue zur Sache des Volkes und des Sozialismus« nach. Als besonderes Verdienst des einstigen Politbüromitglieds galt nun nur noch die »erfolgreiche Arbeit als Vorsitzender des Kreisvorstandes der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft in Königswusterhausen«.
Leo Bauer wurde 1952 von den Sowjets als »US-Spion« zum Tode verurteilt, dann jedoch zu 25 Jahren Arbeitslager in Sibirien begnadigt. Er kam 1955 frei, ging in den Westen und engagierte sich in der SPD. Bruno Goldhammer saß seit April 1951 in Gewahrsam der Sowjets. Nach seiner Übergabe an die DDR verurteilte ihn das Oberste Gericht zu zehn Jahren Haft, 1956 wurde er im Zuge der »Entstalinisierung« entlassen und Chefredakteur der Freiheit in Halle. Adolf (Lex) Ende arbeitete nach seinem SED-Ausschluss als Betriebsbuchhalter des Hüttenwerks Muldenhütten und starb im Januar 1951.
Dass sich die SED bei diesen Urteilen zur Sicherung ihrer Macht nicht nur auf »große Fälle« beschränkte, sondern bis auf die Ebene der Kreise »durchgriff«, sicherte ihre Justiz.
Die Rechtspraxis
Wenn bis heute gern über den »sozialistischen Rechtsstaat« DDR fabuliert wird, wie es zum Beispiel der ehemalige OG-Präsident Günther Sarge in seinen 2013 erschienenen Memoiren Im Dienste des Rechts. Der oberste Richter der DDR erinnert sich tat, widerspricht das den über Jahrzehnte getätigten internen und öffentlichen Aussagen der SED-Führung.
So erklärte zum Beispiel Anton Plenikowski, damals im Zentralkomitee der SED für Justiz, Polizei und Staatssicherheit verantwortlich, im Januar 1952 vor Parteifunktionären: »Die Organe der Justiz sind Teile des Staatsapparates, und deshalb gelten alle die Anweisungen, Maßnahmen und Beschlüsse der Partei, die sich auf den Staatsapparat beziehen, auch für die Genossen im Justizapparat.«
Auf der »Babelsberger Konferenz« am 2. und 3. April 1958 forderte Walter Ulbricht: »Unsere Juristen müssen begreifen, dass der Staat und das von ihm geschaffene Recht dazu dienen, die Politik von Partei und Regierung durchzusetzen.«
Diese Auffassung vertrat auch Erich Honecker, die er auf dem IX. Parteitag der SED 1976 so formulierte: »Die Arbeiterklasse hat den historischen Auftrag, die sozialistische, die kommunistische Gesellschaft zu errichten, und dazu muss sie die Macht fest in der Hand haben. Die Macht ist das Allererste. Diesen Auftrag haben unsere Gerichte verstanden und auch unter den komplizierten Bedingungen des Klassenkampfes sich als zuverlässiges Instrument der Arbeiter-und-Bauern-Macht erwiesen.«
Nach dem XI. Parteitag 1986 legte das Justizministerium gemeinsam mit dem Obersten Gericht der DDR fest: »Die Beschlüsse des XI. Parteitages … sind verbindliche Grundlage für die Tätigkeit aller Gerichte.«
Angesichts dieser Grundlinien scheint die von Günther Sarge formulierte Beschreibung eines »sozialistischen Rechtsstaates« fragwürdig: »Ich verstehe darunter einen Staat, dessen Rechtssetzung dem international anerkannten Rechtsstandard entspricht, der diese Gesetze selbst einhält und auch durchsetzt, der sein Handeln nach den Gesetzen ausrichtet, den Bürgern gegenüber Fürsorge und Gerechtigkeit walten lässt und die in der Verfassung des Landes festgeschriebenen Rechte und Pflichten sichert. Unter diesen Prämissen war die DDR ein Rechtsstaat sozialistischer Prägung.«
Gesteuerte Gerichte
Für diese »sozialistische Prägung« sorgte die gesamte, seit 1952 geschaffene, Gerichtsorganisation der DDR. Strafrechtler Erich Buchholz bezeichnete sie als »unkompliziert, überschaubar und bürgernah«. Darüber gibt es unterschiedliche Ansichten.
Das Gerichtssystem der DDR umfasste drei Stufen vom Kreisgericht über das Bezirksgericht bis zum Obersten Gericht. Dieser Instanzenzug diente dazu, die Rechtsprechung homogen zu gestalten. Was das Oberste Gericht beschloss, galt für die unter ihm stehenden Gerichte als bindende Vorgabe. Heute gibt es – von wenigen Ausnahmen abgesehen – diese Präjudizierung nicht. Erstinstanzliche Entscheidungen zu einer Rechtsfrage gelten für den betreffenden Einzelfall, zu relativ gleichen Sachverhalten können durchaus unterschiedliche Urteile entstehen. Manche sehen in dieser Pluralität der Entscheidungen einen Beleg für die Unabhängigkeit des Rechtsstaates, andere bemängeln diese Praxis. Der hinter der Entscheidungsfreiheit stehende Gedanke geht davon aus, dass die klügsten Richter nicht zwangsläufig an den obersten Gerichten sitzen. Dennoch plädiert eine Vielzahl von Rechtsgelehrten derweil für die Einheitlichkeit der Rechtsprechung. In der DDR galt sie als hoher Wert und sollte durch den »demokratischen Zentralismus«, die »Einheit der sozialistischen Gesetzgebung« und die »Einheit des Gerichtssystems« garantiert werden. Dieser Ansatz hatte jedoch die Schwäche, als Hebel für das Durchsetzen politischer Interessen nutzbar zu sein, was auch rigoros praktiziert wurde.
Die Mehrzahl aller Strafsachen, soweit sie nicht an gesellschaftliche Gerichte, also Schieds- und Konfliktkommission, weitergegeben wurden, was bei etwa einem Viertel der Fälle geschah, verhandelten Kreisgerichte. Sie waren im Regelfall mit einem Berufsrichter und zwei Schöffen besetzt. Dabei hatten die Laienrichter die gleichen Rechte wie die Berufsrichter, zum Beispiel bei Akteneinsicht und direkten Fragen. Urteilsentscheidend war die Stimmenmehrheit.
DDR-Jurist Erich Buchholz sieht das positiv: »Das Strafverfahren vor den Gerichten der DDR war von überzogenen Förmlichkeiten befreit; es wurde in aller Regel bürgernah und für die Menschen im Gerichtssaal nachvollziehbar gestaltet. Schwere oder bedeutende Verbrechen wurden erstinstanzlich vor einem Senat des Bezirksgerichts verhandelt, der regelmäßig in der gleichen Besetzung verhandelte wie das Kreisgericht. Vor den ausschließlich mit drei Berufsrichtern besetzten Senaten des Obersten Gerichts waren anfangs besondere Prozesse in erster und letzter Instanz geführt worden. Später unterblieb das, und es wurde 1987 auch förmlich ein Rechtsmittel gegen erstinstanzliche Urteile des Obersten Gerichts eingeführt.« Fungierten die Bezirksgerichte als zweite Instanz, waren sie mit drei Berufsrichtern besetzt.
Westliche Kritiker bemängelten am DDR-Gerichtssystem von Anfang an, dass es ein Hebel zur »parteilichen Rechtsprechung« war und die Berufsrichter einer »Abhängigkeit von der SED« unterlägen. Bildeten die Bezirksgerichte die erste Instanz, konnten die Senatsvorsitzenden von der Schöffenliste abweichen und ihnen genehme Laienrichter heranziehen. Darin sah man im Westen einen Verstoß gegen das auch in der DDR geltende Prinzip des »gesetzlichen Richters« und unterstellte die Absicht, dadurch »Sondergerichte« schaffen zu können. Das Hamburger Nachrichtenmagazin Der Spiegel monierte in einer Titelgeschichte »Das Recht ist die Partei« vom 18. März 1959: »Das Oberste Gericht schließlich bearbeitet als zweite Instanz die Berufungen und Proteste gegen die erstinstanzlichen Entscheidungen der Bezirksgerichte, sowie als erste und zugleich letzte Instanz alle jene Strafsachen, die der Generalstaatsanwalt durch persönliche Anklage-Erhebung dem Obersten Gericht unterbreitet. Das bedeutet nichts weniger als eine Blankovollmacht für den Generalstaatsanwalt, in jedem Fall, der ihm als politisch interessant erscheint, den Angeklagten aller Rechtsmittel zu berauben: Das von den ausgesuchten Funktionären des Obersten Gerichts gefällte Urteil unterliegt keiner Nachprüfung mehr. Der Generalstaatsanwalt hat damit die Möglichkeit, jedwede Verwaltungsmaßnahme der Regierung … durch exemplarische Strafen zu unterstreichen, indem er einige Fälle, die ›gesellschaftstypisch‹ sind, herausgreift und die mehr oder minder zufälligen Opfer unter beifälligen Kommentaren der gesamten Zonenpresse aburteilen lässt.« Diese Einschätzung ergab sich nicht zuletzt auch aus offiziellen Verlautbarungen der DDR-Justiz.
Die politische Rolle des Obersten Gerichts unterstrich der erste Generalstaatsanwalt der DDR, Ernst Melsheimer, bereits in einem Artikel in der Neuen Justiz, Heft 1/1950: »Das höchste Gericht soll in den für die Grundlagen unseres Staates und für den Bestand unserer Republik entscheidenden Fragen Recht sprechen; es soll auf hoher, weithin dem ganzen Volk sichtbaren Plattform urteilen; es soll schnell und richtig urteilen. Der überragenden Bedeutung von Strafsachen, in denen es um solche Dinge geht, wird eine Aburteilung durch eine örtliche Instanz nicht gerecht; und oft genug können die unteren Instanzen und Staatsanwaltschaften nicht genügend überblicken, dass eine Straftat viel weitreichendere Wurzeln und viel weitergehende Folgen hat, als es vom örtlichen Horizont aus zunächst den Anschein hatte … Die … Aburteilung durch den höchsten Gerichtshof in breitester Öffentlichkeit stärkt und vertieft die demokratische Gesinnung und die demokratische Wachsamkeit der Massen.«
Schau- und Geheimprozesse
Die hier explizit betonte Öffentlichkeit fand in der Praxis schnell und oft umfangreiche Einschränkungen. Zahlreiche in der DDR geführte Geheim- und Schauprozesse sind bis heute Beleg dafür, mit Hilfe des Rechtssystems Unrecht begangen zu haben.
Ihr Hintergrund ergab sich aus dem immer wieder von der SED deklarierten Ziel der »Erziehung« durch das »sozialistische Recht«. Um dieses besonders wirksam zu erreichen, wurde die eigentlich als Rechtsgarant etablierte, allgemein öffentliche Verhandlung modifiziert. An die Stelle einer unbeeinflussten Öffentlichkeit trat nun ein manipuliertes Forum in einem Schauprozess. Es bestand aus »ausgewählten« Zuschauern, Presse, Rundfunk und Film und einer politisch bestimmten Berichterstattung darüber. Die so entstandene »Schau« dominierte oft den »Prozess« – trotz juristisch korrektem Vorgehen verwandelte sich das Gericht zur Agitationsbühne.
Dieses Anliegen erläuterte DDR-Generalstaatsanwalt Ernst Melsheimer auf einer Arbeitssitzung des Innenministeriums am 31. März 1953: »Die Öffentlichkeit soll wissen, was verhandelt worden ist, wenn dieses Wissen uns in unserer Entwicklung vorantreibt.« Das betreffe »alle Verfahren, die geeignet sind, die Ziele unseres Staates zu verwirklichen, die geeignet sind, die Beschlüsse … der SED zu verwirklichen«.
Die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage dazu dauerte bis zur Neufassung der Strafprozessordnung (StPO) 1968. In deren Paragraph 201 hieß es nun: »Termin und Ort der Hauptverhandlung sind so zu bestimmen, dass die Teilnahme an der Strafsache interessierter Bürger gewährleistet ist, um das Staats- und Rechtsbewusstsein der Bürger zu entwickeln, ihre Verbundenheit zu den Organen des sozialistischen Staates zu festigen, die erzieherische Wirkung der Hauptverhandlung zu erhöhen und die Kraft der Öffentlichkeit auf die Überwindung von Gesetzesverletzungen zu lenken.«
In der Praxis geschah dies, indem die Staatsanwaltschaft dem Gericht ihr Interesse an »erweiterter Öffentlichkeit«, faktisch jedoch einer Chiffre für eingeschränkte Öffentlichkeit, bekundete. Daraufhin entwickelte das Ministerium für Staatssicherheit in Abstimmung mit dem ZK der SED das »Drehbuch« des Prozesses. Dazu gehörte der als »Öffentlichkeit« auszuwählende Personenkreis, die Festlegung des Verhandlungsortes und die gesamte organisatorische Kontrolle der Abläufe. Damit wurden Prozesse möglich, an denen manchmal über hundert »Zuschauer« teilnahmen, die Angehörigen der Angeklagten aber im Saal »wegen Überfüllung keinen Platz fanden«.
So konnten durchaus auch »Geheimprozesse« vor einem großen Publikum stattfinden, denn die Geheimniskrämerei betraf nur die unkontrollierte Öffentlichkeit. Nach Paragraph 212 Absatz 2 StPO hatte das Gericht die Möglichkeit, »wegen Gefährdung der Sicherheit des Staates oder im Interesse der Geheimhaltung bestimmter Tatsachen« das Publikum auszuschließen. Entsprechend den Vorgaben des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) sollten die Staatsanwälte dies vor allem bei politisch motivierten Verfahren (»1er-Sachen«) veranlassen. Sie wurden inhaltlich sehr weit gefasst und gingen über tatsächlich sicherheitsrelevante Tatbestände weit hinaus. So fand zum Beispiel »asoziales Verhalten« seine politische Begründung darin, dass der Angeklagte in seiner psychischen Labilität ja möglicherweise »vom Gegner« missbraucht werden könnte. Wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen, bekamen die Angeklagten die Prozessdokumente nicht zugestellt, sondern durften sie lediglich unter Aufsicht lesen.
Der Unterschied zwischen Schau- und Geheimprozessen stellt sich damit im Wesentlichen so dar: Wollte die Partei den »Gegner« unschädlich machen, war der Geheimprozess das probate Mittel. Sollte »der Klassenfeind« überdies »entlarvt« werden, griff man zum Schauprozess.
Zu der im Paragraph 76 Absatz 1 StPO von 1952 festgelegten Pflicht, in allen Strafverfahren erster Instanz vor dem Obersten Gericht einen Verteidiger zu bestellen, auf den der Angeklagte nach Paragraph 76 Absatz 3 aber auch verzichten konnte, merkt der frühere Oberrichter Rudi Beckert an: »Auf eine weitere Besonderheit der Schau- und Geheimprozesse ist hinzuweisen, nämlich auf die Verteidigung der Angeklagten. In den fünfziger Jahren fällt auf: Waren die Verhandlungen öffentlich, wurden Verteidiger bestellt. Wurde hinter verschlossenen Türen verhandelt, ließ das Untersuchungsorgan oder der Generalstaatsanwalt meist vom Beschuldigten eine Erklärung unterschreiben, dass er auf einen Verteidiger verzichte. Dass solche Verzichtserklärungen gerade in bedeutsamen Prozessen dem Gericht überreicht wurden, lässt darauf schließen, dass man den Betreffenden – vorsichtig ausgedrückt – dahingehend beeinflusst hat. Ein unabhängiges Gericht wäre verpflichtet gewesen, einzuschreiten.«
Auch nach der Änderung dieser Praxis, vor allem nach der Ergänzung des Strafprozessrechts durch das Gesetz vom 17. April 1963, blieb die Verteidigung vor den DDR-Gerichten oft eine Farce. Urteile standen vor Verhandlungsbeginn fest, Prozesse verliefen nach Drehbuch, und die letzte Entscheidung traf oft »die Partei«.
Die Allmacht der Staatsanwaltschaft
Getreu dem sowjetischen Vorbild bekam die Staatsanwaltschaft in der DDR eine bisher ungeahnte Machtfülle. Bereits das erste Gesetz über die Staatsanwaltschaft (StAG) vom 23. Mai 1952 war eine nahezu wortgetreue Kopie der entsprechenden sowjetischen Gesetze. Es erlaubte umfangreiche Aufsichtsrechte gegenüber allen staatlichen Behörden bis hinauf zu den Ministerien. Mit der Neufassung des Gesetzes vom 17. April 1963 wurde die Angleichung an das sowjetische Rechtssystem fortgeführt und die Generalstaatsanwaltschaft direkt der Volkskammer und dem Staatsrat der DDR unterstellt. Auch die letzte Änderung des StAG vom 7. April 1977 verankerte ausdrücklich die politische Lenkung der Justiz durch die SED: Die Staatsanwaltschaft »wacht in Verwirklichung der Beschlüsse der Partei der Arbeiterklasse auf der Grundlage der Verfassung, der Gesetze und anderer Rechtsvorschriften der Deutschen Demokratischen Republik über die strikte Einhaltung der sozialistischen Gesetzlichkeit«.
Neu in der deutschen Justizgeschichte war der »Rechtsbehelf der Kassation«. Er bestand im Recht des Generalstaatsanwalts der DDR, jedes rechtskräftige Urteil zu kassieren und eine Neuverhandlung vor dem Obersten Gericht zu veranlassen. Der Betroffene selbst hatte dabei kein Antragsrecht, sondern konnte nur darum bitten, das Urteil zu prüfen. Das geschah im Durchschnitt etwa 5.000 Mal pro Jahr, wobei mehr als 1.000 Anträge von Verurteilten, Geschädigten, Angehörigen oder anderen Bürgern Strafsachen betrafen.
Die Kassation war durch die Übernahme des Modells der sowjetischen Rechtsprechung als Paragraph 311 Absatz 2 in der Strafprozessordnung der DDR verankert und diente der Kontrolle innerhalb der zentralistisch organisierten Spruchpraxis. Zum Umgang damit definierte Paragraph 321 Absatz 1, dass diese »Kassation« dann zu geschehen habe, wenn das Urteil auf einer Verletzung des Gesetzes beruhte, sich der Strafausspruch als gröblich unrichtig darstellte oder die Begründung der Entscheidung unrichtig war. Mit dem 6. Strafrechtsänderungsgesetz vom 29. Juni 1990 (6. StÄG) wurde die Kassation erstmals de lege lata (»nach gelegtem Recht«) vom Kontroll- zum Korrekturinstrument. Nun war es nur noch möglich, sie zugunsten des Verurteilten zu betreiben, wenn sein Urteil eine schwerwiegende Rechtsverletzung darstellte oder der Strafausspruch als unrichtig festgestellt wurde. Diese Neuregelung nach dem Streichen der »führenden Rolle« der SED aus der Verfassung beendete die Betrachtung des Rechtes als Klassenfrage, die die DDR über vierzig Jahre begleitet hatte.
In der nachträglichen Diskussion hält sich die unterschiedliche Sicht auf die Funktion des Rechtes bis heute. Dabei wird – an die Auffassungen von Karl Marx und Friedrich Engels anknüpfend – von den Verfechtern des »sozialistischen Rechtes« unterstellt, dass es überall und zu jeder Zeit »parteilich« sei.
Von der Strafe zur Erziehung
Kommuniziert wurde der Gebrauch des Rechtes als Hebel parteilicher und damit auch staatlicher Macht als angeblicher Liberalisierungsprozess im Interesse der Bürger. Erich Buchholz, ab 1965 Professor für Strafrecht an der Humboldt-Universität, ab 1966 Dekan der Juristischen Fakultät, kommentiert mit Blick auf die Rechtsentwicklung in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre: Nun »wurde der ›gesellschaftlichen Erziehung‹ der Straftäter, vornehmlich in den Arbeitskollektiven, mehr zugetraut: Davon zeugen die 1957 eingeführten neuen Strafarten des öffentlichen Tadels und der bedingten Verurteilung, also von Strafen ohne Freiheitsentzug, sowie die Schaffung von Konfliktkommissionen in den Betrieben.« In der am 6. September 1962 erstmals gesendeten Fernsehdokumentation »Das Wort hat nicht der Staatsanwalt« wurde die Entstehung der Konfliktkommissionen in den Betrieben als Alternative zur herkömmlichen Justiz beschrieben und mehrfach festgestellt, dass dabei Gerichte durch »Arbeiter, zugleich Repräsentanten der Arbeitermacht«, ersetzt würden.
Entstanden waren die Konfliktkommissionen lange bevor sie 1961 durch das Arbeitsgesetzbuch der DDR (Paragraph 144 c) legalisiert und im Gerichtsverfassungsgesetz vom 17. April 1963 gesetzlich verankert wurden. Bereits 1953 bildeten sich erste Gremien in Betrieben, um Arbeitsrechtsstreitigkeiten zu entscheiden. Walter Ulbricht forderte auf dem 4. Plenum des ZK der SED im Januar 1959 eine größere Verantwortung und mehr Befugnisse für diese neue Art der gesellschaftlichen Gerichtsbarkeit, zu der dann ab 1963 auch die neuentstandenen Schiedskommissionen zählten. Ihren endgültigen rechtlichen Status bekam die »gesellschaftliche Gerichtsbarkeit« in der DDR mit dem neuen Strafgesetzbuch vom 1. Juli 1968. Im Paragraphen 28 legte es die Verantwortlichkeit der Konfliktkommissionen für eine Reihe von Verfehlungen in Betrieben, Einrichtungen der Kultur, des Gesundheitswesens, der Volksbildung und der gesellschaftlichen Organisationen fest. In Wohngebieten der Städte und Gemeinden und Genossenschaften übernahmen Schiedskommissionen diese Aufgabe. Das Gesetz bezeichnet beide als »gewählte Organe der Erziehung und Selbsterziehung der Bürger«.
Für Arbeitsrechtssachen waren die Konfliktkommissionen, für »arbeitsscheues Verhalten« dagegen die Schiedskommissionen zuständig. Galten »Vergehen« im Hinblick auf den eingetretenen Schaden und die Schuld des Täters als nicht »erheblich gesellschaftswidrig«, komplett aufgeklärt und von ihm zugegeben, konnten die zuständigen Untersuchungsorgane, Staatsanwaltschaften oder Gerichte die Verhandlung und Bestrafung an die Konfliktkommissionen übergeben. Bei Fahrlässigkeit war dies auch bei großen materiellen Schäden möglich. Weiterhin wurden von ihnen »Verfehlungen« am sozialistischen oder privaten Eigentum und Delikte wie Beleidigung, Verleumdung oder auch Hausfriedensbruch sanktioniert. Bei »Ordnungswidrigkeiten« musste gewährleistet sein, dass die gesellschaftliche Gerichtsbarkeit »erzieherische und vorbeugende Wirkung« entfaltete. Einfache zivilrechtliche und andere Rechtsstreitigkeiten um Geldforderungen konnten geführt werden, wenn die Höhe nicht über 500 Mark lag. Auch Verletzungen der Schulpflicht fielen an die Konfliktkommissionen. Tätig werden konnten sie nur auf Antrag von Geschädigten oder bei Antragstellung Berechtigter – Letzteres war zum Beispiel in Arbeitsrechtssachen so – und durch die Übergabeentscheidung der staatlichen Organe. Alle Verhandlungen waren öffentlich, jeder Teilnehmer an der Verhandlung durfte seine Meinung äußern.
Die vom Gesetz vorgesehenen Erziehungsmaßnahmen begannen bei der Entschuldigung des Rechtsverletzers beim Geschädigten oder vor dem Kollektiv. Weiterhin konnte die Verpflichtung zur Wiedergutmachung des angerichteten Schadens durch Arbeit oder Geld angeordnet werden. Die schärfere Strafe war die Rüge oder eine Geldbuße von 5 bis 50 Mark. Bei Eigentumsvergehen konnte sie bis zum Dreifachen des verursachten Schadens, nicht jedoch über 150 Mark reichen. Weitere Maßnahmen, wie zum Beispiel Rücknahme einer Beleidigung oder die Verpflichtung, unverzüglich einer geregelten Arbeit nachzugehen, waren ebenfalls möglich. Genügte bereits die Verhandlung vor der Konfliktkommission der Erziehung, gab es keine weiteren Folgen. Voraussetzung war immer, dass sich die Kontrahenten einigten, ansonsten ging die Sache vor das Kreisgericht. Gegen die Entscheidungen der gesellschaftlichen Gerichte war innerhalb von zwei Wochen ein Einspruch möglich. Er ging an das zuständige Kreisgericht. Der Staatsanwalt konnte seinerseits innerhalb von drei Monaten nach Beschlussfassung dagegen vorgehen.
Beide Formen der gesellschaftlichen Gerichtsbarkeit spielten in der Rechtspraxis der DDR eine große Rolle. Waren es 1954 noch etwa 8.400 Beratungen, die die Konfliktkommissionen durchführten, stieg deren Zahl bis 1977 auf rund 60.000. Hinzu kamen etwa 23.000 Beratungen pro Jahr durch Schiedskommissionen. Das führte nicht nur zu einer erheblichen Entlastung der Gerichte, sondern auch zu neuen Wegen in der Rechtspflege. 1978 gab es in der DDR 25.358 Konfliktkommissionen mit 225.623 Mitgliedern und 5.124 Schiedskommissionen mit 53.448 Mitgliedern. Frauen waren darin mit etwa 40 bis 43 Prozent leicht unterrepräsentiert.
Der Schwerpunkt der Konfliktkommissionen lag mit rund 60 Prozent bei Arbeitsrechtssachen, in den Schiedskommissionen bei Mietproblemen und Streitigkeiten unter Nachbarn. Nur gegen rund 3,5 Prozent der Entscheidungen der gesellschaftlichen Gerichte gab es Einsprüche, etwa 1 Prozent davon musste aufgehoben oder verändert werden.
Möglich geworden war die letztlich erfolgreiche Arbeit der Schieds- und Konfliktkommissionen durch die Bemühungen um ein neues Strafrecht. Den Maßstab dafür setzte der V. Parteitag der SED im Juli 1958 mit der Feststellung: »Die weitere Entwicklung der Arbeiter- und Bauernmacht bedingt die Weiterentwicklung des sozialistischen Rechts, das den Willen der von Ausbeutung und Unterdrückung befreiten Menschen ausdrückt.« Das Anliegen dieser Weiterentwicklung sah man in »… der Erziehung der Werktätigen zur Arbeits- und Staatsdisziplin, zur bewussten Teilnahme am Aufbau des Sozialismus und zur Verteidigung des sozialistischen Vaterlandes gegen alle Angriffe der Feinde«.
Das nahm in den folgenden Jahren manchmal fragwürdige Formen an.
Faustrecht und Pranger
Von der »Faust der Arbeiterklasse« war gern mal die Rede, wenn es darum ging, unbotmäßige Mitbürger zu disziplinieren. Im Vorfeld des Mauerbaus um 1960 wandelte sich das eher symbolisch gemeinte Bild manchmal in Auswüchse sozialistischen Faustrechts.
Die DDR-Juristen erfuhren davon aus einem im Fachblatt Neue Justiz abgedruckten Urteil des Kreisgerichts Potsdam. Derartige Publikationen erfolgten immer dann, wenn die Entscheidung als »beispielhaft« galt.
Hier ging es um einen eigentlich banalen Fall: Ein Jugendlicher hatte mit seinem Kofferradio – »Heule« genannt – auf der Straße den Westsender RIAS gehört. Das missfiel einem Passanten. Er verlangte von dem Jugendlichen, auf DDR-Wellen umzuschalten, und als der dies nicht tat, zerschlug er das Radio. In seinem Urteil vom 15. Januar 1959 lehnte das Gericht Schadensersatz ab. Begründung: »Gemäß § 228 BGB handelt derjenige nicht widerrechtlich, der eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, um damit eine durch die fremde Sache hervorgerufene drohende Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden. Nachweislich hat der Kläger das Kofferradio so laut spielen lassen, dass auch andere Passanten den Hetzkommentar des RIAS hören konnten. Er hat sich damit eine Verbreitung von Hetze gegen unseren Staat zuschulden kommen lassen.«
Die SED-Zeitungen nahmen die Tendenz zur Selbstjustiz auf. Die Leipziger Volkszeitung titelte am 16. Juni 1961: »Mit Provokateuren wird abgerechnet« und lobte Schläger aus einem Metallbau-Betrieb, die einen Mann krankenhausreif geprügelt hatten, weil er mit einem Bier auf die Westpolitiker Ernst Lemmer und Willy Brandt anstoßen wollte. Leipzigs FDJ-Chef Horst Schumann gab am Tag des Mauerbaus, dem 13. August 1961, einen »Kampfbefehl« aus, in dem es hieß: »Mit Provokateuren wird nicht diskutiert. Sie werden erst verdroschen und dann staatlichen Organen übergeben. (…) Jeder, der auch nur im Geringsten abfällige Äußerungen über die Sowjetarmee, über den besten Freund des deutschen Volkes, den Genossen N. S. Chruschtschow, oder über den Vorsitzenden des Staatsrates Genossen Walter Ulbricht von sich gibt, muss in jedem Falle auf der Stelle den entsprechenden Denkzettel erhalten.«
Wenige Wochen später kam zum Faustrecht der sozialistische Pranger hinzu. In der Aktion »Blitz kontra NATO-Sender« setzten FDJ-Stoßtrupps Leute unter Druck, deren Fernsehantennen, nach dem bayerischen TV-Sender »Ochsenkopf« genannt, gen Westen wiesen. Die wurden »in Richtung Frieden« gedreht oder gleich abgesägt. Die Junge Welt lobte am 29. August 1961: »Eine besonders originelle Idee hatten die Freunde der FDJ-Organisation der Mathias-Thesen-Werft in Wismar. Sie schufen die Figur ›Tele-Conny‹, die all jenen an die Haustür geheftet wird, die noch immer die Fernsehsendungen des Westens empfangen. Sobald die Antennen aber Richtung Sozialismus zeigen, wird ›Tele-Conny‹ wieder abgeholt.«
Wer von derartigen an die »Kauft nicht beim Juden«-Parolen der Nazis erinnernden Aktionen verschont blieb, musste dennoch mit Diffamierungen rechnen. Darüber berichtete das FDJ-Blatt am 7. September 1961, als es frohlockte, dass »der unverbesserliche Otto P.« aus Bad Düben »entlarvt« wurde: »P., der Westfernsehen mit Jugendlichen in seiner Wohnung organisierte und sich auch des Menschenhandels mit DDR-Bürgern schuldig gemacht hat, wurde inhaftiert. Seine Antenne wurde abgesägt, auf dem Marktplatz in Bad Düben für alle Einwohner sichtbar ausgestellt und daneben auf zwei Bildern geschrieben: ›Wir dulden keine Lügen und Hetzantennen – durch sie wurde P. zum Verbrecher an der Arbeiterklasse.‹« Auch andere Zeitungen ergingen sich in langen Abhandlungen über die Wechselbeziehungen zwischen »Ochsenkopf-Antennen«, Staatsverleumdung und Gefängnis.
Diese Art der Selbstjustiz verlief im Sande, nachdem Walter Ulbricht per Interview in der JungenWelt vom 21./22. Oktober 1961 verkündete: »Wenn es bei uns noch kein Gesetz gibt, das überhaupt das Abhören von NATO-Sendern und das Betrachten des Westfernsehens auch im privaten Bereich verbietet, dann deshalb, weil unsere Regierung hofft, durch Erziehung, durch gesellschaftliche Beeinflussung, durch Aufklärung zu erreichen, dass alle unsere Bürger so einsichtig und vernünftig werden, sich nicht der raffinierten feindseligen Propaganda auch im privaten Bereich auszusetzen.«
Damit knüpfte er an den »Beschluss des Staatsrates der DDR über die weitere Entwicklung der Rechtspflege« vom 30. Januar 1961 an. Er sollte die turbulenten Kampagnen der vorangegangenen Jahre dämpfen und für die Bürger wieder mehr Rechtssicherheit im Sinne der »sozialistischen Gerechtigkeit« schaffen. Das bisherige Geschehen nannte man euphemistisch »Überspitzungen«, die es nun zu verhindern galt.
Dennoch flackerten sie immer wieder auf. Ende der sechziger Jahre richteten sie sich vor allem gegen Jugendliche und deren bevorzugte Musik. Manche Gaststättenleiter machten sich ihre Gesetze selbst und hingen Schilder mit Aufschriften wie »Nieten in Nietenhosen unerwünscht« und »Auseinandertanzen verboten« in ihren Lokalen auf. Wurde es trotzdem mal laut, führte die Volkspolizei die »Randalierer« zu und schnitt ihnen auch schon mal gewaltsam die Haare. Geschah dies gar »in Eigeninitiative« durch einen »klassenbewussten Arbeiter«, wie es im November 1968 der Leiter des »Klubs der Jugend und Sportler« in Leipzig, für die Stasi nebenbei als »Hartmut Rüdiger« tätig, veranlasste, wurde das sich wehrende Opfer bestraft und der Täter – der Hausmeister des Klubs – belobigt. Dass derartige Übergriffe gegen »Mistfinken« und »Gammler«, so die SED-Zeitungen, damals bereits über Jahre praktiziert wurden, belegt ein Vorfall aus der Ostberliner »Ernst-Wildangel-Oberschule«. Nachdem dort der FDJ-Sekretär einem Mitschüler gewaltsam die schulterlangen Haare abgeschnitten hatte, kommentierte Neues Deutschland unter dem Titel »Gegen Dreck« am 16. Oktober 1965: »Diese Tat der FDJler verdient volle Anerkennung. Sie sollte Schule machen, damit die Manie, wie ein verwildertes Ferkel herumzulaufen, sich nicht erst in unserem sauberen Staat ausbreitet. Es ist bekannt, dass manche Erwachsene etwas bedenklich sind, die gleichen Methoden wie die FDJler anzuwenden. Offensichtlich fürchten sie, als verkalkte Dogmatiker bezeichnet zu werden oder als Leute, die einen künftigen Hausherrn unserer Republik allzu sehr gängeln und seine bemerkenswerte Persönlichkeit verbiegen.«
Dass diese Art des »Faustrechts« über mehr als zwei Jahrzehnte praktiziert wurde, illustriert eine Eingabe an das Ministerium für Volksbildung vom Januar 1979, die 1996 in einem Dokumentenband veröffentlicht wurde. Darin hieß es unter anderem: »Mein Sohn (10. Kl.) besucht Berlin. An seiner Jacke trägt er ein Emblem von Lewis, dieses wird ihm durch vier Streifenpolizisten gewaltsam unter Drohung abgerissen, obwohl es zu dieser Zeit diese Hosen in der DDR zu kaufen gab. Daraufhin machte er sich ein Emblem aus der BRD, und zwar die Fahne … Darauf wurde er in seiner Schule vom Direktor aufgefordert, die Fahne zu entfernen … Danach traten einige Schüler nach Anstoß zur Selbstjustiz und beschädigten die Jacke erheblich genau wie die VP … Anschließend wurde eine FDJ-Versammlung angesetzt. Hier wurde er als einer am Rande der Gesellschaft und als Lügner sowie wir als Eltern auch hingestellt … Er wurde so erniedrigt, dass er am gleichen Abend versuchte, aus dem Leben zu gehen …«
Mit dem Verbot des Aufnähers »Schwerter zu Pflugscharen« im November 1981 wurden vorherige, ähnliche Übergriffe legalisiert und umfänglich, nun »offiziell«, sanktioniert.
Ein letztes Aufflackern von Tendenzen der Selbstjustiz, allerdings auf verbale Attacken begrenzt und gegen die bis dahin herrschende Ordnung gerichtet, gab es mit dem Einsetzen des Zerfallsprozesses der DDR. So ging zum Beispiel am 10. Oktober 1989 ein Drohbrief an einen Tischler in Ribnitz, in dem es hieß: »Wenn Du Kommunistenschwein noch einmal die Fahne aus dem Fenster hängst, schlagen wir Dich tot. Neues Forum Ribnitz.« Am 9. November 1989 bekamen Mitarbeiter des Rates der Stadt Kühlungsborn Post: »Sekretär des Rates. Du wirst jetzt verurteilt. Verdufte sofort aus Deiner Wohnung. Folgst Du nicht, blasen wir Dir das Licht aus!« Am 17. November 1989 verkündete ein anonymes Schreiben an die SED-Kreisleitung Stralsund: »Das Volksgericht in der ›DDR‹ – Todesurteil gegen … (5 Namen). Hinrichtungsarten: Totprügeln oder erhängen.«
Vorfälle wie diese, von einer unbändigen Wut über die nun zutage tretende Korruption und den Amtsmissbrauch unter den SED-Funktionären ausgelöst, veranlassten Prominente aus Politik, Kultur und Wirtschaft, wie Schriftsteller Stephan Hermlin, Altbischof Albrecht Schönherr, Rockmusiker Toni Krahl, Dramatiker Volker Braun, Schauspielerin Jutta Wachowiak, den Dresdner Oberbürgermeister Wolfgang Berghofer, Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer und andere, am 4. Dezember 1989 einen Appell für eine Sicherheitspartnerschaft zwischen Bürgerkomitees und den staatlichen Organen zu initiieren: »Im ganzen Land gibt es Bekundungen des Zorns und der Empörung über Machtmissbrauch, Korruption, Verbrechen und Versuche zur Verdunklung krimineller Vorgänge. Das ist auch unser Zorn und unsere Betroffenheit. Es gibt Anzeichen, dass aus diesem berechtigten Zorn Handlungen erwachsen, die in die Gefährdung der Sicherheit der Bürger und des Lebens münden könnten.« Die Aufrufe waren erfolgreich, Vernunft setzte sich durch. Selbstjustiz fand letztlich nicht statt.
Die Entwicklung zeigte aber, dass sich die Bürger nicht mehr als Objekt behandeln lassen wollten, zu dem sie das Recht der DDR über Jahre gemacht hatte.
Der Bürger als Objekt
Ende der fünfziger Jahre beschleunigte sich im Osten Deutschlands die Abkehr von der traditionellen bürgerlichen Rechtsprechung. Auf dem V. Parteitag der SED verkündete Walter Ulbricht 1958: »Das sozialistische Recht ist ein wichtiges Mittel zur Entwicklung und Festigung des sozialistischen Bewusstseins der Bürger.« Schon bis dahin hatte das Leben in der DDR den Bürger mehr und mehr zu einem Objekt gemacht. Zehntausende reagierten darauf mit dem Verlassen des Landes gen Westen – noch waren die Grenzen in Berlin offen –, andere arrangierten sich mit den Gegebenheiten. Nun wurde »das Neue« auch offiziell: Das »sozialistische Recht« sah nicht mehr den Schutz der persönlichen Lebensumstände, sondern den des »sozialistischen Vaterlandes« als Schwerpunkt an.
Dieses Überwiegen der Generalprävention – vom Volk meist als Sprechen von »Abschreckungsurteilen« verstanden – war auch in der DDR umstritten, aber es entsprach dem »Erziehungsziel« der Partei. Faktisch machte es Einzelne für die angenommene latente Neigung Anderer, die gleiche Straftat zu begehen, verantwortlich. Da der Beschuldigte damit für etwas einstand, das außerhalb seines Einflusses lag, entstand ein Konflikt zur zentralen Absicht des Rechtes, die Rechtsgüter jedes Einzelnen zu schützen. Die Reformbestrebungen liefen nun jedoch darauf hinaus, mit dem Strafrecht die Staatsbürger nicht nur von der Begehung von Verbrechen abzuschrecken, sondern ihnen auch politische Verhaltensweisen vorzuschreiben.
Dieses Anliegen ging mit neuen Definitionen der Rechtsverletzungen einher, denn die Strafe blieb ein unverzichtbares Machtmittel des Staates. Die Hoffnung vom Absterben der Kriminalität erfüllte sich nicht. Daraus ergab sich die Suche nach der Gewichtung zwischen den gesellschaftlichen Ursachen der Kriminalität und der Notwendigkeit von Strafe. Ihre Ergebnisse schlugen sich dann in dem 1968 in Kraft gesetzten neuen Strafgesetzbuch (StGB) nieder. Es konzentrierte sich auf politische Delikte. Gleichzeitig wies das Gesetz neue Wege, kriminelles Handeln politisch zu bewerten. Das Strafrecht unterschied dazu zwischen Verbrechen, Vergehen, Verfehlungen und Ordnungswidrigkeiten. Als wichtigstes zu schützendes Rechtsgut sah es die eigene Existenz, deren permanente Bedrohung durch äußere Kräfte gesehen wurde.
In diesem Sinne definierte das Strafgesetzbuch nun: »Die erste Art von Verbrechen – Verbrechen gegen die Souveränität der Deutschen Demokratischen Republik, den Frieden, die Menschlichkeit, die Menschenrechte und Kriegsverbrechen – ist Bestandteil und Ergebnis der aggressiven imperialistischen Kriegs-, Eroberungs- und Unterdrückungspolitik … Sie stehen im antagonistischen Widerspruch zur gesamten friedliebenden Menschheit und besitzen zunehmend internationalen Charakter.« Entstehen konnten sie aus der Sicht der sozialistischen Strafrechtler nur außerhalb des Landes oder durch daher rührende Einflussnahme: »Die Verbrechen gegen die Deutsche Demokratische Republik – Staatsverbrechen – … sind Ausdruck und Bestandteil der vom imperialistischen Weltsystem betriebenen Hetz- und Wühltätigkeit gegen die DDR und die anderen sozialistischen Staaten. Sie stellen ihrem Charakter nach eine von außen inspirierte oder organisierte staatsfeindliche Tätigkeit gegen die DDR und andere sozialistische Staaten dar und sind deshalb konterrevolutionär-interventionistische Verbrechen.«
Ganz anders sah es mit Taten aus, die die Bürger des Landes begingen: »Die Verbrechen der allgemeinen Kriminalität – z. B. § 112 (Mord), § 113 (Totschlag), § 162 (verbrecherischer Diebstahl und Betrug zum Nachteil sozialistischen Eigentums), § 164 (verbrecherische Beschädigung sozialistischen Eigentums) und § 181 StGB (verbrecherischer Diebstahl und Betrug zum Nachteil persönlichen und privaten Eigentums) – unterscheiden sich in ihrer sozialen Qualität von den oben genannten Verbrechen.« Da sie ja eigentlich im Sozialismus »aussterben« sollten, wurden sie mit äußeren Einflüssen erklärt: »Sie sind nicht unmittelbar von imperialistischen Agenturen inspiriert oder organisiert. In ihnen drücken sich jedoch oft die Existenz und die Einflussnahme des imperialistischen Systems aus.« Dennoch störten sie das gesellschaftliche Gefüge des Landes: »Das soziale Wesen der Verbrechen der allgemeinen Kriminalität besteht darin, dass der Täter eine gesellschaftsgefährliche Handlung begeht, durch die das Zusammenleben der Bürger, das Verhältnis der Bürger zum Staat und zur Gesellschaft, die Rechte und Interessen der Bürger schwer beeinträchtigt und damit der Entwicklung von Beziehungen sozialistischen Typs schwerer Schaden zugefügt wird.«
Der Blick auf die weiteren Taten war milde: »Alle anderen Rechtsverletzungen sind keine Verbrechen.«
Etwa 90 Prozent der Rechtsverletzungen krimineller Natur wurden demzufolge als Vergehen eingestuft. Sie galten im Unterschied zu den Verbrechen als »gesellschaftswidrig«, nicht jedoch als »gesellschaftsgefährlich«.
Die Lehrmeinung ging dabei von starken graduellen Unterschieden aus, sah die Ursachen aber ausschließlich in der bisherigen Geschichte: »Vergehen resultieren aus dem Wirken der mannigfaltigen materiellen und ideellen Überreste der Vergangenheit in den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen; aus dem Zurückbleiben einzelner Menschen hinter den gesellschaftlichen Anforderungen, ihrer mangelnden Integration in die sozialistische Gesellschaft. Diese Handlungen werden durch die vielfältigen Einflüsse des imperialistischen Systems ständig genährt oder neu belebt.«
Von den Vergehen zu unterscheiden waren Verfehlungen, die als »Handlungen, die unmittelbar den Bereich des Strafrechts tangieren, ohne selbst Straftaten zu sein«, definiert wurden: »Verfehlungen verletzen rechtlich geschützte Interessen der Gesellschaft oder der Bürger. Die Auswirkungen der Tat und die Schuld des Täters sind aber unbedeutend … Auch Verfehlungen sind eine bewusste Verletzung elementarer Regeln des Zusammenlebens.« Als Beispiele wurden hier Hausfriedensbruch, Beleidigung oder Verleumdung, geringfügiger Diebstahl oder Betrug zum Nachteil sozialistischen Eigentums oder zum Nachteil persönlichen oder privaten Eigentums genannt. Dazu sagte das neue Strafrecht: »Die einzelne Tat besitzt jedoch objektiv und subjektiv nicht mehr solche gesellschaftliche Bedeutung, dass auf sie mit Maßnahmen strafrechtlicher Verantwortlichkeit reagiert werden müsste, sondern es können andere Maßnahmen rechtlicher Verantwortlichkeit ergriffen werden, um diese Rechtsverletzungen zu ahnden. Andererseits kommt jedoch diesen Handlungen noch solche soziale Bedeutung zu, dass ihnen nicht allein mit moralischen Sanktionen begegnet werden kann, sondern strikt geregelte Maßnahmen der juristischen Verantwortlichkeit eingesetzt werden müssen, um die verletzten Rechtsbeziehungen wiederherzustellen und die Bürger zur strikten Einhaltung der Regeln zu erziehen.«
Als »Ausdruck von Disziplinlosigkeit und bewusster Negierung von staatlichen Maßnahmen, die der Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens dienen«, wurden Ordnungswidrigkeiten bezeichnet: »Sie richten sich in erster Linie gegen staatliche Leitungsmaßnahmen, indem eine den gesellschaftlichen Erfordernissen entsprechende Organisierung und Gestaltung notwendiger staatlicher Maßnahmen verhindert oder deren Wirksamkeit gehemmt wird, wirtschaftsleitende Maßnahmen beeinträchtigt werden, die öffentliche Ordnung und Sicherheit gestört wird, notwendige Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen in ihrer Wirksamkeit beeinträchtigt werden oder gesetzlich vorgesehene Kontrollmaßnahmen behindert oder erschwert werden.«