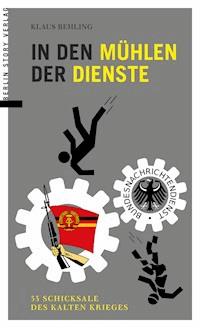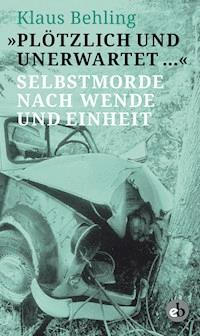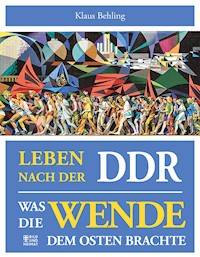Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bild und Heimat
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Auch in der DDR war Kulturgut eine begehrte Handelsware. Denn das kleinere Deutschland war zudem das ärmere. Tausende von früheren Schlössern und Gutshäusern, einstmals nicht nur Herrschafts-, sondern auch Kulturstätten, beherbergten nach dem Zweiten Weltkrieg Flüchtlinge und Heimatvertriebene, Schulen, Krankenhäuser und Dorfläden. Ob dafür die Vernichtung des Alten zwingend notwendig war, wurde immer wieder hinterfragt. Einerseits legte die DDR großen Wert auf die Pflege ihres "nationalen Kulturerbes", andererseits fehlten die Mittel, um Ererbtes zu bewahren. Das "Erwirtschaften von Devisen" galt als wichtiges politisches Ziel – das traurige Ergebnis: der Ausverkauf der Kulturgüter zwischen Ostsee und Erzgebirge. Klaus Behling bietet Tatsachen und Hindergründe rund um Kunsthandel und Kunstraub in der DDR auf, berichtet von geschehenem Unrecht und den Grauzonen der SED-Politik. Mit einem vorangestellten Essay von Bettina Klemm, die neues Licht auf unvollständig geklärte Kunstraub-Fälle in der Nachwendezeit wirft, ergibt dies einen Doku-Krimi voller brisanter Fakten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaus Behling
Auf den Spuren der alten Meister
Kunsthandel und Kunstraub in der DDR
Mit einem Beitrag von Bettina Klemm
Bild und Heimat
Von Klaus Behling liegt bei Bild und Heimat außerdem vor:
Leben in der DDR.
Alles, was man wissen muss (2018)
Von Bettina Klemm liegt bei Bild und Heimat außerdem vor:
Der Dresdner Kulturpalast. Eine Zeitreise von 1969 bis heute (2016)
Der Dresdner Fernsehturm. Eine Zeitreise von 1969 bis heute (2017)
eISBN 978-3-95958-767-9
1. Auflage
© 2018 by BEBUG mbH / Bild und Heimat, Berlin
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Umschlagabbildung: picture alliance / dpa / Zentralbild
Ein Verlagsverzeichnis schicken wir Ihnen gern:
BEBUG mbH / Verlag Bild und Heimat
Alexanderstr. 1
10178 Berlin
Tel. 030 / 206 109 – 0
www.bild-und-heimat.de
Prolog
Handelsware Kulturgut
Kunst und Kulturgut eines Landes sind keine Ware. Trotzdem wird überall auf der Welt damit gehandelt. Das ist immer ein recht ungleiches Geschäft. Flüchtigem Geld, das in aller Regel schnell verbraucht ist, stehen Stücke gegenüber, die damit eigentlich nicht aufzuwiegen sind. Im geringsten Fall stellen sie einen Teil der Erinnerungskultur dar. Sie können aber auch die kulturelle Identität berühren oder millionenschwere Werte sein.
Kunst und kulturelles Gebrauchsgut sind Speicher der Geschichte des Volkes. Ihre Bedeutung resultiert aus dem Lauf der Zeit. Ein Essgeschirr, das vor Jahrhunderten benutzt wurde, war damals nichts weiter als ein alltäglicher Gegenstand ohne großartige Beachtung. Heute wäre es ein wertvolles Zeugnis der Vergangenheit. Das Bildnis eines Fürsten mag seinerzeit Ausdruck unterwürfiger Unfreiheit gewesen sein. Heute weist es den Weg zu historischen Wurzeln – ganz egal, ob sie den Nachgeborenen gefallen oder nicht.
Aus dieser Sicht ist der Handel mit Kulturgut stets ein fragwürdiges Unterfangen. Er mündet schnell in eine Einbahnstraße, die dem einen nützt und dem anderen schadet, und stellt sich meist als Schacher zwischen Armen und Reichen dar. Natürlich versuchen dabei auch die Schwächeren, nicht allzu schlecht abzuschneiden. Aber die Zeit entfaltet unerbittlich ihre Wirkung. Selbst wenn immer nur ein wenig – und oft auch unwichtig Erscheinendes – von einem zum anderen wandert, häuft sich eine wachsende Masse auf. Sie verführt zu einer fatalistischen Betrachtung. Schnell heißt es: Wenn wir dies oder jenes schon nicht erhalten können, so verschwindet es durch den Verkauf wenigstens nicht völlig. Oder man verweist darauf, dass ja alles kontrolliert verlaufe. Der Verkäufer legitimiert so vor sich selbst das aus der Not geborene Geschäft.
Bei genauerem Hinsehen sind das oft nur Entschuldigungen, die den kulturellen Ausverkauf verschleiern sollen. Ärgerlich für viele Länder, die aus Armut ihr Kulturgut vermarkten, ist oftmals gar nicht einmal der Verlust, sondern das Gefühl des Unvermögens, es nicht schützen zu können.
Dieses Unbehagen war auch in der DDR weitverbreitet. Die Gegend zwischen Ostsee und Erzgebirge repräsentierte von Anfang an den ärmeren Teil Deutschlands. Was der Krieg übrig ließ, langte kaum zum Überleben. Tausende von früheren Schlössern, Guts- und Herrenhäusern, einstmals nicht nur Herrschafts-, sondern auch Kulturstätten, wurden zum Obdach für Kriegsflüchtlinge und Heimatvertriebene, zu Schulen, Krankenhäusern, Dorfläden oder LPG-Büros. Dazu zwangen die Verhältnisse, und es ließ sich sogar politisch begründen: Es sollte ja eine ganz neue Gesellschaft entstehen. Ohne Herren und Knechte. Ob dafür aber die Vernichtung des Alten tatsächlich zwingend notwendig war, wurde auch in der DDR immer wieder hinterfragt.
Antworten gab es nicht. Jahrelang schien die Arroganz der Macht ausreichend, sie zu verweigern. Man gewöhnte sich daran, dass aus einstigen Schlösschen Hühnerställe und aus uralten Parks Bolzplätze geworden waren. Manches fiel in den frühen Jahren Vandalismus anheim, anderes wurde einfach abgerissen. Die kulturellen Überbleibsel verschwanden in Depots.
Die offene Grenze bis 1961 erlaubte die Flucht von rund zwei Millionen Menschen aus der DDR. Es waren oft jene mit tiefen bürgerlichen Wurzeln. Mit ihnen ging viel vom Bewusstsein verloren, dass kulturelle Werte zum Lebensstil zählen und sie deshalb bewahrt und gepflegt werden müssen. Als sich nach zwanzig Jahren DDR auch dort bei manchen das Bedürfnis entwickelte, sich mit den Zeugnissen der Vergangenheit zu umgeben, war vieles bereits verloren.
Dies alles gestaltete sich als widersprüchlicher Prozess. Einerseits legte die DDR auf den Erhalt und die Pflege ihres »nationalen Kulturerbes« großen Wert. Gesetze schützten es, für den Wiederaufbau bedeutender Gebäude aus der Vergangenheit wurde viel Geld ausgegeben. Es gab liebevoll geführte Museen bis in die Kleinstädte, viele Menschen engagierten sich ehrenamtlich beim Erhalt von Kulturgut. Andererseits fehlten die Mittel, um Ererbtes zu erhalten. Innenstädte mit ihren kulturellen Zeugnissen verfielen. Das Volk sprach vom »Ruinen schaffen ohne Waffen«. Außerdem wurde Geld gebraucht, um das Hinterherhinken der DDR-Wirtschaft beim technischen Fortschritt nicht beständig größer werden zu lassen. Dieses Geld konnte nicht nur mit Waren erwirtschaftet werden, auch die Substanz musste herhalten. Kulturgut schien eine begehrte Handelsware zu sein.
Damit eröffnete sich ein neuer Konflikt: Welche kulturellen Gebrauchsgüter wären verzichtbar, was musste im Lande verbleiben? Oft gab es ein Tauziehen zwischen den Außenhändlern und den Kulturverantwortlichen. Meist gewannen die Verkäufer, denn politische Parolen wie »Alles zum Wohle der Republik« konnten sie ebenso wie die Bewahrer für sich reklamieren. Das »Erwirtschaften von Devisen« galt als das wichtigere politische Ziel. Ob das Ministerium für Geologie, das mit dem Verkauf von Fossilien und Mineralien dazu beitrug, oder das Ministerium für Kultur, dem der staatliche Kunsthandel unterstand – jeder hatte seinen Teil beizusteuern.
Es war kein Handel zum gegenseitigen Vorteil, sondern ein Ausverkauf. Er hat tiefere Spuren hinterlassen, als sie durch den erzielten Erlös beschreibbar sind. Sie verbinden sich mit geschehenem Unrecht und staatlicher Repression, mit den grauen Bereichen der DDR-Politik gegenüber der Bundesrepublik, mit Kriminalität und schließlich den Beutezügen von Spekulanten, als der zweite deutsche Staat in sich zusammenbrach.
Nach diesen Spuren wird hier gesucht.
Das große Erwachen
Ein Beitrag von Bettina Klemm
Kaum sechs Wochen nach dem Fall der Mauer vermeldete der Allgemeine Deutsche Nachrichtendienst (ADN) Alarmierendes. Am 20. Januar 1990 war zu lesen: »Der DDR-Kriminalpolizei ist am Freitag bekannt geworden, dass eine international organisierte Gruppe unter Einbeziehung krimineller Personen aus der DDR einen Kunstraub in den Staatlichen Schlössern Wörlitz im Bezirk Halle geplant hat … Wie das Ministerium für Innere Angelegenheiten mitteilte, wurden vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung dieser Straftat durch die Deutsche Volkspolizei eingeleitet.«
Eine solche Meldung war weder nur der sich damals gerade entwickelnden Pressefreiheit geschuldet, noch sollte sie nostalgisch an die verlorene »Sicherheit« von Mauer und Stacheldraht erinnern. Kriminelle in West und Ost gehörten einfach zu den Ersten, die bei ihrer »Arbeit« auf die künftige Einheit setzten. Dafür gab es durch die chaotischen Verhältnisse in der sich langsam auflösenden DDR die besten Voraussetzungen.
Der Spiegel (24/1991) berichtete von überforderten Polizisten und fehlenden beziehungsweise mangelhaften Sicherheitsvorkehrungen. So nahmen im Gemeinsamen Landeskriminalamt (GLKA) der fünf neuen Bundesländer Meldungen über Kirchen- und Museumsdiebstähle in der Ex-DDR »dramatisch« zu. Sprecherin Birgitt Griep erklärte, dass der Schaden allein für 1990 auf 32 Millionen Mark geschätzt wurde. Die Tendenz wäre steigend. In einem Beitrag der Nachrichtenagentur dpa war von 47 größeren Einbrüchen die Rede, zum Vergleich dazu wären es im Jahr zuvor fünf Diebstähle mit einem Gesamtschaden von einer Million Mark gewesen. Kriminalisten warnten vor der organisierten Kriminalität und befürchteten, dass dies erst der Anfang wäre. Durch die offenen Grenzen läge die Aufklärungsquote praktisch bei null, denn innerhalb weniger Stunden könnten die Kunstgegenstände in dunklen Kanälen verschwinden.
Liebespärchen auf textilen Tapeten im Schloss Wiederau gestohlen
Wie das Beispiel von Wiederau zeigt, machten die Täter selbst vor Tapeten nicht halt. Über dem Eingang des dreigeschossigen barocken Schlosses prangt die Zahl »1705«. Ein Leipziger Textilhändler hatte das Rittergut südlich von Leipzig 1697 gekauft und das Gebäude darauf errichtet. 1737 erhielt der kursächsische Geheime Rat Johann Christian von Hennicke das Anwesen. Zur entsprechenden Huldigungszeremonie erklang die Kantate »Angenehmes Wiederau, freue dich in deinen Auen«, die Johann Sebastian Bach eigens dafür komponiert hatte. Vielleicht hatte Bach damals den prächtig gestalteten Festsaal mit der illusionistischen Malerei vor Augen gehabt. Der Saal erstreckt sich über zwei Geschosse, an seinen Wänden und der Decke sind Szenen aus der antiken Mythologie zu sehen, gestaltet vom italienischen Maler Giovanni Francesco Marchini. Der Festsaal in Wiederau gilt als eines der letzten im Original erhaltenen Zeugnisse derartiger Ausmalung.
Für Schlagzeilen sorgte jedoch die textile Bildtapete im angrenzenden Raum. Auf ihr waren junge Mädchen und Liebespaare dargestellt. Der Wandschmuck besteht aus bemalter Leinwand, eine preiswertere Form als gewebter Gobelin. Nach Einschätzung des einstigen Leiters des Kulturamts Borna stammt dieser Wandschmuck ebenfalls aus dem 18. Jahrhundert und aus Italien.
Am 22. März 1990 hatten unbekannte Täter ein etwa drei mal dreieinhalb Meter großes Stück gestohlen. In Presseberichten wurde der Gesamtwert der Tapeten auf eine Million Mark geschätzt, der entwendete Teil soll etwa ein Viertel davon ausmachen. Bereits am 10. Juli 1990 teilte die Polizei dem Rat der Gemeinde Wiederau mit, dass die Ermittlungen gegen Unbekannt gemäß Paragraph 143, Ziffer 1 der Strafprozessordnung vorläufig eingestellt wurden. Im April 1990 hatte das Kulturamt die übrig gebliebenen Tapetenwände ausbauen und ins Schloss Schönwölkau bei Delitzsch bringen lassen. Dort wurden die wertvollen Textilien ab September 1990 restauriert. Die gestohlenen Tapetenteile konnten nicht gefunden werden.
Das stark geschundene Schloss erfuhr in den vergangenen Jahren eine grundlegende Sanierung. Diese sei noch nicht abgeschlossen. »Betreten Verboten!«, steht auf einem Schild am Eingang des Grundstücks. Der Eigentümer, die Sachsenerz Bergwerks GmbH, droht: »Jede Zuwiderhandlung wird strafrechtlich verfolgt!« Der Unternehmer Adalbert Geiger aus Baden-Württemberg hat das Schloss 2010 vom Freistaat Sachsen erworben. Bereits vier Jahre zuvor kaufte er das ebenfalls im Leipziger Raum gelegene Schloss Güldengossa. Nach eigenen Angaben hat er fünf Millionen Euro investiert, um das 1720 errichtete Herrenhaus zu sanieren. Es ist heute Stammhaus der Geiger Edelmetalle und öffentlich zugänglich.
Über das Schloss Wiederau spricht Geiger nicht so gern. Es gebe zu diesem Thema zu viele falsche Informationen und Spekulationen. 1906 hatte die Familie von Holleuffer-Kypke das Schloss geerbt. Konrad von Holleuffer-Kypke war zwar adlig, aber der Landwirtschaft und der Arbeiterbewegung verbunden. Auf seinem Portal »Historisches Sachsen« bezeichnet Heyko Dehn den Schlossbesitzer als »roten Baron«, der dennoch mit der Bodenreform enteignet wurde. Danach, so Adalbert Geiger, sei das Schloss im großen Stil und offiziellen Staatsauftrag geplündert worden. Doch darüber schreibe kaum jemand. Die Aufregung bezüglich der Tapetenfragmente hingegen sei groß.
Das Schloss Wiederau wurde zunächst als Notunterkunft für Vertriebene genutzt. Später zogen die Gemeindeverwaltung und ein Kindergarten ein. Seit 1976 stand es gänzlich leer. Auch der Denkmalschutz zeigte wenig Interesse an der Immobilie, er hatte sogar den Schutzstatus aufgehoben. Dem Schloss Wiederau und dem dazugehörigen Wirtschaftshof ging es wie zahlreichen anderen Denkmälern: Sie wurden zu DDR-Zeiten sträflich vernachlässigt. Der Leipziger Kulturbund hatte zwar seit 1976 versucht, mit Notreparaturen das Schlimmste zu verhindern, dennoch musste 1983 die Orangerie abgerissen werden. So hatten es die Diebe 1990 offensichtlich auch nicht schwer, in das Schloss zu gelangen. Erst nach dem Ende der DDR gab es Geld für die Sanierung. Zwischen 1994 und 1997 ließ das Land Sachsen das Dach und die markante gelbe Fassade instand setzen.
Diebe im Auftrag unterwegs?
Zu den »Kunstraub-Krimis« kurz nach dem Ende der DDR gehörte der Diebstahl auf der Burg Querfurt. Von jener Burg im Saalekreis in Sachsen-Anhalt hatten sich Diebe am 14. Juni 1990 aus beachtlicher Höhe aus dem Bilder- und Konzertsaal abgeseilt und drei Gemälde niederländischer Maler aus dem 17. Jahrhundert gestohlen. Dabei müssen sie über Insiderkenntnisse verfügt haben. Kurz nach der Maueröffnung zog es nur wenige Besucher in die Burg Querfurt.
Die Geschichte dieser Höhenburg, mit drei imposanten Türmen, zwei Ringmauern und starken Befestigungsanlagen, reicht bis ins 9. Jahrhundert zurück. Sie gehört zu den bedeutendsten mittelalterlichen Burgen in Deutschland und ist etwa siebenmal größer als die viel berühmtere Wartburg. Seit 1952 existiert im Korn- und Rüsthaus ein Burgmuseum. Im zurückliegenden Jahrzehnt wurden auf der Burg wiederholt Filme gedreht, vielfach mit namhaften Darstellern. So wird auch gern von der »Filmburg Querfurt« gesprochen.
Als Vorlage für ein Drehbuch könnte gleichsam der Gemäldediebstahl auf der Burg dienen. »Kuchenlieferung«, teilten die Diebe dem Pförtner mit und passierten mit zugedeckten Plastikstiegen ungehindert den Kassenbereich. Im ersten Stock hinter dem Saal, der mit acht Gemälden ausgestattet war, befand sich damals (und heute wieder) ein uriges Café. Jeden Nachmittag bekam es frische Kuchen und Torten geliefert. Da es kurz vor dem Café einen Lieferanteneingang gibt, wunderte sich auch niemand, dass die »Lieferanten« nicht wieder hinauskamen. Warum jedoch an diesem Tag niemand im Café die fehlende Kuchenlieferung beklagte, ist bis heute unklar.
Denn statt Kuchen befanden sich in den Stiegen Werkzeuge und Bergsteigerseile. Johanna Rudolph, von 1973 bis 2003 im Museum tätig und zur Tatzeit Direktorin, erinnert sich: Sie wurde gegen 23 Uhr angerufen, der Wachdienst, der regelmäßig mit einem Schäferhund die Runde drehte und mit einer Taschenlampe das Gebäude kontrollierte, hatte ein offenes Fenster entdeckt. Die Polizei kam schnell. An den Wänden fehlten drei Landschaftsbilder samt Stuckrahmen. Offensichtlich waren diese gezielt gestohlen worden, denn im Saal hingen damals auch wertvollere und größere Porträts.
Polizei und Museum rekonstruierten die Tat, Spurenhunde wurden eingesetzt. Noch heute steht im Saal ein dunkler, spätmittelalterlicher Schrank mit Eisenbeschlägen. Er ist etwa zweieinhalb Meter hoch und breit, aber nur fünfzig Zentimeter tief. Das Möbelstück wirkt wie drei übereinander gestapelte Truhen. Der Schrank steht etwa zehn Schritte von der Eingangstür entfernt. Zum Café sind es weitere 25 Schritte. Die Täter haben sich samt Werkzeuge in den Schrankfächern verborgen und gewartet, bis das Museum schloss.
In der Regel hatten die Mitarbeiter bei ihrem letzten Rundgang den Schrank noch einmal geöffnet, an diesem Tag aber nicht. Glücklicherweise, findet die Museumschefin, denn wer weiß, was dann geschehen wäre? Außerdem arbeitete an jenem Tag ein Mitarbeiter noch zu später Stunde im Fotolabor, das sich damals direkt hinter dem Saal befand. Er bereitete eine neue Ausstellung vor.
Bis auf den schon erwähnten Wachdienst und eine Schließanlage gab es im Museum kaum Sicherheitsvorkehrungen. Eine von einem Mitarbeiter selbst gefertigte Alarmanlage funktionierte nach dessen Eintritt in den Ruhestand nicht mehr.
Aufgeschreckt von dreisten Diebstählen in Meiningen und Dessau hatte die Museumschefin beim damaligen Rat des Bezirks um eine neue Alarmanlage gebeten. Im Schloss Elisabethenburg in Meiningen hatten Museumsmitarbeiter im Mai 1990 entdeckt, dass ein Gemälde von Adam Elsheimer, einem bedeutenden Barockmaler des frühen 17. Jahrhunderts, durch eine Kopie ersetzt worden war. Wie Der Spiegel berichtete, glaubt der damalige Museumschef, dass jemand das Gemälde am helllichten Tag »ausgewechselt« hat. In Dessau konnten zwei Täter gefasst werden, als diese sechs Gemälde aus dem Georgium entwendeten. Doch trotz derartiger Fälle bekam Johanna Rudolph eine ablehnende Antwort: Der Rat des Bezirks bestimme, was in welcher Reihenfolge wichtig sei.
Der Rekonstruktion durch die Polizei zufolge haben die Täter im Saal der Burg Querfurt die Bilder abgehängt, das erste Fenster mit rundem Bogen gegenüber vom Eingang geöffnet, ein Bergsteigerseil daran befestigt und sich samt der Bilder etwa acht Meter tief abgeseilt. Allzu groß und kräftig können sie nicht gewesen sein, denn das Fenster ist verhältnismäßig klein. Dann liefen sie über den nördlichen Burgzwinger und seilten sich nochmals von der Burgmauer etwa neun Meter in die Tiefe ab. An dieser Öffnung ist noch heute die Stahlstange zu sehen, an der das Seil befestigt war. Unten stand auf einem Seitenweg das Fluchtauto.
Der Diebstahl muss akribisch geplant worden sein. Danach gab es zahlreiche Vermutungen: 1988 hatte eine Techniksportgruppe die goldene Wetterfahne auf der Spitze des Turms erneuert. Es gab Führungen von Restauratoren-Studenten. Einigen Mitarbeitern wurde gekündigt, hat sich jemand gerächt? Am Ende blieb nichts Belastbares.
Die Diebe hatten es gezielt auf die Landschaftsmalereien abgesehen. Die Gemälde stammen aus der Galerie Alte Meister der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. »Die drei Gemälde aus unserem Bestand gingen 1964 als Dauerleihgabe an das Kreismuseum der Burg Querfurt«, teilt Carina Merseburger mit, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD). Dauerleihgaben der Gemäldegalerie Alte Meister an andere Museen seien nicht nur zu DDR-Zeiten üblich gewesen, sondern werden auch seit der Wende weitergeführt. So sind Leihgaben der Galerie Alte Meister natürlich im Dresdner Residenzschloss, aber auch im Dresdner Stadtmuseum, Schloss Moritzburg, Schloss Weißenfels, im Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg und sogar im Arbeitszimmer des Bundespräsidenten im Schloss Bellevue zu sehen.
Das größte der drei aus dem Saal der Burg Querfurt gestohlenen Gemälde ist mit 47,5 mal 63,5 Zentimetern der »Landweg mit Holzverschlag«. Gemalt wurde es von Pieter de Molijn (1595 –1661) in Öl auf Eichenholz. Im Vordergrund sitzt eine Frau mit weißer Haube an einem Baum vor einem Holzverschlag und betrachtet den Kopf eines vor ihr sitzenden Jungen. Ein stehender Herr mit großem Hut sieht ihnen zu. Im Hintergrund öffnet sich eine leicht hügelige Landschaft.
Die Maler Pieter de Molijn, Salomon van Ruysdael und Jan van Goyen zählen zu den Hauptvertretern der sogenannten tonalen Landschaftsmalerei, die sich in den späten zwanziger Jahren des 17. Jahrhunderts entwickelt hat. Zur Komposition der Bilder gehören spannungsgeladene Diagonalen, die die Waagerechte des Horizonts durchbrechen, die Farben sind zumeist sparsam verwendet worden. Das 17. Jahrhundert wird in der niederländischen Kunst und Kultur auch als das »Goldene Zeitalter« bezeichnet. Dessen wirtschaftliche und kulturelle Blütezeit sicherte den Künstlern gute Einkommen. Während in anderen Ländern der Hochadel und der Klerus die Künste förderten, hatte sich in den Niederlanden besonders durch den Handel mit den Kolonien eine ungewöhnlich breite vermögende Mittelschicht gebildet. Sie stellte einen riesigen Markt für den Absatz künstlerischer und gewerblicher Erzeugnisse dar. Um 1650 arbeiteten in den kleinen Niederlanden etwa 700 Maler. 70.000 Gemälde stellten diese pro Jahr her. Nach Einschätzung des Historikers und Journalisten Christoph Driessen sei dies in der Kunstgeschichte beispiellos, so etwas habe es weder in der italienischen Renaissance noch in Frankreich zur Zeit des Impressionismus gegeben.
Zu den bekannten Malern jener Zeit zählen auch Klaes (Nicolaes) Molenaer (1630 –1676) und Herman Saftleven (1609 –1685). »Windmühle am Flussufer« ist das 42 mal 36 Zentimeter große Ölbild auf Holz von Klaes Molenaer überschrieben. »Flusstal« hat Saftleven sein 42 mal 54 Zentimeter großes, in gleicher Technik gefertigtes Bild genannt. Auch diese beiden Kunstwerke wurden von der Burg Querfurt gestohlen. Bei Auktionen erzielten vergleichbare Gemälde dieser drei Maler Preise im unteren fünfstelligen Bereich.
Bis heute gibt es keine Spur zu den Tätern und zum Verbleib der Gemälde. Doch Carina Merseburger von den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden gibt die Hoffnung nicht auf und versichert: »Wir werden immer versuchen, Bilder, die zu unserem Bestand gehören, zurückzugewinnen. Ob es sich dabei um Diebstahl oder Kriegsverluste handelt, ist unerheblich. Im konkreten Fall haben wir die Eintragung in das Art Loss Register veranlasst, um einen Handel mit diesen Gemälden und einen damit verbundenen gutgläubigen Erwerb zu erschweren. Darüber hinaus sind die drei Gemälde in der Online Collection der SKD veröffentlicht.«
Abendmahlgerät in der Kiesgrube
Auf ein schnelles Geschäft hofften auch kleine Ganoven, wie ein Beispiel aus Dresden zeigt. Schreck in der Morgenstunde: Am 17. Januar 1991 war Pfarrer Joachim Deckert von der St.-Petri-Kirche am Großenhainer Platz in Dresden schon vor acht Uhr in der Kirche, denn ein Vertreter des Energieversorgers wollte den Zählerstand ablesen. Später gab der Pfarrer zu Protokoll, dass die äußere Tür zur Sakristei und ebenso alle Schränke offen standen. Als er in einen Verbindungsraum kam, musste er feststellen, dass die Türen zum Wandschrank gewaltsam geöffnet worden waren und die Gerätschaften für den Gottesdienst fehlten. Der Pfarrer rief die Polizei. Mehrere Türen waren wahrscheinlich mit einem Dietrich geöffnet, ausgehebelt und gewaltsam aufgebrochen worden. Der Schlüssel zum Hauptportal fehlte, normalerweise steckte er in der verschlossenen Tür von innen.
In einem Protokoll an seinen Kirchenvorstand hielt der Pfarrer fest: »Die Kripo sicherte eine Fußspur. Sonst konnte der Diebstahl im Wesentlichen nur registriert werden.« Er vermutete, dass sich die Täter durch die Tür am Türmchen Zutritt verschafft hatten, denn dort waren bleiverglaste Scheiben eingeschlagen worden. Gemeinsam mit dem Kantor stellte der Pfarrer eine Liste mit den gestohlenen Kunstgegenständen zusammen und übergab diese der Polizei. Die Anzeige wurde unter der Nummer K 2034/91 aufgenommen.
Der neugotische Backsteinbau der St.-Petri-Kirche mit dem 68 Meter hohen und schiefergedeckten Turm war 1890 geweiht worden. Nach den Unterlagen, die im Archiv vom Kirchspiel Dresden-Neustadt aufbewahrt werden, wurden bei dem Einbruch folgende Gegenstände gestohlen: vier 220 Millimeter hohe Abendmahlskelche sowie zwei weitere nur wenig größere Kelche, die jeweils eine Widmung von 1890 am geschwungenen Fuß aufwiesen. Zudem war eine Weinkanne mit Deckel und Kreuz entwendet worden, die die St.-Petri-Gemeinde 1890 von der Dreikönigskirche erhalten hatte. Auch die Hostienbüchse hatte einen Deckel mit Kreuz und war, so die Aufschrift, am 17. November 1895 von P. Dr. Albert gestiftet worden. Die dazugehörige große Patene hatte einen Durchmesser von 175 Millimetern. Die Kanne für das Taufwasser wies eine leichte Delle auf. All diese Gegenstände waren aus 800er Silber, die meisten davon hatte die renommierte Berliner Juwelierfirma Sy & Wagner gefertigt. Aus dem Altargeräteschrank wurden auch zwei Leuchter für vier Kerzen gestohlen, vermutlich waren diese aus Zinn. Zudem hatten die Diebe im Lutherzimmer aus einem Koffer einen vergoldeten Abendmahlskelch, eine Hostiendose und einen kleinen Leuchter entwendet. Außerdem ließen sie eine Kaffeemaschine und drei Tassen mitgehen. Der Gesamtwert wurde auf 50.000 Mark geschätzt, erinnert sich Pfarrer Deckert.
Nach dem Diebstahl gab es die nächste Hiobsbotschaft: Der im Frühjahr 1947 geschlossene Versicherungsvertrag stellte keinen ausreichenden Schutz dar. So wurde schließlich mit der Deutschen Versicherungs-AG ein »Vergleich« über 1.500 DM geschlossen. Offensichtlich war die fehlende Versicherung nicht nur das Problem dieser Kirche. Schon einen Tag nach dem Einbruch schloss die Landeskirche »globale Versicherungen« ab.
Doch die Geschichte fand ein gutes Ende: Rund zehn Wochen später spricht der Pfarrer von einem »großen Wunder« vor Ostern. Der Diebstahl hatte sich in der Kirchengemeinde schnell herumgesprochen. So meldeten sich bei der Polizei Zeugen: In einer Wohnung in der Nähe, in der junge Leute lebten, gehe Seltsames vor. Die Polizei ging dem nach und fand dort unter anderem eine Kaffeemaschine und einen kleinen Leuchter. Weil der Pfarrer gerade im Urlaub war, wurde Gemeindepädagogin Annemarie Jehmlich ins Präsidium gebeten. Die Doppelkaffeemaschine war erst kürzlich von einer Partnergemeinde im Westen spendiert worden. Sie hing eine Weile an der Wand und musste deshalb Kratzer an der Rückseite haben, erklärte Jehmlich. Treffer! Sie konnte auch das Muster auf dem kleinen Leuchter genau beschreiben.
Die Polizei konfrontierte die Bewohner der Wohnung mit diesen Aussagen und verhörte sie weiter. Der Kirchendiebstahl war nicht die einzige Tat, die ihnen angelastet wurde. Es ging beispielsweise auch um Motorraddiebstähle. Schließlich gab der dreißigjährige Franko K., einer der Bewohner, den Tipp, dass die Kirchenschätze in der Kiesgrube in Dresden-Leuben »sichergestellt« worden waren. Die Polizei bat die Tauchergruppe der Berufsfeuerwehr aus Leipzig um Hilfe. Nach mehrstündiger Arbeit, wie die Sächsische Zeitung berichtete, holten die Taucher am 19. März die Silberschätze vom Grund der Kiesgrube herauf. Bis auf den Deckel der Hostiendose erhielten Pfarrer Deckert und Oberkirchenrat Dr. Rainer Thümmel acht Tage später bei einem Pressetermin alle gestohlenen Gegenstände zurück. »Ich empfinde es als großes Wunder, dass wir die Dinge wiederbekommen«, wird seinerzeit der Pfarrer zitiert.
Um das Abendmahlgerät zum Gottesdienst am Ostermontag wieder nutzen zu können, hatten es Annemarie Jehmlich und andere Gemeindemitglieder kräftig aufpoliert. Bedeutender als der materielle Wert sei der ideelle. So erinnern die Gravuren von 1890 daran, dass die Silbergegenstände von anderen Gemeinden geschenkt worden waren.
Den Gemeindemitgliedern war das Abendmahlgerät wichtig. Sie sammelten Geld, um die Kunstgegenstände restaurieren zu lassen. Das übernahm wenig später die Werkstatt von Silberschmied Bernhard Greif. Um erneute Diebstähle zu verhindern, wurde der Wandschrank zum Tresor umgebaut.
Übrigens musste die Kirchengemeinde die Hälfte der Versicherungssumme zurückzahlen, weil ja die meisten gestohlenen Gegenstände im wörtlichen Sinne wieder aufgetaucht sind.
I. Schatzjäger auf Beutezug
Als in den siebziger Jahren die erste Nostalgiewelle über die DDR schwappte und plötzlich alte Wagenräder an Balkonwänden unerlässlich erschienen, waren die Bezirke Rostock, Schwerin und Neubrandenburg für Liebhaber echter Antiquitäten ein Geheimtipp. Dort fand sich schon mal eine Barocktruhe als Futterlade in der Scheune, ein edler Sattel im Stall oder ein dreihundert Jahre alter Zinnteller auf dem Hühnerhof. »Dat wier woll von’n Schloss«, hieß die übliche Antwort auf die Frage nach der Herkunft, und für eine Flasche »Weißen« oder »Braunen« und 20 Mark wechselte der Gegenstand schnell den Besitzer.
Für viele Bauern im ehemaligen Land Mecklenburg, zu dem nach dem Krieg auch Vorpommern gehörte, waren die Überbleibsel aus den Guts- und Herrenhäusern wertloses Zeug. Die oft im Haus oder Schuppen verbauten, zuvor sorgfältig abgeputzten Mauersteine schienen viel kostbarer zu sein. Auch sie kamen oft »von’n Schloss«.
Die meisten der enteigneten »Schlösser« gehörten bis 1945 Großgrundbesitzern. Viele waren in den letzten Kriegstagen mit den abrückenden Wehrmachtstruppen gen Westen gezogen, andere flohen vor der russischen Besatzungsmacht. Ihr Eigentum in Häusern und Höfen blieb zurück, manches wurde noch rasch vergraben oder anderswo versteckt – viel Aufhebens wurde darum nirgendwo gemacht. Damals beherrschten andere Sorgen den Alltag. Es ging ums tagtägliche Überleben und ein Dach über dem Kopf. Hunderttausende von Flüchtlingen aus den verlorenen deutschen Ostgebieten oder »Umsiedler«, die einstmals jenseits der neuen Grenzen lebten, standen buchstäblich auf der Straße. Die verlassenen Guts- und Herrenhäuser dienten ihnen oft als erste Unterkünfte.
Natürlich wussten die sowjetischen Besatzer, dass die einstigen Adelssitze meist eine Vielzahl von wertvollen Kultur- und Gebrauchsgütern bargen. Deshalb veranlasste die Sowjetische Militäradministration in Deutschland (SMAD) und danach die Sowjetische Kontrollkommission (SKK) auf der Grundlage ihres Befehls 209 vom 9. September 1947 »Schlossbergungen«, um Wertvolles zu sammeln und erst einmal einzulagern. Der Befehl galt jedoch vordringlich der Errichtung von »Neubauernhöfen«. Das ging mit der Beseitigung kleinerer Adelssitze in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) einher. Marschall Wassili Danilowitsch Sokolowski wies an: »Das Baumaterial sollte von zerstörten kriegszwecklichen Werken und Bauten, von zerstörten Bauten der früheren Güter und Ruinen herrenloser Gebäude unbehindert verwendet werden können.« Bis Ende 1948 mussten laut Befehl daraus in Mecklenburg mindestens 12.000 Wohn- und Wirtschaftsgebäude, in Brandenburg 10.000, in Sachsen-Anhalt 7.000, in Sachsen 5.000 und in Thüringen 3.000 Bauten entstehen.
Viele der zuvor geborgenen Objekte wurden künftigen Museen zugeteilt und wanderten dort meist in Depots, um sie nach dem Wiederaufbau präsentieren zu können. Durch die Enteignung wurden sie später zum Eigentum der DDR, »Volkseigentum« genannt. Anderes ging in die Sowjetunion. Fritz Adler, vor seiner Flucht 1950 in den Westen Chef des Stralsunder Kulturamts und Stadtarchivar sowie Bezirkskonservator für Vorpommern und Rügen, erinnerte sich an Möbel, Bilder und Urkunden, die längs des Schienenstrangs lagen, weil sie von den Waggons gefallen waren, die die wertvollen Stücke zur Verschiffung in den Hafen der Hansestadt bringen sollten.
Angesichts der Not nach dem Krieg galt der Rettung von niederrangigem Kulturgut und kulturellem Gebrauchsgut keine besonders große Aufmerksamkeit. Wohnraum war wichtiger. Die ostdeutschen Landesregierungen begannen, die Weisungen der sowjetischen Besatzungsmacht dazu durchzusetzen. Bernhard Quandt, ab 1948 Landwirtschaftsminister in Mecklenburg, erinnerte sich Jahre später: »Die Leute hatten ja nichts und konnten alles gebrauchen. Wenn sie auf dem Gutshof ein paar alte Teller oder Bestecke fanden oder ein paar Plünnen, die noch als Gardinen vor den Fenstern hingen, und das einfach mitnahmen, war das für uns in Ordnung. Es gab nichts zu kaufen, jeder musste sich selbst helfen.« Manche Bauersfrau hatte in der Nachkriegszeit die Leinwand eines großen Gemäldes so lange gekocht, bis die Farbe ausgewaschen war, um sich dann aus dem Stück Stoff eine Schürze zu nähen. Gobelins dienten als Abdichtmaterial in zugigen Ställen, und massive Möbel wurden zu Brettern.
Was nicht niet- und nagelfest war, verschwand stillschweigend. Damit begann die große Zerstörung der einstigen Guts- und Herrenhäuser in Ostdeutschland.
Nach der Verwaltungsreform von 1952 erhielten die neu gebildeten Kreisverwaltungen der DDR die Aufgabe, eine geeignete Verwendung der freien und noch nutzbaren Gutsgebäude vorzuschlagen. Die Denkmalpflege unterstand damals zunächst dem Ministerium für Volksbildung und dann der Staatlichen Kulturkommission für Kunstangelegenheiten. Planungen sahen vor, dass etwa 150 Herrenhäuser in der gesamten DDR als »erhaltenswert« angesehen werden sollten. Mehrere Tausend weitere Objekte – allein Mecklenburg verfügte vor dem Krieg über 2.328 Gutsbetriebe – fielen einer Verwertung als Wohnungen oder Räume für die Infrastruktur des Dorfes anheim. Sanierungsmaßnahmen wurden nicht eingeplant. Nicht mehr brauchbare Gebäude verfielen.
Das Schloss Kartlow in der Nähe von Demmin war ein Beispiel für den Umgang mit dem ungeliebten Adelserbe. Mitte des 19. Jahrhunderts hatte der Schinkel-Schüler Friedrich Hitzig das Herrenhaus nach dem Vorbild des französischen Renaissance-Schlosses Chambord gebaut. Bauherr war Woldemar von Heyden. Nach Plänen von Peter Joseph Lenné entstand ein Landschaftspark. Bis 1945 residierte dort die Familie von Heyden. In den letzten beiden Kriegsjahren beherbergte sie eine Wehrmachtseinheit vom in der Nähe gelegenen Fliegerhorst Tutow. Als die Rote Armee anrückte, floh Familie von Heyden mit den Offizieren der Luftwaffe gen Westen. Dadurch konnte sie einen Teil ihres wertvollen Besitzes mitnehmen. Doch sehr viel musste auch zurückgelassen werden.
Dann nutzte die Rote Armee Schloss und Park als Erholungsort. Schon im Herbst 1945 wurden zahlreiche Flüchtlinge im Herrenhaus und auf dem dazugehörigen Gutshof einquartiert. Der einstige Pferdestall beherbergte nun drei Familien und ab 1955 auch noch die LPG-Büros. Eine große Scheune wurde zur Gewinnung von Baumaterial abgetragen, zwei Gebäude fielen Bränden zum Opfer. Ins Schloss zog der Konsum und die Gemeindeverwaltung ein, und die Schule bekam ebenfalls einen Raum. »Der Sozialismus« hatte das Besitztum der Familie von Heyden übernommen. Und auch Soldaten waren wieder da, nun die der 1956 gegründeten Nationalen Volksarmee der DDR. Auf dem Flugplatz Tutow lernten sie das Fliegen der sowjetischen Düsenjäger MiG-15 und MiG-17. Deutsche und sowjetische Fallschirmjäger probten dort ihre Sprünge. Hin und wieder ging es auch zu Manövern ins Gelände.
Überraschung in der Latrine
Im September 1960 nistete sich während solch einer Übung eine NVA-Einheit in der Nähe des Schlosses Kartlow ein. Im Schlosspark wurde eine Latrine gegraben. Plötzlich stießen die Soldaten auf einen Widerstand. Eine Kiste kam zum Vorschein. Sie enthielt Teller, Schüsseln und andere Porzellanteile, alle aus der Königlichen Porzellan-Manufaktur Berlin (KPM). Die Soldaten suchten weiter und fanden schließlich fünf solcher Behältnisse. Die Fachleute vom Kreisheimatmuseum Demmin wurden zurate gezogen und identifizierten das alte Geschirr als Geschenk Friedrich des Großen an die Familie von Heyden. Er hatte es im Jahr 1768 gemacht.
Vorsichtshalber wanderte erst einmal alles in den Tresor. Damals galt der Alte Fritz in der DDR noch als übler Militarist, und niemand wollte vorlaute Fragen stellen. Außerdem reichte das Geld nicht, um die Stücke für eine komplette Ausstellung zu restaurieren – später waren bisweilen Einzelteile in Demmin zu sehen.
Viel Aufsehen erregte das alles wohl nicht, denn erst mehr als 25 Jahre später fanden sich Spuren des Latrinenfunds in den Stasiakten. In einem Aktenvermerk vom 19. September 1986 wurde festgehalten, dass damals eine noch im Dorf lebende frühere Haushälterin der Familie von Heyden den Museumsleuten die Herkunft des Porzellans aus dem Besitz ihrer einstigen Herrschaft bestätigt hatte. Auch der Abschnittsbevollmächtigte (ABV) der Volkspolizei hatte seinerzeit den Fund gemeldet. Neben den Kisten in der Latrine gab es eine weitere am »Fasanengebüsch« des Parks. Der ABV meinte, in allen seien Glas und Porzellan gewesen, altes Zeug eben.
Der Grund, sich überhaupt für die alten Sachen zu interessieren, war eine Anfrage aus dem Westen. Dort handelte die Familie von Heyden derweil mit Antiquitäten. Über einen befreundeten Händler ließ sie bei dessen Geschäftspartner Manfred Seidel, stellvertretender Chef des Bereichs Kommerzielle Koordinierung (KoKo) im Außenhandelsministerium der DDR, anfragen, ob es nicht möglich sei, ein paar Erinnerungsstücke aus Kartlow zu bekommen. Die KoKo beschäftigte sich mit der Erwirtschaftung von Devisen im Westen, und dabei gab es auch eine Sparte Kunst und Antiquitäten, deren Aktivitäten noch ausführlich zu betrachten sein werden. Manfred Seidel fungierte nebenbei als Offizier im besonderen Einsatz (OibE) des Ministeriums für Staatssicherheit. So gelangte die Nachricht vom »Heimweh des Grafen« auf den Schreibtisch des Ministers für Staatssicherheit, Erich Mielke.
Sie war mit einem verlockenden Angebot verbunden: Der frühere Besitzer wäre bereit, das Versteck der 1945 vergrabenen Pretiosen preiszugeben, wenn er dafür ein paar Sachen bekäme, die er aus seiner Kindheit auf dem Gut kannte und die ihn an schöne Tage erinnerten.
Nach ein paar unauffälligen Fragen im Dorf stellte sich schnell heraus, dass an dem Angebot etwas dran sein könnte. Gerüchte über vergrabene Schätze hatten den Lauf der Jahre überdauert. Herr von Heyden bekam eine »Aufenthaltsgenehmigung«.
Am 9. September 1986 erschien er in Kartlow. Ein »Herr vom DDR-Kulturministerium« begleitete den Gast, und einige Hilfskräfte für die beabsichtigte Schatzsuche standen bereit. In Wirklichkeit handelte es sich bei den »Gastgebern« um den obersten KoKo-Antiquitätenhändler Joachim Farken, für die Stasi als Inoffizieller Mitarbeiter (IM) »Hans Borau« tätig, und einige Leute der Stasi-Ermittlungsabteilung IX/7. Herr von Heyden führte den Trupp ins alte Sägewerk, doch die Grabung verlief erfolglos.
Der Stasi war das wohl ganz recht, denn der Graf kam ohnehin ungelegen. Ab 1985 hatten die Sowjets in Tutow ihr 368. Selbständiges Schlachtfliegerregiment stationiert. Die Truppe war mit hochmodernen Erdkampfflugzeugen des Typs Suchoi Su-25 ausgerüstet. Sie flogen seit 1981 auch Angriffe in Afghanistan, aber die offizielle Übernahme der Maschinen in die Bewaffnung der sowjetischen Streitkräfte wurde bis 1987 geheim gehalten. Autos der in Potsdam stationierten Alliierten Militärmissionen tauchten plötzlich auf – und nun auch noch der Besuch aus dem Westen! Im Ministerium für Staatssicherheit (MfS) in Berlin war man jedenfalls erst einmal froh, als der alte Herr unverrichteter Dinge wieder abzog.
Trotzdem wurde die Spur des vermeintlichen Schatzes weiterverfolgt. Vom 21. bis zum 24. Oktober 1986 durfte niemand aus dem Dorf auch nur in die Nähe des Gutshofs. Mit dem nötigen technischen Gerät untersuchten nun Spezialisten Zentimeter um Zentimeter. Und sie wurden fündig. Eine Porzellanfigur kam ans Licht, dann Geschirr, Vasen, Jagdwaffen, Glas und Munition – insgesamt 115 Teile. Einiges war verrottet und verrostet, aber ein paar Stücken aus Silber und Kristall hatte die feuchte Erde in über vierzig Jahren nichts anhaben können.
Anfang November begutachtete Wolfgang Hennig, der Direktor des Kunstgewerbemuseums in Berlin-Köpenick, die Fundstücke. Sie rissen ihn nicht vom Hocker, trotzdem stellte er aus der Sicht seines Hauses einen möglichen Ankaufswert von 21.510 Mark fest. Das Museum bekam als Dank eine Untertasse von 1820 und eine Korbschale aus Porzellan von 1908. Der Rest ging mit Zustimmung von Erich Mielke vom 19. November 1986 an Manfred Seidel von der KoKo, »zur Veräußerung über den Staatlichen Kunsthandel«.
Davon bekam der frühere Besitzer Wind, denn der Fund blieb im Dorf nicht unbemerkt. Der Pfarrer des Ortes gab dem Grafen per Brief einen Tipp. Der wandte sich nun an Manfred Seidel und forderte die Herausgabe. Bei der KoKo wollte niemand Ärger wegen der paar Fundstücke. Über einen Mittelsmann konnte der Graf die Gegenstände für den Vorzugspreis von 8.000 DM beim Kunsthandel kaufen. Das 1960 in der Latrine per Zufall entdeckte Geschirr bekam er nach der Wende umsonst zurück.
Für die Schatzsucher der Stasi war das alles keine große Sache, denn sie hatten längst ihr Geschäft mit dem nach dem Krieg in der DDR verbliebenen »herrenlosen Gut« gemacht. So blieb in diesem Fall nur eine Akte von 131 Seiten zurück, die Anfang 1987 in die »gesperrte Ablage« wanderte.
Dort waren derweil auch längst alle Unterlagen verschwunden, die auf einen Millionen-Coup der Stasi kurz nach dem Mauerbau 1961 hinwiesen.
Die Stasi macht »Licht«
Es sollte ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk für den DDR-Staats- und Parteichef Walter Ulbricht werden. Anfang der sechziger Jahre blühte die Hoffnung, nach der Schließung der Grenze nun endlich mit dem ungestörten Aufbau des Sozialismus voranzukommen. Erich Mielke als Minister für Staatssicherheit wollte das Seine dazu beitragen. Am 20. Dezember 1961 verfasste er ein streng vertrauliches Schreiben und wies die Ermittlung und Sicherstellung »bisher nicht ordnungsgemäß erfasster Wertgegenstände, die gesellschaftliches Eigentum« seien, an. Sie wurden bei jenen vermutet, die aus der Zeit von vor dem Krieg noch Bankschließfächer hatten und nun außerhalb der DDR lebten. Auch in den teilweise noch als Ruinen vorhandenen Firmensitzen großer Konzerne wollte man nachsehen.
All das brauchte natürlich den richtigen »politisch-ideologischen« Rahmen. Deshalb hieß es in den entsprechenden Befehlen, dass vor allem Dokumente zur »weiteren Entlarvung der Nazi- und Kriegsverbrecher in Westdeutschland« gesucht und gleichzeitig die »Sicherheitsstandards der Banken« überprüft würden.
Die ganze Sache bekam den Decknamen »Licht« und wurde als »konzentrierter Schlag« unter strengster Geheimhaltung geplant. Dazu lud der Minister die Chefs der Stasi-Bezirksverwaltungen für den 3. Januar 1962 zu einer Dienstbesprechung ein. Er legte den Start der »Aktion Licht« für den 6. Januar fest und wies an, die Ergebnisse »bis zum 9.1.1962, 12 Uhr an die zentrale Einsatzgruppe« zu übermitteln.
Sie waren ganz anders als erwartet. Neben alten Akten und persönlichen Papieren fanden die Ermittler in den geöffneten und aufgebrochenen Schließfächern eine Menge von Wertgegenständen. Die Unterlagen belegten, dass es sich bei vielen Sachen um den Besitz von vor den Nazis aus Deutschland geflohenen Juden handeln musste, und in manchen Fällen gingen auch die früheren Eigentümer aus den Bankunterlagen hervor.
Trotzdem erklärte die Stasi erst einmal alles zu »herrenlosem Gut«. Das weckte Begehrlichkeiten. Stasi-Major Dieter Skiba berichtete in einer Fußnote in seiner als »Vertrauliche Verschlusssache« eingestuften Diplomarbeit »Der Beitrag der Organe des MfS bei der konsequenten Verfolgung von Nazi- und Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit« an der Juristischen Hochschule des MfS vom 13. November 1980, also viele Jahre später: »Neben der Feststellung einer Reihe von Missständen und Unzulänglichkeiten seien insbesondere politisch-operativ auswertbare Dokumente und darüber hinaus auch eine Vielzahl von Wertgegenständen sichergestellt worden, so dass es notwendig sei, in einer Reihe weiterer Objekte ebenfalls derartige Prüfungshandlungen vorzunehmen. Solche in Frage kommende Objekte waren beispielsweise ehemalige Konzerne und Großbetriebe, Gutshöfe, alte Schlösser, Burgen und Museen sowie frühere Wohnsitze ehemaliger aktiver Faschisten und Kriegsverbrecher. Abgesucht wurden auch ehemalige Bergwerke, verschüttete unterirdische Anlagen der faschistischen Wehrmacht und Bunker sowie auch zerstörte Gebäude nach möglichen Verstecken.«
Vier Millionen Mark Diebesgut
Damals brachte der Raubzug einiges ein. Am 11. Juli 1962 meldeten die geheimen Schatzsucher befehlsgemäß ihrem Minister Erich Mielke: »Im Verlauf mehrerer Monate wurden durch das MfS Tresore und Safes sowie Blockschließfächer in den Einrichtungen des sozialistischen Finanzwesens, den Gebäuden und Einrichtungen ehemaliger kapitalistischer Bankunternehmen, die anderweitig genutzt werden, und in beschädigten oder teilweise zerstörten Gebäuden, die nicht mehr nutzungsfähig sind, überprüft. (…) Durch die Überprüfungsmaßnahmen wurden umfangreiche Mengen nicht erfasster Wertgegenstände sichergestellt, deren Gesamtwert – nach vorläufigen Schätzungen – auf 4,1 Mio DM beziffert wird. Darunter befinden sich: Gold- und Schmuckwaren sowie Edelsteine mit einem Wertumfang von ca. 1,5 Mio DM, Silberwaren mit einem Wertumfang von ca. 300 TDM, Briefmarken mit einem Wertumfang von ca. 1,1 Mio DM/West, Gold- und Silbermünzen, Medaillen, Ölgemälde, Kupferstiche, Porzellane und Glaswaren, historische Handschriften u. a. m. …«
Vieles davon ließe sich auf dem internationalen Antiquitätenmarkt verscherbeln. Natürlich konspirativ. Zur Beute gehörten mehr als 250 Gemälde, Kupferstiche und Radierungen, unter anderem von Lucas Cranach, Canaletto, Albrecht Dürer oder Rembrandt. Zudem gab es eine Menge Schmuckstücke und viele seltene Handschriften: Ob Busch, Fontane, Goethe, Hauptmann oder Heine, Schiller, Zola, Herder und die Komponisten Paganini, Reger, Strauss, Schumann und Wagner – alles dürften gut absetzbare Waren gewesen sein. Besonders wenn die Sammler nicht allzu pingelig nach der Herkunft der wertvollen Stücke fragten.
Bei der Stasi war man sich durchaus darüber im Klaren, dass das Auftauchen der Kunstwerke Nachfragen der einstigen Eigentümer provozieren könnte. In einem Vermerk von 1971 hieß es: »Bei den eingezogenen Gegenständen handelte es sich sowohl um Privatbesitz als auch um Vermögenswerte des faschistischen Staates. Hierbei ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass ausländisches Eigentum, geraubt durch faschistische Institutionen, in die eingezogene Masse gelangt ist.«
Deshalb gingen die Pretiosen nicht in den offiziellen Außenhandel der DDR, sondern wurden von der Stasi selbst an den Mann gebracht.
Hatte Erich Mielke 1961 die »Notwendigkeit« der »Aktion Licht« noch damit begründet, »Schieber- und Spekulantentum zu unterbinden«, wurde sie nun ganz nebenbei für einen seiner Offiziere zum Einstieg in dieses Geschäft. Günter Wurm war einer der mit dem heimlichen Verkauf der wertvollen Sachen im Westen betrauten Genossen. Er begann, in die eigene Tasche zu wirtschaften. Als das fast zwanzig Jahre später entdeckt wurde, hatten der Offizier und seine Komplizin ein Vermögen in zweistelliger Millionenhöhe zusammengerafft. Im ersten »Bericht über Ergebnisse der Untersuchung zu festgestellten Manipulationen des Gen. Oberstleutnant Wurm und der Genn. Oberleutnant W.« des MfS vom 12. Februar 1981 hieß es: »An Wertgegenständen einschließlich Devisen wurden sichergestellt: 86 Kg 534 gr Feingold (im) Wert von 19.037.480 Mark.« Dazu kamen 1.626.105 Westmark und 2.202.875 DDR-Mark in bar, viele kleinere Summen in ausländischen Währungen sowie: »Brillanten, Schmuck wie Armbänder, Ketten, Armreifen und Ringe zum durch Gutachter geschätzten Industrieabgabepreis von 2.379.430,- Mark und einem Endverbraucherpreis von 4.045.031,- Mark (sowie) Gold- und Silbermünzen im durch Gutachter geschätzten Gesamtwert von 646.504,- DM …« Im Zuge der Untersuchungen, die Wurm schließlich ins Gefängnis brachten, wo er wenig später starb, stellten die Ermittler im Februar 1981 fest: »Die durch die Genossen Wu. und W. durchgeführten Manipulationen erstreckten sich über einen längeren Zeitraum. Als Ausgangspunkt muss die Ende 1961/Anfang 1962 durchgeführte Aktion ›Licht‹ angesehen werden, die unter der Leitung des Genossen Oberstleutnant Strauch stand und in der auch Gen. Wu. aktiv beteiligt war.«
Doch zurück in die Zeit kurz nach dem Mauerbau. Damals liefen die Geschäfte mit den aus den Bankschließfächern entnommenen Wertsachen günstig, denn beim »kapitalistischen Erbe« der DDR-Banken herrschte eine riesige Unordnung. Die Stasi notierte 1962 zu ihrem Raubzug: »Dabei wurde festgestellt, dass bei allen Finanzorganen fast ausnahmslos kein konkreter Überblick über die vorhandenen Safes und Blockschließfächer und über ihre Nutzung besteht. Bis zu den Maßnahmen des MfS hatte keine Finanzinstitution der DDR einen Überblick über Inhalt und Mieter dieser überprüften Schließfächer.«
In den folgenden Jahren wurde die Sore im Westen, bei der Stasi »Operationsgebiet« genannt, verkauft. Das bestätigte unbeabsichtigt im Februar 1981 der Untersuchungsbericht gegen den ungetreuen Genossen Wurm: »In diesem Zusammenhang [dem Verkauf der aus den Schließfächern geräumten Wertsachen, Anm. d. Verf.] entstand die Aktion ›Konto‹, … in der … Gen. Wu. eine exponierte Rolle einnahm … Die sichergestellten Werte wurden im Verlauf von 2 bis 3 Jahren im Operationsgebiet verkauft … In dieser Zeit, etwa 1967, begann Gen. Wu. mit ersten nicht kontrollierten sogenannten Rücklagen, deren Höhe nicht mehr feststellbar ist.«
Verschleierung und späte Fragen
Der Rest des konfiszierten Vermögens wurde in einem mehr als hundertseitigen Protokoll, das an das Finanzministerium ging, erfasst. Die Stasi hatte gründlich alle Spuren auf frühere Besitzer der Wertsachen getilgt: »Der Ursprung der einzelnen im Rahmen der Aktion eingelieferten Gegenstände ist nicht mehr nachweisbar und bekannt. Selbst in Fällen, wo frühere Eigentümer bei Einlieferung der Masse bekannt waren, ist durch Zusammenfassung der einzelnen Gegenstände nach Verwendungszweck und Verwertungsmöglichkeit (z. B. wurden Briefmarken neu geordnet und zu kompletten Sammlungen zusammengefasst etc.) dieser Nachweis nicht mehr zu führen.«
Daraufhin verlangte der Finanzminister mit der Verfügung 43/62 vom 14. September 1962 Auskunft darüber, was nun geschehen sollte: »Aus dem Bericht muss zu erkennen sein, in welchem Umfang und bei welchen Komplexen der übergebenen Wertgegenstände diese a) unmittelbar dem Export, b) durch modisch bedingte Umarbeitung dem Export bzw. durch Neuanfertigung von Schmuckstücken aus vorhandenem Material dem Export, c) welche Wertgegenstände und welches Wertvolumen dem Binnenhandel, d) welche Gegenstände dem Edelmetallfonds der Republik zugeführt werden können.« Was sich nicht jenseits der Grenzen verwerten ließ, floss somit in den DDR-Haushalt.
Es dauerte 56 Jahre, bevor das 2015 geschaffene Deutsche Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg am 1. September 2017 gemeinsam mit dem Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung an der TU Dresden ein Forschungsprojekt zur »Aktion Licht« von 1961 begann.
Im Mittelpunkt des Interesses stand dabei, erst einmal genau festzustellen, wer damals wann was befohlen, veranlasst und durchgeführt hat. Allein das dürfte ein schwieriges Unterfangen sein, weil die Akteure von einst, so sie überhaupt noch leben, inzwischen uralt sind. Danach kann die Suche nach dem Schicksal der konfiszierten Kulturgüter erfolgen. Dabei ginge es dann besonders um Hinweise auf ihren Verbleib. Nach der jahrzehntelangen Odyssee auf dem internationalen Kunstmarkt dürften sie ebenfalls äußerst schwierig zu finden sein.
Deshalb ist es auch noch nicht abzusehen, ob im Ergebnis der gerade begonnenen Recherche eine Datenbank über die geraubten Schätze entstehen kann. Als Ziel des bis 2019 auf zwei Jahre begrenzten Forschungsprojekts wurde deshalb bisher auch nur die Erarbeitung einer wissenschaftlichen Publikation dazu genannt.
Mit Beginn der Arbeit schloss Uwe Hartmann, Leiter des Fachbereichs Provenienzforschung im Deutschen Zentrum Kulturgutverluste, aus, dass die Kunstwerke, Schmuckstücke, Briefmarken, Autographen und Dokumente aus der »Aktion Licht« Bestandteil der bereits bestehenden Lost-Art-Datenbank der Magdeburger Einrichtung würden: »Diese Datenbank bleibt der NS-Raubkunst vorbehalten. Wir waren uns von vornherein darüber einig, dass wir hier keine Vermischung oder Vergleichbarkeit mit den Kulturgutverlusten in Ostdeutschland nach 1945 zulassen werden.«
Für frühere Eigentümer von in der DDR verlorenem Kulturgut dürften die neuen Fragen kaum neue Erkenntnisse bringen. Wahrscheinlich spurlos verschwunden sind auch jene Wertsachen, die damals in den sechziger Jahren nach dem großen Raubzug im MfS für »schlechte Zeiten« als eiserne Reserve verblieben.
Dort sorgte man nämlich dafür, dass die »Aktion Licht« auch nach Abschluss streng geheim blieb. Dazu startete im Februar 1971 eine Kontrollaktion. Ergebnis: »Bisherige Überprüfungen in den IHB-Bezirksdirektionen [IHB: Industrie- und Handelsbank, Anm. des Verf.] Neubrandenburg, Rostock, Berlin ergaben, dass dort keine derartigen Dokumente oder Quittungen vorliegen, die das MfS in irgendeiner Form belasten. Das MfS ist als durchführendes Organ der Aktion ›Licht‹ rechtlich entlastet durch das Übergabeprotokoll an die verantwortlichen Mitarbeiter des Ministeriums der Finanzen.« Dennoch wurde noch einmal gründlich nachgesehen. Dazu mussten die Inoffiziellen Mitarbeiter heran: »Durch zuverlässige Kräfte in allen Finanzinstitutionen der DDR wird z. Z. überprüft, ob dort noch Unterlagen über die Aktion ›Licht‹ vorliegen. Es handelt sich um ca. 3 – 4.000 entsprechende Einrichtungen.«
Allein diese Aktivitäten deuteten darauf hin, dass sich auch die Stasi des Unrechts ihres Tuns bewusst war, denn sonst wäre das gezielte Verwischen aller Spuren kaum notwendig gewesen.
Als sich die Bedrohung der Existenz der DDR im Spätherbst 1989 abzeichnete, wurden sie wieder brisant. In aller Eile wies Militärstaatsanwalt Frank Michalak am 20. Dezember 1989 die Staatsbank der DDR an, vier verplombte Behälter vom Ministerium für Staatssicherheit mit »wertintensivem Schmuck« zu übernehmen. In einem Übergabeprotokoll vom 21. Dezember 1989 ist weiterhin von 112, ebenfalls verplombten, Behältnissen die Rede, in denen sich »weißes und gelbes Metall« befinde. Inhaltsverzeichnisse gab es zu all dem nicht.
Damit wanderten sehr wahrscheinlich die Reste aus der »Aktion Licht« und weitere von der Stasi illegal vereinnahmte Wertsachen in die Verantwortung des Ministeriums für Finanzen und Preise (MfFP) und unterlagen so dem damals noch funktionierenden Bankgeheimnis der DDR.
Mit dieser »Umlagerung« der Wertsachen wurde möglicherweise ein konspirativer Eigentümerwechsel vollzogen. Darauf deuten Unterschiede im Übergabe-Übernahme-Protokoll des Ministeriums für Staatssicherheit mit dem des Ministeriums für Finanzen und Preise hin. Sie liegen einmal hand- und maschinenschriftlich und einmal nur maschinenschriftlich in einem anderen Schriftbild vor. Nur das MfFP-Protokoll trägt den Zusatz: »Die Behältnisse sind Eigentum des Ministeriums für Finanzen und Preise und dürfen nur mit Zustimmung des Ministers für Finanzen und Preise verlagert bzw. geöffnet werden.«
Was aus dem konspirativ aufgehäuften Schatz wurde, blieb nach der Übernahme der Akten des DDR-Finanzministeriums im Zuge der Einheit im Dunkeln. Es gab keine Papiere mehr.
Ebenso geheimnisvoll verlief die Suche nach Schätzen aus der Nazizeit im Osten Deutschlands. Im Juli 1981 erfuhr der Hamburger Spiegel davon und berichtete: »In der DDR wurden Kunstschätze aus Görings Nachlass geborgen. Weitere Ausgrabungen scheiterten bislang, weil der westdeutsche Informant die Pläne nur gegen Finderlohn herausgibt.« Der war ausgeblieben, und stattdessen hatte der frustrierte Schatzsucher aus dem Westen den Spiegel-Leuten für 1.000 DM ein paar Informationen verkauft, aus denen sie nun eine Story strickten. Sie hatte einen wahren Hintergrund.
FKK im Jagdfieber
Alles begann, als am 14. November 1980 in der Ostberliner Wilhelm-Pieck-Straße 11 das Telefon klingelte. Es war der Anschluss des DDR-Rechtsanwalts und Notars Friedrich Karl Kaul, der als einer der wenigen ostdeutschen Juristen auch vor Gerichten im Westen agieren durfte. Nebenbei brillierte er als Buchautor und Fernsehstar, war Justitiar des DDR-Rundfunks und ein von der Verkehrspolizei gefürchteter Kraftfahrer in seinem Ford Mustang. All das hatte den Anwalt bekannt gemacht, und jeder wusste, wer gemeint war, wenn nur kurz von »FKK« die Rede war.
Der Mann am anderen Ende der Leitung stellte sich mit badischem Akzent als »Weber« vor und machte dem DDR-Anwalt ein sensationelles Angebot: Er wisse, wo Hitlers Reichsmarschall Hermann Göring zum Kriegsende seine Schätze in der Schorfheide vergraben habe. Es ginge um Kleinodien aus Gold und Silber, Gemälde alter Meister, Meißner Porzellan und viele andere Antiquitäten.
FKK war elektrisiert. Viele im Krieg von den Nazis geraubte Schätze galten nach wie vor als verschollen. In der Schorfheide nördlich Berlins hatte Göring seinen opulenten Landsitz Carinhall, den er 1945 von der SS sprengen ließ. Und auch die Geschichte »Webers« schien glaubhaft. Sein Vater sei als Soldat beim Vergraben von Schatzkisten dabei gewesen, berichtete er.
Rechtsanwalt Kaul schrieb umgehend einen Aktenvermerk über das mysteriöse Telefonat, den er seinem Verbindungsmann im Ministerium für Staatssicherheit, Udo Lemme, übersandte. Der damals stellvertretende Chef der MfS-Rechtsstelle übermittelte die Information unverzüglich Erich Mielke, der die Angelegenheit zur Chefsache machte.
Die Stasi suchte seit Jahren nach verborgenen Nazischätzen. Endlich schien sich tatsächlich eine heiße Spur aufzutun. Unter der Registriernummer FV 11/81 wurde der Vorgang »Kunstraub Göring« angelegt.
Damit bekam auch FKK grünes Licht für ein Treffen mit dem Informanten. Es fand am 4. März 1981 im Düsseldorfer Hotel An der Oper statt. Als Erstes enthüllte »Weber«, dass er in Wirklichkeit Medard Klapper heiße und in Karlsruhe einen Militaria-Laden betrieb. Und er erzählte nun eine neue Geschichte: Er selbst sei als Mitglied einer Spezialeinheit beim Vergraben von Schätzen in der Mark Brandenburg dabei gewesen. Überdies habe er fruchtbare Kontakte zu den alten Kameraden von damals. Auch sie hätten entsprechende Hinweise.
Der Spiegelgab später genau diese Version wieder: »Einer der Eingräber machte sich heimlich Aufzeichnungen, auf Zetteln und den Rückseiten von Photographien. Vor kurzem sei nun dieser Mann … aus Südamerika nach Deutschland zurückgekehrt. Vier Pläne habe er mitgebracht, skizziert darauf seien die Stellen, wo unter seiner Leitung die Kunstschätze Görings vergraben wurden: altes Porzellan, zwei Koffer mit Kleinodien aus der Ordenskanzlei, insgesamt 450 Kilogramm Edelmetalle und 47 Aluminiumkisten mit Gemälden alter Meister, die der Marschall vorwiegend in Holland, Belgien und Frankreich vor allem bei jüdischen Sammlern und Galeristen requiriert hatte.«
Kaul war begeistert. In seinem Vermerk für die Stasi hielt er zu den Informationen Klappers fest: »Er bezifferte den Wert der verborgenen Gegenstände auf insgesamt etwa 30 Millionen DM.« Für das Preisgeben der Schatzpläne wollte der Mann aus dem Westen einen Anteil von 20 Prozent des Wertes der Funde. Das hielt Notar Kaul für eine durchaus »angemessene Entschädigung«. Im Frühstücksraum des Hotels hielten die beiden Herren ihre Vereinbarungen unter dem Betreff »Bergung herrenloser Kunstgegenstände in der DDR« fest.
Dabei ging es vor allem erst einmal darum, eine Vertrauensbasis zu schaffen. FKK versicherte deshalb Medard Klapper schriftlich: »Im Auftrage der zuständigen Dienststellen der DDR erkläre ich, dass ich zwar in obiger Angelegenheit zum Abschluss verbindlicher Vereinbarungen, insbesondere bzgl. der Höhe der prozentual nach dem Wert der geborgenen Gegenstände festzusetzenden Entschädigung (Finderlohn) noch nicht ermächtigt bin, dass ich aber die persönliche Garantie dafür übernehme, dass die geborgenen Gegenstände ohne Ausnahme zur Wertbestimmung durch einen von jeder Seite zu benennenden Sachverständigen sichergestellt und ein genaues Inventarverzeichnis in doppelter Ausfertigung angefertigt und jeder Seite zugänglich gemacht wird.« Überdies bestätigte er dem Informanten, dass dieser sich »durch eine die Bergung dieser Gegenstände betreffende Vereinbarung in keinen Gegensatz zu den Gesetzen der DDR begibt«. Für den Fall fremder Besitzansprüche am Fundgut vereinbarten die Herren: »Sollten international von anderer Seite Ansprüche an den geborgenen Kunstgegenständen erhoben werden, die von der DDR anerkannt werden müssen, sollen bezüglich der Entschädigung für die Angabe des Fundortes besondere Vereinbarungen getroffen werden.«
Die Zahlung würde über eine Schweizer Bank abgewickelt werden. Da sich die oben erwähnten »zuständigen Dienststellen der DDR« offenbar ausschließlich auf das Ministerium für Staatssicherheit beschränkten, teilte Friedrich Karl Kaul nur dort mit, wie das genau geschehen sollte: »Das ist tatsächlich möglich, da ich ein derartiges Konto bei der Bank Leu in Zürich für die Abtlg. 90 des ZK (Gen. Raab) eingerichtet und auch Vollmacht dafür habe.«
Nun erglühten auch die wenigen Eingeweihten bei der Stasi im Schatzfieber. Medard Klapper wurde nur oberflächlich überprüft, ein paar seiner zwielichtigen Geschäfte im Westen kamen ans Licht, und es wurde kurz überlegt, ob nicht ein gegnerischer Geheimdienst hinter der ganzen Sache stecken könnte. Doch letztlich griffen die Zweifel nicht, denn der Militaria-Händler hatte derweil an FKK einen ersten Schatzplan übergeben. Es ging um Kisten, angeblich mit wertvollem Porzellan gefüllt, die unter der Treppe des einstigen Herrenhauses in Vietmannsdorf in der Schorfheide vergraben sein sollten. Das klang nicht unwahrscheinlich, denn das Gut Vietmannsdorf, zuvor im Besitz des Chefs der Berliner Engelhardt-Brauerei, war 1943 in Görings per Gesetz vom 29. Januar 1936 geschaffene »Stiftung Schorfheide« eingegliedert worden. Außerdem prahlte Klapper gegenüber dem Ostberliner Anwalt mit seinen guten Kontakten zu alten Nazis in Südamerika und ließ deutlich seine Sympathien für sie erkennen. Das machte ihn für die Stasi noch glaubwürdiger.
Mit riesigem Aufwand startete sie Anfang März 1981 die Suche nach den Nazischätzen in der Schorfheide. Es sollte ein peinlicher Flop werden.
Der Berliner Journalist Andreas Förster recherchierte Anfang der neunziger Jahre die Stasi-Suche nach dem Göring-Schatz und verfolgte die Spuren Medard Klappers. Er resümierte: »Was zu diesem Zeitpunkt weder Kaul noch die Stasi ahnten: Mit dem ehemaligen Waffen-SS-Mann Klapper war Ost-Berlin einem tolldreisten Blender aufgesessen, der dem legendären Fälscher der Hitler-Tagebücher, Konrad Kujau, durchaus ebenbürtig war. Wie der in Ditzingen bei Stuttgart lebende Kujau verkehrte auch der Karlsruher Klapper in den zwielichtigen Kreisen der Militaria-Händler und NS-Fanatiker. Dort ließ sich viel Geld verdienen, denn Orden, Schmuckwaffen und Originalhandschriften von Hitler, Goebbels, Göring und anderen Nazi-Größen wechselten mitunter für Tausende von Mark den Besitzer. Und man kam an Informationen heran, die sich versilbern ließen – entweder bei der Presse, bei Geheimdiensten oder der Polizei.«
Dieser dubiose Hintergrund des Informanten war es wohl auch, der den Spiegel 1981 zögern ließ, seinen richtigen Namen zu nennen. Deshalb erwähnte das Blatt nur kurz: »In einem Dorf, rund 40 Kilometer nördlich Berlins, wurden DDR-Schatzsucher anhand eines von Weber übergebenen Teilplans am 21. März dieses Jahres fündig. Bagger förderten eine Kiste zutage mit altem Porzellan, insgesamt 122 Teile.« Was war tatsächlich geschehen?
Viel Aufwand, wenig Ertrag
Wie immer arbeitete die Stasi konspirativ. Ein paar ältere Einwohner in Vietmannsdorf – heute ein Ortsteil der Stadt Templin – erinnern sich an »archäologische Grabungen« und den aus dem Fernsehen bekannten Friedrich Karl Kaul. »Der Professor hat die ganze Sache geleitet«, sagt einer, und das stimmt auch mit dem Bericht des Spiegels vom Sommer 1981 überein. Unter FKKs Aufsicht, assistiert von »zwei staatlichen Angestellten des Ministeriums für Kultur der DDR«, wurde am 14. März 1981 erst einmal eine »Notarielle Niederschrift« über den Zustand der Gebäude und des Geländes angefertigt.
Es sah nicht gut aus. Teile der Frontseite des »Schlosses«, eine der drei in dem Plan beschriebenen Stellen, galten mittlerweile als »baufällig« und »nicht zu begehen«. Sie waren »von den Einwohnern abgetragen« worden, »die die dadurch freigewordenen Ziegelsteine für sich nutzten«, hielt der Notar fest. Auch der zweite Markierungspunkt an einem Nebengebäude ließ sich nicht mehr finden. Es war Anfang der siebziger Jahre abgebrannt, der Ziegelschutt liegen geblieben. Kaul und die »Herren vom Kulturministerium«, die in Wahrheit von der Stasi kamen, hielten fest: »Eine Nachsuche würde hier offensichtlich den Einsatz schweren Erdbewegungsgerätes erfordern.«
Trotz der notorisch knappen Baukapazitäten in der DDR war das für das Ministerium für Staatssicherheit kein Problem. Bagger rückten an, Suchtrupps mit Sonden untersuchten jeden Quadratzentimeter. Schließlich wurde eine Kiste gefunden, die altes Porzellan barg. Stücke aus Meißen kamen zum Vorschein, ein anderes trug die Aufschrift der berühmten Marke »Sächsische Porzellan-Fabrik von Carl Thieme zu Potschappel-Dresden«. Ein Service der Marke »Royal Copenhagen« von 1794 war auch dabei, alles sorgsam in Zeitungspapier von 1945 eingeschlagen.
Der Fund wurde inventarisiert und in die Berliner Kanzlei Kauls geschafft. Der empfing am 3. April 1981 gemeinsam mit »Herrn Roland vom Kulturministerium«, so stellte sich Udo Lemme von der Stasi-Rechtsstelle vor, Medard Klapper. Der Gast aus Karlsruhe erlebte nun eine riesige Enttäuschung. Kaul und »Herr Roland« zeigten ihm alles, meinten aber, der ganze Krempel sei nicht mehr als 700 Mark wert. Das war sicher nicht aus der Luft gegriffen, auch wenn es der Händler aus dem Westen kaum glauben mochte. Aufgrund der Fundliste und einiger Fotos schätzte ein Antiquitätenhändler in Frankfurt am Main, mit dem Geschirr aus der Schorfheide seien mindestens 20.000 DM, »womöglich um einiges darüber«, zu erzielen.
Die DDR-Vertreter zeigten sich flexibel. Immerhin hatte Klapper ja davon gesprochen, weitere Schatzpläne gesehen zu haben. Dabei ging es um Gold, Platin und Gemälde – das richtig große Geld also. Den Zugriff darauf wollten sich FKK und die Stasi nicht verbauen. Deshalb schlug der Anwalt nun einen neuen Deal vor: Klapper könne bei weiteren Ausgrabungen auf der Grundlage der von ihm zu beschaffenden Pläne selbst dabei sein und direkt seinen Anteil kassieren. Außerdem würde ihm Kaul von seinem West-Konto einen Vorschuss auf den Finderlohn zahlen.
Das klang gut. Klapper schlug ein, doch am 16. April 1981 starb Friedrich Karl Kaul, und der Kontakt riss erst einmal ab. Ein »Herr Roland vom Kulturministerium« war für Medard Klapper nicht aufzufinden.
Die Stasi hatte derweil längst ein anderes Ass im Ärmel. Seit 1980 suchte der Stern-Reporter Gerd Heidemann nach den angeblich verschollenen Hitler-Tagebüchern. Dabei halfen ihm Oberstleutnant Brehmer und Oberstleutnant Ludwig, beide Offiziere der Hauptverwaltung Aufklärung (HV A). Der Fundort wurde an der Absturzstelle eines Luftwaffen-Flugzeugs im sächsischen Börnersdorf vermutet. Die Stasi führte den Journalisten aus dem Westen als Kontaktperson (KP) »Rose«. Heidemann hatte seinen Begleitern nicht gesagt, wonach er tatsächlich Ausschau hielt, aber dass er in Sachen Nazi-Devotionalien unterwegs war, wusste man in Ostberlin.
Deshalb wunderte sich auch kaum jemand, als er am 27. August 1981 in der DDR auftauchte und von einem Plan über verborgene Nazischätze berichtete. Es ging um 450 Kilogramm Gold, 47 Kisten mit Gemälden und Akten aus dem Reichsluftfahrtministerium. Würde die DDR ehrlich mit Heidemann teilen – er verlangte die Hälfte des Wertes der Edelmetalle –, könnten weitere Pläne folgen. KP »Rose« machte auch keinen Hehl daraus, woher die Pläne stammten: Heidemann hatte sie für eine Anzahlung von 25.000 DM von Medard Klapper erworben.
Nun schrillten bei der Stasi die Alarmglocken. Andreas Förster kennt den Grund dafür: »Am 28. August 1981, am Morgen nach dem Treffen mit seiner Kontaktperson ›Rose‹ setzte Oberstleutnant Ludwig einen Bericht über das Heidemann-Angebot an seine Vorgesetzten ab. Die ganze Geschichte klingt eher unwahrscheinlich und zweifelhaft, fügte Ludwig als Einschätzung hinzu. Es müsse jedoch in Rechnung gestellt werden, dass die genannte Kiste mit Porzellan in Vietmannsdorf nach Klappers Tipp tatsächlich gefunden worden sei. ›Deshalb sollte trotz aller Zweifel diesen Hinweisen von KP ›Rose‹ nachgegangen werden‹, empfahl Ludwig.« Das sahen seine Chefs genauso.
Nun begann eine riesige Schatzsuche in der Schorfheide, zunächst am Stolpsee. Die Topographie der Landschaft wurde mit dem von Heidemann gelieferten Plan verglichen, in früheren Bombentrichtern gegraben, und Taucher stiegen in den See. Alles blieb ohne Erfolg.
Gerd Heidemann gab ohne großartiges Bedauern auf. Er meinte, inzwischen einen viel größeren Fisch an der Angel zu haben: die Hitler-Tagebücher. Sein Lieferant im Westen hatte ihm versichert, sie würden aus der DDR stammen. Der Nazi-Devotionalien zugeneigte Reporter war von der Echtheit der Kladden hundertprozentig überzeugt. Vom Stern flossen dafür 9,3 Millionen DM. Es war in Wahrheit der größte Coup des Fälschers Konrad Kujau. Das jedoch ahnte Heidemann noch nicht.
Als der Betrug im Mai 1983 aufflog, spottete die Konkurrenz vom Spiegel: »Das Siegel unecht, das Initial verkehrt, die Schrift gefälscht – wenn das der Führer wüsste. Seine Tagebücher, 38 Jahre nach seinem Tod von der Hamburger Illustrierten ›Stern‹ einer verblüfften Welt präsentiert, sind nicht seine Tagebücher. Es sind Machwerke aus der Nachkriegszeit.«
Gerd Heidemann kosteten sie den Job. Am Rande des Skandals hatte er auch noch eine offene Rechnung mit Medard Klapper. Er verklagte den Karlsruher Militaria-Händler auf Rückzahlung von 187.000 DM, die er ihm als Vorschuss auf den Finderlohn der in der DDR vermuteten Nazischätze bis dahin gezahlt hatte. Klapper verglich sich mit dem Reporter und sagte eine Ratenzahlung zu. Heidemann verzichtete daraufhin auf künftige Ansprüche aus der Schatzsuche in der DDR. Geld bekam er dennoch nicht, denn Schatzjäger Klapper aus dem Westen war längst pleite und für einen neuen Prozess verhandlungsunfähig.
Auch für die Stasi hieß es: Außer Spesen nichts gewesen. Die Kosten der Suche in der Schorfheide betrugen bereits rund 100.000 Mark. Andreas Förster fasst zusammen: »Einzig Minister Mielke wollte so schnell nicht aufgeben. Die Hauptabteilung IX/7 arbeitete sich in der Folgezeit durch Berge von Archivdokumenten, prüfte Unterlagen sämtlicher Dienststellen des NS-Regimes rund um Carinhall, befragte alte Einwohner in der Schorfheide, studierte Landkarten und verblichene Fotos. Wieder und wieder suchten derweil Kampftaucher der Stasi den Grund des Stolpsees ab. Spezialisten des Operativ-Technischen Sektors (OTS) des MfS rückten mit komplizierten Gerätschaften an. Beim Minister für Geologie forderte Mielke Spezialkräfte der Abteilung Geophysik ab; die Kollegen sollten spezielle Technik für Gravimetrie und magnetische Messtechnik mitbringen. Der Minister befahl auch den Einsatz einer Multispektralkamera, die von Bord eines Flugzeuges vom Typ AN 2 aus die drei vermeintlichen Bergungsorte fotografieren sollte. Das Codewort für diese Aktion lautete ›Herbstwind‹.«
Alles blieb ohne Erfolg. Das änderte sich auch nicht, als sich Medard Klapper im Februar 1983 erneut über die nunmehrigen Nachfolger der Kanzlei Kaul in der DDR meldete. Dieses Mal ging es um mit Brillanten gefüllte Urnen, wieder einmal Gold in rauen Mengen und Gemälde und sogar um Teile des Bernsteinzimmers. Die Stasi blieb skeptisch, schob aber am 18. Juli 1983 eine weitere Runde der Schatzsuche an. Klapper reiste auf DDR-Staatskosten einige Male in die Schorfheide. Gefunden wurde wieder nichts. 1984 brach die Stasi endgültig den Kontakt zu ihm ab.