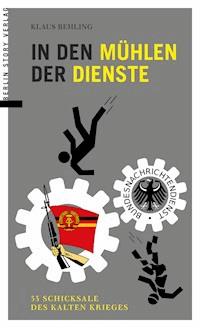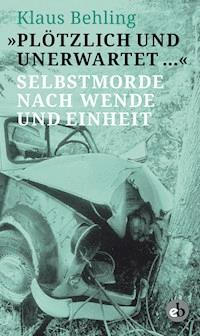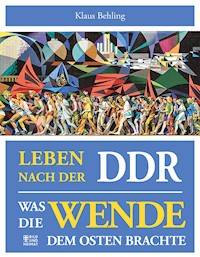Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition berolina
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Als sich die SED 1989 in die PDS verwandelte, verfügte sie über ein geheimes Geldvermögen von rund 6,2 Milliarden DDR-Mark. Hinzu kamen Parteibetriebe, Immobilien und getarnte "Valuta"-Konten. Solange die Partei einen unkontrollierten Zugriff auf das Vermögen hatte, verschwanden gewaltige Summen. Und auch danach wurde getrickst und getäuscht. Im vorliegenden Buch untersucht Bestsellerautor Klaus Behling die Hintergründe des Milliarden-Pokers. Er verfolgt die Wege der Firmen aus dem Schattenreich der SED in die Marktwirtschaft, erzählt, was aus dem Grundbesitz der Partei wurde, und erinnert an verschiedene Betrugsmanöver in jeweils dreistelliger Millionenhöhe. Er zeigt, dass der Streit ums Geld immer auch ein Kampf um politischen Einfluss ist. Am Ende bleiben weit mehr als eine Milliarde Euro unwiederbringlich verschwunden. Auf der Spur der Scheine entdeckt der Autor aber auch neue Geschäfte mit altem SED-Geld lange nach der Jahrtausendwende. Hier geht es um Diamanten aus Afrika, Reis aus Asien und den Kauf einer Millionen-Villa in Spanien – alles ganz legal, denn seit dem 2. Oktober 2000 sind Wirtschaftsstraftaten verjährt. Klaus Behling legt einen brisanten Doku-Krimi vor, der ein immer noch heißes Eisen anpackt und zeigt, welch lange Schatten das einstige SED-Vermögen wirft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaus Behling
Spur
der
Scheine
Wie das Vermögen
der SED verschwand
edition berolina
Von Klaus Behling liegen in den BEBUG Verlagen außerdem vor:
Die Kriminalgeschichte der DDR. Vom Umgang mit Recht und Gesetz im Sozialismus. Politische Prozesse, skurrile Taten, Alltagsdelikte (edition berolina, 2018)
Leben in der DDR. Alles, was man wissen muss(Bild und Heimat, 2018)
Auf den Spuren der Alten Meister. Kunsthandel und Kunstraub in der DDR (Bild und Heimat, 2018)
eISBN 978-3-95841-559-1
1. Auflage
© 2019 by BEBUG mbH / edition berolina, Berlin
Umschlagabbildung: © picture alliance / dpa-Report, Stefan Thomas
Umschlaggestaltung: BEBUG mbH, Berlin
Alexanderstraße 1
10178 Berlin
Tel. 01805/30 99 99
FAX 01805/35 35 42
(0,14 €/Min., Mobil max. 0,42 €/Min.)
www.buchredaktion.de
Vorwort
Götterdämmerung im »Großen Haus«
Das ab 1959 als Sitz des Zentralkomitees (ZK) der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) genutzte Gebäude am Werderschen Markt in Ostberlin wurde zu DDR-Zeiten ehrfürchtig das »Große Haus« genannt. Eine solche Bezeichnung ist sonst eigentlich nur für Theater mit mehreren Spielstätten üblich. So wie man dort aufmerksam verfolgt, was sich auf der Bühne hinter den Mauern tut, so war es im Gegensatz dazu im »Großen Haus«, der Führung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, streng geheim, obwohl von dort aus das ganze Land gesteuert wurde. Trotzdem verstand das DDR-Volk auch die verklausulierten Botschaften, die nach draußen drangen. Als das Zentralorgan der SED Neues Deutschland am 19. Oktober 1989 darüber »informierte«, dass SED-Generalsekretär Erich Honecker einen Tag zuvor wegen seines angegriffenen Gesundheitszustands »bat«, von allen seinen Funktionen entbunden zu werden, wusste jeder, was tatsächlich dahintersteckte.
Ob die Krankheit des 77-jährigen Erich Honecker möglicherweise so ansteckend war, dass sein Wirtschaftslenker Günter Mittag (63) und der Propagandachef Joachim Herrmann (61) gleich mitgehen mussten, eruierte Neues Deutschland erst gar nicht. Ebenso wenig wie die kaum Hoffnung machende Tatsache, dass die »neue« Führung der SED auch nach dem 18. Oktober 1989 ein »Club alter Herren« blieb. Frauen waren im obersten Führungszirkel, dem Politbüro des ZK der SED, ohnehin nicht vertreten. Senior Erich Mielke war nunmehr 81, Junior Egon Krenz, als mit großem Abstand jüngster Spitzenfunktionär, 52 Jahre alt. Das Durchschnittsalter im Politbüro betrug damals 67,3 Jahre und lag damit kräftig über dem DDR-Renteneintrittsalter von 65 Jahren für Männer.
Dementsprechend ruhig ging es bei den Sitzungen im »Großen Haus« zu. In der DDR trug das frühere Reichsbankgebäude die Adresse »Haus des Zentralkomitees am Marx-Engels-Platz, 1020 Berlin« und war das größte Bürohaus Ostberlins. Günter Schabowski, damals 60, erinnerte sich an die Sitzungen des Politbüros: »Es war die Atmosphäre eines Klassenzimmers. Wer etwas sagen wollte, meldete sich, und manchmal nickte der eine oder andere auch schon mal ein.«
Das änderte sich nun im Herbst 1989 schlagartig. Noch am Tag des Sturzes von Erich Honecker waren im Zentralkomitee, dem erweiterten Führungszirkel der Partei, ganz neue Töne zu hören. Sie zeigten die Götterdämmerung als Angst um den Verlust der Macht. »Wir haben keine Minute mehr Zeit«, mahnte Kulturminister Hans-Joachim Hoffmann (60): »Uns steht das Wasser bis hierher. Wir stehen vor neuen gewaltigen Demonstrationen, die der Feind organisiert. (…) Wenn wir jetzt, wenn auch verspätet, uns nicht zu Wort melden, dann sind wir in der Gefahr, dass wir das Wort nicht mehr bekommen.«
Bauminister Wolfgang Junker (60) kam gerade aufgeregt aus Leipzig zurück. Dort hatte er sich anhören müssen, wie die Stadt verrottete. Bitter beklagte er: »… ja, die Stadt zerfällt, was ja nicht wahr ist, es sind Teile der Stadt. Da werde ich als Idiot hingestellt. Was soll das alles? Wenn ich ein Idiot bin, muss die Partei darüber befinden.«
Das tat sie nicht, denn andere Probleme drängten. Der geschmähte Minister eilte einige Tage später zu seinem Vertrauten Alexander Schalck-Golodkowski (57) und versuchte, ihn zur gemeinsamen Flucht nach Moskau zu überreden: »Alex, es ist alles aus. Krenz hat keine Macht mehr. Die werden uns alle aufhängen!« Auch der immer noch mächtige Staatssekretär im Außenhandelsministerium geriet mehr und mehr in Panik: »Irgendwann sagte ich zu meiner Frau: ›Es ist alles aus. Ich kann mich nur noch erschießen.‹« Sie reagierte sofort und schloss die persönliche Pistole ihres Mannes ein.
Sich um derartige Befindlichkeiten Einzelner zu kümmern, stand auf keiner Tagesordnung. Es ging um den Versuch, politisch zu überleben. Sorgen ums Geld gab es dabei nicht, denn die Kassen der Partei waren prall gefüllt.
Deshalb diskutierte im Zentralkomitee auch niemand darüber, als wenige Tage nach dem Sturz Erich Honeckers das Gerücht kursierte, er sei in Wirklichkeit ein schwerreicher Mann mit geheimen Konten in der Schweiz gewesen. In seinem Fall basierte es auf einem Telegramm aus Genf. Am 24. Oktober 1989 ging es bei der Ostberliner Staatsanwaltschaft ein. Die Botschaft lautete:
teletex message ttx d
24.10.89
betr.: ihr nummernkonto 738654 saldenbestaetigung
sehr geehrter herr honecker.
bestaetigen hiermit den saldo ihres kontos zum 18.10.89, 24 uhr:
schweizer franken 367.534.192,12 in worten
dreihundertsiebenundsechzigmillionen, fünfhundertvierunddreißigtausend 192 franken und 12 rappen.
soll der betrag weiterhin als tagesgeld angelegt bleiben oder planen sie den transfer zu einer anderen bank???
wir bitten um diesbezuegliche nachricht.
hochachtungsvoll
s. suessli verwaltungsrat
chredit suisse et rhône
genf schweiz
Offenbar wurde das Telegramm auch anderswo lanciert. Oberstaatsanwalt Bernhard Brocher: »Diese Unterlagen sind an den verschiedenen Stellen aufgetaucht, unter anderem erinnere ich mich, dass wir ein Exemplar unter den Unterlagen von Herrn Mittag hatten und noch bei mindestens zwei weiteren Politbüromitgliedern in der Wohnung gefunden haben.«
Wie gesagt: In den hektischen Diskussionen im Zentralkomitee der SED spielte das Gerücht um das viele Geld keine Rolle.
Am 8. November stand die nächste große Tagung an. Eine neue »Reiseregelung« sollte den Druck aus dem Kessel nehmen. Günter Schabowski verkündete sie am Abend des 9. November eher nebenbei. Er hatte die Sperrfrist für die Nachricht übersehen.
Verteidigungsminister Heinz Keßler (69) versuchte, zu retten, was nicht mehr zu retten war. Während Zehntausende einen ersten Blick hinter die Mauer warfen, verkündete er: »Es wird vorgeschlagen etwa, das Grenzgebiet an der Staatsgrenze zur BRD von gegenwärtig fünf Kilometer auf 500 Meter bis maximal 1.000 Meter zu verringern. Dadurch würden circa 450 Ortschaften mit 170.000 Einwohnern aus dem Grenzgebiet herausgelöst werden.« Im »Sperrgebiet« stauten sich derweil die Trabis.
Andere, wie der ZK-Abteilungsleiter für Planung und Finanzen, Günter Ehrensperger (58), träumten nicht mehr von den alten Zeiten, sondern redeten Klartext: »Wenn man mit einem Satz die Sache charakterisieren will, warum wir heute in dieser Situation sind, dann muss man ganz sachlich sagen, dass wir mindestens seit 1973 Jahr für Jahr über unsere Verhältnisse gelebt haben und uns etwas vorgemacht haben. Es wurden Schulden mit neuen Schulden bezahlt … Wenn wir aus dieser Situation herauskommen wollen, müssen wir 15 Jahre mindestens hart arbeiten und weniger verbrauchen, als wir produzieren.«
Von einer selbstverschuldeten Misere wollte Chefideologe Kurt Hager (77) nichts wissen. Er machte am 10. November den Feind in Bonn als Schuldigen aus: »Wem das noch nicht klar ist, der hätte das vielleicht heute Nacht erkennen können, als der Bundestag geschlossen das Deutschlandlied sang und damit offenkundig wurde, welche Pläne realisiert worden sind und was noch beabsichtigt ist. Es ist beabsichtigt, mit unserer Partei Schluss zu machen, und es ist beabsichtigt, die DDR zumindest in eine große Abhängigkeit zu bringen.«
Seinen Anteil an dieser Entwicklung sah er eher milde: »Ich muss auch sagen, dass ich ganz offensichtlich immer weiter mich entfernt habe vom tatsächlichen, realen täglichen Leben, von dem, was in den Betrieben oder in den Kaufhallen oder sonst wo vor sich ging.«
Für den neuen SED-Chef Egon Krenz blieb hingegen keine Zeit zur Rückbesinnung. Am Morgen des 10. November hatte er die Sitzung mit einer Warnung eröffnet: »Ich weiß nicht, ob wir alle noch nicht den Ernst der Lage erkannt haben. Der Druck, der bis gestern auf die tschechoslowakische Grenze gerichtet war, ist seit heute Nacht auf unsere Grenzen gerichtet.«
Von »Panik und Chaos« war nun die Rede, und Egon Krenz konstatierte: »Die Lage hat sich in der Hauptstadt, in Suhl und in anderen Städten äußerst zugespitzt. Arbeiter verlassen Betriebe …«
Drei Tage später, am 13. November, kündigten sämtliche DDR-Parteien in der Volkskammer der SED die Gefolgschaft auf. Erich Mielke sprach seine berühmten Worte von der Liebe zu allen Menschen, die er stets gepflegt habe, und wurde öffentlich ausgelacht. Ab 13 Uhr ging es im Zentralkomitee weiter.
ZK-Kandidat Siegfried Funke, bislang nur einer der mehr als 200 Statisten im Zentralkomitee, berichtete Erschreckendes: »Zurzeit werden draußen in den Betrieben Parteisekretäre reihenweise abgeschlachtet. Sie müssen sich gerade bekennen für das, was das Politbüro getan hat.« Das stimmte zwar nicht, aber dem einen oder anderen jagte es schon einen gehörigen Schrecken ein.
Hans Modrow, damals 61 Jahre alt, SED-Chef im Bezirk Dresden und gerade zum neuen Ministerpräsidenten gekürt, machte sich Gedanken über die nächsten Wahlen. Sie sollten möglichst verzögert werden: »Wenn wir gegenwärtig Wahlen machen, können wir uns alle ausrechnen, wie hoch der Prozentsatz für die SED sein wird. Das können sich auch die anderen Parteien ausrechnen, wie sie aussehen …«
Es war allerhand in Bewegung geraten, und es waren nicht nur die Zehntausende, die täglich die DDR verließen. Am 16. November versprach Neues Deutschland auf Seite eins: Wir »haben die Ursachen der ernsten Mängel zu analysieren versucht und einen Standpunkt erarbeitet, wie wir als Journalisten, als Mitarbeiter im Organ des Zentralkomitees der SED zur Erneuerung des Sozialismus in der DDR, zur Erneuerung unserer Partei beitragen können …« Andere Blätter begannen an diesem Tag mit dem Abdruck der Programme des Westfernsehens.
Auf den DDR-Bildschirmen war am 19. November Egon Krenz ganz privat in seinem neuen Haus in Berlin-Pankow zu bewundern, und Hans Modrow musste am 21. November seinen Ausweis vorzeigen, bevor er unangemeldet das Elektro-Apparate-Werk (EAW) Berlin-Treptow besuchen durfte. Als junger Mann hatte er dort einmal ein Betriebspraktikum gemacht.
All das war ebenso neu wie die nun einander jagenden Diskussionen und Tagungen der SED-Führung.
Bereits am 13. November 1989 hatte die in ungewohnte Bewegung geratene Volkskammer die Einrichtung eines zeitweiligen Untersuchungsausschusses »zur Überprüfung von Fällen des Amtsmissbrauchs, der Korruption, der persönlichen Bereicherung und anderen Verdachts der Gesetzesverletzung« beschlossen. Er konstituierte sich am 22. November und bestand aus je zwei Vertretern aus jeder der zehn im Parlament vertretenen Fraktionen. Vorsitzender wurde der von 1960 bis 1986 als Präsident des Obersten Gerichts der DDR tätig gewesene CDU-Abgeordnete Heinrich Toeplitz (75), der der Volkskammer seit 1951 angehörte.
Am 30. November 1989 gab es dann endlich auch grünes Licht für die Aufklärung der Vergangenheit aus dem Zentralkomitee der SED. Egon Krenz verkündete: »Ich muss sagen, dass Amtsmissbrauch und Korruption eines Mitglieds der SED unwürdig ist. So werden wir auch alle diese Fälle aufdecken.«
Als das der Rentner Erich Honecker in seinem Haus hinter den Mauern der Funktionärssiedlung in Wandlitz in der Zeitung las, fühlte er sich zu Unrecht beschuldigt. Gleich am 1. Dezember stellte er deshalb seinerseits »Strafanzeige wegen öffentlicher Verleumdung und der Beschuldigung der Korruption«. Sie wurde zwar nicht verfolgt, aber später in seiner Akte unter dem Aktenzeichen 111-1-90 abgelegt.
Am 2. Dezember informierten die Zeitungen über erste Ergebnisse der Untersuchungskommission der Volkskammer. Nun tauchte auch das Gerücht über die Honecker-Millionen wieder auf. Die Berliner Zeitung berichtete an diesem Tag von einem Vorstoß des Abgeordneten der National-Demokratischen Partei Deutschlands (NDPD), Gerd Staegemann, Zahnmediziner und Professor an der Medizinischen Akademie »Carl Gustav Carus« in Dresden, seit 1966 Abgeordneter der Volkskammer: »Große Zustimmung im Plenarsaal fand Prof. Dr. Gerd Staegemann von der NDPD-Fraktion, der eine Stellungnahme zu den Gerüchten von geheimen Konten in der Schweiz mit Einlagen von etwa 100 Milliarden Mark forderte. Derartige Machenschaften seien entschieden zu verurteilen und rückhaltlos aufzudecken. Außenhandelsminister Beil teilte mit, von derartigen Konten nichts zu wissen.« Dass sich das Gerücht also inzwischen potenziert hatte – im Genfer Telegramm war von rund 370 Millionen Franken die Rede –, schien niemandem aufzufallen.
Am 3. Dezember 1989 um 8.30 Uhr kam das Politbüro zu seiner letzten Sitzung zusammen. Am Morgen jenes Tages wurden Harry Tisch (62) und Günter Mittag in Wandlitz verhaftet. Auf der folgenden ZK-Sitzung ab 13 Uhr gab Hans Modrow bekannt, dass sich Alexander Schalck-Golodkowski in den Westen abgesetzt hatte.
Zu diesem Zeitpunkt waren die SED-Chefs in den fünfzehn DDR-Bezirken bereits weitgehend abgelöst. Egon Krenz kämpfte mit den verschiedenen Vorschlägen, wie es künftig mit der Partei weitergehen solle: »Das ist doch eine unerträgliche Situation. Drei-, viermal am Tage kriege ich von verschiedenen Genossen, die erst mal das vorgeschlagen haben, dann das vorgeschlagen haben, eine andere Meinung … Also, das ist doch unerträglich. Wir brauchen doch eine Disziplin in dieser Partei. Wir sind doch kein zusammengelaufener Haufen. Entschuldigt bitte, bitte um Verzeihung, Genossen! Aber irgendwo sind ja die Nerven auch …«
Wie blank die Nerven lagen, zeigte Bernhard Quandt, 86 Jahre alt, nach dem Krieg Ministerpräsident Mecklenburgs und danach bis 1974 SED-Chef im Bezirk Schwerin. Mit brüchiger Stimme, weinend und zitternd, hielt der alte Mann seine letzte Rede: »Liebe Genossen, mir fällt es sehr schwer, hier und heute vor dem Zentralkomitee aufzutreten, wo gesagt worden ist, dass unsere Partei, unsere ruhmreiche Partei, in Gefahr ist, sich aufzulösen. Das fällt mir sehr schwer zu begreifen. (…) Und jetzt soll es mit der Partei zu Ende sein? Das darf nicht sein, Genossen, das darf nicht sein! (…) Wir haben im Staatsrat die Todesstrafe aufgehoben, ich bin dafür, dass wir sie wieder einführen und dass wir alle standrechtlich erschießen, die unsere Partei in eine solche Schmach gebracht haben … Wir stehen als Zentralkomitee einer solchen Verbrecherbande als Gefolgschaft hintereinander, das will mir nicht in den Kopf …«
Für derart radikale Lösungen war es längst zu spät. Um 14.50 Uhr schloss Egon Krenz die letzte Tagung des ZK. Es war vorbei. Die bisherige SED-Führung hatte sich aufgelöst.
Zwei Tage später leitete der Generalstaatsanwalt Ermittlungsverfahren gegen die vormaligen SED-Spitzenfunktionäre Erich Honecker, Erich Mielke, Günther Kleiber (58), Werner Krolikowski (61), Willi Stoph (75) und Hermann Axen (73) sowie den Stellvertreter Alexander Schalck-Golodkowskis, Manfred Seidel (61), ein. Nach den geltenden DDR-Gesetzen erforderte in allen Fällen die Schwere des Tatverdachts eine Untersuchungshaft.
Erich Honecker wartete derweil in Wandlitz auf eine Reaktion auf seine Strafanzeige wegen der aus seiner Sicht unberechtigten Verleumdung und der Beschuldigung der Korruption. Weil nichts passierte, schrieb er am 5. Dezember einen empörten Brief an Generalstaatsanwalt Günter Wendland: »Erstens ersuche ich um Ermittlung der Verursacher dieser öffentlichen Verleumdung, zweitens ersuche ich den Generalstaatsanwalt um die restlose Aufklärung des Sachverhaltes ohne Ansehen von Personen …« Wieder gab es keine Antwort. Stattdessen plante die Generalstaatsanwaltschaft für den 7. Dezember weitere Verhaftungen der abgesetzten SED-Spitzenfunktionäre.
Bei Erich Honecker gestaltete sich das schwierig, denn der angegriffene Gesundheitszustand des 77-Jährigen erlaubte keine Haft. Deshalb blieb den Staatsanwälten zunächst nichts anderes übrig, als dem gestürzten Staatschef lediglich mitzuteilen, dass gegen ihn ermittelt würde. Erich Honecker glaubte erst einmal, es ginge nun endlich um seine Anzeige vom 1. Dezember und seinen Brief dazu vom 5. des Monats. Als sich dies als Irrtum herausstellte, schoss ihm der Blutdruck hoch und der Atem wurde schwer. Die immer noch für seine Betreuung zuständigen MfS-Mitarbeiter hatten das Telefon im Haus bereits abgeklemmt, so dass es schwierig wurde, einen Arzt zu alarmieren. Doch schließlich klappte es. Dann folgte eine fast vierstündige Hausdurchsuchung.
Sie erbrachte keine relevanten Beweise, aber immerhin erste Aufschlüsse über das Vermögen von Margot und Erich Honecker. Ihre Sparbücher der Berliner Sparkasse wiesen per 28. November 1989 für Erich Honecker 211.994 Mark und für seine Frau Margot 77.502 Mark aus. Sie wurden konfisziert.
Die Hintergründe des ominösen Telegramms aus Genf erklärte das alles nicht. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass es in dieser Form – also als »Privatvermögen« Erich Honeckers – weder Konto noch Kohle gab.
Marc Dosch, Sprecher der Credit Suisse, bestätigte bei späteren Recherchen: »Dieses Telex kann nicht aus unserem Hause stammen. Unsere Bank trat nicht unter diesem Namen auf, und es gab nie einen Verwaltungsrat mit dem Namen Süssli.«
Die Spur zum »Klassenfeind« schien ebenfalls eiskalt zu sein. David von Kiedrowski, Sprecher des Bundesnachrichtendienstes: »Dem BND ist dieses Telex nicht bekannt.« Das ist kaum zu bezweifeln, denn den westlichen Nachrichtendienstlern war die Götterdämmerung am Werderschen Markt offenbar insgesamt kaum aufgefallen. Drei Tage vor dem Mauerfall hatte der Bundesnachrichtendienst sogar noch eine Sensation nach Bonn zu vermelden: Erich Honecker habe »am 6.11. seine Schwester in Wiebelskirchen/Saarland besucht« und sei »dann zur ärztlichen Behandlung in die Schweiz weitergereist«. Hätten die Geheimdienstler ihren eigenen Berichten getraut, wäre das kaum noch nötig gewesen. Im August 1989 soll Erich Honecker laut BND tödlichen Bauchspeicheldrüsenkrebs gehabt haben. Tatsächlich gab es am 13. September 1989 dann auch eine »Expressmeldung« nach Bonn – vorsichtshalber wurde auf »erhebliche Zweifel« hingewiesen –, nach der der DDR-Chef verstorben und das Begräbnis für den 24. September 1989 geplant sei.
Dennoch zeigte das merkwürdige Telegramm damals seine Wirkung, denn nun war das Gerücht, Honecker habe privat Geld in der Schweiz gebunkert, erst einmal in der Welt.
Ausweislich einer Paraphe Margot Honeckers mit Datum vom 25. Oktober 1989 auf einem Exemplar des fraglichen Telegramms erfuhr auch der angebliche Besitzer selbst von seinem vermeintlichen Reichtum. Die Fälschung war wohl zu offensichtlich, um ihm Sorgen zu bereiten. Aber offenbar hatte er einen Verdacht. Erich Honecker: »Die Schweizer Banken haben das dementiert, und auch die famose Erfindung eines NVA-Angehörigen über ein Konto von mir im Umfang von 370 Millionen Francs erwies sich als eine Fehlleistung.«
Wer Interesse daran gehabt haben könnte, dem abgesetzten SED-Chef durch ein solches Gerücht zu schaden, blieb im Dunkeln. Oberstaatsanwalt Brocher: »Also wir haben das nicht ermittelt … Aber für mich deutet vieles darauf hin, dass entsprechende Truppen im MfS, die auch nicht unbeteiligt am Machtwechsel in der DDR im Oktober interessiert waren, die am besten Geeigneten für so etwas sind. Aber es könnte auch natürlich aus anderen Bereichen stammen. Möglicherweise auch aus konkurrierenden Gruppen in der Partei.«
Am Ende wies die gezielte Desinformation nur auf ein Problem hin, das in der hektischen Auflösungsphase der alten SED-Führung aus gutem Grund unerwähnt blieb: Die Erbschaft aus mehr als vierzig Jahren uneingeschränkten Wirtschaftens ohne jegliche Begrenzung oder Rechenschaftspflicht. Es ging um viel Geld und noch mehr Vermögen im In- und Ausland, über das nur ganz wenige Bescheid wussten. Dieser »Schatz der Arbeiterklasse« sollte das »Auf zum letzten Gefecht« der nächsten Jahre bestimmen.
1. Kapitel
Die Verwandlung einer Partei
Am 28. März 1988 beklagte sich Neues Deutschland heftig darüber, dass unter seinem Namen unverschämt gelogen würde. Das war aber beileibe kein selbstkritischer Blick auf die eigene Arbeit. Das Blatt druckte eine Meldung der DDR-Nachrichtenagentur ADN. Sie teilte mit, dass »im Verkehr zwischen der BRD, Berlin (West) und der DDR eine primitive, im Westen hergestellte Falschausgabe des ›Neuen Deutschlands‹ verbreitet« worden sei.
Die Sache hatte derweil nicht nur hektische Aktivitäten bei der völlig überraschten Stasi ausgelöst, sondern machte auch die Zeitungen im Westen auf einen offenbar unerhörten Vorgang aufmerksam.
Am 19. März war einigen Tausend DDR-Bürgern ein Neues Deutschland in die Hände geraten, das sie überraschte und staunen ließ. »Der neue ›Glasklar‹-Kurs der SED erobert die Herzen der Massen«, hieß der Aufmacherartikel. Die Vorzeilen erläuterten: »Öffnung der SED nach Glasnost-Vorbild. Umfassende Reformen gehen weiter. Erich Honecker als großer Erneuerer des Sozialismus gewürdigt«.
Das Imitat sah täuschend echt aus. Das miese Zeitungspapier stimmte, das Layout entsprach der gewohnten Langeweile, und die Typographie saß. Nur das Format war ein wenig kleiner, und der Inhalt schien sensationell. Erich Honecker erläuterte die neue Politik, und ein »Großes ND-Quiz« stellte die Frage: »Was wird aus der Mauer?« Dazu wurden gleich »Sieben mutige Vorschläge« mitgeliefert, wie sie verschwinden könnte. In einer »Bekanntmachung der Musterung für den Wehrdienst« wurden die jungen Männer vom Geburtsjahrgang 1970 darauf aufmerksam gemacht, dass sie aus Gewissensgründen auch einen Ersatzdienst leisten könnten, und nicht einmal eine Kurznachricht fehlte, die vermeldete: »Der Fernsehkommentator Karl-Eduard von Schnitzler hat es vorgezogen, die DDR zu verlassen. Er wird seinen Alterswohnsitz in der Volksrepublik Albanien nehmen.«
All das konnte nicht echt sein. Doch wer steckte dahinter? Die Stasi hatte die Westberliner taz im Verdacht, aber bereits nach wenigen Tagen stellte sie fest: »Inoffiziell konnten Informationen erarbeitet werden, wonach der o. g. Falschdruck mit hoher Wahrscheinlichkeit von der Zeitschrift ›Tempo‹ in Hamburg herausgegeben wurde.«
Damit lag sie richtig. Das 1985 von dem österreichischen Journalisten Markus Peichl gegründete und von ihm bis 1990 als Chefredakteur geführte Magazin hatte die rund 6.000 Exemplare der falschen Ausgabe des Neuen Deutschland hergestellt.
In der DDR begann es damals – meist noch unter der Decke – langsam zu gären. Markus Peichl erinnert sich: »Wir wollten ein Zeichen setzen. Wir wollten zeigen, dass der Westen nicht pennt, wenn die kritischen Leute in der DDR aufwachen.«
Via Westfernsehen gelangte die Information über die ND-Fälschung zurück in die DDR. Dort suchten nun viele nach dem sensationellen »Zentralorgan«. Die Tempo-Redaktion hatte es über den Limousinenservice der Ostberliner Devisenhotels über die Grenze geschmuggelt. Danach verteilten Teams von Freiwilligen das Blatt in Hausbriefkästen und legten es an öffentlichen Plätzen aus, um so Fotos von erstaunten Ostlesern machen zu können. Ein Teil gelangte auch über den Postweg oder Interzonenzüge ins Land. Die Stasi notierte am 22. März 1988, dass 178 »fiktive Zeitungen« im D 439 Köln–Rostock entdeckt wurden: »Die Zeitungen befanden sich abgelegt in Toiletten, Waschräumen und Abteilen.«
Eigentlich war die Idee, unter dem echten Kopf einer Zeitung falsche Nachrichten zu verbreiten, durchaus nicht neu und von den Propagandamachern verschiedenster Couleur x-mal erprobt. Trotzdem dürfte das gefälschte ND etwas erreicht haben, was Satire üblicherweise kaum schafft: Weniger als tausend Tage später wurden fast alle der frei erfundenen »Nachrichten« wahr! Sechs Beispiele: ∙ »Revolutionärer Vorschlag – DDR schafft AKWs ab« ∙ »Volkskammer beschließt bürgernahe Justiz – Auch neue Gesetze zur Staatssicherheit beraten« ∙ »DDR-Mark jetzt Hartwährung … ›Genex‹ wird aufgelöst« ∙ »DDR wird zum Einkaufsparadies – Anschluss ans Weltniveau erreicht« ∙ »›Billy‹ ist endlich da« ∙ »Hinaus in die Welt – Neue Flüge und Pauschalreisen«.
Nach dem Sturz Erich Honeckers am 18. Oktober 1989 und dem drei Wochen später erfolgten Mauerfall traf die Wucht der Ereignisse besonders die über vierzig Jahre lang die DDR beherrschende SED.
Am 1. Dezember 1989 änderte die Volkskammer die Verfassung und strich den bis dahin gesetzlich festgelegten Führungsanspruch der Partei. Auch die Mehrheit der SED-Abgeordneten stimmte dafür. Nur fünf Abgeordnete enthielten sich des Votums.
Am 4. Dezember 1989 informierte das Parteiblatt über den Rauswurf von Erich Honecker, Erich Mielke und weiteren früheren Spitzenfunktionären aus der SED. Nun musste alles sehr schnell gehen. Neues Deutschland kündigte an: »Das bisherige Zentralkomitee betrachtet es als seine Pflicht, vor dem einberufenen außerordentlichen Parteitag Rechenschaft über die Ursachen für die Krise in der SED und in der Gesellschaft abzulegen.« Diesen Parteitag in der Regie der derweil entmachteten DDR-Staatspartei gab es nicht mehr. Stattdessen versammelten sich die Genossinnen und Genossen zu einem ganz anderen Zweck.
Das Märchen vom eisernen Besen
An vorweihnachtliche Besinnlichkeit mochte im Dezember 1989 kaum jemand denken. Stattdessen saßen viele Leute nach ihren ersten Ausflügen in den Westen am Abend vor dem Ostkanal ihres Fernsehgeräts, was ungewöhnlich genug war. Sie lernten so einen bis dahin den meisten unbekannten, kleinen Mann mit einem riesengroßen Besen kennen. Er sollte die bislang allmächtige Sozialistische Einheitspartei Deutschlands auf Kurs zur Erneuerung der DDR bringen. Sein Name: Gregor Gysi. Um die vom Besen symbolisierte Aufgabe zu erledigen, war erst einmal ein gründliches Reinemachen angesagt. »Die Partei« stand derweil im Verdacht, in ihrer Führung von Amtsmissbrauch und Korruption durchsetzt zu sein.
Dagegen versuchte sie sich nun zu wehren. Plötzlich wusste jeder, wer an allem schuld war. Neue Köpfe wurden gesucht.
Dazu fanden sich am 8. und 9. Dezember Genossinnen und Genossen aus den Grundorganisationen der SED in der Dynamo-Sporthalle in Berlin-Hohenschönhausen zu einem Sonderparteitag zusammen. Die Hektik war offenbar so groß, dass im Nachhinein nicht einmal ihre genaue Zahl festzustellen ist. Die Linkspartei nennt in ihrer Chronik 2.878 Abgesandte, die erstmals wieder in geheimer Wahl bestimmt wurden. Der Mitteldeutsche Rundfunk sprach später von 2.750 Delegierten und 92 Gästen aus den Bezirken, der Nachrichtensender n-tv zählte 2.147 Parteitagsteilnehmer. Sie alle, wie viele es auch immer gewesen sein mögen, sollten die Weichen für die Zukunft stellen. Hans Modrow, seit knapp einem Monat der neue Ministerpräsident der DDR, bestimmte die Marschrichtung: »Lasst uns diese Partei, die sich auf Karl Marx und Friedrich Engels, Wilhelm Liebknecht und August Bebel, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, Ernst Thälmann und Rudolf Breitscheid, Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl beruft, lasst diese Partei nicht zerbrechen, nicht untergehen, sondern macht sie sauber und stark!«
Das klang gut. Aufbruch und Neuanfang schienen vielen möglich. Dass die DDR ohne ihre Mauer keine Überlebenschance hatte, war für die meisten ihrer Bürger damals noch undenkbar. Eine »bessere DDR« war nicht nur das Ziel vieler der in der SED organisierten Frauen und Männer, sondern auch das der neu entstandenen Bürgerbewegungen. Sie hatten den Sturz der bisherigen Machthaber initiiert. Die immer noch mächtige Partei musste künftig mit Konzepten und Inhalten überzeugen, wenn sie den gesellschaftlichen Umbruch überhaupt mitgestalten wollte.
Damit stellte sich eine ungewohnte Aufgabe, denn mehr als vierzig Jahre stützte sich die SED auf die Bajonette der sowjetischen Besatzer. Als Michail Gorbatschow am Tag seiner Amtsübernahme darauf verwies, dass künftig jedes Land seinen eigenen Weg »zum Sozialismus« finden müsse, nahm das in Ostberlin niemand so richtig ernst. Der Fall der Mauer am 9. November 1989 bewies dann, dass es Moskau tatsächlich so meinte, wie angekündigt.
Das hatte nun auch die wankende Staatspartei begriffen. Für Hans Modrows Brandrede auf dem Sonderparteitag gab es brausenden Beifall. Die muffige, erstarrte Organisation schien aus einem jahrelangen Dornröschenschlaf erwacht zu sein. Rund ein Viertel der Delegierten wollten einen radikalen Neuanfang. Damit waren sie sich mit vielen DDR-Bürgern einig. Die Auflösung der alten und die Gründung einer neuen Partei stand dabei auf der Tagesordnung. Nicht weniger als »sauber und stark« sollte die neue Partei werden. Über den Weg dahin hatte die neue Führung, trotz des symbolisch übergebenen Besens zur Reinigung, ihre eigenen Vorstellungen.
Schon in seiner Antrittsrede erklärte der gerade gewählte Vorsitzende Gregor Gysi, weshalb solch ein neuer Start auf keinen Fall mit dem Ende der alten SED verbunden sein dürfe: »Die Auflösung der Partei und ihre Neugründung wäre meines Erachtens eine Katastrophe für die Partei … Das Eigentum der Partei wäre zunächst herrenlos, anschließend würden sich sicherlich mehrere Parteien gründen, die in einen juristischen Streit um die Rechtsnachfolge träten … Kurzum: Ich verstehe sehr gut, wie es zu solch einer Idee kommen kann, aber bei Abwägung aller Folgen wäre eine solche Entscheidung in hohem Maße verantwortungslos.«
Das überraschte manche. Eigentlich sollte es beim Parteitag um eine neue Politik gehen. Ans Geld – vom Barem bis zu einem umfänglichen Firmenimperium – dachte bislang niemand.
Eine Woche später wurde der Sonderparteitag fortgesetzt. Nun gab es vom Vorsitzenden der derweil in »Sozialistische Einheitspartei Deutschlands – Partei des Demokratischen Sozialismus« (SED-PDS) umbenannten Partei auch eine Information darüber, wer eigentlich die Besitzer des riesigen Vermögens der bisherigen Staatspartei waren: »Zum Parteieigentum und zu Parteibetrieben ist zu sagen, dass wir auch dies überprüfen. Gehört uns etwas nicht, geben wir es zurück. Ist es aber unser Eigentum, dann gehört es allen Mitgliedern der Partei, und wir haben kein Recht, das Eigentum daran aufzugeben, wohl aber die Pflicht, eine sinnvolle Nutzung zu sichern.«
Das waren neue Töne, denn bislang hatten die Mitglieder nur ihre üppig bemessenen Beiträge zu entrichten. Dass sie eigentlich reich waren, wussten sie nicht, und wie viel sie angeblich besaßen, schon gar nicht.
Die ganze Sache betraf noch eine Menge Leute. Die letzte verbindliche Mitgliederzahl wurde allerdings per 31. Mai 1989 erhoben. Damals betrug sie 2.310.604 Frauen und Männer. In den folgenden Monaten hatten viele die SED, dann die SED-PDS verlassen. Damit gaben sie ihren Anspruch am gemeinsamen Vermögen auf. Deshalb interessierte es sie auch nicht mehr besonders, als der Parteivorstand am 4. Februar 1990 verkündete, künftig nur noch den Namen »Partei des Demokratischen Sozialismus« (PDS) führen zu wollen. Kurz und bündig hieß es: »Unsere Partei ist nicht mehr die SED.«
Das stimmte so nicht, denn das Erbe an Geld, Unternehmen und Grundstücken wollte die PDS durchaus antreten. Durch ihre Umbenennung entstand keine neue Partei. Es gab keinen Akt der Neugründung, und es fand auch kein Mitgliederwechsel statt. Damit wurde die PDS rechtlich nicht zur Rechtsnachfolgerin der SED, sondern blieb mit dieser identisch. So sah sie es auch mit dem Blick auf das Eigentum.
Dass der »Schatz der Arbeiterklasse« nun den noch verbliebenen Genossinnen und Genossen gehörte, hatte Parteichef Gregor Gysi erneut auf der Tagung des Parteivorstands am 6. Januar 1990 unterstrichen: »Niemand von uns hat aber zu sich selbst eine so anmaßende Grundeinstellung, dass er sich legitimiert fühlt, über das Eigentum von etwa 1,5 Millionen Mitgliedern selbstherrlich durch Verzicht zu entscheiden.«
Statistisch betrachtet, müssten die Mitglieder erheblich reicher geworden sein, denn im Mai 1990 waren nur noch 450.000 Parteigänger in der PDS. Nach diversen weiteren Umbenennungen und Fusionen zählte die heutige Nachfolgepartei DIE LINKE per 31. Dezember 2018 62.016 Genossinnen und Genossen.
Bereits damals wussten allerdings nur ein paar Dutzend Funktionäre der Partei, um wie viel Vermögen es sich eigentlich handelte.
Rätseln um den Schatz der SED
Bereits am 3. Dezember 1989, einem Sonntag, zog es Hunderttausende von Menschen auf die vier Fernverkehrsstraßen, die die DDR kreuzten. Um Punkt 12 Uhr bildeten sie eine Menschenkette. Auf mitgeführten Transparenten waren Forderungen nach Anklage und Bestrafung bei Machtmissbrauch und Korruption und nach Offenlegung von Parteifinanzen und dem Vermögen der SED im In- und Ausland zu lesen.
Das versprach die am darauffolgenden Wochenende zur SED-PDS umgewandelte SED dann auch. Doch schon wenig später, am 5. Januar 1990, gab es neue Töne. Die Berliner Zeitung berichtete unter Berufung auf den Pressesprecher der SED-PDS über ein Treffen des Parteivorstands mit den Chefs der parteieigenen Betriebe: »Im Ergebnis der Diskussion sei Übereinstimmung festgestellt worden, dass rechtmäßiges Parteieigentum als solches anerkannt bleiben müsse. Die Parteien, die die SED-PDS verkörpert, seien letztmalig 1933 enteignet worden. Eine solche Konstellation, so wird betont, wird nie wieder zugelassen … Die SED-PDS, so ihr Pressesprecher, haftet mit ihrem gemeinsamen Eigentum und Vermögen für die soziale Sicherheit in den Parteibetrieben. Er verwies darauf, dass auf dem kommenden Parteitag, wie angekündigt, Rechenschaft über die bisherige Verwendung von finanziellen Mitteln gelegt und Pläne zur künftigen Verwendung zur Diskussion gestellt werden.«
Der Hinweis auf »1933«, den Beginn der Naziherrschaft in Deutschland, hatte einen tieferen Sinn. Es war der Anspruch auf das nach dem Krieg von der sowjetischen Besatzungsmacht an die aus KPD und SPD gebildete SED übergebene Vermögen. Überdies schloss er dessen Vermehrung in den Jahren der DDR ein. Um was und wie viel es sich dabei handelte, wusste immer noch niemand.
Die in der Wendezeit gegründete und dann bei der Volkskammerwahl am 18. März 1990 mit 3.007 Wählerstimmen untergegangene Unabhängige Volkspartei (UVP) reichte Anfang Januar beim Generalstaatsanwalt und Obersten Gericht der DDR eine Anzeige und Klage gegen die SED ein. Sie wollte damit erreichen, dass das gesamte SED-Vermögen in »Volkseigentum« überging. In der Klageschrift hieß es unter anderem: »Das gesamte Vermögen des Verklagten ist … einzuziehen, da es auf Kosten des Volkes, zum Nachteil des Volkes und gegen den Willen des Volkes durch den Verklagten gebildet wurde und gegen das Volk zur Verdummung und Unterdrückung eingesetzt wurde.« Die Aktion blieb eine Fußnote der Geschichte ohne jedwede Auswirkung.
Dennoch gab es auch Ungewöhnliches. Am 5. Februar 1990 berichtete Neues Deutschland erstmals in seiner Geschichte über die »Finanzrechnung 1989 der SED«. Sie war in »Mark der DDR« und »Valuta« unterteilt. Konkrete Einnahmen wies sie nur bei DDR-Mark aus. Danach zahlten die SED-Mitglieder 710,4 Millionen Mark Beiträge, die Parteibetriebe führten 720,3 Millionen Mark ab, »Organisations- und Verwaltungsarbeit« brachten 63,8 Millionen Mark ein, und 0,3 Millionen gab es durch Schenkungen. Insgesamt betrugen somit die Einnahmen 1.494,8 Millionen Mark. Ihnen standen Ausgaben von 1.644,9 Millionen Mark gegenüber. Dazu hieß es: »Zur Deckung der Gesamtausgaben wurden 150,1 Mio. Mark aus dem Reservefonds eingesetzt.« Zu den Valutaausgaben wurde nur angegeben: »Zur Finanzierung der Valutaaufwendungen standen 1989 101,5 Mio. VM (Valutamark, entsprach Deutscher Mark, K. B.) und 3,01 Mio. Mark SW (Sozialistische Währungen, K. B.) zur Verfügung.« Über die Herkunft dieses Geldes gab es nur Prozentangaben, wie etwa die Einnahme von 45,5 Prozent harter Währung und 96,1 Prozent sozialistischer Währungen, »durch Ankauf bei der Staatsbank gemäß bestätigtem Plan entsprechend den in der DDR geltenden Grundsätzen«.
Einem Buchhalterlehrling im ersten Lehrjahr wäre eine solche »Bilanz« um die Ohren gehauen worden. In der sich wandelnden DDR nahm sie im ersten Quartal 1990 kaum jemand zur Kenntnis. Es ging um die Vorbereitung der ersten freien Wahl zur Volkskammer am 18. März und für die PDS dabei ums Überleben. Sie wurde schließlich mit 1.892.329 Stimmen, was 16,4 Prozent entsprach, drittstärkste Kraft und zog mit 66 Mandaten ins neue DDR-Parlament ein. Lothar de Maizière (CDU) bildete nach einer Wahlbeteiligung von 93,4 Prozent der Wählerinnen und Wähler aus der »Allianz für Deutschland« (bestehend aus der DDR-CDU, der neu gegründeten Partei Deutsche Soziale Union – DSU – und dem ebenfalls neuen Demokratischen Aufbruch – DA), der SPD und den Liberalen eine Koalition.
Nun war es Sache der neuen Regierung, die Vermögensverhältnisse der PDS aufzuklären. Sie setzte dazu die »Unabhängige Kommission zur Überprüfung des Vermögens der Parteien und Massenorganisationen der DDR« (UKPV) ein. Diese nahm am 1. Juni 1990 ihre Tätigkeit auf und arbeitete bis zum 15. Dezember 2006.
Ihr Ermittlungsauftrag bestand zunächst darin, zu prüfen, ob die Parteien und Massenorganisationen der DDR ihr Vermögen rechtmäßig erworben hatten. Um das in Erfahrung zu bringen, hatte bereits die von Hans Modrow geführte Regierung am 21. Februar 1990 das »Gesetz über Parteien und andere politische Vereinigungen« erlassen. Es verpflichtete alle Parteien – darunter natürlich auch die PDS – dazu, einmal im Jahr einen Rechenschaftsbericht abzugeben.
Daran hielten sich die SED-Nachfolger nicht. Deshalb änderte die Koalitionsregierung dieses Parteiengesetz in drei wichtigen Punkten. Ministerpräsident Lothar de Maizière beauftragte die Kommission mit der Ermittlung und Überprüfung des betreffenden Vermögens. Sie bekam dazu die gleichen Rechte der Beweisaufnahme wie ein Staatsanwalt. Zum Zweiten wurden die Parteien und Massenorganisationen verpflichtet, der Kommission Auskunft über die Entwicklung ihres Vermögens seit 1945 bis zum 7. Oktober 1989 zu erteilen und ihr über diesen Zeitraum eine Vermögensübersicht vorzulegen. Der dritte Punkt bestimmte, dass sie über ihr per 7. Oktober 1989 vorhandenes Vermögen, nun »Altvermögen« genannt, nur noch mit Zustimmung des Vorsitzenden der Kommission verfügen durften. Das neue Gesetz enthielt jedoch keine Sanktionen für den Fall des Verstoßes gegen diese Pflichten und keine Bestimmungen darüber, welche Vermögenswerte die Parteien und Massenorganisationen künftig behalten dürften.
Die Kommission stellte zum 1. Oktober 1989 allein ein Geldvermögen der SED von 6,2 Milliarden DDR-Mark fest. Hinzu kam das Vermögen der Parteibetriebe. Allein die riesige Geldsumme hätte für mehr als 88.000 Eigenheime gereicht, die in der DDR mit 70.000 Mark kalkuliert wurden, oder für über 190.000 damals brandneue Viertakter-»Wartburg« zum Stückpreis von rund 32.000 Mark. In der Gesamtsumme an Geld ohne die Firmen war ein sogenannter »Sonderfonds« von 3,5 Milliarden DDR-Mark und ein »Valutafonds« von 80 Millionen Valutamark enthalten. All das war gut getarnt, denn das Geld lag auf verschiedenen Nummernkonten bei der Deutschen Handelsbank AG. Exotische Namen wie »655 Flora«, »546 Fauna«, »831 Samba« oder das Dollar-Konto »Lilie« deuteten auf die Absicht ihrer Verschleierung hin. Die Konten wurden außerhalb der Parteibilanz geführt. Ein Hauptkonto des »Sonderfonds« wies als Kontoinhaber nicht die SED, sondern die Staatsbank der DDR aus. Damit war dieser Teil des Geldes von vornherein als »schwarze Kasse« angelegt.
In den 23 Monaten vom 1. Oktober 1989 bis zum 31. August 1991 – dem Zeitpunkt, zu dem das Altvermögen der SED vom Neuvermögen der PDS offiziell getrennt wurde – verringerte sich das Vermögen von rund 6.200.000.000 DDR-Mark auf nur noch 205.700.000 DDR-Mark. Fast 97 Prozent des Geldes waren also verschwunden. Die UKPV stellte in ihrem Abschlussbericht 2006 fest, dass der Löwenanteil dieser Summe vor der Verfügungssperre dieser Gelder ab 1. Juni 1990 und der Währungsunion am 1. Juli 1990 ausgegeben wurde.
An jenem Tag änderte sich alles, denn die DDR-Mark wich der Deutschen Mark (DM). Der Weg in die deutsche Einheit nahm Fahrt auf, und nach dem Einigungsvertrag und dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland am 3. Oktober 1990 galten nun neue Regeln. Die Verwaltung des Altvermögens der ostdeutschen Parteien und Massenorganisationen übernahm schon vorher die Treuhandanstalt. Die Kommission mit dem sperrigen Namen blieb für die Ermittlung und Überprüfung des Vermögens und alle grundsätzlichen rechtlichen Entscheidungen zuständig. Dazu gehörte auch eine Regelung darüber, was mit dem Vermögen geschehen sollte. Sie orientierte sich am zwischen der DDR und der Bundesrepublik vereinbarten Grundsatz »Rückgabe vor Entschädigung«. Daraus ergab sich, dass die Parteien und Massenorganisationen nur das behalten durften, was sie nach rechtsstaatlichen Grundsätzen im Sinne des nun auch in der früheren DDR geltenden Grundgesetzes erworben hatten. War dies nicht der Fall, ging es an die früheren Eigentümer zurück. Das verbleibende Vermögen erhielten die ostdeutschen Länder im Verhältnis zu ihrer Einwohnerzahl für »gemeinnützige Zwecke«.
Die Umsetzung dieser Gesetzeslage gestaltete sich schwierig. Die Geste mit dem Besen auf dem Sonderparteitag der SED im Dezember 1989 war wohl nicht so ernst gemeint. Ein Vierteljahrhundert später blieb die Suche nach dem historischen Gegenstand erfolglos. Bei der heutigen Linkspartei hieß es, er sei spurlos verschwunden. »Seine Aufgabe hatte sich ja auch erledigt«, meinte Gregor Gysi.
Darüber gibt es geteilte Meinungen, denn schon im Februar 1990 schob die PDS nicht nur diverse Finanzmanipulationen im In- und Ausland an, sondern versuchte auch, mit einer spektakulären Aktion die leidige Diskussion um das Vermögen zu stoppen.
Befreiungsschlag mit Hintertür
In der im Internet nachzulesenden »Geschichte der Linkspartei« hörte sich die ganze Sache wenig sensationell an: »Das Vermögen der SED wurde auf der Grundlage des Parteiengesetzes der DDR (§§ 20 a und 20 b) vom Februar 1990 mit dem Stichtag 7. Oktober 1989 unter treuhänderische Verwaltung gestellt. Eine Unabhängige Kommission zur Überprüfung des Vermögens der Parteien und Massenorganisationen der DDR hatte die Aufgabe, den materiell-rechtsstaatlichen Erwerb des Parteivermögens zu prüfen und festzustellen. Unabhängig davon hat die PDS auf eigenen Beschluss Anfang 1990 aus dem Parteivermögen eine Summe von 3,041 Mrd. Mark der DDR an den Staatshaushalt der DDR für soziale und kulturelle Zwecke abgeführt.«
Der Allgemeine Deutsche Nachrichtendienst (ADN) informierte am 5. Februar 1990 lapidar: »Der Parteivorstand der SED-PDS hat gestern beschlossen, die Partei nur noch PDS, also ›Partei des Demokratischen Sozialismus‹, zu nennen … Ein Reserveguthaben von über drei Milliarden Mark, so legte der Parteivorstand fest, werde an den Staatshaushalt der DDR zurückgeführt … Das Reserveguthaben, das die Partei dem Staat übergeben will, stammt aus nicht verbrauchten Gewinnen der Parteibetriebe aus den vergangenen 20 Jahren. Wie der Parteivorstand ADN informierte, hat er in einem Schreiben an den Ministerpräsidenten der DDR darum gebeten, das Geld für bestimmte Zwecke zu verwenden und darüber öffentlich zu informieren.«
Das war wenig Aufklärung über viel Geld. Immerhin deutete die Meldung aber an, dass keine bedingungslose Abgabe erfolgen solle. Glaubt man der am gleichen Tag veröffentlichten »Finanzrechnung 1989 der SED«, entsprach die Summe knapp den Ausgaben der Partei für zwei Jahre. Damals hatte sie noch rund 44.000 hauptamtliche Mitarbeiter.
Bei der Überweisung dieser 3,041 Milliarden DDR-Mark an den Staatshaushalt im Februar 1990 war es dann auch die Einflussnahme der PDS, die die Aktion fragwürdig machte. Die Kontrolleure der Parteifinanzen stellten achtzehn Jahre später fest: »Ungeachtet der Abführung behielt die Partei weiterhin einen wesentlichen Einfluss über die Verteilung dieser Gelder, die zu einem Teil wieder in Parteibetriebe flossen.«
Dahinter steckte keine große Ermittlungsarbeit, denn bei der Verteilung des Geldsegens wurde meist der edle Spender im Hintergrund genannt. So teilte zum Beispiel das Ministerium für Kultur am 4. April 1990 dem Ostberliner Metropol-Theater mit: Bei der Vergabe der Mittel »fanden Vorschläge Berücksichtigung, die an die PDS herangetragen wurden«.
Dieses »Herantragen« von »Vorschlägen« erfolgte im Februar 1990. Der Ministerrat unter Hans Modrow bekam eine Liste, wohin die mehr als 3 Milliarden Mark auf Wunsch der Partei fließen sollten. Sie enthielt beispielsweise eine Kulturförderungsgesellschaft nebst »Kulturschutzverband Künstler der DDR« mit 150 Millionen Mark ebenso als potentiellen Empfänger wie den Verband der Jüdischen Gemeinden mit 0,5 Millionen, den mit PDS-Freunden besetzten Zentralen Ausschuss für Jugendweihe mit 19 Millionen oder das Europäische Humor- und Satire-Festival Leipzig mit 0,2 Millionen.
Der Beschluss des Ministerrats, ob und wie das Geld nach den PDS-Vorgaben zu verteilen sei, fiel am 15. März 1990. Drei Tage später wurde die PDS-Regierung ab- und die letzte DDR-Regierung unter Lothar de Maizière gewählt. Bis er seine Regierung bildete, vergingen noch knapp vier Wochen bis zum 12. April 1990. Diese Zeit sollte genutzt werden. Lothar de Maizière erinnert sich: »Ich hatte den Eindruck, die wollen wieder nur ihre eigenen Leute bedenken, das war indiskutabel … Wer geklautes Geld wieder rausgibt, kann nicht darüber befinden wollen, wohin es geht.«
Dennoch kamen dieses Zeitfenster und die Unerfahrenheit der »Laienspieler« in der neuen Regierung der PDS zugute. Der Spiegel berichtete Ende 2001: »Von dem ›Stunk‹, den de Maizière gemacht haben will, steht jedoch nichts im Protokoll des Ministerrats. Im Gegenteil: Die Beschlussvorlage wurde sogar noch zu Gunsten der PDS geändert. So hatte die PDS 98 Millionen Ostmark zunächst für die Unterstützung parteieigener oder -naher Verlage vorgesehen. Nur war das riskant, weil die Treuhand parteinahe Firmen schon im Visier hatte und kontrollierte. Also wurde das Geld flugs im Posten ›Kulturfonds‹ beim Ministerium für Kultur versteckt, was auf den ersten Blick unverdächtiger erschien. Noch dreister korrigierten die Altkader den Entwurf bei der pauschalen Förderung für ›Objekte des Gesundheitswesens, des Umweltschutzes, der Kultur, der Jugend sowie des Sports‹. Ursprünglich waren dafür 900 Millionen Ostmark vorgesehen. Im Beschluss des Parteifreundes Modrow schrumpfte der Geldsegen auf 200 Millionen Ostmark. Dafür wurde ein neuer Förderbereich maßgeschneidert: ›Der Minister der Finanzen wird beauftragt, mit dem Vorstand der PDS die Bildung einer Stiftung zu beraten und erforderliche Maßnahmen einzuleiten.‹ Die Parteistiftung, zu der es später nicht kam, sollte mit 700 Millionen Ostmark ausgestattet werden. Der Widerstand gegen die Trickser kann nicht groß gewesen sein. Das Protokoll vermerkt ›Einigung‹, und im Modrow-Beschluss heißt es lakonisch: ›Die in der Sitzung gegebenen Hinweise … sind in Abstimmung mit dem Parteivorstand der PDS zu entscheiden.‹ So wurden am Ende vor allem Künstler, Verlage und Wissenschaftler bedacht, einst die Elite der SED und von der PDS als geeignete Multiplikatoren für eine neue sozialistische Zeit geschätzt. Dennoch konnten die Postkommunisten im Juni ungehindert fabulieren, die Milliarden seien nur ›für gemeinnützige Zwecke‹ verwendet worden.«
Wie das die PDS genau alles zu steuern versuchte, ist nicht mehr nachvollziehbar. In den archivierten Akten des Bundesfinanzministeriums finden sich am Original des damaligen Schreibens der PDS an den neuen Ministerpräsidenten Lothar de Maizière nur noch kleine Papierfetzen unter einer Tackerklammer. Der einstmals angeheftete Wunschzettel ist verschwunden.
Trotzdem lassen sich die Winkelzüge der Geldverteilung nach PDS-Vorgaben in verschiedenen Fällen beispielhaft rekonstruieren – so etwa beim Altberliner Verlag. Im Frühjahr 1990 ahnte kaum jemand, dieser könne etwas mit der verblichenen SED zu tun gehabt haben. Es schien um eine völlig »unpolitische« Firma zu gehen, die niemals im Fokus der Aufmerksamkeit stand. Sie produzierte nichts anderes als beliebte Kinderbücher. Die über Jahre verschleierten Eigentumsverhältnisse machten jedoch das Verstecken von Geld in den letzten Monaten der DDR erst möglich.
Der Verlag entstand 1945 unter dem Namen »Altberliner Verlag Lucie Groszer« als privates Unternehmen. Am 15. Oktober 1979 verkaufte die Eigentümerin ihre Firma an den Kinderbuchverlag Berlin der DDR, der damals bereits der SED gehörte. Der Kaufpreis für Lucie Groszers Verlag betrug 203.200,25 DDR-Mark. Ein Firmenwert wurde nicht berücksichtigt.
Am 5. Dezember 1979 erschien der Altberliner Verlag per Eintrag im Register der volkseigenen Wirtschaft. Das übergeordnete Organ wurde nun das Ministerium für Kultur. Diese Funktion bekam es für den Altberliner Verlag, ebenso wie für andere DDR-Verlage, durch eine Vereinbarung mit der Abteilung Finanzverwaltung und Parteibetriebe beim ZK der SED vom 17. April 1984. Für die Verwaltung erhielt das Kulturministerium von den Verlagen eine jährliche Umlage. Durch die Eintragung des Ministeriums im Register der volkseigenen Wirtschaft blieb nach außen die SED als tatsächlicher Eigentümer verborgen.
Per 31. Dezember 1989 betrug die Bilanzsumme des Altberliner Verlags 6.885.000 DDR-Mark. Für das Geschäftsjahr 1989 wurden 3.678.000 DDR-Mark Gewinn ausgewiesen. Davon gingen 3.112.000 DDR-Mark direkt an die Hauptkasse des ZK der SED.
Mit Wirkung vom 31. Januar 1990 beendete das Kulturministerium seine Verwaltungstätigkeit. Einige der ihm bislang unterstellten Verlage sollten nun nach einem Beschluss des Parteivorstands der SED-PDS vom 11. Januar 1990 in »Volkseigentum« überführt, andere »unter dem Gesichtspunkt der Sicherung des Parteivermögens« einer neu zu gründenden »Buchverlagsgesellschaft« zugeordnet werden.
Zur Letzteren gehörte der Altberliner Verlag. Der Beschluss sah eine Prüfung vor, »ob aus Gründen der Sicherung des Parteivermögens an diesen Buchverlagen eine Veränderung der Rechtsform und juristische Ausgestaltung als G. m. b. H. erforderlich ist«. Das schien der Fall zu sein, und deshalb sollten diese neue »Gesellschaft mit beschränkter Haftung« mit einem Stammkapital von 20.000 DDR-Mark künftig zehn bisherige Verlagsmitarbeiter tragen. Sie wurde am 21. März 1990 gegründet und am 21. Mai ins Handelsregister eingetragen.
Den neuen Besitzern des Altberliner Verlags griff die Partei unter die Arme. Am 22. Mai 1990 schloss der PDS-Vorstand mit ihnen einen Vertrag, der die nunmehrige GmbH als Rechtsnachfolger des bisherigen Betriebs zum Eigentümer von dessen gesamtem Vermögen machte.
Am 28. Mai 1990 vereinbarte der PDS-Vorstand mit dem neuen Geschäftsführer einen Kaufpreis von 1.533.000 DDR-Mark. Dieses Geld gab es gleichzeitig als Darlehen der Partei. Bis Jahresende 1990 blieb es zinslos, danach war es mit 3,25 Prozent jährlich zu verzinsen. Eine Tilgung sollte ab 1993 erfolgen. Sicherheiten wurden nicht vereinbart.
Damit war die GmbH faktisch an die Stelle des bisherigen Eigentümers – der SED, dann der SED-PDS und schließlich der PDS – getreten. Auf Wunsch der Partei zahlte das Kulturministerium im April 1990 an den nun »privatisierten« Altberliner Verlag einen nicht rückzahlbaren Förderbetrag von 5 Millionen DDR-Mark.
Somit hatte sich in diesem Fall der Kreis des Geldkarussells von der »Abgabe« an den Staatshaushalt der DDR im Februar 1990 zur nun getarnten Verfügung durch die PDS geschlossen.
Das widersprach allerdings dem damals geltenden Recht zur Vergabe von Fördermitteln. Die neuen Kapitalisten zeigten sich davon wenig beeindruckt. Stattdessen versuchten sie, Ende 1990 die Zuordnung der im Finanzvermögen stehenden Immobilie in ihr Eigentum zu erwirken. Die beabsichtigte kostenfreie Übertragung blieb zunächst ohne Erfolg. Einem Kauf des um 1780 errichteten Gebäudes in der attraktiven Lage der Neuen Schönhauser Straße in Berlin-Mitte durch die Gesellschafter stand jedoch nichts im Wege. Sie konnten dafür ein Investitionsvorrangverfahren nutzen. Danach wurde das Haus mit Hilfe der Denkmalpflege restauriert, und so floss noch einmal öffentliches Geld in »private« Taschen.
Nun stand nur noch eine Einigung mit der Treuhand aus, denn laut Gesetz gehörte ihr ja eigentlich all das Vermögen. Die Vergleichsverhandlungen zogen sich bis Mitte 1992 hin. Dann nahm die Treuhand das Angebot über die Abtretung der Geschäftsanteile an. Als nun alleinige Gesellschafterin verkaufte sie Ende 1992 das Unternehmen. Zusätzlich zum Kaufpreis flossen aus den im April 1990 vom Ministerium für Kultur gewährten Fördermitteln rund 1,1 Millionen DM an die Treuhandanstalt zurück. Der Rest der in den Jahren bis dahin bewegten Gelder war versickert.
Nach der erneuten und nun tatsächlich echten Privatisierung behauptete sich der Altberliner Verlag noch etwa zehn Jahre. Im August 2003 meldete er Insolvenz an. Die Taschenbuchrechte waren bereits vorher an die dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG in München verkauft worden. 2005 lebte der Verlag noch einmal kurz auf, im September 2008 wurde endgültig Insolvenz angemeldet.
Das große Schmelzen des Vermögens
Neben der großzügig erscheinenden Geste der Überweisung an den Staatshaushalt der DDR gab es etliche weitere Posten, die das Misstrauen der Unabhängigen Kommission zur Überprüfung des Vermögens der Parteien und Massenorganisationen der DDR hervorriefen, als sie später versuchte, die Ursachen der gewaltigen Geldschmelze von rund 6,2 Milliarden auf gut 205 Millionen DDR-Mark nachzuvollziehen.
Einer davon betraf die Rentenzahlungen an ausscheidende Mitarbeiter der Partei. In ihrem Bericht vom 24. August 1998 stellte die Kommission dazu fest: »Zu den wesentlichen Ausgaben, die zur Reduzierung des immensen Geldvermögens führten, gehörten: … rund 750 Mio. M/DDR als ›Rentenfonds‹ an die Staatliche Versicherung der DDR zur Übernahme der Rentenverpflichtungen der Partei im März 1990 …«
Das klang erst einmal nach einer fürsorglichen und notwendigen Maßnahme. Beim näheren Hinsehen stellte sich jedoch heraus, dass diese Überweisung nicht zum Abfließen dieses Betrags bei der PDS führte. Sie hatte mit der Staatlichen Versicherung vereinbart, dass diese das Geld lediglich für die Partei verwalten sollte. Deshalb bestand die Unabhängige Kommission auf einer Sicherstellung durch die Treuhand. Als sie im März 1993 erfolgte, waren von den einstmals 750 Millionen DDR-Mark, was nach der Währungsunion rund 375 Millionen DM entsprach, inklusive Zinsen noch etwa 290 Millionen DM vorhanden.
Bis zum Inkrafttreten des Rentenüberleitungs-Ergänzungsgesetzes (Rü-ErgG) am 1. Juli 1993 zahlte die Treuhand monatlich rund 3 Millionen DM an rentenberechtigte ehemalige hauptamtliche Funktionäre der Partei und ihrer ehemals organisationseigenen Betriebe. Aus der Freiwilligen Zusatzrentenversicherung (FZR) ergaben sich für diesen in der DDR privilegierten Personenkreis zusätzliche Ansprüche bei der Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenversorgung.
Mit dem Inkrafttreten des oben genannten Gesetzes stellte der »Rentenfonds« Vermögen der Bundesrepublik Deutschland dar. Die FZR für die früheren hauptamtlichen Mitarbeiter der Partei wurde gleichzeitig in die Rentenversicherung überführt. Zur Deckung ihrer Rentenansprüche und -anwartschaften reichte der übrig gebliebene SED-PDS-»Rentenfonds« bei weitem nicht aus. Sachverständige schätzten bereits 1998 einen zusätzlichen Bedarf von mehr als 500 Millionen DM.
Großzügig ging es auch bei den Personalkosten zu. Die Unabhängige Kommission stellte fest, dass »rund 190 Mio. DM Personalkosten und Sozialpläne für Parteimitarbeiter« gezahlt wurden. Und: »Hierin enthalten sind rund 119 Mio. DM für Abfindungen (Sozialpläne) im Zeitraum vom Oktober 1989 bis August 1991.«
Hintergrund dieser Abfindungszahlungen war der Abbau des hauptamtlichen SED-Apparats. Sein Personalbestand schmolz von rund 44.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Oktober 1989 auf nur noch etwa 150 Ende 1991. Vom Dezember 1989 bis zum 30. Juni 1990 zahlte die PDS Überbrückungsgelder an ausgeschiedene hauptamtliche Kräfte bis einschließlich zur Kreisebene. Das kostete umgerechnet etwa 41 Millionen DM. Dieses »Überbrückungsgeld« berechnete sich aus der Differenz zwischen dem niedrigeren Nettolohn bei einer Neubeschäftigung und dem bisherigen Parteigehalt. Es wurde für ein Jahr gezahlt.
Der Verlust des Arbeitsplatzes war damals für viele Werktätige in der DDR bedrückender Alltag. Die meisten von ihnen bekamen dabei keinerlei oder nur eine kleine Abfindung. Im sich auflösenden SED-Apparat war das anders. Der PDS-Bundesvorstand vereinbarte mit der zu jener Zeit zuständigen Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen (HBV) im Juli und November 1990 Abfindungszahlungen für ausscheidende »Parteiarbeiter« von bis zu 20.000 DM. Die PDS zahlte auf dieser Grundlage allein im zweiten Halbjahr 1990 insgesamt rund 67 Millionen Mark aus.
Mit Beschluss vom 5. Februar 1991 forderte die Unabhängige Kommission die Treuhand auf, einen neuen Sozialplan zu vereinbaren. Er sollte dem Verfahren mit den anderen entlassenen DDR-Werktätigen entsprechen.