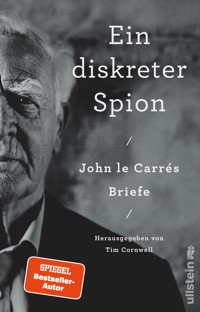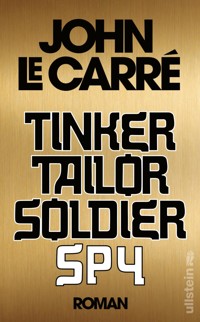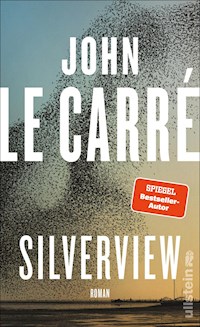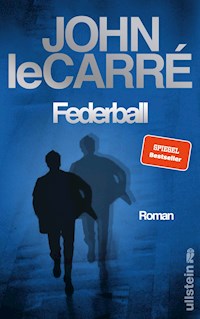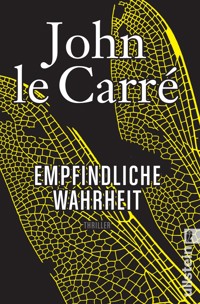14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein wahnwitziges Intrigenspiel im Schatten der Berliner Mauer - Der legendäre George Smiley, ehemaliger Chef des britischen Geheimdienstes, wird noch einmal gebraucht. Aber Smiley spielt nicht mit. Er ermittelt auf eigene Faust, wird sein eigener Agent in dem seltsamsten und erregendsten Fall seiner gesamten Karriere. Ein atemberaubender Kampf beginnt, der Smiley durch ganz Europa führt und erst im Schatten der Berliner Mauer sein Ende findet … Große TV-Doku "Der Taubentunnel" ab 20. Oktober 2023 auf Apple TV+
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Das Buch
Der legendäre George Smiley, einst Chef des britischen Geheimdienstes, heute im Ruhestand, wird noch einmal aktiv. Von seiner ehemaligen Behörde erhält er einen delikaten Auftrag – allerdings soll er diesmal nichts aufdecken, sondern etwas vertuschen helfen. Er soll Spuren verwischen, die darauf hindeuten können, dass der Tod eines alten Agenten mehr gewesen sein könnte, als nur ein bedauerlicher Unglücksfall. Aber Smiley spielt nicht mit und beginnt auf eigene Faust zu ermitteln. Und bald stößt er auf den einzigen ihm ebenbürtigen Gegner, Karla, mit dem es nun endlich zur langerwarteten Abrechnung kommt …
Der Autor
John le Carré, geboren 1931 Poole, Dorset, studierte in Bern und Oxford Germanistik, bevor er in diplomatischen Diensten u.a. in Bonn und Hamburg tätig war. Der Spion der aus der Kälte kam begründete seinen Weltruhm als Bestsellerautor. Er lebt mit seiner Frau in Cornwall und London.
In unserem Hause sind von John le Carré bereits erschienen:
Absolute Freunde · Agent in eigener Sache · Dame, König, As, Spion · Das Rußlandhaus · Der ewige Gärtner · Der heimliche Gefährte · Der Nachtmanager · Der Spion, der aus der Kälte kam · Der Schneider von Panama · Der wachsame Träumer · Die Libelle · Ein blendender Spion · Ein guter Soldat · Ein Mord erster Klasse · Eine Art Held · Eine kleine Stadt in Deutschland · Empfindliche Wahrheit · Geheime Melodie · Krieg im Spiegel · Marionetten · Schatten von gestern · Single & Single · Unser Spiel · Verräter wie wir
John le Carré
Agent in eigener Sache
Roman
Aus dem Englischen von Rolf und Hedda Soellner
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-0530-1
Neuausgabe im Ullstein Taschenbuch
1.April 2013
© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2006
© 1979 by Authors Workshop AG
Titel der englischen Originalausgabe: Smiley’s People
(Hodder an Stoughton, London) Deutsche Übersetzung von Rolf und Hedda Soellner mit freundlicher Genehmigung Hoffmann & Campe Verlag, Hamburg
Umschlaggestaltung: Sabine Wimmer, Berlin
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
E-Book: CPI – Clausen & Bosse, Leck
1
Zwei scheinbar unzusammenhängende Ereignisse gingen dem Ruf voraus, der Smiley aus seinem dubiosen Ruhestand zurückholen sollte. Das erste hatte als Ort der Handlung Paris und als Zeit der Handlung den kochenden Monat August, wenn die Pariser traditionsgemäß ihre Stadt der sengenden Sonne und den Busladungen zusammengepferchter Touristen überlassen. An einem dieser Augusttage – dem vierten, genau gesagt, und um Schlag zwölf Uhr, wie eine Fabriksirene, gefolgt von einer Kirchenglocke, bezeugte – tauchte in einem quartier, das einst für seinen hohen Anteil an russischen Emigranten der ärmeren Sorte bekannt gewesen war, eine stämmige, etwa fünfzigjährige Frau mit einer Einkaufstasche in der Hand aus der Dunkelheit eines alten Lagerhauses auf und ging, nach ihrer Gewohnheit, energisch und zielstrebig das Trottoir entlang zur Bushaltestelle. Die Straße war grau und eng und verödet, mit einigen kleinen hôtels de passe und einer Menge Katzen. Aus irgendeinem Grund war die Gegend besonders ruhig. Das Lagerhaus blieb, seiner verderblichen Waren wegen, während der Urlaubszeit geöffnet. Die Hitze, geschwängert von Ausdünstungen, die auch nicht der leiseste Lufthauch vertrieb, stieg wie aus einem Liftschacht an ihr hoch, doch die slawischen Züge der Frau zeigten keinerlei Beschwer. Sie war für Anstrengungen an einem heißen Tag weder gekleidet noch gebaut, denn sie war so kurzbeinig und dickleibig, daß sie ein wenig rudern mußte, um vorwärts zu kommen. Ihr schwarzes Kleid von klösterlicher Strenge wies weder eine Taille noch irgendeinen Putz auf, wenn man von dem Käntchen weißer Spitze am Hals und von einem großen abgegriffenen Kreuz aus vermutlich wertlosem Metall auf ihrem Busen absah. Die rissigen Schuhe, deren Spitzen beim Gehen auswärts gerichtet waren, erzeugten einen hallenden Trommelschlag zwischen den Häusern mit den geschlossenen Fensterläden. Die schäbige Tasche, die seit dem frühen Morgen voll war, gab ihrer Trägerin eine leichte Schlagseite, und man sah, daß sie an Lasten gewöhnt war. Es ging aber auch etwas Fröhliches von ihr aus. Das graue Haar war zu einem Knoten gefaßt, doch eine widerspenstige Stirnlocke wippte über den Brauen im Rhythmus ihres Watschelschritts. Ein verwegener Humor sprach aus ihren Augen. Ihr Mund über dem Boxerkinn schien bereit, beim geringsten Anlaß zu lächeln.
Als sie an ihrer Bushaltestelle angekommen war, stellte sie die Tasche ab und massierte sich mit der rechten Hand den Rücken, eine Bewegung, die sie in letzter Zeit oft machte, obwohl sie ihr keine Erleichterung verschaffte. Der hohe Hocker in dem Lagerhaus, wo sie jeden Vormittag als Aufsicht arbeitete, hatte keine Lehne, und sie verspürte in zunehmendem Maß diese Unzulänglichkeit. »Du Teufel!« apostrophierte sie den schuldigen Teil. Nachdem sie ihn gerieben hatte, faltete sie die schwarzen Ellbogen nach hinten, wie eine alte Stadtkrähe, die sich zum Fliegen anschickt. »Du Teufel«, wiederholte sie. Plötzlich fühlte sie, daß sie beobachtet wurde. Sie schwenkte herum und lugte zu dem massigen Mann hoch, der wie ein Turm vor ihr aufragte. Er war außer ihr der einzige Mensch an der Haltestelle, ja sogar in der ganzen Straße. Sie hatte nie mit ihm gesprochen, und doch war sein Gesicht ihr vertraut: so groß, so weichlich, so verschwitzt. Sie hatte es gestern gesehen, sie hatte es vorgestern gesehen und, soweit sie sich erinnern konnte – Herrgott, sie war schließlich kein wandelndes Tagebuch! – auch vorvorgestern. Während der letzten drei oder vier Tage war dieser schwächliche und nervöse Riese, wenn er so auf einen Bus wartete oder vor dem Lagerhaus herumlungerte, für sie zu einer Figur der Straßenszenerie geworden; mehr noch, er gehörte einem ganz bestimmten Typus an, nur hatte sie ihn bis jetzt noch nicht einordnen können. Sie dachte, er sehe traqué – gehetzt – aus, wie so viele Pariser heutzutage. Sie sah so viel Angst in ihren Gesichtern, in der Art und Weise, wie sie grußlos aneinander vorbeigingen. Vielleicht war es überall so, wie sollte sie das wissen? Mehr als einmal hatte sie sein Interesse an ihr bemerkt. Sie hatte sich sogar gefragt, ob er womöglich Polizist sei; mit dem Gedanken gespielt, ihn zu fragen. Soviel Großstadt-Chuzpe besaß sie durchaus. Seine düstere Erscheinung verwies auf Polizei, ebenso wie sein verschwitzter Anzug und der nutzlose Regenmantel, der wie ein altes Uniformstück über seinem Arm hing. Sollte sie recht haben und er wirklich von der Polizei sein, dann – es war weiß Gott nicht mehr zu früh – unternahmen diese Idioten endlich etwas gegen die Flut von Diebereien, die seit Monaten ihre Inventurarbeiten zur Hölle machten.
Der Fremde hatte sie schon seit geraumer Zeit angestarrt und glotzte sie weiterhin unentwegt an.
»Ich bin von Rückenschmerzen geplagt, Monsieur«, vertraute sie ihm schließlich in ihrem langsamen und klassisch ausgesprochenen Französich an. »Der Rücken ist nicht groß, aber der Schmerz steht in keinem Verhältnis dazu. Sind Sie zufällig Arzt? Orthopäde?«
Dann fragte sie sich, wie sie so an ihm hochsah, ob er nicht selber krank sei, und sie einen schlechten Scherz gemacht habe. Sein Gesicht und Nacken glitzerten ölig, und um seine willensschwachen wäßrigen Augen lag ein Zug blinder Selbstbesessenheit. Er schien über sie hinweg auf einen eigenen Kummer zu blicken. Sie wollte ihn schon danach fragen – sind Sie vielleicht verliebt, Monsieur? – betrügt Ihre Frau Sie? – und zog bereits in Erwägung, ihn zu einem Glas Mineralwasser oder einer tisane in ein Bistrot zu lotsen – als er sich plötzlich von ihr abwandte und hinter sich blickte, dann über ihren Kopf hinweg in die andere Richtung die Straße hinunter. Und sie hatte den Eindruck, daß er verängstigt war; nicht nur traqué, sondern zu Tode erschrocken. Er war also vielleicht kein Polizist, sondern ein Dieb; obgleich der Unterschied, wie sie sehr wohl wußte, oft nur minimal war. »Sie heißen Maria Andrejewna Ostrakowa?« sagte er plötzlich in einem Ton, als ängstige ihn die Frage.
Er sprach französisch, aber sie wußte, daß er so wenig Franzose war, wie sie Französin, und die korrekte Aussprache ihres Namens mit dem Patronymikon verwies auf seine Herkunft. Sie erkannte sofort die verschliffene Redeweise und deren Ursache, die eigenartige Zungenbewegung, und sie identifizierte zu spät und mit beträchtlichem inneren Schauder den Typus, den sie nicht hatte bestimmen können.
»Wenn schon – wer um alles in der Welt sind Sie?« fragte sie zurück und reckte das Kinn drohend vor.
Er schob sich einen Schritt näher. Der Größenunterschied wurde plötzlich beklemmend. Desgleichen das Maß, in dem die Züge des Mannes seinen unerfreulichen Charakter verrieten. Aus ihrer Froschperspektive sah die Ostrakowa seine Schwäche ebenso deutlich, wie seine Furcht. Sein schweißbedecktes Kinn hatte sich grimassierend nach vorn geschoben, die Mundwinkel waren nach unten gezogen, um Härte vorzutäuschen, aber sie wußte, daß er nur eine unheilbare Feigheit bannen wollte. Er sieht aus wie jemand, der sich zu einer Heldentat aufrafft, dachte sie. Oder zu einer Missetat. Er ist ein Mensch, der keiner spontanen Handlung fähig ist, dachte sie.
»Sie wurden in Leningrad am 8.Mai 1927 geboren?« fragte der Fremde.
Wahrscheinlich hatte sie »ja« gesagt. Sie war sich später dessen nicht ganz sicher. Sie sah, wie er sich wiederum mit der Zunge über die Lippen fuhr. Sie sah, wie sich seine blassen furchterfüllten Augen hoben und auf den näherkommenden Bus starrten. Sie sah, wie eine geradezu panikartige Unentschlossenheit von ihm Besitz ergriff, und sie hatte den Eindruck – der sich später als eine fast hellseherische Ahnung heraustellen sollte – daß er erwog, sie unter die Räder zu stoßen. Er tat es nicht, aber er stieß die nächste Frage auf Russisch hervor – im brutalen Moskauer Amtston:
»1956 erhielten Sie die Erlaubnis, die Sowjetunion zu verlassen zwecks Pflege Ihres kranken Ehemannes, des Verräters Ostrakow? Und auch zu gewissen anderen Zwecken?«
»Ostrakow war kein Verräter«, unterbrach sie ihn. »Er war Patriot.« Instinktiv hob sie die Einkaufstasche auf und umklammerte den Henkel mit ganzer Kraft.
Der Fremde redete ungerührt über diesen Einspruch hinweg, und sehr laut, um das Rattern des Busses zu übertönen. »Ostrakowa, ich bringe Ihnen Grüße von Ihrer Tochter aus Moskau, ferner von gewissen offiziellen Stellen. Ich möchte mit Ihnen über Ihre Tochter sprechen. Steigen Sie nicht ein.«
Der Bus hatte angehalten. Der Fahrer kannte sie und streckte die Hand nach ihrer Tasche aus. Der Fremde fügte mit gesenkter Stimme noch eine schreckliche Bemerkung hinzu: »Alexandra hat ernsthafte Schwierigkeiten, die des Beistands einer Mutter bedürfen.«
Der Fahrer forderte sie zum Einsteigen auf. Er tat es in dem ruppigen Ton, den sie beide sonst scherzhaft gebrauchten. »Los, Mütterchen! Zu heiß für die Liebe. Geben Sie mir Ihre Tasche, und ab die Post!«
Drinnen ertönte Gelächter; dann schimpfte jemand – diese Alte hält den ganzen Betrieb auf! Sie spürte die Hand des Fremden, der unbeholfen nach ihrem Arm griff, wie ein linkischer Liebhaber, der nach den Knöpfen grapscht. Sie riß sich los. Sie versuchte, dem Fahrer etwas zu sagen, brachte aber nichts heraus: Sie öffnete den Mund, schien jedoch das Sprechen verlernt zu haben. Nur mit Mühe konnte sie ein Kopfschütteln zustande bringen. Der Fahrer rief ihr noch etwas zu, dann winkte er achselzuckend. Die Schimpfkanonade verstärkte sich – alte Vettel, mittags schon besoffen, wie eine Hure! Regungslos sah die Ostrakowa zu, wie der Bus abfuhr und verschwand; sie wartete, bis ihre Sicht wieder klarer wurde und ihr Herz zu galoppieren aufhörte. Jetzt brauche ich ein Glas Wasser, dachte sie. Gegen die Starken kann ich mich selbst schützen. Gott bewahre mich vor den Schwachen.
Sie folgte ihm schwer hinkend in ein Lokal. In einem Zwangsarbeitslager hatte sie sich vor genau fünfundzwanzig Jahren bei einem Kohlenschlipf im Bergwerk das Bein an drei Stellen gebrochen. Am heutigen vierten August – das Datum war ihr nicht entfallen – war unter dem grausamen Schlag, den die Mitteilung des Fremden ihr versetzt hatte, wieder das Gefühl des Verkrüppeltseins über sie gekommen.
Das Lokal war das letzte in der Straße, wenn nicht in ganz Paris, wo es weder Neonlicht noch Jukebox gab, dafür allerdings einige Spielautomaten, die von früh bis spät rumsten und blitzten. Im übrigen herrschte das gewohnte mittägliche Stimmengewirr; es ging um hohe Politik, Pferderennen oder was sonst die Pariser beschäftigt; da war auch das übliche Trio von Prostituierten, die leise miteinander sprachen, und ein stumpfsinniger junger Kellner in einem schmutzigen Hemd, der die neuen Gäste sofort zu einem Ecktisch führte, den ein schmuddeliges Campari-Aufstellschild als reserviert kennzeichnete. Es folgte ein Augenblick lächerlicher Banalität. Der Fremde bestellte zweimal Kaffee, doch der Kellner wandte ein, daß man zu Mittag nicht den besten Tisch des Hauses reservieren lasse, nur um Kaffee zu trinken: Der patron muß ja schließlich seine Miete bezahlen, Monsieur. Das Ganze in einem Patois, dem der Fremde nicht zu folgen vermochte, so daß die Ostrakowa übersetzen mußte. Der Fremde errötete und bestellte, ohne die Ostrakowa zu fragen, zweimal Schinkenomelett mit frites, sowie zwei Bier. Dann strebte er nach »Herren«, um sich aufzumöbeln – offenbar im Vertrauen darauf, daß sie ihm inzwischen nicht ausrücken werde –, und als er zurückkam, war sein Gesicht trocken und das rötliche Haar gekämmt, doch der Mief, der jetzt in dem geschlossenen Raum von ihm ausging, erinnerte die Ostrakowa an Moskauer U-Bahnen, an Moskauer Straßenbahnen und an Moskauer Verhörräume. Auf seinem kurzen Gang von der Herrentoilette zum Tisch hatte er ihr, beredter als mit allem, was er ihr je hätte sagen können, bestätigt, was sie bereits befürchtet hatte: Er war einer von »ihnen«. Der verborgene Dünkel, die bewußte Unmenschlichkeit des Ausdrucks, die gewichtige Art, wie er jetzt die Unterarme auf dem Tisch hochwinkelte und mit gespielter Unschlüssigkeit nach einem Stück Brot im Körbchen griff, als tauche er eine Feder ins Tintenfaß, das alles erweckte in der Ostrakowa die schlimmsten Erinnerungen an ihr Leben als »gefallene« Frau unter dem Druck einer übelwollenden Moskauer Bürokratie.
»So«, sagte er und nahm gleichzeitig ein Stück Brot. Er wählte ein knuspriges Endstück. Mit seinen Pranken hätte er es im Nu zerquetschen können, doch statt dessen zupfte er mit fetten Fingerspitzen damenhaft Flocken daraus, als sei dies die offizielle Eßart. Während er knabberte, rutschten seine Brauen in die Höhe, und seine Augen füllten sich mit Selbstmitleid, ich armer Mensch in diesem fremden Land. »Weiß man hierorts, daß Sie in Rußland ein unmoralisches Leben geführt haben?« fragte er schließlich. »Nun, vielleicht nehmen sie’s in einer Stadt voller Huren damit nicht so genau.«
Die Antwort lag ihr fix und fertig auf der Zunge: Mein Leben in Rußland war nicht unmoralisch. Unmoralisch war nur Ihr System.
Aber sie sagte es nicht, sondern verharrte in Schweigen. Die Ostrakowa hatte sich geschworen, ihr scharfes Temperament und ihre scharfe Zunge an die Kandare zu nehmen, und sie half nun körperlich der Einhaltung dieses Gelübdes nach, indem sie unter dem Tisch ein Stück Haut an der weichen Innenseite des Handgelenks ergriff und es durch den Ärmel hindurch mit aller Gewalt zusammenkniff, so, wie sie es damals Hunderte von Malen getan hatte, als derartige Verhöre für sie an der Tagesordnung waren. – Wann haben Sie zuletzt von Ihrem Mann, dem Verräter Ostrakow, gehört? Nennen Sie alle Personen, mit denen Sie in den letzten drei Monaten zusammengekommen sind! Zu ihrer bitteren Erfahrung hatte sie auch die übrigen Lektionen des Verhörs gelernt. Ein Teil ihrer selbst spielte sie in diesem Augenblick durch, und obgleich diese Lektionen, geschichtlich gesehen, bereits der vorhergehenden Generation angehörten, schienen sie ihr so zutreffend, wie gestern, und ebenso lebenswichtig: nie der Ruppigkeit mit Ruppigkeit begegnen; sich nie provozieren lassen, nie auftrumpfen, nie witzig oder überlegen oder geistreich sein; sich nie aus der Fassung bringen lassen aus Wut oder Verzweiflung oder durch das Aufwallen einer jähen Hoffnung, die eine bestimmte Frage erwecken könnte. Stumpfsinn mit Stumpfsinn erwidern und Routine mit Routine. Und nur tief, tief innen die beiden Geheimnisse verwahren, die alle diese Erniedrigungen erträglich machten: ihren Haß auf »sie« und die Hoffnung, eines Tages, nach endlos vielen Tropfen Wasser auf den Stein, durch Verschleiß und durch eine wunderbare Fehlschaltung des schwerfälligen Behördengetriebes, von »ihnen« die Freiheit zu erhalten, die sie ihr verweigerten.
Er hatte ein Notizbuch gezogen. In Moskau wäre es die Akte Ostrakowa gewesen, aber hier in einem Pariser Bistrot war es ein glattes, schwarzes, ledergebundenes Notizbuch, über dessen Besitz sich in Moskau sogar ein Funktionär glücklich gepriesen hätte.
Akte hin, Notizbuch her, die Vorrede war die gleiche: »Sie wurden als Maria Andrejewna Rogowa am 8.Mai 1927 in Leningrad geboren«, wiederholte er. »Am 1.September 1948 heirateten Sie, im Alter von 21Jahren, den Verräter Ostrakow, Igor, Infanteriehauptmann in der Roten Armee, Sohn einer estnischen Mutter. 1950 desertierte besagter Ostrakow, der damals in Ost-Berlin stationiert war, mit Unterstützung reaktionärer estnischer Emigranten verräterisch in die faschistische Bundesrepublik und ließ Sie in Moskau zurück. Er ging nach Paris, nahm später die französiche Staatsbürgerschaft an und unterhielt Kontakte zu antisowjetischen Elementen. Zum Zeitpunkt seiner Fahnenflucht hatten Sie kein Kind von diesem Mann. Auch waren Sie nicht schwanger. Richtig?«
»Richtig«, sagte sie.
In Moskau hätte sie gesagt: »Richtig, Genosse Hauptmann« oder: »Richtig, Genosse Kommissar«, aber in einem lärmenden französischen Bistrot war eine derartige Förmlichkeit unangebracht. Die Hautfalte an ihrem Handgelenk war taub geworden. Sie ließ los, wartete, bis die Stelle wieder durchblutet war, und kniff von neuem zu.
»Als Ostrakows Komplizin wurden Sie zu fünf Jahren Arbeitslager verurteilt, jedoch vorzeitig aufgrund der Amnestie nach Stalins Tod im März 1953 freigelassen. Richtig?«
»Richtig.«
»Nach Ihrer Rückkehr nach Moskau haben Sie trotz der Aussichtslosigkeit eines solchen Unterfangens einen Auslandspaß beantragt, um zu ihrem Mann nach Frankreich zu reisen. Richtig?«
»Er litt an Krebs« sagte sie. »Hätte ich keinen Antrag gestellt, so wäre ich meiner Pflicht als Ehefrau nicht nachgekommen.«
Der Kellner servierte die Omelettes mit frites und zwei Elsässer Biere, und die Ostrakowa bat, einen thé citron zu bringen: Sie war durstig, machte sich aber nichts aus Bier. Als sie sich an den garçon wandte, versuchte sie, mit Lächeln und Blicken eine Brücke zu ihm zu schlagen, prallte aber an seiner steinernen Gleichgültigkeit ab; sie bemerkte, daß sie außer den drei Prostituierten die einzige Frau im Lokal war. Der Fremde hielt das Notizbuch schräg vor sich, wie ein Missale, schaufelte eine Gabelvoll ein, dann noch eine, während die Ostrakowa den Griff auf das Handgelenk verstärkte. Alexandras Name pulsierte in ihrem Kopf wie eine offene Wunde, und sie erwog tausenderlei ernsthafte Schwierigkeiten, die des Beistands einer Mutter bedürften.
Der Fremde fuhr essend mit ihrer Lebensgeschichte fort. Aß er zum Vergnügen, oder aß er nur, um nicht wieder aufzufallen? Sie kam zu dem Schluß, daß er ein Gewohnheitsesser sei.
»Zwischenzeitlich«, verkündete er kauend.
»Zwischenzeitlich«, flüsterte sie unwillkürlich.
»Zwischenzeitlich«, gab er mit vollem Mund von sich, »gingen Sie, ungeachtet Ihrer angeblichen Sorge um Ihren Mann, den Verräter Ostrakow, ein ehebrecherisches Verhältnis mit dem sogenannten Musikstudenten Glikman, Joseph, ein, einem Juden mit vier Vorstrafen wegen antisozialen Verhaltens, den Sie während Ihrer Haft kennengelernt hatten. Sie lebten mit diesem Juden in dessen Wohnung zusammen. Richtig oder falsch?«
»Ich war einsam.«
»Als Folge dieses Konkubinats mit Glikman haben Sie im Entbindungsheim Oktoberrevolution in Moskau eine Tochter zur Welt gebracht, Alexandra. Die Elternschaftsurkunde wurde von Glikman, Joseph, und Ostrakowa, Maria, unterzeichnet. Das Mädchen wurde auf den Namen des Juden Glikman standesamtlich eingetragen. Richtig oder falsch?«
»Richtig.«
»Die ganze Zeit über haben Sie Ihr Gesuch um einen Auslandspaß aufrechterhalten. Warum?«
»Sagte ich Ihnen schon. Mein Mann war krank. Es war meine Pflicht, das Gesuch aufrechtzuerhalten.«
Er aß wieder, so gierig, daß er seine zahlreichen schlechten Zähne zur Schau stellte. »Im Januar 1956 wurde Ihnen auf dem Gnadenweg ein Paß ausgestellt, unter der Bedingung, daß Sie Ihre Tochter Alexandra in Moskau zurückließen. Sie haben die genehmigte Aufenthaltsfrist überschritten und sind in Frankreich geblieben, ohne Rücksicht auf Ihr Kind. Richtig oder falsch?«
Die Eingangstür und die Fassade waren aus Glas. Ein großer Laster parkte davor, und im Lokal wurde es plötzlich dunkel. Der junge Kellner knallte ihren Tee hin, ohne sie anzusehen.
»Richtig«, sagte sie wieder und brachte es fertig, den Fremden anzuschauen. Sie wußte sehr wohl, was nun kommen würde, und zwang sich, ihm zu zeigen, daß sie wenigstens in dieser Hinsicht keine Zweifel und kein Bedauern hegte. »Richtig«, wiederholte sie herausfordernd.
»Als Gegenleistung für eine wohlwollende Verbescheidung Ihres Antrags durch die Behörden hatten Sie sich den Organen des Staatssicherheitsdienstes gegenüber schriftlich verpflichtet, während Ihres Pariser Aufenthalts gewisse Aufgaben durchzuführen. Erstens, Ihren Mann, den Verräter Ostrakow, zu überreden, in die Sowjetunion zurückzukehren.«
»Versuchen, ihn zu überreden«, sagte sie mit einem schwachen Lächeln. »Er war dieser Anregung nicht zugänglich.«
»Zweitens, Sie haben sich ebenfalls verpflichtet, Informationen über Umtriebe und Mitglieder revanchistischer sowjetfeindlicher Emigrantengruppen zu sammeln. Sie haben zwei völlig wertlose Berichte geliefert, und dann nichts mehr. Warum?« »Mein Mann verachtete derartige Gruppen und hatte den Kontakt mit ihnen abgebrochen.«
»Sie hätten auch ohne ihn in diesen Gruppen verkehren können. Sie haben sich schriftlich verpflichtet und die Verpflichtung nicht eingehalten. Ja oder nein?«
»Ja.«
»Und dafür lassen Sie Ihr Kind in Rußland zurück? Bei einem Juden? Um sich einem Volksfeind und Landesverräter zu widmen? Dafür vernachlässigen Sie Ihre Pflicht? Überschreiten Sie die genehmigte Frist, bleiben Sie in Frankreich?«
»Mein Mann lag im Sterben. Er brauchte mich.«
»Und das Kind Alexandra? Es brauchte Sie nicht? Ist ein sterbender Mann wichtiger als ein lebendes Kind? Ein Verräter? Ein Verschwörer gegen das Volk?«
Die Ostrakowa ließ ihr Gelenk los, griff entschlossen nach dem Tee und verfolgte das Glas mit der obenauf schwimmenden Zitronenscheibe auf dem Weg zu ihrem Mund. Über das Glas hinweg sah sie einen schmierigen Mosaikboden, und jenseits davon das geliebte, grimmig-freundliche Gesicht Glikmans, das sich über sie neigte, sie aufforderte, zu unterzeichnen, wegzugehen, alles zu schwören, was »sie« verlangten. Die Freiheit für einen ist mehr als die Sklaverei für drei, hatte er geflüstert; ein Kind von Eltern wie wir hat keine Chance in Rußland, ob du nun bleibst oder gehst; geh, und wir werden versuchen, nachzukommen; unterschreibe alles, reise ab und lebe für uns alle; wenn du mich liebst, dann geh …
»Damals waren die Zeiten immer noch hart«, sagte sie schließlich zu dem Fremden, als beschwöre sie Erinnerungen herauf. »Sie sind zu jung. Die Zeiten waren hart, selbst nach Stalins Tod: immer noch hart.«
»Schreibt der kriminelle Glikman weiterhin an Sie?« fragte der Fremde in überlegenem und wissendem Ton.
»Er hat nie geschrieben«, log sie. »Wie könnte er schreiben, als Dissident unter Hausarrest? Die Entscheidung, in Frankreich zu bleiben, habe ich allein getroffen.«
Schwärz dich an, dachte sie; tu alles, um die zu schonen, die in »ihrer« Gewalt sind.
»Ich habe von Glikman nichts gehört, seit ich vor mehr als zwanzig Jahren nach Frankreich kam«, fügte sie, wieder Mut fassend, hinzu. »Auf indirektem Weg habe ich erfahren, daß er über mein antisowjetisches Verhalten erzürnt war. Er wollte nichts mehr mit mir zu tun haben. Im Grunde wollte er schon damals, als ich ihn verließ, wieder einschwenken.«
»Hat er nie wegen Ihres gemeinsamen Kindes geschrieben?« »Er hat weder geschrieben, noch Botschaften übermitteln lassen. Wie schon gesagt.«
»Wo ist Ihre Tochter jetzt?«
»Weiß ich nicht.«
»Haben Sie keine Nachricht von ihr bekommen?«
»Natürlich nicht. Ich habe nur gehört, sie sei in ein staatliches Waisenhaus gekommen und habe einen anderen Namen erhalten. Vermutlich weiß sie nichts von meiner Existenz.«
Der Fremde aß wieder mit einer Hand, während er in der anderen das Notizbuch hielt. Er schaufelte ein, mampfte ein bißchen und spülte dann das Essen mit dem Bier hinunter, ohne sein überlegenes Lächeln zu verlieren.
»Und jetzt ist auch der kriminelle Glikman tot«, gab der Fremde schließlich sein kleines Geheimnis preis. Wobei er weiteraß. Plötzlich wünschte sich die Ostrakowa, die zwanzig Jahre möchten zweihundert sein. Sie wünschte sich, Glikmans Gesicht hätte nie auf sie herabgesehen, sie hätte ihn nie geliebt, nie für ihn gesorgt, nie Tag um Tag für ihn gekocht oder sich mit ihm betrunken, in seinem Einzimmer-Exil, wo sie von der Mildtätigkeit ihrer Freunde lebten, ohne das Recht auf Arbeit, ohne das Recht auf irgendetwas außer Musik hören und einander lieben, sich betrinken, in den Wäldern umherschweifen und sich von den Nachbarn die kalte Schulter zeigen lassen.
»Wenn sie mich das nächste Mal einsperren – oder dich –, dann werden sie uns das Kind ohnehin wegnehmen. Alexandra ist für uns so und so verloren«, hatte Glikman gesagt. »Aber du kannst dich retten.«
»Ich werde mich entschließen, wenn ich dort bin«, hatte sie geantwortet.
»Entschließe dich jetzt.«
»Wenn ich dort bin.«
Der Fremde schob den leeren Teller beiseite und nahm das elegante französische Notizbuch wieder in beide Hände. Er blätterte um, als schlage er ein neues Kapitel auf.
»Was nun Ihre kriminelle Tochter Alexandra betrifft«, verkündete er mit noch immer vollem Mund.
»Kriminell?« flüsterte sie.
Zu ihrem Erstaunen rezitierte der Fremde eine neue Liste von Verbrechen. Die Ostrakowa glitt dabei endgültig aus der Gegenwart. Ihre Blicke lagen auf dem Mosaikboden, und sie bemerkte die Langustinenschalen und die Brotkrümel. Doch ihr Geist war wieder in dem Moskauer Gerichtssaal, wo ihr eigener Prozeß aufs neue ablief. Wenn nicht der ihre, dann der von Glikman – nein, auch der nicht. Wessen Prozeß also? Sie erinnerte sich an Prozesse, denen sie als unerwünschte Zuschauer beigewohnt hatten. Prozesse von Freunden, wenn auch nur von Zufallsfreunden: zum Beispiel Leuten, die das absolute Verfügungsrecht der Behörden infrage gestellt hatten; oder irgendeinen nicht genehmigten Gott verehrten; oder kriminell abstrakte Bilder malten; oder politisch gefährliche Liebesgedichte schrieben. Die plaudernden Gäste im Bistrot wurden zur gröhlenden claque der Sicherheitspolizei; das Knallen an den Spielautomaten zum Zuknallen von Eisentüren. Am soundsovielten wegen Ausbruchs aus dem staatlichen Waisenhaus an der Dingsstraße soundsoviele Monate Besserungsverwahrung. Am soundsovielten wegen Beleidigung von Organen des Staatssicherheitsdienstes soundsoviele Monate, verlängert wegen schlechter Führung; gefolgt von soundsovielen Jahren interner Verbannung. Die Ostrakowa spürte, wie sich ihr der Magen umdrehte, und sie glaubte, ihr werde übel. Sie legte die Hände um das Teeglas und sah die roten Kneifmale an den Gelenken. Der Fremde fuhr in seiner Aufzählung fort, und sie hörte, daß man ihrer Tochter zwei weitere Jahre verpaßt hatte, wegen Arbeitsverweigerung in der Soundso-Fabrik. Gott helfe ihr, was war ihr eingefallen? Woher hatte sie das? fragte die Ostrakowa sich ungläubig. Wie hatte Glikman es angestellt, dem Kind in der kurzen Zeit, ehe es ihm weggenommen wurde, seinen Stempel aufzudrücken und alle Bemühungen des Systems zunichte zu machen? Angst, Jubel, Verwunderung wirbelten in ihrem Geist wild durcheinander, bis eine Bemerkung des Fremden alles zum Stillstand brachte.
Ich habe nicht gehört«, flüsterte sie nach einer Ewigkeit. Ich bin ein bißchen durcheinander. Würden Sie freundlicherweise wiederholen, was Sie eben gesagt haben?«
Er sagte es nochmals, und sie starrte ihn an, versuchte, sich an alle Tricks zu erinnern, vor denen man sie gewarnt hatte, aber es waren zu viele, und ihr war alle Gerissenheit abhanden gekommen. Sie besaß nicht mehr Glikmans Gabe – falls sie sie jemals besessen hatte –, »ihre« Lügen zu entziffern und »ihnen« immer um ein paar Züge voraus zu sein. Sie wußte nur, daß sie, um sich zu retten und um wieder mit ihrem geliebten Ostrakow vereint zu sein, eine große Sünde begangen hatte, die größte, die eine Mutter begehen kann. Der Fremde hatte angefangen, ihr zu drohen, aber die Drohung schien ausnahmsweise belanglos. Bei Verweigerung der Zusammenarbeit – sagte er gerade – würde eine Kopie der von ihr unterschriebenen Verpflichtungserklärung gegenüber den Sowjetbehörden ihren Weg zur französischen Polizei finden. Kopien ihrer zwei wertlosen Berichte (verfaßt, wie er sehr wohl wußte, einzig zu dem Zweck, die Behörden zu beschwichtigen) würden unter den noch vorhandenen Pariser Emigranten – deren Häuflein weiß Gott heutzutage kaum noch zählte! – in Umlauf gebracht werden. Wieso eigentlich sollte sie sich einem Druck beugen müssen, um ein Geschenk von so unschätzbarem Wert anzunehmen – da doch aufgrund irgendeines unerklärlichen Gnadenakts dieser Mann, dieses System ihr die Chance boten, sich und ihr Kind freizukaufen? Sie wußte, daß ihre täglichen und nächtlichen Gebete um Vergebung erhört worden waren, die Tausende von Kerzen, die Tausende von Tränen. Sie ließ es ihn ein drittes Mal sagen. Sie ließ ihn das Notizbuch von seinem Gesicht wegnehmen und sah, daß sich sein weichlicher Mund zu einem halben Lächeln verzogen hatte und er sie idiotischerweise um Verzeihung zu bitten schien, noch während er diese aberwitzige gottgesandte Frage wiederholte:
»Angenommen, es wurde beschlossen, die Sowjetunion von diesem zersetzenden und asozialen Element zu befreien, was hielten Sie davon, wenn Ihre Tochter Alexandra Ihnen hierher nach Frankreich folgen würde?«
In den Wochen nach dieser Begegnung und bei all den Schritten, die sich daraus ergaben – verstohlene Besuche in der sowjetischen Botschaft, Ausfüllen von Formularen, Unterzeichnen von Eidesstattlichen Erklärungen, Einholen eines certificat d’hebergement, mühevolles Durchwandern immer neuer französischer Ministerien –, verfolgte die Ostrakowa ihre eigenen Unternehmungen, als handle es sich um jemand anderen. Sie betete oft, doch ging sie dabei wie zu einer Verschwörung ans Werk, verteilte die Gebete auf mehrere russisch-orthodoxe Kirchen, so daß man sie in keiner von ihnen bei einem ungebührlichen Pietätsaufwand beobachten konnte. Einige dieser Kirchen waren weiter nichts als kleine Privathäuser im 15. und 16. Arrondissement, mit Patriarchenkreuzen aus Sperrholz und mit alten, regengetränkten russischen Anschlägen an den Türen, auf denen billige Unterkunft gegen Klavierunterricht gesucht wurde. Sie ging in die Kirche der Auslandsrussen, in die Kirche zur Erscheinung der Heiligen Jungfrau, in die Kirche des Heiligen Seraphim von Sarow. Sie ging überall hin. Sie klingelte, bis jemand kam, ein Küster oder eine schmalgesichtige Frau in Schwarz; sie gab ihnen Geld und durfte sich dafür in der feuchten Kälte vor kerzenbeleuchtete Ikonen knien, den schweren Weihrauch einatmen, bis sie halb trunken war. Sie tat Gelübde an den Allmächtigen, sie dankte Ihm, bat Ihn um Rat, hätte Ihn um ein Haar gefragt, was Er wohl getan hätte, wenn ein Fremder unter ähnlichen Umständen an Ihn herangetreten wäre, erinnerte Ihn daran, daß so oder so Druck auf sie ausgeübt werde und sie verloren sei, wenn sie nicht gehorche. Zugleich aber meldete sich ihr unverwüstlicher Hausverstand, und sie fragte sich immer wieder, warum gerade sie, die Frau des Verräters Ostrakow, die Geliebte des Dissidenten Glikman, die Mutter einer – so wenigstens gab man ihr zu verstehen – turbulenten und asozialen Tochter, so untypischer Nachsicht teilhaftig werden sollte.
In der sowjetischen Botschaft wurde sie, als sie ihren ersten formellen Antrag stellte, so rücksichtsvoll behandelt, wie sie es sich nie hätte träumen lassen, mit einer Milde, die weder einer Überläuferin und abtrünnigen Spionin, noch der Mutter eines ungebärdigen Teufelsbratens zukam. Sie wurde nicht rauh in ein Wartezimmer verwiesen, sondern in ein Büro gebeten, wo ein junger und zuvorkommender Beamter sie mit westlicher Höflichkeit bedachte und ihr sogar, wenn Feder oder Mut sie im Stich ließen, bei der ordentlichen Formulierung ihres Falles behilflich war.
Und sie sprach mit niemanden darüber, nicht einmal mit ihren nächsten Verwandten – der nächste war ohnehin nicht besonders nah. Die Warnung des Rothaarigen klang ihr Tag und Nacht in den Ohren: Die geringste Indiskretion, und Ihre Tochter kommt nicht frei.
Und an wen, außer an Gott, konnte sie sich schließlich wenden? An ihre Halbschwester Valentina, die in Lyon lebte und mit einem Autohändler verheiratet war? Allein beim Gedanken, daß die Ostrakowa mit einem Beamten des Moskauer Geheimdienstes zusammengekommen war, würde Valentina nach ihren Riechsalzen greifen müssen. In einem bistrot, Maria? Am hellichten Tag, Maria? Ja, Valentina. Und was er gesagt hat, ist wahr. Ich habe eine uneheliche Tochter von einem Juden.
Am meisten setzte ihr die Ereignislosigkeit zu. Wochen vergingen; in der Botschaft hieß es, ihr Antrag werde in »wohlwollende Erwägung« gezogen; die französischen Behörden hätten versichert, daß Alexandra sich rasch um die französische Staatsbürgerschaft werde bewerben können. Der rothaarige Fremde hatte die Ostrakowa überredet, Alexandras Geburt rückzudatieren, so daß das Kind als eine Ostrakowa und nicht als eine Glikman gelten könne; er sagte, die französischen Behörden würden dies akzeptabler finden; und das traf anscheinend zu, obwohl sie damals bei ihren eigenen Einbürgerungsgesprächen nie die Existenz einer Tochter erwähnt hatte. Nun waren plötzlich keine Formulare mehr auszufüllen und keine Hürden mehr zu nehmen, und die Ostrakowa wartete, ohne zu wissen, worauf. Auf das Wiederauftauchen des rothaarigen Fremden? Es gab ihn nicht mehr. Im Konsum eines Schinkenomeletts mit frites, einiger Biere und zweier Stücke knusprigen Brots hatten sich seine existentiellen Bedürfnisse offenbar erschöpft. Sie konnte sich nicht vorstellen, in welcher Beziehung er zur Botschaft stand. Er hatte gesagt, sie solle sich dort einfinden, sie sei bereits angemeldet, was gestimmt hatte. Aber wenn sie auf »Ihren Mitarbeiter« anspielte oder deutlicher auf »Ihren großen blonden Mitarbeiter, der mich an Sie verwiesen hat«, begegnete sie nur lächelndem Unverständnis.
So hörte allmählich das, worauf sie wartete, zu existieren auf. Zuerst war es vor ihr gewesen, jetzt lag es hinter ihr, und sie hatte nicht gespürt, wann es vorbeiging, den Augenblick der Erfüllung. War Alexandra schon in Frankreich angekommen? Die Ostrakowa hielt dies langsam für möglich. Mit einem für sie neuen und untröstlichen Gefühl der Enttäuschung musterte sie die Gesichter der jungen Mädchen auf der Straße und fragte sich, wie Alexandra wohl aussehen möge. Wenn sie nach Hause kam, fiel ihr Blick automatisch auf den Dielenteppich, in der Hoffnung, eine handgeschriebene Nachricht oder einen pneumatique vorzufinden: »Mama, ich bin da. Ich wohne im Soundso-Hotel …« Ein Telegramm mit der Flugnummer: Eintreffe Orly morgen, heute abend; oder war es nicht Orly, sondern Roissy-Charles de Gaulle? Sie kannte sich in Fluglinien nicht aus, ging also in ein Reisebüro, nur um zu fragen. Beides war möglich. Sie erwog sogar, sich die Kosten für einen Telefonanschluß vom Herzen zu reißen, nur damit Alexandra sie anrufen könne. Aber was um alles in der Welt erwartete sie sich eigentlich nach all den Jahren? Tränenreiche Wiedervereinigung mit einem Kind, mit dem sie nie vereint gewesen war? Nostalgisches Wiederknüpfen eines Familienbandes, das sie vor mehr als zwanzig Jahren bewußt durchschnitten hatte? Ich habe kein Recht auf das Mädchen, verwies sie sich streng; ich habe nur Schulden und Pflichten. Sie fragte in der Botschaft nach, aber dort wußte man auch nicht mehr. Die Formalitäten seien erfüllt, hieß es. Mehr wüßten sie nicht. Und wenn sie, Ostrakowa, nun ihrer Tochter Geld schicken wollte? fragte sie listig– für den Flug zum Beispiel oder das Visum? – könne man ihr vielleicht eine Adresse geben, eine Stelle benennen, über die Alexandra zu erreichen sei?
Wir sind kein Postamt, lautete der Bescheid. Die plötzliche Frostigkeit erschreckte die Ostrakowa, sie ging nicht mehr hin. Darauf machte sie sich wieder Gedanken um die paar verwischten Fotos, die alle gleich waren, und die man ihr zum Anheften an die Formulare gegeben hatte. Diese Fotos waren alles, was sie je zu Gesicht gekriegt hatte. Sie wünschte, sie hätte Kopien davon machen lassen, doch das war ihr gar nicht in den Sinn gekommen. Törichterweise hatte sie angenommen, sie werde bald das Original kennenlernen. Sie hatte die Fotos nicht länger als eine Stunde in Händen gehabt! Sie war damit straks von der Botschaft zum Ministerium geeilt, und als sie von dort wegging, hatten die Fotos bereits ihren bürokratischen Dienstweg angetreten. Aber sie hatte die Bilder genau betrachtet! Mein Gott, und wie genau, jedes einzelne, obwohl sie wirklich alle gleich waren! In der Metro, in den Vorzimmern des Ministeriums, sogar unterwegs auf der Straße hatte sie auf dieses leblose Konterfei ihres Kindes gestarrt und mit aller Macht versucht, in den ausdruckslosen grauen Schatten irgendeinen Hinweis auf den geliebten Mann zu finden. Vergeblich. Bis jetzt hatte sie sich, wenn sie überhaupt daran zu denken wagte, vorgestellt, die Heranwachsende trüge Glikmans Züge, so klar, wie das neugeborene Kind sie getragen hatte. Es war doch ganz und gar unmöglich, daß ein so kraftvoller Mann wie Glikman in Alexandra nicht für immer weiterleben sollte. Doch die Ostrakowa sah nichts von Glikman auf diesem Foto. Er hatte sein Judentum wie eine Fahne getragen. Es war ein Teil seiner einsamen Revolution gewesen. Er war nicht orthodox, nicht einmal gläubig, und er mißbilligte ihre heimliche Frömmigkeit fast so sehr, wie er die Sowjetbürokratie verabscheute – und doch hatte er sie um ihre Brennschere gebeten und sich Schläfenlöckchen fabriziert, wie die Chassidim sie tragen, nur um dem Antisemitismus der Behörden eine Zielscheibe zu bieten, wie er sich ausdrückte. Doch in dem Gesicht auf dem Foto erkannte sie nicht einen Tropfen seines Blutes wieder, nicht den geringsten Funken seines Feuers – obwohl dieses Feuer, nach Aussage des Fremden, gewaltig in dem Mädchen loderte.
»Wenn sie eine Leiche fotografiert hätten, um zu diesem Bild zu kommen«, dachte die Ostrakowa laut in ihrer Wohnung, »dann würde mich das nicht wundern.« Und mit dieser unverblümten Feststellung gab sie ihrem wachsenden inneren Zweifel zum erstenmal äußeren Ausdruck.
Wenn sie im Lagerhaus schuftete, wenn sie an langen Abenden allein in ihrer winzigen Wohnung saß, zermarterte die Ostrakowa sich das Hirn darüber, wem sie sich anvertrauen könnte; einem Menschen, der weder verteufeln noch verhimmeln würde; der um die Ecken des Weges sehen könnte, den sie entlangging; und vor allem einem, der nicht sprechen und ihr damit– wie man ihr versichert hatte – alle Chancen verderben würde, Alexandra wiederzusehen. Plötzlich, eines Nachts, gab ihr entweder Gott oder ihr fieberhaft arbeitendes Gehirn die Antwort ein: der General! dachte sie, setzte sich im Bett auf und knipste das Licht an. Ostrakow selbst hatte ihr von ihm erzählt! Diese Emigrantengruppen sind eine Katastrophe, hatte er immer gesagt, und man muß sie meiden, wie die Pest. Der einzige, dem man trauen kann, ist Wladimir, der General; er ist ein alter Teufel und ein Weiberheld, aber er ist ein ganzer Mann, er hat Beziehungen, und er kann den Mund halten.
Aber Ostrakow hatte dies vor etlichen zwanzig Jahren gesagt, und selbst alte Generale sind nicht unsterblich. Und außerdem – Wladimir, wer? Sie kannte nicht einmal seinen Familiennamen. Sogar den Vornamen Wladimir – so Ostrakow – hatte er sich seinerzeit für den Militärdienst zugelegt; denn sein echter Name war estnisch und untauglich zur Verwendung in der Roten Armee. Trotzdem machte sie sich am nächsten Tag zu dem Buchladen an der Sankt Alexander Newsky-Kathedrale auf, wo man oft Informationen über die dahinschwindende russische Kolonie erhalten konnte, und stellte ihre ersten Nachforschungen an. Sie erfuhr einen Namen und sogar eine Telefonnummer, aber keine Adresse. Das Telefon war abgeschaltet. Sie ging zur Post und redete so lange auf die Beamten ein, bis sie ein Telefonbuch von 1956 hervorzauberten, in dem die »Bewegung für die baltische Freiheit« eingetragen war, dahinter eine Adresse in Montparnasse. Die Ostrakowa war nicht auf den Kopf gefallen. Sie schlug im Straßenverzeichnis nach und fand unter der Adresse vier weitere Organisationen: die Riga-Gruppe, die Vereinigung der Opfer des Sowjet-Imperialismus, das Achtundvierziger-Komitee für ein freies Lettland und das Reval-Komitee für Freiheit. Obwohl sie sich lebhaft an Ostrakows bissige Bemerkungen über derartige Vereine erinnerte – seinen Beitrag hatte er aber trotz allem immer brav bezahlt –, ging sie zur angegebenen Adresse und klingelte. Das Haus war wie eine ihrer kleinen Kirchen: bizarr und scheinbar unbewohnt. Schließlich öffnete ein alter Weißrusse die Tür. Er trug eine schief zugeknöpfte Strickjacke, lehnte auf einem Spazierstock und sah sie von oben herab an.
Alle fort, sagte er und deutete mit dem Stock die kopfsteingepflasterte Straße entlang. Ausgezogen. Weg. Verdrängt von größeren Organisationen, fügte er hinzu und lachte. Zu wenig Leute, zu viele Gruppen, und sie zankten sich wie Kinder. Kein Wunder, daß der Zar besiegt worden ist! Der alte Weißrusse hatte ein Gebiss, das nicht paßte, und das spärliche Haar war über den ganzen Schädel gezogen, um die Glatze zu verbergen.
Aber der General? fragte sie. Wo der General sei? Lebte er noch, oder war er –?
Der alte Russe feixte und fragte, ob es geschäftlich sei.
Privat, sagte die Ostrakowa geistesgegenwärtig, eingedenk des Rufs, den der General als Schwerenöter genossen hatte, und sie brachte sogar ein verschämtes Lächeln zustande. Der alte Russe lachte, daß seine Zähne klapperten. Er lachte nochmals und sagte: »Oh, der General!« Dann verschwand er und kam mit einer Londoner Adresse zurück, in Lila auf eine Karte gedruckt, die er ihr gab. Der General wird sich nie ändern, sagte er; noch im Himmel wird er hinter den Engeln her sein und versuchen, sie zu vernaschen, keine Frage. Und in dieser Nacht saß die Ostrakowa, während in der ganzen Nachbarschaft alles schlief, am Schreibtisch ihres toten Mannes und schrieb an den General mit dem Freimut, den wir gemeinhin Fremden vorbehalten, und nicht in Russisch, sondern in Französisch, um so größere Distanz zu sich selbst zu wahren. Sie erzählte ihm von ihrer Liebe zu Glikman und schöpfte Trost aus dem Wissen, daß der General die Frauen nicht weniger liebte, als Glikman dies getan hatte. Sie gab unumwunden zu, daß sie als Spionin nach Frankreich gekommen war, und sie erklärte, wie sie die beiden nichtssagenden Berichte zusammengeschustert hatte, die der schmutzige Preis für ihre Freiheit gewesen waren. Sie habe es à contre coeur getan, sagte sie, Phantasie und Phantasterei, sagte sie, ein Nichts. Aber die Berichte existierten, ebenso wie ihre schriftliche Verpflichtung, und sie zogen ihrer Freiheit enge Grenzen. Dann sprach sie ihm von ihrer Seele und von den Gebeten zu Gott in all den russischen Kirchen. Seit der rothaarige Fremde sie angesprochen habe, sei ihre Existenz unwirklich geworden; sie habe das Gefühl, man verweigere ihr eine natürliche Erklärung ihres Lebens, und wenn es eine schmerzliche Erklärung wäre. Sie hielt mit nichts vor ihm zurück, denn ihre Schuldgefühle, so sie welche empfand, hatten nichts mit ihren Bemühungen, Alexandra in den Westen zu bringen, zu tun, sondern vielmehr mit ihrem Entschluß, in Paris zu bleiben und ihren Mann bis zu seinem Tod zu pflegen, wonach, sagte sie, die Sowjets sie ohnehin nicht mehr hätten zurückkommen lassen, da sie ja ebenfalls abtrünnig geworden war.
»Aber, General«, schrieb sie, »müßte ich heute nacht vor meinen Schöpfer persönlich treten und ihm sagen, was in den Tiefen meines Herzens verborgen ist, ich würde ihm sagen, was ich nun Ihnen sage. Ich habe meine Alexandra unter Schmerzen geboren. Tag und Nacht kämpfte sie gegen mich, und ich kämpfte zurück. Schon im Mutterleib war sie das Kind ihres Vaters. Mir blieb keine Zeit, sie lieb zu gewinnen; ich kannte sie nur als den kleinen jüdischen Streiter, den ihr Vater mir gemacht hat. Aber, General, eines weiß ich mit Sicherheit: Das Mädchen auf dem Foto ist weder Glikmans Tochter noch die meine. Man will mir ein Kuckucksei ins Nest legen, und wenn ich alte Frau mich auch nur allzugern täuschen ließe, ich durchschaue den Betrug, und mein Haß auf die Betrüger ist stärker als alles andere.«
Als sie den Brief beendet hatte, steckte sie ihn sofort in den Umschlag, damit sie ihn nicht mehr lesen und anderen Sinnes werden könne. Dann klebte sie absichtlich zu viele Briefmarken darauf, als opfere sie eine Kerze für einen geliebten Menschen.
Während der nächsten zwei Wochen nach Absendung des Schreibens ereignete sich nichts, und sie war über dieses Schweigen merkwürdig erleichtert, auf eine Art, wie dies nur Frauen möglich ist. Dem Sturm war die Ruhe gefolgt, sie hatte das Wenige getan, was sie tun konnte – hatte ihre Schwäche und ihren Verrat gestanden und ihre einzige große Sünde –, der Rest war in Gottes und des Generals Hand. Ein Streik der französischen Post erschütterte sie nicht. Sie sah darin eher ein weiteres Hindernis, das die Mächte, die ihr Schicksal gestalteten, zu überwinden hätten, wenn ihr Wille dazu stark genug war. Sie ging zufrieden zur Arbeit, und ihr Rücken hörte auf, ihr Beschwerden zu machen, was sie als Omen ansah. Sie nahm die Dinge sogar wieder philosophisch. Es ist so oder so, sagte sie sich; entweder Alexandra war im Westen und besser daran – wenn es sich tatsächlich um Alexandra handelte –, oder Alexandra war, wo sie immer gewesen war, und nicht schlechter daran. Doch allmählich meldete sich ein anderer Teil ihrer selbst, der den falschen Optimismus durchschaute. Es gab eine dritte Möglichkeit, und das war die schlimmste und ihrer Ansicht nach die bei weitem wahrscheinlichste: nämlich, daß Alexandra zu einem dunklen und vielleicht üblen Zweck eingespannt wurde; daß »sie« ihr Zwang antaten, wie »sie« ihr selber Zwang angetan hatten, die Menschlichkeit und den guten Willen mißbrauchten, die Glikman seiner Tochter mitgegeben hatte. In der vierzehnten Nacht erlitt die Ostrakowa einen heftigen Weinkrampf, mit tränenüberströmtem Gesicht wanderte sie quer durch Paris auf der Suche nach einer Kirche, irgendeiner, sofern sie nur offen war, bis sie zur Alexander Newsky Kathedrale kam. Sie war offen. Kniend betete sie lange Stunden zum heiligen Josef, der ja schließlich auch ein Vater und Beschützer war und zudem Glikmans Namenspatron, wenn Glikman sich auch über diese Verbindung mokiert hätte. Und am Tag nach dieser erschöpfenden Andachtsübung ward ihr Gebet erhört. Ein Brief kam. Er trug weder Marke noch Stempel. Sie hatte vorsichtshalber auch die Anschrift ihrer Arbeitsstätte angegeben, und der Brief erwartete sie dort, wahrscheinlich irgendwann in der Nacht durch Boten überbracht. Es war ein sehr kurzer Brief, der weder Namen noch Adresse des Absenders aufwies. Die Unterschrift fehlte. Wie ihr eigener war er in gestelztem Französisch abgefaßt, in dem kühnen, fast napoleonischen Gekleckse einer alten und diktatorischen Hand, in der sie sofort die des Generals erkannte.
Madame! – fing er an, und es klang ihr wie ein Tagesbefehl –Ihr Brief hat den Schreiber sicher erreicht. Ein Freund unserer gemeinsamen Sache wird Sie demnächst aufsuchen. Er ist ein Ehrenmann und wird sich durch Übergabe der anderen Hälfte beiliegender Ansichtskarte ausweisen. Ich ersuche Sie dringend, bis dahin mit niemandem über diese Angelegenheit zu sprechen. Der Betreffende wird zwischen acht und zehn Uhr abends zu Ihrer Wohnung kommen und dreimal klingeln. Er besitzt mein absolutes Vertrauen. Vertrauen auch Sie ihm völlig, Madame, und wir werden alles tun, um Ihnen zu helfen.
Selbst in ihrer Erleichterung amüsierte sie sich insgeheim über den melodramatischen Ton des Schreibers. Warum hatte man den Brief nicht direkt in ihre Wohnung gebracht, fragte sie sich; und warum sollte ich mich sicherer fühlen, weil er mir die Hälfte einer Londoner Ansicht gibt? Das Stück Postkarte stellte nämlich einen Teil von Picadilly Circus dar und war absichtlich brutal schräg abgerissen, nicht abgeschnitten worden. Der Raum für schriftliche Mitteilungen war leer.
Zu ihrem Erstaunen kam der Abgesandte des Generals noch am gleichen Abend.
Er klingelte dreimal, wie brieflich angekündigt, mußte aber gewußt haben, daß sie zuhause war – mußte gesehen haben, wie sie heimkam und Licht machte –, denn sie hörte nur den Deckel am Briefschlitz klappern, lauter als sonst, und als sie zur Tür ging, sah sie das abgerissene Stück Ansichtskarte am Boden liegen, an derselben Stelle, die sie so oft mit den Augen abgesucht hatte, während sie sich nach einer Botschaft von ihrer Tochter Alexandra sehnte. Sie hob es auf und lief ins Schlafzimmer zu ihrer Bibel, wo ihre eigene Hälfte bereitlag, und tatsächlich, die Teile paßten zusammen, Gott war auf ihrer Seite, der heilige Josef hatte sich für sie verwendet. (Aber trotzdem, was für ein nutzloser Unsinn, das Ganze!) Und als sie ihrem Besucher die Tür öffnete, glitt er an ihr vorbei wie ein Schatten: ein Wichtelmännchen in einem schwarzen Mantel mit Samtaufschlägen am Kragen, der ihm das Aussehen eines Operettenverschwörers verlieh. Sie haben mir einen Zwerg geschickt, um einen Riesen zu fangen, war ihr erster Gedanke. Er hatte geschwungene Brauen und ein zerfurchtes Gesicht, und über seinen spitzen Ohren standen hochgekringelte schwarze Haarbüschel, die er mit seinen kleinen Handflächen vor dem Dielenspiegel glatt strich, als er den Hut abnahm – so munter und komisch, daß die Ostrakowa bei anderer Gelegenheit laut aufgelacht hätte über all das Leben, den Humor und die Ungeniertheit, die er ausstrahlte.
Doch nicht heute abend.
Heute abend trug er einen Ernst zur Schau, der, wie sie sofort spürte, nicht seiner Natur entsprach. Heute abend machte er ganz auf eiligen Geschäftsmann, der gerade seinem Flugzeug entstiegen war – sie hatte auch den Eindruck, er sei nur zu einer Stippvisite in der Stadt: so adrett, so leichtes Gepäck, heute abend wollte er nur zur Sache kommen.
»Haben Sie meinen Brief sicher erhalten, Madame?« Er sprach russisch, schnell, mit estnischem Akzent.
»Ich dachte, es sei der Brief des Generals gewesen«, erwiderte sie, wobei sie unwillkürlich eine gewisse Strenge in ihren Tonfall legte.
»Ich habe den Brief für ihn überbracht«, sagte er ernst. Er grub in einer Innentasche herum, und sie hatte das entsetzliche Gefühl, er werde, wie der große Russe, ein glattes schwarzes Notizbuch zücken. Statt dessen brachte er jedoch ein Foto zum Vorschein, und ein Blick darauf genügte: die bleichen verschwitzten Züge, der Ausdruck der Verachtung für alles Weibliche, nicht nur für sie, die Mischung aus Gelüst und Feigheit.
»Ja«, sagte sie. »Das ist der Fremde.«
Als sie sah, wie er aufatmete, wußte sie sogleich, daß er zu den Leuten gehörte, von denen Glikman und seine Freunde als »einer von uns« sprachen – nicht unbedingt ein Jude, aber ein ganzer Kerl. Von diesem Augenblick an nannte sie ihn im Stillen den »Magier«. In ihrer Vorstellung waren seine Taschen voll verblüffender Tricks, und in seinen fröhlichen Augen tanzten Zauberlichter.
Die halbe Nacht redete die Ostrakowa mit dem Magier, so hingegeben, wie sie es nur zu Glikmans Zeiten getan hatte. Zuerst erzählte sie alles wieder von vorne, erlebte es nochmals in allen Einzelheiten und entdeckte zu ihrer Überraschung, wie lückenhaft ihr Brief war, den der Magier auswendig zu kennen schien. Sie erklärte ihm ihre Gefühle und ihre Tränen; ihren schrecklichen inneren Aufruhr; sie beschrieb die Tölpelhaftigkeit ihres schwitzenden Peinigers. Er war so unfähig – sagte sie immer wieder verwundert – als wäre es sein erstes Mal gewesen, sagte sie – keinen Schliff, kein Selbstvertrauen. Komisch, sich den Teufel als Stümper vorzustellen! Sie erzählte von dem Schinkenomlett mit frites und dem Bier, und er lachte; von ihrem Eindruck, daß dieser Mann gefährlich schüchtern und verklemmt sei – kein Frauenfreund. Meist stimmte der kleine Magier ihr herzlich zu, als seien er und der Rothaarige alte Bekannte. Sie vertraute dem Magier völlig, wie der General es ihr nahegelegt hatte; sie war des ewigen Argwohns müde. Sie redete, dachte sie später, so rückhaltlos wie damals mit Ostrakow in ihrer Heimatstadt, als die beiden ein junges Liebespaar gewesen waren, während der Nächte, da sie glaubten, es wäre jeweils die letzte in ihrem Leben, aneinandergeklammert, unter dem näherrückenden Kanonendonner der Belagerer; oder mit Glikman, während sie darauf warteten, daß »sie« an die Tür hämmern und ihn wieder ins Gefängnis zurückbringen würden. Sie sprach zu seinem alerten und verstehenden Blick, zu dem Lachen in ihm, zu der Toleranz, die, wie sie sofort spürte, der bessere Teil seiner unorthodoxen und vielleicht antisozialen Natur war. Und je länger sie sprach, um so mehr sagte ihr der weibliche Instinkt, daß sie in ihm eine Leidenschaft schürte – keine Liebe in diesem Fall, sondern einen scharfen und präzisen Haß, der auch der kleinsten Frage, die er stellte, Durchschlagskraft und Treffsicherheit verlieh. Was und wen er genau haßte, konnte sie nicht sagen, aber sie fürchtete für jeden, sei es nun der rothaarige Fremde oder sonstwer, der das Feuer dieses kleinen Magiers auf sich gezogen hatte. Glikmans Leidenschaft, so erinnerte sie sich, war eine allgemeine, eine diffuse Leidenschaft gewesen, die sich fast zufällig auf eine Reihe von Symptomen konzentrierte, kleine oder große. Die des Magiers aber war einstrahlig, gezielt auf einen Punkt gerichtet, den sie nicht sehen konnte.
Als der Magier sie schließlich verließ – mein Gott, dachte sie, es ist ja beinah Zeit, zur Arbeit zu gehen! – hatte die Ostrakowa ihm jedenfalls alles gesagt, was sie zu sagen hatte, und der Magier hatte seinerseits in ihr Gefühle geweckt, die seit Jahren, bis zu dieser Nacht, ausschließlich der Vergangenheit angehört hatten. Während sie benommen die Teller und Flaschen wegräumte, brachte sie es, trotz der Komplexität ihrer Gefühle für Alexandra, für sich selbst und für ihre beiden toten Männer fertig, über ihre weibliche Torheit zu lachen.
»Und dabei kenne ich nicht einmal seinen Namen!« sagte sie laut und schüttelte spöttisch den Kopf. »Wie kann ich Sie erreichen?« hatte sie gefragt. »Wie kann ich Sie benachrichtigen, wenn er wieder auftaucht?«
Gar nicht, hatte der Magier geantwortet. Aber sollte die Sache sich zuspitzen, dann könne sie wieder an den General schreiben, unter seinem englischen Namen und einer anderen Adresse. »Mr.Miller«, sagte er ernst, mit Betonung auf der zweiten Silbe, und gab ihr eine Karte, auf der eine Londoner Adresse in Großbuchstaben von Hand gedruckt war. »Aber seien Sie diskret«, mahnte er. »Sie müssen sich indirekt ausdrücken.«
An diesem ganzen Tag und noch viele weitere Tage hindurch bewahrte die Ostrakowa zuvorderst in ihrem Gedächtnis das letzte, schwindende Bild des Magiers, wie er von ihr fort und das schlecht beleuchtete Treppenhaus hinabglitt. Seinen letzten flammenden Blick, voll angespannter Entschlossenheit und Erregung: »Mein Wort, ich pauke Sie heraus. Und Dank, daß Sie mich zu den Waffen riefen.« Seine kleine weiße Hand, die auf dem breiten Treppengeländer hinunterflatterte, Runde um Runde, in einer sich verengenden Spirale von Abschiedsgrüßen, wie ein Taschentuch aus einem Eisenbahnfenster winkt, bis es in der Dunkelheit des Tunnels verschwindet.
2
Das zweite der beiden Ereignisse, die George Smiley aus seinem Ruhestand holten, fand ein paar Wochen später im Frühherbst desselben Jahres statt: nicht in Paris, sondern in Hamburg, einstmals Freie und Hansestadt, jetzt fast erdrückt unter der Last seines Wohlstands; und doch verglüht der Sommer nirgends so glanzvoll, wie an den gold-orangenen Ufern der Alster, die bis jetzt noch niemand trockengelegt oder zubetoniert hat. George Smiley bekam natürlich nichts von dieser melancholischen Herbstpracht zu sehen. Er schuftete an dem fraglichen Tag selbstvergessen und mit all der Überzeugung, die er aufbringen konnte, an seinem gewohnten Tisch in der London Library am St.James’s Square vor sich hin, und alles, was er durch das Schiebefenster des Lesesaals sehen konnte, waren zwei spindlige Bäume. Die einzige Beziehung zu Hamburg, die er hätte anführen können – wäre ihm später eingefallen, einen Zusammenhang herzustellen, was jedoch nicht der Fall war –, lag auf dem parnassischen Feld deutscher Barocklyrik, denn er schrieb damals an einer Monographie über den Barden Opitz, redlich bemüht, zwischen echter Leidenschaft und öder literarischer Konvention der Zeit zu unterscheiden.
In Hamburg war es kurz nach elf Uhr morgens, und der Fußweg, der zum Landungssteg führte, war mit Sonnenlicht und abgefallenem Laub gesprenkelt. Über dem platten Wasser der Außenalster lag ein glühender Dunst, durch den die Turmhelme am Ostufer wie grüne Flecke auf den nassen Horizont hingetupft schienen. Rote Eichhörnchen schusselten am Strand entlang und sammelten Vorräte für den Winter. Der schlaksige und leicht anarchistisch wirkende junge Mann auf dem Steg, der einen Trainingsanzug und Laufschuhe trug und dessen hohlwangiges Gesicht zwei Tage alte Bartstoppeln aufwies, hatte indessen weder Augen noch Interesse für sie. Sein rotgeränderter Blick war starr auf das ankommende Schiff geheftet. Unter den linken Arm hatte er eine Hamburger Zeitung geklemmt, und ein so geschultes Auge wie das von George Smiley hätte sofort bemerkt, daß es die Ausgabe von gestern war, nicht die von heute. In der rechten Hand hielt er krampfhaft einen Strohkorb, der besser zur stämmigen Madame Ostrakowa gepaßt hätte, als zu diesem elastischen und schmuddeligen Sportler, der aussah, als wolle er jeden Moment ins Wasser springen. Aus dem Korb lugten Orangen, auf denen ein gelber Kodak-Umschlag mit englischem Aufdruck lag. Außer dem jungen Mann war niemand auf dem Landungssteg, und der Dunst über dem Wasser verstärkte sein Gefühl der Einsamkeit. Seine einzigen Gefährten waren der Fahrplan der Alsterschiffahrt und ein uralter Anschlag, der den Krieg überstanden haben mußte und Hinweise zur Wiederbelebung von Halbertrunkenen gab; alle Gedanken des Wartenden konzentrierten sich auf die Instruktionen des Generals, die er sich immer wieder vorsagte, wie ein Gebet.
Das Schiff legte an, und der junge Mann hopste an Bord wie ein Kind in einem Tanzspiel – ein Wirbel von Schritten, dann bewegungslos, bis die Musik wieder einsetzt. Achtundvierzig Stunden lang hatte er Tag und Nacht an nichts anderes zu denken gehabt, als an diesen Augenblick: jetzt. Hinter dem Steuer seines Lasters hatte er wachsam auf die Straße gestarrt und sich zwischen kurzen Blicken auf die Photos von Frau und Töchterchen hinter dem Rückspiegel die vielen Dinge vorgestellt, die katastrophal schiefgehen konnten. Er wußte, daß er eine Begabung für Katastrophen hatte. Während der seltenen Kaffeepausen hatte er die Orangen ein Dutzendmal aus- und wieder eingepackt, den gelben Umschlag längs daraufgelegt, quer – nein, dieser Winkel ist besser, günstiger, man kann dann leichter herankommen. Am Stadtrand hatte er sich Münzen besorgt, um das Fahrgeld abgezählt bereit zu haben – wenn der Schaffner ihn nun aufhielte, in ein müssiges Gespräch verwickelte? Die Zeit war so knapp bemessen für das, was er tun mußte! Er hatte sich überlegt, daß er nicht deutsch sprechen würde. Er würde irgendetwas brabbeln, lächeln, wortkarg sein, abbittende Gesten vollführen, aber stumm bleiben. Oder er würde einige seiner estnischen Wörter von sich geben – einen Bibelvers, der ihm noch von seiner protestantischen Kindheit im Gedächtnis geblieben war, ehe sein Vater darauf bestand, daß er russisch lerne. Aber jetzt, wo der Augenblick so nah war, bemerkte der junge Mann, daß sein Plan einen Haken hatte. Wenn nun die Mitreisenden ihm zu Hilfe kamen? Im polyglotten Hamburg, nur wenige Kilometer vom Osten entfernt, konnten sechs x-beliebige Leute mit ebenso vielen Sprachen aufwarten! Besser den Mund halten, keine Miene verziehen.
Wenn er sich bloß rasiert hätte! Wenn er bloß weniger auffällig aussähe!
In der Hauptkabine des Schiffes sah der junge Mann niemanden an. Er hielt die Augen gesenkt; Augenkontakt vermeiden, hatte der General befohlen. Der Schaffner plauderte mit einer alten Dame und nahm keine Notiz von ihm. Er wartete nervös, versuchte, ruhig auszusehen. Er hatte den Eindruck von unterschiedslos mit grünen Filzhüten und grünen Mänteln angetanen Frauen und Männern, die ihn einhellig mißbilligten. Jetzt war er an der Reihe. Er hielt seine feuchte Handfläche hin. Eine Mark, ein Fünfzigpfennigstück, ein paar Zehnpfennigmünzen. Der Schaffner bediente sich wortlos. Linkisch tappte der junge Mann zwischen den Sitzen zum Heck. Der Landungssteg bewegte sich weg. Sie halten mich für einen Terroristen, dachte der junge Mann. Seine Hände waren mit Motoröl beschmiert, und er wünschte, er hätte es abgewischt. Vielleicht ist auch welches auf meinem Gesicht. Keine Miene verziehen, hatte der General gesagt. Abseits halten. Nicht lächeln, nicht finster dreinschauen. Normal verhalten. Er sah auf die Uhr, mit einer bemüht langsamen Bewegung. Er hatte schon vorher den linken Ärmelbund hochgerollt, um die Uhr freizumachen. Obwohl er nicht groß war, duckte er sich zusammen, als er plötzlich im Heckteil ankam, das im Freien lag und nur mit einem Sonnendach überdeckt war. Es war eine Sache von Sekunden. Nicht mehr von Tagen oder Kilometern; nicht mehr von Stunden. Sekunden. Der Stoppzeiger seiner Uhr rückte über die Sechs. Wenn er das nächste Mal die Sechs erreicht, dann los. Eine Brise hatte sich erhoben, doch er spürte sie kaum. Die Zeit war ein gräßliches Problem für ihn. Er wußte, wenn er aufgeregt war, verlor er jeden Zeitsinn. Er befürchtete, der Sekundenzeiger könne, eh er es merkte, eine Doppelrunde drehen und so zwei Minuten zu einer raffen. Im Heckteil waren alle Sitze frei. Er steuerte ruckweise auf die allerletzte Bank zu, wobei er den Korb mit den Orangen in beiden Händen vor seinem Magen und die Zeitung in die Achselhöhle geklemmt hielt: Ich bin’s, entziffert meine Signale. Er kam sich idiotisch vor. Die Orangen waren viel zu auffällig. Warum um alles in der Welt sollte ein unrasierter junger Mann im Trainingsanzug einen Korb voll Orangen und die gestrige Zeitung herumtragen? Das ganze Schiff mußte aufmerksam geworden sein! »Herr Kapitän – dieser junge Mensch – dort drüben –, das ist ein Bombenleger. Er hat eine Bombe in seinem Korb, er will uns entführen oder das Schiff versenken!« Ein Paar stand Arm in Arm mit dem Rücken zu ihm an der Reling und starrte in den Dunst. Der Mann war winzig, kleiner als die Frau. Er trug einen schwarzen Mantel mit Samtkragen. Sie beachteten ihn nicht. So weit nach hinten setzen, wie es irgend geht; direkt an den Mittelgang, hatte der General gesagt. Er setzte sich und betete zu Gott, daß es beim erstenmal klappen möge und keine der Ausweichlösungen nötig sein würde. »Beckie, ich tu es für dich«, flüsterte er im stillen und dachte an seine Tochter, während er sich die Worte des Generals ins Gedächtnis zurückrief. Trotz seiner protestantischen Herkunft trug er unter dem Reißverschluß seiner Jacke ein Holzkreuz, ein Geschenk seiner Mutter. Warum hielt er es versteckt? Damit Gott nicht Zeuge seines Wortbruchs werde? Er wußte es nicht. Er wollte nur wieder fahren, nichts als fahren, bis er umfiele oder sicher zu Hause wäre. Nirgends hinsehen, hatte der General gesagt. Er solle nirgends anders als gerade vor sich hinsehen: Du bist der passive Partner. Du hast weiter nichts zu tun, als die Gelegenheit zu liefern. Keine Parole, nichts; nur den Korb mit den Orangen und den gelben Umschlag und die Zeitung unterm