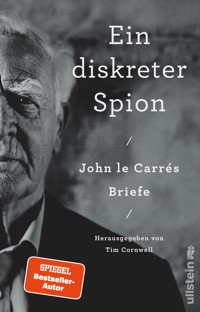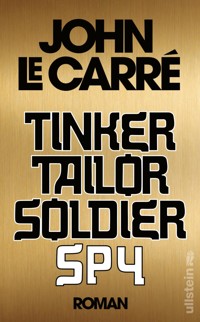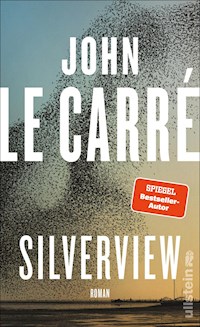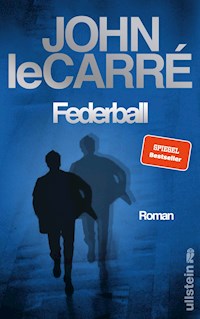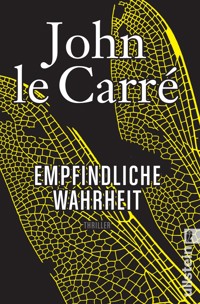9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Das geniale Finale der Welterfolge "Der Spion, der aus der Kälte kam" und "Dame, König, As, Spion" 1961: An der Berliner Mauer sterben zwei Menschen, Alec Leamas, britischer Top-Spion, und seine Freundin Liz Gold. 2017: George Smileys ehemaliger Assistent Peter Guillam wird ins Innenministerium einbestellt. Die Kinder der Spione Alec Leamas und Elizabeth Gold drohen, die Regierung zu verklagen. Die Untersuchung wirft neue Fragen auf: Warum mussten die Agenten an der Berliner Mauer sterben? Hat der britische Geheimdienst sie zu leichtfertig geopfert? Halten die Motive von damals heute noch stand? In einem dichten und spannungsgeladenen Verhör rekonstruiert Peter Guillam, was kurz nach dem Mauerbau in Berlin passierte. Bis George Smiley die Szene betritt und das Geschehen in einem neuen Licht erscheint. Der Spion, der aus der Kälte kam ... ist zurück - Der ultimative Roman über die dunklen Seiten der Geheimdienste Große TV-Doku "Der Taubentunnel" an 20. Oktober 2023 auf Apple TV+
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
Das Buch
Der Spion, der aus der Kälte kam …
ist zurück – der ultimative Roman über die dunklen Seiten der Geheimdienste »Vielleicht der bedeutendste britische Schriftsteller der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er hat den langsamen Verfall unserer Welt und die Beschaffenheit unserer Demokratien wie kein anderer beschrieben.
Ein erstklassiger Autor!« IAN McEWAN
»John le Carrés Romane überzeugen wie die von Balzac, sie klagen an wie die von Zola, aber sie predigen nicht. Sie addieren sich zu einem einzigen großen humanistischen Plädoyer.« DER SPIEGEL
»John le Carré kann die ganze Bandbreite menschlicher Regungen, von panischer Angst bis verzweifelter Liebe. Vor allem aber kann er Geschichten erzählen.«SUNDAY TIMES
Die Autoren
JOHN LE CARRÉ, 1931 geboren, studierte in Bern und Oxford. Er war Lehrer in Eton und arbeitete während des Kalten Kriegs kurze Zeit für den britischen Geheimdienst. Seit nunmehr fünfzig Jahren ist das Schreiben sein Beruf. Er lebt in London und Cornwall.
PETER TORBERG, geboren 1958 in Dortmund, studierte in Münster und in Milwaukee, Wisconsin. Zu den von ihm übersetzten Autoren gehören u.a. Paul Auster, William Golding, David Peace, Daniel Woodrell und Oscar Wilde.
JOHN LE CARRÉ
Das Vermächtnis der Spione
ROMAN
Aus dem Englischen von Peter Torberg
ULLSTEIN
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN: 978-3-8437-1701-4
Die Originalausgabe erschien 2017
unter dem Titel A Legacy of Spies bei Viking,
einem Imprint von Penguin Random House UK, London
© 2017 by David Cornwell
© der deutschsprachigen Ausgabe
2017 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
1.
Folgendes ist eine nach bestem Wissen und Gewissen verfasste, wahrheitsgetreue Darstellung meiner Rolle in der britischen Operation mit dem Codenamen WINDFALL, die Ende der fünfziger, Anfang der sechziger Jahre gegen das ostdeutsche Ministerium für Staatssicherheit (STASI) geführt wurde und mit dem Tod des besten britischen Geheimagenten und der unschuldigen Frau endete, für die er sein Leben ließ.
Ein Geheimagent ist menschlichen Empfindungen gegenüber ebenso empfänglich wie der Rest der Menschheit. Doch für ihn zählt, wie gut er in der Lage ist, diese Empfindungen zu unterdrücken, ob nun zum Zeitpunkt des Geschehens oder, wie in meinem Fall, fünfzig Jahre danach. Bis vor ein paar Monaten noch wehrte ich entschlossen die anklagenden Stimmen ab, die von Zeit zu Zeit darauf aus waren, mir den Schlaf zu rauben, wenn ich des Nachts in meinem Bett auf dem entlegenen Bauernhof in der Bretagne, meinem Zuhause, dem Muhen der Kühe und dem Gackern der Hühner lauschte. Ich war zu jung, beteuerte ich dann, ich war zu unschuldig, zu naiv, hatte zu wenig Erfahrung. Wenn ihr schon nach Schuldigen sucht, entgegnete ich den Stimmen, dann wendet euch an die Großmeister der Täuschung, George Smiley und seinen Dienstherrn Control. Ihre perfektionierte Durchtriebenheit war es, beharrte ich, ihr hinterhältiger, gelehrter Verstand, nicht der meine, die für den Triumph wie das Leid verantwortlich waren, die WINDFALL mit sich brachte. Erst jetzt, da mich der Geheimdienst, dem ich die besten Jahre meines Lebens geschenkt habe, zur Verantwortung zieht, fühle ich mich trotz meines Alters und meiner zunehmenden Vergesslichkeit dazu getrieben, die hellen und dunklen Seiten meiner Beteiligung an der Affäre zu Papier zu bringen, koste es, was es wolle.
Wie ich vom Geheimdienst angeworben wurde – dem »Circus«, wie wir Jungtürken ihn damals in jenen angeblich glücklichen Tagen nannten, als wir noch nicht in einer absurden Festung an der Themse untergebracht waren, sondern in einem bombastischen viktorianischen Gebäudekomplex aus roten Ziegelsteinen, der sich an den Cambridge Circus schmiegte –, bleibt mir ebenso ein Rätsel wie die Umstände meiner Geburt; vor allem, da beide Ereignisse untrennbar miteinander verwoben sind.
Mein Vater, an den ich mich kaum erinnere, war meiner Mutter zufolge der nichtsnutzige Sohn einer reichen anglofranzösischen Familie aus den englischen Midlands, ein Mann mit immensem Lebenshunger, einem schnell dahinschwindenden Erbe und einer rettenden Liebe zu Frankreich. Den Sommer 1930 verbrachte er im Kurort Saint-Malo an der Nordküste der Bretagne, frequentierte dort die Casinos und maisons closes und machte ganz allgemein eine gute Figur. Meine Mutter, einziges Kind einer langen Linie bretonischer Bauern und damals zwanzig, war ebenfalls in dem Städtchen, wo sie gerade bei der Hochzeit der Tochter eines reichen Viehauktionators ihren Pflichten als Brautjungfer nachkam. Zumindest behauptete sie das. Allerdings ist sie die einzige Quelle, und sie hatte durchaus keine Bedenken, etwas auszuschmücken, wenn die Fakten gegen sie standen, und es würde mich überhaupt nicht überraschen, wenn sie eigentlich weniger ehrenwerte Gründe in die Stadt geführt hätten.
Nach der Zeremonie, so ihre Geschichte, entfernten eine weitere Brautjungfer und sie sich unerlaubt von der Hochzeitsfeier, um heimlich ein, zwei Gläser Champagner zu trinken, und sie begaben sich, noch immer in ihrer Aufmachung, auf einen Abendspaziergang an der belebten Promenade, über die mein Vater ebenfalls flanierte. Meine Mutter war hübsch und flatterhaft, ihre Freundin weniger. Es entwickelte sich eine stürmische Romanze. Über das Tempo dieser Beziehung äußerte sich meine Mutter verständlicherweise nur sehr verhalten. Eilig wurde eine weitere Hochzeit ausgerichtet. Ich war das Ergebnis. Mein Vater war von Natur aus nicht besonders eheaffin, wie es scheint, und bereits in den ersten Jahren brachte er es fertig, häufiger abwesend als anwesend zu sein.
An dem Punkt aber nimmt die Geschichte eine heroische Wendung. Der Krieg ändert alles, wie wir wissen, und meinen Vater änderte er im Handumdrehen. Kaum war der Krieg erklärt, hämmerte mein Vater auch schon an die Türen des britischen Kriegsministeriums und bot seine Dienste jedem an, der sie haben wollte. Seine Mission bestand darin, so meine Mutter, Frankreich im Alleingang zu retten. Dass sein Plan womöglich auch dazu diente, den familiären Bindungen zu entfliehen, ist eine Blasphemie, die ich in Gegenwart meiner Mutter nicht äußern durfte. Die Briten hatten gerade die Special Operatives Executive gebildet, eine Sondereinsatztruppe, die von Winston Churchill persönlich den berühmten Auftrag erhalten hatte, »Europa in Brand zu stecken«. Die Küstenstädtchen im Südwesten der Bretagne waren Tummelplätze deutscher U-Boot-Aktivitäten, der größte davon unser Heimatort Lorient, eine ehemalige französische Marinebasis. Fünfmal sprang mein Vater über bretonischem Boden mit dem Fallschirm ab und tat sich mit all den Gruppen der Résistance zusammen, die er nur auftun konnte, sorgte für seinen Beitrag am Chaos und starb in den Händen der Gestapo einen grausamen Tod im Gefängnis in Rennes; er hinterließ ein Beispiel selbstloser Hingabe, dem kein Sohn je gerecht werden kann. Sein anderes Vermächtnis war ein deplatzierter Glaube an das britische Schulsystem, der mich, trotz des eigenen miserablen Abschneidens meines Vaters an seiner Privatschule, demselben Schicksal überantwortete.
Die ersten Jahre meines Lebens hatte ich im Paradies verbracht. Meine Mutter beschäftigte sich mit Kochen und Plaudern, mein Großvater war streng, aber freundlich, der Bauernhof gedieh. Daheim sprachen wir Bretonisch. An der katholischen Volksschule in unserem Dorf brachte mir eine wunderschöne junge Nonne, die sechs Monate als Au-pair-Mädchen in Huddersfield verbracht hatte, die Grundlagen des Englischen und, so war es Pflicht für alle, des Französischen bei. In den Ferien tobte ich barfuß auf den Feldern und an den Klippen rings um unseren Hof herum, erntete Buchweizen für die Crêpes meiner Mutter, versorgte eine alte Muttersau namens Fadette und spielte ausgelassen mit den anderen Dorfkindern.
Die Zukunft bedeutete mir nichts; dann brach sie über mich herein.
In Dover überließ mich meine Mutter einer molligen Dame namens Murphy, Cousine meines verstorbenen Vaters, die mich in ihr Haus nach Ealing mitnahm. Ich war acht Jahre alt. Durch das Fenster des Eisenbahnabteils sah ich meine ersten Sperrballons. Beim Abendessen erklärte Mr Murphy, in ein paar Monaten sei alles vorbei, doch Mrs Murphy widersprach ihm, und die beiden redeten mir zuliebe langsam und wiederholten jedes Wort. Am nächsten Tag ging Mrs Murphy mit mir zu Selfridges und kaufte eine Schuluniform für mich, wobei sie penibel darauf achtete, die Quittung einzustecken. Am Tag danach stand sie am Bahnhof Paddington am Gleis und weinte, während ich ihr zum Abschied mit meiner neuen Schulkappe winkte.
Wenn es um die Anglisierung geht, die sich mein Vater für mich wünschte, muss ich etwas ausholen. Es herrschte Krieg. Die Schulen mussten mit dem zurechtkommen, was sie bekamen. Ich war nun nicht länger Pierre, sondern wurde Peter. Mein schlechtes Englisch machte mich zum Gespött meiner Mitschüler, mein bretonisch eingefärbtes Französisch zum Gespött der überlasteten Lehrer. Unser kleines Dorf Les Deux Églises, erfuhr ich ganz nebenbei, war von den Deutschen überrannt worden. Die Briefe meiner Mutter trafen, wenn überhaupt, in braunen Umschlägen mit britischen Briefmarken und Londoner Poststempel ein. Erst Jahre später konnte ich mir halbwegs ausmalen, durch welche tapferen Hände diese Briefe gegangen sein mochten. Die Ferien zogen in einem Rausch aus Lagern für Knaben und Ersatzeltern vorüber. Private Vorbereitungsschulen in roten Ziegelgebäuden wichen granitgrauen Privatschulen, doch der Lehrplan blieb derselbe, dieselbe Margarine, dieselben Moralpredigten über Patriotismus und British Empire, dieselbe willkürliche Gewalt und wahllose Grausamkeit, dasselbe ungestillte, unfokussierte sexuelle Verlangen. Eines Frühlingsabends im Jahr 1944, kurz vor dem D-Day, rief mich der Direktor in sein Arbeitszimmer und teilte mir mit, dass mein Vater den Heldentod gestorben sei und ich stolz auf ihn sein könne. Aus Gründen der Geheimhaltung gab es keine weiteren Erklärungen.
Mit sechzehn kehrte ich am Ende eines besonders nervtötenden Sommerhalbjahrs als fast erwachsener britischer Sonderling in die wieder friedliche Bretagne zurück. Mein Großvater war gestorben. Ein neuer Gefährte namens Monsieur Emile teilte nun das Bett mit meiner Mutter. Ich scherte mich nicht um Monsieur Emile. Die eine Hälfte von Fadette hatten die Deutschen bekommen, die andere Hälfte die Résistance. Auf der Flucht vor den Widersprüchen meiner Kindheit und erfüllt von kindlichem Pflichtgefühl, reiste ich heimlich mit dem Zug nach Marseille, machte mich ein Jahr älter und versuchte, mich zur Fremdenlegion zu melden. Mein närrisches Abenteuer fand ein schnelles Ende, als die Legion eine seltene Ausnahme machte und dem Flehen meiner Mutter nachgab, weil ich kein Ausländer, sondern Franzose war: Sie schickte mich wieder zurück in die Gefangenschaft, diesmal im Londoner Vorort Shoreditch, wo Markus, der angebliche Stiefbruder meines Vaters, eine Handelsgesellschaft betrieb, die kostbare Felle und Teppiche aus der Sowjetunion importierte – er sagte stets nur Russland –, und angeboten hatte, mich in die Lehre zu nehmen.
Onkel Markus ist noch so ein ungelöstes Rätsel in meinem Leben. Bis zum heutigen Tag weiß ich nicht, ob sein Angebot, mich auszubilden, nicht vielleicht in irgendeiner Weise von meinen späteren Dienstherren eingefädelt worden war. Als ich ihn fragte, wie mein Vater denn ums Leben gekommen sei, schüttelte er missbilligend den Kopf – nicht wegen meines Vaters, sondern als Antwort auf die Grobheit meiner Frage. Manchmal frage ich mich, ob es möglich ist, von Geburt an still und leise zu sein, so wie manche Menschen von Geburt an reich sind oder groß oder musikalisch. Markus war nicht böse, streng oder unhöflich. Er war nur still und leise. Er war Mitteleuropäer und hieß mit Nachnamen Collins. Ich fand nie heraus, wie er vorher geheißen hatte. Er sprach ein schnelles Englisch mit leichtem Akzent, aber ich erfuhr nie, was seine Muttersprache war. Er nannte mich Pierre. Er hatte eine Lebensgefährtin namens Dolly, die ein Hutgeschäft in Wapping führte und ihn an Freitagnachmittagen an der Tür seines Lagerhauses abholte. Ich bekam allerdings nie heraus, wo sie ihre Wochenenden verbrachten, ob sie miteinander oder mit anderen verheiratet waren. In Dollys Leben gab es einen Bernie, aber ich weiß nicht, ob Bernie ihr Mann, Sohn oder Bruder war, denn auch Dolly war von Geburt an still und leise.
Bis heute weiß ich nicht, ob die Collins Trans-Siberian Fur & Fine Carpet Company ein echtes Handelshaus war oder eine Tarnfirma zum Zwecke der Spionage. Als ich das später recherchieren wollte, lief ich vor eine Wand. Ich wusste, jedes Mal, wenn Onkel Markus sich auf eine Handelsmesse vorbereitete, ob nun in Kiew, Perm oder Irkutsk, zitterte er heftig; und wenn er zurückkam, trank er heftig. Und jedes Mal tauchte in den Tagen vor einer solchen Handelsmesse ein wortgewandter Engländer namens Jack auf, becircte die Sekretärinnen, schaute bei mir im Sortierraum vorbei und rief: »Hallo, Peter, alles in Ordnung?« – nie Pierre –, um dann Markus irgendwo zu einem guten Mittagessen einzuladen. Nach dem Essen kam Markus dann zurück ins Büro und schloss sich ein.
Jack behauptete, Zwischenhändler für feine Zobel zu sein, doch ich bin mir sicher, dass er in Wirklichkeit mit Geheimwissen handelte, denn als Markus vermeldete, seine Ärzte würden ihm keine weiteren Handelsmessen mehr erlauben, schlug Jack vor, dass ich ihn an Markus’ Stelle zum Essen begleiten solle; er führte mich in den Travellers’ Club in Pall Mall und fragte mich, ob mir das Leben in der Fremdenlegion lieber gewesen wäre, ob ich es mit einer meiner Freundinnen tatsächlich ernst meine und warum ich von der Privatschule geflohen sei, wo ich doch Kapitän des Boxteams gewesen sei; dann wollte er wissen, ob ich jemals daran gedacht hätte, etwas Nützliches für mein Land zu tun, womit er England meinte, denn wenn ich den Eindruck hätte, den Krieg aufgrund meines Alters verpasst zu haben, dann sei nun die Gelegenheit gekommen, das nachzuholen. Während des Essens erwähnte er meinen Vater nur ein einziges Mal, und das so nebenbei, dass ich den Eindruck gewann, das Thema hätte ihm genauso gut einfach entfallen sein können:
»Ach, und was Ihren hochverehrten Papa angeht. Ganz im Vertrauen, und ich habe nichts dazu gesagt. Geht das in Ordnung?«
»Ja.«
»Er war ein sehr mutiger Bursche und hat seinem Land einen verflucht guten Dienst erwiesen. Seinen beiden Ländern. Reicht das?«
»Wenn Sie das sagen.«
»Also, auf sein Wohl!«
Auf sein Wohl, wiederholte ich, und wir stießen auf meinen Vater an.
In einem eleganten Landhaus in Hampshire gaben mir Jack, sein Kollege Sandy und eine tüchtige junge Frau namens Emily, in die ich mich umgehend verknallte, eine kurze Einführung, wie man einen toten Briefkasten in der Innenstadt von Kiew leerte – es handelte sich tatsächlich um ein loses Stück Mauerwerk in der Wand eines alten Tabakkiosks, von dem sie einen Nachbau in der Orangerie aufgestellt hatten. Sie zeigten mir, wie ich das Signal erkannte, das mir verriet, dass es sicher war, ihn zu leeren – in diesem Fall ein Stück zerschlissenes grünes Band, das an einem Geländer baumelte. Und sie zeigten mir, wie ich zu markieren hatte, dass ich den Briefkasten geleert hatte; dazu sollte ich die leere Schachtel einer russischen Zigarettenmarke in einen Mülleimer neben einem Bushäuschen werfen.
»Ach, und wenn du ein russisches Visum beantragst, Peter, nimm lieber deinen französischen Pass, nicht den britischen«, schlug Jack leichthin vor und erinnerte mich daran, dass Onkel Markus eine Filiale in Paris habe. »Und übrigens, Emily ist tabu«, fügte er hinzu, für den Fall, das ich andere Vorstellungen hätte, was ja auch stimmte.
Das also war mein erster Job, mein allererster Einsatz für den Service, den ich späterhin als Circus kennenlernte, die erste Vision von mir als geheimer Krieger nach dem Vorbild meines toten Vaters. Ich kann nicht mehr all die anderen Jobs aufzählen, die ich im Laufe der folgenden paar Jahre übernahm, ein halbes Dutzend mindestens, in Leningrad, Gdansk und Sofia, dann auch Leipzig und Dresden, und alle verliefen recht unspektakulär, soweit ich das beurteilen konnte, mal abgesehen von der Herausforderung, sich darauf einzustellen und hinterher wieder loszulassen.
An langen Wochenenden, in einem anderen Landhaus mit einem anderen wunderschönen Garten, erweiterte ich mein Repertoire durch neue Tricks, wie Gegenüberwachung und heimliche Übergabe in Menschenmengen. Irgendwann im Verlauf dieser Eskapaden wurden mir bei einer zurückhaltenden kleinen Feierlichkeit in einem Unterschlupf in der South Audley Street die Tapferkeitsmedaillen meines Vaters überreicht, eine französische, eine englische, zusammen mit den Urkunden, die die Verleihung begründeten. Warum erst jetzt?, hätte ich fragen können. Doch zu dem Zeitpunkt hatte ich bereits begriffen, nicht nachzufragen.
Erst zu Beginn meiner Aufenthalte in Ostdeutschland betrat jener rundliche, bebrillte, stets bekümmerte George Smiley mein Leben, an einem Sonntagnachmittag in West Sussex, während der Nachbesprechung meines Einsatzes, die nicht mehr mit Jack stattfand, sondern mit einem kräftigen Burschen namens Jim, tschechischer Abstammung und etwa in meinem Alter. Es dauerte, bis ich seinen Nachnamen herausfand: Prideaux. Ich erwähne ihn, weil er später ebenfalls eine wichtige Rolle in meiner Karriere spielte.
Smiley sagte nicht viel bei dieser Nachbesprechung, er saß nur da, hörte zu und starrte mich ab und zu durch seine Brille mit dem dicken Rahmen an wie eine Eule. Nach der Besprechung aber schlug er vor, wir sollten eine Runde durch den Garten drehen, der endlos schien und auf einen Park hinausging. Wir unterhielten uns, setzten uns auf eine Bank, spazierten weiter, setzten uns wieder, sprachen weiter. Meine liebe Mutter – lebte sie noch, ging es ihr gut? Ihr geht’s gut, George, danke der Nachfrage. Ein bisschen schrullig, aber es geht ihr gut. Und mein Vater – hatte ich die Medaillen aufgehoben? Ich antwortete, dass meine Mutter sie jeden Sonntag polieren würde, was stimmte. Ich erwähnte nicht, dass sie sie mir ab und zu ansteckte und weinte. Anders als Jack fragte George mich nie nach meinen Frauenbekanntschaften. Er wird wohl gedacht haben, dass ihre schiere Anzahl Sicherheit versprach.
Wenn ich mich jetzt an diese Unterhaltung zurückerinnere, drängt sich mir der Gedanke auf, dass Smiley sich, ob nun bewusst oder unbewusst, als jene Vaterfigur anbot, zu der er später werden sollte. Aber vielleicht war das nur mein Eindruck, nicht seiner. Tatsache ist, dass ich das Gefühl hatte, nach Hause zu kommen, als er mir endlich die entscheidende Frage stellte, obwohl doch meine Heimat auf der anderen Seite des Kanals, in der Bretagne, lag.
»Wissen Sie, wir haben uns gefragt«, sagte er versonnen, »ob Sie schon mal daran gedacht haben, regelmäßig für uns zu arbeiten? Leute, die für uns im Außendienst tätig sind, sind nicht immer auch für den Innendienst geeignet. In Ihrem Fall glauben wir allerdings, es könnte klappen. Wir zahlen nicht sonderlich gut, und es kommt vor, dass Karrieren abbrechen. Aber wir halten es für eine wichtige Aufgabe, solange man das Ziel im Auge behält und sich nicht allzu große Sorgen um den Weg dorthin macht.«
2.
Mein Bauernhof bei Les Deux Églises besteht aus einem unbedeutenden, aus Granit errichteten, kantigen Landhaus aus dem 19. Jahrhundert, einer baufälligen Scheune mit einem Steinkreuz auf dem Giebel, Resten von Befestigungsanlagen aus lang vergessenen Kriegen, einem uralten Steinbrunnen, der stillgelegt ist, früher, vor der Besatzung der Nazis, aber von den Widerstandskämpfern als Versteck für Waffen genutzt wurde, einem ebenso alten Backhaus, einer in die Jahre gekommenen, nicht mehr betriebenen Cidrepresse und fünfzig Hektar mittelmäßigem Weideland, das zu den Klippen und der Meeresküste hinunterreicht. Der Hof befindet sich seit vier Generationen im Besitz der Familie. Ich bin die fünfte. Er ist weder nobel noch profitabel. Schaue ich aus dem Wohnzimmerfenster, dann erhebt sich zu meiner Rechten der knorrige Turm einer Kirche aus dem 19. Jahrhundert, zu meiner Linken eine weiße, strohgedeckte allein stehende Kapelle. Diese Bauwerke haben dem dazwischen liegenden Dorf seinen Namen verliehen. In Les Deux Églises sind wir, wie in der gesamten Bretagne, katholisch oder nichts. Ich bin nichts.
Um unseren Hof von Lorient aus zu erreichen, fahren Sie erst etwa eine halbe Stunde die südliche Küstenstraße entlang, die im Winter von dürren Pappeln gesäumt ist; unterwegs kommen Sie an Überresten von Hitlers Atlantikwall vorbei, die man nicht abreißen kann und nach einer Weile an ein neuzeitliches Stonehenge erinnern. Nach etwa dreißig Kilometern sollten Sie Ausschau nach einer vollmundig Odyssée genannten Pizzeria halten; kurz danach liegt auf der rechten Seite ein stinkender Schrottplatz, auf dem der fehlgenannte Honoré, ein vagabundierender Trunkenbold, den zu meiden mich meine Mutter stets anhielt, in der Gegend auch bekannt als der Giftzwerg, Krimskrams verscherbelt, alte Autoreifen und Pferdemist. Wenn Sie auf ein verbeultes Schild mit der Aufschrift Delassus stoßen, so der Name der Familie meiner Mutter, biegen Sie auf eine mit Schlaglöchern übersäte Fahrspur ab und bremsen am besten stark, wenn Sie die Löcher überqueren, oder Sie machen es wie Monsieur Denis, der Postbote, der Vollgas gibt und geschickt um sie herumkurvt. Dies tat er auch an jenem sonnigen Vormittag im Frühherbst, zur Empörung der Hühner auf dem Hof und der erhabenen Missachtung durch Amoureuse, meine geliebte Irish-Setter-Hündin, die viel zu sehr damit beschäftigt war, ihren neuesten Wurf zu putzen, als banalen menschlichen Angelegenheiten ihre Aufmerksamkeit zu schenken.
Vom ersten Augenblick an, als Monsieur Denis – alias le Général, dank seiner Körpergröße und der angeblichen Ähnlichkeit mit Präsident de Gaulle – sich aus seinem gelben Lieferwagen geschlängelt hatte und die Vorderstufen hinaufkam, wusste ich, dass der Brief, den er in seiner dürren Hand hielt, vom Circus stammte.
Zunächst beunruhigte mich das nicht; ich fand es sogar ganz amüsant. Es gibt ein paar Dinge beim britischen Geheimdienst, die sich wohl nie ändern. Eins davon ist die übertriebene Sorge um die Art von Briefpapier, die man zur öffentlichen Korrespondenz verwendet. Es darf nicht zu offiziell oder formell wirken: Das wäre schlecht für die Tarnung. Der Umschlag darf nicht durchscheinen, ist also vorzugsweise gefüttert. Standardweiß ist zu auffällig; also leicht eingefärbt, aber nichts, was einen amourösen Hintergrund andeuten könnte. Ein schwaches Blau, ein helles Grau, beides ist erlaubt. Dieser Umschlag hier war blassgrau.
Nächste Frage: Wird die Adresse getippt oder von Hand geschrieben? Um die richtige Antwort zu finden, sollte man wie stets die Bedürfnisse des jeweiligen Außendienstlers berücksichtigen, in diesem Falle also meine: Peter Guillam, ehemaliger Angehöriger des Geheimdienstes, genießt in aller Dankbarkeit seinen Ruhestand. Seit vielen Jahren wohnhaft im ländlichen Frankreich. Besucht keine Veteranentreffen. Lebenspartnerschaften nicht bekannt. Bezieht die volle Pension, darf also belästigt werden. Schlussfolgerung: In einem abgelegenen bretonischen Weiler, in den sich nur selten Fremde verirren, könnte ein getippter, halboffiziell wirkender blassgrauer Umschlag mit einer britischen Briefmarke für Stirnrunzeln sorgen, also handschriftliche Adresse. Jetzt zum schwierigen Teil. Der Service, oder wie sich der Circus heutzutage sonst nennt, kann sich irgendeiner Form von Sicherheitsklassifizierung nicht entziehen, und wenn sie nur Privat lautet. Vielleicht zur Extraabsicherung noch ein Persönlich anfügen? Privat & Persönlich, nur zu Händen des Adressaten? Zu dick aufgetragen. Bleiben wir bei Privat. Oder, wie in diesem Fall, besser bei Personell.
1 Artillery BuildingsLondon, SE14
Lieber Guillam,
wir sind uns noch nicht begegnet, deshalb erlauben Sie mir bitte, dass ich mich vorstelle. Ich bin in Ihrer alten Firma für das Management der geschäftlichen Belange zuständig und sowohl mit aktuellen wie auch vergangenen Fällen betraut. Eine Angelegenheit, in der Sie vor einigen Jahren dem Anschein nach eine bedeutende Rolle innehatten, ist uns überraschend wieder vorgelegt worden, und mir bleibt keine andere Wahl, als Sie darum zu bitten, sich so bald wie möglich in London einzufinden, um uns bei der Vorbereitung einer Stellungnahme zu unterstützen.
Ich bin ermächtigt, Ihnen die Rückerstattung Ihrer Reisekosten (Economy Class) und auf das Londoner Preisniveau abgestimmten Spesen in Höhe von £130/Tag für die Dauer Ihres erforderlichen Aufenthaltes anzubieten.
Da uns offenbar keine Telefonnummer von Ihnen vorliegt, kontaktieren Sie bitte Tania unter der oben angegebenen Nummer (R-Gespräch), oder, falls Sie über eine E-Mail-Adresse verfügen, melden Sie sich unter der unten genannten Adresse. Ich möchte Ihnen keine Unannehmlichkeiten bereiten, muss jedoch betonen, dass die fragliche Angelegenheit von einiger Dringlichkeit ist. Erlauben Sie mir zum Abschluss dieses Schreibens noch auf Paragraph 14 des Vertrags hinsichtlich Ihres Ausscheidens aus dem Dienst hinzuweisen.
Hochachtungsvoll, A. Butterfield (RB des CS)
P. S. Bitte achten Sie darauf, Ihren Personalausweis mit sich zu führen, wenn Sie sich am Empfang melden. A. B.
Statt »RB des CS« lies Rechtsberater des Chief of Service. Statt »Paragraph 14« lies lebenslange Pflicht zu erscheinen, falls die Bedürfnisse des Circus dies verlangen. Und statt »erlauben Sie mir« lies vergessen Sie nicht, welche Hand Sie füttert. Ich habe keine E-Mail-Adresse. Und warum trägt der Brief kein Datum: aus Sicherheitsgründen?
Catherine ist mit ihrer neunjährigen Tochter Isabelle im Obstgarten und spielt mit einem Pärchen ausgelassener junger Ziegen, das wir uns kürzlich zugelegt haben. Sie hat ein breites bretonisches Gesicht und bedächtige braune Augen, die einen ausdruckslos mustern. Catherine streckt ihre Arme aus, so dass die Ziegen an ihr hochspringen, und die kleine Isabelle, die ihren Spaß daran hat, klatscht in die Hände vor Freude und wirbelt auf dem Absatz herum. Allerdings muss Catherine, so kräftig sie auch ist, darauf achten, immer eine Ziege nach der anderen aufzufangen, denn wenn beide gleichzeitig losspringen, werfen sie sie glatt um. Isabelle kümmert sich nicht um mich. Direkter Augenkontakt ist ihr lästig.
Auf dem Acker hinter ihnen bückt sich gerade der taube Yves, der gelegentlich bei uns arbeitet, und erntet Kohl. Mit der rechten Hand schneidet er die Wurzeln ab, mit der linken wirft er die Kohlköpfe auf einen Karren, aber der Winkel seines krummen Buckels ändert sich nie. Er wird von einem alten grauen Pferd namens Artemis beobachtet, noch so ein Findelkind von Catherine. Vor ein paar Jahren haben wir einen streunenden Strauß aufgenommen, der von einem benachbarten Hof ausgebrochen war. Als Catherine den Bauern informierte, meinte der nur, wir könnten ihn behalten, er sei zu alt. Der Strauß starb friedlich, und er erhielt ein Staatsbegräbnis.
»Brauchst du etwas, Pierre?«, fragt Catherine.
»Ich muss leider für ein paar Tage fort«, antworte ich.
»Nach Paris?« Catherine mag es nicht, wenn ich nach Paris fahre.
»Nach London«, antworte ich. Und da man in meiner Situation sogar noch im Ruhestand eine Tarnung braucht: »Jemand ist gestorben.«
»Jemand, der dir nahesteht?«
»Nicht mehr«, erwidere ich mit einer festen Stimme, die mich selbst überrascht.
»Dann ist es nicht wichtig. Reist du noch heute ab?«
»Morgen. Ich nehme den frühen Flug von Rennes.«
Es hat Zeiten gegeben, da musste der Circus nur pfeifen, und ich wäre nach Rennes gestürzt, um direkt eine Maschine zu erwischen. Heute nicht mehr.
Man muss schon am Sitz des Service im alten Circus in den Rang eines Spions aufgenommen worden sein, um den Widerwillen verstehen zu können, der mich überkam, als ich am folgenden Nachmittag gegen vier Uhr mein Taxi bezahlte und den Betonlaufsteg zur schockierend angeberischen neuen Zentrale des Service beschritt. Man hätte schon zum Höhepunkt meiner Agententätigkeit an meiner Stelle sein müssen, wenn ich mal wieder hundemüde von irgendeinem gottverlassenen Außenposten zurückkehrte – höchstwahrscheinlich in der Sowjetunion oder einem ihrer Satelliten. Du kommst auf direktem Weg vom Flughafen mit dem Bus angefahren, dann nimmst du die U-Bahn zum Cambridge Circus. Das Einsatzteam wartet schon, um dich auszuhorchen. Du steigst die fünf abgewetzten Stufen zum Eingang des viktorianischen Schandflecks hinauf, den wir abwechselnd Zentrale, Service oder einfach nur Circus nennen. Und schon bist du zu Hause.
Vergiss die Kämpfe, die du mit der Einsatzleitung, der Materialbeschaffung oder der Verwaltung hattest. Das sind doch nur die üblichen Querelen zwischen Außendienst und Zentrale. Der Portier in seinem Kabuff wünscht dir mit einem wissenden »Willkommen daheim, Mr Guillam!« einen guten Morgen und fragt, ob du deinen Koffer abgeben möchtest. Und du bedankst dich bei Mac oder Bill oder wer sonst gerade an dem Tag Dienst hat und denkst gar nicht daran, ihm deinen Ausweis vorzuzeigen. Du lächelst und weißt nicht mal, warum. Vor dir befinden sich die drei launischen alten Fahrstühle, die du seit deinem ersten Tag im Geheimdienst hasst – und diesmal stecken auch noch zwei von ihnen in den oberen Etagen fest, und der dritte ist Controls Privatfahrstuhl, also denk nicht mal darüber nach. Außerdem würdest du dich sowieso viel lieber in dem Labyrinth aus Fluren und Sackgassen verlieren, dieser zu Stein gewordenen Verkörperung der Welt, in der du zu leben beschlossen hast, mit ihren wurmstichigen Holztreppen, ramponierten Feuerlöschern, Fischaugenspiegeln und dem Gestankgemisch aus kaltem Zigarettenqualm, Nescafé und Deodorant.
Und nun diese Ungeheuerlichkeit. Dieser Spionage-Freizeitpark an der Themse.
Unter den Blicken mürrischer Männer und Frauen in Tracksuits melde ich mich am panzerglasgeschützten Empfangstresen und schaue zu, wie mein britischer Ausweis von einem hin- und hergleitenden Metalltablett mitgenommen wird. Das Gesicht hinter dem Glas gehört zu einer Frau. Die elektronische Stimme mit den absurden Betonungen ist allerdings die eines Mannes:
»Bitte legen Sie alle Schlüssel, Handys, Bargeld, Armbanduhren, Schreibgeräte und alle sonstigen metallischen Gegenstände, die Sie bei sich tragen, in die Box auf dem Tisch zur Linken, bewahren Sie den weißen Anhänger auf, der zu Ihrer Box gehört, und gehen Sie dann mit den Schuhen in der Hand weiter durch die Tür mit der Aufschrift Besucher.«
Ich erhalte meinen Pass zurück. Ich gehe also weiter, werde von einem fröhlichen Mädchen von vielleicht vierzehn Jahren mit einem Pingpongschläger abgesucht und dann in einem aufrechten Glassarg durchleuchtet. Nachdem ich die Schuhe wieder angezogen und die Schnürsenkel gebunden habe – eine erheblich demütigendere Prozedur als das Ausziehen, irgendwie –, werde ich von einer fröhlichen Teenagerin, die mich fragt, ob ich einen guten Tag gehabt hätte, zu einem ungekennzeichneten Fahrstuhl gebracht. Habe ich nicht. Ich hatte auch keine gute Nacht, falls sie das wissen will, will sie aber nicht. Dank des Briefs von A. Butterfield habe ich so schlecht geschlafen wie seit zehn Jahren nicht mehr, aber das kann ich ihr auch nicht sagen. Ich bin Außendienstler mit Haut und Haaren, zumindest war ich das. Mein natürliches Umfeld waren die offenen Weiten der Spionage. Nun muss ich in meinen sogenannten besten Jahren feststellen, dass eine Vorladung, die aus heiterem Himmel vom Circus in seiner neuen Gestalt hereinschneit und mein sofortiges Erscheinen in London verlangt, mich auf eine nächtliche Seelenerkundung schickt.
Wir haben das oberste Stockwerk erreicht, so fühlt es sich zumindest an, aber es gibt keine entsprechende Anzeige. In der Welt, in der ich einst zu Hause war, verbargen sich die größten Geheimnisse immer im obersten Stockwerk. Meine jugendliche Begleiterin hat eine ganze Reihe Bänder mit elektronischen Anhängern um den Hals. Sie öffnet eine unmarkierte Tür, ich trete ein, sie schließt sie. Ich greife nach dem Türgriff. Er gibt nicht nach. Ich bin schon ein paarmal in meinem Leben eingeschlossen gewesen, wenn auch immer von der Gegenseite. Es gibt keine Fenster, nur ein paar Kinderzeichnungen mit Blumen und Häusern. Das Werk von A. Butterfields Nachwuchs? Oder die Kritzeleien früherer Insassen?
Und was ist mit dem ganzen Lärm passiert? Je länger ich lausche, umso größer wird die Stille. Kein fröhliches Geklapper der Schreibmaschinen, keine Telefone, die unbeachtet auf ihren Gabeln klingeln, kein klappriger Aktenwagen, der wie das Gefährt des Milchmannes durch die Flure mit den blanken Holzdielen rattert, kein wütender Mann, der brüllt, man solle endlich mitdieser verfluchten Pfeiferei aufhören! Irgendwo auf der Strecke zwischen Cambridge Circus und Albert Embankment ist etwas gestorben, und zwar nicht nur das Gequietsche der Aktenwagen.
Ich setze mich auf einen Stuhl aus Stahl und Leder. Ich blättere durch eine zerfledderte Ausgabe von Private Eye und frage mich, wer von uns denn seinen Humor verloren hat, das Satiremagazin oder ich. Ich stehe auf, rüttle erneut an der Tür und setze mich auf einen anderen Platz. In der Zwischenzeit habe ich mir überlegt, dass A. Butterfield wohl eine intensive Studie meiner Körpersprache vornimmt. Nun, wenn er das tut, viel Spaß dabei, denn bis die Tür aufspringt, eine agile Mittvierzigerin mit kurzen Haaren im Geschäftskostüm hereinsaust und mit einem Londoner Akzent verkündet: »Ach, hi, Peter, wie schön. Ich bin Laura, wollen Sie nicht mitkommen?«, muss ich wohl im Schnelldurchlauf all die Fehlzündungen und Katastrophen durchlebt haben, in die ich in meinem Leben staatlich zugelassener Gaunerei verwickelt gewesen bin.
Wir marschieren durch einen leeren Flur und betreten ein klinisch weißes Büro mit Fenstern, die man nicht öffnen kann. Ein milchgesichtiges, bebrilltes Privatschulbürschchen unbestimmten Alters in Hemd und mit Zahnspange springt hinter seinem Schreibtisch auf und greift nach meiner Hand.
»Peter! Du meine Güte! Sie sehen ja richtig fesch aus! Halb so alt! Gute Reise gehabt? Kaffee? Tee? Sicher? Wirklich schön, dass Sie kommen konnten. Eine riesige Hilfe. Laura kennen Sie schon? Natürlich. Tut mir sehr leid, dass Sie warten mussten. Anruf von oben. Jetzt ist alles gut. Setzen Sie sich.«
Zu allem Überfluss drückt er vertraulich die Augen zusammen, um noch größere Nähe zu signalisieren, während er mich zu einem Lehnstuhl mit unbequem senkrechtem Rücken führt. Dann setzt er sich wieder hinter seinen Schreibtisch, der mit ziemlich alt aussehenden, mit den Farben aller möglichen Länder beflaggten Circus-Akten überhäuft ist. Zwischen den Akten stützt er, für mich unsichtbar, die im Hemd steckenden Ellbogen auf und verknotet seine Hände unter dem Kinn.
»Ich bin übrigens Bunny«, erklärt er. »Ein völlig bescheuerter Name, aber der hängt mir schon seit Kindertagen nach. Wenn ich es recht bedenke, ist das vielleicht der Grund, warum ich hier gelandet bin. Man kann ja schlecht im High Court of Justice zeigen, was man kann, wenn alle hinter einem herlaufen und ›Bunny, Bunny‹ brüllen, oder?«
Ist das seine übliche Art zu reden? Spricht der durchschnittliche Geheimdienstanwalt mittleren Alters heute so? In der einen Sekunde schmissig, in der nächsten wie in einer vergangenen Zeit? Die englische Gegenwartssprache klingt ungewohnt in meinen Ohren, aber wenn es nach Lauras Gesichtsausdruck geht, die neben ihm Platz nimmt, ist das alles wohl ganz normal. Im Sitzen wirkt sie wild und sprungbereit. Siegelring am Mittelfinger der rechten Hand. Der Ring ihres Vaters? Ein geheimes Signal für irgendwelche sexuellen Vorlieben? Ich bin zu lange nicht mehr in England gewesen.
Unbedeutender, von Bunny gelenkter Small Talk. Seine Kinder, zwei Mädchen, schwärmen für die Bretagne. Laura war schon in der Normandie, aber nicht in der Bretagne. Sie verrät aber nicht, mit wem.
»Aber Sie sind doch in der Bretagne geboren, Peter!«, legt Bunny plötzlich völlig unmotiviert los. »Wir sollten Sie Pierre nennen!«
Peter ist ganz okay, winke ich ab.
»Also, ganz offen gesprochen, Peter, haben wir hier einen ernsthaften juristischen Kuddelmuddel zu klären«, fährt Bunny langsamer und lauter fort, nachdem er die neuen Hörhilfen entdeckt hat, die aus meinen weißen Locken hervorlugen. »Keine Krise, noch nicht, aber wichtig, und ich fürchte, recht explosiv. Und dabei benötigen wir ganz dringend Ihre Hilfe.«
Worauf ich erwidere, dass ich nur zu gern behilflich sein möchte, Bunny, es ist eine wirklich schöne Vorstellung, dass man nach all den Jahren noch immer von Nutzen sein kann.
»Ich bin natürlich hier, um den Service zu schützen. Das ist mein Job«, fährt Bunny fort, als hätte ich kein Wort gesagt. »Und Sie sind als Privatperson hier, ehemaliger Mitarbeiter, zugegeben, seit langem schon im friedlichen Ruhestand, da bin ich sicher, aber ich kann nicht garantieren, dass Ihre Interessen und unsere Interessen in jeder Hinsicht übereinstimmen werden.« Augen zu Schlitzen gepresst. Starres Grinsen. »Was ich damit sagen will, Peter: Bei allem, was Sie vor Urzeiten für das Büro getan haben und wofür wir Sie sehr respektieren, das hier ist der Service. Sie sind Sie, und ich bin ein gnadenloser Anwalt. Wie geht es Catherine?«
»Gut, danke. Warum fragen Sie?«
Weil ich sie nicht auf die Liste habe aufnehmen lassen. Um mir Angst zu machen. Um mir zu signalisieren, dass ohne Bandagen gekämpft wird. Und wie scharf die Augen des Service sind.
»Wir haben uns gefragt, ob wir sie nicht auf die recht lange Liste Ihrer Lebensgefährtinnen setzen sollten«, erläutert Bunny. »Dienstvorschriften und all das.«
»Catherine ist meine Pächterin. Sie ist die Tochter und Enkelin der vorherigen Pächter. Ich habe lediglich beschlossen, auf dem Grundstück zu wohnen. Ich habe nie mit ihr geschlafen und habe auch nicht die Absicht, es zu tun, wenn Sie das überhaupt etwas angeht. War es das?«
»Wunderbar, danke.«
Meine erste glaubhaft vorgebrachte Lüge. Jetzt noch schnell ein Ablenkungsmanöver: »Hört sich ganz so an, als bräuchte ich einen eigenen Anwalt«, sage ich.
»Das wäre ein wenig voreilig; außerdem können Sie sich bei den heutigen Stundensätzen sowieso keinen leisten. In den Akten steht, Sie seien verheiratet gewesen und dann nicht mehr. Ist das beides korrekt?«
»Ja.«
»Und beides innerhalb eines Kalenderjahres. Ich bin beeindruckt.«
»Vielen Dank.«
War das witzig gemeint? Provokant? Ich fürchte Letzteres.
»Jugendlicher Leichtsinn?«, meint Bunny im unverändert höflichen Ton der Neugier.
»Ein Missverständnis«, erwidere ich. »Noch weitere Fragen?«
Doch Bunny weicht nicht so leicht zurück, und genau das will er mir auch vermitteln. »Na ja, von wem ist es dann – das Kind? Wer ist der Vater?« – immer noch mit dieser aalglatten Stimme.
Ich tue so, als würde ich nachdenken. »Wissen Sie, ich glaube, ich habe sie noch nicht mal gefragt«, antworte ich. Und während er noch überlegt: »Und da wir gerade dabei sind, darüber zu reden, wer was mit wem macht, könnten Sie mir vielleicht verraten, was Laura hier will«, schlage ich vor.
»Laura ist unsere Expertin für Geschichte«, erwidert Bunny volltönend.
Geschichte in der Gestalt einer Frau ohne Mimik, mit kurzen Haaren, braunen Augen und ungeschminktem Gesicht. Außer mir lächelt niemand mehr.
»Also, was steht in der Anklageschrift, Bunny?«, frage ich fröhlich, wo wir uns langsam auf den Nahkampf vorbereiten. »›Majestätsbeleidigung?‹«
»Ach, kommen Sie, Anklageschrift ist doch reichlich übertrieben, Peter!«, protestiert Bunny ebenso fröhlich. »Es gibt ein paar Dinge zu klären, das ist alles. Eine Frage noch, bevor wir zu allem anderen kommen. Darf ich?« – er drückt die Augen zusammen. »Operation Windfall. Wie wurde sie initiiert, wer leitete sie, an welcher Stelle lief alles aus dem Ruder, und welche Rolle haben Sie dabei gespielt?«
Findet die Seele Erleichterung, wenn einem klarwird, dass die schlimmsten Erwartungen eingetroffen sind? Nicht in meinem Fall.
»Windfall sagten Sie, Bunny?«
»Windfall« – lauter, für den Fall, dass seine Worte meine Hörhilfe nicht erreicht haben. Immer schön langsam. Denk dran, du bist in einem gesetzten Alter. Dein Gedächtnis ist heutzutage auch nicht mehr das beste. Immer mit der Ruhe.
»Und Windfall war genau was, Bunny? Geben Sie mir einen Hinweis. Von welcher Zeit reden wir hier?«
»Anfang der Sechziger. Heute.«
»Eine Operation, sagten Sie?«
»Ein verdeckter Einsatz. Namens Windfall.«
»Gegen welches Ziel?«
Laura meldet sich überraschend zu Wort: »Sowjetunion und Satellitenstaaten. Direkt gerichtet gegen den ostdeutschen Geheimdienst, die Staatssicherheit, Stasi« – wobei sie mir zuliebe schier brüllt.
Stasi? Stasi? Einen Augenblick. Ach ja, die Stasi.
»Mit welcher Absicht, Laura?«, frage ich, dabei weiß ich es ja schon.
»Um eine Täuschung zu inszenieren, den Feind in die Irre zu führen, eine wichtige Quelle zu schützen. Um in das Moskauer Zentrum vorzudringen und den oder die vermeintlichen Verräter in den Rängen des Circus zu identifizieren.« Tempowechsel hin zur Wehklage: »Allerdings liegen uns darüber absolut keine Akten mehr vor. Nur ein paar Querverweise zu Akten, die sich in Luft aufgelöst haben. Verschwunden, möglicherweise gestohlen.«
»Windfall, Windfall«, wiederhole ich, schüttle den Kopf und lächle, wie das alte Männer tun, selbst wenn sie noch nicht ganz so alt sind, wie andere das vielleicht vermuten. »Tut mir leid, Laura. Da klingelt bei mir nichts, tut mir leid.«
»Nicht mal ein leises Glöckchen?« – Bunny.
»Nicht mal das, leider. Völlige Stille« – während ich Bilder meines jugendlichen Alter Ego aus dem Kopf verbanne, wie ich mich in der Tarnung eines Pizzaboten über den Lenker meines Motorrads beuge und eine nächtliche Sonderlieferung Akten aus der Circus-Zentrale nach sonst wo in London transportiere.
»Nur für den Fall, dass ich es nicht erwähnt habe oder Sie es nicht gehört haben«, sagt Bunny mit seiner ausdruckslosesten Stimme. »Unserem Verständnis nach war Ihr Freund und Kollege Alec Leamas an der Operation Windfall beteiligt, der, wie Sie sich vielleicht noch erinnern, an der Berliner Mauer erschossen wurde, als er seiner Freundin Elizabeth Gold zu Hilfe kommen wollte, die man kurz zuvor an der gleichen Stelle erschossen hatte. Aber vielleicht haben Sie das auch vergessen?«
»Das habe ich natürlich nicht, verflucht«, blaffe ich ihn an. Erst dann erkläre ich: »Sie haben mich nach Windfall gefragt, nicht nach Alec. Und die Antwort darauf lautet: Nein. Ich erinnere mich nicht daran. Hab noch nie davon gehört. Tut mir leid.«
Bei jeder Befragung stellt die Leugnung den entscheidenden Wendepunkt dar. Vergessen Sie die Höflichkeiten, die bis dahin ausgetauscht wurden. Vom Augenblick der Leugnung an ist nichts mehr so, wie es war. Bei einem Geheimpolizisten wird Leugnung wahrscheinlich für sofortige Repressalien sorgen, vor allem, weil der durchschnittliche Geheimpolizist dümmer ist als seine Zielperson. Der erfahrene Befrager wiederum versucht nicht umgehend, eine Tür einzutreten, die ihm vor der Nase zugeschlagen wird. Stattdessen wird er sich sammeln und sein Ziel aus anderer Richtung angreifen. Nach Bunnys zufriedenem Lächeln zu urteilen, hat er genau das vor.
»Also, Peter.« Trotz meiner Beteuerungen spricht er wieder für Schwerhörige: »Schieben wir für den Augenblick mal die Frage nach der Operation Windfall beiseite, aber würde es Ihnen wohl etwas ausmachen, wenn Laura und ich Ihnen ein paar Hintergrundfragen ganz allgemeiner Art stellen?«
»Und die wären?«
»Es geht um persönliche Verantwortung. Das alte Problem, wo der Gehorsam gegenüber den Befehlen von Vorgesetzten endet und die Verantwortung für das eigene Handeln beginnt. Verstehen Sie, was ich meine?«
»Nicht ganz.«
»Sie sind im Einsatz. Die Zentrale hat Ihnen grünes Licht gegeben, doch läuft nicht alles nach Plan. Das Blut Unschuldiger wird vergossen. Sie oder ein Ihnen nahestehender Kollege stellen fest, dass Sie übers Ziel hinausgeschossen sind. Haben Sie jemals über eine solche Situation nachgedacht?«
»Nein.«
Entweder hat er vergessen, dass ich schwerhörig bin, oder er hat entschieden, dass ich es nicht bin:
»Und Sie, Sie persönlich können sich nicht, rein theoretisch, vorstellen, wie es zu einer solch schwierigen Situation kommen könnte? Wenn Sie so auf die vielen Zwickmühlen zurückblicken, in denen Sie während Ihrer langen Tätigkeit gesteckt haben?«
»Nein. Kann ich nicht. Tut mir leid.«
»Nicht ein einziges Mal, dass Sie den Eindruck hatten, Sie würden Ihre Kompetenz überschreiten und hätten etwas in Gang gebracht, das Sie nicht mehr aufhalten konnten? Dass Sie Ihre eigenen Gefühle, Bedürfnisse – Gelüste gar – über die Pflicht gestellt haben, vielleicht? Mit fatalen Folgen, die Sie nicht beabsichtigt oder vorausgesehen haben?«
»Nun, so was hätte mir ja einen Verweis der Zentrale eingebracht, oder? Oder eine Rückversetzung nach London. Oder in einem besonders schweren Fall den Tritt«, meine ich und runzle disziplinarisch die Stirn.
»Holen Sie mal etwas weiter aus, Peter. Nehmen wir doch mal an, dass es da draußen geschädigte Dritte geben könnte. Ganz normale Personen aus der Außenwelt, die – aufgrund einer von Ihnen begangenen Handlung – aus einem Irrtum heraus, sagen wir mal, im Eifer des Gefechts, oder wenn das Fleisch schwach ist – Kollateralschäden erlitten haben. Personen, die Jahre später, vielleicht gar eine Generation später feststellen, dass sie einen ziemlich saftigen Prozess gegen den Secret Service anstrengen könnten. Entweder um Schadenersatz zu fordern, oder, wenn das nicht funktioniert, um eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung oder Schlimmerem zu erheben. Gegen den Service allgemein oder –«, die Augenbrauen schießen in gespielter Empörung in die Höhe – »einen namentlich bekannten Mitarbeiter. Haben Sie niemals so etwas als Möglichkeit in Betracht gezogen?« – nun klingt er weniger wie ein Anwalt, sondern eher wie ein Arzt, der einen für die wirklich schlechte Neuigkeit schon mal weichklopft.
Lass dir Zeit. Kratz dich mal am alten Kopf. Besser doch nicht.
»Ich hatte wohl zu viel damit zu tun, dem Feind das Leben schwerzumachen, nehme ich an« – dazu das müde Lächeln des Veteranen. »Der Feind vor dir, die Zentrale im Nacken, da bleibt nicht viel Zeit zum Philosophieren.«
»Am einfachsten wäre es für jene Dritten, einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss einsetzen zu lassen und mit Hilfe einer Abmahnung den Weg zu rechtlichen Schritten zu ebnen, ohne aufs Ganze zu gehen.«
Ich krame noch im Gedächtnis, Bunny.
»Wenn erst mal rechtliche Schritte eingeleitet werden, tritt jeder Untersuchungsausschuss beiseite. Damit den Gerichten freie Hand bleibt.« Er wartet, vergeblich, und setzt nach:
»Und Windfall, da klingelt noch immer nichts? Eine verdeckte Operation, die sich über zwei Jahre erstreckte und in der Sie eine wesentliche – manche würden sagen, heldenhafte – Rolle spielten? Und da klingelt nichts?«
Laura stellt mir mit ihren starren braunen Nonnenaugen dieselbe Frage, und ich tue wieder so, als würde ich in meinem Altherrengedächtnis kramen und – verdammich – auf absolut gar nichts stoßen, aber das war ja auch anno Toback, von ihnen aus betrachtet, nehme ich an – dazu ein reumütiges, enttäuschtes Schütteln des weißen Hauptes.
»War das nicht irgendeine Art Trainingseinheit oder so etwas?«, frage ich tapfer.
»Laura hat Ihnen doch gerade gesagt, um was es sich handelte«, erwidert Bunny scharf, und ich mache: »Ach ja, stimmt, hat sie«, und versuche, peinlich berührt zu schauen.
Lassen wir Windfall beiseite und überdenken mal die Aussicht, eine ganz gewöhnliche Person aus der Welt außerhalb würde einen namentlich bekannten ehemaligen Mitarbeiter des Service erst durch das Parlament jagen und ein zweites Mal vor Gericht zubeißen. Allerdings haben wir noch keinen Namen genannt, auch nicht, über welchen ehemaligen Mitarbeiter wir hier sprechen. Wir, weil, falls Sie sich schon jemals einer Befragung unterziehen mussten und sich auf dem heißen Stuhl wiederfanden, zwischen Ihnen und Ihren Inquisitoren eine Art Komplizenschaft besteht: Sie und Ihre Befrager sitzen auf der einen Seite des Tischs und die Belange, die zu diskutieren sind, auf der anderen.
»Nehmen wir doch nur mal Ihre persönliche Akte dazu oder das, was davon noch übrig ist, Peter«, klagt Laura. »Sie ist nicht gesäubert, sie ist filetiert worden. Sicher gab es da sensible Bereiche, die als zu geheim für das allgemeine Archiv angesehen wurden. Darüber kann sich ja niemand beschweren. Dazu sind geheime Bereiche nun mal da. Aber wenn wir im Dienstarchiv nachsehen, was finden wir da? Ein fettes, großes Nichts.«
»Absolut gar nichts«, bekräftigt Bunny zur Klarstellung. »Ihre gesamte Dienstzeit besteht Ihrer Akte zufolge aus einem Haufen von Vernichtungsbescheinigungen.«
»Wenn überhaupt«, merkt Laura an; offenbar ist sie nicht sonderlich erschüttert über diese eher unjuristische Tirade.
»Aber um fair zu sein, Laura« – Bunny wirft sich nun den fadenscheinigen Mantel des guten Bullen über –, »womit wir es hier zu tun haben, könnte auch ohne weiteres das Werk von Bill Haydons bösen Angedenkens sein, oder nicht?« – und dann an mich gerichtet: »Aber vielleicht haben Sie ja auch vergessen, wer Haydon ist.«
Haydon? Bill Haydon. Ich sehe ihn vor mir: von den Sowjets gesteuerter Doppelagent, der als Kopf des allmächtigen Gemeinsamen Lenkungsausschusses im Circus, kurz Joint genannt, drei Jahrzehnte lang dessen Geheimnisse eifrig an die Zentrale in Moskau übermittelt hatte. Er ist auch der Mann, dessen Name mir den Großteil des Tages durch den Kopf spukt, allerdings werde ich nicht aufspringen und brüllen: »Dieser Mistkerl, am liebsten würde ich ihm das Genick brechen« – das hatte im Laufe der Angelegenheit schon ein anderer übernommen, den ich kannte, zur allgemeinen Zufriedenheit der eigenen Seite.
Laura setzt in der Zwischenzeit ihre Unterhaltung mit Bunny fort:
»Oh, daran habe ich nicht den geringsten Zweifel, Bunny. Das gesamte Dienstarchiv weist überall Spuren von Bill Haydon auf. Und Peter hier war einer der Ersten, die ihn aufspürten, richtig, Pete? In Ihrer Rolle als George Smileys persönlicher Assistent. Sein Torwächter und Lieblingsschüler, oder nicht?«
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.