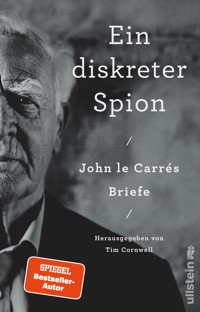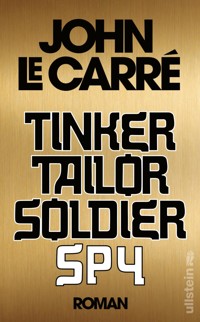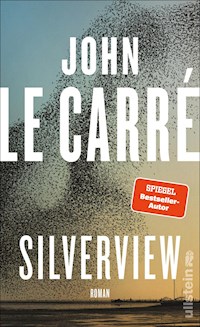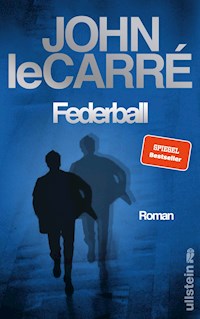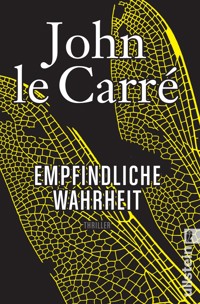16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Alle Romane von John le Carré jetzt als E-Book! - Eine Explosion im Diplomatenviertel zerstört die Villa des israelischen Arbeitsattachés und fordert drei Todesopfer. Ein weiterer grausamer Anschlag in einer Reihe europaweiter Attentate, zu denen sich die Terrorgruppe Palästinensische Agonie bekennt. Für den endgültigen Vernichtungsschlag gegen die Terroristen braucht der israelische Meisterspion Schulmann die Hilfe von Charlie, einer jungen englischen Schauspielerin. Als sie einwilligt, einen mit Sprengstoff beladenen Mercedes durch Jugoslawien zu fahren, gibt es für sie kein Zurück mehr. Um zu überleben, wird sie die Rolle ihres Lebens spielen müssen... Der Bestseller - neu aufgelegt zum 75. Geburtstag von John le Carrè. Große TV-Doku "Der Taubentunnel" ab 20. Oktober 2023 auf Apple TV+
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1060
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Das Buch
Eine Serie von Bombenattentaten auf israelische Diplomaten und Organisationen erschüttert Europa. Nachdem bei einem Anschlag auf die Villa des Arbeits-Attachés in Bonn ein Kind zu Tode gekommen ist und in Holland ein junger Schriftsteller in die Luft gesprengt wurde, entsendet die israelische Regierung eine Expertengruppe. Schulmann, der das Team leitet, ist dem palästinensischen Drahtzieher der Attentate schon seit Jahren auf der Spur und will ihm mit einem riskanten Plan ein für allemal das Handwerk legen: Eine junge englische Schauspielerin, Charlie, soll – mit einer gefälschten Biographie versehen – die Geliebte des Palästinensers mimen und, angeblich in dessen Auftrag, einen Mercedes voll mit Plastiksprengstoff quer durch Jugoslawien steuern. Aus Neugier und Abenteuerlust läßt sie sich auf das gefährliche Spiel ein und gerät zwischen die Fronten eines unbegreiflichen Krieges …
Regisseur Park Chan-wook hat Die Libelle 2018 als Miniserie mit Michael Shannon, Alexander Skarsgård und Florence Pugh in den Hauptrollen verfilmt.
Der Autor
John le Carré, am 19. Oktober 1931 in Poole, Dorset, geboren, war nach seinem Studium in Bern und Oxford in den sechziger Jahren in diplomatischen Diensten u. a. in Bonn und Hamburg tätig. Sein Roman Der Spion, der aus der Kälte kam machte ihn 1963 weltbekannt. Zahlreiche seiner Bestseller wurden erfolgreich verfilmt. Der Autor lebt mit seiner Frau in Cornwall.
In unserem Hause sind von John le Carré bereits erschienen:
Absolute Freunde · Agent in eigener Sache · Dame, König, As, Spion · Das Rußlandhaus · Der ewige Gärtner · Der heimliche Gefährte · Der Nachtmanager · Der Spion, der aus der Kälte kam · Der Schneider von Panama · Der wachsame Träumer · Die Libelle · Ein blendender Spion · Ein guter Soldat · Ein Mord erster Klasse · Eine Art Held · Eine kleine Stadt in Deutschland · Empfindliche Wahrheit · Geheime Melodie · Krieg im Spiegel · Marionetten · Schatten von gestern · Single & Single · Unser Spiel · Verräter wie wir
John le Carré
Die Libelle
Roman
Aus dem Englischenvon Werner Peterich
List Taschenbuch
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Ungekürzte Ausgabe im Ullstein Taschenbuch
Oktober 2006
5. Auflage 2009
© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2006
© für die deutsche Ausgabe Ullstein Heyne List GmbH & Co. KG,
München 2003/List Verlag
© 1983 by David Cornwell
Titel der englischen Originalausgabe: The Little Drummer Girl
(Hodder and Stoughton, London)
© der Übersetzung von Werner Peterich: Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Titelabbildung: © The Little Drummer Girl Distribution Limited
An Ink Factory production for BBC
ISBN 978-3-8437-0853-1
BBC and the BBC logo are trademarks of the British Broadcasting Corporation and are used under licence. BBC logo © BBC 1996.
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
E-Book: CPI – Clausen & Bosse, Leck
TEIL I
Die Vorbereitung
Die Libelle
Es tanzt die schöne Libelle
Wohl auf des Baches Welle;
Sie tanzt daher, sie tanzt dahin,
Die schimmernde, flimmernde Gauklerin.
Gar mancher junge Käfertor
Bewundert ihr Kleid von blauem Flor,
Bewundert des Leibchens Emaille
Und auch die schlanke Taille.
***
O daß ich nie gesehen hätt
Die Wasserfliege, die blaue Kokett
Mit ihrer feinen Taille –
Die schöne, falsche Canaille!
Heinrich Heine
Kapitel 1
Den Beweis brachte der Anschlag in Bad Godesberg, obwohl die deutschen Behörden das nun weiß Gott nicht wissen konnten. Vor Bad Godesberg war zunehmend Verdacht aufgekommen, sehr viel sogar. Aber die ausgesprochen überlegene Planung – im Gegensatz zu der minderwertigen Qualität der Bombe – ließ den Verdacht zur Gewißheit werden. Früher oder später, heißt es im Gewerbe, hinterläßt jeder seine Signatur. Ärgerlich ist nur das lange Warten.
Die Bombe explodierte viel später als vorgesehen, wahrscheinlich gut zwölf Stunden später – am Montagmorgen um acht Uhr sechsundzwanzig. Mehrere stehengebliebene Armbanduhren, die den Opfern gehörten, bestätigten den Zeitpunkt. Wie bei den Vorläufern in den letzten paar Monaten hatte es keine Warnung gegeben. Aber das war auch nicht beabsichtigt. Der israelische Beauftragte für Waffenbeschaffung, der sich auf Reisen in Düsseldorf aufhielt, war mit seinem Auto ohne Vorwarnung in die Luft gesprengt worden, und auch die Organisatoren eines jüdisch-orthodoxen Kongresses in Amsterdam wurden nicht vor der Bombe gewarnt, die man ihnen in einem Buch versteckt geschickt hatte, wobei die Ehrenvorsitzende zerfetzt wurde, während ihre Assistentin verbrannte. Das gleiche galt für die Mülleimerbombe, die vor einer israelischen Bank in Zürich zwei Passanten verstümmelt hatte. Nur bei der Stockholmer Bombe hatte es eine Warnung gegeben, und da stellte sich heraus, daß es sich um eine ganz andere Gruppe handelte, die mit der Serie überhaupt nichts zu tun hatte.
Um acht Uhr fünfundzwanzig war die Drosselstraße in Bad Godesberg eine von Diplomaten bewohnte, baumbestandene Nebenstraße gewesen wie viele andere, von der politischen Bonner Hektik so weit weg, wie man es erwarten kann, wenn man sich nicht weiter als fünfzehn Autominuten entfernt. Es war eine neue, jedoch keineswegs kahle Straße mit üppigen, verschwiegenen Gärten, Dienstbotenzimmern über den Garagen und schmiedeeisernen Sicherheitsgittern vor den Butzenglas-Fenstern. Das Wetter im Rheinland hat den größten Teil des Jahres etwas von der schweißtreibenden Wärme des Dschungels; die Vegetation – wie die Zahl der Botschaftsangehörigen – wächst dort fast so schnell, wie die Deutschen ihre Straßen bauen, und noch etwas rascher, als sie ihre Karten herstellen. Aus diesem Grunde waren die Vorderseiten einiger Häuser bereits halb von dichtgepflanzten Koniferen verdunkelt, die, wenn sie jemals die ihnen zustehende Größe erreichen, vermutlich das ganze Viertel in ein Grimmsches Märchendunkel tauchen werden. Diese Bäume nun erwiesen sich als erstaunlich wirksamer Schutz gegen die Druckwelle, und schon wenige Tage nach dem Anschlag verkaufte ein Gartencenter sie als Spezialität.
Eine ganze Reihe von Häusern hat ein ausgesprochen nationalistisches Aussehen. Die gleich um die Ecke der Drosselstraße liegende Residenz des norwegischen Botschafters zum Beispiel ist ein schmuckloses rotes Backsteinbauernhaus, das geradewegs aus dem Börsenmakler-Umland Oslos hierherverpflanzt zu sein scheint. Das ägyptische Konsulat weiter oben auf der anderen Seite strahlt das verlorene Air einer Villa aus Alexandria aus, die einst bessere Zeiten gesehen hat. Trauervolle arabische Musik dringt nach draußen, und vor ihren Fenstern sind für alle Ewigkeit gegen das Anbranden der nordafrikanischen Hitze die Rolläden heruntergelassen. Es war Mitte Mai, der Tag hatte wunderschön mit sich gemeinsam im leichten Wind wiegenden Blüten und frischem Laub begonnen. Die Magnolienblüte war gerade vorüber, und die traurigen weißen Blütenblätter, die zum größten Teil bereits abgefallen waren, hatten hinterher die Trümmer geziert. Bei so viel Grün drang vom Rauschen des Pendlerverkehrs auf der Autostraße kaum etwas herüber. Der auffälligste Laut bis zur Explosion war noch das Lärmen der Vögel, zu denen ein paar dicke Tauben gehörten; sie hatten eine Vorliebe für jene blaßblaue Glyzine, die der ganze Stolz des australischen Militär-Attachés war. Einen Kilometer weiter im Süden machten von hier aus unsichtbare Lastkähne auf dem Rhein einen behäbigen, tuckernden Laut, den die Bewohner aber nur wahrnehmen, wenn er einmal aussetzt. Kurz, es war ein Morgen, ganz dazu angetan, einem deutlich zu machen, daß Bad Godesberg trotz aller Katastrophen, über die man in den ernsten und überängstlichen westdeutschen Zeitungen las – Wirtschaftsflaute, Geldentwertung, Pleiten und Arbeitslosigkeit, all die üblichen und anscheinend unheilbaren Leiden einer kräftig prosperierenden kapitalistischen Wirtschaft –, ein solider und anständiger Ort war, wo man durchaus leben konnte, und Bonn nicht halb so schlimm, wie es immer hingestellt wurde.
Je nach Nationalität und Rang, waren einige Ehemänner bereits ins Büro gefahren. Doch Diplomaten sind alles mögliche – nur dem Klischee des Diplomaten entsprechen sie nicht. Ein schwermütiger skandinavischer Botschaftsrat zum Beispiel lag noch im Bett und litt unter einem durch eheliche Überbeanspruchung hervorgerufenen Katzenjammer. Ein südamerikanischer Geschäftsträger, angetan mit Haarnetz und seidenem chinesischem Morgenmantel, Ausbeute einer Tour durch Peking, lehnte aus dem Fenster und gab seinem philippinischen Fahrer Anweisungen für den Einkauf. Der italienische Botschaftsrat rasierte sich, war aber dabei nackt. Er liebte es, sich nach dem Bad, aber vor der täglichen Morgengymnastik zu rasieren. Seine vollständig angekleidete Frau war bereits unten und machte ihrer verstockten Tochter Vorhaltungen, am Abend zuvor zu spät nach Hause gekommen zu sein – ein Wortwechsel, zu dem es fast an jedem Morgen der Woche kam. Ein Gesandter von der Elfenbeinküste telefonierte auf der Auslandsleitung und setzte seine Vorgesetzten über seine jüngsten Versuche in Kenntnis, dem zunehmend widerwilligen deutschen Minister Entwicklungshilfe abzuluchsen. Als die Leitung plötzlich tot war, glaubten die Herren in Abidschan, er habe einfach aufgelegt, und schickten ihm ein ätzendes Telegramm, in dem sie nachfragten, ob er vorhabe, seinen Abschied einzureichen. Der israelische Arbeits-Attaché war bereits seit einer Stunde fort. Er fühlte sich in Bonn nicht wohl, und soweit ihm möglich war, arbeitete er gern zu den Jerusalemer Bürozeiten. So nahm es seinen Lauf, und eine Menge ziemlich billiger Nationalitätenwitze fand eine Bestätigung in Wirklichkeit und Tod.
Irgendwo steckt in jedem Bombenattentat auch ein Wunder; in diesem Fall sorgte der amerikanische Schulbus dafür, der gerade gekommen und mit den meisten schulpflichtigen Kindern des Diplomatenviertels wieder abgefahren war, die sich jeden Tag auf dem Wendekreis keine fünzig Meter vom Epizentrum entfernt einfanden. Wie durch eine gnädige Fügung hatte an diesem Montag morgen keines der Kinder seine Hausaufgaben vergessen, keines verschlafen oder eine unüberwindliche Abneigung gegen die Schule bekundet. Die Heckscheiben zersprangen, der Fahrer fuhr in Schlangenlinie über den Rinnstein, eine kleine Französin verlor ein Auge, doch im großen und ganzen kamen die Kinder mit heiler Haut davon, was hinterher als Erlösung empfunden wurde. Denn auch das gehört zu solchen Bombenanschlägen oder zumindest zu dem, was unmittelbar danach geschieht: ein allgemeines hemmungsloses Bedürfnis, die Lebenden zu feiern, statt Zeit damit zu vergeuden, die Toten zu betrauern. Der eigentliche Kummer in solchen Fällen kommt später, wenn der Schock sich gelegt hat, gewöhnlich nach ein paar Stunden, aber gelegentlich auch früher. Der Krach der Explosion selbst war etwas, woran die Leute sich nicht erinnerten, jedenfalls nicht diejenigen, die in der Nähe waren. Auf dem anderen Rheinufer, in Königswinter, wollten sie einen ganzen Krieg gehört haben, gingen mit schlotternden Gliedern und halb taub umher und grinsten sich wie Komplizen beim Überleben an. Diese verfluchten Diplomaten, versicherten sie einander, was war da schon zu erwarten? Man sollte sie allesamt nach Berlin verfrachten, wo sie unsere Steuergelder in Frieden ausgeben können! Nur die in der Nähe hörten zunächst überhaupt nichts. Das einzige, was sie sagen konnten – sofern sie überhaupt etwas sagen konnten –, war, daß die Straße sich geneigt oder ein Schornstein auf der anderen Seite sich lautlos vom Dach gehoben habe oder daß die Druckwelle durch ihr Haus gerast sei, wie sie ihre Haut gespannt, sie angefallen, zu Boden geworfen, die Blumen aus der Vase gerissen und die Vase gegen die Wand geworfen habe. Woran sie sich allerdings erinnerten, das war das Klirren zersplitternden Glases, das zaghaftfegende Geräusch von jungem Laub, das auf die Straße fiel. Und das Wimmern von Menschen, die zu große Angst hatten zu schreien. So daß sie sich offensichtlich nicht so sehr des Krachs bewußt waren als vielmehr der Tatsache, daß der Schock sie ihrer natürlichen Sinneswahrnehmungen beraubt hatte. Nicht wenige Zeugen berichteten auch vom Lärm des Küchenradios beim französischen Botschaftsrat, das laut das Kochrezept des Tages hinausplärrte. Eine Ehefrau, die sich für besonders vernünftig hielt, wollte von der Polizei wissen, ob es möglich sei, daß sich die Lautstärke des Radios durch die Druckwelle erhöht habe. Bei einer Explosion, erwiderten die Beamten behutsam, als sie sie in eine Wolldecke gehüllt fortführten, sei alles möglich, doch in diesem Falle gäbe es eine andere Erklärung. Da die Fensterscheiben beim französischen Botschaftsrat alle herausgedrückt worden seien und niemand im Haus in der Verfassung gewesen sei, das Radio abzustellen, habe nichts es davon abhalten können, einfach auf die Straße hinauszureden. Aber sie verstand es überhaupt nicht.
Die Presse war selbstverständlich bald zur Stelle und zerrte an den Absperrungen; die ersten überschwenglichen Berichte töteten acht und verwundeten dreißig und schoben die Schuld auf eine sonst nicht ernstzunehmende rechts-extremistische deutsche Organisation namens »Nibelungen 5«, die aus zwei geistig zurückgebliebenen Halbwüchsigen und einem verrückten alten Mann bestand, der nicht einmal imstande gewesen wäre, einen Luftballon so weit aufzublasen, daß er platzte. Bis Mittag war die Presse gezwungen, die Zahl der Toten auf fünf zu reduzieren (darunter ein Israeli), die der ernstlich Verwundeten auf vier und zwölf andere, die aus diesem oder jedem Grund ins Krankenhaus eingeliefert worden waren; jetzt war von den italienischen Roten Brigaden die Rede, wofür es jedoch nicht den geringsten Anhaltspunkt gab. Am nächsten Tag vollzogen die Zeitungen nochmals eine Kehrtwendung und schoben den Anschlag dem Schwarzen September in die Schuhe. Noch einen Tag später bekannte sich eine Gruppe, die sich Palästinensische Agonie nannte, zu der Gewalttat – eine Organisation, die sich überzeugend auch zur Urheberschaft der vorangegangenen Bombenanschläge bekannt hatte. Der Name Palästinensische Agonie blieb haften, selbst wenn es sich dabei weniger um einen Namen für die Attentäter handelte als um eine Erklärung für ihr Handeln. Und da erfüllte er auch seinen Zweck, wurde er doch, wie nicht anders zu erwarten war, für die Überschrift so manch eines gedankenschweren Leitartikels aufgegriffen.
Unter den Nicht-Juden, die den Tod fanden, war eine sizilianische Köchin der Italiener, der andere der philippinische Chauffeur. Zu den vier Verwundeten gehörte die Frau des israelischen Arbeits-Attachés, in dessen Haus die Bombe explodiert war. Sie verlor ein Bein. Bei dem getöteten Israeli handelte es sich um ihren kleinen Sohn Gabriel. Doch das Opfer, auf das man es abgesehen hatte, war nicht darunter. Das war vielmehr ein Onkel der verwundeten Frau des Arbeits-Attachés, der zu Besuch aus Tel Aviv in Godesberg war: ein Talmud-Gelehrter, der wegen seiner falkenhaften Ansichten hinsichtlich der Rechte der Palästinenser auf der Westbank mäßig gefeiert wurde. Er glaubte mit einem Wort, sie hätten überhaupt keine Rechte, und verkündete das laut und häufig ohne jede Rücksicht auf die Ansichten seiner Nichte, der Frau des Arbeits-Attachés, die zur ungebundenen, freien israelischen Linken gehörte und deren Kibbuz-Erziehung sie nicht auf den hemmungslosen Luxus des Diplomatendaseins vorbereitet hatte.
Hätte Gabriel im Schulbus gesessen, wäre er gerettet worden, doch Gabriel hatte sich an diesem wie an so vielen anderen Tagen nicht wohl gefühlt. Er war ein wirres, überaktives Kind, das bis zu diesem Tag als Störenfried in der Straße gegolten hatte, besonders während der Zeit der Mittagsruhe. Allerdings war er, wie seine Mutter, musikalisch begabt gewesen, und jetzt war es das Natürlichste von der Welt, daß kein Mensch in der Straße sich an ein Kind erinnern konnte, das man inniger geliebt hätte. Ein rechtsstehendes deutsches Boulevardblatt, das vor pro-jüdischer Einstellung nur so troff, nannte ihn den »Engel Gabriel«, ein Titel, der – was die Redakteure freilich nicht wußten – beiden Religionen bekannt ist, und brachte eine ganze Woche lang völlig aus der Luft gegriffene Geschichten über Gabriels heiligmäßiges Leben. Die seriösen Zeitungen waren nicht frei von Anklängen an diese Einstellung. Das Christentum, so erklärte ein Star-Kolumnist – und zitierte damit Disraeli, ohne seine Quelle preiszugeben –, sei die Vollendung des Judentums, oder es sei gar nichts. So war Gabriel ebensosehr ein christlicher wie ein jüdischer Märtyrer; und besorgten Deutschen war dank dieser Erkenntnis viel wohler in ihrer Haut. Ohne daß dazu aufgerufen worden wäre, wurden von den Lesern Tausende von Mark gespendet, die irgendwie ausgegeben werden mußten. Es war die Rede davon, ein Gabriel-Denkmal zu errichten; von den anderen Toten wurde kaum gesprochen. Der jüdischen Tradition gemäß wurde der beklagenswert kleine Sarg Gabriels sofort nach Israel geflogen, um dort beigesetzt zu werden; seine Mutter, die noch nicht reisefähig war, blieb in Bonn, bis ihr Mann sie begleiten und sie gemeinsam in Jerusalem Schiwah sitzen konnten.
Am frühen Nachmittag des Tages, an dem die Explosion sich ereignet hatte, traf ein Sechs-Mann-Team israelischer Experten aus Tel Aviv ein. Auf deutscher Seite war der umstrittene Dr. Alexis aus dem Innenministerium im weitesten Sinne mit der Untersuchung beauftragt und fuhr pflichtgemäß zum Flugplatz, um die Israelis abzuholen. Alexis war ein kluger, gerissener Bursche, der sein Leben lang darunter gelitten hatte, zehn Zentimeter kleiner zu sein als die meisten seiner Mitmenschen. Aber vielleicht zum Ausgleich für diesen Nachteil war er – sowohl im Privatleben als auch im Beruf – von einer gewissen Unbesonnenheit, und es wurden ihm leicht strittige Dinge angehängt. Er war sowohl Jurist als auch Sicherheitsbeamter und dazu jemand, der um die Macht spielte, ein Typ, wie ihn die Deutschen heutzutage häufig hervorbringen, ein Mann mit gepfefferten liberalen Überzeugungen, die der sozial-liberalen Koalition nicht immer willkommen waren und die er zu ihrem Leidwesen auch noch liebend gern im Fernsehen von sich gab. Sein Vater, davon ging man allgemein aus, war in der Nazizeit irgendwie im Widerstand gegen Hitler gewesen, und dieses Mäntelchen war in diesen veränderten Zeiten etwas, in das der unstete Sohn nicht so recht hineinpaßte. Ganz gewiß gab es in Bonns Glaspalästen jedenfalls Leute, die ihm die für seine Aufgabe nötige Solidität absprachen; daß er sich vor kurzem hatte scheiden lassen – wobei beunruhigenderweise zutage gekommen war, daß er eine um zwanzig Jahre jüngere Geliebte hatte –, war nicht gerade dazu angetan gewesen, ihre Ansichten über ihn zu heben.
Wäre irgend jemand sonst angekommen, Alexis hätte sich nicht die Mühe gemacht, zum Flugplatz zu fahren – in der Presse sollte nicht über die Sache berichtet werden –, aber die Beziehungen zwischen Israel und der Bundesrepublik hatten gerade einen Tiefstand erreicht, und so beugte er sich dem Druck des Ministeriums und fuhr hin. Ganz gegen seine Wünsche koppelte man ihn in letzter Minute mit einem etwas schwerfälligen schlesischen Polizeibeamten aus Hamburg zusammen, einem erklärten Konservativen und Zauderer, der sich auf dem Gebiet der »Studenten-Überwachung« in den siebziger Jahren einen Namen gemacht hatte und als großer Fachmann für Unruhestifter und Bombenleger galt. Ein weiterer Vorwand war, daß er den Israelis sicher sehr genehm wäre; doch wie jedermann sonst wußte auch Alexis, daß er hauptsächlich als Gegengewicht zu seiner Person fungierte. Aber wichtiger war bei den im Augenblick angespannten Beziehungen vielleicht, daß sowohl Alexis als auch der Schlesier »unbelastet« waren – keiner von beiden war alt genug, um auch nur im entferntesten für das verantwortlich zu sein, was die Deutschen bekümmert ihre unbewältigte Vergangenheit nennen. Was immer den Juden heute angetan wurde, Alexis und sein unerwünschter schlesischer Kollege hatten es gestern nicht getan; und Alexis senior auch nicht, falls es noch weiterer Bestätigung bedurfte. Die Presse hob all dies auf Alexis’ behutsame Anweisung hin deutlich hervor. Nur in einem Leitartikel hieß es, solange die Israelis wahllos weiterhin Palästinenserdörfer und -lager bombardierten – wobei nicht nur ein Kind getötet werde, sondern jedesmal Dutzende –, müßten sie eben auf diese Art barbarischer Vergeltung gefaßt sein. Gleich am nächsten Tag erschien eine glühende, wenn auch etwas verworrene Erwiderung des Pressereferenten der israelischen Botschaft. Seit 1961, so schrieb er, sei der Staat Israel ständig das Angriffsziel des arabischen Terrorismus. Die Israelis würden nirgends auf der Welt auch nicht einen einzigen Palästinenser umbringen, wenn man sie nur in Ruhe ließe. Gabriel habe nur aus einem einzigen Grund den Tod gefunden: weil er Jude war. Die Deutschen täten gut daran, sich zu erinnern, daß Gabriel damit nicht allein stehe. Falls sie den Holocaust vergessen hätten – vielleicht erinnerten sie sich an die Olympischen Spiele vor zehn Jahren in München?
Der Redakteur beendete die Korrespondenz und nahm sich einen Tag frei.
Die anonyme Maschine der israelischen Luftwaffe aus Tel Aviv landete am äußersten Ende des Flugfeldes, auf Zoll- und Paßformalitäten wurde verzichtet, und die Zusammenarbeit, die Tag und Nacht durchging, begann sofort. Alexis hatte strikte Anweisungen erhalten, den Israelis nichts abzuschlagen, doch dieser Befehl war überflüssig: Er war Philosemit, und das war allgemein bekannt. Er hatte Tel Aviv den obligatorischen »Liaison«-Besuch abgestattet und war mit gebeugtem Haupt in der Holocaust-Gedenkstätte fotografiert worden. Und was den schwerfälligen Schlesier betrifft – nun, wie er nicht müde wurde, jedem zu versichern, der ihm zuhören wollte, seien sie schließlich alle hinter demselben Feind her, oder etwa nicht? Womit er offensichtlich die Roten meinte. – Wenn auch die Ergebnisse einer ganzen Reihe von Ermittlungen noch ausstanden, war es der gemeinsamen Untersuchungskommission am vierten Tag gelungen, ein überzeugendes vorläufiges Bild dessen zusammenzusetzen, war sich ereignet hatte.
Zunächst einmal konnte man übereinstimmend davon ausgehen, daß für das Haus, welches das Ziel des Anschlags gewesen war, keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden waren, diese nach der zwischen der Botschaft und den Bonner Sicherheitsbehörden geschlossenen Vereinbarung aber auch nicht vorgesehen waren. Das Haus des israelischen Botschafters drei Straßen weiter wurde rund um die Uhr bewacht. Ein grünes Polizeiauto stand davor Wache; ein Metallzaun lief um das Gründstück herum; und jeweils zwei Sicherheitsbeamte, die viel zu jung waren, als daß sie die Ironie der Geschichte, die ihr Hiersein bedeutete, in irgendeiner Weise hätten anfechten können, patrouillierten pflichtschuldigst mit Maschinenpistolen bewaffnet durch den Garten. Für den Botschafter gab es außerdem einen kugelsicheren Wagen und eine Motorrad-Eskorte der Polizei. Er war schließlich Botschafter und Jude zugleich; infolgedessen hieß es, bei ihm doppelt gut achtzugeben. Dagegen ein einfacher Arbeits-Attaché, nun, das war doch wohl etwas anderes, und man soll nicht übertreiben. Sein Haus fiel unter den allgemeinen Schutz der Streifenwagen, die im Diplomatenviertel patrouillierten, und man konnte nichts weiter sagen, als daß das Haus eines Israelis selbstverständlich Gegenstand besonderer Wachsamkeit sei, wie die Fahrtenbücher der Polizei bewiesen. Als weitere Vorsichtsmaßnahme würden die Namen der israelischen Botschaftsangestellten nicht in den offiziellen diplomatischen Listen geführt, aus Angst, man könne zu irgendwelchen impulsiven Taten ermutigen; schließlich war Israel im Augenblick nicht ganz leicht zu verknusen. Politisch gesehen.
Kurz nach acht an besagtem Montagmorgen schloß der Arbeits-Attaché seine Garage auf und untersuchte wie üblich die Radkappen sowie – mit Hilfe eines an einem Besenstiel befestigten Spiegels, den man ihm eigens zu diesem Zweck gegeben hatte – den Unterboden seines Autos. Das wurde von dem Onkel seiner Frau, der mit ihm fuhr, bestätigt. Der Arbeits-Attaché sah auch unter den Fahrersitz, ehe er den Zündschlüssel umdrehte. Diese Vorsichtsmaßregeln waren für alle im Ausland tätigen israelischen Beamten verbindlich eingeführt worden, seit die Bombenattentate angefangen hatten. Er wußte wie alle seine Kollegen, daß es nur etwa vierzig Sekunden dauert, eine gewöhnliche und handelsübliche Radkappe mit Sprengstoff zu füllen, und daß es noch weniger Zeit erfordert, eine Haftbombe unter dem Benzintank zu plazieren. Wie alle seine Kollegen wußte er auch – und das war ihm seit seinem verspäteten Eintritt in den diplomatischen Dienst eingebleut worden –, daß viele Leute ihn mit Freuden in die Luft jagen würden. Froh, daß das Auto in Ordnung war, sagte er seiner Frau und seinem Sohn auf Wiedersehen und fuhr zur Arbeit.
Hinzu kommt noch, daß das Au-pair-Mädchen der Familie, eine über jeden Verdacht erhabene junge Schwedin namens Elke, gemeinsam mit ihrem gleichfalls über jeden Verdacht erhabenen deutschen Freund Wolf, der gerade Urlaub von der Bundeswehr hatte, in den Westerwald gefahren war, um dort eine Woche Urlaub zu machen. Wolf hatte Elke am Sonntagnachmittag mit seinem VW-Kabrio abgeholt, und jeder, der am Haus vorüberkam oder sonst zusah, hätte sehen können, wie sie zum Weggehen gekleidet aus der Vordertür kam, dem kleinen Gabriel einen Abschiedskuß gab und sich fröhlich winkend vom Arbeits-Attaché verabschiedete, der an der Tür stehenblieb, um ihr nachzusehen, während seine Frau, die mit Leidenschaft frisches Gemüse zog, im Garten hinter dem Haus weiterarbeitete. Elke war seit einem Jahr oder noch länger bei der Familie und nach den Worten des Arbeits-Attachés ein beliebtes Mitglied des Haushalts.
Diese beiden Umstände – die Abwesenheit des beliebten Aupair-Mädchens sowie das Fehlen eines besonderen polizeilichen Schutzes – hatten das Attentat möglich gemacht. Und daß es erfolgreich hatte verlaufen können, lag an der verhängnisvollen Gutmütigkeit des Arbeits-Attachés selbst.
Am selben Sonntagabend klingelte es um sechs Uhr – also zwei Stunden nach Elkes Abfahrt –, während der Arbeits-Attaché sich in einem religiösen Disput mit seinem Gast herumschlug und seine Frau wehmütig deutschen Boden bearbeitete, an der Haustür. Einmal. Wie immer spähte der Arbeits-Attaché durch das Guckloch, ehe er aufmachte. Und wie immer griff er, während er hinausspähte, nach seinem Dienstrevolver, obwohl ihm nach den örtlichen Bestimmungen das Tragen von Schußwaffen untersagt war. Doch alles, was er durch die kleine Linse sah, war ein etwa ein- oder zweiundzwanzigjähriges blondes, recht zartes und freundlich aussehendes Mädchen, das neben einem ziemlich abgenutzten grauen Koffer mit den Anhängern einer skandinavischen Fluggesellschaft am Griff vor der Tür stand. Ein Taxi – oder war es eine private Limousine? – wartete hinter ihr auf der Straße; er konnte den Motor laufen hören. Ganz fraglos. Er meinte sogar, sich an das Stottern einer falsch eingestellten Zündung zu erinnern, doch das war später, als er sich an Strohhalme klammerte. So wie er sie beschrieb, war sie ein wirklich nettes Mädchen: ätherisch und sportlich zugleich und mit Sommersprossen um die Nase. Anstelle der üblichen langweiligen Uniform von Jeans und Bluse trug sie ein schlichtes blaues, bis zum Hals zugeknöpftes Kleid und ein seidenes Kopftuch, weiß oder cremefarben, das ihr goldenes Haar vorteilhaft zur Geltung brachte und – wie er beim ersten, herzzerreißenden Gespräch bereitwillig gestand – seinem einfachen Sinn für Anstand schmeichelte. Er legte daher seinen Dienstrevolver wieder in die oberste Kommodenschublade in der Halle, nahm die Sicherheitskette ab und sah sie strahlend an, weil sie bezaubernd war und er selbst schüchtern und riesengroß.
All dies immer noch bei der ersten Vernehmung. Der talmudische Onkel sah und hörte nichts und war als Zeuge völlig unergiebig. Von dem Augenblick an, da er allein gelassen und die Zimmertür zugemacht worden war, scheint er sich ganz im Einklang mit der selbstauferlegten Lebensregel, niemals seine Zeit zu verschwenden, in einen Kommentar der Mischna vertieft zu haben.
Das Mädchen sprach englisch mit Akzent: einem skandinavischen, keinem französischen oder südländischen; sie probierten alle möglichen Akzente bei ihm aus, doch weiter einengen als bis auf Skandinavisch konnten sie es nicht. Zuerst fragte sie, ob Elke zu Hause sei, wobei sie sie nicht Elke nannte, sondern »Ucki«, ein Kosename, den nur ihre engsten Freunde gebrauchten. Der Arbeits-Attaché erklärte ihr, sie sei vor zwei Stunden in Urlaub gefahren; wie schade, ob er helfen könne? Das Mädchen gab sich leicht enttäuscht und sagte, sie werde ein andermal vorbeischauen. Sie sei gerade aus Schweden eingetroffen und habe Elkes Mutter versprochen, Elke diesen Koffer mit Kleidern und Schallplatten zu bringen. Das mit den Platten war ein besonders raffiniertes Detail, da Elke ganz wild auf Pop-Musik war. Inzwischen hatte der Arbeits-Attaché es sich nicht nehmen lassen, sie hereinzubitten, und in seiner Einfalt sogar den Koffer über die Schwelle getragen, etwas, was er sich sein Leben lang nicht verzeihen würde. Ja, selbstverständlich habe er die vielen Ermahnungen gelesen, niemals Pakete von Dritten anzunehmen; jawohl, er wisse genau, daß Koffer beißen könnten. Aber hier handelte es sich um Elkes Freundin Katrin aus ihrer Heimatstadt in Schweden, die den Koffer am selben Tag von Elkes Mutter bekommen hatte! Der Koffer sei ein wenig schwerer gewesen, als er angenommen hatte, doch das hatte er auf die Platten geschoben. Als er Katrin gegenüber fürsorglich bemerkte, der Koffer müsse ja ihren gesamten Gepäckbonus beansprucht haben, erklärte sie, Elkes Mutter habe sie eigens mit dem Auto auf den Stockholmer Flugplatz gebracht, um das Übergewicht zu bezahlen. Es war ein Koffer mit festen Wänden, wie er bemerkte, und er sei nicht nur schwer gewesen, sondern habe sich auch fest gepackt angefühlt. Nein – bewegt habe sich beim Anheben nichts, da sei er ganz sicher. Ein brauner Anhänger, ein Fragment, war erhalten geblieben.
Er hatte dem Mädchen einen Kaffee angeboten, doch sie hatte abgelehnt und erklärt, sie dürfe ihren Fahrer nicht warten lassen. Nicht Taxi. Fahrer. Diesen Punkt hatten die Ermittlungsbeamten fast zu Tode geritten. Er hatte sie gefragt, was sie denn in Deutschland mache, und sie hatte erwidert, sie hoffe, sich als Theologiestudentin an der Universität Bonn einschreiben zu können. Aufgeregt hatte er nach einem Schreibblock gesucht, dann nach einem Bleistift, und sie aufgefordert, ihren Namen und ihre Adresse zu hinterlassen; sie hatte ihm jedoch beides zurückgegeben und lächelnd gesagt: »Sagen Sie nur, ›Katrin‹ war hier, dann weiß sie schon Bescheid.« Sie wohne im evangelischen Mädchenwohnheim, erklärte sie, doch das nur für kurze Zeit, denn sie sehe sich nach einem Zimmer um. (Ein solches Wohnheim gibt es in Bonn; noch ein raffiniertes, auf Genauigkeit verweisendes Detail.) Sobald Elke aus dem Urlaub zurück sei, sagte sie, werde sie wieder vorbeikommen. Vielleicht könnten sie ihren Geburtstag zusammen feiern. Das hoffe sie. Wirklich. Der Arbeits-Attaché schlug vor, sie könnten ja eine Party für Elke und ihre Freunde geben, vielleicht ein Käse-Fondue, das er selbst vorbereiten könne. Denn meine Frau – wie er hinterher immer wieder rührend wiederholte – ist eine Kibbuznik, Sir, und hat mit der feinen Küche nicht viel im Sinn.
Hier etwa begann von der Straße her das Hupen des Wagens oder Taxis. Lage etwa mittleres C., mehrere kurze helle Töne, drei ungefähr. Sie schüttelten sich die Hand, und sie gab ihm den Schlüssel. Dabei bemerkte der Arbeits-Attaché zum erstenmal, daß sie weiße Baumwollhandschuhe trug, doch sei sie die Art Mädchen gewesen und der Tag stickig, wenn man einen schweren Koffer schleppt. Infolgedessen weder die Handschrift noch Fingerabdrücke auf dem Block, und auf Koffer und Schlüssel auch nicht. Die ganze Begegnung hatte, wie der arme Mann hinterher schätzte, fünf Minuten gedauert. Länger nicht, wegen des Fahrers. Der Arbeits-Attaché hatte ihr nachgesehen, wie sie den Gartenweg hinunterging – eine hübsche Art zu gehen, sexy, ohne bewußt aufreizend zu sein. Er hatte die Tür geschlossen, gewissenhaft die Sicherheitskette wieder vorgelegt und dann den Koffer in Elkes Zimmer getragen, das im Erdgeschoß lag, und ihn auf das Fußende des Bettes gelegt, wobei er fürsorglich noch daran gedacht hatte, ihn flach hinzulegen, weil das besser für die Kleider und die Platten sei. Den Schlüssel hatte er obendrauf gelegt. Seine Frau, die im Garten unverdrossen harte Erde mit der Hacke bearbeitete, hatte nichts gehört, und als sie später hereingekommen war, um sich zu den beiden Männern zu setzen, hatte ihr Mann vergessen, ihr davon zu erzählen.
Hier kam es zu einer kleinen und sehr menschlichen Richtigstellung.
Vergessen? fragten die israelischen Ermittler ungläubig. Wie es denn möglich sei, solche häuslichen Umstände, bei denen es um eine Freundin von Elke aus Schweden ging, einfach zu vergessen? Wo der Koffer doch auf dem Bett gelegen habe?
Der Arbeits-Attaché brach abermals zusammen und gab zu, nein, vergessen habe er die Sache eigentlich nicht.
Dann was? fragten sie.
Es sei mehr … es sah so aus … als ob er – auf seine einsame, innere Weise – zu dem Schluß gekommen sei, gesellschaftliche Dinge hätten im Grunde aufgehört, seine Frau im geringsten zu interessieren, Sir. Ihr einziger Wunsch sei es, in ihren Kibbuz zurückzukehren und frei und ohne das alberne diplomatische Getue mit Menschen zu verkehren. Anders ausgedrückt – nun, das Mädchen war so hübsch, Sir – nun, vielleicht täte er besser daran, sie für sich zu behalten. Und was den Koffer betrifft, nun, meine Frau geht nie in Elkes Zimmer, verstehen Sie – ging, meine ich –, Elke kümmert sich selbst um ihr Zimmer.
Und der Talmud-Gelehrte, der Onkel Ihrer Frau?
Dem hatte der Arbeits-Attaché auch nichts gesagt. Von beiden bestätigt.
Sie schrieben es kommentarlos hin: sie für sich zu behalten. Wie ein Geisterzug, der plötzlich von den Gleisen verschwindet, hatte damit der Gang der Ereignisse ein Ende. Elke, der Wolf tapfer zur Seite stand, wurde nach Bonn zurückgeholt und kannte keine Katrin. Elkes Privatleben wurde durchforstet, doch das brauchte seine Zeit. Ihre Mutter hatte weder einen Koffer geschickt, noch wäre sie im Traum darauf gekommen, so etwas zu tun – was die Musik betreffe, so habe sie etwas gegen den schlechten Geschmack ihrer Tochter, erzählte sie der schwedischen Polizei; nie würde sie auf den Gedanken kommen, sie darin auch noch zu bestärken. Wolf kehrte untröstlich zu seiner Einheit zurück und wurde ermüdenden, aber richtungslosen Verhören des militärischen Abwehrdienstes unterworfen. Ein Taxichauffeur meldete sich nicht, obgleich ihn Polizei und Presse in ganz Deutschland aufforderten, sich zu melden, und ihm in absentia eine Menge Geld für seine Geschichte geboten wurde. In den Passagierlisten, Computern und Datenbänken der anderen deutschen Flugplätze, von Köln ganz zu schweigen, fand sich keine passende Reisende aus Schweden oder sonstwoher. Beim Arbeits-Attaché klingelte es nicht beim Anblick von Fahndungsfotos der bekannten und unbekannten Terroristinnen samt dem Troß der »Halb-Illegalen«; dabei war er fast wahnsinnig vor Kummer und hätte jedem geholfen, um nur irgend etwas zu tun, und sei es nur, um selbst das Gefühl zu haben, zu etwas nutze zu sein. Er konnte sich weder daran erinnern, was für Schuhe das Mädchen angehabt, noch ob sie Lippenstift, Parfüm oder Mascara benutzt habe, ob ihr Haar gebleicht gewesen sei oder sie womöglich gar eine Perücke getragen habe. Wie komme er, so ließ er durchblicken – er, der von seiner Ausbildung her Wirtschaftswissenschaftler sei, in jeder Beziehung sonst ein treu- und warmherziger Bursche, der verheiratet sei und sich außer für Israel und die Familie nur noch für Brahms interessierte –, wie komme er dazu, etwas vom Haarfärben zu verstehen?
Jawohl, daran erinnere er sich: Sie habe gute Beine und einen sehr weißen Hals gehabt. Und lange Ärmel, ja; sonst wären ihm ihre Arme aufgefallen. Jawohl, einen Petticoat oder ähnliches; sonst hätte er bei dem Sonnenlicht hinter ihr draußen wohl die Körperumrisse wahrgenommen. Einen BH? – Vielleicht nicht. Sie habe einen kleinen Busen gehabt und sehr gut ohne auskommen können. Lebende Modelle wurden für ihn angezogen. Er muß sich hundert verschiedene blaue Kleider angesehen haben, die alle möglichen Kaufhäuser aus ganz Deutschland schickten, aber er konnte sich um alles auf der Welt nicht daran erinnern, ob Kragen und Ärmelbündchen von anderer Farbe gewesen waren; so groß seine innere Qual auch war, sie half seinem Gedächtnis nicht auf die Sprünge. Je mehr sie ihn fragten, desto mehr vergaß er. Die üblichen Zufallszeugen bestätigten zwar Teile seiner Aussage, hatten aber nichts von Belang hinzuzufügen. Den Polizeistreifen war der Zwischenfall vollkommen entgangen; vermutlich war die Übergabe der Bombe zeitlich darauf abgestimmt gewesen. Der Koffer hätte von zwanzig verschiedenen Marken sein können. Beim Wagen oder Taxi hatte es sich um einen Opel gehandelt oder um einen Ford; er war grau gewesen, nicht besonders sauber und weder alt noch neu. Bonner Nummernschild? Nein, aus Siegburg. Ja, mit Taxizeichen auf dem Dach. Nein, ein Schiebedach, und jemand hatte Musik herauskommen hören, doch welches Programm, konnte nicht festgestellt werden. Jawohl, eine Antenne. Nein, keine. Beim Fahrer hatte es sich um einen Nordeuropäer gehandelt, möglicherweise auch um einen Türken. So was hatten Türken schon getan.
Glattrasiert, aber mit Lippenbart und dunklem Haar. Nein, blond. Leicht gebaut; könnte eine als Mann verkleidete Frau gewesen sein. Jemand war sicher, daß an der Heckscheibe ein kleiner Schornsteinfeger gebaumelt hatte. Könnte aber auch ein Aufkleber gewesen sein. Jawohl, ein Aufkleber. Jemand behauptete, der Fahrer habe einen Anorak getragen. Möglicherweise aber auch einen Pullover. An diesem toten Punkt schien die Gruppe der israelischen Experten in eine Art kollektiven Komas zu verfallen. Sie wurden lethargisch, kamen spät und gingen früh und verbrachten viel Zeit in ihrer Botschaft, wo sie offenbar neue Anweisungen erhielten. Tage vergingen, und Alexis kam zu dem Schluß, daß sie auf etwas warteten. Die Zeit totschlugen, aber doch irgendwie da waren. Unter Dampf standen und sich doch in Geduld faßten, so wie es Alexis viel zu oft selbst ging. Er besaß einen ungewöhnlich guten Riecher, solche Dinge lange vor seinen Kollegen zu erkennen. Wenn er versuchte, sich in Juden hineinzuversetzen, meinte er, in einem erlauchten Vakuum zu leben. Am dritten Tag stieß ein breitgesichtiger älterer Mann, der sich Schulmann nannte, zu dem Ermittlungsteam; begleitet wurde er von einem sehr dünnen Assistenten, der höchstens halb so alt war wie er. Alexis sah in ihnen einen jüdischen Caesar und seinen Cassius.
Das Eintreffen von Schulmann und seinem Adlatus bedeutete für den guten Alexis eine nicht geringe Befreiung von der aufgestauten Wut über seine eigene Ermittlung und von der Lästigkeit, überall den schlesischen Polizeibeamten auf den Fersen zu haben, der zunehmend das Verhalten eines Nachfolgers statt dem eines Assistenten an den Tag legte. Als erstes fiel ihm bei Schulmann auf, daß er die Temperatur der israelischen Expertengruppe augenblicklich ansteigen ließ. Bis zu Schulmanns Eintreffen hatten die sechs Männer den Eindruck gemacht, als fehlte ihnen etwas. Sie waren höflich gewesen, hatten keinen Alkohol getrunken, hatten ihre Netze ausgespannt und untereinander den dunkeläugigen orientalischen Zusammenhalt einer Kampfgruppe bewahrt. Ihre Selbstbeherrschung konnte Außenstehende ganz schön aus der Fassung bringen, und als der umständliche Schlesier bei einem schnellen Mittagessen in der Kantine auf den Gedanken verfiel, Witze über koscheres Essen zu machen, sich herablassend über die Schönheiten ihrer Heimat auszulassen, und sich dann auch noch gestattete, sehr abfällig über die Qualität israelischen Weins zu sprechen, nahmen sie diese Huldigung mit einer Höflichkeit auf, von der Alexis wußte, daß sie sie Blut kostete. Selbst als er fortfuhr, über die Wiederbelebung der jüdischen Kultur in Deutschland sowie die geschickte Art zu reden, mit der die neuen Juden die Grundstückspreise in Frankfurt und Berlin in die Höhe getrieben hätten, hielten sie ihre Zunge noch im Zaum, obwohl die finanziellen Machenschaften von Schtetl-Juden, die dem Ruf nach Israel nicht gefolgt waren, sie insgeheim genauso abstießen wie die Plumpheit ihrer Gastgeber. Dann jedoch, als Schulmann da war, wurde plötzlich alles auf ganz andere Weise klar. Er war der Anführer, auf den sie gewartet hatten: Schulmann aus Jerusalem, dessen Ankunft ein paar Stunden im voraus durch einen verwirrten Anruf von der Zentrale in Köln angekündigt worden war.
»Sie schicken einen besonderen Spezialisten. Der wird sich schon bei Ihnen melden.«
»Spezialist für was?« hatte Alexis wissen wollen, der es sich – ganz untypisch für einen Deutschen – zur Regel gemacht hatte, etwas gegen Leute mit besonderen Qualifikationen zu haben.
Keine Auskunft. Doch dann war er da – für Alexis’ Empfinden kein Spezialist, sondern der breitstirnige, betriebsame Veteran einer jeden Schlacht seit den Thermopylen, zwischen vierzig und neunzig Jahren alt, vierschrötig, slawisch und kräftig und weit mehr Europäer als Hebräer, mit mächtigem Brustkorb, dem weitausgreifenden Schritt eines Ringers und der Begabung, jeden zu beruhigen; und dazu dieser quirlige Gehilfe, der überhaupt nicht erwähnt worden war. Vielleicht doch kein Cassius, sondern eher der Urtyp des dostojewskischen Studenten: halb verhungert und im Kampf mit den Dämonen. Wenn Schulmann lächelte, durchzogen Runzeln sein Gesicht, in Jahrhunderten von Wasser eingegraben, das immer dieselben Felsrinnen heruntergeflossen war; und die Augen waren schmal zusammengekniffen wie die eines Chinesen. Dann, lange nach ihm, lächelte auch sein Adlatus und gab echogleich irgendeine verdrehte tiefe Bedeutung wieder. Wenn Schulmann jemanden begrüßte, kam sein ganzer rechter Arm wie ein seitlicher Schwinger auf einen zugeschossen, so schnell, daß – falls man ihn nicht vorher abfing –, einem die Puste wegblieb. Bei dem Adlatus hingen dagegen die Arme an der Seite herunter, als ob er sich nicht traute, sie allein loszulassen. Wenn Schulmann redete, feuerte er sich widersprechende Gedanken wie eine breitgestreute Geschoßgarbe ab, um dann abzuwarten, welche ankamen und welche zu ihm zurückkehrten. Die Stimme des Adlatus folgte ihnen wie Bahrenträger, die mitfühlend die Gefallenen einsammeln.
»Ich bin Schulmann. Freut mich, Sie kennenzulernen, Dr. Alexis«, sagte Schulmann in einem fröhlichen Englisch mit Akzent.
Nur Schulmann.
Kein Vorname, kein Rang, kein akademischer Titel, weder Aufgabenbereich noch Beruf. Und der Student hatte überhaupt keinen Namen, zumindest nicht für Deutsche. Kein Name, kein unverbindliches Geplauder und kein Lächeln. Ein Anführer, das war Schulmann, wie Alexis ihn sah; ein Hoffnungsbringer, ein Preßlufthammer, ein Aufgabenbewältiger ganz besonderer Art; ein angeblicher Spezialist, der ein Zimmer für sich allein brauchte und auch noch am selben Tag bekam – dafür sorgte schon der Adlatus. Bald hörte man Schulmann unablässig hinter geschlossenen Türen reden; sein Ton hatte etwas von einem Anwalt von außerhalb, der ihre bisher geleistete Arbeit genau unter die Lupe nahm und bewertete. Man brauchte kein Hebraist zu sein, um die Warums und Wiesos, die Wanns und Warum-nichts herauszuhören. Ein Improvisator, dachte Alexis: selber ein geborener Stadtguerilla. Wenn er schwieg, hörte Alexis das auch und fragte sich, was zum Teufel er denn plötzlich so Interessantes las, daß sein Mundwerk aufhörte zu arbeiten. Oder beteten sie? – War so was bei ihnen denkbar? Es sei denn natürlich, der Adlatus war an der Reihe, etwas zu sagen; in diesem Fall würde Alexis nicht das kleinste Gewisper mitbekommen, denn im Beisein von Deutschen besaß seine Stimme genauso wenig Volumen wie sein Körper.
Mehr als alles andere bekam Alexis jedoch Schulmanns Drängen mit. Er war so etwas wie ein wandelndes Ultimatum, jemand, der den Druck, unter dem er selbst stand, an seine Mitarbeiter weitergab und der ihren Bemühungen etwas fast unerträglich Verzweifeltes gab. Wir können es schaffen, aber wir können auch scheitern, sagte er in der lebhaften Phantasie von Alexis. Wir sind zu lange zu spät gekommen. Schulmann war ihr Impresario, ihr Manager, ihr General – alles in einem –, aber er seinerseits erhielt auch eine Menge Befehle. So jedenfalls sah Alexis ihn und lag damit gar nicht mal so falsch. Er erkannte es an der harten und fragenden Art, wie Schulmanns Männer ihn ansahen, nicht wegen irgendwelcher Einzelheiten ihrer Arbeit, sondern in Hinblick auf den Fortschritt, den man erzielte – nützt das was, ist das ein Schritt in die richtige Richtung? Er erkannte es an Schulmanns Art, wie er gewohnheitsmäßig den Jackenärmel zurückschob, wenn er den linken Unterarm packte und dann das Handgelenk herumriß, als gehöre es jemand anderm, bis das Ziffernblatt seiner alten Stahluhr ihn anstarrte. Also ist Schulmann auch eine Frist gesetzt worden, dachte Alexis: auch unter ihm tickt eine Zeitbombe; der Adlatus hat sie in der Aktenmappe.
Das Zusammenspiel zwischen den beiden Männern faszinierte Alexis, war in seinem Streß eine willkommene Ablenkung für ihn. Als Schulmann einen Gang durch die Drosselstraße unternahm und in den gefährlichen Trümmern des in die Luft gesprengten Hauses stand, klagend den Arm hochwarf, seine Uhr betrachtete und so außer sich zu sein schien, als ob es sein eigenes Haus gewesen wäre, hielt sich der Adlatus in seinem Schatten wie sein Gewissen, die knochigen Hände entschlossen an die Hüften gepreßt, während er seinen Herrn und Meister mit dem geflüsterten Ernst seiner Überzeugungen zurückzuhalten schien. Als Schulmann den Arbeits-Attaché zu einem letzten Gespräch zu sich bat und die Unterredung zwischen ihnen, die durch die Zwischenwand ohnehin halb zu verstehen war, sich zu einem Schreien steigerte und dann zu einem Gemurmel wie im Beichtstuhl wurde, war es der Adlatus, der den gebrochenen Mann aus dem Zimmer führte und persönlich wieder der Obhut seiner Botschaft anvertraute. Auf diese Weise bestätigte sich eine Theorie, mit der Alexis von Anfang an geliebäugelt hatte, doch die zu verfolgen Köln ihm auf jeden Fall strikt untersagt hatte. Alles deutete darauf hin. Die eifernde, introvertierte Ehefrau, die nur von ihrer heiligen Erde träumte; das erschreckende Schuldbewußtsein des Arbeits-Attachés; das absurd übertriebene Getue, mit dem er das Mädchen Katrin empfangen und sich in Elkes Abwesenheit geradezu zu deren stellvertretendem Bruder hochstilisiert hatte; sein merkwürdiges Eingeständnis, er habe zwar Elkes Zimmer betreten, doch seine Frau würde das nie tun. Für Alexis, der sich zu seiner Zeit durchaus in ähnlichen Situationen befunden hatte und sich gerade in einer solchen befand – schuldgebeutelte Nerven, die bei jedem kleinen sexuellen Hauch vibrierten –, durchzogen diese Zeichen deutlich die gesamte Akte, und insgeheim bereitete es ihm Genugtuung, daß Schulmann sie auch gelesen hatte. Aber wenn Köln in dieser Hinsicht unerbittlich war, so gebärdete Bonn sich nahezu hysterisch. Der Arbeits-Attaché war ein öffentlicher Held: der Vater, der einen schmerzlichen Verlust erlitten hatte, der Mann einer schrecklich verstümmelten Frau. Er war das Opfer einer antisemitischen Untat auf deutschem Boden; er war ein in Bonn akkreditierter israelischer Diplomat, per definitionem so ehr- und achtbar wie nur jeder denkbare Jude. Wer waren denn die Deutschen, daß ausgerechnet sie, so legten sie ihm nahe zu berücksichtigen, einen solchen Mann als Ehebrecher hinstellten? Noch am selben Abend folgte der völlig aufgewühlte Arbeits-Attaché seinem Kind nach Israel, und die Nachrichtensendungen des Fernsehens brachten in ganz Deutschland eine Aufnahme, wie er mit stämmigem Rücken mühselig die Gangway hinaufstieg, während der allgegenwärtige Alexis – den Hut in der Hand – ihm mit versteinerter Hochachtung nachblickte.
Manches von dem, was Schulmann unternahm, kam Alexis erst zu Ohren, nachdem das israelische Team wieder heimgeflogen war. So kam er zum Beispiel fast, wenn auch nicht ganz, durch Zufall dahinter, daß Schulmann und sein Adlatus das Mädchen Elke unabhängig von den deutschen Ermittlern aufgesucht und sie zu nachtschlafender Zeit bewogen hatten, ihre Abreise nach Schweden zu verschieben, damit sie sich ganz aus freien Stücken und wohlbezahlt zu einer vertraulichen Unterhaltung zu dritt bereitfinde. Sie hatten einen ganzen Nachmittag damit verbracht, sie in einem Hotelzimmer in die Mangel zu nehmen, und brachten sie dann, ganz im Gegensatz zu ihrer Sparsamkeit, wenn es um gesellschaftliche Dinge auf anderen Gebieten ging, munter mit einem Taxi zum Flughafen. All dies – so vermutete Alexis – mit dem Ziel, herauszubekommen, wer ihre richtigen Freunde waren und mit wem sie es trieb, wenn ihr Freund sich wieder sicher in der Obhut der Bundeswehr befand. Und woher sie das Marihuana und die Amphetamine bezog, die sie in den Trümmern ihres Zimmers gefunden hatten. Oder – was wahrscheinlicher war – von wem sie sie hatte und in wessen Armen sie gern lag und über sich und ihre Arbeitgeber redete, wenn sie wirklich angetörnt und entspannt war. Darauf kam Alexis zum Teil deshalb, weil inzwischen seine eigenen Leute ihm ihren vertraulichen Bericht über Elke gebracht hatten, und die Fragen, die er Schulmann zuschrieb, waren dieselben, die er ihr gern selbst gestellt hätte, wenn Bonn ihm nicht einen Maulkorb umgehängt und »Hände weg« geschrien hätte.
Keinen Schmutz, sagten sie weiterhin. Erst mal soll Gras darüber wachsen. Und Alexis, der inzwischen ums eigene Überleben kämpfte, nahm den Hinweis auf und hielt den Mund, weil mit jedem Tag, der verging, die Aktien des Schlesiers zum Nachteil seiner eigenen stiegen.
Trotzdem hätte er gutes Geld für die Art von Antworten gegeben, die Schulmann ihr mit seinem wahnsinnigen und erbarmungslosen Drängen zwischen Blicken auf sein altmodisches Monstrum von Uhr abgeluchst hatte: für das gezeichnete Porträt des virilen arabischen Studenten oder des Junior-Attachés vom äußeren Rand des diplomatischen Dienstes zum Beispiel – oder war es ein Kubaner gewesen? –, mit reichlich Geld und den richtigen kleinen Päckchen Stoff und einer unerwarteten Bereitschaft zuzuhören. Viel später, als es längst zu spät war, um noch eine Rolle zu spielen, erfuhr Alexis auch – über den schwedischen Geheimdienst, der gleichfalls angefangen hatte, sich für Elkes Liebesleben zu interessieren –, daß Schulmann und sein Adlatus in den frühen Morgenstunden, als andere schliefen, eine Sammlung von Fotos möglicher Kandidaten zusammengebracht hatten. Und daß Elke darunter einen herausgepickt hatte, dem Vernehmen nach Zypriot, den sie nur mit Vornamen gekannt hatte – Marius –; er hatte von ihr verlangt, daß sie ihn französisch aussprach. Und daß sie ihnen eine entsprechende, formlose Erklärung unterschrieben hatte – »Ja, das ist der Marius, mit dem ich geschlafen habe« –, die sie, wie sie ihr zu verstehen gegeben hatten, für Jerusalem brauchten. Warum mochten sie das getan haben? überlegte Alexis. Um damit irgendwie Schulmanns Frist weiter hinauszuschieben? Als Sicherheit, um daheim in der Zentrale Kredit herauszuschlagen? Alexis verstand diese Dinge. Und je mehr er darüber nachdachte, desto größer wurde das Gefühl innerer Verwandtschaft, kameradschaftlichen Einvernehmens mit Schulmann. Du und ich, wir sind vom selben Stamm, hörte er sich förmlich denken. Wir rackern uns ab, wir fühlen, wir erkennen.
Alexis spürte all dies ganz tief und mit großem Selbstbewußtsein.
Die obligatorische Schlußbesprechung fand im Vortragssaal statt, in dem der unbeholfene Schlesier den Vorsitz über dreihundert Stühle führte, von denen die meisten leer waren; auf ihnen verteilten sich jedoch die beiden Gruppen, die deutsche und die israelische, die wie die Familien bei einer Trauung zu beiden Seiten des Mittelgangs der Kirche zusammenhockten. Die Zahl der Deutschen war durch Beamte aus dem Innenministerium und einiges Stimmvieh aus dem Bundestag verstärkt worden; die Israelis hatten den Militär-Attaché aus der Botschaft dabei, doch ein paar aus ihrem Team, darunter Schulmanns ausgemergelter Adlatus, waren bereits nach Tel Aviv zurückgekehrt – zumindest behaupteten das seine Kollegen. Der Rest versammelte sich um elf Uhr vormittags vor einer mit einem weißen Tuch bedeckten Tafel, auf der die verräterischen Überbleibsel der Explosion wie archäologische Funde nach einer langen Grabung ausgestellt waren, ein jedes mit einem maschinebeschrifteten Etikett versehen. Daneben konnte man an einer Pinwand die üblichen Schreckensbilder betrachten – in Farbe, um möglichst wirklichkeitsgetreu zu sein. An der Tür ein hübsches Mädchen, das allzu reizend lächelte, als es den Teilnehmern Plastikhefter mit Hintergrundmaterial überreichte. Hätte sie Bonbons oder Eis ausgeteilt, es würde Alexis nicht überrascht haben. Die Deutschen unterhielten sich lebhaft und renkten sich nach allem, einschließlich der Israelis, die ihrerseits das tiefe Schweigen jener bewahrten, für die jede vergeudete Minute ein Martyrium bedeutete, den Hals aus. Nur Alexis – dessen war er sich sicher – begriff und teilte ihre heimliche Qual, worauf immer sie auch beruhen mochte. Wir sind einfach zuviel, dachte er. Wir sind es, um die es eigentlich geht. Bis vor einer Stunde hatte er erwartet, selber den Vorsitz zu führen. Er hatte erwartet, knapp und bündig zu sagen, was zu sagen war, hatte sich insgeheim sogar schon ein munteres englisches »Thank you, gentlemen« zurechtgelegt, um danach zu verschwinden. Doch die hohen Herren hatten ihre Entscheidungen getroffen und wollten den Schlesier zum Frühstück, Mittag- und Abendessen; Alexis wollten sie nicht, nicht einmal zum Kaffee. Infolgedessen drückte er sich, die Arme vor der Brust verschränkt, auffällig im Hintergrund herum und bekundete nach außen hin ein sorgloses Interesse, während er innerlich schäumte und versuchte, sich in die Lage der Juden hineinzuversetzen. Als alle bis auf Alexis saßen, hatte der Schlesier seinen Auftritt, und zwar mit jenem besonderen beckenbetonten Gang, den ein gewisser Typ von Deutschen nach Alexis’ Erfahrung annahm, wenn er ein Rednerpult bestieg. Hinter ihm trottete ein verschüchterter junger Mann in weißem Kittel, beladen mit einem Duplikat des nunmehr berühmten abgewetzten grauen Koffers samt den Anhängern der skandinavischen Luftfahrtgesellschaft, den er wie eine Opfergabe auf das Podium legte. Als Alexis sich nach seinem Helden Schulmann umsah, entdeckte er ihn ziemlich weit hinten allein auf einem Platz neben dem Mittelgang. Er hatte Jacke und Schlips abgelegt und trug eine bequeme Hose, die wegen seines mächtigen Leibesumfangs ein wenig zu hoch über seinen unmodernen Schuhen endete. Die stählerne Armbanduhr blinkte am gebräunten Handgelenk; das Weiß seines Hemdes vor der wettergegerbten Haut verlieh ihm das wohlwollende Aussehen von jemandem, der im Begriff steht, in die Ferien zu fahren. Bleib noch etwas, und ich komme mit, dachte Alexis sehnsüchtig und mußte an die wenig erfreuliche Unterredung mit den hohen Herren denken.
Der Schlesier sprach englisch, »mit Rücksicht auf unsere israelischen Freunde«. Doch auch, wie Alexis vermutete, mit Rücksicht auf jene seiner Anhänger, die gekommen waren, um zu begutachten, wie ihr Champion sich mache. Der Schlesier hatte den obligaten Ausbildungskurs in Subversionsbekämpfung in Washington gemacht und sprach daher das verhunzte Englisch eines Astronauten. In der Einführung ließ er sie wissen, die furchtbare Tat sei das Werk »radikaler linker Elemente«, und als er auf die »übertriebene sozialistische Nachsicht der heutigen Jugend gegenüber« anspielte, kam von den Sitzen der Parlamentarier ein gewisses zustimmendes Stühlerücken. Nicht einmal unser geliebter Führer hätte es besser ausdrücken können, dachte Alexis, ließ sich äußerlich jedoch nichts anmerken. Aus baulichen Gründen sei die Sprengwirkung in die Höhe gegangen, sagte der Schlesier und wandte sich einer graphischen Darstellung zu, die sein Assistent hinter ihm entrollte, habe praktisch den Mittelteil des Hauses sauber herausgetrennt und das Kinderzimmer mitgerissen. Kurz gesagt ein Riesenknall, dachte Alexis erregt, warum das also nicht sagen und dann den Mund halten. Aber der Schlesier hielt nichts von Mundhalten. Nach den besten Schätzungen müsse es sich um fünf Kilo Sprengstoff gehandelt haben. Die Mutter sei mit dem Leben davongekommen, weil sie sich gerade in der Küche aufgehalten habe. Bei der Küche handele es sich um einen Anbau. Die plötzliche und unvermutete Verwendung eines deutschen Wortes rief – zumindest bei den Deutschsprechenden – eine eigentümliche Verlegenheit hervor.
»Was ist Anbau auf englisch?« erkundigte der Schlesier sich brummig bei seinem Assistenten, was zur Folge hatte, daß alle sich gerade hinsetzten und im Geist nach der Übersetzung suchten.
»Annexe«, rief Alexis vor den anderen und handelte sich damit ein gewisses gequältes Lachen von den Wissenden und weniger gequälte Verärgerung vom Klub der Anhänger des Schlesiers ein.
»Annexe«, wiederholte also der Schlesier in seinem besten Englisch, ging stillschweigend über die unwillkommene Hilfe hinweg und mühte sich blindlings weiter.
Im nächsten Leben werde ich Jude oder Spanier oder Eskimo oder ein radikaler Anarchist wie alle Welt auch, beschloß Alexis. Bloß nicht Deutscher – das tut man nur einmal, aus Buße, aber damit hat sich’s auch. Nur ein Deutscher bringt es fertig, ein totes jüdisches Kind als Vorwand zu benutzen, um eine Antrittsrede zu halten.
Der Schlesier redete über den Koffer. Billig und häßlich, die Art, wie vor allem Un-Personen wie Gastarbeiter und Türken sie bevorzugten. Und Sozialisten, hätte er hinzufügen können. Wer sich dafür interessiere, könne das in den Unterlagen nachlesen oder sich die übriggebliebenen Teile des Stahlrahmens auf dem Tisch ansehen. Man konnte aber auch zu dem Schluß kommen – einem Schluß, zu dem Alexis schon vor langer Zeit gekommen war –, daß sowohl Bombe als auch Koffer eine Sackgasse darstellten. Nur konnten sie sich der Rede des Schlesiers nicht entziehen, denn es war nun mal der große Tag des Schlesiers, und sein Vortrag war seine Siegerurkunde über den entthronten Gegner, Alexis, der sich immer für persönliche Freiheit eingesetzt hatte.
Vom Koffer selbst ging er zum Inhalt über. Der Sprengsatz sei mit zwei Arten von Füllmaterial in der richtigen Lage gehalten worden, Gentlemen, sagte er. Bei Füllung Nr. 1 habe es sich um alte Zeitungen gehandelt; die Untersuchungen hätten ergeben, daß es sich um Bonner Ausgaben der Springer-Presse aus den letzten sechs Monaten gehandelt habe – wie passend, dachte Alexis. Bei Füllung Nr. 2 um eine zerschnittene ausrangierte Wolldecke der US Army, ähnlich jener, wie sie jetzt von meinem Kollegen, Mr. Soundso, vom staatlichen Untersuchungslabor hochgehalten wird. Während der verschüchterte Assistent eine große graue Wolldecke zur Ansicht in die Höhe hielt, ratterte der Schlesier stolz seine anderen brillanten Schlußfolgerungen herunter. Alexis hörte der Aufzählung dessen, was er bereits wußte, gelangweilt zu: das verbogene Ende des Zünders … winzig kleine Partikel nicht detonierten Sprengstoffs, erwiesenermaßen russisches Standard-Plastik, den Amerikanern unter der Bezeichnung C4 bekannt, den Briten unter der Bezeichnung PE und den Israelis unter der, die sie nun einmal hatten … die Aufzugswelle einer billigen Armbanduhr … die verkohlte, aber immer noch als solche erkennbare Feder einer Wäscheklammer. Mit einem Wort, dachte Alexis, klassischer Aufbau, geradewegs aus der Bombenschule. Keinerlei kompromittierendes Material, nichts, was auf irgendwelche Eitelkeit hätte schließen lassen, keinerlei Schnickschnack, der über eine in den Innenwinkel des Deckels eingebaute kinderleichte Zündung hinausgegangen wäre. Höchstens daß die Dinger, die die Kinderchen heutzutage zusammenbastelten, einen geradezu sehnsüchtig an die guten altmodischen Terroristen der siebziger Jahre zurückdenken ließen, dachte Alexis.
Der Schlesier schien das gleichfalls zu denken, doch machte er einen schrecklichen Witz darüber: »Wir nennen so was eine Bikini-Bombe«, verkündete er stolz. »Nur das absolute Minimum. Keine Extras!«
»Und keine Verhaftungen«, rief Alexis bedenkenlos und wurde dafür mit einem bewundernden und merkwürdig wissenden Blick von Schulmann belohnt.
Seinen Assistenten brüsk übergehend, griff der Schlesier jetzt mit einem Arm in den Koffer und zog triumphierend ein Stück Weichholz heraus, auf dem die Nachbildung montiert worden war, so etwas wie der Stromkreis eines Modell-Rennautos aus mit Isolierstoff überzogenem Draht, der in zehn Stäben aus grauem Kunststoff endete. Während die Uneingeweihten sich darum scharten, um das Ding genauer in Augenschein zu nehmen, bemerkte Alexis überrascht, daß Schulmann, die Hände in den Taschen, seinen Platz verließ und zu ihnen hinüberschlenderte. Aber wozu? fragte sich Alexis im Geiste, den Blick schamlos auf ihn geheftet. Warum plötzlich so gemächlich, nachdem du doch gestern kaum Zeit gehabt hast, einen Blick auf deine verbeulte Uhr zu werfen? Alexis ließ alle Bemühungen, gleichgültig zu erscheinen, fahren und stellte sich rasch neben ihn. So bastelt man eine Bombe, erklärte der Schlesier, wenn man nach der üblichen Schablone gemacht ist und Juden in die Luft jagen will. Man kauft sich eine billige Uhr wie diese hier; man sollte sie ja nicht stehlen, sie vielmehr in einem großen Kaufhaus kaufen, möglichst zur Hauptgeschäftszeit, und außerdem noch ein paar andere Dinge erstehen, um das Erinnerungsvermögen des Verkäufers zu verwirren. Den Stundenzeiger entferne man. Dann bohre man ein Loch in das Glas, stecke eine Heftzwecke hinein, verbinde den Stromkreis mit Hilfe eines guten Klebstoffs mit dem Kopf der Heftzwecke. Dann die Batterie. Daraufhin den verbliebenen Zeiger so nahe oder so weit von der Heftzwecke entfernt einstellen, wie man will. Ganz allgemein gelte allerdings die Regel, möglichst wenig Zeit dazwischenzuschalten, um zu gewährleisten, daß die Bombe nicht entdeckt und entschärft wird. Die Uhr ziehe man auf, dann überzeuge man sich davon, daß der Minutenzeiger noch funktioniert. Er tut es. Zu demjenigen beten, von dem man annimmt, daß er einen dazu gebracht hat, den Zünder in die Sprengkapsel hineinzudrücken. In dem Augenblick, da der Minutenzeiger den Dorn der Reißzwecke berührt und der Kontakt den Stromkreis schließt, und so Gott will, geht die Bombe dann los.
Um dies Wunder zu demonstrieren, entfernte der Schlesier die unschädlich gemachte Zündung sowie die zehn Stäbe Demonstrationssprengstoff aus Plastik und ersetzte ihn durch eine kleine Glühbirne, wie man sie für Taschenlampen verwendet.
»So, und jetzt beweise ich Ihnen, wie der Stromkreis funktioniert!« rief er.
Niemand zweifelte daran, daß es klappte. Die meisten kannten so etwas in- und auswendig, doch wie dem auch sei, für einen Augenblick, so wollte es Alexis scheinen, überlief es unwillkürlich alle Umstehenden gleichzeitig, als die kleine Birne munter ihr Signal aufblinken ließ. Nur Schulmann schien ungerührt. Vielleicht hat er wirklich schon zuviel gesehen, dachte Alexis, und ist das Mitleid in ihm endgültig erloschen. Denn Schulmann achtete überhaupt nicht auf die Birne. Er blieb über den nachgebauten Zündmechanismus gebeugt stehen, setzte ein breites Lächeln auf und betrachtete ihn mit der kritischen Aufmerksamkeit eines Kenners.
Ein Parlamentarier, der zeigen wollte, wie gescheit er war, erkundigte sich, warum die Bombe nicht rechtzeitig losgegangen sei. »Diese Bombe war vierzehn Stunden im Haus«, wandte er in seidigem Englisch ein. »Ein Minutenzeiger dreht sich aber höchstens eine Stunde, ein Stundenzeiger zwölf Stunden. Wie erklärt man sich, bitte, vierzehn Stunden bei einer Bombe, die maximal nur zwölf Stunden warten kann?«
Der Schlesier hatte für jede Frage einen ganzen Vortrag bereit. Einen solchen gab er jetzt zum besten, während Schulmann, immer noch nachsichtig lächelnd, anfing, mit dicken Fingern an den Rändern des Modells leicht herumzupolken, als ob er in der Füllung darunter etwas verloren hätte. Vielleicht habe die Uhr nicht funktioniert, sagte der Schlesier. Möglicherweise habe die Autofahrt bis in die Drosselstraße den Mechanismus durcheinandergebracht. Denkbar auch, daß der Arbeits-Attaché, als er den Koffer auf Elkes Bett legte, den Stromkreis gestört habe, sagte der Schlesier. Und da es sich um eine billige Uhr gehandelt habe, sei auch vorstellbar, daß sie aufgehört habe zu gehen und dann plötzlich wieder in Gang gekommen sei. Alles war möglich, dachte Alexis, dem es nicht gelang, seinen Ärger herunterzuschlucken.
Schulmann jedoch kam mit einem anderen, einem genialeren Vorschlag.
»Oder vielleicht hat der Bombenbastler nicht genug Farbe vom Uhrzeiger runtergekratzt«, sagte er wie beiläufig, während er seine Aufmerksamkeit den Scharnieren des Koffers zuwandte. Er fischte ein altes Soldatenmesser aus der Tasche, wählte einen plumpen Dorn aus der Vielzahl der Möglichkeiten aus, schob ihn versuchsweise unter den Kopf der Reißzwecke und überzeugte sich, wie leicht es war, sie zu entfernen. »Die Leute in Ihrem Labor haben die ganze Farbe abgekratzt. Aber wer weiß, vielleicht war dieser Bombenbastler nicht so ein wissenschaftlicher Typ wie Ihre Techniker«, sagte er und ließ den Dorn laut einschnappen. »Nicht so fähig. Nicht so sauber in seinen Konstruktionen.«
Aber es war doch ein Mädchen, wandte Alexis heftig bei sich ein. Warum spricht Schulmann plötzlich von einem er, wo wir doch an ein hübsches Mädchen in einem blauen Kleid denken sollen? Zumindest für den Augenblick offenbar völlig ahnungslos, in welchem Maße er den Schlesier mitten in seiner Vorführung abgekanzelt hatte, wandte Schulmann seine Aufmerksamkeit der hausgebastelten Zündvorrichtung im Deckelinneren zu und zupfte vorsichtig an dem Ende Draht, das ins Futter hineingesteckt und mit einem Dübel in der Öffnung der Wäscheklammer verbunden war.
»Gibt es da was Interessantes, Herr Schulmann?« erkundigte sich der Schlesier mit engelhafter Selbstbeherrschung. »Haben Sie vielleicht eine Spur entdeckt? Sagen Sie es uns, bitte. Es interessiert uns sehr.«
Schulmann überlegte sich das großzügige Angebot.
»Zuwenig Draht«, verkündete er dann, wandte sich wieder dem weißgedeckten Tisch zu und suchte unter den schauerlichen Exponaten herum. »Hier drüben haben wir die Überreste von siebenundsiebzig Zentimetern Draht.« Er fuchtelte mit einer verkohlten und aufgewickelten Drahtdocke in der Luft herum. Wie ein Strang Wolle war sie ohne Halterung aufgewickelt und wurde von einer Schlaufe um die Taille zusammengehalten. »In Ihrer Rekonstruktion sind es höchstens fünfundzwanzig Zentimeter. Warum fehlt bei Ihrer Rekonstruktion ein halber Meter Draht?«
Einen Moment herrschte betretenes Schweigen, ehe der Schlesier ein lautes, nachsichtiges Lachen ausstieß.