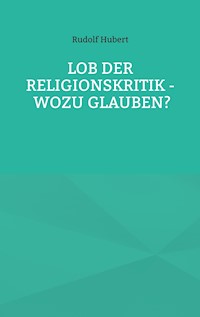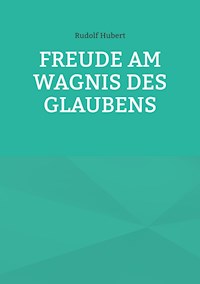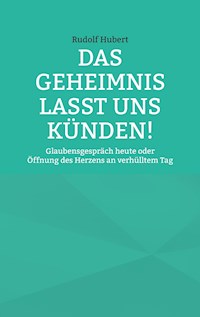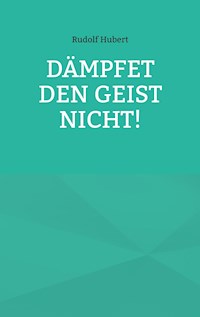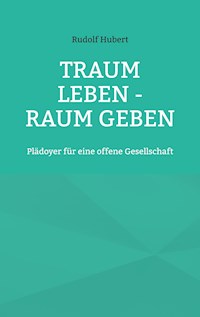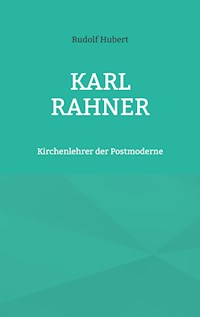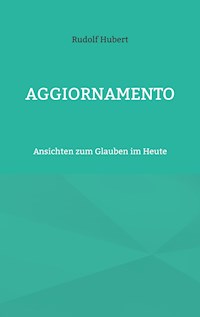
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Der kirchlichen Verkündigung kommt, um des Menschen willen! gerade heute schon deshalb eine unverzichtbare Aufgabe zu! Die Frage nach dem Menschen offen zu halten und jeglicher Verkürzung zu wehren, deutlich und vernehmbar zu machen: Die entscheidende Dimension des Menschen ist die zu Gott selbst. Sie ist seine tiefste, von Gott, dem unendlich liebenden Geheimnis, eröffnete Möglichkeit. Und damit wird auch ersichtlich, dass die Liebe Gottes nicht nur unendlich ist. Sie ist zugleich so unbegreiflich, wie Gott unbegreiflich ist. Herausgeber: Hans-Jürgen Sträter, Adlerstein Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 59
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Fragen als Akt der Frömmigkeit - Reinhold Schneiders Vermächtnis
Zur Liebe berufen – Kirchliches Leben in Sozialraumbezügen (Bezugnahme auf ein Wort der Deutschen Bischöfe)
„Sucht die Nähe Gottes, dann wird er sich euch nahen (Jak. 4,8) - Karl Rahner als Glaubenszeuge
Hans Urs von Balthasar – der Lehr- und Lesemeister
Was ist der Mensch? - Fingerzeige von Eugen Drewermann
Epilog oder Kleine Glaubensfibel von der Unbegreiflichkeit Gottes
Zum Autor
Ansichten zum Glauben im Heute
I. Fragen als Akt der Frömmigkeit – Reinhold Schneiders Vermächtnis
1.
In einem lesenswerten Aufsatz aus dem Jahr 1964 fand ich folgende Sätze, die mich sehr beeindruckt haben:
„Es ist das Verhängnis des Zeitgeistes, zu meinen, dass die Wirklichkeit unter einem einzigen Aspekt, nämlich dem positivistischen, begriffen werde könne. Infolge dieses Verhängnisses werden wir geradezu primitiv in Bezug auf das Leben und den Tod. Wenn der Tod nur biologisch gesehen wird, wird auch das Leben degradiert. Dann ist es im Haushalt des Weltalls nichts anderes als das zufällige und sinnlose Abenteuer des Protoplasmas, und es wäre dann nicht einmal sinnlos, wenn in ferner Zukunft nur noch Insekten die Erde bevölkerten. Denn biologisch gesehen ist der Sinn des Lebens das Überleben des Stärkeren, d.h. dessen, der den Bedingungen der Erde am besten angepasst ist.“1
Warum mich diese Sätze beeindruckt haben? Nun, dieser Text ist schon ein wenig „in die Jahre gekommen“. Vielleicht dachte man vor über 50 Jahren noch so, aber heute? Sind wir nicht aufgeklärt? Wissen wir nicht viel mehr über die Welt, über den Menschen, über die Zukunft? Denken wir ernsthaft noch so platt biologistisch und verwechseln einen Aspekt der Wirklichkeit mit der Wirklichkeit insgesamt?
Angesichts der Flüchtlingskrise in Europa, der drastischen Abschottungstendenzen der reichen vor den armen Ländern und der vielen Stellvertreterkriege kommen mir erhebliche Zweifel, ob wir wirklich im Zusammenleben der Menschen über das fast ausschließlich dominierende Recht des Stärkeren hinausgekommen sind. Was macht den Menschen zum Menschen? Diese Frage stellt sich in jeder Generation neu. Die Antwort auf diese Frage liegt nicht in den Genen, sie kann nicht vererbt werden. Sie muss in jeder Generation, von jedem Einzelnen neu erworben werden. Während die Nationalsozialisten von „Blut und Boden“ redeten und die Kommunisten den Menschen lediglich als „Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse“ zu beschreiben wussten, ist heute - allerdings auch nur dort, wo die Frage nach dem Menschen ausdrücklich gestellt wird – von ihm als Verbraucher, als Konsument und als Kostenfaktor die Rede. Fröhliche Urständ‘ feiert zudem ein reiner Materialismus, der vorgibt, ‚objektive‘ und ‚wissenschaftliche‘ Ergebnisse zu präsentieren, die angeblich eindeutig erweisen, dass die Freiheit des Menschen nichts als lächerliche Täuschung sei. Gott – ein reines Wunschgebilde, der Mensch nichts weiter als „Vehikel seiner Gene oder Meme“. Und wenn ‚das Gefährt‘ dann zu alt geworden ist, muss es verschwinden, um Platz zu schaffen für neue und leistungsfähigere ‚Überlebensmaschinen‘, die die Weiterexistenz unserer Gene gewährleisten.2
Wenn nicht lächerlich, dann zumindest komisch wirkt es, wenn Christen in dieser Welt des reinen Pragmatismus und der sich so aufgeklärt gebenden Mentalität heutigen Zeitgeistes den Menschen als „Gotteskind“ bezeichnen, als ein Wesen, das zum Leben mit Gott in der Gemeinschaft der Heiligen in Liebe berufen ist. Mir scheint zudem: Je mehr kirchlicher Glaube im Schwinden begriffen ist und Gott zu einem nichtssagenden Begriff verkommt, ja zum Fremdwort wird, desto stärker wenden sich Menschen esoterischen Heilslehren zu oder eben jenem Pragmatismus, der sich die Frage nach dem Ganzen, nach sich selbst und damit auch nach Gott verbietet. Wo keine sinnvolle Frage gestellt wird, kann auch keine sinnvolle Antwort erwartet werden. Deshalb nimmt sich vielerorts die Botschaft von Ostern, von der Auferstehung des menschgewordenen Gottes, zu unserem Heil und Segen, heute teilweise recht merkwürdig aus. Ja, sagen wir es genauer, um uns die Situation nicht zu verharmlosen: Die christliche Botschaft wirkt oft skurril, wie „aus der Zeit gefallen“. Weil, ja weil traditionelle Voraussetzungen des Glaubens vielerorts fast völlig weggebrochen sind. Wir sind – in Europa, in Deutschland, im so genannten „christlichen Abendland“ – viel-fach zu Analphabeten im Glauben geworden. Und nur mühsam müssen wir uns das Einmaleins des Glaubens ganz neu aneignen.
1 Aus „Abschied vom Christentum?“Hamburg 1964 – Hans Schomerus: Und am Ende der Tod, S.273f
2 Vgl. exemplarisch die Bücher von Richard Dawkins „Der Gotteswahn“; „Die Gotteslüge“ oder das Buch von Christopher Hitchens „Der Herr ist kein Hirte“.
2.
Wo ist eigentlich die Antwort auf Reinhold Schneiders existentielle Anfragen zu finden, für die „Winter in Wien“3 exemplarisch steht?4Je mehr ich mich in diese Frage vertiefe, desto bedeutsamer wird der 1958, im Alter von nicht einmal 55 Jahren verstorbene Reinhold Schneider mir. Anhand seiner Überlegungen zu geschichtsmächtigen Personen wie beispielsweise Friedrich Schiller oder dem alttestamentlichen Propheten Jeremia in „Pfeiler im Strom“5 spüre ich: Hier thematisiert Schneider eigentlich ‚meine‘ Fragen. Und sicherlich nicht nur meine! Er wird gewissermaßen zum ‚Stichwortgeber‘ einer ganzen Epoche, der auch mir in zweifacher Hinsicht hilfreich ist: Bei Reinhold Schneider fühle ich jene Fragen in einer Tiefe an – und ausgesprochen, wie es heute offensichtlich nicht mehr allzu häufig geschieht. Aber dort, wo es geschieht, treffen diese Fragen mit einer Wucht auf, dass viele Antworten sich bei genauerem Hinsehen nur als klägliche Versuche entpuppen, die angesichts des existentiellen Gewichtes dieser Fragen als viel zu leicht befunden werden.
Außerdem thematisiert Schneider eine Situation, die heute vielleicht noch stärker als Mitte des 20. Jahrhunderts existentiell von vielen Menschen erfahren wird: Die – fast vollständige – Irrelevanz des Religiösen für einen Großteil unserer Lebensbereiche.
„‘Sie haben keinen Wein mehr‘: damit beginnt das Evangelium. Wie aber steht es mit denen, die nicht geladen wurden zur Hochzeit? Immer schmaler wird die Tafel des Bräutigams, immer breiter werden die Tische, an denen niemand mehr nach Wundern verlangt.“6 Reinhold Schneider hat schon vor Jahrzehnten in geradezu prophetischer Weise das Dilemma der Glaubensverkündigung, wie wir es heute in kaum gekanntem und geahntem Ausmaß erleben, beschrieben.
Was, wenn der Glaube nicht einmal mehr fragwürdig, der Frage würdig ist? Wenn der köstliche Wein unbeachtet stehenbleibt, weil weder Durst noch Geschmack (mehr) vorhanden sind? Wenn es keine sinnvollen Antworten mehr geben kann, weil es keine Fragen mehr gibt? Wenn der Mensch vergessen hat, dass er vergessen hat – nämlich nach sich selbst und dem Sinn des Ganzen zu fragen? Karl Rahner sprach davon, dass der Gottesverlust einhergeht mit dem Selbstverlust und davon, dass dies durchaus völlig ‚normal‘, ganz unspektakulär, geräuschlos und unbemerkt, vor sich gehen kann.
Die Fragen nach Sinn und Ziel, nach Grund und Wert – sie werden bei diesem ‚Befund‘ offensichtlich völlig irrelevant. Sie finden in der Welt keinen sinnvollen ‚Anknüpfungspunkt‘ (mehr), sie lassen sich weder hinreichend begründen noch verifizieren. Sie zu stellen, verbietet sich ganz offensichtlich aus „intellektueller Redlichkeit“.
3 Reinhold Schneider „Winter in Wien“, Freiburg-Basel-Wien 1958 – Die hier verwendeten Zitate sind der Buch - Ausgabe von 1963 entnommen
4