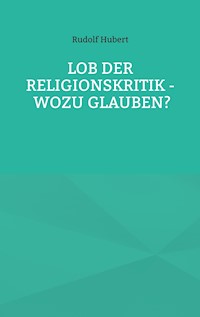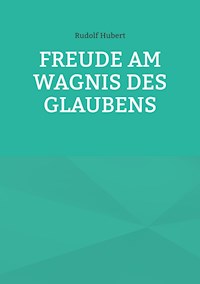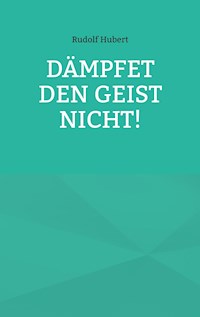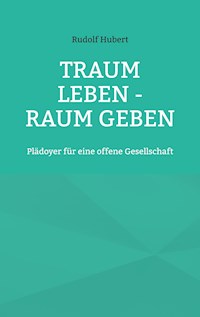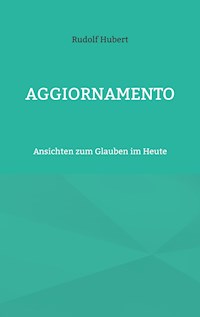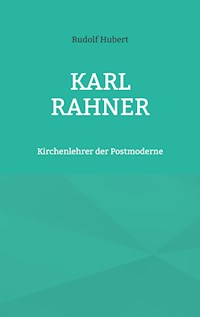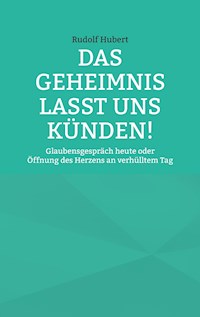
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Wo ist eigentlich die Antwort auf Reinhold Schneiders existentielle Anfragen zu finden, für die Winter in Wien nur exemplarisch steht? Je mehr ich mich in diese Frage vertiefe, desto bedeutsamer wird der 1958, im Alter von nicht einmal 55 Jahren verstorbene Reinhold Schneider mir. Anhand der Überlegungen zu geschichtsmächtigen Personen wie Friedrich Schiller oder dem alttestamentlichen Propheten Jeremia in Pfeiler im Strom spüre ich: Hier thematisiert Schneider eigentlich meine Fragen. Und sicherlich nicht nur meine! Er wird gewissermaßen zum Stichwortgeber, der mir in zweifacher Hinsicht hilfreich ist: Bei Reinhold Schneider fühle ich jene Fragen in einer Tiefe an, und ausgesprochen, wie es heute offensichtlich nicht mehr allzu häufig geschieht. Herausgeber: Hans-Jürgen Sträter, Adlerstein Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 62
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Geheimnis lasst uns künden!
Glaubensgespräch heute
oder „Öffnung des Herzens“1
an „verhülltem Tag“2
von Rudolf Hubert
1 "Die Öffnung des Herzens" ist das Einführungskapitel in Karl Rahners Buch "Von der Not und dem Segen des Gebetes". ("Beten mit Karl Rahner", Band 1 "Von der Not und dem Segen des Gebetes", Freiburg-Basel-Wien, 2004; - Zuerst in Felizian Rauch, Innsbruck, 1949). In ihm geht es um Selbstkonfrontation, um Besinnung auf das Selbst- und Weltverständnis des heutigen Menschen. Glauben und Leben, Denken und Fragen, bilden in diesem weit verbreiteten Buch Karl Rahners eine untrennbare Einheit. Hinzu kommen Glaubenserfahrungen und Bilder, die auch sprachlich klassische Schönheit erreichen.
2 "Verhüllter Tag" - Bekenntnis eines Lebens - autobiografische Schrift Reinhold Schneiders unter diesem Titel, Freiburg-Basel-Wien, 1959 (zuerst bei Jakob Hegner, Köln, 1954)
INHALT
HINFÜHRUNG – ANFRAGEN
REINHOLD SCHNEIDERS VERMÄCHTNIS
WARUM BIN ICH HEUTE CHRIST?
ANHANG – KLEINES GLAUBENSBREVIER
Zum Autor
I. Hinführung - Anfragen
Unnachahmlich beschreibt Reinhold Schneider in „Winter in Wien“ die ‚Dissonanzen des Lebens‘, aus denen ein Großteil der Welt besteht. Vieles klang schon an in seinem Werk „Verhüllter Tag“. In „Winter in Wien“ werden die Konturen jedoch noch deutlicher: Haben Tragik, Absurdität, die ‚Dissonanzen des Lebens‘, nicht doch das letzte Wort in all den Fragen nach dem Sinn des Lebens? Wir sind heute Zeugen einer Flüchtlingsproblematik ungeheuren und ungeahnten Ausmaßes. Papst Franziskus legt seine Enzyklika „Lauda to si“ vor, in der nicht nur ein Hymnus auf die Schöpfung angestimmt wird, der mich teilweise an Teilhard de Chardin erinnert. Der Papst analysiert scharf das Versagen gegenüber Gottes Schöpfung durch uns Menschen, er stellt das himmelschreiende Unrecht in zwischenmenschlichen und gesellschaftlichen Beziehungen heraus, das primär auf einem ungeordneten Verhältnis zu uns selbst resultiert, weil wir uns nicht so sehr als „verdankte Existenz“ göttlicher Liebe erleben, sondern eher als „zur Existenz verdammt“ (Sartre), die sich nur mühsam im Konkurrenzkampf aller gegen alle „ihrer Haut erwehren kann“. Papst Franziskus spricht gar von einem Taumel des überbordenden Konsums und des Eigennutzes, dem er die Verantwortung gegenüberstellt, die eigentlich mit unserem Menschsein gegeben ist. Dabei ist Papst Franziskus kein Pessimist. Aber er beschreibt eindringlich und schonungslos die Folgen für Mitwelt und Umwelt, ja für uns selbst, wenn wir als Menschen unserer Verantwortung nicht gerecht werden.
Es drängen sich Fragen auf, gerade angesichts jener Verdrängungsversuche, in denen so getan wird, als ob hier ein „Horrorszenario“ vorgestellt wird, dass so schlimm schon nicht sein wird.
Und neben der fast panischen Zukunftsangst, die es teilweise gibt, verbunden mit einem abgrundtiefen Pessimismus, der sich teilweise in Verschwörungstheorien flüchtet, die heute ‚fröhlich Urständ‘ im weltweiten Netz und auf dem Büchermarkt feiern, existiert parallel ein ungebrochener Fortschrittsglaube, der das Heil nach wie vor alleine von den Möglichkeiten der Technik und der gesellschaftlichen Entwicklung des Menschen her erwartet.
Wird nicht mitunter zu laut und unkritisch (zumindest teilweise) das Lob auf die „gute Schöpfung“ angestimmt, ohne das des Schöpfers „aller guten Gaben“ gedacht wird?
Stimmt die Diagnose der Fortschrittsgläubigen überhaupt, dass die Gesetze der gesellschaftlichen Entwicklung fast wie von selbst das „goldene Zeitalter“ heraufführen, so dass „das Märchen vom Lande morgen und übermorgen“
3
bald Wirklichkeit wird?
Muss nicht der Erkenntnis viel mehr Raum gegeben werden, dass wir Gott (jenseits aller ‚Götter‘) schon deshalb brauchen, weil die Welt nun ‘mal so ist, wie sie ist, mit all ihren Ambivalenzen des Guten und Bösen, des Tragischen und Hoffnungsvollen, des Absurden und der glücklichen Fügungen?
Wie weit trägt insbesondere angesichts der Realität des Tragischen die Erkenntnis, dass „wir glauben, weil wir lieben“
4
?
Und trägt die Antwort wirklich etwas aus und wie weit greift sie, dass wir nur im Vollzug der Hoffnung ihrer gewahr und ansichtig werden (können)?
Glauben und Leben sind keine ‚intellektuelle Spielerei‘. Doch wie merkwürdig ‚steril‘, ja fast hilflos erscheint mitunter die Auskunft, dass die Gottesfrage nur im Leben selbst eine Antwort finden kann, eben weil sie keine ‚intellektuelle Spielerei‘ ist?
Sind nicht alle „Grenzgänger“
5
der Versuch, sich gewissermaßen einen „Reim auf das Leben“ zu machen, eine Antwort zu finden auf die Frage, „was die Welt im Innersten zusammenhält“
6
?
3 Titel eines Kinofilms in der ehemaligen DDR, indem es um das Leben von Karl Marx und Friedrich Engels ging
4 Buchtitel von Eugen Drewermann, Ostfildern 2010
5 Ebenfalls ein Buchtitel von Eugen Drewermann, Ostfildern 2015
6 Aus Goethes „Faust“ – „Das ich erkenne, was die Welt / im Innersten zusammenhält“ (Faust I)
II. Reinhold Schneiders Vermächtnis
Wo ist eigentlich die Antwort auf Reinhold Schneiders existentielle Anfragen zu finden, für die „Winter in Wien“7 nur exemplarisch steht?8 Je mehr ich mich in diese Frage vertiefe, desto bedeutsamer wird der 1958, im Alter von nicht einmal 55 Jahren verstorbene Reinhold Schneider mir. Anhand der Überlegungen zu geschichtsmächtigen Personen wie Friedrich Schiller oder dem alttestamentlichen Propheten Jeremia in „Pfeiler im Strom“9 spüre ich: Hier thematisiert Schneider eigentlich ‚meine‘ Fragen. Und sicherlich nicht nur meine! Er wird gewissermaßen zum ‚Stichwortgeber‘, der mir in zweifacher Hinsicht hilfreich ist: Bei Reinhold Schneider fühle ich jene Fragen in einer Tiefe an – und ausgesprochen, wie es heute offensichtlich nicht mehr allzu häufig geschieht.
Schneider bringt also zunächst jene Fragen in‘ s Wort, die heute häufig geahnt, weniger jedoch bewusst ausgesprochen und thematisiert werden. Das scheint vielleicht das eigentliche Dilemma unserer Zeit zu sein: Nur wer sich den eigentlichen Fragen des Lebens stellt, ja, wer sie zu allererst wahrnimmt und zulässt, wird in der Lage sein, verlässlich Orientierung geben zu können – auch und gerade dann, wenn scheinbar danach nicht (mehr) gefragt wird. Das, was am meisten verdrängt wird, kann das am meisten Bedrängende, das am meisten Andrängende und Vermisste sein, ja das im wörtlichen Sinn Notwendige! Insofern ist Reinhold Schneider ein wirklicher „Kundschafter der Existenztiefe“10, der unserer Zeit jene Stichworte vorgibt, die sie dringend braucht und die sie sich selbst offensichtlich nicht (mehr) zu geben vermag. Es ist gerade die Tiefe und Radikalität, mit der Reinhold Schneider seine Fragen formuliert, die gleichermaßen faszinierend wie aufrüttelnd, ja aufreizend ist und die Ausschau halten lässt nach Antworten, die dem Niveau dieser Fragen entsprechen.
Dabei scheint es nur auf den ersten Blick merkwürdig zu sein, „wie da die Gipfel einander zunicken“.11 Denn wenn es um das Ganze menschlicher Existenz geht, wird man wohl Pinchas Lapide zustimmen müssen, der es so formuliert: „Gottlose Menschen, falls es solche gibt, scheinen mir metaphysisch behindert zu sein, denn ihnen fehlt die menschlichste aller Dimensionen: Das Gespür für den personalen Gott.“12 Und Herbert Vorgrimler schreibt zu den Glaubensschwierigkeiten, die sich „aus einer typisch heutigen Mentalität“13 ergeben: „Sie bestehen weniger in einer Ablehnung dieser oder jener Glaubensaussage als vielmehr in dem Widerwillen oder der Unfähigkeit, seine eigene Transzendenz zu akzeptieren und damit Gotteserfahrungen zuzulassen… Die Anerkennung der menschlichen Transzendenz steht in engstem Zusammenhang mit dem Kampf gegen inhumane Zustände und um die Rettung der Schöpfung vor der hemmungslosen Gier der Transzendenzlosen.“14
Es ist dieser evidente Zusammenhang, um den es in den folgenden Überlegungen geht. Die teilweise verheerenden praktischen Folgen, die sich aus der „Gier der Transzendenzlosen“15 für Mit- und Umwelt, ja für das eigene Selbstverständnis des modernen Menschen und seinen Umgang mit sich selbst ergeben, erweisen nicht nur die ungebrochene Aktualität von Reinhold Schneiders Botschaft aus „Winter in Wien“ aus dem Jahre 1958, 16