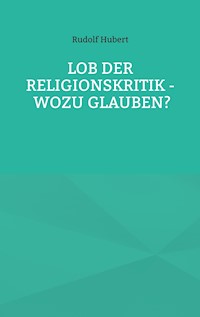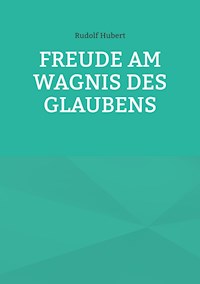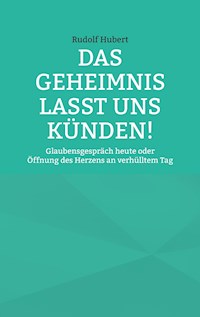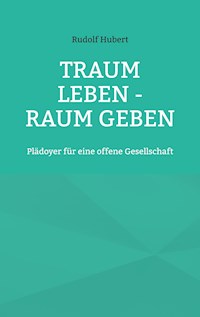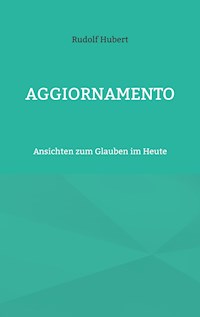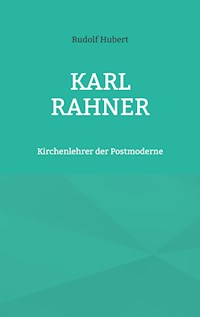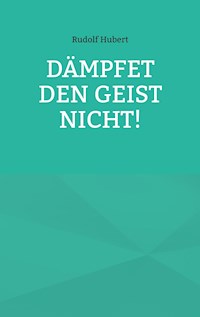
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Warum dieses Büchlein? Und wen will es erreichen? Um es gleich vorweg zu sagen: Es ist kein leicht lesbares Buch, das man mal so zwischendurch einfach konsumieren kann. Das ist es nicht und wer mit dieser Erwartung an dieses Büchlein herantritt, wird es sicherlich nach den ersten Zeilen enttäuscht zur Seite legen. Es ist ein theologisches Buch - das allerdings nicht nur für Theologen geschrieben ist, sondern für all jene, die sich ernsthaft Gedanken machen um den Sinn des Lebens, um den Glauben heute und morgen, um Sinn, Wirklichkeit und Erscheinung von Kirche. Herausgeber: Hans-Jürgen Sträter, Adlerstein Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 140
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
I.
Annäherungen – zwei gegensätzliche Erfahrungen und Beobachtungen
II.
Glaubensvermittlung in heutiger Zeit
Hinführung
Verschiedene Optionen der Glaubensvermittlung
2.1. Hans Urs von Balthasar – Dialog und Dienst aus unanfechtbarer Identität
2.2. Karl Rahner – Identität in Dialog und Dienst
2.3. Die Glaubensanfrage aus Reinhold Schneiders „Winter in Wien“
2.4. Die Einheit von Orthodoxie und Orthopaxie
III.
Vertiefung
IV.
„Die Armut der Sprache zurückgewinnen…
Kirchlichkeit des Glaubens
Jesus der Christus
Orientierung in einer unüberschaubaren Welt
Der atheistische Humanismus und die „anonym Verbündeten“ im Glauben
Welche Fragen sind von Gott?
Die Frage nach Leid, Not und Tod - Not und Segen des Gebetes
V.
Kurzformel des Glaubens
Zum Autor
Vorwort
Warum dieses Büchlein? Und wen will es erreichen? Um es gleich vorweg zu sagen: Es ist kein leicht lesbares Buch, das man „mal so zwischendurch“ einfach konsumieren kann. Das ist es nicht und wer mit dieser Erwartung an dieses Büchlein herantritt, wird es sicherlich nach den ersten Zeilen enttäuscht zur Seite legen. Es ist ein theologisches Buch – das allerdings nicht nur für Theologen geschrieben ist, sondern für all jene, die sich ernsthaft Gedanken machen um den Sinn des Lebens, um den Glauben heute und morgen, um Sinn, Wirklichkeit und Erscheinung von Kirche.
„Ja, gibt’s denn nicht genug solcher Bücher?“ – höre ich den kritischen Einwand ebenso wie jenen: „Wer liest denn das schon?“ Und noch ein Einwand ist mir bewusst: „Es gibt doch viele Experten, die werden schon wissen, was sie tun, was soll es denn da noch Neues geben?"
Um etwas Neues wird und kann es zunächst schon deshalb nicht gehen, weil das 'Alte' so jung ist, dass es sowohl heute als auch morgen 'brandaktuell' ist. Das will das vorliegende Büchlein erweisen und es wird versuchen, explizit und implizit auf diese und weitere Fragen an Kirche und Glauben einzugehen.
An dieser Stelle sei schon ein ganz kleiner Fingerzeig eines möglichen Antwortversuchs gegeben: Nach Aussage von Papst Franziskus wird die Kirche eine „verbeulte Gestalt“ haben, weil sie an die „Ränder geht“. Dort, wo es rau und hart, oft auch lieblos und ungerecht zugeht. Dort soll Kirche sein. Und warum soll sie dort sein? Ich bin davon überzeugt, dass die Kirche, dass der Glaube die beste, weil menschlichste Kunde ist. Weil er eine Botschaft der Liebe, der Freude und der Hoffnung ist. Und weil außer ihm nur Banalität, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit Platz haben.
Dabei sei gleich zweierlei mit gesagt: Diese Wirklichkeit gilt allen Menschen und sie ist überall anzutreffen. Es ist pure Arroganz, Heuchelei und Ignoranz, zu meinen, nur, wo man sich ausdrücklich dazu bekennt, gibt es diese Wirklichkeit. Diese Aussage ist zutiefst Selbstverständnis christlichen Glaubens, weil Gott „alles in allem“ ist und seine Güte, Huld und Barmherzigkeit viel weiter reichen, als wir es uns in unseren oft engen Gedanken und Überlegungen vorstellen können.
Und ein Zweites: Ich habe den nicht unbegründeten Verdacht, dass diese Botschaft heute und erst recht morgen in Gefahr geraten kann, ein „Geschwätz von gestern“ zu sein bzw. zu werden. "Löscht den Geist nicht aus!" Dieser Aufruf aus dem ersten Thessalonicherbrief kommt mir in den Sinn, wenn ich auf manche, oft ambivalente Entwicklungen, in Gesellschaft und Kirche blicke.
Glaube läuft vielfach Gefahr – trotz intensiver „Erneuerungsprozesse“ – ein gesellschaftliches Randphänomen zu werden. Dabei geht es nach eigenem Selbstverständnis um nicht mehr oder weniger als um die Frage nach dem rechten Bild vom Menschen, das immer mehr ausschließlich in die Rolle eines Konsumenten, Verbrauchers und Kostenfaktors zu geraten scheint. Für den christlichen Glauben ist die Gefahr der Irrelevanz, der Ignoranz viel größer als jede Religionskritik, weil hier noch um Glauben und Wahrheit gerungen wird. Leider antworten Teile der Kirchen auf diese Gefahr zunehmender Bedeutungslosigkeit für das praktische Leben darauf mit Rückzug und fundamentalistischen Tendenzen. Nichts ist verkehrter und bedrückender als das.
Darum werden in diesem Büchlein – über weite Textpassagen hin – Glaubenszeugen zu Wort kommen, die – trotz aller Unterschiedlichkeit – den Marsch der Kirche in‘s Getto verhindern wollten bzw. wollen. Genannt seien ausdrücklich Karl Rahner, Hans Urs von Balthasar, Reinhold Schneider und Eugen Drewermann.1 Wenn mich mein Eindruck nicht täuscht, sind gerade die beiden großen katholischen Theologen des 20. Jahrhunderts, Rahner und Balthasar, heute kaum mehr bekannt. Dabei haben sie in einer geradezu exemplarischen Weise die Herausforderungen der neueren Zeit an- und in ihr Wirken aufgenommen, so dass sie heute noch brandaktuell sind. Ich glaube, insbesondere die Theologie Karl Rahners2 ist - immer noch - im Kommen. Und auch Reinhold Schneider ist kaum noch bekannt, obwohl er in seinem Werk in geradezu exemplarischer Weise das
Thema Tragik und Glaube aufgenommen hat. In einer Zeit großer kollektiver Verdrängungen ist gerade die Relevanz dieser Thematik bei der Frage der Glaubensweitergabe schwerlich zu überschätzen.
Das vorliegende Büchlein gliedert sich wie folgt:
Am Anfang steht eine ‚Bestandsaufnahme‘ anhand zweier gegensätzlicher Beobachtungen zum Phänomen Glaube und Kirche.
Im Mittelteil geht es, neben Fragen der Vermittlung theologischer Optionen, insbesondere um Fragen der praktischen Glaubensweitergabe. Fragen theologischer Reflexion werden ergänzt durch pastoraltheologische, an der Praxis im Erzbistum Hamburg orientierte, Erwägungen.
Der Schlussteil widmet sich ausdrücklich wichtigen Glaubenshelfern. Dabei haben die Beiträge Karl Rahners und Eugen Drewermanns einen herausgehoben Stellenwert.
Wenn das Büchlein mit dazu beitragen würde, dass Glaube, Liebe und Hoffnung gestärkt werden, hätte es seinen Zweck mehr als erfüllt.
1 Bei Letztgenanntem sei die Anmerkung bzw. Differenzierung gestattet, dass ich die Glaubensbegründung in seinem kaum noch überschaubaren Werk sehr schätzen gelernt habe. Drewermanns Pauschalverurteilung der Kirche und auch seine generell abwertenden Äußerungen seinen Theologenkollegen gegenüber werden dagegen von mir abgelehnt. Es ist eine gewisse Tragik über Person und Werk Drewermanns zu konstatieren: Viele seiner Impulse sind heute buchstäblich notwendig. Leider scheint es keine Brücke (mehr) zu geben zwischen Eugen Drewermann und der kirchlichen Theologie. Dabei wäre diese so wichtig, denn die Sorge, dass Stimme und Anliegen von Kirche und Glauben immer leiser und immer weniger gehört werden in unserer Zeit, bis sie vielleicht eines Tages ganz verschwunden sind, teilt Eugen Drewermann sicherlich, wenn auch mit einer ganz eigenen Akzentuierung, wenn ich beispielsweise an seine Absetzbewegung von der Kirche und gleichzeitig sein unaufhörliches Insistieren auf das Anliegen des Mannes aus Nazareth denke. Nur so ist für mich der Umfang seines Werkes erklärbar und verständlich, ebenso der Inhalt solcher Werke, wie "Wendepunkte". Für diese Distanz und Entfremdung sehe ich übrigens wesentlich tiefere und andere Gründe als theologische Meinungsverschiedenheiten! Denn auch Drewermann weiß, dass die Botschaft des Mannes aus Nazareth zuerst und zuletzt eine kirchliche ist, denn ohne Kirche wäre sie im "Flugsand der Geschichte" untergegangen.
2 Seiner Theologie verdanke ich sehr viel. Ich denke, dass viele Impulse Karl Rahners - wenn sie denn von der Kirche (endlich!) mutig und entschlossen aufgegriffen würden - man denke an Karl Rahners Büchlein "Strukturwandel der Kirche als Aufgabe und Chance"! - neue Aufbrüche bewirken könnten.
I. Annäherungen - zwei gegensätzliche Erfahrungen und Beobachtungen
Beginnen wir mit einer kleinen Geschichte und zwei geschichtstheologischen Erwägungen, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Während die erste Geschichte verstörend, beklemmend und gleichzeitig aufklärerisch wirkt, sind die beiden anderen Aussagen geprägt von einem Blick auf die Geschichte und der Frage: Welche Rolle spielten und spielen Glaube und Christentum in Geschichte und Gesellschaft und wie sieht eine - mögliche - Zukunftsperspektive aus?
Die Geschichte vom Feuerbringer3
„In alten Zeiten war es jemandem gelungen, aus totem Stein, aus trockenem Laub und aus zerriebenem Holz Feuer zu entzünden. In seiner Freude suchte er einen Menschenstamm im hohen Norden auf, um den Frierenden in den Wintermonaten Licht und Wärme zu schenken. Die Menschen waren darüber so glücklich, dass sie vergaßen, dem Manne zu danken. Der nämlich war sehr bald schon weitergereist, zu einem Nachbarstamm, um auch diesem den Segen des Feuers zu bringen. In diesem Stamme aber wurden die Priester eifersüchtig auf die neue Gabe der Götter. Sie brachten den Mann um. Und um ihre Tat zu verschleiern, errichteten sie in dem vornehmsten ihrer Tempel mitten auf dem Hochaltar ein Bild des ehrwürdigen, allzeit zu verehrenden Feuerbringers. Ja, ihre Hochachtung für diesen Mann ging so weit, dass sie einen eigenen Kult für ihn einrichteten. Mit großer Sorgfalt setzten sie die Gebete und Formeln fest, in denen es möglich und nötig sei, jenen Mann richtig und wirksam zu verehren. Sie gaben sogar eine offizielle Lebensbeschreibung des großen heiligen Feuerbringers und Mannes Gottes heraus, die in allen Familien gelesen werden musste und schon den Kindern zum Lernen aufgegeben wurde. Und damit niemand in Irrtum darüber gerate, von welch wahrer Natur und erhabener Wesensart jener Gottesmann wirklich gewesen sei, erstellten sie eine ausführliche Darlegung des einzig wahren, für alle verbindlichen Glaubens an den großen und einzigartigen, allen Menschen guten Willens verbindenden Feuerbringers; und damit niemand mehr die also irrtumsfrei unterwiesenen Gläubigen zu Irrtum verführe, verfügten sie obendrein streng, dass im Falle auch nur der geringfügigsten Abweichung in Inhalt und Wortlaut von der vorgeschriebenen Diktion ihrer Dogmen der derart Schuldiggewordene mit dem Feuertod zu bestrafen sei als ein Feind der Götter und der Menschen. Kein Vergehen gab es, das für größer galt als dieses. - Alles war somit auf das beste und trefflichste bestellt, um den großen, göttlichen Feuerbringer in allen Zeiten zu ehren; es fehlte nur noch, dass die barbarischen Völker ringsum der gleichen Wahrheit und Segnung teilhaftig würden. Man zog daher aus und zerstörte ihre primitiven Hütten und heidnischen Gotteshäuser; man zwang sie, in den Bergwerken nach Silber und Gold zu graben und bestrich damit die Pfeiler und Kuppeln der herrlichsten Kirchen. Kein Opfer schien groß genug, dessen die Ehre des göttlichen Feuerbringers nicht wert gewesen wäre. Nur die Kunst des Feueranzündens selber war in Vergessenheit geraten. Niemand mehr wusste, dass Feuer sich finden lässt einzig in etwas so Einfachem wie einem toten Stein, einem bisschen trockenen Laub und zerriebenem Holz. Die Priester probierten wohl insgeheim immer wieder, mit Blättern aus purem Gold, mit Zweigen aus schimmerndem Silber und mit den kostbarsten rotglühend glänzenden Rubinen und Granaten Feuer zu entfachen. Doch vergebens. Der Kult des Feuermachens hatte die Kunst, Feuer zu machen, endgültig getilgt.
Was erlaubt unter solchen Umständen das Wiederfinden des ‚Feuers‘? - Keine Religion, auch nicht die christliche, beglaubigt sich länger durch die Erhabenheit ihrer Tradition und Geschichte – selbst die Länge von zweitausend Jahren beweist nicht das Geringste für ihre Wahrheit; im Gegenteil, MARTIN LUTHER schon wusste, dass eineinhalbtausend Jahre Kirchengeschichte womöglich nichts sind als eine stets wachsende Entfremdung und Verfälschung des Ursprungs. Wer diese Möglichkeit auch nur von ferne zulässt, der beruhigt sich niemals mehr beim Anblick all der Kathedralen und Dome, der Kirchen und Kapellen, der Museen und Schatzkammern, der Tresore und Banken, der Grundbesitze und Aktien… Der wird viel eher misstrauisch und traurig, wenn er den Kontrast zwischen dem ‚Bild‘ des ‚Feuerbringers‘ und dem goldenen Rahmen, in den man es einfasst, bemerkt. Womöglich wollte jener göttliche Feueranzünder gar keine kultische Verehrung seiner Person, er mochte nur, dass die Menschen es lernten, nach seiner Weise aus dem toten Stoff den Funken des Feuers zu schlagen und niemanden mehr schutzlos frieren zu lassen!“
Das Christentum in der Geschichte
"Bislang hatten Götter als fern, grausam und launenhaft gegolten. Sie waren vor allem unerreichbar - und das war auch gut so, denn Götter wurden gefürchtet und nicht geliebt. Die Vorstellung, die Götter zu lieben, war lachhaft. Noch absurder war höchstens die Idee, die Götter - oder ein übermächtiger Gott - könnte jeden Einzelnen kennen und lieben. Genau das predigte Paulus aber: <<Jeder Einzelne wird von Gott geliebt.>> ... Dieses Konzept der <<Religion für alle>> war ein revolutionärer, urdemokratischer Akt. Mit gewaltigen Folgen. Durch die Hervorhebung einer persönlichen Beziehung zu Gott, die für alle erreichbar sein sollte, brachte Paulus die Idee einer universellen Menschenwürde auf die Welt. Der amerikanische Sozialanthropologe Ernest Becker bezeichnete dies als die <<bemerkenswerteste aller Leistungen des christlichen Weltbildes: Er nahm sich die Sklaven, die Krüppel, die Schwachsinnigen, die Einfältigen und die Mächtigen und machte sie alle zu potentiellen Helden...>>...Die Nachricht von der persönlichen Liebe Gottes zu jedem Einzelnen hatte sich als unwiderstehlich erwiesen. Das moderne Konzept des Individualismus und der Menschenwürde, der Glaube, dass jeder einzelne Mensch wertvoll ist, verdankt seine Existenz der Idee eines jeden Einzelnen liebenden Gottes. Der areligiöse Humanismus und unser säkularer Wertekanon haben später - sehr viel später - die Vorstellung vom absoluten Wert des Individuums und der Autonomie jedes Menschen von der Religion übernommen. Das säkulare Konzept der Menschenwürde ist aber nichts anderes als die von seinen religiösen Konnotationen befreite Version der von Paulus verbreiteten christlichen Botschaft. In der von Paulus verbreiteten Botschaft vom göttlichen Funken in jedem Menschen waren noch weitere soziale und politische Sprengkapseln versteckt. Zum Beispiel die implizierte Gleichheit vor Gott von Mann und Frau. Oder von Herr und Sklave. Gott ist durch seinen Geist ganz nah bei jedem ...Die Verbreitung des Christentums ging mit Gewalt einher… Und dennoch kann man der christlichen Religion selbst als hartgesottener Kirchengegner nicht absprechen, dass sie eine Idee in die Welt gebracht hat, die der antiken Welt komplett fremd war: den Kult der Schwachheit...Mit diesem Paradox - Sieg durch Gewaltverzicht – formulierte er (gemeint ist Paulus, Anm. RH) etwas, was zum ideellen Kern der westlichen Welt wurde, auch des späteren, säkularen Wertekanons des Westens: die Achtung vor dem Schwachen, die Sorge um Hilfsbedürftige, die Verpflichtung für das Leben jedes Einzelnen. Ein Christ wird nicht behaupten, dass dieser Geist die Welt regiert, erst recht nicht im Westen, aber es lässt sich auch schwerlich leugnen, dass dieser Geist in unserer Gesellschaft etwas höchst Revolutionäres bewirkt hat. Die Geringschätzung der rohen Macht des Stärkeren, die Zügelung von Willkür, all das, was westliche Vorstellungen von Fairness und Rechtsstaatlichkeit ausmacht, hat sich - als stabileres Fundament für eine fortschrittliche Gesellschaft erwiesen als Willkürherrschaften. Die Stärke des westlichen, des europäischen Modells ist offenbar ihr Respekt vor Schwäche...Es gibt auch guten Grund, sogenannte <<westliche Werte>> zu verteidigen. Im Kern - das wird nur häufig vergessen - basieren sie auf der Achtung vor dem Schwachen. Deswegen haben wir so ein dichtes Netz an Krankenhäusern. Sonst gäbe es in Europa keinen auf Solidarität gründenden Wohlfahrtsstaat, der allen Bürgern und Einwanderern die Chance auf Teilhabe an der Gesellschaft gibt. Würde das europäische Gesellschaftsmodell nicht auf dem Prinzip der Achtung vor dem Schwachen gründen, wäre Europa nicht so attraktiv und würde nicht Menschen aus Kulturen anziehen, die diese Achtung nicht kennen." 4
Ganz ähnlich argumentierte schon vor vielen Jahren der Literaturnobelpreisträger Heinrich Böll:
"Selbst die allerschlechteste christliche Welt würde ich der besten heidnischen vorziehen, weil es in einer christlichen Welt Raum gibt für die, denen keine heidnische Welt je Raum gab; für Krüppel und Kranke, Alte und Schwache, und mehr noch als Raum gab es für sie: Liebe für die, die der heidnischen und der gottlosen Welt nutzlos erschienen und erscheinen...ich empfehle es der Nachdenklichkeit und der Vorstellungskraft der Zeitgenossen, sich eine Welt vorzustellen, auf der es Christus nicht gegeben hätte, eine Welt, die der gleichen müsste, wie sie der Quinicey in seinen Opiumträumen sah"5
Wie passt das zusammen? Wie können diese unterschiedlichen, ja gegensätzlichen Wahrnehmungen erklärt werden? Gibt es eine Verbindung zwischen diesen Gegensätzen? Wir leben in einer sehr ambivalenten Zeit, die geprägt ist von einer bis zum Zerreißen drohenden Spannung: Einerseits vom (Alb)Traum scheinbar menschlicher Allmacht und gleichzeitig von abgrundtiefer Angst und Ohnmacht. Es hat den Anschein, als können und wissen wir (fast) alles. Und offensichtlich ist die gleichzeitige Empfindung der Ohnmacht vor Schrecknissen apokalyptischen Ausmaßes noch nie so groß wie heute. Diese Ambivalenz scheint den Menschen von heute nicht nur zu kennzeichnen. Sie scheint ihn – wenn wir uns nur die jüngsten Terror – Szenarien weltweit vor Augen führen - buchstäblich zu zerreißen.
3 Eugen Drewermann, Das Wichtigste im Leben“, Ostfildern 2015, S. 64 ff; ursprünglich aus Eugen Drewermann „Jesus von Nazareth“, 32 f
4 Alexander von Schönburg "Weltgeschichte - to go – rororo-Taschenbuchverlag, Berlin 2017, S. 103 ff
5 "Sie gaben Zeugnis" - herausgegeben von Anton Gundlach, München, 1958, S. 93 f
II. Glaubensvermittlung in heutiger Zeit
1. Hinführung
Um die Situation besser zu verstehen, ist ein geschichtstheologischer Hinweis nötig, der es auch erlaubt, dieses heutige menschheitliche Drama geschichtlich entsprechend einzuordnen:
"Es ist grundlegend wichtig zu sehen, dass es echten Atheismus erst nachchristlich gibt: als Antitheismus. Vorher gab es die Möglichkeit, zugleich religiös und >>atheistisch<< zu sein: etwa im Buddhismus. Der Weltgrund war eben ein tief verborgenes Geheimnis, das noch jenseits aller vorstellbaren Gottesbilder lag.….Seit Jesus Christus mit dem Anspruch auftrat, als Sohn Gottes die unmittelbare Darstellung seines göttlichen Vaters zu sein und den Geist Gottes zu besitzen und ihn sogar zu verleihen: seither kann der Mensch sich anmaßen, selber das Absolute, das Autonome sein zu wollen, das sich selber Gesetz ist…Hier wird nur vergessen: dass Christus in der Gestalt der >>Erniedrigung<< erschien…6
Die Frage, die sich angesichts dieses ‚Befundes‘ mit umso größerer Dringlichkeit stellt, ist die nach dem „Ort des Glaubens“ in dieser Zeit, in dieser Situation.7 Dabei