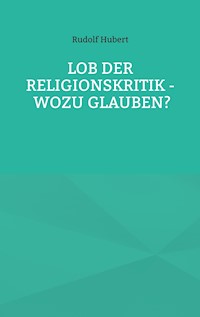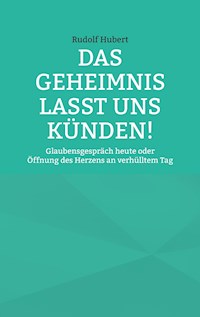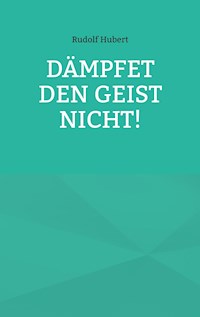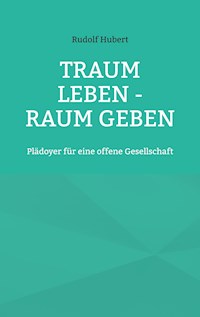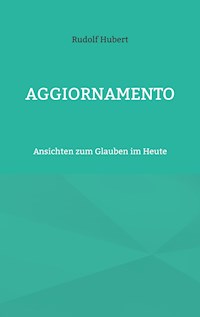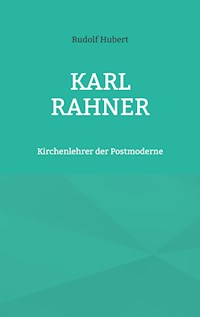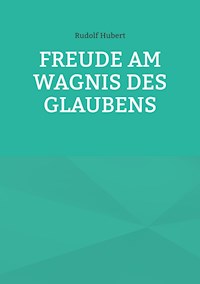
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
n unser heutigen Gott-fernen Zeit ist der Glaube an die Frohe Botschaft, an das Evangelium, eine besonders große Herausforderung, ein Wagnis der besonderen Art. Doch dieses Wagnis soll doch auch zur Freude dienen. In diesem Buch werden zu diesem Thema Theologen wie Karl Rahner und andere hörbar. Herausgeber: Hans-Jürgen Sträter, Adlerstein Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 68
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Theologische Grundfragen
Glaube und Unglaube
„Fels des Atheismus“
Die agnostische Grundbefindlichkeit unserer Zeit
„Für den, der staunt, steht alles in Frage“
„Die tiefste Erfahrung des Menschen ist nicht der Mensch, sondern Gott
Fragen praktischer Pastoral – Orte kirchlichen Lebens in Pastoralen Räumen
Hinführung
Aussagen des II. Vatikanischen Konzils zur Kirche in der Welt von heute
„Vom Glauben inmitten der Welt“
Strategie
Missionsbemühung
Glaubenden
Mystagogie
Zum Autor
A) Theologische Grundfragen
I. Glaube und Unglaube
Das Buch „Glaube und Unglaube“1 von Friedrich Heer2 und Gerhard Szczesny,3 wurde vor nunmehr fast 60 Jahren geschrieben. Dieses kleine, in Briefform verfasste, Bändchen scheint schon vor über einem halben Jahrhundert die wichtigsten religiösen Fragen von heute aufgenommen bzw. vorweggenommen zu haben. Es war und ist für mich nach wie vor ebenso spannend wie lesenswert. Und es betrifft nicht nur die Fragen, sondern ebenso die Antwortversuche. Friedrich Heer versucht in beeindruckender Art und Weise seinen Glauben so zu formulieren, dass ein Dialog mit Gerhard Szczesny tatsächlich „auf Augenhöhe“ gelingt.
Ich möchte meine Aussage an einem kleinen Beispiel aus diesem Buch exemplarisch aufzeigen. Am Ende seines ersten Briefes4 formuliert Szczesny die entscheidende Frage an Heer unter ausdrücklicher Bezugnahme auf Reinhold Schneiders5 letztes und vielleicht bedeutsamstes Werk „Winter in Wien“6.„Winter in Wien“ war und ist ein ebenso schwieriges wie theologisch aufregendes Buch. Nach Meinung von Eugen Biser, Karl Pfleger und Klaus Hemmerle gilt es als eines der wichtigsten theologischen Bücher des 20. Jahrhunderts.7 Und das nicht so sehr wegen der Antwortversuche, sondern eher wegen der Tiefe der Fragen an den Glauben, ohne diesen preiszugeben. Die Frage Reinhold Schneiders, auf die sich Szczesny bezieht, lautet:
„Ist sie (nämlich die Frage nach der Unsterblichkeit) aber nun dem Menschen wesentlich? Ist sie unabdingbar? Nein“.8
Auf die Antwort Heers hab‘ ich recht lange warten müssen. Friedrich Heer, der bekannte Kulturphilosoph aus Wien und Freund Reinhold Schneiders, kam auf diese Frage Szczesnys erst in seinem letzten Brief an seinen kritischen Freund zurück. Dort formuliert er pointiert und eindeutig:
„Hier stelle ich mich Ihrer wichtigsten und größten Frage und wiederhole sie noch einmal: Welche humanisierende Bedeutung soll das Ewige Leben für Menschen haben, die die Unsterblichkeit des Individuums weder für glaubwürdig halten, noch ersehnen?“
Antwort: der Christ hat die Aufgabe, eben diese humanisierende Bedeutung des Ewigen Lebens durch sein eigenes Leben, durch seine Präsenz, seinen nichtchristlichen Brüdern darzustellen.“ 9
Soweit das Zitat von Friedrich Heer, der sicherlich dabei auch das Engagement und Zeugnis Reinhold Schneiders, besonders in der Zeit des Nationalsozialismus und sein Eintreten für einen konsequenten Pazifismus in den Jahren der Aufrüstung in Ost und West, mit im Blick hatte.10 Schneider, der aktiv für den Frieden eintrat und dafür selbst Anklagen und Verleumdungen hinnehmen musste, berichtete in seinem letzten Werk im Winter 1957/58 von einem Besuch bei Friedrich Heer in Wien.11
Szczesny - als bekennender Atheist – formulierte seine Sicht auf das Christentum in einer Art und Weise, die der Antwort Heers nicht unähnlich ist:
„Das Christentum hat nur dann eine Chance, die kommenden Jahrzehnte und Jahrhunderte zu überleben, wenn es bereit ist, mit allen anderen, alten und neuen, das Ganze der Welt und des Daseins ins Auge fassenden Glaubensentwürfen eine universale Front gegen jene Mächte zu bilden, die unser Leben auf Funktionalität, Produktivität und Kollektivität reduzieren wollen.“12
Mir scheint, dass diese Aussage exakt jene Aufgaben und Herausforderungen beschreibt, denen sich die Kirche – heute mehr denn je - gegenübersieht bzw. denen gegenüber sie ihren Auftrag zu erfüllen hat. Vielleicht bedarf es – auch heute – solch einer weit- und hellsichtigen Klarheit eines konsequenten Religionskritikers, damit wir der buchstäblichen Notwendigkeit des Glaubens ansichtig werden.
II. „Fels des Atheismus“?
Die Fragen des Leides, der Not und des Todes gehören ganz sicher zum „Felsen des Atheismus“ (Büchner).13 Wie kann man als gläubiger Mensch damit „in intellektueller Redlichkeit“ (Karl Rahner)14 umgehen? Denn man wird zugeben müssen, dass die vielfältigen Fragen von Leid, Not und Tod den Glauben an den ‚lieben‘ Gott zumindest stark irritieren. Einen ersten
Hinweis auf diese, so genannte Theodizeefrage, können wir einem Brief Karl Rahners entnehmen:
„Es ist doch eigentlich so, dass der Atheist, für den dieses Leid eine absolut unlösbare Endgültigkeit hat, dieses Leid gerade als letztlich belanglos, als endlich, als eine Unvermeidlichkeit einer sich entwickelnden und sich immer wieder aufs Neue in ihren Gestalten auflösenden Natur erklären muss. Der Atheist hat das geringste Recht, dieses Leid der Welt besonders wichtig zu nehmen. Ein Mensch, der glaubt, dass Gott existiert als ein heiliger, gerechter, liebender, unendlich mächtiger Gott, für den ist eigentlich das Leid erst ein wahres Problem. Er löst es dann nicht, aber er kann wirklich einsehen, dass gerade er von seiner Position her viel radikaler dieses Leid als Frage ernst nehmen kann als ein Atheist, der im Grunde genommen von vornherein sich mit der Absurdität dieser Welt, dieser Naturentwicklung, dieses Aufgehens und Abstürzens zufrieden geben muss.“15
Heiner Geissler denkt viele theologische Antwortversuche auf die Frage, wie Gott, Leid und Tod zusammen gehen (können) konsequent durch und schreibt dann in seinem jüngsten Buch “Kann man noch Christ sein, wenn man an Gott zweifeln muss?“16
„Es gibt das plausible Argument von Dostojewski und Kant, Gott sei das Postulat der praktischen Vernunft. Aber selbst die Vorstellung dieses Gottes kann nicht in Übereinstimmung gebracht werden mit dem millionenfachen Unrecht, dem Hungertod, den Leiden und den Schmerzen der Menschen und der seit Tausenden Jahren praktizierten Gewaltanwendung der Stärkeren gegen die Schwachen, der Mächtigen gegen die weniger Mächtigen. Aber noch etwas steht mit Sicherheit fest: Den Gott, wie ihn die Theologie der christlichen Kirchen beschreibt, kann es nicht geben…Der Glaube an diesen Gott gibt uns keine Antwort, welchen Sinn das Leiden auf der Erde hat. Wir müssen also mit der Sinnlosigkeit des Leidens leben. Wir haben als Christen keine bessere Sinndeutung des Leidens in der Welt als jeder andere auch. Deswegen wird das Leiden für viele immer mehr zum <<Fels des Atheismus>>.“17
Dieser Herausforderung können wir nicht entlaufen; auch und gerade dann nicht, wenn es um die Glaubensweitergabe geht, um die kritischen (Nach) Fragen der Kinder und Enkel, der Freunde, Bekannten und Nachbarn. Ich möchte von daher noch eine gläubige Stimme zu dieser Frage beibringen, die dieser Herausforderung auch sprachlich eine Form gibt, die jedes Achselzucken und leichtfertige Antwortversuche ad absurdum führt:
„Der suchende Mensch, der simpel oder gelehrt philosophiert, kann sich nie bis zu dem Satz vortasten: Gott ist die Liebe. Gegen diesen Satz erhebt die Welt, wie sie nun einmal aussieht, kategorischen Einspruch…Es sei denn, der Mensch ziehe es vor…aus eigener heroischer Kraft sich mitten in der zerreißenden Existenz aufzuschwingen, wie Nietzsche, zur Bejahung der Welt, wie sie ist: Ja und Amen in alle Ewigkeit zu diesem wiederkäuenden Ungeheuer, diesem Willen zur Macht. Er sehe aber zu, dass er keines der Konzentrationslager aus dieser Bejahung ausklammere. Er mag es versuchen und zusehen, ob er dabei seine heilen Sinne behalten kann.“18
Behutsam nimmt uns Karl Rahner angesichts dieser realen Anfechtung mit auf den Weg auf der Suche nach Antwort, die eine aufgehende, allseits befriedigende Lösung sich von selber verbietet. Weil Karl Rahner diese Frage in einer Tiefe aufnimmt, die die Antwort in gewisser Weise schon ‚mitbringt‘, soll er ausführlich zu Wort kommen. Seine Aussagen zu dieser – für den Glauben lebenswichtigen – Frage haben an Aktualität und theologischer Brisanz nichts eingebüßt, ganz im Gegenteil, sie werden immer relevanter, ja unentbehrlich, wenn es um „Glaubensrechenschaft in intellektueller Redlichkeit“ geht: