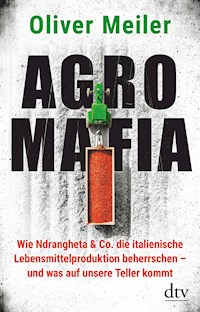
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Mafia im 21. Jahrhundert: Tomaten sind das neue Kokain Der größte Exportschlager Italiens ist seine Küche. Der Anteil der Mafia an diesem Geschäft: 25 Milliarden Euro jährlich. Sie kontrolliert nicht selten gesamte Lieferketten, vom Anbau bis zum Endprodukt. Und durch die Coronakrise hat sich ihr Einfluss noch vergrößert. Die Leidtragenden sind die Bauern und Händler – aber auch die Käufer italienischer Lebensmittel: wir. Oliver Meiler hat mit Richtern der nationalen Anti-Mafia-Behörde und von der Mafia bedrohten Journalisten und Herstellern vor Ort gesprochen. Er nimmt uns mit auf eine Reise durch die Essenslandschaften Italiens, zeichnet die Wege von Olivenöl, Mozzarella und Co. bis zu uns nach und deckt die mafiösen Strukturen dahinter auf. Atmosphärisch, fesselnd, erschütternd!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Oliver Meiler
Agromafia
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Inhaltsverzeichnis
Prolog – Wie Italien mit seinem Essen die Welt eroberte und die Mafia sich auf ihre Ursprünge besann
»Die Mafia ist auf dem Land geboren, und auf dem Land findet sie zurück zu ihrer Berufung.«
Paolo Borrometi, italienischer Journalist
Das Vermächtnis des »Paten«
Am Anfang steht die Geschichte mit den Fleischklößchen, geschmort in Olivenöl und an Tomaten. Im ersten Teil der Filmtrilogie Der Pate von Francis Ford Coppola gibt es eine legendäre Szene, sie spielt in einer Küche. Im Hintergrund sitzen Männer an einem Tisch und essen. Pete Clemenza, den sie auch »Fat Clemenza« nennen, steht am Herd. Er holt Michael Corleone zu sich und führt ihm das Rezept von Pasta mit meatballs vor, mit Fleischbällchen, eine Fusion aus sizilianischer und amerikanischer Küche.
Man könne nie wissen, sagt er zu ihm, vielleicht müsse er ja mal für 20 Männer kochen, und führt die Zubereitung gleich vor, gießt Öl in die Pfanne, lässt es ordentlich heiß werden, gibt Knoblauch dazu, ein paar frische Tomaten und Tomatenmark. Man müsse nur aufpassen, dass es nicht ansetze. Dann lässt er alles schmoren, gibt die Wurst hinzu, die Klößchen, einen Schuss Wein und einen Löffel Zucker. Der Zucker, sagt Clemenza, sei der Trick.
Die italo-amerikanischen Gangster und ihre Vorliebe für gutes Essen. Mit solchen Szenen hat Der Pate das Bild, das man sich außerhalb Italiens von der sizilianischen Mafia macht, für immer besetzt. Gewissermaßen romantisiert. Das Essen ist zentral, ständig wird gegessen. Beim Essen zelebrieren die Bosse die Einheit der Familie, die Tradition, die Liebe. Der Film beginnt mit einem großen Hochzeitsgelage. Und als Don Vito Corleone angeschossen wird, hat er gerade zwei Orangen bei einem Gemüseladen gekauft. Er sackt auf der gegenüberliegenden Straßenseite zusammen. Ein Kind weint, ein Hund heult. Die Orangen sind eine Metapher für Sizilien, fürs Leben, eine Verneigung vor der Heimat.
Man kann Coppola nicht vorwerfen, er habe Vorurteile über die Italiener verbreiten wollen. Er selbst hat italienische Wurzeln. Doch Der Pate aus den Siebzigerjahren, ein Klassiker, ist voller Klischees über Italien, über die italianità, die italienische Lebensart, und die Mafia, die sich mit Macht in die Köpfe gegraben haben. Und wie das nun mal so ist mit Gemeinplätzen: Sie sind wahr, wenigstens zum Teil.
Wahr ist zum Beispiel, dass sich die Mafia immer schon für das Essen interessierte. Die Bräuche zu Tisch sind ihr wichtig, sie festigen die Gemeinschaft. In Kalabrien zum Beispiel enden Taufen neuer Clanmitglieder und strategische Sitzungen immer mit einem Mahl. Und mit Wein. Jeder Familie gehört mindestens ein Restaurant, manche besitzen hunderte davon.
Das Geschäft mit dem Essen, mit Gemüse und Früchten, Olivenöl und Mozzarella, Pizza und Pasta, ist in den vergangenen Jahrzehnten zu einem bedeutenden Sektor im Portfolio der Mafia geworden. Jedes Jahr etwas mehr. Es ist ihr zweitgrößtes Geschäft, mehr als 24 Milliarden Euro nimmt sie damit im Jahr ein. Nur Drogen bringen noch mehr, aber Drogen sind illegal, schon bevor sie in die Hände der Mafia geraten.
Essen ist Bedürfnis, Alltag, Freude. Noch nie kam uns die Mafia so nah: Sie hat sich zu uns an den Tisch gesetzt, sich auf den Teller geschlichen. Das Business der Agromafia, wie man die Mafia vom Feld und der Lebensmittelproduktion nennt, wächst parallel zum Erfolg der italienischen Küche. Und dieser Erfolg ist phänomenal, weltumspannend, eine der ganz großen Geschichten.
Pizza, Pasta, Tiramisù
Italien und sein Essen. Wäre auch die italienische Sprache so bekannt, würde die Welt nicht von food sprechen, wenn es um das Elementare und Köstliche geht, um die Gaumenfreuden, so sie einem vergönnt sind. Sondern von cibo, ausgesprochen: tschibo. Andere Länder begründen ihre Macht auf Erdöl. Auf Ingenieurskunst oder auf ein mächtiges Militär.
Die Italiener haben ihr Essen. Soft Power, pfannenweise.
Natürlich haben sie auch Mode, Design, die große bellezza ihrer Städte, das Vermächtnis ihrer Künstler und Dichter. Vor allem aber hat Italien sein Essen und die ganze Kultur drum herum: das unendliche Tafeln in Gesellschaft an langen Tischen, die Verklärung der Natur und ihrer Früchte, das wunderbare Theater des Lebens.
Von den vier italienischen Wörtern, die sich die Welt gut merken kann, handeln drei vom Essen. Nach »Ciao« kommen »Pasta«, »Pizza«, »Tiramisù«. Für viele ist es ein Dreiklang aus der Sehnsuchtskiste. Danach kommen wohl bald »Mozzarella«, »Pesto«, »Carpaccio«, »Carbonara«. Und »Prosecco«, »Cappuccino«, vielleicht auch »Gelato«.
Keine nationale Küche hat international so viel Erfolg wie die italienische. Nicht als hohe Gastronomie, nicht als Nouvelle Cuisine oder als kulinarisches Spektakel für Reiche. Sondern als bekömmliche Weltküche für fast alle, als cucina franca. Billig, einfach und unendlich variabel.
Auf der Rangliste der Länder mit den meisten Restaurants in der Kategorie »Drei Sterne« im Guide Michelin, dem maßgeblichen Gastronomieführer, belegt Italien keinen der ersten drei Plätze. Zählt man aber die Lokale zusammen, die überall auf der Welt italienisches Essen anbieten, kleine und große, Pizzerien und Restaurants, Osterien und Trattorien, dann ist die cucina italiana, die italienische Küche, ohne Konkurrenz.
Viele italienische Speisen sind einst in der Armut geboren und wurden von den Emigranten in die Welt getragen, als Heimwehstiller. Die Apulier nahmen Apulisches mit, die Sizilianer Sizilianisches, die Piemonteser Piemontesisches. Das Paradegericht aber war und ist die Pasta al pomodoro, Teigwaren an Tomaten. Ohne die Fleischklößchen von »Fat Clemenza«. Pasta und Tomaten gehen immer, auch wenn sonst gar nichts mehr geht. Es ist das Nationalgericht einer Nation, die erst im 19. Jahrhundert zusammengefunden hat. Ihr größter gemeinsamer Nenner, ihre gastronomische Quintessenz. Mit einigen Blättern Basilikum obendrauf, etwas Olivenöl und fein geriebenem Parmigiano Reggiano.
An der Qualität des Tomatensugo, sagen die Italiener, erkennt man, ob ein Restaurant auch komplexere Gerichte gut hinbekommt. Er ist der Test. Meistens wird die Pasta al pomodoro mit Spaghetti zubereitet, die früher Vermicelli hießen, Würmchen. Natürlich al dente, bissfest. An den Spaghetti hängt der sugo besonders gut. Aber es geht auch mit den feineren Capellini, den Härchen, den dickeren Bucatini, die innen hohl sind, mit den breiteren Fettuccine, den Tagliatelle, den Pappardelle. Oder mit pasta corta, kurzen Teigwaren also: Penne, Rigatoni, Farfalle, Lumache, Conchiglie. Wahrscheinlich waren es die Araber, die die trockenen, leicht haltbaren Teigwaren nach Italien brachten, als sie im frühen Mittelalter Sizilien eroberten.
Aber heutzutage ist das nicht mehr von großer Bedeutung. Die Italiener haben die Pasta für sich entdeckt und ihr mit den Jahrhunderten einen derart prominenten Platz eingeräumt, dass die Ursprungsdebatte bestenfalls die Historiker interessiert. In den Anfängen war sie ein Essen für Reiche. Je mehr Pasta jemand aß, desto wohlhabender musste er sein. Man kochte sie durch, bis sie ganz weich war, und aß sie mit Löffeln. Zunächst war Pasta eher eine Süßspeise, versetzt mit Zucker.
Im Neapel des 19. Jahrhunderts wurde sie dann salzig. Und da Neapel damals eine stilgebende Großmetropole war, dauerte es nicht lange, bis die neue Interpretation auch in anderen Städten ihre Anhänger fand. Alles ließ sich in der Pasta verarbeiten, auch Fisch und Fleisch, oder wie die Italiener sagen: mare e monti, Meer und Berge. Dazu alle Gemüse, Käse, Pilze, Ei, einfach alles. Die Reste des Vortags. Und die besten und frischesten Produkte vom Markt. Oder nur Öl und Chili, olio e peperoncino.
Die italienischen Auswanderer trugen die Pasta dann in alle Welt, buchstäblich, mit sich im Schiff in die USA und nach Lateinamerika, später in schwer beladenen Autos in den Norden Europas. Sie waren die Botschafter des italienischen Essens, die Pioniere seiner Verbreitung. Zu Beginn wurden die Gerichte belächelt und gemieden, wie die Emigranten selbst auch: Man nannte die Italiener Spaghetti- oder Maccheroni-Fresser, und das war nicht anerkennend gemeint. Mit der Zeit aber gewannen die Italiener und ihr Essen die Herzen der einheimischen Bevölkerung und ließen sie nie mehr los.
Sie sind Trendsetter geworden. Was den Italienern schmeckt und gefällt, trifft meist den kollektiven Geschmack. Wenn sie zum Beispiel in ein großbauchiges Glas einen knalligfröhlich orangenfarbenen, eigentlich viel zu süßen und in Vergessenheit geratenen Bitter aus Padua kippen, Prosecco und Soda dazugeben, einen Orangenschnitz, dann trinken bald alle Spritz, und die Seele wandert in den Süden. Am beliebtesten ist er übrigens in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Egal, auf welchen Kontinent man blickt, überall lässt sich dieselbe Korrelation beobachten: Je stärker ein Land wirtschaftlich wächst, desto größer wird die Nachfrage nach italienischen Produkten, nach italienischem Frisch- und Hartkäse, nach italienischen Weinen, nach italienischem Olivenöl, nach Schinken aus Parma und San Daniele. China zum Beispiel führt von Jahr zu Jahr mehr italienische Esswaren ein. Zwischen 2008 und 2018 wuchs dort der Import von italienischen Lebensmitteln um 254 Prozent.[1] Wer hätte gedacht, dass die Chinesen, die ebenfalls sehr genaue Vorstellungen davon haben, was bei ihnen auf den Tisch kommen soll, einmal so angetan sein würden von einer ausländischen Küche. Unter vermögenden Chinesen gelten italienische Produkte mit Gütesiegeln oder eccellenze, wie die Italiener sie nennen, auch als Statussymbole.
Es gibt eine ganze Menge davon. Kein Land bringt mehr Produkte hervor, die als schützenswert gelten und bei der Europäischen Union mit Herkunftsmarken registriert sind. Von den rund 3000, die auf dieser Liste mit Gütesiegeln stehen, kommt fast ein Drittel aus Italien. Das ist kein Monopol, aber viel fehlt nicht. Die Italiener, um es pauschal zu sagen, essen selbst auch wahnsinnig gerne italienisch. Auf ausländisches Essen könnten viele ganz verzichten.
Diese fast exklusive Liebe der Italiener zum eigenen Essen führt dazu, dass nirgendwo sonst die Schere zwischen Import und Export von Esswaren so stark auseinanderklafft: Italien ist mit deutlichem Abstand der weltweit größte Nettoexporteur von Lebensmitteln. Gefolgt von Japan, der Türkei, Mexiko und Thailand, alle weit abgeschlagen. Frankreich kommt erst an sechster Stelle, obschon man denken könnte, es sei ähnlich erfolgreich auf dem Weltmarkt.[2] Doch die Franzosen essen »ethnischer«, allein die vielen Restaurants aus den ehemaligen Kolonien wollen beliefert sein mit Waren aus Nordafrika, aus Schwarzafrika und Asien. Deutschland wiederum gehört zu den größten Nettoimporteuren. Noch mehr Lebensmittel führen nur Spanien, Australien, Kanada, Großbritannien, Brasilien, China und die USA ein.
Slow Food und Food Porn
Selbst in schwierigen Zeiten schafft es die italienische Lebensmittelindustrie, ihren Erfolg noch auszubauen. In der jüngsten Wirtschaftskrise, die Italien stärker und länger gefangen hielt als andere große europäische Länder, von 2008 bis 2018, wuchs nur noch das Geschäft mit dem Label »Made in Italy«, das für alles Italienische wie die Exportschlager Kleider, Möbel, Maschinen steht, sowie der settore agroalimentare, der Landwirtschafts- und Lebensmittelbereich. Als im Frühjahr 2020 Corona ausbrach und alles lahmlegte, in Lockdown und Shutdown, lief dieser Sektor einfach weiter, ohne Probleme in den Fleischereien, den Käsereien, bei der Ernte auf den Feldern und ohne Engpässe bei der Lieferung. Auf keines ihrer geliebten Lebensmittel mussten die Italiener verzichten, als sie auf fast alles verzichten mussten. Vielleicht kauften sie anders ein, mehr online, aber sonst veränderte sich nichts. Der Export von Früchten und Gemüsen aus Italien ist im ersten, dramatischen Halbjahr 2020 sogar gewachsen im Vergleich zur selben Zeitspanne im pandemie- und krisenfreien Vorjahr.[3] Das Essen, es ist ein fast dämmerfreies Geschäft, ein tragender Pfeiler der nationalen Wirtschaft.
Mit dem cibo werden in Italien jährlich 140 Milliarden Euro umgesetzt.[4] Bei dieser Angabe wird nur der Handel mit den Produkten gerechnet. Zählt man alles dazu, was darüber hinaus noch zur Branche gehört, nämlich die italienischen Restaurants, der Verkauf von italienischen Maschinen für die Herstellung von Dosentomaten und Teigwaren, der Transport und die Verteilung von Gemüse und Früchten, kommt man auf einen Betrag von 540 Milliarden Euro pro Jahr. Das entspricht dem Bruttoinlandsprodukt von Norwegen und Dänemark, zusammengenommen.
Fast jeder fünfte italienische Arbeitnehmer ist in dieser Industrie tätig, 3,8 Millionen sind es insgesamt.[5] Sie arbeiten auf Feldern und in Rebbergen, in Märkten und Fabriken, in Pizzerien. Der settore agroalimentare ist zu einem der größten Arbeitgeber des Landes geworden, größer noch als der Staat. Er steht für 25 Prozent des italienischen Bruttoinlandsprodukts. Und er wächst kontinuierlich.
Die Zeiten für einen weiteren Expansionsschub sind ideal. Ernährung ist zur Religion geworden. Spitzenköche werden wie Rockstars gefeiert, das Fernsehen ist voll mit Kochshows. Wo immer man hinzappt, überall kocht jemand. Oder misst sich beim Kochen mit anderen.
Im Restaurant zücken wir zuerst das Handy und fotografieren den Teller vor uns für die Freunde in den sozialen Netzwerken, bevor wir zur Gabel greifen. Influencer und Blogger machen das beruflich, manchen von ihnen folgen mittlerweile mehr Leute, als große Zeitungen Leser haben. Der Begriff Food Porn ist zum Modebegriff geworden, so schnell wird er wohl nicht wieder aus unserem Wortschatz verschwinden.
Im reichen Teil der Welt scheint sich fast alles um das gesunde und politisch korrekte Essen zu drehen. Um die vegetarische oder vegane Gestaltung des Nahrungshaushalts. Um Allergien, von denen man bis vor Kurzem noch nie etwas gehört hatte. Um so genannte Superfoods. Um die Geschichten hinter der Ernährung. Man ist, was man isst.
Jeder will wissen, wo das Essen herkommt, und zwar ganz genau. Nach Jahrzehnten fiebriger Globalisierung, in denen alles von überall immer überall verfügbar sein sollte, besinnen sich viele wieder auf die Saisons von Früchten und Gemüsen, auf kurze und umweltschonende Transportwege, auf die schönen Dinge aus dem eigenen Beet, von Dachgärten in Städten und von vertikal angelegten Feldern, auf Bio von nebenan.
Slow Food erfreut sich international großer Beliebtheit, was der italienischen Küche und ihrem Geschäft gelegen kommt. Gegründet wurde die Gegenbewegung zum Fast Food bereits 1986 – im Piemont. Und wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass der Kopf hinter der Initiative ein Soziologe ist: Carlo Petrini aus Bra, Sohn einer Gemüsehändlerin und eines Eisenbahners. Als Petrini die Bewegung ins Leben rief, war er der Meinung, dass das Essen seine Würde verliere, wenn alles schnell gehen müsse und der Mensch seinen Bezug zur Natur und zur traditionellen Herstellung von Lebensmitteln verliere. Was schon immer war, soll auch immer bleiben. Nicht unverändert, aber verwurzelt im kulturellen Erbe. Slow Food breitete sich schnell aus, es entstanden daraus auch eine Universität und eine internationale Konferenz, die Terra Madre heißt, Mutter Erde.
Die dieta mediterranea, wie die Italiener die Mittelmeerküche nennen und damit vor allem ihre eigene meinen, entspricht ziemlich genau dem gegenwärtigen Kanon bewusster Ernährung. Sie ist frisch, leicht, ausgewogen und gesund. Wer sie richtig lebt, der erliegt keinen Exzessen. Auf ihrem Speiseplan stehen täglich Getreide und ein Glas Rotwein, drei Mal in der Woche Fisch und Gemüse, zwei Mal in der Woche Käse und weißes Fleisch, einmal rotes Fleisch, Wurstwaren, Süßigkeiten. Gekocht wird allein mit kalt gepresstem Olivenöl, dem Saft der Götter. Es dient auch als Veredler. Fast überall wird es hinzugegeben, weil es fast zu jedem Gericht passt.
Als die UNESCO2010 die Mittelmeerküche in ihre Liste mit immateriellen Kulturerben aufnahm, hob sie nicht nur die Traditionen und Riten bei der Herstellung der Produkte hervor, beim Ernten und Fischen, sondern auch das Soziale, das Zusammensein: »Das gemeinsame Essen ist die Basis für die kulturelle Identität und deren Fortleben in allen Gemeinschaften rund um das Mittelmeer.«[6]
Die Mittelmeerküche ist schon lange nicht mehr eine Küche von Armen für Arme. Sie ist für viele zum Mantra geworden. Mag sein, dass ihre Überhöhung auch dem Marketing geschuldet ist. Vielleicht stimmt es ja gar nicht, dass man länger lebt, wenn man mediterran isst, wie Studien behaupten. Dass man damit zum Beispiel Herzkrankheiten vorbeugen kann, wie es der gesunde Lebensabend vieler Menschen auf Sardinien, im Cilento und auf Kreta zu belegen scheint. Aber der Umkehrschluss ist wohl noch unwahrscheinlicher.
Von Piraten und Plünderern
Der Triumph der italienischen Küche, diese Welteroberung, birgt auch Gefahren. Er ruft Trickser und Betrüger auf den Plan, jeder will etwas vom Kuchen.
Weil alles, was italienisch klingt, wie Gesang in den Ohren vieler Menschen liegt und die Kauflust weckt, sind auch die Imitatoren nicht weit, die Etikettenschwindler. In Italien nennt man sie »Agropiraten«. Gemeint sind jene Hersteller überall auf der Welt, die vorgeben, beste italienische Produkte zu verkaufen, »Made in Italy« also, die nach Italien riechen und schmecken sollen. Auf die Verpackungen und auf die Flaschen kleben sie Fotos vom Kolosseum, vom schiefen Turm von Pisa oder von der Rialto-Brücke in Venedig und geben den Produkten italienische Namen. Meistens ist nichts daran italienisch, nicht einmal die Rechtschreibung der Namen, was dem Absatz aber nicht abträglich sein muss. Das Business mit dem »Italian Sounding«, dem italienisch Klingenden also, ist gigantisch. Schätzungen gehen von 60 bis 100 Milliarden Euro im Jahr aus.
Andere Länder würden sich das nicht bieten lassen. Die Franzosen zum Beispiel reagieren sehr rabiat, wenn ihre gastronomischen Exzellenzen kopiert werden, etwa der Camembert oder der Champagner. Die Italiener beneiden die Franzosen für dieses resolute Vorgehen und klagen dann jeweils, sie selbst seien unfähig, einheitlich aufzutreten, als starke, nationale Lobby auf internationalem Parkett.
Fare sistema, gemeinsam für eine Sache kämpfen, war noch nie eine besonders ausgeprägte Tugend in der italienischen Wirtschaft. Weder in der Mode noch beim Essen. Das hat auch damit zu tun, dass die meisten italienischen Unternehmen als mittlere, kleine bis sehr kleine Familienbetriebe entstanden sind. Die Konsortien und Kooperativen, in denen sie sich zusammenfinden, handeln nicht immer im Interesse aller. Am Ende gilt oft: jeder für sich.
Die unsichtbare Mafia
Das passt der Mafia. Fare sistema, das ist ihr Ding. Der Mafia ist die Branche rund ums Essen nicht nur lieb, sie ist ihr auch sehr vertraut. Sie kommt vom Land, dort ist sie geboren: auf den Feldern, auf den Weiden, in den Ställen.
Auf Sizilien ist es die Cosa Nostra, in Kalabrien die ’Ndrangheta, und in Kampanien sind es die Camorra und die Clans der Casalesi. Gemeinsam ist den Mafiosi dieser drei großen italienischen Kartelle, dass sie einst Bauern und Mittelsmänner von Großgrundbesitzern im Hinterland von Palermo, Reggio Calabria und Neapel waren.
Sie trieben die Feldarbeiter an, die sie zu Hungerlöhnen beschäftigten. Dann trugen sie das Gemüse und die Früchte auf die Märkte und in die Häfen der Städte und holten dort für die Herrschaften, die sie schickten, möglichst viel für die Ware heraus. Notfalls mit Gewalt.
Während die Preise anderswo in Europa an Börsen bestimmt wurden, war es im Süden Italiens die Mafia, die bestimmte. In den fruchtbaren Ebenen Kampaniens nannte man sie presidenti dei prezzi, Preispräsidenten. War ein Boss besonders gut darin, rief man ihn presidente unico, den einzig wahren Preispräsidenten. Besonders gut war einer, wenn er sich mit seinen Vorstellungen immer durchsetzte. Mit welchen Mitteln er das schaffte, war kaum von Bedeutung.
Im Verlauf des 20. Jahrhunderts wurde die Mafia immer stärker, die Scharnierfunktion hatte sie zusehends satt. Sie jagte die Feudalherren zum Teufel und übernahm die Ländereien. Der Weg vom Feld zum Markt und zum Kunden war nun in ihrer Hand. Die Sizilianer exportierten ihre Orangen schon bald ins Ausland, unter anderem nach Amerika, an die Gemüsestände von New York und Chicago.
La terra, das Land als Boden und Herkunft, ist der Mafia heilig. Sie beschwört es mit religiöser Ernsthaftigkeit, das dient dem Mythos. Auch cosca, das italienische Wort für Clan, kommt aus der Landwirtschaft: Artischockenherz. Jedes Blatt der Artischocke, jedes Mitglied, ist mit der Mitte verbunden, festgemacht am Herzen der Macht.
Mit dem Bild aus dem Paten hat die neue Mafia, die heute die kriminellen Geschäfte kontrolliert, nichts gemein. Die Gangsterromantik war immer schon verschroben, echte Paten spiegelten sich aber gerne darin. Die Filme aus Hollywood machten sie auf skurrile Weise sympathisch, sie banalisierten das Verbrechen. Das wirkt bis heute nach: Das Faszinosum ist noch immer stärker als die rohe Realität, zumindest außerhalb Italiens. Die Mafia wird nachhaltig unterschätzt, überall in Europa.
Regierungen und Ermittler lassen sich leicht in die Irre führen. Die neue Mafia ist stiller geworden. Sie schießt weniger als die alte, sie tötet kaum noch. Und das ist ein Grund für große Besorgnis. Denn das heißt, dass es ihr gut geht, dass ihre Geschäfte laufen, dass sie sich wohlig eingerichtet hat in der Gesellschaft, dass auch die Gleichgewichte unter den Clans funktionieren. Die Mafia tötet nur, wenn sie sich bedrängt fühlt.
In den vergangenen Jahren passierte das fast ausschließlich in Apulien, bei der Quarta Mafia, der vierten Mafia. So nennen die Experten das lose Konglomerat aus dem kleinen Kartell der Sacra Corona Unita und den anarchischen Banden im Foggiano, der Region rund um Foggia. Aber sonst?
Die neue Mafia wird von den gut ausgebildeten Nachkommen der alten, inhaftierten Bosse geführt, die ihre Hochzeit in den Achtziger- und Neunzigerjahren hatten, manche auch noch zu Beginn des neuen Jahrtausends. Die Clans haben ihre Sprösslinge an die besten Universitäten geschickt, auch an ausländische, damit sie dort Wirtschafts- und Rechtswissenschaften studieren. Und Informatik.
Weltgewandte junge Menschen sind das, mehrsprachig, mit internationalen Netzwerken und guten Umgangsformen. Sie müssen fähig sein, Computersysteme zu hacken, Geld zu verschieben, neue Märkte zu entdecken. Sie sollen Onlinewetten manipulieren, komplizierte Firmenkonstrukte mit Schachtelunternehmen bilden, mit Hochfrequenzhandel an der Börse und mit Immobilien die Einkünfte mehren. Die meisten Geschäfte der Mafia laufen noch immer mit Cash, vor allem der Drogenhandel. Bargeld hinterlässt keine Spuren. Doch mehr und mehr handelt sie auch mit Kryptowährungen.
Was sie selbst nicht übernehmen kann, lagert die Unterwelt an Spezialisten der Oberwelt aus, die ihnen helfen. An Notare, Treuhänder, Anwälte, Richter, Banker, Beamte, Polizisten. Man nennt sie colletti bianchi, Weißkragen, der Begriff leitet sich aus dem Englischen ab: von White-Collar Crime. Die meisten dieser Schnittstellenfiguren wissen, für wen sie arbeiten, wenn sie Zertifikate fälschen, Bauausschreibungen manipulieren oder Insiderinformationen weitergeben. Sie erhalten dafür außergewöhnlich hohe Kommissionen.
Ein Heer unbescholtener und unverdächtiger Bürger stellt sich da in den Dienst der Mafia, bis sie auffliegen. Neuerdings nimmt der Staat bei Razzien manchmal auch hunderte Personen gleichzeitig fest, stürmt Kanzleien und Studios, Villen in Residenzvierteln, Ämter und Rathäuser. Die meisten Verhafteten sind jeweils Weißkragen, denen die Justiz dann in mühseligen Verfahren nachweisen muss, dass sie dazugehören, dass sie eine Zwischenwelt bilden. Alles fließt ineinander.
Beim Versuch, der neuen Mafia einen Namen zu geben, behalfen sich die Kenner mit den üblichen Kategorien: »Mafia 2.0«, wurde sie schon genannt, oder »Mafia 3.0«. Auch »Mafia futuristica« konnte man schon lesen, die futuristische Mafia. Vielleicht trifft es die Definition von Saverio Lodato am besten, dem Autor von La Mafia invisibile: Die unsichtbare Mafia.[7]
Ihre Herrschaftsgebiete im Süden Italiens kontrolliert sie wie ehedem, in jede Ecke reichen ihre Arme. Doch sie macht keinen Lärm mehr. Sie nistet sich geduldig ein: in der Politik, den Ämtern und Freimaurerlogen, in allen Zentren der Macht, auch im Norden Italiens und im Ausland. Ihre Geschäfte sind längst international angelegt. Die kalabrische ’Ndrangheta unterhält Filialen überall auf der Welt, eine besondere Vorliebe hat sie für Deutschland.
Vor allem aber investiert die neue Mafia ganz massiv in die legale Geschäftswelt. Während der Wirtschaftskrise gelang es ihr, Milliarden aus dem Drogenhandel zu waschen. Das ging ganz einfach: Viele Unternehmen rangen ums Überleben, die Banken gaben kaum mehr Kredite. Die Mafia aber war liquid und kaufte alles zusammen, was es zu kaufen gab. Auch tausende Restaurants – und hektarweise Agrarland.
Der Ausbruch von Corona mit allen seinen unweigerlich verheerenden Folgen für die Wirtschaft, den Tourismus und die Gaststätten weckte neue Sorgen. In Italien hieß es schon bald, die Mafia werde im Gewand von »Schakalen und Geiern« über die Opfer der Krise herfallen, sie mit Wucherzinsen und Erpressung in die Abhängigkeit treiben und sie dann verzehren, wie sie das in der Not immer tue.[8] Die Regierung in Rom forderte die italienischen Banken deshalb auf, ausnahmsweise schnell und unkompliziert Kredite zu gewähren, um Restaurants und Hotels vor dem Zugriff der Clans zu retten. Ein Wettrennen mit der Zeit, mit unsicherem Ausgang und trüber Vorahnung: In der Regel ist das Geld der Mafia schneller.
Rückkehr aufs Land
Als 2012 der erste Jahresbericht über die Agromafia herauskam, näherte sich die Wirtschaftskrise in Italien gerade ihrem Höhepunkt. Herausgegeben wurde er von der Denkfabrik Eurispes, von Coldiretti, dem großen italienischen Landwirtschaftsverband mit 1,6 Millionen Mitgliedern, und vom Osservatorio sulla criminalità nell’ agricoltura e sul sistema agroalimentare, der Aufsichtsstelle für Kriminalität in der Landwirtschaft und der Lebensmittelindustrie. Glaubwürdigere Quellen gab es auf dem Gebiet nicht. Coldiretti, früher der bäurische Flügel der christdemokratischen Partei Democrazia Cristiana (DC), ist eine der beliebtesten Instanzen in Italien. Ihr grün-gelbes Signet mit der Weizenähre im Zentrum und dem albero della vita, dem Lebensbaum, rundherum, gilt als Vertrauenssiegel. Dem Observatorium wiederum steht ein Mann vor, der beide Phasen der Mafia kennt, die alte und die neue: Gian Carlo Caselli, geboren 1939. Er war zuvor Oberstaatsanwalt in Palermo.
Caselli und Coldiretti bündelten in ihrem Rapport die Daten von Sondereinheiten mehrerer Polizeikorps, von den Carabinieri, der Forstpolizei, der Steuerpolizei, und der Zollbehörde, der Staatsanwaltschaften im ganzen Land und dem Office Européen de Lutte Anti-Fraude (OLAF), dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung. Da kam viel Material zusammen. Für die Italiener war der Bericht ein Schock. Solange die Mafia für Drogen- und Waffenhandel stand, für Prostitution und Erpressung, schien sie weit weg zu sein von der geordneten Welt der Normalbürger. Nun war sie einem plötzlich nah, versteckt auf dem Teller. Sie ließ sich nicht mehr ignorieren.
Vom Feld bis aufs Regal der Supermärkte und auf die Tische: Die Mafia hat die gesamte Kette unterwandert. Sie kam vom Land, und aufs Land ist sie zurückgekehrt, wenn sie es denn jemals verlassen hat. Sie kaufte Ländereien im großen Stil, um selbst Gemüse und Früchte zu produzieren oder, öfter noch, um Subventionen aus den Strukturfonds der Europäischen Union abzuschöpfen. Besitzer, die nicht verkaufen mochten, wurden in die Knie gezwungen. Mit Viehraub, Brandanschlägen, der Zerstörung ganzer Ernten. Ein Beispiel: Im Jahr 2019 allein sind 22 000 Bienenstöcke gestohlen worden, ein Großteil davon im Piemont, einer Region mit großer Honigproduktion.[9] Kann das Zufall sein?
Mancherorts kontrollieren die Clans die Wasserversorgung, und wer das Wasser kontrolliert, der kontrolliert bekanntlich fast alles in der Landwirtschaft. Sie kümmern sich auch um Zulieferdienste und Zubehör: etwa um die Plastikplanen für die Treibhäuser, den Dünger, die Holzpaletten und die grünen Plastikkörbe für den Transport. Kümmern heißt: Niemand anders darf in diese Geschäftsfelder einsteigen. Die Müllentsorgung? Ebenfalls in der Hand der Mafia.
Sie beherrscht den Transport von Gemüse und Früchten. Davon profitiert sie doppelt, denn zwischen den Kisten mit den frischen Lebensmitteln lässt sich auch andere Ware transportieren. Die Mafia bestimmt den Preis der Melonen, der Tomaten, der Orangen und Zitronen, von allem. Dafür haben die Kartelle die wichtigsten Großmärkte im Land infiltriert: im sizilianischen Vittoria war es die Stidda, in Fondi bei Rom waren es die Casalesi, und in Mailand die Piromallis von der ’Ndrangheta. Sie exportieren Ware in alle Welt, auch mal gepanschtes Zeug, das sie als »Made in Italy« den Märkten anbieten. Für den Vertrieb nutzen sie nicht mehr nur die konventionellen Kanäle über kleine und große Supermärkte: Der Onlinemarkt ist eine süße Verheißung, er ist schließlich schwer zu kontrollieren.
Und dann sind da noch die vielen Restaurants und Pizzerien, die die Kartelle über die Jahre zusammengekauft haben. Nicht alle werfen Geld ab, sie dienen vor allem der Geldwäsche. Aber wenn die Lage stimmt und man durch die Fenster direkt auf die schönen piazze der italienischen Kunststädte schaut, dann sind die Lokale Goldgruben.
Seit 2012 ist jedes Jahr ein neuer Bericht zur Agromafia erschienen. Ihre Verfasser führten immer neue Beispiele an, Skandale, Betrugsfälle. Jeweils im Februar warten die italienischen Medien mit Spannung darauf, wie hoch Caselli und die Coldiretti den Umsatz der Agromafia schätzen. 2012 waren es 12,5 Milliarden Euro, 2019 schon 24,5 Milliarden Euro. Im Durchschnitt wachsen die Einkünfte aus diesem Geschäft um zehn Prozent pro Jahr. Einige Produkte versprechen Gewinnmargen von 500, gar 1000 Prozent. Kein Business der Mafia ist verlässlicher und stabiler als das Geschäft mit der Ernährung.
Der Rapport nennt die Mafia der Landwirtschaft und des Essens Agromafie, im Plural also. Die Mehrzahl fasst alles, auch die Grauzone der kleinen und großen Banden von Betrügern, Täuschern und Panschern, die, genau genommen, nicht zu den bekannten Vereinigungen der organisierten Kriminalität gehören. Durchgesetzt hat sich der Begriff dennoch in der Einzahl: Agromafia. Eine neue Mafia, die sich aus der alten nährt und sich auf ihren Ursprung besinnt.
Anleitung für eine Reise
Dieses Buch ist eine Reise durch Italien, einmal andersherum, von Süd nach Nord, entlang der Seidenstraße der Agromafia. Sie beginnt in Pachino an der Südspitze Siziliens, wo die wohl köstlichste Tomate der Welt herkommt, und führt durch Kalabrien und Kampanien nach Rom, in die Emilia und bis nach Mailand, wo diese Tomate nach einer Serie dubioser Preisaufschläge vor ihrem Versand ins Ausland noch den ortomercato passiert und dann auch in die Schweiz, nach Österreich und Deutschland gelangt.
Diese Seidenstraße gibt es offiziell natürlich nicht, inoffiziell aber sehr wohl. Sie erschließt sich aus den Erkenntnissen von Prozessen ersten, zweiten und dritten Grades. Italien kennt drei Instanzen der Gerichtsbarkeit. Wichtige Quellen sind auch Operationen der Polizei, Berichte von Kronzeugen und Mafiajägern, die Zeugnisse mutiger Bürger. Sie alle erzählen, wie es kommen konnte, dass sich die drei großen Kartelle der Mafia, die hier porträtiert werden, in die geliebte und gefeierte Welt des italienischen Essens fressen konnten. Jedes auf seine Art. Die viel kleinere Quarta Mafia, die apulische, erscheint darin nur am Rande. Sie folgt aber demselben Muster, sie hat denselben Ursprung. Und auch sie verdient viel Geld auf den fruchtbaren Feldern des Südens – und an den furchtbaren Arbeitsbedingungen der Feldarbeiter.
Das Buch erzählt von den Schatten, die auf dieser sonnigen Welt des italienischen Essens liegen. Ein großer Teil der italienischen Lebensmittelproduktion ist sauber, sie wird betrieben von Menschen mit viel Leidenschaft für ihren Beruf und für die Traditionen. Zehntausende Kontrollen führt das italienische Landwirtschaftsministerium jedes Jahr durch, es inspiziert Ställe, testet Olivenöle, Käse, Schinken. Und immerzu wird an neuen Methoden gearbeitet, dank derer sich die Herkunft der Produkte in Zukunft besser nachverfolgen und das Essen vor Betrügern schützen lässt. Eine Sammlung davon findet sich im Kapitel zum »guten Bauchgefühl«, dem Epilog. Doch trotz zahlreicher Gegenmaßnahmen wächst der Anteil der Mafia am Geschäft unheimlich schnell, exponentiell und dazu antizyklisch. Dieses Geschäft läuft eben immer, auch in einer Wirtschaftskrise oder in einer Pandemie.
Die Mafia gedeiht insgesamt prächtig, die kalabrische im Besonderen. Nicht nur in Italien. Sie hat sich mal wieder gehäutet, ihre Strategie geändert. Nicola Gratteri, der Oberstaatsanwalt aus Kalabrien und beste Kenner der ’Ndrangheta, warnt die Kollegen Polizeikommissare und Staatsanwälte im Ausland seit Jahren schon, sie möchten doch aufhören, die Schlagkraft der Mafia auf die leichte Schulter zu nehmen, sie zu banalisieren. Man hört ihm zu wenig zu.
1 – Sizilien: Geblendet von der Sonne des Südens
»Dein Herz wird in der Pfanne braten. Ich werde es essen, hast du verstanden, du Bettnässer? Wo du dich auch versteckst, ich werde dich finden, obschon dein Leben nicht einmal die Fahrkarte für die Reise wert ist.«
Venerando Lauretta, Boss aus Vittoria, zum Journalisten Paolo Borrometi
»Oro rosso«, rotes Gold
Auf der Strada Provinciale 19, der Provinzstraße nach Pachino. Hier, am Ende einer spitzen Landzunge im Südosten Siziliens, hört Italien auf. Danach kommt nur noch Meer, und dann Afrika. Es geht auch andersherum: Hier beginnt Italien. Der Süden des Südens ist das. Europa, aber eine andere Welt. Johann Wolfgang von Goethe schrieb in seinem Werk Italienische Reise: »Italien ohne Sizilien macht gar kein Bild in der Seele: hier ist erst der Schlüssel zu allem.«
Das Sonnenlicht ist warm und weiß, wie ausgewaschen, der Asphalt gebleicht. Im Sommer wird es unvorstellbar heiß. Den Straßenrand der SP19 säumen Olivenbäume, Palmen, viel Grün auch im Herbst noch, und eine fast unendliche Serie von Treibhäusern, eines nach dem anderen. Ihre weißen Plastikdächer blitzen in der Sonne.
Pachino ist eine kleine Stadt mit nur 22 000 Einwohnern, gelegen auf einer sanften Anhöhe. Die Sizilianer sagen pachinu oder auch bachinu, der Klang liegt sanfter im Ohr als bei Pachino. Vom zentralen Platz, der Piazza Vittorio Emanuele mit ihrer Kirche, ein paar Restaurants, einer Apotheke, einer Bar, führen Straßen in alle Himmelsrichtungen. Am Ende jeder dieser Straßen sieht man die Felder. Rund um die Piazza, wie hingewürfelt, stehen quadratische, betongraue Häuser. Sie sehen alle gleich aus, Einbahnstraße um Einbahnstraße.
Nach Pachino fahren keine Touristen. Die zieht es nach Noto, Modica, Ragusa und Scicli, in die neobarocken Städte der Umgebung mit ihrem dunklen Charme, es sind Juwelen der Baukunst. Pachino ist nicht so prächtig und pittoresk wie die Nachbarstädte, aber es ist ähnlich bekannt, auch im Ausland. Grund dafür sind die wunderbaren Früchte der Natur, die unter den blitzenden Plastikdächern wachsen, mittlerweile das ganze Jahr. Die Tomate von Pachino oder il Pachino ist die Prinzessin der Tafeln. Sie schmeckt noch wie Tomate, würde man sagen, nicht wässrig und fad wie andere. Die Tomate aus Pachino ist süßlich, nur einen Hauch sauer, die Haut fest. Pachino und seine Tomate bilden eine Symbiose, seit der ersten Anpflanzung im Jahr 1925.
Es gibt sie in fünf Varianten. Ciliegino, die kleine Kirsche, oder Cherry, ist von allen die bekannteste. Man sagt ihr krebshemmende Wirkung nach. Datterino, die Rispentomate, ist oval wie eine Dattel. Sie ist noch etwas süßer als die Cherrytomate, man kann sie auch ohne Gewürz und Öl essen, sie genügt sich selbst. Die Rundglatte, tondo liscio, ist eine kleine, kugelrunde, dunkelgrüne Tomate, leicht haltbar. Und dann gibt es noch eine große Version, costoluto, die Gerippte, die vor allem in Küstennähe angebaut wird, wo der Boden salzig ist.
So unterschiedlich Geschmäcker auch sein mögen: il Pachino gehört zu den besten Tomatensorten der Welt. Und zu den teuersten. Roh schmeckt sie besonders gut, als Begleiterin der Mozzarella di bufala etwa, des Büffelmozzarella. Oder mit burrata. Auch mit Thunfisch lässt sie sich gut kombinieren. Sie besteht auch allein, als Salat mit Olivenöl und Origano, der bricht die Süße mit seiner herben Note und bringt sie so noch stärker hervor. Es gibt die Tomate aus Pachino auch als sugo oder passata, oberes Preissegment, als Basis für die Zubereitung von Pastasaucen.
Der ganze Süden und seine Küche in einem Gemüse, einem Nachtschattengewächs, dem pomodoro, so sagen die Italiener: Goldapfel.
Die Tomate kommt nicht von hier, ihren Ursprung hat sie als wildes Gewächs in Lateinamerika. Die Azteken aßen sie schon vor Jahrtausenden, bevor die spanischen Eroberer sie nach Europa brachten, wo sie schnell sehr beliebt wurde. Im 16. Jahrhundert wurde der Tomate, oder Tomatl, wie sie hieß, nachgesagt, sie habe aphrodisische Mächte. Und ihre Pflanze galt als hübsch, fast so hübsch wie Blumen.
Ihr Großkonsum begann erst einige Jahrhunderte später, als man in Parma eine Methode fand, die Tomate in Dosen aufzubewahren: flüssig als passata, in kleine Stücke gehackt oder in Streifen filetiert. Es war der Beginn einer Eroberung. Heute gibt es mehr als 5000 Tomatensorten, alle stammen sie von der Tomatl ab.
Die Italiener produzieren jedes Jahr fünf Millionen Tonnen Tomaten, nur die Amerikaner stellen noch mehr her. Am europäischen Markt halten die 3500 kleinen und mittleren Betriebe aus Italien eine Quote von 50 Prozent.[10] Im Norden ist die Produktion mittlerweile größtenteils automatisiert, Parma ist noch immer die Hauptstadt der Dosentomate. Im Süden dagegen wird an vielen Orten weiterhin von Hand geerntet – zu allen Jahreszeiten, in der Sommerhitze wie in der Winterkälte. Ein Teil der Tomaten wird exportiert. Doch auch der heimische Binnenmarkt ist interessant: Jeder Italiener isst durchschnittlich im Jahr 65 Kilogramm Tomaten.
Neben der Pachino gibt es weitere Sorten, die man feiert, als wären sie Delikatessen. Die längliche San Marzano aus Sarno bei Salerno etwa, wegen ihrer Form auch Flaschentomate genannt, ist tiefrot und fleischig wie sonst keine, und ihr Wassergehalt ist gering. Sie wird vor allem zu pelati verarbeitet, zu Gehäuteten also, ganz oder in Streifen. In Neapel sagt man, dass nur eine Pizza mit San Marzano eine wahre neapolitanische Pizza sei. Und wenn die Neapolitaner das sagen, sollte man ihnen unbedingt zuhören. Die leuchtend rote, ovale Piennolo wächst an den Abhängen des Vesuvs, ihr intensives, süßsaures Aroma zieht sie aus dem vulkanischen Boden. Und aus dem Mythos darum herum. In Italien hat man deshalb nie das Gefühl, man rede nur von Gemüse, wenn man über Gemüse redet.
So wurde der »Goldapfel« zum Symbol der mediterranen Küche. Zur Prinzessin der Tafeln. In Pachino spricht man auch vom oro rosso, dem roten Gold. Und das ist buchstäblich gemeint. Die Betreiber eines kleinen Gemüsestandes bei der Tankstelle am Ausgang der Stadt haben zwei große Löwenstatuen aus Marmor zu ihrer Auslage von Tomaten und Auberginen, Orangen und Zitronen gestellt. Mächtige Tiere sind das, man ist stolz auf sein Gemüse. Die Löwen sind auch ein Symbol der Mafia.
Alles babba?
Als der Sizilianer Paolo Borrometi begann, sich etwas näher für Pachino und seine einzigartigen pomodorini zu interessieren, hatte der örtliche Clan das Geschäft mit den Tomaten schon unterwandert. Die Mafiosi saßen zu dieser Zeit bereits im örtlichen Konsortium, das die europäischen Gütesiegel vergibt. Alle wussten Bescheid, niemand mochte darüber reden.
Borrometi war damals ein junger Enthüllungsjournalist und Jurist aus Modica, eine Stimme in der Wüste, einer, der Sachen schrieb, die sonst niemand schrieb. Mit seinen Ermittlungen zerrte er an einem alten Mythos: Vom Südosten Siziliens, der die Provinzen Siracusa und Ragusa umfasst, sagte man früher, er sei immun gegen das organisierte Verbrechen, die Mafia könne sich dort unmöglich festsetzen.
Messina, Palermo, Catania, Trapani, Agrigento – die großen Städte und ihre Provinzen waren infiziert, das war allen bekannt, sie waren zerfressen von Cosa Nostra, eigentlich waren sie verloren. Die Ecke im Süden aber war anders, eine Enklave, vom Glück und der Sonne geküsst, lieblich umwogt vom kobaltblauen Meer. Glaubte man. Und ein bisschen babba sei sie auch, sagte Leonardo Sciascia einmal, der große sizilianische Schriftsteller.
Babba ist ein sizilianisches Wort für langweilig, man kann es auch mit »dümmlich« übersetzen. In diesem Zusammenhang sollte das auch heißen: zu harmlos, um mafiös zu sein. Die Mafia aber ist schlau und brutal. Wer etwas anderes behauptete, wie das Paolo Borrometi tat, den schimpfte man einen Nestbeschmutzer, einen Fantasten, der sich nur interessant machen wolle. Für die fimmine, für die Frauen. Auch von Borrometi sagte man, er prahle nur mit seinen spektakulären Geschichten, um damit aufzufallen und eine Frau zu erobern, warum denn sonst?[11]
Seine Artikel erschienen zunächst im Giornale di Sicilia, der sizilianischen Lokalzeitung. In den Anfängen schrieb Borrometi dort vor allem über kulturelle Themen, davon gab es genug in seiner Heimat, viele Städte sind Weltkulturerbe der UNESCO.
Als er dann anfing, über die nicht so schönen Seiten zu schreiben, gründete er mit Freunden und Kollegen eine Homepage, die er La Spia nannte. Der Name »Der Spion« war eine ironische Spitze gegen seine Gegner: Um seine Glaubwürdigkeit zu beschädigen, hatten die auch herumerzählt, Borrometi sei ein »Bulle«, ein »Spion«.
Eine kleine Enklave der Glückseligen auf einer Insel, die sich fest im Griff der Cosa Nostra befand? Ganz glaubwürdig war das ohnehin nie, schließlich waren die zwei Provinzen wohlhabend, und die Mafia geht immer dahin, wo das Geld hockt. Nirgendwo in Italien gab es mehr Bankfilialen pro Einwohner als in Ragusa und Siracusa, nicht einmal in Mailand. In den Häfen lagen Yachten, die waren so luxuriös wie jene in Portofino und Monte Carlo.
Rund um die Städte entstanden große Einkaufszentren, eines nach dem anderen, die immer leer standen und doch nicht schlossen. Auch Tankstellen reihten sich plötzlich in kurzer Abfolge aneinander, wo es früher doch gar keine gab. Die alten Gesetze des Marktes, so machte es den Anschein, galten hier nicht. Die Nachfrage neigte gegen Null, das Angebot aber war riesig.
Irgendwann war klar, dass die Mafia diese Provinzen, die nach außen babba wirkten, als große Waschmaschinen für ihr schmutziges Geld benutzte. Natürlich geht im Waschgang eine ganze Menge Geld verloren, manchmal bis zu 70 Prozent der investierten Beträge. Denn damit das Geld auch ganz rein wird, frei von jedem Verdacht, müssen auch Steuern dafür entrichtet werden.
Doch die Summen, die das Verbrechen abwirft, sind so riesig, dass das, was übrigbleibt, immer noch genügt, um alle reich zu machen. Ein Teil des Geldes fließt den Familien zu, deren Väter, Onkel, Söhne im Gefängnis sitzen. Die Mafia hat ihr eigenes Vorsorgesystem.
Auch der Staat hatte sich lange Zeit blenden lassen vom guten Ruf der Region. Er kontrollierte sie kaum, die Präsenz der Polizei war spärlicher als im restlichen Süden des Landes. Das Klima war nicht nur ideal für das Gedeihen der Tomaten, es gediehen auch die Kartelle. Im Schatten wuchsen gar mehrere Syndikate gleichzeitig. Sie operierten nebeneinander, manchmal auch gegeneinander. Wenn immer möglich, taten sie es aber ohne viel Aufsehen.
Die Mutationen der Mafia
Die Cosa Nostra beherrschte über drei Jahrzehnte hinweg die sizilianische Mafia. Bis 2006. Angeführt wurde sie in dieser Zeit von den Corleonesi, den Familien aus Corleone im Hinterland von Palermo.
Ihr letzter großer Boss war Bernardo Provenzano, und dieser hatte eine besondere Verbindung zu Land und Erde, zu Vieh und Gemüse. Er war Bauer. Sie nannten ihn »Zu Binnu u tratturi«, »Onkel Bernardo der Traktor«. Schießen könne er »wie ein Gott«, hieß es von Provenzano. Wenn man das Bild des Agromafioso idealtypisch einer Person zuordnen müsste, böte sich »Onkel Bernardo der Traktor« an, ja er würde sich aufdrängen wie eine Karikatur. Dabei war er nur einer von vielen Bauern und Hirten mit einer kriminellen Karriere.
Als sie Provenzano im April 2006 verhafteten, auf einem Bauernhof bei Corleone, waren die Italiener erstaunt. Dieser ungebildete, knorrig-kauzige Mann hatte es also geschafft, sich 43 Jahre lang zu verstecken, sogar daheim in Corleone, und alle zu narren. Er regierte Cosa Nostra mit sogenannten pizzini, kleinen Papierzetteln. Darauf standen Anweisungen, es waren Befehle von oben, von ihm, dem Boss der Bosse. Die Zettel mussten immer zerstört werden, nachdem sie gelesen worden waren.
So funktionierte die Kommunikation damals, sie war abhörsicher. Zwei Kinder zeugte Provenzano in der langen Zeit seiner »Flucht«, wie die Italiener es nennen, wenn ein Mafioso untertaucht. Es wurden zwei Söhne: Angelo, geboren 1975, und Francesco Paolo, geboren 1982. Der Zweitgeborene sollte moderne Sprachen studieren und Lehrer werden.
In der Zeit vor »Zu Binnu« hatte Salvatore »Totò« Riina Cosa Nostra geführt, auch er war Corleonese. Und dieser Riina sagte einmal: »Ohne Geld und Respekt bist du eine Null gemischt mit dem Nichts.« Er hatte die sizilianische Mafia verändert wie bis dahin keiner vor ihm in ihrer ganzen, zweihundertjährigen Geschichte. Ihre Essenz hatte er umgepolt und sie letztlich ruiniert.
Riina stellte sich gegen den italienischen Staat, er forderte ihn militärisch heraus, wo die Strategie aller Mafias doch immer gewesen war, sich mit dem Staat zu arrangieren, still und heimlich, mehr oder weniger harmonisch. Man hatte einander gewähren lassen, Politiker dafür fanden sich immer, so lief das Geschäft für beide Seiten am besten. Auch im wirtschaftlichen Establishment hatte man sich mit dieser Regelung abgefunden. Die Mafia war eine unbequeme Alliierte der Elite, aber eben doch: eine Alliierte.
Doch dann zerbrach das Gleichgewicht, der stille Pakt fiel auseinander. Wie und warum genau, darüber wird noch immer debattiert. Vier Jahrzehnte später.
1975 hatte der italienische Staat plötzlich damit begonnen, viel härter gegen die Mafiosi vorzugehen. Angetrieben wurde er von Richtern, Polizisten und Politikern, die es wirklich ernst meinten mit dem Kampf gegen Cosa Nostra. Sie führten keine Scheingefechte, sie gingen den ganzen Weg. Wen der Staat nun wegsteckte, der war wirklich weg. Haft nach »41 bis«, einem Artikel im italienischen Strafvollzugsgesetz, war und ist das härteste Verwahrungsregime in der westlichen Welt. Die Italiener nennen es auch »carcere duro«, hartes Gefängnis. Erdacht wurde es als Mittel im Kampf gegen den Terrorismus und gegen die Mafia. Es sieht Isolationshaft und ständige Bewachung vor, jede Post wird kontrolliert. Selbst der Hofgang ist streng limitiert. Es schnitt die Bosse komplett ab von der Außenwelt, von ihren Familien, den Clans.
Früher war das immer anders gewesen, und die Bosse befahlen auch aus dem Gefängnis. Zuweilen war es für sie sogar ein Vorteil, einzusitzen, etwa während der Clanfehden, da waren sie drinnen sicherer als draußen und behielten die Gesamtlage besser im Blick. Doch Artikel »41 bis«, der so heißt, weil die Gesetzgeber die alte Zahlenabfolge im Gesetz nicht ändern mochten und die wichtige Novelle deshalb einfach als Zusatz an Artikel 41 anhängten, zog die Paten aus dem Verkehr. Das »bis« war kein Zusatz, es war entscheidend. Das Kommunizieren wurde viel schwieriger. Die Aura ihrer Macht verblasste.
Einige Jahre später startete Riina die »fase stragista«, so nennt man die »Ära des Terrorismus« der Mafia, und diese Phase sollte alles verändern – für Cosa Nostra selbst, aber auch für das organisierte Verbrechen im ganzen Land. Mit Bomben und vielen omicidi eccellenti, Prominentenmorden: an Politikern, Richtern, Polizeichefs.
Am Dreikönigstag 1980, an einem Sonntagmorgen, brachte Cosa Nostra Piersanti Mattarella um. Mattarella war damals Präsident der sizilianischen Regionalregierung, ein junger, mutiger Mann, der die Mafia bekämpfen wollte, 44 Jahre alt war er. Der Christdemokrat saß im Auto neben seiner Frau. Sie wollten zur Messe fahren, der Killer schoss durchs Fahrerfenster.
Es war der Auftakt einer langen Serie von Morden an berühmten Vertretern des Staates. Alle waren sie politisch motiviert, so auch der Mord am Präfekten von Palermo, Carlo Alberto dalla Chiesa, im Herbst 1982. Der Staat reagierte mit einem Großprozess, der die Organisation in ihrem Kern treffen sollte. Es war, als hätte er schon lange alles bereit gehabt für diesen Moment, nur keinen passenden Ort.
Für den »maxiprocesso«, den Großprozess, bauten sie in Palermo, nicht weit vom legendären Gefängnis Ucciardone, in kurzer Zeit eine Halle, die so groß war, dass sie Hunderte fasste. »Raumschiff«, nannte man diese Halle, oder »Bunkeraula«. Im hinteren Teil des Saals waren Zellen mit Gitterstäben eingerichtet, damit die Angeklagten den Verhandlungen beiwohnen konnten. Die Zellen sahen aus wie Käfige im Tierpark. Die Sicherheitstechnologie im Bunker aber war hochmodern. Die Italiener sollten sehen, dass der Staat ernst macht.
In diesem Prozess wurde zum ersten Mal eine neue Norm aus dem Strafgesetzbuch angewandt, die den Kreis viel weiterzog als alle vorherigen und der Mafia in der Folge Hunderte hohe Haftstrafen eintrug. Die Norm »416 bis« verschärfte nicht nur das Strafmaß für den Tatbestand »Zugehörigkeit zur Mafia«, auf den nun ein Gefängnisaufenthalt zwischen zehn und fünfzehn Jahren stand, auch für einfache Mitglieder. Sondern sie definierte zusätzlich, was der Staat alles unter einem Mafioso verstand. Als mafiös gilt seitdem, wer die einschüchternde Kraft der Organisation nutzt, um sich einen wirtschaftlichen Vorteil zu verschaffen, zum Beispiel im Wettbewerb um einen öffentlichen Bauauftrag. Falls die Organisation für die Umsetzung ihrer Ziele mit Waffen droht oder zumindest welche zur Verfügung hat, sind Strafen bis 26 Jahre möglich. Außerdem statuiert das neue Gesetz, dass alle Güter, die sich die Mafia auf diese Art erworben hat, vom Staat beschlagnahmt werden.
Erlassen wurde es nach dem Mord am Präfekten. Der Prozess war in jeder Beziehung »maxi«. Allein die Anklageschrift umfasste insgesamt 750 000 Seiten. 474 mutmaßliche Mafiosi wurden dem Gericht vorgeführt, viele von ihnen waren Kader der Organisation. Manchmal standen sie in Gruppen in den Käfigen, riefen Kommentare in die Aula, lachten höhnisch über die Vorwürfe, die man ihnen machte. Das Verfahren dauerte 638 Tage, es taktete die Nachrichten im Land. 600 Journalisten reisten an, auch viele ausländische waren da.[12]
Über Italien hing damals die oft schon enttäuschte Hoffnung, der Staat würde es diesmal schaffen, der Mafia beizukommen. Doch Riinas Terror sollte da erst richtig beginnen, er war als Rache angelegt. »Man muss zuerst Krieg führen, bevor man Frieden schließen kann«, sagte er einmal.[13] Noch mehr Brutalität, noch prominentere Morde, noch mehr Tote. Auch viele unbeteiligte Menschen gerieten ins Feuer von Cosa Nostra.
Am 23. Mai 1992, um 17.57 Uhr, sprengte die Mafia per Fernzündung ein Stück der Autobahn A29, bei der Ausfahrt Capaci. Drei gepanzerte Fiat Croma wirbelte es durch die Luft, in einem saß Giovanni Falcone, der große Anti-Mafia-Richter aus Palermo, und seine Frau Francesca Morvillo, auch sie Richterin. In den anderen Wagen saßen die Leibwächter. Fünf Tote, 23 Verletzte.
Nur zwei Monate später, am 19. Juli 1992, um 16.58 Uhr, detonierte eine weitere Bombe. 90 Kilogramm Sprengstoff waren in einem gestohlenen Auto deponiert worden, das auf einem Parkplatz an der Via D’Amelio in Palermo vor der Hausnummer 21 stand. Dort lebten die Mutter und die Schwester von Paolo Borsellino, dem anderen großen Mafiajäger jener Zeit. Er kam zu Besuch, es war ein Sonntag, er wurde zum Inferno. Sechs Tote, 24 Verletzte.
Mit diesen beiden Attentaten hatte Riina den Bogen überspannt. Die Italiener waren geschockt. Alle romantische Folklore, so es sie denn jemals gegeben hatte, war weg. Selbst in ihren Hochburgen verlor Cosa Nostra an Gunst. Die alten Gleichgewichte waren weggesprengt.
Ein halbes Jahr nach dem Mord an Borsellino wurde Riina verhaftet. Sie nannten ihn »U curtu«, den Kurzen, weil er klein gewachsen war, und »La belva«, die Bestie, weil er im Umgang mit seinen Gegnern so unvorstellbar unmenschlich war. Er saß auf der Rückbank eines Autos mit Fahrer, mitten in Palermo, an einer Straßenampel im Morgenverkehr, als die Polizei seinen blutigen Ritt stoppte. Auch er hatte als Flüchtiger gegolten, jahrzehntelang. Dabei hatte er die meiste Zeit daheim in Palermo verbracht.
Damals begann der Niedergang der Corleonesi. Der Angriff auf den Staat war misslungen, der militärische Flügel hatte verloren, seine Mitglieder kamen ins Gefängnis. Verwahrt nach »41 bis«.





























