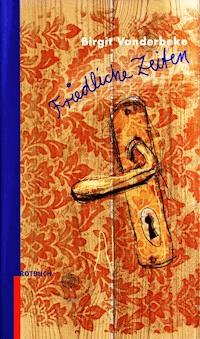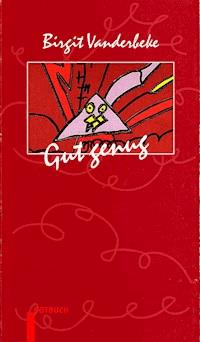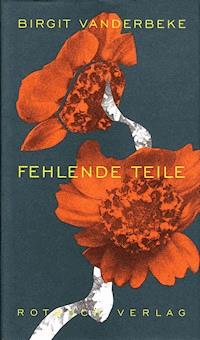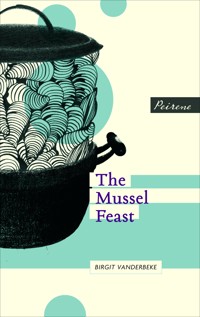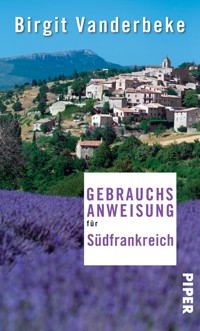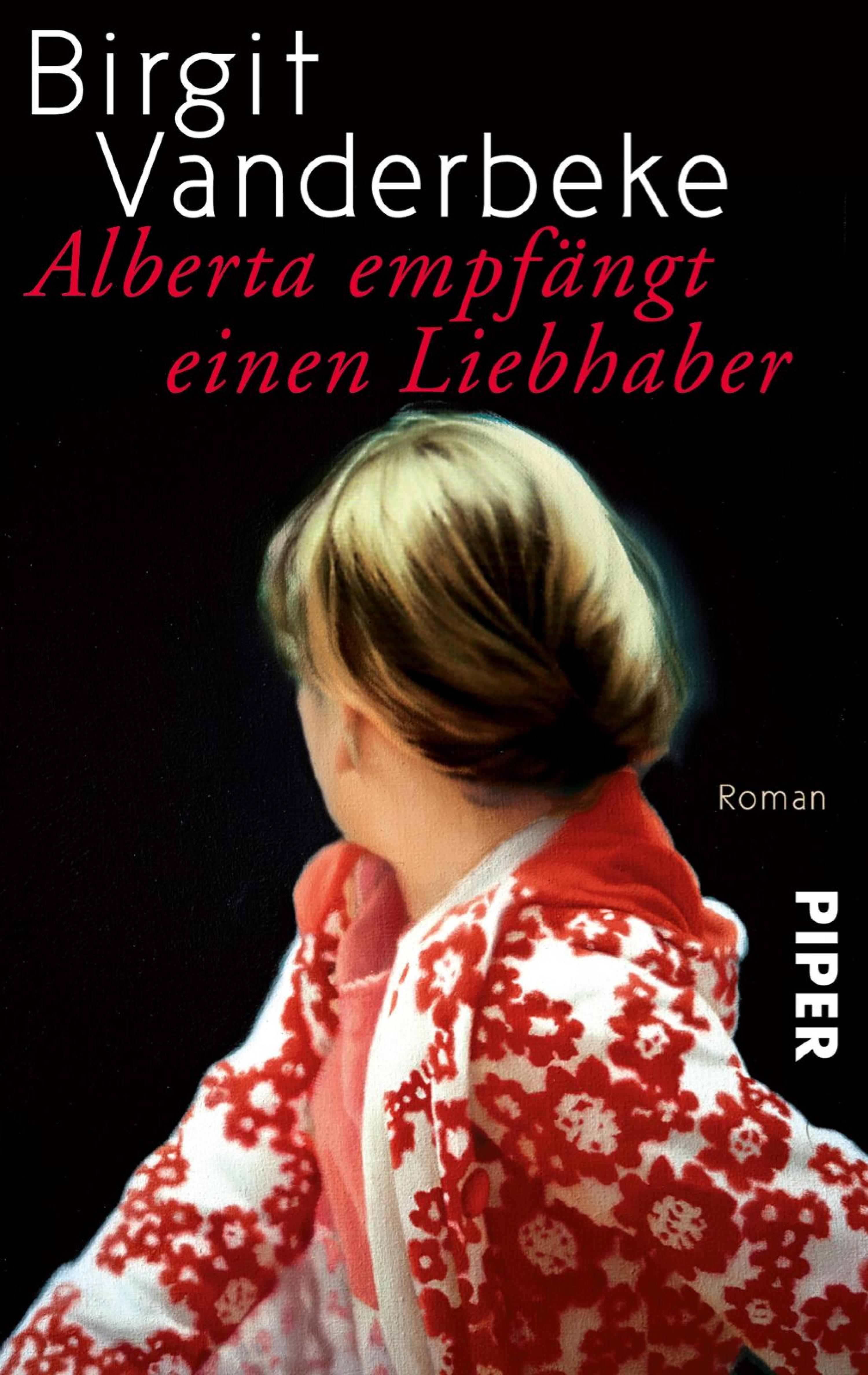10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Unsere Zukunft speist sich aus unserer Vergangenheit. Die Erzählerin dieses autobiografischen Romans, mittlerweile selbst Großmutter, spürt den Fäden und Verbindungen zwischen den Generationen nach: Was bewog die eigene Großmutter, Ostende zu verlassen und ihrem 14-jährigen Sohn Gaston, der sich der deutschen Wehrmacht angeschlossen hatte, nach Deutschland zu folgen? Wie hielt sie, die nie wieder nach Belgien zurückkehrte, das Leben in der Fremde aus? Und wie können diese Erinnerungen in Zeiten, die erneut von Flucht und Vertreibung geprägt sind, Trost und Hilfe sein? Im abschließenden Teil ihrer beeindruckenden Roman-Trilogie umkreist Birgit Vanderbeke Fragen, die weit zurückführen und doch aktueller nicht sein könnten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de/literatur
Heinrich Böll wurde zitiert aus: Zur Verteidigung der Waschküchen, in: Werkausgabe Heinrich Böll Bd. 12, Köln, 2008
© Piper Verlag GmbH, München 2019Covergestaltung: Kornelia Rumberg, www.rumbergdesign.deCovermotiv: Martin Barraud / Getty Images
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Zitat
Es sind vielleicht nicht alle …
Der Böll hat auch schon früher …
Es ist ganz erstaunlich, wie wenig …
Zum Meer hinunter waren es …
Der Laden an der Bushaltestelle …
Nach den Osterfeiertagen …
In den ersten Tagen …
Wir saßen am Goldenen Strand, …
In Dublin legten wir uns …
Wenn die Kamera sich sehr lange um etwas Totes herum bewegt, dann wird das Tote als tot erkennbar, und dann wird die Sehnsucht nach etwas Lebendigem entstehen können
Rainer Werner Fassbinder
Es sind vielleicht nicht alle bei dir, denke ich.
Alle vielleicht nicht.
Aber da drüben kennt einfach jeder jeden, und wenn du einen von ihnen bei dir hast, kannst du nie wissen, wen noch, und schon sind es im Grunde alle.
Bei mir fing das mit meiner Oma Maria an, ohne dass ich überhaupt merkte, dass sie bei mir war und mich behütete. Mich hat nie jemand behütet. Der einzige Mensch, der auf mich aufgepasst hat, war immer nur ich selber gewesen.
Deshalb wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass meine Oma Maria mich behüten könnte. Immerhin war sie tot, und wenn schon die Lebenden nicht mit mir sprachen und auf mich aufpassten, wäre ich nicht darauf gekommen, dass die Toten bei mir sein und mich behüten könnten. Alle vielleicht nicht, aber erstaunlich viele dann doch. Aber das merkt man erst mit der Zeit. Wenn überhaupt.
Angefangen hatte es also mit meiner Oma Maria, und dann kam irgendwann später der Heinrich Böll dazu, und dabei hatte vermutlich der Gerhard Zwerenz seine Hände im Spiel, der den Böll schon zu Lebzeiten gekannt hatte, und wenn Sie den Böll und den Zwerenz nicht kennen sollten, wundern Sie sich nicht. Wir vergessen heute sehr schnell. Das hat mit der schwarzen Magie zu tun, die dafür sorgt, dass die Wirklichkeit vor unseren Augen verschwindet und zerrinnt, und mit der Wirklichkeit verschwindet das Erinnern an alle, die vor uns da waren und uns von der Wirklichkeit erzählen könnten.
Meine Oma Maria war meine andere Oma. Sie war die Mutter von meinem Vater. Sie hieß andere Oma, weil sie anders war und weil wir in Dahme bei meiner Oma Frieda in der Bahnhofstraße 16 wohnten und nicht bei ihr in der Wallstraße 5. Wir hätten bei ihr auch gar nicht wohnen können, weil ihre Wohnung viel zu klein und meine Oma Maria viel zu arm war. Aber ich konnte schon als kleines Kind von der Bahnhofstraße in die Wallstraße laufen und die andere Oma besuchen. Ich habe sie gern besucht.
Min meisje, sagte sie, wenn ich reinkam.
Ihre Haustür war nie abgeschlossen.
Schließlich war sie gestorben und tot. Zu der Zeit, als sie starb, hatte ich in Frankfurt gerade mit dem Studium angefangen, kurz zuvor war ich volljährig geworden und kam natürlich nicht auf die Idee, dass sie bei mir sein und mich behüten könnte. Ich war etwas zerschlagen und zerschunden aus meiner Kindheit rausgekommen, fühlte mich benommen und hatte keine Ahnung, warum manche zerschlagen und zerschunden werden und andere nicht.
Eine Frage der Gerechtigkeit, dachte ich. Für Fragen der Gerechtigkeit ist das Recht zuständig, also studierte ich Jura. Damals war Fritz Bauer schon ein paar Jahre lang tot. Es dauerte nicht sehr lange, bis ich verstand, dass es mit der Gerechtigkeit nichts würde, wenn Fritz Bauer es nicht geschafft hatte, die Nazis vor Gericht zu bringen. Falls Sie auch von Fritz Bauer noch nie gehört haben, wundern Sie sich nicht. Er hatte im Krieg vor den Nazis abhauen müssen. Nach dem Krieg wurde er Staatsanwalt und versuchte, die Nazis vor Gericht zu bringen. Einmal hat er den Israelis einen Obernazi verraten, den er ohne den israelischen Geheimdienst nicht vor Gericht gekriegt hätte, weil die Deutschen und die Amis nicht besonders scharf darauf waren, die Nazis vor Gericht zu stellen, aber dann erwischten die Israelis den Obernazi, und so kam er vor Gericht. Das war dann der Eichmann-Prozess; aber Fritz Bauer kapierte schnell, dass es den Deutschen und den Amis nicht darum ging, die Nazis vor Gericht zu bekommen und zu bestrafen.
Mein Vater war kein Nazi und Massenmörder gewesen, nur Direktor in der pharmazeutischen Industrie, und da war wiederum ein früherer Nazi der oberste Chef. Der hatte so richtig in der Sache mit dringehangen und anschließend dafür gesorgt, dass die Leute, die bei der IG Farben gewesen waren, gute Stellen bei den Farbwerken bekamen. Aber mein Vater hatte nichts mit den Experimenten zu tun oder mit den Medikamenten, die die IG Farben in den KZs getestet hatte. Er war bei Kriegsende erst zehn Jahre alt und also dafür viel zu jung gewesen.
Vermutlich hatte er auch mit der Sache in Chile nichts zu schaffen gehabt. Das waren die Amis gewesen, die den Putsch angezettelt und den Präsidenten umgebracht hatten, und mein Vater hatte nur indirekt mit den Amis und eher mit dem Auswärtigen Amt in Bonn zu tun. Keine Ahnung, was er von diesen ganzen Mord- und Foltersachen und den Lagern in Chile überhaupt wusste, aber natürlich fand er auch, dass die Regierung Allende das Ende gefunden hatte, das sie verdiente. So stand es in einem Brief, den die chilenische Filiale nach Vollzug der Angelegenheit an die Farbwerke nach Hause schrieb. In dem Brief stand auch, dass das Vorgehen der Polizei und des Militärs nicht intelligenter hätte geplant und koordiniert werden können und dass es sich um eine Aktion handelte, die bis ins letzte Detail vorbereitet war und glänzend ausgeführt wurde, und nachdem der Diktator Pinochet eingesetzt worden war, wurde Chile ein für Hoechster Produkte zunehmend interessanter Markt. Aber ich bekam davon nicht mehr sehr viel mit, weil ich nicht mehr bei meinen Eltern wohnte. Ich bin auch nicht sicher, ob mein Vater zu Hause überhaupt noch davon sprach.
Von Vietnam und dem Agent Orange hatte er noch gesprochen, aber wenn er davon sprach, dass die Farbwerke den Amis das Dioxin für ihr Agent Orange geliefert hatten, sagte er immer gleich dazu, dass ich darüber nicht reden sollte.
Kein Sterbenswörtchen davon zu irgendjemand, sagte er. Haben wir uns verstanden.
Natürlich sagte ich kein Sterbenswörtchen davon zu irgendjemandem, auch wenn ich wusste, dass man genau hinschauen, hinhören und die Klappe aufmachen muss, wenn man nicht will, dass es immer wieder Krieg gibt. Aber ich war noch ein Kind. Ein Kind hat keine Stimme, also habe ich die Klappe gehalten, wenn mein Vater mir gesagt hat, dass ich die Klappe halten solle, und trotzdem bin ich ziemlich zerschlagen und zerschunden aus meiner Kindheit herausgekommen, auch wenn ich versucht hatte, alles so zu machen, dass ich halbwegs ungeschoren davonkomme. Aber es hatte nicht funktioniert.
Schließlich machte ich Abitur und zog sofort aus der Wohnung meiner Eltern aus. Kurz danach starb meine Großmutter Maria. Meine andere Oma. Ein paar Wochen vorher war sie achtzig Jahre alt geworden.
Nach ihrem Tod fing sie an, mich zu behüten, auch wenn ich davon sehr lange Zeit nichts gewusst und mitgekriegt habe.
Als sie noch am Leben und viel jünger war, hatte sie natürlich zuerst einmal versucht, ihre beiden Söhne zu behüten.
So habe ich es später mit Noah gemacht, und so macht es Noahs Frau heute mit dem Kleinen. Nur ist das bei meiner Großmutter Maria auf der ganzen Linie danebengegangen. Das war im Zweiten Weltkrieg. Da ist kaum jemand heil herausgekommen, und ihre beiden Söhne waren zwar am Ende des Krieges noch am Leben, aber das war auch schon alles, was meine Großmutter hatte ausrichten können, und auch das hätte beinahe nicht geklappt. Sie war so unverheiratet, wie man nur sein konnte, und ihr Leben lang arm wie eine Kirchenmaus.
Als sie gestorben ist, hat sie einen alten Pappkoffer hinterlassen, in den sie ihre Siebensachen gepackt hatte. Gewaschen, geplättet und ordentlich zusammengefaltet. Den Koffer hat mein Vater später weggeschmissen. Obendrauf lag ein Briefumschlag, und in den Briefumschlag hatte sie genau die Summe gesteckt, die für ihre Beerdigung gebraucht würde.
Die Beerdigung ist dann doch teurer geworden. Sie ist sogar sehr viel teurer geworden, als meine Großmutter sich das hätte leisten können, weil mein Vater nicht wollte, dass seine Mutter in einem Armeleutegrab beerdigt würde.
Er hat nach dem Tod seiner Mutter entsetzlich gelitten. Ich fand das sonderbar, weil er sich nie um sie gekümmert hatte, als sie noch am Leben war. Sogar ihren Geburtstag hat er alle Jahre wieder vergessen. Mein Vater hatte am selben Tag Geburtstag wie seine Mutter, und also war es besonders merkwürdig: Seinen eigenen Geburtstag hat er sich merken können, aber nicht den seiner Mutter. Deshalb kam es mir sonderbar vor, wie er plötzlich gelitten hat. Aber er war tatsächlich vor Schmerz ganz im Wahn, hat geklagt und sich die Haare gerauft; tagelang ist er nicht aus dem Schlafzimmer herausgekommen, in das er sich eingesperrt hatte, und dann setzte er sich in den Kopf, dass sie das schönste Grab im ganzen Ort bekäme. Er hat alle Leute, die er in Dahme gekannt hat, zu ihrer Beerdigung eingeladen, und schließlich ist tatsächlich alles, was einen Namen hatte, auf den Friedhof gekommen, und danach noch in den Ratskeller, und alle haben meinen Vater bestaunt, weil er im Westen ein hohes Tier und so reich geworden war, dass er sich das teure Grab und die Blattgoldinschrift leisten und noch den ganzen Ratskeller reservieren konnte für das königliche Mahl nach der Trauerfeier für seine geliebte Mutter.
Gleich nach ihrem Tod hat mein Vater alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das beste handgeschlagene Blattgold von den besten Goldschlägern zu bekommen. Er ist selbst nach Schwabach gefahren, um sich vor Ort darum zu kümmern, und schließlich hat er einen Steinmetz in Westberlin ausfindig gemacht, der den Grabstein gestalten und die Inschrift mit dem Schwabacher Blattgold verzieren konnte. Wie der Stein später vom Westen in den Osten gekommen und am Grab meiner Großmutter in Dahme aufgestellt worden ist, weiß ich nicht mehr; jedenfalls hat sich mein Vater darüber gefreut, wie eindrucksvoll die Beerdigung gewesen ist, obwohl natürlich der Stein mit dem Blattgold noch längst nicht da war, aber mein Vater hat allen, die er eingeladen hatte, davon erzählt, und allen Gästen ist vor Respekt die Spucke weggeblieben.
Sein älterer Bruder Gaston saß zu der Zeit noch in Belgien im Knast, weil er seine Frau erschlagen hatte. Die Kinder der beiden waren da schon unauffindbar und nicht zur Beerdigung erschienen, aber mein Vater sagte, dass sie sowieso kein Verhältnis zu uns und zu ihrer Großmutter gehabt hätten, und während des Trauermahls im Ratskeller hat jemand meinem Vater den Mercedesstern von seinem neuen Mercedes geklaut. Der Stern war dann natürlich auch unauffindbar. Das regte meinen Vater schrecklich auf.
Ich war nicht mit zur Beerdigung gefahren, was ihn auch sehr aufgeregt hat, aber ich war zu der Zeit schon volljährig, also konnte er nichts dagegen tun. Und er konnte auch nichts dagegen tun, dass ihm jemand den Mercedesstern vom Wagen geklaut hatte. Die Pietätlosigkeit des Sternediebes regte ihn fast noch mehr auf als die Pietätlosigkeit seiner Tochter, die sich geweigert hatte, nach Dahme zu fahren und ihre Großmutter würdig und feierlich zu Grabe zu tragen.
Man stelle sich das nur vor, sagte er anschließend, während wir alle im Ratskeller sitzen, klaut mir einer den Stern. Der hat von Pietät noch nie was gehört.
Meine Großmutter hätte ihre beiden Söhne gern behütet, nur hatte es zu ihren Lebzeiten nicht geklappt, weil sie arm und allein war.
Dommen jong, hat sie zu meinem Vater gesagt. Sogar als der schon ein hohes Tier war und alle Mitarbeiter in seiner Abteilung vor ihm zitterten, sagte sie noch Dommen jong zu ihm.
Bei Gaston hatte es nicht funktioniert mit dem Behüten, und bei ihrem jüngeren Sohn im Grunde auch nicht, obwohl der später ein hohes Tier war und ziemlich reich. Das heißt ja noch längst nicht, dass es geklappt hätte, und so hatte meine Großmutter mit ihren beiden Söhnen Pech, aber manchmal überspringt es eine Generation.
Man muss Geduld haben. Langmütig sein, großherzig und geduldig.
Der Böll hat auch schon früher …
*
Der Böll hat auch schon früher auf andere aufgepasst und sich um sie gekümmert, und offenbar macht er das noch immer. Trotzdem habe ich mich darüber gewundert, dass er plötzlich auftauchte und sich gerade um mich kümmerte.
Im Grunde wundere ich mich jetzt noch, weil wir überhaupt nicht verwandt sind und ich ihn zu Lebzeiten gar nicht gekannt habe, aber ich nehme mal an, dass der Zwerenz dahintergesteckt hat. Mit dem bin ich zwar auch nicht verwandt, aber den habe ich gekannt, als er noch lebte, also könnte es sein, dass der das mit dem Böll eingefädelt hat.
Wie gesagt: Falls Sie von Böll und Zwerenz noch nie was gehört haben, ist das nicht erstaunlich, weil kein Mensch heute mehr über sie spricht, aber vor ein paar Jahrzehnten waren sie ziemlich bekannt. Der Böll hat sogar den Nobelpreis für Literatur bekommen, und der Zwerenz hat zwar keine Preise bekommen, aber viele Bücher geschrieben, die eine Menge Leute gelesen haben. Der Böll und der Zwerenz waren beide im Krieg gewesen und hatten davon lebenslang die Schnauze voll, und von den Nazis hatten sie die Nase natürlich auch gestrichen voll, und wenn man ihre Bücher liest, hat man auch lebenslang die Schnauze davon voll. Selbst wenn man das Glück hat, überhaupt nicht im Krieg gewesen zu sein.
All das scheint einem heute, als wäre es lang vorüber und vorbei, aber die Dinge sind nicht vorbei, nur weil man die Leute vergessen hat, die davon erzählt haben, und das, was sie erzählt haben, gilt natürlich noch immer, auch wenn es heute niemand mehr hören will, weil inzwischen überall auf der Welt andauernd Kriege geführt werden und immer weiter und weiter geführt werden sollen, weil Kriege fast das Einzige sind, woran sich noch dickes Geld verdienen lässt. Also kommen der Böll und der Zwerenz und ihre Bücher nicht mehr vor.
Der Böll hat den Zwerenz und seine Frau Ingrid zu Lebzeiten gekannt, sogar ziemlich gut. Immerhin so gut, dass er ihnen einen Persilschein besorgt hat, nachdem sie aus dem Osten abhauen mussten. Und als dann später meine Eltern mit mir in den Westen sind, haben die Zwerenzens sich um uns gekümmert und uns einen Persilschein besorgt. Wir sagten jedenfalls Persilschein, auch wenn der Persilschein eigentlich für die Nazis gegolten hatte, die eine weiße Weste brauchten, bevor sie ihre Karriere wieder aufnehmen konnten. Wer aber später aus dem Osten in den Westen abhaute, brauchte auch einen Persilschein, in dem stand, dass er nicht für die Kommunisten wäre und nicht für die Stasi gearbeitet hatte, und die Zwerenzens hatten also ihren Persilschein von Böll bekommen, und wir bekamen später unseren von den Zwerenzens.
Zwerenz mochte mich gern, und ich mochte ihn auch gern. Wir mochten uns alle drei, Ingrid, Gerhard und ich. Irgendwann haben wir uns aus den Augen verloren, weil schließlich nicht jeder jeden sein Leben lang kennen und sehen kann, und als ich die Einladung zu Böll bekam, war also der Zwerenz inzwischen uralt und vermutlich mit einem Bein schon drüben.
Wie dem auch sei, der Böll und der Zwerenz werden wohl gesehen haben, dass ich auf dem Zahnfleisch ging. Nehme ich mal an. Inzwischen gehen alle Schriftsteller auf dem Zahnfleisch und können von Glück sagen, wenn sie mit einem Professor verheiratet sind, der sich eine Künstlerin leisten kann, oder wenigstens mit einer Studienrätin, die einen schriftstellernden Ehemann oder eine schriftstellernde Ehefrau durchfüttern möchte. Manche haben auch Familien, von denen sie was erben können.
Bei Gianni und mir sieht das etwas anders aus. Wenn ich auf dem Zahnfleisch gehe, wird es eng, weil wir von meinem Beruf gelebt haben, solange es ihn noch gab, und weil weit und breit niemand in Sicht ist, an den wir uns wenden könnten, wenn ich auf dem Zahnfleisch gehe. Weil inzwischen alle digitalisiert sind und kein Mensch mehr freiwillig Bücher liest, zumal schon seit Langem immer mehr Büchereien geschlossen werden. Trotzdem geht es Gianni und mir immer noch ziemlich gut, weil wir ein kleines Haus gekauft haben, als Schriftsteller vorübergehend mal ein richtiger Beruf war und Häuser noch zu bezahlen waren.
Das war noch im letzten Jahrhundert. Danach war Schriftsteller immer noch eine Weile lang ein Beruf, etwa so lange, bis die Kultur sich erledigt hatte, und wir hatten kurz vorher gerade auf den letzten Drücker noch ein Grundstück für Noah kaufen können. Sogar noch Anfang dieses Jahrhunderts.
Es war knapp, wir hatten Glück, und als wir den Vertrag für Noahs Grundstück unterschrieben hatten, sagte Gianni, es fühlt sich an, als wären wir wieder mal über den Bodensee geritten.
Wir sind schon oft über den Bodensee geritten, Gianni und ich.
Inzwischen bauten Gianni und Noah gemeinsam an Noahs Haus. Vierhändig.
Dann kam die Krise.