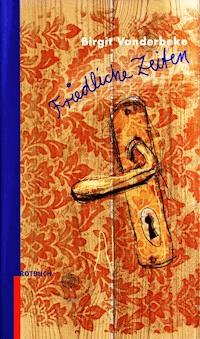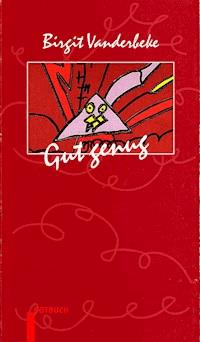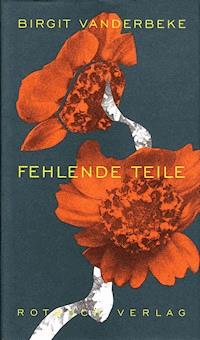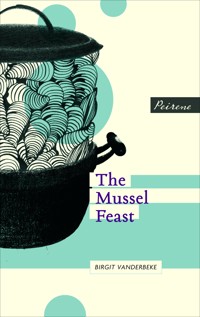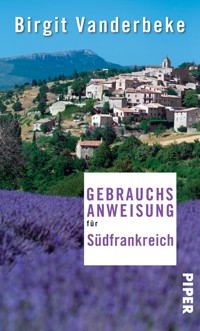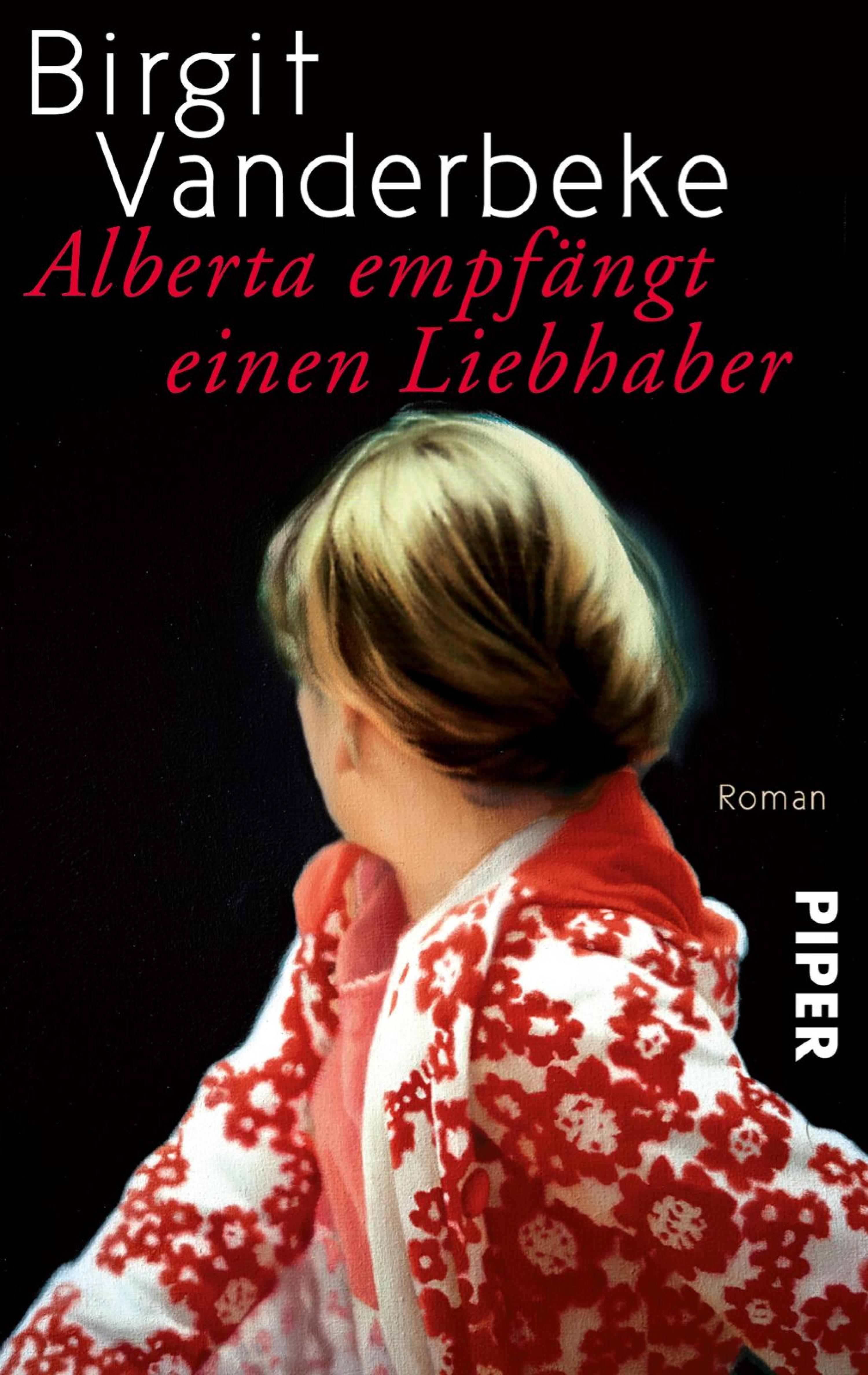8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eines Tages ist sie einfach da, Pola Nogueira. Sie bringt ihren Hund mit, undsie ist schwanger. Ihr Erscheinen verwirrt nicht nur Jule Tenbrock, die übereifrigeAngestellte einer Wäscherei, die wie alle anderen im siebten Distriktseit langem weder einen Hund noch ein Kind gesehen hat. Einzig TimonAbramowski zeigt sich neugierig und offen gegenüber Pola, die vom Land indie Stadt geflüchtet ist, um dort ihr Kind zu bekommen. Doch mit der unkontrollierbarenSinnlichkeit und dem Leben, das sie mitbringt, wird es keinleichtes Spiel für sie werden. Und nicht zuletzt für Timon, dem sehr schnellklar ist, dass er sich mit Pola auf kein geringes Abenteuer einlässt … Wervon dem Charme des wunderbaren Romans »Das lässt sich ändern« verzaubertwar, wird die anarchische Kraft der Pola Nogueira lieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2012
ISBN 978-3-492-95856-1
Deutschsprachige Ausgabe:
© 2012 Piper Verlag GmbH, München
Umschlaggestaltung: Kornelia Rumberg, www.rumbergdesign.de
Umschmotiv: plainpicture/Arcangel
Datenkonvertierung E-Book: Kösel, Krugzell
Bis zu jenem Oktoberabend war der siebte Distrikt ruhig und friedvoll gewesen. Die Bewohner waren damit beschäftigt, Bonuspunkte und -sterne zu sammeln, um das bevorstehende Weinfest angemessen begehen zu können. Sie bereiteten sich auf die Übertragung des Wettbewerbs der Kulturen vor, eines der wichtigsten Medienereignisse des Jahres, und außerdem hatte Kabel 7 eine neue Show aufgelegt, »Cosy Home«, bei der man anrufen, an einer Meinungsumfrage teilnehmen und, wenn man unter die ersten fünfzig Anrufer kam, etwas Schönes für die Wohnung gewinnen konnte. Jule Tenbrock beeilte sich auf dem Heimweg, um den Anfang nicht zu verpassen. Im Super-K hatten sie indische Woche, und Jule nahm die Komplettbox Maharani, Käsecracker, Kichererbsen-Masala und Obstsalat von exotischen Früchten, hielt rasch noch im Coffee-Point, um einen Cappuccino zu holen, und schaffte es dann in weniger als acht Minuten mit dem Pappbecher in der Hand nach Hause.
Schon zwei Wochen vor Beginn der Sendung waren die Gewinne in den Vitrinen der Stiftung auf der Meile ausgestellt und beschildert: nostalgisches Seifenregal, vier geschmackvolle Trio-Schalen für Snacks mit farbenfrohem Silikonuntersetzer, eleganter Zeitungsständer, hochwertiges Bettwäscheset. Jule Tenbrock war erpicht auf das romantische Blumenservice. Unzerbrechliche Luminose, geschwungene Linie, Grundfarbe Weiß, wahlweise mit Kornblumen- oder Klatschmohndekor. Jule hatte eine Schwäche für schöne Dinge, sie träumte von dem Candle-Light-Dinner aus dem Spot, mit dem »Cosy Home« angekündigt worden war: Die rote Tischdecke der Lotus-Serie hatte sie längst in ihrem Schrank. Zusammen mit dem passenden Besteckset, den beiden Kerzenhaltern und den Gläsern für Weiß- und für Rotwein hatte sie bereits im Vorfeld der neuen Show eine Menge Punkte in das Candle-Light-Dinner gesteckt.
Jule Tenbrock war eine fleißige Bonussammlerin, und seit sie den Job in der Wäscherei hatte, zusätzlich zu den drei Nachbarschaftsabenden pro Woche, an denen sie bei Frau da Rica vorbeischaute, war ihre Bilanz prächtig. Und wenn Frau da Rica demnächst den Gips abbekäme und sich wieder selbst versorgen könnte, würde Jule sich um jemand anders kümmern, sie war ein Muster an Engagement in der nachbarschaftlichen Wohltätigkeit. Fehlte allerdings noch dieses Luminose-Service mit dem Blumenmuster, weshalb sie die Sendung auf keinen Fall verpassen wollte. Die Nummer, unter der man beim Sender anrufen konnte, hatte sie längst programmiert, um später keine Zeit mit Wählen zu vergeuden und ganz sicher zu sein, dass es mit dem Service auch klappte.
Clemens wollte sie von dem Dinner erst etwas sagen, wenn sie das Geschirr auch wirklich in den Händen hätte. Und beim Dinner würde sich zeigen, ob aus Clemens und ihr etwas werden könnte.
Im Treppenhaus nahm sie sich rasch die Angebotsinfos vom Super-K, von der Superette und dem Konsomarkt, die in drei Bündeln auf dem Boden lagen; die Schnüre waren schon aufgeschnitten und lagen daneben. Schlamperei, dachte Jule und hob sie auf, der neue Hausdienst war einfach nicht auf der Höhe.
Sie nahm zwei Stufen auf einmal, solche kleinen Übungen sind unerlässlich für eine gute Figur, und war außer Atem, als sie im obersten Stockwerk ankam und beinah über das formlose graue Bündel gestolpert wäre, das da mitten auf der Treppe abgelegt worden war.
Im nächsten Moment ging das Licht aus.
Jule Tenbrock stieg an dem Bündel vorbei die letzte Stufe hoch und suchte den Knopf neben ihrem Namensschild. Sie würde sich bei der Stiftung über den Hausdienst beschweren, der etwas unförmig Graues vor ihrer Tür abgeladen hatte, das hier ganz sicher nicht hingehörte. Es war stockfinster im Flur, der verdammte Lichtschalter war nicht zu finden, Jule konnte die Hand vor den Augen nicht erkennen. Aber sie konnte etwas riechen.
Und plötzlich war es aus mit der Ruhe im siebten Distrikt. Im Bruchteil einer Sekunde verflog Jules Unmut, ihr Ärger verwandelte sich in Herzrasen und blanke Panik.
Das Bündel roch eigenartig. Es roch lebendig und ganz eindeutig unsauber. Unhygienisch.
Der Lichtschalter war nicht dort, wo er hätte sein müssen, Jules Hand war nicht so ruhig, wie sie hätte sein müssen, und aus dem unhygienisch riechenden grauen Bündel kamen jetzt Töne. Etwas seufzte, schnaufte und röchelte unmenschlich aus dem Bündel heraus, es machte Töne, die Jule nicht kannte. Endlich wurde es wieder hell im Treppenhaus, Jule wollte nichts weiter, als in ihre Wohnung verschwinden und geschützt sein vor diesem keuchenden Ding auf der Treppe, sie wandte ihm den Rücken zu und versuchte, es einfach nicht gesehen zu haben, aber sie hatte es gesehen, bevor das Licht ausgegangen war, und in ihrem Rücken schnaufte es weiter.
Und dann fing es an zu sprechen.
’tschuldigung, sagte das Ding. Es hatte eine klare, junge Stimme.
Jule hielt in ihrer Bewegung inne, sah angestrengt ihre Wohnungstür an und dachte nach.
Dann drehte sie sich langsam um.
Oben schaute jetzt ein ungekämmter Kopf mit schwarzen Haaren aus dem Bündel heraus und sagte, ’tschuldigung, aber ich weiß nicht, wo ich hinsoll.
In der bläulichen Treppenhausbeleuchtung sah Jule, dass das Graue einmal ein Mantel gewesen sein musste, ein sehr großer, uralter, doppelreihig geknöpfter Herrenmantel, in dem heute ein weibliches Wesen steckte. Aus dem Inneren des Mantels schnaufte es weiter. Das Wesen selbst schnaufte nicht, also musste da noch jemand im Mantel stecken.
Jule schwieg. Das Wesen mit den wirren schwarzen Haaren schlug kurz den Mantel auseinander und sagte, ich und Zsazsa wissen nicht, wo wir hinsollen.
Das ist ein Hund, sagte Jule entsetzt beim Anblick des schnaufenden Tiers.
Zsazsa war ein Hund.
Ja, sagte das Wesen, das ist mein Hund.
Jule begriff auf der Stelle, dass dieses weibliche Wesen nicht aus dem siebten Distrikt und auch aus keinem der anderen Distrikte kommen konnte.
Auf dem gesamten städtischen Gebiet waren Tiere nicht zugelassen. Hund, Katze, Maus, gesundheitlich ein Graus.
Tiere gab es im Tierpark. Jule hatte sich einmal von Clemens dazu überreden lassen, ihre Freizeitsterne für eine Busfahrt in die Erlebnis-Arena zu nutzen. Alle schwärmten von dem magischen Wochenende mit Spiel, Sport und Spaß, und schließlich war sie Clemens zuliebe Autoscooter gefahren, hatte sich auf den Action Tower zerren lassen, in die Achterbahn, auf die gigantische Spiralrutsche, und zuletzt hatte auch ein Besuch im Tierpark auf dem Programm gestanden, mit der Bäreninsel, den Flamingos, den Zebras, einem Giraffenhaus und dem Seelöwenbecken. Die Abteilung Antarktis war geschlossen gewesen, weil die Pinguine Malaria hatten. Wie auch immer. Tiere gab es im Tierpark. Und die Erlebnis-Arena war nicht Jules Sache.
Dieses Wesen jedenfalls, das mitsamt seinem Hund vor Jule Tenbrocks Wohnung im Treppenhaus saß, konnte nicht von hier sein, es musste von draußen kommen.
Draußen, dachte Jule. Draußen war Detroit.
Sie spürte, wie sich bei diesem Gedanken das kalte Entsetzen in ihrem Inneren ausbreitete, vom Magen nach oben hochkroch, bis in die Brust, in den Hals.
Draußen, das waren die ehemaligen Fabrikbezirke um die Stadt herum, die schon vor Jahrzehnten aufgegeben worden waren, stillgelegt, sich selbst überlassen. Draußen gab es keine Ordnung, keine Stiftung, keinen Fernsehsender, keine Bonuspunkte und -sterne, keinen Telefonservice, das war der gesetzlose Gürtel am Rande der Stadt, das waren Kriminelle und Banden, die sich nachts durch die verlassenen Straßen trieben, dunkle Gestalten, Zeugnisse einer untergegangenen Zeit, Reste des letzten Jahrhunderts, die längst vom Netz der Gemeinnützigkeit genommen waren.
Dahinten herrschen Zustände wie im alten Detroit, sagte Clemens, wenn die Medien über die Zustände in den vorstädtischen Problemzonen berichteten. Die Nachrichten brachten regelmäßig Schreckensmeldungen – Häuser wurden geplündert und abgefackelt, von Prügeleien war die Rede, sogar Schießereien sollte es dort geben, und am bedenklichsten waren die Orgien, die die Banden veranstalteten; sie nahmen gefährliche Substanzen zu sich und fielen übereinander her, die Folge waren, so die Medien, grassierende Krankheiten und die Verbreitung bedrohlicher Seuchen, die nur mit Mühe von den innerstädtischen Distrikten ferngehalten werden konnten.
Jule wusste nicht so genau, was Detroit war, aber Clemens war mit dem Bus schon mehrmals zu einem seiner Einsätze in den Stiftungslaboren durch den Vorstadtgürtel hindurchgefahren, er wusste, wovon er sprach, und sagte, das, was sie in den Nachrichten bringen, ist noch harmlos gegen die tatsächlichen Zustände, das ist nur die Spitze des Eisbergs. In Wirklichkeit traut sich da gar kein Reporter rein, weil keiner Lust hat, abgeknallt zu werden oder sich irgendwas einzufangen.
Inzwischen sagte auch Jule Detroit, wenn sie von den Außenbezirken sprach; viele Bürger und Bürgerinnen im siebten Distrikt sagten Detroit dazu, ohne genau zu wissen, was das war. Dahinter fingen die Felder an, die manchmal im Fernsehen kamen, der Weizen, der Mais, der Raps, der Kohl, Felder, so weit das Auge reichte, die Gewächshäuser mit den Erdbeeren und Tomaten und die Labore, Fertigungsungszentren, Kühlhallen, die Schlachthöfe, Verladestationen, die gesamte Forschung und Versorgung.
Jule schaute auf das Bündel vor ihr. Sie hatte noch nichts gesagt, weil man nichts sagen kann, wenn ein Wesen mit Hund im Treppenhaus sitzt und nicht weiß, wo es hinsoll. Es war schwer zu entscheiden, ob es eine Frau oder ein Mädchen war. Der Hund hatte aufgehört mit seinen Tönen, er hatte eine spitze Nase aus dem Mantel herausgestreckt, Jule sah zwei dunkle Schlappohren und einen Hals mit honigfarbenen, kurzen Haaren. Das Tier verfolgte die Situation mit wachsamen braunen Augen, aber sein Geruch wurde immer stärker und unangenehmer; unhygienisch, dachte Jule. Sie hielt den Lichtknopf mit dem Zeigefinger gedrückt, um nicht noch einmal mit diesen fremden Eindringlingen vor ihrer Wohnung im Dunklen stehen zu müssen, und fragte sich, was sie ausgerechnet von ihr wollten.
Was wollen Sie hier, sagte sie schließlich.
Weiß nicht, sagte das Wesen, sonst war nirgends offen, und hier war die Tür nicht eingerastet.
Dieser Hausdienst, dachte Jule, aber in dem Moment hörte sie unten die große Doppeltür ächzen und kurz darauf die unregelmäßigen Schritte von Abramowski.
Sie wusste, jetzt hatte sie nicht mehr viel Zeit.
Im Treppenhaus roch es nach Tier. Jule spürte einen Anflug von Übelkeit und Unwillen. Was wollten die hier. Über der rechten Augenbraue des Wesens sah sie einen blutigen Riss. Vier Augen starrten ihr ins Gesicht, und Abramowski kam in großen Schritten nach oben.
Mit der Ruhe im siebten Distrikt würde es vorbei sein. Sie würde ihrem Nachbarn nicht gut erklären können, wer dieses Wesen war, Wesen mit stinkendem Hund, also schloss sie rasch die Wohnungstür auf, legte einen Zeigefinger auf die Lippen, scheuchte die Frau mit dem Hund nach drinnen und machte die Tür wieder zu, bevor Abramowski den vierten Stock erreicht hatte.
Dann legte sie das Ohr an die Tür und wartete, bis die Tür gegenüber geschlossen wurde.
*
Pola Nogueira stand in Jule Tenbrocks Flur. Sie wäre gern hineingegangen in das kleine Wohnzimmer, das sie vom Flur aus sehen konnte, vor allem hätte sie sich gern hingesetzt, aber sie traute sich nicht. Neben ihr saß ganz still der Hund. Beide musterten das cremefarbene Sofa und die dazu passenden cremefarbenen Sessel vor sich. Pola war dankbar, dass sie bei einer Frau gelandet waren, einer jungen Frau, die vermutlich ungefährlich war, bei Männern konnte man es nicht wissen, aber sie begriff schnell, dass das hier keine Lösung für länger sein würde.
Höchstens einmal duschen, im Glücksfall baden, vielleicht etwas essen, dachte sie, und dann nichts wie weg.
Sobald die Tür ihres Nachbarn zugefallen war, wurde Polas Gastgeberin hektisch, verschwand in einem kleinen Badezimmer und kam gleich darauf mit einer Sprühflasche wieder heraus. Dann machte sie ganz leise ihre Wohnungstür wieder auf, schlich auf Zehenspitzen hinaus und versprühte einen süßlichen Duft im Treppenhaus, schloss danach rasch ihre Tür und wurde dann erst wieder etwas ruhiger. Jule stand im Flur, horchte eine Weile nach draußen, aber da tat sich nichts mehr.
Bio-Dekontamination, sagte sie dann.
Bio-Dekontamination, wiederholte die Frau mit dem Hund ungläubig.
Das Wort schien ihr von einem anderen Stern zu kommen, so lächerlich wenig hatte es mit dem Leben zu tun, das sie in den letzten Monaten geführt hatte, in der langen Zeit, seit ihre Großmutter gestorben war und sie Klein-Camen verlassen hatte und mit Zsazsa durch die endlosen Felder in Richtung Stadt unterwegs gewesen war, bis sie schließlich die Vororte erreicht hatte, die längst vom Netz genommen und großenteils zerfallen waren.
Pola hatte fast vergessen, was eine richtige Wohnung ist. Zuletzt hatte sie im Geräteschuppen einer Villa gewohnt, deren Türen und Fenster vernagelt waren, wahrscheinlich hatten die Besitzer die Bretter angebracht, als sie einer nach dem anderen das Villenviertel aufgegeben und geglaubt hatten, eines Tages wieder zurückkommen zu können. Einige Villen waren aufgebrochen, hier und da waren ein paar inzwischen wieder bewohnt. Die meisten Villen aber in der Gegend, in der Pola untergekrochen war, standen geplündert sperrangelweit offen und waren tot. Nichts als alte Häusergerippe, durch die der Wind hindurchfegte.
Neben Pola wohnten Isabella und Pinkus, Einzelgänger, die nicht in die ehemaligen Neubaugebiete ziehen mochten, wo mehr los war, aber manchmal nahmen sie Pola mit, wenn am Grillplatz die großen Feuer brannten, und Pola fühlte sich sicherer, wenn sie mit Isabella und Pinkus ging, allein hätte sie nicht in die Neubaugebiete gehen mögen, in denen kaum Frauen lebten. Nicht dass sie Angst gehabt hätte, Angst hilft nicht. Aber Zsazsa hatte seit der Sache auf den Feldern schreckliche Angst vor Männern.
Jetzt war Pola zum ersten Mal wieder in einer richtigen lebenden Wohnung mit sauberen cremefarbenen Sesseln, die genau zu einem cremefarbenen Sofa passten, auf dem die Bewohnerin in aller Ruhe lesen könnte, Musik hören, fernsehen, es gab Lichtschalter, Steckdosen, Strom, aus der Leitung kam fließendes Wasser. Und das alles schüchterte Pola nach den vergangenen Monaten etwas ein, also drückte sie sich noch im Eingangsbereich herum und wagte sich nicht in den Raum mit dem sauberen flauschigen Teppich.
Da fragte Jule Tenbrock plötzlich in Polas Andacht hinein nach ihrer Di-Card.
Was für eine Karte, sagte Pola.
Ihre Distrikt-Card, sagte Jule. Ihre Registrierung.
Was für ein Distrikt.
Der siebte, sagte Jule, wir sind hier im siebten Distrikt.
Di-Card ist nicht, sagte Pola und schüttelte den Kopf mit den wirren schwarzen Haaren.
Jule Tenbrock warf einen Blick auf Zsazsa und sagte, das dachte ich mir.
Danach entstand eine kleine Pause, in der sie überlegte, ob sie die Leptospirose-Epidemie erwähnen sollte. Jedes Kind wusste, dass die mutierte Leptospirose Tausende Todesopfer gefordert hatte. Sie war nach den Stürmen aus Nicaragua, den Philippinen, Brasilien eingeschleppt worden, hatte sich in nordwestlicher Richtung rasend verbreitet und war nur durch die neue Seuchenverordnung vom Stadtgebiet fernzuhalten gewesen. Hund, Katze, Maus. Das hatte Jule Tenbrock wie jedes Kind schon in der Pflichtschule gelernt, aber die Frau mit dem Hund hatte offenbar die Pflichtschule nicht besucht, jedenfalls nicht im siebten Distrikt, und wo sie herkam, wusste man womöglich nichts von der Leptospirose und ihren Folgen, man wusste es nicht oder hatte es wieder vergessen. Jule Tenbrock beschloss, dass es sinnlos war, davon jetzt zu sprechen.
Pola verfolgte auf dem Gesicht ihrer Gastgeberin, wie diese mit sich kämpfte, sie konnte die widerstreitenden Empfindungen nicht entschlüsseln, umso überraschter war sie dann, als Jule sich schließlich trotz ihres inneren Widerstrebens überwand und ihr die Hand gab.
Ich bin Jule Tenbrock, sagte sie.
Anschließend verschwand sie in ihrem Badezimmer, um sich die Hände zu waschen.
Als sie wieder zurückkam, sagte sie, und wer sind Sie, so ganz ohne Di-Card.
Pola Nogueira, sagte Pola, und Zsazsa kennen Sie ja schon. Auch keine Distrikt-Karte.
Sie bluten ja. Sie sind verletzt, sagte Jule und zeigte auf Polas Stirn.
Ist bloß ein Kratzer, sagte Pola und strich mit dem Finger darüber, um zu zeigen, dass die Wunde schon verschorft war, aber Jule schüttelte den Kopf und murmelte kaum hörbar etwas von Infektion und dass das versorgt werden müsse.
Ich hol rasch das Polyhexanid, sagte sie und verschwand noch einmal im Bad.
Pola war entmutigt. Unter Versorgung hätte sie sich etwas zu essen und zu trinken vorgestellt, eine Dusche und dann vielleicht ein Bett, aber Jule Tenbrock bestand auf dem antibakteriellen Mittel, dessen Namen Pola nicht kannte, und als das Pflaster klebte, sagte Jule, über die ganze Aufregung haben wir jetzt die Show verpasst. Ist diesmal nichts mit dem Luminose-Service. Schade.
Was für eine Show und was für ein Service, fragte Pola.
Jule zeigte auf die Vitrine hinter ihrem Sofa und sagte, ich habe eine Schwäche für schöne Sachen.
Ziehen Sie doch Ihre Schuhe aus, sagte sie dann.
Es war eine Einladung, ihr Zimmer zu betreten.
Gern, sagte Pola erleichtert.
Während Jule von der Show und dem Service erzählte, unzerbrechliches Luminose-Material, Kornblume oder Mohn, schaute Pola sich Jules schöne Sachen an. Sie war befremdet.
Da war ein herzförmiger Schmetterlingsschmuckteller, der aufrecht an der Wand lehnte, und davor war ein sonderbares Sammelsurium drapiert. Runde Holzkästchen, mit Phantasievögeln und Orchideen bemalt, verschiedene Blech- und Holzdosen, manche lackiert, manche mit Blumenapplikation, ein paar Schüsseln, eine gelb lackierte Handtasche, eine scheußliche kleine vergoldete Standuhr, ein paar Gläser, etliche Tassen und Becher, zwei Puppen, die eine im Anzug, die andere im weißen Hochzeitskleid, dann noch Stofftiere, Teddybär, Krokodil, Papagei, sowie zwei verschnörkelte Kerzenständer.
Pola sah ihren Hund an und strich ihm über den Kopf. Sie dachte daran, dass Zsazsa, ganz brav, keinen Mucks von sich gegeben hatte, obwohl sie halb verhungert sein musste nach den beiden Tagen, in denen sie durch den Wald gestolpert waren und Pola gedacht hatte, sie würden nie aus dem Dickicht finden.
Es war klar, dass Jule Tenbrock in ihrem Element war, wenn sie von den schönen Dingen sprach, die sie schon gewonnen hatte und die sie noch vorhatte zu gewinnen, sie hätte stundenlang weiter davon erzählen können, aber Pola unterbrach die Erzählung.
Ich will nicht unhöflich sein, sagte sie, als Jule Tenbrock eine Pause machte, aber könnten wir wohl ein Stück Brot haben.
Jule Tenbrock hörte auf zu reden und sah plötzlich aus der Bahn geworfen und entgeistert aus. Sie antwortete nicht.
Sie ist schockiert, dachte Pola.
Brot jedenfalls schien es in ihrer Welt der Shows und schönen Dinge nicht zu geben, und als Pola vorsichtig sagte, vielleicht ein Glas Milch, sah Jule Tenbrock aus, als würde sie gleich in Ohnmacht fallen, aber schließlich fing sie sich und sagte, vielleicht mögen Sie einen Kaffee.
Danke, gern, sagte Pola, und wenn Sie etwas Wasser hätten.
Zum Kaffee noch dazu, fragte Jule.
Pola öffnete ihren Rucksack und zog eine Schüssel hervor, die ganz oben auf ihren Sachen lag.
Ende der Leseprobe