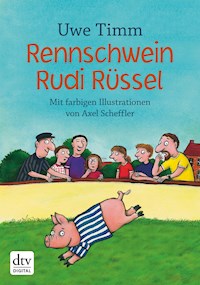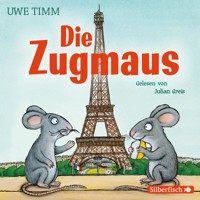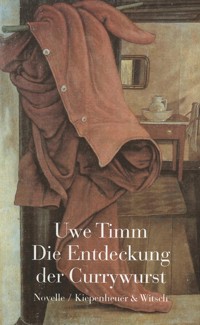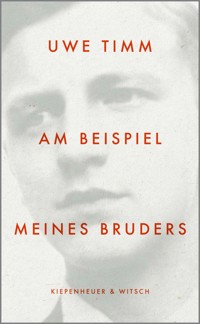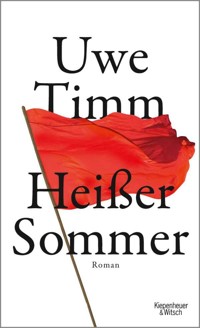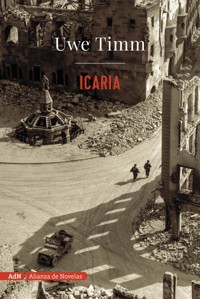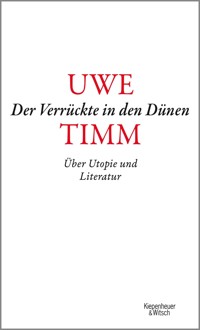11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In seinem neuen Buch erzählt Uwe Timm von seinen Lehrjahren als Kürschner im Hamburg der Fünfzigerjahre. Von kuriosen Erlebnissen im Beruf und der Welt der Mode, von besonderen Freundschaften und den Büchern, die sein Leben verändert haben. Hamburg 1955 – der noch 14-jährige Uwe wird von seinem Vater, dem Inhaber eines Pelzgeschäfts, in die Kürschnerlehre gegeben. Im Takt der Stechuhren lernt der junge Mann die kreative Präzision, die das heute fast ausgestorbene Handwerk erfordert, schult den Blick für das Material, die Kundinnen, die Tücken und Geheimnisse dieser Kunst. Er lauscht den Geschichten der Kollegen, schließt Freundschaften, bekommt Bücher empfohlen, entdeckt die Stadt und den Jazz. Der Lehrling, der vom Schreiben träumt, liest heimlich im Sortierzimmer Salinger und Camus, begleitet den »roten Erik« auf die Reeperbahn, erkundet mit dem Kollegen Johnny-Look, reichlich schüchtern noch, die Liebe, wird von Meister Kruse politisch initiiert und streitet sich nun umso intensiver mit dem Vater über die NS-Zeit. Inzwischen ist auf dem Pelzmarkt ein Preiskampf ausgebrochen, das Kürschnergeschäft der Familie floriert nicht mehr, und als der Vater plötzlich an einem Herzinfarkt stirbt, muss der 18-Jährige ein völlig überschuldetes Geschäft sanieren. Die harte Arbeit und die großen Sorgen bringen ihn nicht ab von der Vorstellung eines ganz anderen Lebens. Ein großartiges Buch der Erinnerungen und des Aufbruchs, präzise und poetisch. Ein sprechendes Zeitbild, ein Initiationsroman der Liebe, des Lesens, des Arbeitens und Träumens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Uwe Timm
Alle meine Geister
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Uwe Timm
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Uwe Timm
Uwe Timm, geboren 1940 in Hamburg, lebt in München und Berlin. Sein Werk erscheint seit 1984 bei Kiepenheuer & Witsch in Köln, u. a.: »Heißer Sommer« (1974), »Morenga« (1978), »Der Schlangenbaum« (1986), »Kopfjäger« (1991), »Die Entdeckung der Currywurst« (1993), »Rot« (2001), »Am Beispiel meines Bruders« (2003), »Der Freund und der Fremde« (2005), »Halbschatten« (2008), »Vogelweide« (2013), »Ikarien« (2017), »Der Verrückte in den Dünen« (2020).
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
In seinem neuen Buch erzählt Uwe Timm von seinen Lehrjahren als Kürschner im Hamburg der Fünfzigerjahre. Von kuriosen Erlebnissen im Beruf und der Welt der Mode, von besonderen Freundschaften und den Büchern, die sein Leben verändert haben.
Hamburg 1955 – der noch 14-jährige Uwe wird von seinem Vater, dem Inhaber eines Pelzgeschäfts, in die Kürschnerlehre gegeben. Im Takt der Stechuhren lernt der junge Mann die kreative Präzision, die das heute fast ausgestorbene Handwerk erfordert, schult den Blick für das Material, die Kundinnen, die Tücken und Geheimnisse dieser Kunst. Er lauscht den Geschichten der Kollegen, schließt Freundschaften, bekommt Bücher empfohlen, entdeckt die Stadt und den Jazz. Der Lehrling, der vom Schreiben träumt, liest heimlich im Sortierzimmer Salinger und Camus, begleitet den »roten Erik« auf die Reeperbahn, erkundet mit dem Kollegen Johnny-Look, reichlich schüchtern noch, die Liebe, wird von Meister Kruse politisch initiiert und streitet sich nun umso intensiver mit dem Vater über die NS-Zeit.
Inzwischen ist auf dem Pelzmarkt ein Preiskampf ausgebrochen, das Kürschnergeschäft der Familie floriert nicht mehr, und als der Vater plötzlich an einem Herzinfarkt stirbt, muss der 18-Jährige ein völlig überschuldetes Geschäft sanieren. Die harte Arbeit und die großen Sorgen bringen ihn nicht ab von der Vorstellung eines ganz anderen Lebens.
Ein großartiges Buch der Erinnerungen und des Aufbruchs, präzise und poetisch. Ein sprechendes Zeitbild, ein Initiationsroman der Liebe, des Lesens, des Arbeitens und Träumens.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2023, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © akg-images / Paul Almasy
ISBN978-3-462-31194-5
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Hinweis
I. Kapitel
II. Kapitel
Danksagung
Literaturverzeichnis
Zum Schutz von Personen wurden Namen zum Teil verändert und Handlungen, Ereignisse und Situationen an manchen Stellen modifiziert.
I.
Das Kind beobachtet das Rotkehlchen auf dem Ast. Das Kind wartet. Der kleine Vogel sitzt und fliegt nicht. Auch die anderen Vögel, die Bussarde, Sperber, die beiden Kanarienvögel, sitzen auf ihren Ästen und fliegen trotz ausgebreiteter Schwingen nicht auf. Das Kind wartet. Die Tiere sind wie im Märchen erstarrt. Das mächtige Buch, in mattrotes Leinen gebunden, mit einer geprägten Goldzeichnung: Ein bärtiger Riese steht hinter einer Tanne, davor der Däumling. Ein Wunderbuch. Auf den Papierseiten glänzt und blitzt es. Diamanten, sagt der Vater, aus der Schatztruhe von König Drosselbart. Grimms Märchen. Die erste eindrückliche Wahrnehmung eines Buchs, das jetzt hinter mir im Schrank der ausgewählten Bände steht. Die Augen der Mutter wandern beim Vorlesen hin und her. Die Vorfreude auf das Umblättern, die zarten Aquarellbilder, das tapfere Schneiderlein, die erstarrte Zeit in Dornröschens Schloss, der Däumling, der mit seinem Spazierstock, einer Stecknadel, durch den Schornstein mit dem Rauch in die weite Welt hinausgetragen wird, und der Schrecken, König Blaubarts Schloss, das verbotene Zimmer. Geschichten, die wiederholt werden konnten, gleichbleibend, und sich doch durch Fragen des Kindes und Antworten der Mutter veränderten. Stille. Draußen war Krieg. Pommerland ist abgebrannt, sagte die junge Frau des Leutnants, die mit uns zur Untermiete in dem ziegelroten Haus wohnte, an der Itz, in Coburg.
Unter der Zimmertür der Lichtschein, dort sitzt die Mutter, liest oder näht. Draußen auf der Straße ziehen die dem großen Morden entkommenen Menschen vorbei.
Im Herbst die Rückkehr nach Hamburg. Eine Trümmerstadt. Schuttberge. Geruch nach feuchtem Mörtel. Wohnen und schlafen in einem zugigen Kellerzimmer mit einer Eislandschaft an der Wand. Hunger und abermals Hunger. Die Mutter, der Vater lesen vor: Geschichten aus Tausendundeine Nacht. Der magnetische Fels, an dem die Schiffe zerschellen. Die Palastpforte, durch die der Sultan als Bettler geht. Der Bucklige. Die Gärten. Die Rose. Das Wasser. Der Zauberer. Der Dichter. Der Handwerker.
1955, kurz vor meinem fünfzehnten Geburtstag, stellte ich mich bei Erich Levermann vor. Gekommen war ich mit dem Vater, der, obwohl er das Kürschnerhandwerk nicht erlernt hatte, ein kleines, aber gut gehendes Pelzgeschäft betrieb, das er Atelier nannte. Er hatte uns bei Erich Levermann angemeldet. Ein Selbstständiger, worauf der Vater Wert legte, sprach zum Selbstständigen, wenn auch der Unterschied in der Selbstständigkeit erheblich war, der Betrieb des Vaters hatte, samt Chauffeur, zwölf Angestellte, der von Levermann an die sechzig. Erich Levermann saß im Büro hinter einem breiten Schreibtisch und ihm gegenüber der Vater. Ich stand daneben und blickte aus dem Fenster auf ein gegenüberliegendes Bürohaus, darüber der Himmel. Schien die Sonne oder war es nieselig grau? Ein Tag im März, nicht mehr Kind, aber noch nicht erwachsen. Woran dachte ich? Dass in dem Gespräch über mein Leben verhandelt wurde? Wahrscheinlich dachte ich an den Einbeinigen aus der Schatzinsel. Das für Jugendliche gekürzte und illustrierte Buch las ich gerade zum zweiten oder dritten Mal. Draußen flog hin und wieder eine Möwe vorbei, dieses schwerelose Gleiten, diese jähen Abstürze, als hätten sie sich an der Luft gestoßen. Die Binnenalster war nah, nur einen Büroblock entfernt. Die beiden Männer redeten über mich. Was sie sagten, davon ist mir nichts im Gedächtnis geblieben. Die Hände aus den Taschen, hat der Vater gesagt, bevor wir ins Büro gingen. Ich trug den dunkelblauen Konfirmationsanzug, ein weißes Hemd. War die Krawatte grün? Sie war grün, sagt eine Stimme in mir, nein, hellblau, sagt eine andere Stimme. Das Blau war eine sichere Farbe. Die Farbe Grün konnte ins Braun spielen. Nicht Farbenblindheit, aber eine Farbenschwäche im Rot-Grün-Bereich. Das durfte nicht erwähnt werden. Aber die feinsten Grauschattierungen konnte ich sehen und genau bestimmen.
Den Beruf des Kürschners hatte ich mir nicht ausgesucht, so wie auch der Vater ihn nicht für sich ausgesucht hatte. Sein Wunsch war wohl gewesen – er sprach nicht darüber –, Künstler zu werden. War es seine Entscheidung, dass ich auf der Volksschule blieb? Vielleicht wollte der Vater mich vor einem Versagen auf der Höheren Schule schützen. Meine Aufsätze waren lang, aber voller Fehler. Das Schreiben war ein Stutzen, ein Widerwille gegen die Beliebigkeit der Zeichen. Sie waren so fern von dem, was sie bezeichneten, warum, sagt die Erinnerung, muss der Schwan mit einem a geschrieben werden, da er doch zwei Flügel hat? Die Autorität der Zeichen, die durch die Lust am Erzählen überwunden wurde. Dieses gewundene Wort: Rechtschreibschwierigkeit.
Die Möglichkeit, dass ich sitzen bleiben könnte, schreckte den Vater. Besser ein guter Volksschüler als ein schlechter Gymnasiast. Und überhaupt sollte der Junge, nachdem der ältere Sohn gefallen war, einmal das Geschäft übernehmen. Ich schickte mich in die Entscheidung. Die Trauer über den Verlust der Freunde, die zum Gymnasium wechselten, darunter der beste, Klaus Meyer. Der Schmerz, zurückzubleiben. Ich stand da und hörte den beiden Männern zu, die rauchten und Kaffee tranken. Der Nochvierzehnjährige spürte in seiner verträumten Abwesenheit, dass der sonst so souverän auftretende Vater hier zum Bittsteller wurde. Levermann hatte nochmals die Bewerbung gelesen, mein Zeugnis studiert und in unser abwartendes Schweigen hinein gesagt, eigentlich stelle er nur Lehrlinge mit Abitur oder Mittlerer Reife ein. Aber gut, sagte er, das Zeugnis ist in Ordnung.
Der Vater und Levermann gaben sich die Hand. Ich wurde mit einem Kopfnicken entlassen.
Wir fuhren mit dem Fahrstuhl hinunter.
Geschafft, sagte der Vater, und du machst mir keine Schande!
Das Wort Schande bezeichnete alles, was die so mühsam aufgebaute Existenz der Familie, die Selbstständigkeit, hätte vernichten können.
Das Pelz- und Modehaus Levermann lag in der Hamburger Innenstadt, dem Rathaus nah. Es war das größte Pelzgeschäft in der Stadt und galt als elegant und solide, allein Edelpelz Berger hatte ein vergleichbares Niveau, mit einem nicht unwesentlichen Unterschied: Dessen Namensgeber und Besitzer Otto Berger begleitete der Ruf eines genialen Modisten, der, wenn die ausgefallenen Modelle seiner Mäntel nicht den richtigen Faltenwurf zeigten, im Entwurfsatelier tobte und einmal einen Stellspiegel mit einem Stuhl zertrümmert haben soll. Alltagsmythen, die sich um jeden gefragten Schneider, Friseur, Künstler oder Kürschner ranken. Sie alle dürfen, ja müssen etwas Außerordentliches, auch Verrücktes haben, den Ausweis des Genialen. Nichts davon hatte Erich Levermann, dafür war die Firma – und mit ihr die Lehrlinge und Meister – mit zahlreichen Preisen für solides Handwerk ausgezeichnet worden. Die Modelle wirkten zeitgemäß, also modern, aber in Maßen, sodass man nicht über die Form der Mäntel stutzte und den Trägerinnen irritiert nachblickte.
Unten, an dem Eck Bergstraße und Hermannstraße, zog sich an zwei Seiten die breite Fensterfront der Firma Levermann entlang, eine der Kunststoffpuppen trug einen Ozelotmantel. Wir blieben vor dem Fenster stehen. An keiner Stelle war zu erkennen, wo die zwei Felle, um die Länge des Mantels zu erreichen, aneinandergesetzt worden waren, das feine und dichte, falbbraun bis gelbrötlich glänzende Fell, oben an Kopf und Hals die dunklen Längsstreifen, die sich in Reihen zu Voll- und Ringflecken auflösten, dieser so staunenswerte Farbschutz, der das Tier im Laub verbergen konnte, war hier ausgestellt.
Das sind die Könner unter den Kürschnern. Wenn du mal so einen Mantel machen kannst, dann hast du es geschafft, wird der Vater gesagt haben.
Das waren so ganz andere Schaufenster als das eine mit der darüber leuchtenden milchweißen Neonröhren-Schrift Pelze Timm. Das Pelze in Schreibschrift mit einem schwungvollen, aus dem E kommenden Unterstrich, darunter das Timm in Blockschrift. Die Schrift hatte der Vater selbst entworfen, und auf dem Foto wirkt sie noch heute – oder schon wieder – modern. Eine kopflose Puppe stand im Schaufenster und trug wochenweise wechselnde Pelzmäntel: Rotfuchs, Nutria oder Persianer. Neben der Puppe lag ein weiterer Mantel oder eine Pelzjacke und auf der anderen Seite, geometrisch aufgefächert, ein Bündel Nerze oder schwarzer Persianerfelle. Wohlgewählt das gedämpfte, ins Goldene spielende Licht. Und stets ein großer Strauß frischer Blumen, die dem Schaufenster etwas Privates, Einladendes geben sollten. Tatsächlich leuchtete das Geschäft in der Nacht und zog die wenigen Passanten auf dem Eppendorfer Weg an. Die kopflose Puppe mit dem angedeuteten schwarzen Samthals war zeitlos und blieb über Jahrzehnte, bis das Geschäft verkauft wurde.
Im Schaufenster Levermanns hingegen konnte man den Sittenwandel verfolgen und datieren, die stilisierten Kunststoffpuppen der Sechzigerjahre lockten in den frühen Achtzigerjahren mit naturalistischen Echthaar-Perücken, schwungvollen Wimpern und zeigten unter halb geöffneten Nerzmänteln schwarz bestrumpfte Beine mit Strapsen. Zwei Jahrzehnte später schmeichelten die Mäntel abstrakten Stahlgestellen.
Im obersten Stock lag die Werkstatt, zwei über Eck gehende große, lichte Räume, hinter deren Fensterreihen der Himmel nahe schien. An der Fensterfront verlief ein durchgehender, fünfundzwanzig Meter langer Holztisch, Esche poliert, an dem neun Kürschner, zwei Kürschnerinnen und sechs Lehrlinge standen oder auf hohen Holzböcken saßen und arbeiteten, ein ruhiges Tun, Felle nach Farbe und Rauche sortieren, in feine Streifen schneiden, die millimeterweise verschoben und ausgelassen wurden, wie es fachgerecht heißt.
Die Kürschnerei zählte im mittelalterlichen Florenz wegen ihres kostbaren Materials, also der Hermelin-, Nerz-, Fuchs- und Biberfelle, zu den sieben Höheren Künsten. Kürschner waren hoch angesehen und in der Stadt wohlgelitten, während die Gerber abgeschieden am Rande der Dörfer und Städte leben mussten, zu nahe waren sie mit ihrer Tätigkeit dem Tod und dem Gestank.
Die weißen Kittel, die säuberlich geschnittenen Schablonen, die Schnittmuster, die geknickten Leder- und Stoffscheren, die silbernen Markier-Rädchen, die hellen, nach Holz riechenden Polarfuchsfelle, die, hauchte man darüber, sich vom reinen Weiß ins Hellgrauweiß abschatteten, all das Werkzeug und Material hatte mich lange nicht an den Tod und das Leid der Tiere denken lassen. Da war eine Ferne, wie sie ähnlich die Träger der Pelzmäntel, der Ledertaschen oder der Schuhe fraglos begleitet. Ich war nie mit der Tötung der Tiere oder mit dem Abziehen ihrer Felle in Berührung gekommen. Das Gewerk der Zurichtung habe ich nur einmal anlässlich eines Besuchs in einer Gerberei gesehen. Die räumliche Form des Lebens war in eine Fläche verwandelt worden, die nur noch von fern an das Tier erinnerte.
Die Felle aus der Gerberei rochen nach dem Holz der Sägespäne, mit denen sie geläutert wurden, oder nach einem unbestimmten orientalischen Gewürz. Genaue Berechnungen nach Vorgabe der Schnittmuster für die Länge und Breite der Mantelteile oder Capes, Jacken oder Stolen waren notwendig. Nerzfelle mussten, um auf die Länge eines Mantels zu kommen, in Streifen geschnitten und wieder zusammengenäht werden. Eine Arbeit, die, waren die Streifen nur 0,5 Zentimeter breit, eine ruhige Hand und äußerste Präzision erforderte.
Hinter den Kürschnern an der Werkbank standen in einer Reihe die zehn leise surrenden elektrischen Pelznähmaschinen. Eine Arbeit, die keine Gespräche zuließ. Die Näherinnen saßen, der Rangfolge ihres Könnens entsprechend, hintereinander, die beste, eine etwas geziert Gehende und Sprechende mit hochgeschnallten Brüsten, saß in der Nähe von Meister Walther Kruse. Hinter ihr kamen all die anderen bis zu der jeweils Jüngsten, die eben ihre Ausbildung abgeschlossen hatte. Das Nähen erforderte beides, Fingerspitzengefühl und Fingerfertigkeit. Die Nähte durften so wenig wie möglich vom Leder erfassen und mussten dennoch haltbar sein. Haare durften nicht eingenäht, die Fellkanten nicht zu hoch sein und die festgelegte Zeit pro Stück nicht überschritten werden. Auch bei dieser mechanischen Arbeit zeigte sich Können. Von den Kürschnern fehlerhaft berechnete Fellstreifen vermochte eine geschickte Näherin ein wenig auszugleichen. Vor allem durften sich in den fertigen Nerz- oder Nutriamänteln die Nahtstellen im Fell nicht abzeichnen. Das unterschied die gelungene Arbeit von Pfusch.
So anders war der von sachten Bewegungen und verhaltenen Gesprächen erfüllte Raum, in dem an jeweils sechs langen Tischen je vier Handnäherinnen saßen. Am Kopfende stand der Tisch der Directrice und ihrer Assistentin. Hier wurden die Seiden aus Italien, Persien und China nach den Schnittmustern zugeschnitten. Dahinter stand der Tisch, an dem die teuren Pelzmäntel wie Nerz, Nutria, Feh und Biber von meist älteren, schon langjährig in der Firma arbeitenden Frauen gefüttert wurden, wie es sprechend hieß. Sie verstärkten das Leder der Mantelteile mit Vliesstoff, an den Rändern mit einem fest gewebten Stoffstreifen und brachten die Schulterpolster an. Sodann wurden die Seidenfutter eingenäht. Hinter diesem Tisch kam ein zweiter, an dem die weniger wertvollen Mäntel gefüttert wurden, die verschiedenen Persianer-, Fuchs-, Wallabymäntel, und die hinteren Tische waren den aus Persianerstücken zusammengesetzten Mänteln sowie den Reparaturen vorbehalten.
Die Handnäherinnen arbeiteten wie alle anderen auf Akkord, allerdings war der damals noch gemach. Die vorgegebene Stückzeit war, wie die Stempeluhr, eine Neuerung in der Firma Levermann. Im hellen Raum der Handnäherinnen herrschte zumeist die Ruhe einer nachmittäglichen Hausarbeit, hin und wieder das Rascheln der Seide, das Zischen eines der wuchtigen Bügeleisen.
Der Weg durch diesen Raum zu den weiter hinten gelegenen Waschräumen und Toiletten war begleitet von den leisen Gesprächen der Näherinnen und diesem unbestimmbaren Duft aller nur denkbaren Parfums, der sich süßlich schwer auf das Hirn legte. Hin und wieder, eher selten, blickte eine der Näherinnen von ihrer Arbeit auf. Die Erinnerung bringt mit dem Raum sogleich diese junge Frau vor Augen, die unter ihnen saß, vielleicht drei oder vier Jahre älter als ich, also schier unerreichbar fern, mit ihrem mir zugewandten Lächeln jedoch so nah. Das Erscheinen dieser blond strahlenden Näherin wurde von den Gesellen mit Bemerkungen kommentiert. Vor allem von Breitkamp, meinem Lehrgesellen, einem ehemaligen Marineleutnant, der sie so gern einmal eingeladen hätte, was sie freundlich ablehnte.
Die Lehrlinge wurden für drei oder mehr Monate einem Meister zugeteilt oder einem Lehrgesellen, der kurz vor der Meisterprüfung stand oder sich darauf vorbereitete. Keiner von ihnen hatte eine pädagogische Ausbildung. Breitkamp war, wenn er nicht von seinen Liebschaften sprach – er brauchte Zuhörer –, ein umgänglicher, gut aussehender, witziger, sich mehrmals am Tag das Haar kämmender Mann Anfang dreißig. Er prüfte seinen Kamm, zählte die darin hängenden Haare, schüttelte den Kopf, sagte: Bitte keine Glatze. Er erzählte von seinen norwegischen Freundinnen, die er in Narvik, Stavanger und Bergen gehabt hatte, und von dem vor zehn Jahren zu Ende gegangenen Seekrieg, von U-Booten, Torpedobooten und dem Untergang seines Schiffs, eines Transporters. Der war trotz des heftigen Abwehrfeuers der Flak von englischen Flugzeugen angegriffen und mittschiffs von einem abgeworfenen Torpedo getroffen worden. In wenigen Minuten war der mit Eisenerz aus Narvik beladene Frachter gesunken. Breitkamp hatte das Glück, gerade auf der Brücke Dienst zu tun, sprang in das sieben Grad kalte Wasser und wurde nach wenigen Minuten von einem begleitenden Torpedoboot aus entdeckt und von der Besatzung geborgen. Von dem Schock war ihm der Tick geblieben, dass er, war er aufgeregt, einen Rachenlaut ausstieß, als müsse er Wasser ausspucken.
Das waren die Erzählungen der Überlebenden.
Breitkamp zeigte mir, wie Persianerfelle mit einer Zackennaht ineinandergeschnitten wurden, damit sie die erforderliche Mantellänge bekamen, erklärte die Formeln für die Berechnung. Er nahm sich Zeit für seine Erklärungen, schob mir allerdings auch Arbeiten zu, die ihm erlaubten, die eigene Stückabrechnung zu verbessern.
Einmal kam eine Näherin, stempelte ihre Karte ab, ging zu ihm und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Ein Lachen, sie gab ihm einen leichten Stoß vor die Brust und ging zurück zu all den anderen Näherinnen. Gott sei Dank, sagte er, sie hat ihre Tage bekommen. Das war, solange ich mit ihm arbeitete, seine Hauptsorge, dass eine seiner Freundinnen schwanger werden könnte. Geschafft, sagte er dann. Und manchmal schwieg er und schüttelte nur den Kopf.
Sein Reden war jedes Mal ein Stich, und ich versuchte das Gespräch in andere Richtungen zu lenken, auf Stavanger, auf die Vorpostenboote und den Schiffsuntergang, auf die junge Frau, die Norwegerin, wie er sie nannte, die nach der Kapitulation der Wehrmacht in Stavanger von ihm schwanger zurückgeblieben war. Er habe sie zurücklassen müssen, betonte er. Die Wehrmacht hatte kapituliert, und er kam drei Monate lang in englische Kriegsgefangenschaft. Zugleich begleitete ihn die Furcht, die Frau könne eines Tages mit dem Kind an der Hand vor seinem Reihenhaus in Rahlstedt stehen.
Und Ihre Frau?, fragte ich.
Kann keine Kinder kriegen.
Die Lehrlinge siezten die Gesellen, diese wiederum duzten die Lehrlinge. Drei, höchstens vier Jahre, dann wird die Lust zur Pflicht, sagte Breitkamp. Heirate nicht, war sein Rat.
Ein Filou, sagten die Maschinennäherinnen, von denen er der einen oder anderen auch schon Gutes getan und mir davon erzählt hatte, der die Einzelheiten nicht hören wollte. Nichts von dieser mir noch unbekannten Nähe mit all dem nur Wünschbaren, dem noch Unfasslichen und Geheimnisvollen.
Die Werkstatt Levermanns war durch die Anmietung eines Büros im obersten Stockwerk des gegenüber gelegenen Fölsch-Blocks erweitert worden. In dem hellen, sparsam eingerichteten Raum arbeiteten der Geselle Drechsler, die Kürschnerin Annabell, eine aus dem Banat geflohene Maschinennäherin, und ich. Annabell und Drechsler waren ein Paar. Ich stand als Lehrling zwischen ihnen. Hin und wieder brachte Drechsler, was in der Werkstatt verboten war, einen Plattenspieler mit, legte Jazzplatten auf und erzählte von Charlie Parker, Dizzy Gillespie und Miles Davis, den er mit der Platte Blue Moods gerade für sich entdeckt hatte. Die lichte Werkstatt war erfüllt von einem Rhythmus, einer Melodie, die zu der sorgsamen Arbeit, dem hellen Leder, den Fellen passten. Hier hörte ich den Jazz, der zu Hause, wo es nur Beethoven-, Brahms- und Tschaikowski-Schallplatten gab, verpönt war. Drechsler konnte die Melodien summen und den Rhythmus bestimmter Stücke in bewundernswerter Präzision mit den Zeigefingern und der flachen Hand auf den Tisch trommeln. Seine Platten lieh er nicht aus – ihm sei einmal eine zerkratzt zurückgegeben worden. Spielte er Trompete? Oder Schlagzeug oder Bass oder beides? Sonderbar, dass ich mich daran nicht erinnern kann. Und fragen kann ich nicht mehr. Aber das blieb im Gedächtnis: Dieser junge Mann mit dem dichten hellblonden Haar und den blauen Augen konnte sich regelrecht in Wut reden, über die Wiederbewaffnung, über die alten Nazis in Regierung und Wirtschaft. Als Kind war er mit seiner Mutter aus Braunsberg in Ostpreußen geflüchtet. Sie hatten die Wohnung aufgeräumt und sorgfältig abgeschlossen und waren, die russische Artillerie feuerte schon in die Stadt, mit den Koffern zum Bahnhof gegangen und in einem der letzten überfüllten Züge Richtung Westen, ins Reich, gefahren, mussten aber, weil der Zugverkehr unterbrochen war, umkehren und den Weg mit einem Treck über das zugefrorene Haff nehmen, wurden manchmal von einem Pferdewagen oder einem Militärlaster mitgenommen bis nach Kolberg, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und sind von dort mit einem Fischkutter nach Flensburg gebracht worden. Die Mutter hatte auf dem gesamten Weg den Wäschesack mitgeschleppt. Am Straßenrand lagen die Erfrorenen und die durch Beschuss getöteten Frauen und Kinder.
Aufbrausend und ungeduldig mit mir, dem Lehrling im ersten Jahr, hatte er etwas Einschüchterndes, von dem auch die Maschinennäherin und seine Freundin Annabell betroffen waren. Diese arbeitete in der Hierarchie des Könnens und der Achtung im mittleren Feld der Kürschner, die mit der Herstellung von Persianermänteln beschäftigt waren, wobei es in der Gruppe abermals eine Rangordnung gab: Jene, die auch die in Locke, Farbe und Glanz kompliziert zu verarbeitenden hell- bis weißgrauen Naturpersianer in Mäntel oder Jacken verwandeln durften, standen über denen, die nur die einheitlich schwarz gefärbten und daher leichter zu verarbeitenden Persianerfelle zugeteilt bekamen. Eine besondere Herausforderung hingegen waren die in der Locke flachen, geflammten Breitschwanzpersianer, die eine Fachklasse bearbeitete, zu der Drechsler gehörte.
Aus den anfallenden Fellresten wurden Persianer-Stücke-Mäntel hergestellt, eine Aufgabe der Lehrlinge im dritten Lehrjahr und zwei alter Kürschner. Eine gering geachtete Arbeit, bei der die Ränder ähnlicher Stücke gerade geschnitten, zusammengenäht und dann auf einer Holzplatte aufgezweckt wurden. Die Maschinennäherinnen hassten diese Arbeit, die Lehrlinge und die beiden in der Hierarchie zuunterst stehenden Kürschner auch.
Für das Sortieren der Persianerstücke war ein weiteres Büro im Fölsch-Block angemietet worden, dessen beide Fenster in den Hof des großen Hauses führten. Das Sortieren, das Vergleichen der Fellstücke, die nach Größe, Form der Locke und dem Glanz in verschiedenen Kästen gesammelt wurden, war ein ruhiges Tun, das dem Tagträumen Raum ließ. Das Vergleichen dieser bei näherer Betrachtung so ähnlichen und doch unterschiedlichen Fellstücke hatte etwas von einer meditativen Tätigkeit. Eine bei den Lehrlingen unbeliebte, da einsame Arbeit, die mir allerdings zusagte.
Ich saß und blickte in die gegenüberliegenden Büros, wo Frauen an Schreibmaschinen saßen, telefonierten, schrieben, gut ausgeleuchtet von den Neonröhren und Schreibtischlampen, die jetzt, im November, schon am frühen Nachmittag, wenn die Dunkelheit sich im Innenhof sammelte, angeschaltet waren. Hin und wieder, selten, kamen Männer in die Zimmer, wahrscheinlich leitende Angestellte, deren Räume zum Rathaus und zur Bergstraße hinausgingen. Einmal, abends, sah ich, wie, als ein Mann ins Zimmer kam, eine Frau vom Schreibtisch aufsprang, ihm entgegenstürzte, um den Hals fiel, während er sich mit ihr wie zum Tanz drehte, sie mit dem Rücken gegen die Tür drückte, die beiden sich küssten, wie er die Hand unter ihren Rock schob und wie die wild verknäuelte Bewegung plötzlich erstarrte, sie den Rock wieder herunterzog. Beide standen lauschend da, dann ging er schnell aus dem Zimmer und sie zum Schreibtisch, ließ sich in den Sessel fallen, schüttelte den Kopf, ihr Haar flog nur so hin und her.
Ein andermal saß in einem weiter unten gelegenen Büro eine Frau über den Schreibtisch gebeugt, das Gesicht in den Händen verborgen, ihr Kopf zuckte, dann blickte sie hoch, holte aus der Handtasche ein Taschentuch, einen Spiegel und ein Etui, wischte sich die Augen und begann sich zu schminken, sorgfältig, prüfte mit kleinen Kopfbewegungen sachlich ihre Arbeit im Spiegel. Das waren die seltenen Bilder zu dem Kummer, den Leidenschaften, der Eifersucht, von denen in der Werkstatt erzählt wurde. Das Gewöhnliche war das Telefonieren, Schreibmaschineschreiben, Abheften der Briefe in Ordner.
Die Tage dehnten sich. Und ich träumte vor mich hin. Drechsler kam selten ins Zimmer, und wenn, nicht etwa zur Kontrolle, sondern weil ich etwas für ihn holen oder ausrichten sollte. Auf dem kurzen Weg vom obersten Stock hinunter auf die Straße, die ich überqueren musste, um im gegenüberliegenden Gebäude mit dem Fahrstuhl hinauf zur Werkstatt in den fünften Stock zu fahren, hatte ich, in ganz andere Welten versunken, vergessen, was ich denn bringen oder ausrichten sollte. Kam zurück und hatte etwas anderes gebracht. Drechsler sagte: Himmel Sack, und schlug auf den Tisch. Es war Annabell, die ihn dann beruhigte, vorsichtig, da sich seine Wut auch gegen sie richten konnte. Fünfzehn Jahre war ich alt und stolperte oft, stieß an Tische, Stühle, Tassen fielen zu Boden, Gläser zersplitterten, ich war mit der Länge meiner Arme und Beine noch nicht vertraut. In den letzten Monaten hatte ich überraschend noch ein paar Zentimeter zugelegt.
Das Sortierzimmer, so wurde es in der Firma genannt, hatte den Vorteil, dass ich dort lesen konnte, nur in Maßen allerdings, denn die geleistete Arbeit war an den verschiedenen Kisten ablesbar. Jedenfalls habe ich mich später, im Sommer des zweiten Lehrjahrs, zur Überraschung von Werkmeister Jäckel nochmals freiwillig zum Stückesortieren gemeldet. Ich las die in einem Trödelantiquariat gekauften Bücher über die Polarforscher Fridtjof Nansen und Ernest Shackleton, vor allem die zweibändige Eroberung des Südpols von Roald Amundsen. Das jeweilige Buch konnte ich, falls jemand ins Zimmer kam, unter die Persianerstücke schieben. Die staunenswert akribische Vorbereitung Amundsens auf die Reise zum Südpol, die Mühen und Strapazen der Wanderung über das Eis haben mich – draußen zog der Sommer vorbei – zu seinem Begleiter gemacht. Jahrzehnte später, eingeladen zu einer Lesung in Oslo, war mein Wunsch, dieses Museum zu besuchen, das eine Ausstellung zu Amundsen zeigte, seine Tagebücher, Berechnungen, Pelzjacken. Amundsen, der mit einem Flugzeug 1928 zur Rettung des mit seinem Zeppelin auf einer Eisscholle notgelandeten Generals Nobile aufgebrochen war, kehrte von diesem Flug nicht zurück. Eine Suchexpedition wurde ausgeschickt, vergeblich. Amundsen war und blieb verschwunden. Nach Jahren wurde in Nordnorwegen ein Treibstofftank seines Flugzeugs angeschwemmt. Fünfzig Jahre nach der Lektüre habe ich ihn gesehen, zylindrisch, in Form und Länge einem Kajak ähnlich. Der Tank war wie eine Konservendose an einer Seite ein Stück weit aufgeschnitten, das Metall war hoch- und umgebogen worden. Wahrscheinlich hatte aus dem Metalltank ein Boot gebaut werden sollen.
Eines Tages kam ein junger Mann in mein stilles Zimmer, groß und kräftig, trug, was im Pelzgeschäft nicht gern gesehen wurde, eine abgetragene proletarische Lederjacke. Erik war nur kurz in der Hauptwerkstatt beschäftigt gewesen, hatte Ärger mit dem Werkmeister bekommen und war überraschend dieser den Lehrlingen zugeordneten Beschäftigung zugeteilt worden. Nun saßen wir, Erik und ich, nebeneinander an dem langen Tisch auf hohen Holzböcken – man musste auf die ausgebreiteten Fellstücke von oben blicken können. Die im Hof gestaute Wärme strömte durch die beiden geöffneten Fenster ins Zimmer.
Erik war ein gutes halbes Jahr durch die Vereinigten Staaten gereist und der Erste, dem ich begegnete, der das Land nach dem Krieg besucht hatte. Erzählungen über Amerika, andere, kannte ich von den dort interniert gewesenen deutschen Kriegsgefangenen.
Ich saß im weißen Umhang vor dem Spiegel, und Friseur Mansfeld machte mit der Schere ein paar Leerschnitte in der Luft, erzählte, wie er als Soldat im Afrikakorps 1943 von den Amerikanern in Tunesien gefangen genommen und mit anderen Gefangenen in einem Truppentransporter nach Amerika gebracht worden war. Voll schwärmerischer Bewunderung waren seine Erzählungen, wie er mit dem Schiff in New York ankam, die Lichter der Wolkenkratzer sah, die lange Fahrt in den Süden, die Landschaft, die Berge, die Wüste, und wie sie, während die Menschen in Deutschland der Gefahr der Bomben ausgesetzt waren, sicher, wenn auch hinter Stacheldraht, und gut genährt leben konnten. Sein Staunen sprach aus der Beschreibung der Baumwollhemden, der Kammgarnhosen, der Qualität der Lederschuhe, des reichhaltigen Essens. Er verdiente als Kriegsgefangener in einer Konservendosenfabrik achtzig Cent pro Tag und im Lager etwas hinzu, konnte als Friseur arbeiten, sich im Beruf perfektionieren und lernte, mit der Schere eine Stoppelfrisur zu schneiden. Die trug er mir bei jedem Besuch wieder von Neuem an, was ich jedes Mal wieder ablehnte, um weiter bei meinem unauffälligen Kurzhaarschnitt zu bleiben. Sommer 1946, sagte er, war der amerikanische Traum aus, da wurde er mit anderen Kameraden aus dem Paradies in New Mexico vertrieben und in das zerstörte Hamburg zurückgebracht. Wir hatten Glück, sagte er jedes Mal, die armen Kameraden, die in Sibirien Bäume fällen mussten.
Ganz anders waren Eriks Erzählungen. Nach dem Abschluss seiner Lehre war er wiederholt im Frankfurter US-Konsulat vorstellig geworden, hatte schließlich ein Visum bekommen und war an Bord eines Frachters nach New York gefahren, hatte sich, wie es hieß, rübergearbeitet, als Hilfssteward. Davon zeugten Anekdoten, deren Wahrheitsgehalt durch ihre Detailgenauigkeit Beglaubigung gewann. Dieser junge Mensch musste dem Kapitän regelmäßig eine Tasse Kaffee auf die Brücke bringen. Bei Wellengang schwappte der Kaffee über, und die Tasse war nur noch halb voll. Nachdem Erik jedes Mal angeschnauzt worden war, nahm er fortan einen kräftigen Schluck Kaffee in den Mund und spuckte ihn kurz vor der Tür zur Brücke wieder in die Tasse.
In Amerika war er mit Bus, Eisenbahn und per Anhalter gereist und erzählte von den weiten Feldern, den Wäldern und der Gastfreundschaft auf dem Lande, aber auch vom Leid und der Armut der Menschen in den Städten. Er hatte in New York in einer großen Pelzmanufaktur gearbeitet, wo er, obwohl nicht gelernt, als Maschinennäher angestellt worden war. Zeitungen hatte er ausgetragen, in einer Reinigung Hemden gepresst und in Chicago in einer Fleischfabrik den geschlachteten Rindern die Zungen herausgeschnitten.
Ich fragte viel und war ein begieriger Zuhörer, sodass er, obwohl sechs Jahre älter als ich, mich zu einem Kinobesuch einlud – der Lehrling verdiente 30 DM im Monat. War es Das Fenster zum Hof? Aber die Vorführung war ausverkauft. So gingen wir, eine milde Frühsommernacht, weiter zur Reeperbahn, schlenderten zwischen den Neugierigen und Erlebnishungrigen an den Kneipen, Restaurants vorbei, am Café Keese mit seinem Ball Paradox – Kurt Student, hochdekorierter General der Fallschirmjäger, war der damals noch Empfangschef? –, gingen diesen Boulevard der Lüste entlang. Im Eingang einer großen Bar – kein Bums, kein Striptease, kein Rotlicht, ein Etablissement, das sich als gepflegt auswies – spielte ein Barpianist auf dem Klavier. Wir hörten einen Augenblick den gängigen Melodien zu. Der Pianist stand auf, reckte sich, zündete sich eine Zigarette an. Der Portier, ein geübter Aufreißer und Menschenkenner, hatte Erik beobachtet, wie er dastand und zuhörte, und sagte: Versuchen Sie’s doch mal.
Nach einem kurzen Zögern setzte Erik sich tatsächlich auf den Klavierhocker, griff sehr langsam, kurz innehaltend, in die Tasten, einen Moment dachte ich peinlich berührt, noch kannte ich ihn zu wenig, er wolle den Pianisten parodieren, könne gar nicht spielen, aber nach einem kurzen Lauf, und dann sehr entschieden und konzentriert, spielte er drei Stücke, drei [28]Stücke von Bach. Das ist die Erinnerung: Der Barpianist hielt wie vergessen die brennende Zigarette in den Fingern, Passanten waren stehen geblieben, ein paar Touristen, rotgesichtige Bauern mit Ehefrauen, aus Schleswig-Holstein oder Niedersachsen, Matrosen eines im Hafen liegenden spanischen Zerstörers, zwei, drei Nutten, ein Betrunkener mit schaukelndem Oberkörper, den Kopf nach vorn gebeugt und schwerfällig nickend. Erik spielte in diesem breiten, grell beleuchteten Eingang, umgeben von einer konzentrierten, den Trubel draußen abgrenzenden Stille. Er endete, stand auf, ein kurzes Nicken zu dem Pianisten und den Zuhörern, deren Klatschen er mit der Hand abwinkte.
Komm, sagte er, komm, und so gingen wir weiter in den trunkenen Lärm, in das Neonleuchten der Nacht.
In den knapp zwei Wochen, die wir zusammenarbeiteten, hatte er nicht erwähnt, dass er Klavier spielen konnte, und erst recht nicht, in welch staunenswerter Perfektion. Jetzt erzählte er auf meine Frage, dass er fast jeden Abend spiele. Die Behandlung der Felle sei gut für die Finger und für das Klavierspiel. Und ich dachte, mit diesen Händen hat er geschlachteten Ochsen die Zungen herausgeschnitten.
Nach gründlicher Vorbereitung zur Aufnahme am Konservatorium – in Frankfurt oder Berlin? –, sagte er, sei er nach seinem Vorspiel in der klassischen Abteilung abgelehnt worden. Er hatte sich entschieden, mit seiner Mittleren Reife eine Kürschnerlehre zu machen, um seinen, wie er mit einem inzwischen nahezu ausgestorbenen Wort sagte, Broterwerb zu sichern. Spielen, mit dem Ziel aufzutreten, wollte er weiter, und zwar ganz entschieden – Jazz. Jetzt spiele er hin und wieder in einer Band in Pinneberg, manchmal hier und da in Amateurbands, er müsse sich aber weiter perfektionieren.
Ich hatte ihn in den nächsten Tagen in seiner kleinen, gesondert auf einem Grundstück in Eppendorf stehenden Garage besucht, in der ein Opel Olympia auf Holzpfosten aufgebockt war, die Reifen standen an der Wand, daneben ein paar leere, noch aus englischem Militärbestand stammende Benzinkanister. Das rückwärtige Mauerwerk war, vermutlich aus akustischen Gründen, mit einer Spanplatte abgedeckt, auf die er eine Wolldecke gezweckt hatte. Davor stand das Klavier. Dort spielte er am Abend, oft auch nachts, in einem Geruch von Öl und Benzin.
Ich saß auf einem Kanister und hörte zu, wie er einige Etüden von Chopin spielte, er nannte die Nummern der Stücke, und nach einer kurzen Pause, in der er die Tasten anstarrte, als wollte er sie durch Hypnose eigenständig zum Erklingen bringen, sagte er, in der nächsten Woche werde er in Barmbek mit einer Amateurband auftreten. Das Klavier hatte er stimmen lassen, dennoch, der Klang war nicht gut. Auch diese Verstimmung gehöre, wie er sagte, dazu. Ich fragte ihn, ob er in Amerika gespielt hätte, nein, aber er habe viele Bands in den Clubs gehört.
Ein fremder Klang, schroff, disharmonisch, schlug gegen die Wolldecke, nicht vergleichbar dem Swing, den ich bis dahin gehört hatte. Sommer 1956, der Free Jazz kam, nach Meinung der Fachleute, erst um 1960 auf. Vielleicht wurde ich in dieser Garage Zeuge eines Experiments, das von vielen Musikern zur gleichen Zeit, an verschiedenen Orten betrieben wurde, um schließlich in so herausragenden Musikern wie Ornette Coleman, John Coltrane und anderen seine Ausprägung zu erlangen.
Ich habe Erik und seine Band in Barmbek gehört. Ein guter Swing, mehr nicht. Er saß am Piano, hinzu kamen ein Kornett, Bass, Klarinette, eine dieser zahlreichen Amateurbands, die sich am Wochenende verabredeten und in inniger Versunkenheit miteinander spielten. Ungefähr zwanzig Zuhörer saßen in der Kneipe. Ich war der Einzige, der nicht rauchte und kein Bier trank.
Ich erzählte ihm, dass ich als Schüler im Amerikahaus Hemingways The Old Man and the Sea mithilfe eines Wörterbuchs gelesen hätte. Gut drei Wochen dauerte es, bis ich mich durch den kurzen Roman gekämpft hatte, ganz auf die Handlung konzentriert, die verlässliche Freundschaft zwischen dem Jungen und dem alten Fischer, wie der Junge sich um den Alten sorgt, ihm Essen und ein Bier bringt, den Korb mit den Seilen und der Harpune zum Boot trägt, Abschied von dem Alten nimmt, der hinausrudert, sich von der Strömung weit treiben lässt, bis auf dem offenen Meer ein Fisch anbeißt, der Kampf mit dem mächtigen Tier, zwei Tage und zwei Nächte zieht der Fisch das Boot an der Angelschnur hinter sich her, die aufgerissenen Hände des Alten, der die Angelschnur über den Rücken gelegt