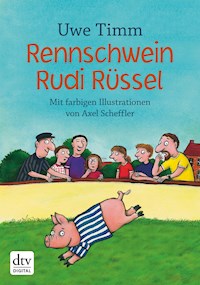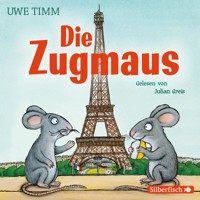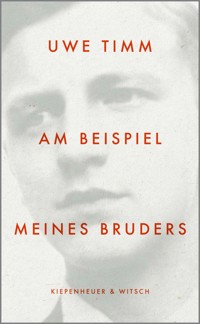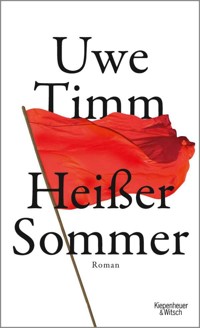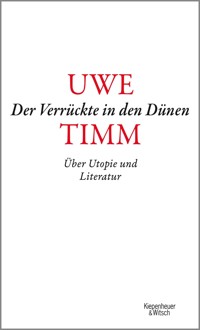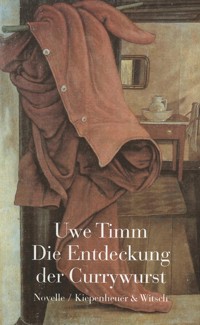
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie schmeckt die Erinnerung? Und wie kommt es zu großen und kleinen Entdeckungen? Der Erzähler besucht in einem Altersheim eine Frau, von der er glaubt, sie habe die Currywurst entdeckt. Lena Brücker, weit über achtzig, rückt aber auf seine Fragen nicht so schnell mit der Antwort heraus. Vielmehr erzählt sie eine ganz andere Geschichte, die zunächst recht alltäglich beginnt, sich dann aber als eine unerhörte Begebenheit erweist. Im April 1945, kurz vor Kriegsende, hat sie einen Marinesoldaten in ihrer Wohnung versteckt und mit ihm ein Liebesverhältnis angefangen. Dann aber kapituliert Hamburg. Die vierzigjährige Lena Brücker will den jungen Deserteur noch nicht heim zu Frau und Kind lassen. Sie verschweigt ihm, daß der Krieg zu Ende ist. So sitzt er in der Wohnung fest und wird mit Ersatzgenüssen umsorgt, Geschichten und Gerichten: Wildgemüse, Eichelkaffee und falscher Krebssuppe. Bis er eines Tages den Geschmackssinn verliert. Eine Novelle im ursprünglichen Sinn des Wortes, nämlich als »kleine Neuigkeit«. In ihr wird erzählt, wie man sich in dunklen Zeiten ein Licht aufsteckt, am Leben hält, sich ein wenig Lust sichert, wenn nötig auch mit der Lüge. So wird das Erzählen, ohne jede theoretische Reflexion, thematisiert: wie diese labberigen Wurstscheiben durch ein Gewürz eine märchenhafte Fremde bekommen und damit das Wunderbare ins Alltägliche bringen. Die Frage nach der Entdeckung der Currywurst führt schließlich – wie in einem Kreuzworträtsel – am Ende doch noch zu einem verborgenen Sinn. Am 04. September 2024 feiert die Currywurst ihr 75. Jubiläum. Kein anderer Autor hat ihr ein so literarisches Denkmal gesetzt wie Uwe Timm mit »Die Entdeckung der Currywurst«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Uwe Timm
Die Entdeckung der Currywurst
Novelle
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Uwe Timm
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Uwe Timm
Uwe Timm, geboren 1940, freier Schriftsteller seit 1971. Sein literarisches Werk erscheint im Verlag Kiepenheuer & Witsch, zuletzt »Am Beispiel meines Bruders«, 2003, mittlerweile in 17 Sprachen übersetzt, »Der Freund und der Fremde«, 2005, »Halbschatten«, 2008, »Am Beispiel eines Lebens«, 2010, »Freitisch«, 2011 und »Vogelweide«, 2013.
Uwe Timm wurde 2006 mit dem Premio Napoli sowie dem Premio Mondello ausgezeichnet, erhielt 2009 den Heinrich-Böll-Preis und 2012 die Carl-Zuckmayer-Medaille.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Wie schmeckt die Erinnerung? Und wie kommt es zu großen und kleinen Entdeckungen?
Der Erzähler besucht in einem Altersheim eine Frau, von der er glaubt, sie habe die Currywurst entdeckt. Lena Brücker, weit über achtzig, rückt aber auf seine Fragen nicht so schnell mit der Antwort heraus. Vielmehr erzählt sie eine ganz andere Geschichte, die zunächst recht alltäglich beginnt, sich dann aber als eine unerhörte Begebenheit erweist.
Im April 1945, kurz vor Kriegsende, hat sie einen Marinesoldaten in ihrer Wohnung versteckt und mit ihm ein Liebesverhältnis angefangen. Dann aber kapituliert Hamburg. Die vierzigjährige Lena Brücker will den jungen Deserteur noch nicht heim zu Frau und Kind lassen. Sie verschweigt ihm, daß der Krieg zu Ende ist. So sitzt er in der Wohnung fest und wird mit Ersatzgenüssen umsorgt, mit Geschichten und Gerichten: Wildgemüse, Eichelkaffee und falscher Krebssuppe. Bis er eines Tages den Geschmackssinn verliert.
Eine Novelle im ursprünglichen Sinn des Wortes, nämlich als »kleine Neuigkeit«. In ihr wird erzählt, wie man sich in dunklen Zeiten ein Licht aufsteckt, am Leben hält, sich ein wenig Lust sichert, wenn nötig auch mit der Lüge. So wird das Erzählen, ohne jede theoretische Reflexion, thematisiert: wie diese labberigen Wurstscheiben durch ein Gewürz eine märchenhafte Fremde bekommen und damit das Wunderbare ins Alltägliche bringen. Die Frage nach der Entdeckung der Currywurst führt schließlich – wie in einem Kreuzworträtsel – am Ende doch noch zu einem verborgenen Sinn.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 1993, 1995, 2000, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
eBook © 2013, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln
Covermotiv: © Albert Aereboe, Die rote Jacke, 1924
ISBN978-3-462-30761-0
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
Für
Hans Timm
(1899–1958)
1.
Vor gut zwölf Jahren habe ich zum letzten Mal eine Currywurst an der Bude von Frau Brücker gegessen. Die Imbißbude stand auf dem Großneumarkt – ein Platz im Hafenviertel: windig, schmutzig, kopfsteingepflastert. Ein paar borstige Bäume stehen auf dem Platz, ein Pissoir und drei Verkaufsbuden, an denen sich die Penner treffen und aus Plastikkanistern algerischen Rotwein trinken. Im Westen graugrün die verglaste Fassade einer Versicherungsgesellschaft und dahinter die Michaeliskirche, deren Turm nachmittags einen Schatten auf den Platz wirft. Das Viertel war während des Krieges durch Bomben stark zerstört worden. Nur einige Straßen blieben verschont, und in einer, der Brüderstraße, wohnte eine Tante von mir, die ich als Kind oft besuchte, allerdings heimlich. Mein Vater hatte es mir verboten. Klein-Moskau wurde die Gegend genannt, und der Kiez war nicht weit.
Später, wenn ich auf Besuch nach Hamburg kam, bin ich jedesmal in dieses Viertel gefahren, durch die Straßen gegangen, vorbei an dem Haus meiner Tante, die schon vor Jahren gestorben war, um schließlich – und das war der eigentliche Grund – an der Imbißbude von Frau Brücker eine Currywurst zu essen.
Hallo, sagte Frau Brücker, als sei ich erst gestern dagewesen. Einmal wie immer?
Sie hantierte an einer großen gußeisernen Pfanne.
Hin und wieder drückte eine Bö den Sprühregen unter das schmale Vordach: eine Feldplane, graugrün gesprenkelt, aber derartig löchrig, daß sie nochmals mit einer Plastikbahn abgedeckt worden war.
Hier geht nix mehr, sagte Frau Brücker, während sie das Sieb mit den Pommes frites aus dem siedenden Öl nahm, und sie erzählte, wer inzwischen alles aus dem Viertel weggezogen und wer gestorben sei. Namen, die mir nichts sagten, hatten Schlaganfälle, Gürtelrosen, Alterszucker bekommen oder lagen jetzt auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Frau Brücker wohnte noch immer in demselben Haus, in dem früher auch meine Tante gewohnt hatte.
Da! Sie streckte mir die Hände entgegen, drehte sie langsam um. Die Fingergelenke waren dick verknotet. Is die Gicht. Die Augen wollen auch nicht mehr. Nächstes Jahr, sagte sie, wie jedes Jahr, geb ich den Stand auf, endgültig. Sie nahm die Holzzange und griff damit eine der selbst eingelegten Gurken aus dem Glas. Die haste schon als Kind gern gemocht. Die Gurke bekam ich jedesmal gratis. Wie hältste das nur in München aus?
Imbißstände gibts dort auch.
Darauf wartete sie. Denn dann, und das gehörte mit zu unserem Ritual, sagte sie: Jaa, aber gibts da auch Currywurst?
Nein, jedenfalls keine gute.
Siehste, sagte sie, schüttete etwas Curry in die heiße Pfanne, schnitt dann mit dem Messer eine Kalbswurst in Scheiben hinein, sagte Weißwurst, grausam, und dann noch süßer Senf. Das veddelt einen doch. Sie schüttelte sich demonstrativ: Brrr, klackste Ketchup in die Pfanne, rührte, gab noch etwas schwarzen Pfeffer darüber und schob dann die Wurstscheiben auf den gefältelten Pappteller. Das is reell. Hat was mitm Wind zu tun. Glaub mir. Scharfer Wind braucht scharfe Sachen.
Ihr Schnellimbiß stand wirklich an einer windigen Ecke. Die Plastikbahne war dort, wo sie am Stand festgezurrt war, eingerissen, und hin und wieder, bei stärkeren Böen, kippte eine der großen Plastik-Eistüten um. Das waren Reklametische, auf deren abgeplattetem Eis man die Frikadellen und, wie gesagt, diese ganz einmalige Currywurst essen konnte.
Ich mach die Bude dicht, endgültig.
Das sagte sie jedesmal, und ich war sicher, sie im nächsten Jahr wiederzusehen. Aber in dem darauffolgenden Jahr war ihr Stand verschwunden.
Daraufhin bin ich nicht mehr in das Viertel gegangen, habe kaum noch an Frau Brücker gedacht, nur gelegentlich an einem Imbißstand in Berlin, Kassel oder sonstwo, und dann natürlich immer, wenn es unter Kennern zu einem Streit über den Entstehungsort und das Entstehungsdatum der Currywurst kam. Die meisten, nein, fast alle reklamierten dafür das Berlin der späten fünfziger Jahre. Ich brachte dann immer Hamburg, Frau Brücker und ein früheres Datum ins Gespräch.
Die meisten bezweifelten, daß die Currywurst erfunden worden ist. Und dann noch von einer bestimmten Person? Ist das nicht wie mit Mythen, Märchen, Wandersagen, den Legenden, an denen nicht nur einer, sondern viele gearbeitet haben? Gibt es den Entdecker der Frikadelle? Sind solche Speisen nicht kollektive Leistungen? Speisen, die sich langsam herausbilden, nach der Logik ihrer materiellen Bedingungen, so wie es beispielsweise bei der Frikadelle gewesen sein mag: Man hatte Brotreste und nur wenig Fleisch, wollte aber den Magen füllen, da bot sich der Griff zu beiden an und war noch dazu voller Lust, man mußte das Fleisch und das Brot ja zusammenmanschen. Viele werden es getan haben, gleichzeitig, an verschiedenen Orten, und die unterschiedlichen Namen bezeugen es ja auch: Fleischbengelchen, Boulette, Fleischpflanzerl, Hasenohr, Fleischplätzchen.
Schon möglich, sagte ich, aber bei der Currywurst ist es anders, schon der Name verrät es, er verbindet das Fernste mit dem Nächsten, den Curry mit der Wurst. Und diese Verbindung, die einer Entdeckung gleichkam, stammt von Frau Brücker und wurde irgendwann Mitte der vierziger Jahre gemacht.
Das ist meine Erinnerung: Ich sitze in der Küche meiner Tante, in der Brüderstraße, und in dieser dunklen Küche, deren Wände bis zur Lamperie mit einem elfenbeinfarbenen Lack gestrichen sind, sitzt auch Frau Brücker, die im Haus ganz oben, unter dem Dach, wohnt. Sie erzählt von den Schwarzmarkthändlern, Schauerleuten, Seeleuten, den kleinen und großen Ganoven, den Nutten und Zuhältern, die zu ihrem Imbißstand kommen. Was gab es da für Geschichten. Nichts, was es nicht gab. Frau Brücker behauptete, das läge an ihrer Currywurst, die löse die Zunge, die schärfe den Blick.
So hatte ich es in Erinnerung und begann nachzuforschen. Ich befragte Verwandte und Bekannte. Frau Brücker? An die konnten sich einige noch gut erinnern. Auch an den Imbißstand. Aber ob sie die Currywurst erfunden habe? Und wie? Das konnte mir niemand sagen.
Auch meine Mutter, die sonst alles mögliche und das bis ins kleinste Detail im Gedächtnis hatte, wußte nichts von der Erfindung der Currywurst. Mit Eichelkaffee habe Frau Brücker lange experimentiert, damals gabs ja nichts. Eichelkaffee habe sie, als sie ihre Imbißbude nach dem Krieg eröffnete, ausgeschenkt. Meine Mutter konnte mir sogar noch das Rezept nennen: Man sammelt Eicheln, trocknet sie in der Backröhre, entfernt die Fruchtschale, zerkleinert und röstet die Fruchtkerne sodann. Danach wird noch die übliche Kaffee-Ersatz-Mischung zugesetzt. Der Kaffee war etwas herb im Geschmack. Wer den Kaffee über einen längeren Zeitraum trank, verlor, behauptete meine Mutter, langsam den Geschmack. Der Eichelkaffee hat die Zunge regelrecht gegerbt. So konnten Eichelkaffeetrinker in dem Hungerwinter 47 sogar Sägespäne in das Brot einbacken, und es mundete ihnen wie ein Brot aus bestem Weizenmehl.
Und dann gab es da noch die Geschichte mit ihrem Mann. Frau Brücker war verheiratet? Ja. Sie hat ihn eines Tages vor die Tür gesetzt.
Warum?
Das konnte meine Mutter mir nicht sagen.
Am nächsten Morgen fuhr ich zur Brüderstraße. Das Haus war inzwischen renoviert worden. Der Name von Frau Brücker stand – was ich erwartet hatte – nicht mehr am Klingelbrett. Die ausgetretenen hölzernen Treppenstufen waren durch neue, mit Messingstreifen beschlagene, ersetzt, das Licht im Treppenhaus war hell und ließ mir Zeit, die Treppen bis oben hochzusteigen. Früher leuchtete es nur 36 Stufen lang. Als Kinder liefen wir um die Wette gegen das Licht die Treppe hoch, bis zur obersten Etage, wo Frau Brücker wohnte.
Ich ging durch die Straßen des Viertels, schmale baumlose Straßen. Hier wohnten früher Hafen- und Werftarbeiter. Inzwischen waren die Häuser renoviert und die Wohnungen – die City ist nicht weit – luxuriös ausgestattet worden. In den früheren Milch-, Kurzwaren- und Kolonialwarenläden hatten sich Boutiquen, Coiffeurs und Kunstgalerien eingerichtet.
Nur das kleine Papierwarengeschäft von Herrn Zwerg gab es noch. In dem schmalen Schaufenster stand inmitten von angestaubten Zigarren-, Zigarillo- und Stumpenkisten ein Mann mit Tropenhelm, in der Hand hielt er eine lange Pfeife.
Ich fragte Herrn Zwerg, ob Frau Brücker noch lebe, und wenn, wo.
Was wollen Sie denn, fragte er mit geballtem Mißtrauen. Der Laden ist schon vermietet.
Ich erzählte ihm, als Beweis dafür, daß ich ihn von früher her kenne, wie er einmal, es muß 1948 gewesen sein, auf einen Baum gestiegen sei; der einzige Baum hier in der Gegend, der nicht in den Bombennächten abgebrannt oder später nach dem Krieg zu Brennholz zersägt worden war. Es war eine Ulme. Auf die war eine Katze vor einem Hund geflüchtet. Sie war hoch und immer höher gestiegen, bis sie nicht mehr zurückklettern konnte. Eine Nacht hatte sie im Baum gesessen, auch den folgenden Vormittag noch, dann war Herr Zwerg, der bei den Sturmpionieren gedient hatte, unter den Augen vieler Neugieriger dem Tier nachgestiegen. Die Katze war aber vor ihm höher und noch höher in die Baumkrone geflüchtet, und plötzlich saß auch Herr Zwerg hoch oben im Baum und konnte nicht mehr heruntersteigen. Die Feuerwehr mußte kommen und holte mit einer Leiter beide, Herrn Zwerg und die Katze, aus dem Baum. Meiner Erzählung hatte er schweigend zugehört. Er drehte sich um, nahm sein linkes Auge heraus und putzte es mit einem Taschentuch. Das waren Zeiten, sagte er. Er setzte sich das Auge wieder ein und schnupfte sich die Nase aus. Ja, sagte er schließlich, ich war überrascht, als ich so weit oben saß, konnte von oben die Distanz nicht recht abschätzen.
Er war von den alten Bewohnern der letzte in dem Haus. Vor zwei Monaten hatte ihm der neue Hausbesitzer eine Mieterhöhung angekündigt. Die war nicht mehr bezahlbar. Würd ja noch weitermachen, auch wenn ich nächstes Jahr achtzig werd. Kommt man so ja unter die Leute. Rente? Schon. Verhungern kannste nich davon, aber leben auch nich. Jetzt kommt hier ne Vinothek rein. Dachte zuerst, is so was wie n Musikgeschäft. Frau Brücker? Nee, is schon lange weg. Die is bestimmt schon nicht mehr.
Ich habe sie dann doch noch getroffen. Sie saß am Fenster und strickte. Die Sonne schien abgemildert durch die Stores. Es roch nach Öl, Bohnerwachs und Alter. Unten im Empfang saßen rechts und links an den Korridorwänden viele alte Frauen und ein paar alte Männer, Filzhausschuhe an den Füßen, orthopädische Manschetten an den Händen, und starrten mich an, als hätten sie seit Tagen auf mein Kommen gewartet. 243 hatte mir der Pförtner als Zimmernummer gesagt. Ich war zum Einwohnermeldeamt gegangen, dort hatte man mir ihre Adresse gegeben, ein städtisches Altersheim in Harburg.
Ich habe sie nicht wiedererkannt. Ihr Haar war, schon als ich sie zuletzt gesehen hatte, grau, aber jetzt war es dünn geworden, ihre Nase schien gewachsen zu sein, auch das Kinn. Das früher leuchtende Blau ihrer Augen war milchig. Allerdings waren ihre Fingergelenke nicht mehr geschwollen.
Sie behauptete, sich deutlich an mich erinnern zu können. Kamst als Junge auf Besuch, nich, und hast bei der Hilde iner Küche gesessen. Später warste manchmal am Imbißstand. Und dann bat sie mich, mein Gesicht anfassen zu dürfen. Sie legte das Strickzeug aus den Händen. Ich spürte ihre Hände, ein flüchtig tastendes Suchen. Zarte, weiche Handflächen. Die Gicht is weg, dafür kann ich nix mehr sehen. Gibt eben so was wie n allmächtigen Ausgleich. Hast ja keinen Bart mehr, auch das Haar nich mehr so lang. Sie blickte hoch und in meine Richtung, aber doch ein wenig an mir vorbei, als stünde hinter mir ein anderer. Neulich war einer da, sagte sie, der wollte mir ne Zeitschrift andrehn. Ich kauf nix.
Sobald ich sprach, korrigierte sie den Blick und sah mir manchmal in die Augen. Ich wollte nur etwas fragen. Ob ich das richtig in Erinnerung hätte, dass sie kurz nach dem Krieg die Currywurst erfunden habe.
Die Currywurst? Nee, sagte sie, ich hab nur nen Imbißstand gehabt.
Einen Moment lang dachte ich, es wäre besser gewesen, sie gar nicht besucht und gefragt zu haben. Ich hätte dann weiter eine Geschichte im Kopf gehabt, die eben das verband, einen Geschmack und meine Kindheit. Jetzt, nach diesem Besuch, konnte ich mir genausogut irgend etwas ausdenken.
Sie lachte, als könne sie mir meine Ratlosigkeit, ja meine Enttäuschung, die ich nicht verbergen mußte, ansehen.
Doch, sagte sie, stimmt, will mir hier aber keiner glauben. Die haben nur gelacht, als ich das erzählte. Haben gesagt, ich spinne. Jetzt geh ich nur noch selten runter. Ja, sagte sie, ich hab die Currywurst entdeckt.
Und wie?
Is ne lange Geschichte, sagte sie. Mußte schon n bißchen Zeit haben.
Hab ich.
Vielleicht, sagte sie, kannste nächstes Mal n Stück Torte mitbringen. Ich mach uns n Kaffee.
Siebenmal fuhr ich nach Harburg, sieben Nachmittage der Geruch nach Bohnerwachs, Lysol und altem Talg, siebenmal half ich ihr, die sich langsam in den Abend ziehenden Nachmittage zu verkürzen. Sie duzte mich. Ich siezte sie, aus alter Gewohnheit.
Man wartet ja auf nix, sagte sie, und dann nix mehr sehen. Siebenmal Torte, siebenmal schwere süßmassive Keile: Prinzregenten, Sacher, Mandarinensahne, Käsesahne, siebenmal brachte ein freundlicher Zivildienstleistender namens Hugo rosafarbene Pillen gegen zu hohen Blutdruck, siebenmal übte ich mich in Geduld, sah sie stricken, schnell und gleichmäßig klapperten die Nadeln. Das Vorderteil eines Pullovers für ihren Urenkel entstand vor meinen Augen, ein kleines Strickkunstwerk, eine Wolllandschaft, und hätte mir jemand erzählt, das sei das Werk einer Blinden, ich hätte es nicht geglaubt. Zuweilen hatte ich den Verdacht, sie sei gar nicht blind, aber dann tastete sie sich wieder an die Stricknadeln im Pullover heran und erzählte weiter, zuweilen unterbrochen, wenn sie nachdenklich die Maschen zählte, den Rand befühlte, nach dem anderen Faden tastete – sie mußte ja mit zwei, manchmal sogar mit mehr Fäden arbeiten –, die Nadel langsam, aber zielgenau in die Maschen einführte, in sich versunken und doch über mich hinwegsah, um sodann ohne jede Hast, aber auch ohne zu stocken die Strickarbeit wiederaufzunehmen, erzählte von notwendigen und zufälligen Ereignissen, wer und was alles eine Rolle gespielt hatte bei der Entdeckung der Currywurst: ein Bootsmann der Marine, ein silbernes Reiterabzeichen, zweihundert Fehfelle, zwölf Festmeter Holz, eine whiskytrinkende Wurstfabrikantin, ein englischer Intendanturrat und eine englische rotblonde Schönheit, drei Ketchupflaschen, Chloroform, mein Vater, ein Lachtraum und vieles mehr. Das alles erzählte sie stückchenweise, das Ende hinausschiebend, in kühnen Vor- und Rückgriffen, so daß ich hier auswählen, begradigen, verknüpfen und kürzen muß. Ich lasse die Geschichte am 29. April 1945, an einem Sonntag beginnen. Das Wetter in Hamburg: überwiegend stark bewölkt, trocken. Temperatur zwischen 1,9 und 8,9 Grad.
2.00: Hitlers Trauung mit Eva Braun. Trauzeugen sind Bormann und Goebbels.
3.30: Hitler diktiert sein politisches Testament. Großadmiral Dönitz soll seine Nachfolge als Staatsoberhaupt und Oberbefehlshaber antreten.
5.30: Die Engländer gehen bei Artlenburg über die Elbe.
Hamburg soll als Festung bis zum letzten Mann verteidigt werden. Barrikaden werden gebaut, der Volkssturm wird aufgerufen, der Heldenklau geht durch die Krankenhäuser, das letzte, das allerletzte, das allerallerletzte Aufgebot wird an die Front geworfen, so auch der Bootsmann Bremer, der in Oslo im Stab des Admirals die Seekartenkammer geleitet hatte. Dort war er seit Frühjahr 44 so gut wie unabkömmlich gewesen, bis er Heimaturlaub bekam und auch gefahren war, nach Braunschweig. Er hatte seine Frau besucht und seinen knapp einjährigen Sohn zum ersten Mal gesehen und sich überzeugen können, daß er zahnte und Papa sagen konnte. Dann hatte er sich wieder auf die Rückreise zu dem Seekartenmagazin gemacht, war in einem überfüllten Personenzug bis Hamburg gekommen, von dort mit einem Militärlaster nach Plön gefahren, am nächsten Tag von einem Pferdefuhrwerk nach Kiel mitgenommen worden, von wo aus er sich nach Oslo einzuschiffen gedachte. In Kiel war er aber zu einer Panzerjagd-Einheit abkommandiert worden und nach einer dreitägigen Ausbildung an der Panzerfaust nach Hamburg befohlen worden, wo er sich bei seiner neuen Einheit melden mußte, die im Endkampf in der Lüneburger Heide eingesetzt werden sollte.
Gegen Mittag war er in Hamburg angekommen, hatte etwas von seiner Marschverpflegung, zwei Scheiben Kommißbrot und eine kleine Dose Leberwurst, gegessen und war durch die Stadt gegangen. Er kannte Hamburg von früheren Besuchen, konnte die Straßen aber nicht wiedererkennen. Einige Fassaden waren stehengeblieben, dahinter die borstig ausgebrannte Turmruine der Katharinenkirche. Kalt war es. Eine von Nordwesten herantreibende Wolke schob sich der Sonne entgegen. Bremer sah auf der Straße den Schatten auf sich zuwandern, und er erschien ihm wie ein dunkles Vorzeichen. Am Straßenrand zerschlagene Ziegel, verkohlte Balken, Bruchstücke von Sandsteinquadern, die einmal das Portal eines Hauseingangs gewesen waren, noch stand ein Teil der Treppe, aber sie führte ins Nichts. Wenige Menschen waren auf der Straße, zwei Frauen zogen eine kleine Handkarre, ein, zwei Wehrmachtslaster mit Holzvergasern fuhren vorbei, ein von einem Pferd gezogenes Dreiradauto. Bremer erkundigte sich nach einem Kino. Man schickte ihn zu Knopfs Lichtspielhalle auf der Reeperbahn. Er ging zum Millerntor, dann zur Reeperbahn. Nutten standen, grau und abgehärmt, in den Hauseingängen, zeigten ihre mageren Beine. Wunschkonzert wurde in der Abendvorstellung gezeigt. Vor der Kasse stand eine lange Schlange. Man konnte sich ja sonst für sein Geld nichts mehr kaufen.
Tschuldigung, sagte er, weil er die Frau, die sich hinter ihm angestellt hatte, mit seinem Marschgepäck weggedrückt hatte.
Macht nichts, sagte Lena Brücker. Sie war gleich nach Feierabend aus der Lebensmittelbehörde nach Hause gegangen, hatte sich umgezogen und, da die Sonne hin und wieder zwischen den Wolken leuchtete, ihr Kostüm angezogen. Den Rock hatte sie für dieses Frühjahr etwas gekürzt. Ihre Beine konnten sich sehen lassen, noch, wie sie dachte, denn in drei, vier Jahren wäre sie für einen derart kurzen Rock schon zu alt. Sie hatte sich die Beine mit der hellbraunen Strumpffarbe eingerieben, die Stellen, die etwas zu dunkel geraten waren, verstrichen und sich dann vor dem Spiegel einen feinen schwarzen Strich über die Waden gezogen. Mindestens drei Schritte mußte sie vom Spiegel weggehen, dann aber sah es aus, als trüge sie Seidenstrümpfe. Auf dem Großneumarkt roch es nach Brand und nassem Mörtel. Am Millerntor war in der Nacht zuvor ein Haus von einer Brandbombe getroffen worden. Noch immer schwelte der Schuttberg. Die Büsche in dem Vorgarten waren von der jähen Hitze ergrünt, die zu nah an der Brandruine stehenden verdorrt, einige Ästchen sogar verkohlt. Sie ging an dem Café Heinze vorbei, von dem nur noch die Fassade stand. Neben dem Eingang war noch auf einem Schild zu lesen: Swing tanzen verboten! Reichskulturkammer. Längst wurde der Schutt auf dem Bürgersteig nicht mehr weggeräumt. Die Bars waren geschlossen, kein Tanz, kein Striptease. Sie kam zu Knopfs Lichtspielhalle, außer Atem, sah die Schlange, dachte, hoffentlich komm ich noch rein, stellte sich hinter einem Marinesoldaten an, einem jungen Bootsmann.
So waren Hermann Bremer und Lena Brücker Schritt um Schritt hierher und hintereinander zu stehen gekommen, und er hatte sie mit seinem Gepäck, einem Seesack mit einer daraufgebundenen, eingerollten graugrün gesprenkelten Feldplane gestreift. Macht nichts. Erst ein Zufall ließ sie ins Gespräch kommen. Sie kramte in ihrer Handtasche nach der Geldbörse, da rutschte ihr der Haustürschlüssel raus. Er bückte sich, sie bückte sich, sie stießen mit den Köpfen zusammen, nicht stark, nicht schmerzhaft, er spürte kurz nur ihr Haar im Gesicht, sanft, weichblond. Er hielt ihr den Schlüssel hin. Was war ihr zuerst aufgefallen? Die Augen? Nee, die Sommersprossen, er hatte Sommersprossen auf der Nase, mittelblondes Haar. Hätte glatt mein Sohn sein können. Sah aber noch jünger aus, als er war, damals 24 Jahre. Dachte im ersten Moment, der ist neunzehn, vielleicht zwanzig. Nett sah er aus, so dünn und hungrig. War so zögernd und etwas unsicher, aber mit offenen Augen. Sonst hab ich mir nix dabei gedacht. Nicht in dem Augenblick. Ich hab ihm von dem Film erzählt, den ich in der letzten Woche gesehen hatte: Es war eine rauschende Ballnacht. Filmegucken war das einzige Vergnügen, wenn nicht mal wieder das Licht ausfiel.
Sie wollte wissen, auf welchen Einheiten er fahre. Sie fragte das mit dem richtigen Begriff. Das hatte man ja täglich gehört und gelesen: schwere Einheiten, die Schlachtschiffe, Panzerkreuzer, Schweren Kreuzer. Nur war von den schweren Einheiten, abgesehen von der Prinz Eugen, nichts mehr übriggeblieben. Aber leichte Einheiten gabs noch, Torpedoboote, Schnellboote, Minensuchboote. Und dann die U-Boote.
Nein, er sei in der letzten Zeit im Stab des Admirals in Oslo gewesen, Abteilung Seekarten. War auf einem Zerstörer gefahren, 1940. In Narvik versenkt. Später auf einem Torpedoboot im Ärmelkanal, dann ein Vorpostenboot. Sie saßen im Kino nebeneinander auf knarzenden Sesseln, kalt war es. Sie fror in ihrem Kostüm. Die Wochenschau: Lachende deutsche Soldaten fuhren vorbei, um einen russischen Angriff irgendwo an der Oder zurückzuschlagen. Die Vorschau auf den nächsten Film: Kolberg. Gneisenau und Nettelbeck, Kristina Söderbaum, die Reichswasserleiche, lacht und weint. Noch während der Vorschau – Kolberg brannte – begannen draußen die Luftschutzsirenen zu heulen. Das Saallicht ging an, flackerte, fiel aus. Licht von Taschenlampen. Die Zuschauer drängten aus den beiden Saaltüren, liefen in Richtung auf den großen Bunker an der Reeperbahn. In einen Großbunker wollte sie auf keinen Fall. Lieber in irgendeinen Luftschutzkeller. Einer dieser großen Bunker hatte nämlich neulich einen Volltreffer vor die Tür bekommen. Ein Feuersturm war durch den Bunker gegangen. Später sah man die Menschen an den Leitungen hängen, verkohlt und klein wie Puppen. Lena Brücker lief zu einem Wohnhaus, folgte dem weißen Pfeil: Luftschutzraum, hinter ihr her Bremer.
Ein Luftschutzwart, ein alter Mann mit einem nervösen Zucken im Gesicht, schloß hinter ihnen die Stahltür. Lena Brücker und Bremer setzten sich auf eine Bank. Ihnen gegenüber saßen die Hausbewohner, einige alte Männer, drei Kinder, mehrere Frauen, die neben sich Koffer und Taschen gestellt, Decken und Federbetten um die Schultern gelegt hatten.
Sie wurden von den Leuten angestarrt. Dachten wohl: das ist Mutter und Sohn. Oder: das ist ein Liebespaar. Der Luftschutzwart, mit seinem Stahlhelm auf dem Kopf, kaute, sah zu ihnen herüber. Was wird er gedacht haben? Da hatte sich mal wieder eine reife Frau einen jungen Mann angelacht. Wie die beiden die Köpfe zusammensteckten. Der Rock war ziemlich kurz. Ein gutes Stück vom Oberschenkel war zu sehen. Strümpfe trug die nicht, die Farbe war dort, wo sie die Beine übereinanderschlug, abgerieben, da war hell das nackte Fleisch zu sehen. Aber ne Nutte war das nicht. Nicht mal eine dieser Amateurnutten. Deren Geschäfte gingen schlecht, ganz schlecht sogar. Gab ja jede Menge alleinstehender Frauen. Ehemänner im Feld geblieben oder an der Front. Die Frauen schmissen sich den Männern an den Hals. Der Luftschutzwart griff in die Tasche seines Mantels und holte ein Stückchen Schwarzbrot raus. Er kaute und starrte zu Lena Brücker rüber. Überall Frauen, Kinder, alte Leute. Und da sitzt so n Junge von der Marine. Die beiden sitzen und flüstern. Haben sich bestimmt auf einem Tanzfest kennengelernt, einem privaten natürlich, öffentliche waren ja verboten. Keine öffentlichen Vergnügungen mehr, während draußen Väter und Söhne kämpften. Und fielen. Alle sechs Sekunden fällt ein deutscher Soldat. Aber Feiern läßt sich nicht verbieten, nicht das Lustigsein, nicht dieser Drang zu lachen, gerade wenn es so wenig zu lachen gibt.
Der Luftschutzwart beugte sich vor, versuchte etwas von dem Gespräch der beiden mitzuhören. Aber was hörte er? Leitstelle, Kartenkammer, Seekarten. Bremer flüsterte von Seekarten, die gerollt, gefaltet, numeriert und alphabetisch geordnet werden mußten, die er in Oslo im Stab des Admirals verwalten, das heißt mit neuen Karten vergleichen oder austauschen mußte.
Dabei durfte es zu keiner Verwechslung kommen. Denn die Karten mußten immer auf dem neuesten Stand sein, er zeichnete ein, wo die Vorpostenboote standen, vor allem aber, wo die Minenfelder lagen, wo die Einfahrten und die Durchfahrten waren. Sonst konnte passieren, was schon passiert war, daß deutsche Schiffe auf die selbstgelegten Minen fuhren. Er wolle sich keineswegs interessant machen, aber der Posten sei nicht unwichtig, und jetzt sei er, nach einem Urlaub in Braunschweig, auf der Rückreise nach Oslo zu einer Panzerjagd-Einheit abkommandiert worden. Verstehen Sie, sagte er, ich bin Seemann. Sie nickte. Er sagte nicht: Ich habe keine Erfahrung im Erdkampf, das ist der reine Wahnsinn. Er sagte nicht: Die wollen mich in letzter Minute noch verheizen. Er sagte das nicht nur nicht, weil man als Mann, zumal als Soldat, so etwas nicht sagen konnte, sondern weil es nicht ratsam war, das jemandem, den man noch nicht richtig kannte, zu sagen. Immer noch gab es Volksgenossen, die Defätismus anzeigten.
Zwar sah er an ihrem Kostüm nicht das Parteiabzeichen. Das sah man aber in diesen Tagen nur noch selten. Man trug es unter dem Mantel, gut verdeckt vom Schal.
Plötzlich: ein fernes dumpfes Brummeln, ein erdtiefes Wühlen. Der Hafen, sagte Lena Brücker. Sie bombardieren den U-Boot-Bunker. Fern das Grummeln der explodierenden Bomben. Dann – nah – eine Detonation, ein Stoß, die Notbeleuchtung fiel aus, und noch ein Stoß, der Boden schwankte, das Haus, der Keller schaukelte wie ein Schiff. Die Kinder schrien, und auch Bremer hatte aufgeschrien. Lena Brücker legte ihm den Arm um die Schulter. Hat nicht das Haus getroffen, war irgendwo nebenan.