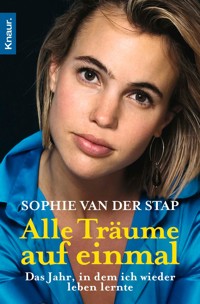
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Sophie ist 21, als bei ihr ein besonders aggressiver Krebs festgestellt wird. Voller Trotz sagt sie der Krankheit den Kampf an – und gewinnt ihn schließlich. Ihre Freundin hingegen, die ebenfalls erkrankt ist, kann nicht gerettet werden. Wie soll Sophie, die mit dem Tod gerungen und einen geliebten Menschen verloren hat, nun weiterleben? Sie tritt die Flucht nach vorn an – und begibt sich auf eine Reise um die Welt, auf der Suche nach einem neuen Leben. Sie bricht auf nach Buenos Aires, Rio, Lhasa und Hongkong, versucht, alle Träume auf einmal zu leben – und stellt am Ende fest, dass die Antwort auf ihre Frage nach dem Lebenssinn nicht in der Ferne zu finden ist, sondern nur in ihr selbst. Alle Träume auf einmal von Sophie van der Strap: eine Biografie im eBook!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Sophie van der Stap
Alle Träume auf einmal
Das Jahr, in dem ich wieder leben lernte
Aus dem Niederländischen von Barbara Heller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Sophie ist 21, als bei ihr ein besonders aggressiver Krebs festgestellt wird. Voller Trotz sagt sie der Krankheit den Kampf an – und gewinnt ihn schließlich. Ihre Freundin hingegen, die ebenfalls erkrankt ist, kann nicht gerettet werden.
Wie soll Sophie, die mit dem Tod gerungen und einen geliebten Menschen verloren hat, nun weiterleben? Sie tritt die Flucht nach vorn an – und begibt sich auf eine Reise um die Welt, auf der Suche nach einem neuen Leben. Sie bricht auf nach Buenos Aires, Rio, Lhasa und Hongkong, versucht, alle Träume auf einmal zu leben – und stellt am Ende fest, dass die Antwort auf ihre Frage nach dem Lebenssinn nicht in der Ferne zu finden ist, sondern nur in ihr selbst.
Inhaltsübersicht
Für Chantal
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Epilog
Danke
Danke, Zus, für das [...]
Für Chantal
10. November 1971 – 12. April 2007
There is an old belief,
That on some solemn shore,
Beyond the sphere of grief
Dear friends shall meet once more.
Beyond the sphere of Time and Sin
And Fate’s control,
Serene in changeless prime
Of body and of soul.
That creed I fain would keep
That hope I’ll ne’er forgo,
Eternal be the sleep,
If not to waken so.
J. G. Lockhart (1794–1854)
1
That Love is all there is, is all we know of Love …
Emily Dickinson
27. März 2007. Eigentlich nur ein Datum, und doch so viel mehr. An diesem Tag bin ich von zu Hause weggefahren. Die schmerzhaften Erinnerungen folgten zu schnell aufeinander, als dass ich sie hätte abschütteln können. Nicht einmal für einen Tag, eine Minute, einen Augenblick. Ich machte einen Umweg über Deutschland nach Spanien, aber bald zeigte sich, dass Spanien nicht groß und weit genug war. Die Kilometer spulten sich schnell ab, fast so schnell wie meine Gedanken. In meinem Kopf drängten sich die Worte, im Rückspiegel die Lkws, aber die Straße vor mir war leer. Und vor allem: frei.
240638 zeigte der Kilometerzähler an, doch nur die letzten 638 waren von mir. Ich fuhr aus Amsterdam weg, weg von allem, was mein Leben beherrschte und bestimmte, hin zu einem neuen, leeren Tag. Einem Tag, so dachte ich, der nur in Spanien auszufüllen war. Aber Einsamkeit kann man leider nicht ausfüllen, das weiß ich inzwischen. Es war vielmehr die Einsamkeit, die mich ausfüllte.
Das Leben bedeutete mir mehr als ich dem Leben. Den vorausgegangenen Rollentausch musste ich machtlos zulassen, und ich driftete immer weiter von meinem eigenen Spielfeld ab in Richtung Seitenauslinie. Vielleicht war es ja schon immer so. Vielleicht ist es einfach so. Vielleicht hat mein Machbarkeitsglaube mehr von einem Traum als vom Wachzustand. Ich weiß es nicht. Wie auch immer: Mein Unglaube an Grenzen nagte wie besessen an meinem Glauben an Möglichkeiten. Die Erkenntnis, dass das Leben aus mehr Zufällen besteht, als ich je hatte wahrhaben wollen, kroch wie eine Nacktschnecke in mich hinein. Es herrschte Krieg in meiner Philosophie, und den Konflikt musste ich selbst lösen.
Einerseits folgte ich den Pfaden eines Traums, andererseits entfernte ich mich aus einem früheren Traum, den ich von meiner Zukunft abkoppeln musste. Mit Chantals Sterben und dem Schrumpfen meines Herzens wurde die kalte Decke, die sich um mich gelegt hatte, immer erstickender.
Wenn die Wirklichkeit sich verschiebt, dann verschieben sich unsere Erwartungen mit. Meine Erwartungen passten sich unmerklich den neuen Pflastersteinen an, die ich an einem windigen Januarmorgen vor zwei Jahren zum ersten Mal betrat. An jenem Morgen wurde alles anders. Es ist schwer nachzuvollziehen, was mit einem sehr jungen Menschen passiert, wenn der Weg vor ihm aufhört zu existieren. Du kannst nicht mehr träumen, und du wagst nicht mehr zu träumen, ohne den Schmerz der Einsamkeit zu spüren, die nicht auszufüllen ist. Du bist krank und wirst vielleicht noch im selben Jahr sterben. Die Aktivitäten am Wegrand kommen plötzlich zum Stillstand.
Bis zu dieser befristeten Atempause hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich jemals noch das Leben führen würde, das ich heute führe, denn eines Tages erblickte ich im Spiegel nicht nur mich selbst, sondern auch meine eigene Sterblichkeit. Damals wusste ich noch nicht, dass der ungebetene Gast neben mir mein Spiegelbild besser wiedergab, als es je irgendein Spiegel getan hatte. Und ich wusste noch nicht, dass sich in diesem Bild eine Schriftstellerin verbarg, oder eine Frau, die in den Armen eines Tangotänzers zum Leben erwacht. Man muss nur lange genug hinsehen – irgendetwas zerbricht immer. Ein Stück Unbefangenheit oder vielleicht ein weiteres Stück Romantik.
Seit jenem Tag im Januar, als ich dem Tod die Hand reichte, ist mein Leben zu einer Aneinanderreihung von Augenblicken geworden. Ich reise von Moment zu Moment, ohne mich irgendwo niederzulassen. Das Phänomen Zeit sieht ganz anders aus als vorher, als ich noch langfristige Pläne hatte. Zeit ist kein Brunnen mehr, so tief, dass man nicht auf den Grund sehen kann. Einen Grund, den nicht einmal die Sonne erreicht. Da ist bloß noch eine Pfütze, die von Tag zu Tag kleiner wird.
Ich musste mich nicht nur von der Zukunft abkoppeln, sondern auch von der Vergangenheit, in der ich so hochfliegende Träume gehabt hatte. Erst als ich alles losließ, gelang es mir, mich an das zu klammern, was ich zu tun hatte: überleben. Ich schöpfte Glück aus dem, was ich hatte, und Gleichmut aus dem, was ich nicht hatte. Gleichmut führt zu neuen Träumen und Türen.
Der Spiegel erschien mir leer, so ganz ohne die Jungmädchenträume von gestern und die wohldurchdachten Pläne von morgen, die bei allem, was ich tat, wie heißes Wachs an mir klebten. Aber seltsamerweise wirkte das auch sehr befreiend. Ohne Erwartungen ist alles leichter und sogar schöner. Wie sich zeigte, lagen meine Träume viel näher, als ich je geglaubt hätte. Das Paradoxe an alldem ist, dass das Nichts des Todes mich dem Quell des Lebens so nahe brachte. Vom Geborenwerden in einem Netz von Vorschriften und Etiketten hin zum Menschwerden, wie ich mir vorstelle, dass der Mensch gedacht ist: universell und frei.
An jenem 27. März, als mich schon der Aprilwind vorwärtstrieb, befand ich mich an einem Scheideweg zwischen zwei Welten. Links lag die Welt, die von unserem Dasein bestimmt wird, rechts jene, die von unserem Tod bestimmt wird. Ich stehe noch immer dazwischen, springe zwischen den beiden Erdkugeln hin und her und korrigiere beständig meine Definition von Leben und Zeit, begleitet von der stets präsenten schmerzhaften Ironie des Lebens: dass wir erst dann wissen, was Leben ist, wenn wir ein Stück davon verloren haben. So wie ein Mensch, der uns nahesteht, einen Teil von uns mitnimmt in jene andere Welt, für die wir noch keine gültige Eintrittskarte haben. Oder als säßen wir selbst ganz vorn in dem Klassenzimmer, in dem die besten Schüler in der ersten Reihe aufs Sterben warten. In diesem Raum lernen wir leben, und erst wenn wir wissen, wie das geht, können wir alles loslassen, was nötig ist, um schließlich allein zu sterben.
Mein Leben hat sich um hundertachtzig Grad gedreht. Es gleicht in nichts mehr dem Leben, das ich vor zwei Jahren in aller Zufriedenheit geführt habe. Eine ganze Menge ist geschehen, und die Erinnerungen an die Ereignisse sind mir zu viel. Sie verdrängen alles andere aus meinem Kopf. Wie eine Mauer stehen sie zwischen mir und meinem damaligen Leben. Selbst zwischen mir und der immer wieder erwachenden Straße unter mir. Die Müllmänner mit ihren unverrückbaren Arbeitszeiten, die Fensterputzer auf der anderen Straßenseite, der Bäcker schräg gegenüber, täglich ab sechs geöffnet. Ich fühle mich isoliert, weit weg von diesen Banalitäten, die ich durchs Fenster, aus der Entfernung, täglich sehe.
Wenn ich auf jenen Tag zurückblicke, weiß ich, dass es nach allen Abzweigungen, die ich ausprobiert habe, im Grunde nur in eine Richtung weitergeht. Ich kann nicht zurück in das Leben, dem ich mein Leben lang Gestalt gegeben habe, und sich daran zu klammern macht das Loslassen nur schwerer. Ich kann nur vorwärts. Ich muss weiter, auf einem neuen Weg, einem Weg, an dem die Raststätten noch unverschmutzt und die Bahnhöfe leer sind. Ich habe vergeblich dagegen angekämpft, habe versucht, an Gewohntem festzuhalten, und bin dabei keinen Schritt weitergekommen. All der Stillstand weist letztlich in eine Richtung: nach rechts. Oder ich schaukle mit auf den Wellen der Veränderung, versuche mir die Veränderung zu eigen zu machen. Rückwärts oder vorwärts.
Ich blickte auf die leere Straße vor mir und trat das Gaspedal noch weiter durch. It is a wide open road.
Dem Navigationsgerät zufolge hatte ich noch 264 Kilometer vor mir. Mein erstes Ziel war Heidelberg, denn dort lag Chantal im Sterben, und Menschen, die sterben, stehen nun mal ganz oben auf der Liste. Erst recht, wenn sie Chantal Smithuis heißen. Es war halb acht Uhr abends, als ich Heidelberg erreichte. Das Navi wusste zum Glück, wo ich hinmusste, denn ich selbst wusste es nicht. Nach sehr vielen Linkskurven und ein paar Rechtskurven tauchten rechts die Wörter KRANKENHAUS ST. VINCENTIUS auf, in weißen Neonbuchstaben an der Fassade eines für eine Klinik ungewöhnlich schönen Gebäudes. Ich schaute unwillkürlich zu den Fenstern hinauf, die meiner Freundin einen herrlichen Blick über den Fluss bescherten. Zehn Minuten später sollte ich mit allen Sinnen erfahren, dass Chantal sich, mehr als irgendjemand sonst, am Grün und Rosa einiger Häuser am anderen Ufer erfreute, an den roten Streifen ihrer Bettwäsche, den Käsebroten und vor allem an dem Moment um sechs Uhr, wenn es Zeit war für ein warmes Bad mit Rosenblättern, dem Höhepunkt ihres Tages. Sie war von den Zehen bis zur Brust gelähmt, außerdem kahl und nicht mehr wiederzuerkennen. Das kam von den Medikamenten, die ihr rund um die Uhr eingeflößt wurden. Sie war gefangen in einem Körper, der nicht mehr der ihre war.
Während sich der Himmel erst grau, dann blau und schließlich rosa färbte, dachte ich an unsere Freundschaft zurück. Es war eine Freundschaft weniger Tage, aber vieler Momente. Momente, in denen es um Dinge ging, die wir schon getan hatten, und um Dinge, die wir noch tun sollten. Unsere erste Begegnung vor anderthalb Jahren, bei der ich eine Gänsehaut bekommen hatte; drei Stunden, die wie drei Minuten verflogen. Wir teilten miteinander eine Welt, die niemand sonst mit uns teilen konnte. Ob wir nun auf dem Albert-Cuyp-Markt Muscheln kauften oder zusammen ins Krankenhaus gingen, um wieder einen Befund zu erhalten, der unser Leben bestimmen sollte, ein Leben, das in Chantals Fall zum Stillstand gekommen ist.
Wir wussten, was es heißt, als junge Frau Krebspatientin zu sein, zusammen auf einem leeren Bahnsteig zu stehen, weil wir als Einzige den Zug verpasst hatten. Da standen wir still in einem Leben, das vierundzwanzig Stunden am Tag an uns vorbeirauschte. Während wir auf den Zug warteten und in einer Zeitschrift mit retuschierten weißen Zähnen auf der Titelseite blätterten, entdeckten wir die Welt des Todes, während um uns herum alle damit beschäftigt waren, das Leben zu entdecken. Dennoch ging dieses Leben auch für uns weiter, zwangsläufig. Es hatte sich nur ein Loch aufgetan an der Stelle, an der vor noch gar nicht langer Zeit unsere Träume den Kurs bestimmt hatten. Beim nächsten Befund blieb Chantal allein zurück. Ich erwischte den Zug buchstäblich in letzter Sekunde. Sie hatte ihn wieder verpasst. Chantal war diejenige, die allein auf dem leeren Bahnsteig zurückblieb.
Der Landrover kroch im ersten Gang vorsichtig in die Einfahrt der Tiefgarage. Ein ungeheures Piepen ertönte. Auf einer deutschen Autobahn mag ich mich ja wie ein kleiner Michael Schumacher fühlen, in einer deutschen Tiefgarage bin ich nichts weiter als eine Frau am Steuer. Erleichtert lenkte ich den Wagen auf einen freien Stellplatz, eigens für Frauen reserviert in diesem frauenfreundlichen – oder auch frauenfeindlichen, je nachdem, aus welcher feministischen Perspektive man es betrachtet – Parkhaus und horchte auf seinen letzten Seufzer. Der erste Tag des Wegseins war fast zu Ende. Und der erste ist immer der schwierigste.
Es muss kurz nach acht gewesen sein, als ich die Tiefgarage verließ und merkte, dass ich schon am Leib meiner Freundin vorbeigefahren war. Ich sage bewusst »Leib«, denn wie viel von der Chantal, die ich kannte, schlief dort oben noch? Wie eng waren wir noch verbunden? Je tiefer sie fiel in den dunklen, tiefen Schacht, der Tod heißt, desto weiter fühlte ich mich von ihr entfernt. Ich war ja gerade mit dem Aufstieg Richtung Everest befasst. Doch es war nicht so sehr die Entfernung, die uns trennte, sondern das immer verwirrendere Grübeln über unser Leben und die Momente, die uns blieben. Chantal saß ganz vorn im Klassenzimmer, auf dem besten Wege, in ihrer letzten Prüfung eine Eins zu bekommen. Verdammt noch mal, Krebs, da bist du wieder.
»Chan?«, flüsterte ich durch den Türspalt.
»Sophietje!«
»Ach, Süße, da liegst du nun.«
»Ja, da liege ich nun. War viel Verkehr?« So war Chan: immer um andere besorgt.
Ich sprach zu Chantal, aber ich sah auf einen Körper, den ich noch nie gesehen hatte. Es war unser aller Körper in dem Augenblick, da der Tod uns näher ist als das Leben und uns vielleicht deshalb mehr Ruhe schenkt, als das Leben noch zu bieten hat. Chantal war blasser als früher, die blauen Adern zogen eine tödliche Spur über ihre Arme und Beine, sie machten die Haut stumpf und hart und endeten in einem Gemälde aus blauen Flecken. Als wären es die Adern, durch die das Leben aus ihr floss, in eine andere Welt. Gruselig, was, dass ich da auch bald liege. Ihre Worte – gesprochen vor weniger als einem Jahr, als wir an der Leichenhalle des Antoni-van-Leeuwenhoek-Krankenhauses vorbeikamen – gingen mir wie ein Mantra im Kopf herum. Da lag sie nun, auf ihrer letzten Matratze.
Bei einem Menschen, der im Sterben liegt, braucht man nicht ins Detail zu gehen, um die Dinge zu erklären, wie sie sind. Wie kein anderer weiß er, was Sache ist, und vielleicht kann diese Hellsichtigkeit selbst jetzt noch ein Geschenk genannt werden. Jedes Wort – und es sind nicht eben wenige, aber auch gewiss nicht viele – ist wohlüberlegt, wohlerwogen und ernst gemeint. Ich weiß nicht, warum mich diese Klarheit an einen stillen See denken ließ, dessen Wellen sacht ans Ufer plätschern; so klar, so ruhig und irgendwo, tief unter der Oberfläche, so zufrieden.
Chantal sorgte sich um meine Nachtruhe, um meinen knurrenden Magen und die Leere in meinem übervollen Herzen. Ich solle stets meinem Herzen folgen, sagte sie, ich solle zu jeder Zeit einen Gürtel tragen, aber einen passenden, einen in der Farbe meiner Schuhe, und ich solle mich nach dem Stuhlgang mit feuchtem Toilettenpapier abwischen. Nie zuvor haben Worte die Dinge derart auf den Punkt gebracht. Sie übertrafen in einer Sekunde alle Höhepunkte des amerikanischen Kinos.
An meinem ersten Vormittag im farbenprächtigen Heidelberg kam ich auf der Suche nach einem Gürtel an einem unscheinbaren kleinen, mit chinesischen Lebensmitteln vollgestopften Laden vorbei. Als ich hineinwollte, half die Verkäuferin gerade einer Kundin mit einem Kinderwagen aus der Tür. Drinnen sah ich nichts, was meine Fantasie angeregt hätte, aber vielleicht war sie im Moment auch nicht anzuregen. Beim Bezahlen steckte mir die Frau einen Glückskeks zu. Sprüche und Weisheiten. Willkommene Unterbrechung eines drögen Gesprächs, aber unerwünschte Spannungskurve an Tagen, an denen die Emotionen über die Vernunft siegen. Ich hatte keinen Bedarf an weiteren Gedanken, daher steckte ich das silberne Päckchen ungeöffnet neben die Wasserflasche in meinen Korb und ging weiter in die Stadt. Bei jedem Schritt dachte ich an Chantal, die tags zuvor noch gescherzt hatte, sie stehe schon morgens um halb fünf neben ihrem Bett, weil sie so wenig schlafe.
»Na ja, sozusagen«, fügte sie nach einer kurzen Pause hinzu. Stehen, sitzen, sich bewegen, das konnte sie schon seit drei Wochen nicht mehr. Geschweige denn etwas spüren. Nein, sie lag wie ein neugeborenes Kind im Bett, mit dem großen Unterschied, dass sie den Verstand einer Frau von fünfunddreißig und wahrscheinlich noch viel mehr Jahren hatte.
»Ich bin wieder wie ein Baby. Ich mache in die Windeln, ich werde gefüttert und gewaschen. Schrecklich. Dabei bin ich gewöhnt, mich um alles selbst zu kümmern, so sehr, dass es schon fast neurotische Züge annimmt.«
Zurück bei Mama, so nannte sie es auch. Und aus diesen Worten sprach nichts als Liebe. Glück sogar. Das lernt man, wenn man stirbt: Liebhaben in seiner reinsten Form. Man lernt, Unwichtiges zu erkennen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Nicht aus Lernbegierde, sondern aus der Notwendigkeit zu überleben. Man selektiert, jeden Tag ein bisschen mehr, bis nur noch vier Menschen am Bett stehen. Aber für Chantal war der Weg weitaus länger. Sie musste nicht bloß selektieren, sondern auch loslassen und abkoppeln. War es anfangs ums Überleben gegangen, so ging es jetzt um ein Sichfügen. Sie musste sich lösen von dem, was sie am dringendsten zum Überleben brauchte: von ihrer Hoffnung und von ihrer Mutter.
Sie weinte und klagte nicht, zumindest nicht in meinem Beisein. Doch als sie vom Zusammensein mit ihrer Mutter erzählte, so wie sie es seit einigen Monaten Tag für Tag erlebte, da rannen die Tränen aufs Kissen, ehe sie und ich es uns versahen. Tränen der Liebe, der Trauer und des Glücks beim Gedanken an ihre Mutter. Diese Liebe spürte sie genauso, wenn sie allein war, vielleicht sogar noch intensiver. Auch ihre Mutter kam besser mit ihrem Kummer zurecht, wenn sie allein und nicht bei ihren Lieben war.
Dass in diesen intimen Minuten ausgerechnet ich an Chantals Bett stand und nicht eine ihrer besten Freundinnen, ist eine Tatsache, deren Warum wir beide deutlich spürten, aber nicht verstanden. War es, weil wir einander aus der sicheren Entfernung unserer Beziehung, in der die Wahrheit einen nicht so hart trifft, ganz nahe kommen konnten? War ich jemand, mit dem sie über alles sprechen konnte, über all ihre Ängste, all ihren Schmerz – ohne den Schmerz des anderen spüren zu müssen? War es, weil sie sich in ihrer Lage lieber an jemanden wandte, der diesen Teil ihrer Geschichte verstehen konnte? Wenn auch stets mehr als Zuschauerin denn als Verwandte? War es, weil ich ihre Hoffnung auf ein anderes Leben verkörperte, ein Leben auf Papier?
Letztlich traf alles zu, und es war alles gleich wichtig, aber es war auch eine heikle Rolle für mich. Zum Glück wurde sie mit jedem Augenblick entschärft. Und Augenblicke gibt es sehr viele, wenn die Tage gezählt sind. Manchmal verstrichen lange Minuten, in denen wir uns stillschweigend dieser geradezu schreienden Intimität bewusst waren. Mal waren es Scherze, mal Fragen, die wir uns immer wieder stellten. Nur manchmal ging es um etwas anderes, und beim Mittagessen ergab sich sogar ein angeregtes Gespräch. Allerdings nur kurz. Man kann ein klagendes Herz vorübergehend ignorieren, aber niemals ausschalten. Und klagen, das tat es. Bei uns beiden.
Als ich am Nachmittag ins Hotel zurückging, das nur dreihundert Meter von Chantals Klinik entfernt lag, kam ich an einem Thai-Restaurant vorbei. Ein köstlicher Duft nach Kokosmilch und grünem Curry stieg mir in die Nase, also trat ich ein. Drinnen stand ein Mann und telefonierte, etwas zu laut, doch mit einer Stimme, die mich unerwartet fröhlich machte. Er las eine Telefonnummer von einem Kärtchen ab, das er in der Hand hielt. Ich konnte es nicht lassen, ein paar Zahlen einzuwerfen.
»Fast richtig«, sagte er lachend, als er auflegte. Sein Lachen wirkte ansteckend. Sieh an, bis zu diesem Moment hatte ich gar nicht gewusst, dass es in Deutschland so viel zu lachen gab. Sein Handy klingelte erneut.
»Ja, hallo, hier George Michael.« Wieder musste ich lachen. Ich freute mich sogar schon auf das, was er als Nächstes sagen würde. Die Verkäuferin packte seine Currys mit meiner Suppe ein.
»Zusammen, nicht?«
»Noch nicht«, antwortete er, »aber vielleicht heute Abend.« Wieder ein Volltreffer.
Zurück im Hotel, plagten mich Stiche wie Hunderte kleiner Nadeln tief drinnen in meinem Körper. Stiche, die mich an meine eigene Krankenhausvergangenheit erinnerten, aber vor allem an meine Verbundenheit mit dem Körper, der ein paar hundert Meter weiter rasend schnell starb, von unten nach oben – kein Gefühl, keine Bewegung, nichts. Tot bis in die Brust.
Am Abend aß ich zum zweiten Mal hintereinander allein, am selben Tisch, an dem ich tags zuvor meinen ersten deutschen Happen hinuntergeschluckt und an diesem Morgen meinen ersten schwarzen Kaffee getrunken hatte. Das bisschen Gewohnheit, die diese Wiederholung mit sich brachte, kam mir wie ein kurzer, aber warmer Luftstrom entgegen. Ich hatte den kleinen Tisch an der Wand gewählt: einer Wand zum Anlehnen. Als ich in meiner Tasche nach Notizbuch und Stift kramte, stieß ich auf den Glückskeks aus dem chinesischen Laden. Vorsichtig wickelte ich ihn aus dem Silberpapier und brach ihn mit voller Konzentration behutsam auf. Our destiny is to merge with infinity. Wie passend. Mit diesen Worten schlief ich um kurz nach neun ein. Der Druck der Emotionen ließ mich zehn Stunden lang in einem traumlosen Schlaf versinken.
Chantal war hart in all der Zeit, in der wir miteinander zu tun hatten. Sie war hart genug, um mit ihrem Todesurteil umzugehen. Ihr Stewardessenkostüm tauschte sie gegen Arbeitslosengeld ein, ihre Freunde wurden immer weniger und blieben schließlich ganz weg. Das kann man ihnen nicht verübeln, so geht das nun einmal. Chantals dichtes blondes Haar wuchs kurz und dunkel nach. Ihre breiten Schultern, ihre prächtigen vollen Brüste, ihre Taille und ihre Hüften, wie mit einem weichen Pinsel gezeichnet. Ihre stets gepflegten roten Zehennägel. Dazu dieses million dollar smile, das niemand unbeachtet ließ. Aus ihrem Schnellzugfenster sah sie, wie sich das alles unerbittlich veränderte. Ihre Krankheit nahm sie mit aller Hässlichkeit ein. Der aufgeschwemmte Bauch, die erschlafften Muskeln und schließlich die aufgedunsenen Wangen, die sie am weitesten von der bildschönen Frau entfernten, die sie einmal gewesen war. An dieser Einsamkeit führte auch für sie kein Weg vorbei. Vielleicht spürte Chantal sie am stärksten, wenn sie an den Schimmel dachte, der nun nicht mehr angaloppiert kommen würde. Chantal wusste, dass sie sterben würde, ohne ihr Jawort gegeben zu haben, ohne Kinder in die Welt gesetzt zu haben, ohne davongaloppiert zu sein, in die Ehe.
31. März 2007. Es ist still und leer in der Tiefgarage, als ich dort ankomme. Ein Glück, dann lässt es sich besser ausparken. Ich fühle mich wohl und sicher in dem Landrover, mit meinen Sachen auf dem Rücksitz, der mittlerweile als improvisierte Wäscheleine dient. Die Unruhe des Weggehens ist der Ruhe des Wegseins gewichen. Fünf Tage ist es inzwischen her, dass ich zu Hause losgefahren bin und dabei einen riesigen Abfallbehälter auf dem Halfords-Parkplatz gerammt habe. Schnell weiterfahren schien mir in dem Moment – mit bereits zwei Strafzetteln in der Tasche – das Beste, was ich tun konnte. Frauen am …
Vor fünf Tagen bin ich auch von Chantal weggefahren, und meine Gedanken haben sich mit der Landschaft verändert. Das Navi führt mich noch einmal an Chantal vorbei, dann bin ich auf der Autobahn Richtung Frankreich. Mein Ziel: St. Jean des Vignes, fünfzehn Kilometer nördlich von Lyon. Ein chambre d’hôtel, ein einzelnes Zimmer, ein einzelner Hügel, ein einzelner Baum, eine einzelne Kirche und eine einzelne französische Landstraße. Einfachheit ist das Einzige, wonach ich mich jetzt sehne.
Ich denke an Chantal, von der ich am Morgen Abschied genommen habe. Im Grunde ist sie damit für mich schon ein bisschen gestorben. Scheintot nennt man das, glaube ich. Und ich denke an Timo, den Mann, den ich liebe, dem aber Liebe nicht genug zu sein scheint.
In Die Hexe von Portobello schreibt Paulo Coelho, dass Menschen, die ihre eigene kleine Welt verlassen, dazu neigen, abenteuerlustiger zu werden, dass sie dadurch ihre Hemmungen verlieren und ihre Vorurteile leichter aufgeben. Schön hippiemäßig klingt das, und ich mag es schön hippiemäßig, aber so langsam frage ich mich, ob ein Satz Vorurteile und abgegriffene Normen das Leben nicht sehr viel einfacher machen. Allen voran die Norm, dass man von verheirateten Männern, bei denen zufällig noch die Ehefrau im Gästezimmer liegt, die Finger lassen soll. Ich frage mich auch, woher all meine exotischen Träume und unmöglichen Verliebtheiten kommen, wo ich mich doch im Grunde meines Herzens wie jedes andere Mädchen nach einem Banker als Freund sehne.
Timo und ich haben uns vor sieben Monaten, die mir wie sieben Jahre vorkommen, kennengelernt. Beunruhigend, was die Zeit manchmal mit uns macht. Nach neun Jahren, die überwiegend von Pizzaromantik geprägt waren und gelegentlicher guter Hausmannskost, lavierte ich zwischen Überraschungen und Enttäuschungen, die eines gemeinsam hatten: Beide dauerten nie lange. Alles in allem ergab das einen wirren Haufen Verliebtheiten, der mir gar nicht schnell genug mit dem wahren Kuss weggefegt werden konnte.
Der Kuss kam mit Timo. Per SMS. Ob eines der neun Mädchen frei sei und in sein Büro kommen könne, fragte er. Mehr nicht.
Ich verstand kaum etwas, aber das hinderte mich nicht, seine Tür zu öffnen. Außerdem war es, wie ich fand, ein wunderbarer Anfang von etwas, das ich später Kaviarromantik nennen sollte. Ich habe das Souvenir noch. Ein blaues Döschen mit einem Fisch und einer persischen Aufschrift, für das manche Leute viel Geld bezahlen. Mir persönlich sind Muscheln lieber. Aber gut, es wurde Kaviar. Die Romantik unter der Romantik sozusagen.
Ich beschloss also, in sein Büro zu gehen, und stand kurz darauf zum ersten Mal auf der kleinen Distelwegfähre nach Amsterdam-Nord. Die Gegend gehört seit Jahren nicht mehr zum Poldergebiet, aber ich fühle mich dort immer noch ein bisschen wie in den Ferien. Wie auf der Autobahn in Deutschland verliere ich in Amsterdam-Nord schnell die Orientierung. Ob ich mich schon in Bewegung gesetzt hätte, fragte er mich auf der Fähre per SMS. Ich wollte schon eine freche Antwort zurückschicken, überlegte es mir dann aber noch einmal, denn ich wusste ja nicht, was mich erwartete: ein Mann mit Midlife-Crisis oder ein Rockstar. Oder beides.
Ich klingelte, oder vielleicht war die Haustür auch offen – ich weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich Ersteres, denn ich wusste ja kaum, wie das Büro hieß und was sie dort überhaupt machten. Entwürfe, wie sich herausstellte. Überall hingen Zeichnungen von Gebäuden und großen Konstruktionen. Auch ein Architekturmodell stand da, und mitten im Raum lag ein Ruderboot mit ein paar Sachen darin. Es war offensichtlich ein Architekturbüro. Eine Menge Zeichner saßen und standen herum, so um die fünfzehn. Alle sahen auf, wie man es eben zu tun pflegt, wenn ein neues Püppchen hereinkommt.
Eine freundliche, etwas mollige Frau, offenbar die Sekretärin, hob den Kopf.
»Guten Morgen, bist du Sophie?«
»Ja.«
»Hast du gut hergefunden?«
»Klar.« Das war gelogen, aber sich in Amsterdam-Nord zu verlaufen fand ich unpassend für eine Frau von Welt. Und ich gebe mich gern als Frau von Welt.
»Schön, Timo erwartet dich schon.«
Sie schickte mich in den hinteren Teil des Raumes. Oder den vorderen, je nach der Perspektive des Betrachters. Ich ließ den Blick durch den Raum schweifen und schaute dann genauer hin, so weit ich sehen konnte. Die Fenster gingen auf den IJ hinaus, ein umwerfender Blick für jemanden, der zum ersten Mal mit der Distelwegfähre übergesetzt hat. Schließlich blieben meine Augen irgendwo zwischen einem Cordanzug und Schnürstiefeln hängen: der Mann, um den es ging. Der Typ zog mich gewaltig an. Vielmehr der Typ Rockstar.
Seine Haare hingen in ungepflegten langen Strähnen herab. Das fiel mir jedenfalls als Erstes auf. Statt sich den Haarschnitt eines Mannes anzusehen, achtet man viel zu sehr auf die Augen, die Größe, die Kleidung, die Schuhe. Alles ebenfalls ungeheuer wichtig, aber die Haare, die sind das Wichtigste. Timos Haarfarbe liegt irgendwo zwischen blond und grau. Das finde ich wunderschön: so eine gestufte Frisur in mehreren Blond- und Grautönen, die bei jedem Licht anders schimmern. Aber rückblickend hätte ich ihm wohl doch etwas länger in die Augen schauen sollen, denn darin lagen schon damals die erdrückenden Zweifel verborgen.
Ich ging also auf ihn zu, und ich muss sagen, er strahlte. Jedenfalls lachte er übers ganze Gesicht. Ich allerdings auch. Denn es war eine lustige und spannende Situation. Dass er schon damals von mir angetan war, merkte ich sofort, schenkte dem jedoch keine besondere Beachtung. Männer sind schnell von einer jungen Frau begeistert, die ein Buch geschrieben hat.
Das Gespräch war auch nett, vor allem weil es dabei nur am Rande ums Geschäft ging. Er schnitt es zwar an, aber bald war klar, dass ich nicht meiner beruflichen Fähigkeiten wegen hier saß. Sehr vernünftig von ihm im Übrigen. Trotzdem bekam alles, was wir besprachen, ein geschäftliches Deckmäntelchen umgehängt, schließlich musste eine Motivation dafür erkennbar sein, dass wir in seinem Büro hemmungslos flirteten.
Als ich zwei Stunden später wieder ging, war ich mehr als froh. Es fiel mir auf, weil ich am Morgen alles andere als froh aufgewacht war. So geht es mir öfter, ohne dass ich den Grund dafür benennen könnte – ziemlich irritierend. Na ja, für heute war das jedenfalls geklärt. Für die nächsten Tage auch, wie sich zeigte, als ich am Abend eine SMS bekam:
Netter als erwartet
Ja, allerdings. Vor allem weil ich ohne jede Erwartung zu dem Gespräch gegangen war.
Ich sage nicht, dass ich mich auf der Stelle in ihn verliebt hatte, aber es war auf der Stelle um mich geschehen. Oder ist das jetzt kompletter Blödsinn? Irgendwie war mir klar, dass ich diesen etwas abgehalfterten Rockstar näher kennenlernen musste. Und dass ich ihn mehr als lieb haben wollte, wusste ich schon, bevor wir uns die Hand gaben. Sie kam also sehr gelegen, diese SMS. Ich nahm mein Handy und drückte auf Neue Nachricht.
Spannender als erwartet
Senden. Ich hoffte, in seinen Armen wiederzufinden, was ich im Krankenhaus verloren hatte: meine Träume. Von dem Tag an, als ich Timo kennenlernte, habe ich sie alle um ihn herumgeflochten, ohne wahrhaben zu wollen, dass er dieses Märchen auch noch mit jemand anderem erlebte, der noch längst nicht von der Bildfläche verschwunden war. Ein Zuhause, die Kinder – das ganze Drum und Dran, bis hin zu dem Baum im Garten hinterm Haus.
Waren die Schuhe genehm?
Er hatte seine Hausaufgaben gemacht. Fußnote: Siehe Heute bin ich blond, Seite 10.
Genehm
Wir waren verliebt. Frisch verliebt. Schrecklich verliebt. Schön verliebt. Wahnsinnig verliebt. Dass er bei mir, in der kleinen Wohnung einer Dreiundzwanzigjährigen im Jordaan, wach wurde und ich bei ihm, in einem Palast in Nordholland, unterstrich jeden Morgen aufs Neue die Trennlinie zwischen unseren Welten, die wir jedoch beide mit dem, was schön war an diesen Welten, beiseiteschoben. Ich schreibe in der Vergangenheit, weil der Fortbestand dieser Morgenstunden heute an einem seidenen Faden hängt. Auch deshalb, weil ich mit seinem Wagen weggefahren bin, ohne ihm zu sagen, wann ich zurückkomme – ich weiß es einfach noch nicht –, aber vor allem, weil er nicht weiß, was er will.
Während sein Tag vom Terminkalender seiner Sekretärin und von den Fußballterminen seiner Söhne bestimmt wird, ist meiner gefärbt vom Kommen und Gehen einzelner Momente. Er hat den Terminkalender, ich habe die Zeit. Timo steht samstagabends johlend am Spielfeldrand, ich flattere wie ein Schmetterling ein bisschen in einem Wirrwarr von Abenteuern hin und her, deren Anfang und Ende ich noch nicht kenne.
Diese Abenteuer haben einst auf einem Betonmäuerchen begonnen, mit einem Bier in der Hand, weil ich dachte, die Bierflasche, zusammen mit den Sternen und der Sommerhitze des Jahres 1997, gehöre einfach dazu. Zur Pizzaromantik, meine ich. Meine Vorstellung von Liebe reichte gerade mal bis »Beverly Hills 90 210« und den griechischen Tragödien, die wir in der Schule durchnahmen. Ziemlich wirr also. Wir fuhren mit Emilianos weißer Vespa durch die Gegend, wir schwammen in einsamen Buchten, wir liebten uns in den Wäldern. Für so etwas sind Mädchen nun mal sehr empfänglich. Frauen übrigens auch, so energisch sie es auch bestreiten.
Timo und ich verkörpern meine Überzeugung, dass nicht Grenzen unser Leben bestimmen, sondern die Möglichkeiten, die dahinterliegen. Dieser feste Glaube bedeutet schlichtweg Schwierigkeiten, aus dem einfachen Grund, dass ich die Grenzen nicht sehe, auch dann nicht, wenn sie da sind. Das ist ziemlich beunruhigend, wenn man bedenkt, dass eine dieser Grenzen eine einfache Rechenaufgabe ist, nämlich fünfundvierzig Jahre minus dreiundzwanzig. Wenn das allein nicht Grund genug für eine Notbremsung ist, dann zählt man noch eine Frau und zwei Kinder dazu und kommt zu dem eindeutigen Ergebnis, dass die ganze Sache von Anfang an unter einem schlechten Stern stand. Die beiden lebten allerdings getrennt, muss ich dazusagen. Aber gut, ich war nicht vorausschauend genug. Und bin es noch immer nicht.
Solche Gedanken sind es, die mich unterwegs immer weiter von Chantal fortziehen. Auch in Heidelberg war ich unterwegs, und doch wieder nicht, weil sich ein Teil von mir bei Chantal so sehr zu Hause fühlt. Der einsame Teil, würde ich sagen.
Ich fahre durch den Südwesten Deutschlands nach Frankreich, nicht weit vom Schwarzwald, den Goldmund auf der Reise durch sein Leben durchwandert. Karlsruhe. Straßburg. Mühlhausen. Auf der Fahrt durch Deutschland werden Narziss und Goldmund, ebenso wie Siddhartha und Govinda, die Figuren aus Hermann Hesses Büchern, zusammen mit dem Schwarzwald in meiner Windschutzscheibe so lebendig, dass sie nur noch ein paar Seiten von meinem Kilometerzähler entfernt sind.





























