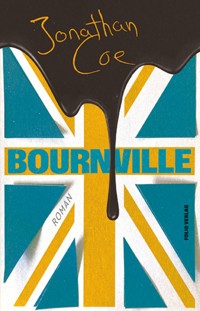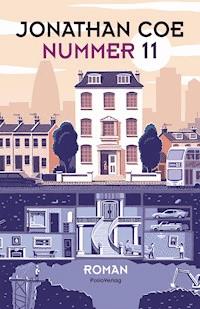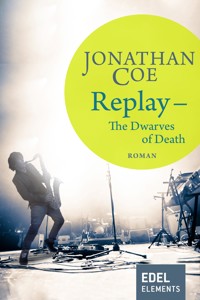Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Winshaws sind exemplarische Sieger der Gesellschaft: Hilary, die erfolgssüchtige Klatschkolumnistin; Roddy, der gerissene Kunsthändler; Henry, der Labour-Politiker; Dorothy, die unerbittliche Regentin über ein Fast-Food-Imperium. Und sie alle vertuschen ein blutiges Geheimnis, dessen Hintergründe nur die alte Tante Tabitha kennt, die man sicherheitshalber für verrückt erklärt hat: Sie ist davon überzeugt, daß ihr Bruder Godfrey im Zweiten Weltkrieg nicht gefallen ist, sondern auf Geheiß eines Familienmitglieds ermordet wurde. Im Sommer 1990 beginnt der junge Schriftsteller Michael Owen seine Auftragsarbeit an der offiziellen Biographie des Winshaw-Clans. Je näher er der wahren Geschichte seiner Hauptdarsteller kommt, desto mehr verschmilzt diese mit dem Plot eines Films, den Michael dreißig Jahre zuvor als kleiner Junge gesehen hat: 'Eine Leiche auf Urlaub', mit der wunderschönen Shirley Eaton in der Hauptrolle. Sie ließ seiner Phantasie seit damals keine Ruhe mehr . . .
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 780
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jonathan Coe
Allein mit Shirley Roman
Ins Deutsche übertragen von Dirk van Gunsteren
Orphée: Enfin, Madame ... m’expliquerez-vous?
La Princesse: Rien. Si vous dormez, si vous rêvez, acceptez vos rêves. C’est le rôle du dormeur.
aus Cocteaus Filmfassung von Orphée
»Triff mich« rief er, doch das war bald vergessen
»Lieb mich«: Doch erfüllt uns Liebe mit Furchtsamkeit
Lieber fliehen wir und fliegen zum Mond
Als zu sagen das rechte Wort zur rechten Zeit.
Louis Philippe Juri Gagarin
Inhalt
Prolog – 1942–1961
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
TEIL I – London
August 1990
Hilary
September 1990
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Henry
Oktober 1990
Kapitel 1
Kapitel 2
Roddy
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
November 1990
Dorothy
Juni 1982
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Thomas
Dezember 1990
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Mark
Januar 1991
TEIL II – Eine Organisation des Todes
1 – Wo ein letzter Wille ist
2 – Beinah ein böser Unfall
3 – Kein Grund zur Panik!
4 – Eine Partie Billard
5 – Eine Dame irrt sich
6 – Die Krönung
7 – Fünf goldene Stunden
8 – Ein Hinterzimmerspion
9 – Mit Gagarin zu den Sternen
Impressum
Prolog 1942–1961
1
Schon zweimal hatte das Schicksal die Winshaws heimgesucht, doch noch nie hatte es so hart zugeschlagen.
Die erste dieser Tragödien ereignete sich in der Nacht des 30. November 1942, als der damals erst zweiunddreißigjährige Godfrey Winshaw bei einem Flug in geheimer Mission über Berlin abgeschossen wurde. Die Nachricht erreichte Winshaw Towers in den frühen Morgenstunden des folgenden Tages und hatte zur Folge, daß Godfreys ältere Schwester Tabitha den Verstand verlor, den sie bis heute nicht wiedergefunden hat. So groß war ihre geistige Verwirrung, daß man sie für außerstande hielt, dem Gottesdienst für ihren Bruder beizuwohnen.
Es ist eine Ironie des Schicksals, daß ebendiese Tabitha Winshaw – eine inzwischen einundachtzigjährige Frau, die heute ebensowenig bei klarem Verstand ist wie in den vergangenen fünfundvierzig Jahren – die Mentorin und Sponsorin des Buches ist, das Sie, geneigter Leser, in Ihren Händen halten. Tabitha Winshaws Zustand einigermaßen objektiv zu beschreiben ist nicht unproblematisch. Dennoch muß man Tatsachen Rechnung tragen, und Tatsache ist: Seit der Nachricht von Godfreys tragischem Tod ist Tabitha das Opfer einer grotesken Wahnvorstellung. Sie ist, kurz gesagt, davon überzeugt (sofern das Wort »Überzeugung« in diesem Fall angemessen ist), daß Godfrey nicht etwa deutschem Flakfeuer, sondern vielmehr den Ränken seines eigenen Bruders Lawrence zum Opfer gefallen ist.
Ich will nicht unnötig bei dem schweren Schicksal verweilen, welches einer bedauernswerten und seelisch labilen Frau vom Leben zugeteilt wurde, doch erfordert diese Angelegenheit insofern eine Erläuterung, als sie einen nicht unerheblichen Einfluß auf den weiteren Verlauf der Geschichte der Winshaws hat und daher in eine Art Zusammenhang gestellt werden muß. Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen. Der Leser sollte wissen, daß Tabitha beim Tode ihres Bruders sechsunddreißig Jahre alt und nicht nur noch immer unverheiratet war, sondern auch keinerlei Neigung zeigte, in den Stand der Ehe zu treten. Es war einigen Familienmitgliedern nicht entgangen, daß ihr Verhältnis zum anderen Geschlecht sich bestenfalls mit dem Wort »Gleichgültigkeit« und schlimmstenfalls mit dem Wort »Abscheu« umschreiben ließ. So groß das Desinteresse war, mit dem sie den Annäherungsversuchen gelegentlicher Verehrer begegnete, so leidenschaftlich war die Liebe und Hingabe, die sie Godfrey entgegenbrachte, der, wie die wenigen erhaltenen Dokumente und Fotografien belegen, der bei weitem lebenslustigste, stattlichste, dynamischste und ganz allgemein gewinnendste der fünf Geschwister war. Da man wußte, wie stark Tabithas Gefühle für ihn waren, glaubte die Familie Grund zu einer gewissen Besorgnis zu haben, als Godfrey im Sommer 1940 seine Verlobung bekanntgab, doch anstelle der von manchen befürchteten blindwütigen Eifersucht entwickelte sich zwischen ihr und ihrer zukünftigen Schwägerin eine herzliche, innige Freundschaft, und so wurde die Hochzeit mit Mildred Ashby im Dezember desselben Jahres zu einem in jeder Hinsicht geglückten Ereignis.
Für Lawrence hingegen, ihren ältesten Bruder, hegte Tabitha weiterhin entschieden feindschaftliche Gefühle. Die Ursachen für die Antipathie zwischen diesen beiden unglücklichen Geschwistern liegen im dunkeln. Höchstwahrscheinlich wurzelte sie in unterschiedlichen Temperamenten. Lawrence war, wie sein Vater Matthew, ein zurückhaltender und manchmal ungeduldiger Mann und verfolgte seine nationalen und internationalen Geschäftsinteressen mit einer zielstrebigen Entschlossenheit, die für viele an Rücksichtslosigkeit grenzte. Das Reich weiblicher Feinsinnigkeit und zarter Gefühle, das Tabitha bewohnte, war ihm vollkommen fremd; er hielt sie für flatterhaft, überspannt, neurotisch und »nicht ganz dicht« – ein Urteil, das, aus heutiger Sicht, traurig prophetisch anmutet. (Es sei jedoch gesagt, daß er damals mit seiner Meinung nicht allein stand.) Kurz gesagt: Die beiden gingen sich nach Möglichkeit aus dem Weg, und wie gut sie daran taten, läßt sich an den unglücklichen Ereignissen ablesen, die auf Godfreys Tod folgten.
Unmittelbar vor seiner tödlichen Mission hatte Godfrey Winshaw einige Tage Urlaub in der friedlichen Atmosphäre von Winshaw Towers verbracht. Mildred hielt sich natürlich ebenfalls dort auf; sie war zu diesem Zeitpunkt seit mehreren Monaten mit ihrem ersten und einzigen Kind (einem Sohn, wie sich erweisen sollte) schwanger, und vermutlich war es die Aussicht, diese beiden Verwandten zu sehen, die Tabitha bewegte, ihr eigenes stattliches Anwesen zu verlassen und den Fuß über die Schwelle ihres verhaßten Bruders zu setzen. Obgleich Matthew Winshaw und seine Gemahlin noch lebten und sich bester Gesundheit erfreuten, beschränkte sich ihr Wirkungskreis mittlerweile hauptsächlich auf eine Reihe von Zimmern in einem abgeschlossenen Flügel von Winshaw Towers, und Lawrence hatte die Stelle des Hausherren eingenommen. Es wäre jedoch irreführend zu behaupten, er und seine Frau Beatrice seien gute Gastgeber gewesen. Lawrence wurde wie üblich stark von seinen Geschäften in Anspruch genommen, was bedeutete, daß er in seinem Arbeitszimmer stundenlange Telefongespräche führen und einmal sogar über Nacht nach London fahren mußte. (Dabei ließ er seine Gäste allein, ohne seine Abwesenheit zu erklären oder sich zu entschuldigen.) Beatrice machte keine Anstalten, die Verwandten ihres Bruders willkommen zu heißen, sondern zog sich unter dem Vorwand hartnäckiger Migräneanfälle regelmäßig in ihr Schlafgemach zurück und überließ die Gäste für den größten Teil ihres Aufenthaltes sich selbst. So waren Godfrey, Mildred und Tabitha auf sich allein gestellt – was ihren Wünschen vielleicht entgegenkam – und verlebten einige schöne Tage. Sie wandelten durch den Park und verbrachten angenehme Stunden in den weitläufigen Räumlichkeiten von Winshaw Towers.
Am Nachmittag des Tages, an dem Godfrey zum Luftwaffenstützpunkt Hucknall aufbrechen mußte – die erste Station bei einem Auftrag, von dem seine Frau und seine Schwester nur eine unbestimmte Vorstellung hatten –, führte er mit Lawrence im braunen Studierzimmer ein langes Gespräch. Worüber sie sprachen, wird für immer ein Geheimnis bleiben. Nach seiner Abreise beschlich beide Frauen ein Gefühl der Unruhe. Bei Mildred äußerte sich die natürliche Sorge einer Ehefrau und zukünftigen Mutter, deren Mann sich auf eine wichtige Mission mit ungewissem Ausgang begibt, bei Tabitha dagegen eine heftige, zügellose Erregung, die sich in einer gesteigerten Feindseligkeit gegenüber Lawrence manifestierte.
Wie irrational sie in dieser Hinsicht war, wird bereits an einem dummen Mißverständnis deutlich, zu dem es nur einige Tage zuvor gekommen war. Eines Abends zu später Stunde war sie, ohne anzuklopfen, in das Arbeitszimmer ihres Bruders getreten, wo er eines seiner geschäftlichen Telefonate führte, und hatte ihm einen Zettel entrissen, auf dem er – in ihrer Version dieses Zwischenfalls – geheime Anweisungen seines Gesprächspartners notiert hatte. Sie ging so weit zu behaupten, Lawrence habe, als sie ihn unterbrochen habe, »ein schuldbewußtes Gesicht« gemacht und versucht, den Zettel mit Gewalt wieder an sich zu bringen. Sie hatte das Stück Papier jedoch mit kindischem Trotz an sich gepreßt und es bei ihren persönlichen Papieren verwahrt. Später, als sie ihre wahnhafte Anschuldigung gegen Lawrence vorbrachte, drohte sie, das Schriftstück »als Beweis« vorzulegen. Glücklicherweise hatte der hervorragende Dr. Quince, seit Jahrzehnten bewährter Hausarzt der Winshaws, zu diesem Zeitpunkt bereits seine Diagnose gestellt, aus der hervorging, daß man gegenüber allen Behauptungen von seiten Tabithas in Zukunft größte Skepsis würde walten lassen müssen. Die Geschichte scheint das Urteil des Doktors übrigens zu bestätigen, denn als kürzlich einige Schriftstücke aus Tabithas Besitz in die Hände des Verfassers gelangten, war darunter auch die umstrittene Notiz. Sie ist inzwischen vergilbt und besteht aus einer von Lawrence eilig hingekritzelten Anweisung an den Butler, ihm in seinem Schlafzimmer einen abendlichen Imbiß zu servieren.
Tabithas Zustand verschlechterte sich nach Godfreys Abreise, und in der Nacht, in der er zu seinem letzten Flug aufbrach, ereignete sich ein sonderbarer Zwischenfall, ernster und grotesker als alle vorangegangenen. Ursache war eine weitere Wahnvorstellung Tabithas, nämlich daß ihr Bruder in seinem Schlafzimmer heimliche Unterredungen mit Spionen der Nazis führte. Wiederholt behauptete sie, vor der verschlossenen Schlafzimmertür gestanden und leises Stimmengemurmel in abgehacktem, befehlsgewohntem Deutsch gehört zu haben. Als schließlich selbst Mildred an der Wahrheit dieser Beobachtung zu zweifeln begann, unternahm Tabitha einen letzten Versuch, ihre Behauptung zu beweisen. Nachdem sie nachmittags den einzigen Schlüssel zum Schlafzimmer ihres Bruders an sich genommen hatte, wartete sie, bis sie überzeugt war, daß Lawrence wieder eines seiner niederträchtigen konspirativen Gespräche führte, schloß die Tür von außen ab und lief nach unten, wobei sie aus Leibeskräften schrie, sie habe ihren Bruder auf frischer Tat bei einem Verrat ertappt. Der Butler, die Dienstmädchen, das Küchenpersonal, der Chauffeur, der Kammerdiener, der Stiefeljunge und die anderen Bediensteten eilten sogleich herbei, dicht gefolgt von Mildred und Beatrice. Die ganze Gesellschaft, die sich in der großen Halle versammelt hatte, wollte sich gerade hinaufbegeben, um der Sache auf den Grund zu gehen, als Lawrence, ein Queue in der Hand, aus dem Billardsalon trat, wo er nach dem Essen einige Runden allein gespielt hatte. Selbstverständlich befand sich niemand in seinem Schlafzimmer, doch das zerstreute Tabithas Verdacht durchaus nicht; sie fuhr fort, ihren Bruder anzuschreien, und beschuldigte ihn aller möglichen Tricks und Schliche, bis man sie schließlich mit Gewalt in ihr Zimmer im Westflügel brachte, wo die für alle Eventualitäten gerüstete Schwester Gannet ihr ein Beruhigungsmittel verabreichte.
Dies war die Atmosphäre, die an jenem schrecklichen Abend in Winshaw Towers herrschte, als nächtliche Totenstille sich über das altehrwürdige Anwesen senkte, eine Stille, die um drei Uhr morgens durch das Schrillen des Telefons und die Nachricht von Godfreys furchtbarem Schicksal zerrissen wurde.
Die Leichen wurden nie geborgen – weder Godfrey noch seinem Kopiloten wurde ein christliches Begräbnis zuteil. Man hielt jedoch zwei Wochen später einen Gedenkgottesdienst in der privaten Kapelle der Winshaws ab. Seine Eltern saßen während der ganzen Zeremonie bleich und mit versteinerten Gesichtern da. Godfreys jüngerer Bruder Mortimer sowie seine Schwester Olivia und ihr Mann Walter waren aus Yorkshire angereist, um ihm die Ehre zu erweisen. Nur Tabitha fehlte. Sie war, kaum daß sie von Godfreys Tod erfahren hatte, in Raserei verfallen. Zu den Gegenständen, mit denen sie Lawrence angegriffen hatte, gehörten Kerzenleuchter, Golfschirme, Buttermesser, Rasiermesser, Reitgerten, ein Luffaschwamm, ein Golfschläger Nr. 4 und Nr. 7, eine afghanische Kriegstrompete von erheblichem historischen Wert, ein Nachttopf und eine Panzerabwehrkanone. Noch am folgenden Tag verfügte Dr. Quince ihre sofortige Einweisung in eine nahe gelegene Nervenheilanstalt.
Diese verließ sie in den folgenden neunzehn Jahren nicht ein einziges Mal. Auch trat sie nur selten mit den Mitgliedern ihrer Familie in Verbindung und zeigte keinerlei Interesse an ihren Besuchen. Ihr Geist (oder vielmehr seine kläglichen Überreste) beschäftigte sich ausschließlich mit den Umständen, die zum Tod ihres Bruders geführt hatten, und sie studierte mit zwanghaftem Eifer Bücher, wissenschaftliche Veröffentlichungen und Journale, die sich mit dem Kriegsverlauf, der Geschichte der Royal Air Force und allem, was auch nur entfernt mit der Fliegerei zu tun hatte, befaßten. (Ihr Name erscheint beispielsweise auf der Abonnentenliste von Zeitschriften wie Professional Pilot, Flypast, Jane’s MilitaryReview und Cockpit Quarterly.) Man hielt es für das klügste, sie in der Obhut geschulter, aufopferungsvoller Pfleger zu lassen – bis zum 16. September 1961, dem Tag, an dem man ihr auf Ersuchen ihres Bruders Mortimer die Erlaubnis gab, das Heim für einen Abend zu verlassen. Diese Entscheidung war zweifellos von Mitgefühl diktiert, sollte sich aber als verhängnisvoll erweisen.
In jener Nacht wurde Winshaw Towers ein zweites Mal vom Tod heimgesucht.
2
Rebecca saß am Erkerfenster des Schlafzimmers und sah hinaus auf die Ostterrasse und die öde Weite des Moors, das sich bis zum Horizont erstreckte. Mortimer legte seine Hand sanft auf ihre Schulter.
»Es wird schon gut werden«, sagte er.
»Ich weiß.«
Er tätschelte sie beruhigend und trat vor den Spiegel, um Fliege und Kummerbund zurechtzurücken.
»Das ist wirklich sehr nett von Lawrence. Eigentlich sind alle sehr nett. Ich hab noch nie erlebt, daß alle so nett zueinander sind.«
Es war Mortimers fünfzigster Geburtstag, und ihm zu Ehren veranstaltete Lawrence ein kleines, aber erlesenes Dinner, zu dem die ganze Familie – auch das schwarze Schaf Tabitha – eingeladen war. Rebecca, die dreizehn Jahre jünger war als ihr Mann und sich eine kindliche, zarte Schönheit bewahrt hatte, würde zum erstenmal alle auf einmal zu sehen bekommen.
»Sie sind ja keine Ungeheuer. Nicht wirklich jedenfalls.« Mortimer drehte seine linke Manschette um fünfzehn Grad und begutachtete kritisch das Ergebnis. »Ich meine, du magst doch Mildred, oder?«
»Aber sie gehört eigentlich nicht zur Familie.« Rebecca sah weiter aus dem Fenster. »Arme Milly. Zu schade, daß sie nie wieder geheiratet hat! Ich finde, Mark hat sich sehr zu seinem Nachteil entwickelt.«
»Ach, er ist nur in schlechte Gesellschaft geraten. Ist mir auch passiert, damals im Internat. In Oxford wird sich das schnell ändern.«
Rebecca wandte den Kopf – eine Geste der Ungeduld. »Immer nimmst du sie in Schutz. Ich weiß, daß sie alle mich nicht mögen. Sie haben uns nie verziehen, daß wir sie nicht zu unserer Hochzeit eingeladen haben.«
»Das war aber allein meine Entscheidung, nicht deine. Ich wollte nicht, daß sie alle kommen und dich anglotzen.«
»Na bitte. Du magst sie auch nicht. Es muß doch einen Grund dafür ...«
Ein diskretes Klopfen war zu hören, und im nächsten Augenblick erschien der ernste, hagere Butler in der Tür und trat respektvoll ein. »Es werden jetzt die Cocktails serviert, Sir. Im Vorzimmer des Salons.«
»Danke, Pyles.« Der Butler hatte kehrtgemacht und war schon fast hinaus, als Mortimer ihm nachrief: »Ach, Pyles?«
»Sir?«
»Würden Sie mal nach den Kindern sehen? Wir haben sie im Kinderzimmer gelassen. Schwester Gannet ist bei ihnen, aber Sie wissen ja, daß sie manchmal ... ein bißchen einnickt.«
»Sehr wohl, Sir.« Pyles hielt inne und sagte, bevor er hinausging: »Darf ich Ihnen im Namen des Personals unsere herzlichsten Glückwünsche aussprechen und der Hoffnung Ausdruck geben, daß sich dieser Tag noch oft wiederholen möge?«
»Danke, Pyles. Sehr freundlich.«
»Es ist mir ein Vergnügen, Sir.«
Er schloß schweigend die Tür. Mortimer ging zum Fenster und blieb hinter seiner Frau stehen, die noch immer auf die trostlose Landschaft starrte.
»Wir sollten lieber hinuntergehen.«
Rebecca rührte sich nicht.
»Den Kindern geht’s bestimmt gut. Pyles wird ein Auge auf sie haben. Er ist ein feiner Kerl.«
»Ich hoffe nur, daß sie nichts kaputtmachen. Sie spielen immer so wild, und wenn sie irgend etwas zerbrechen, wird Lawrence wieder endlos darauf herumreiten.«
»Roddy ist ein kleiner Rabauke. Er steckt Hilary an. Sie ist eigentlich ein liebes Mädchen.«
»Sie sind beide gleich ungezogen.«
Mortimer streichelte ihren Nacken. Er konnte ihre Nervosität spüren.
»Liebling, du zitterst ja.«
»Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist.« Er setzte sich neben sie. Unvermittelt barg sie ihr Gesicht an seiner Schulter, wie ein Vogel, der Zuflucht sucht. »Ich bin ganz nervös. Ich weiß gar nicht, wie ich ihnen gegenübertreten soll.«
»Wenn du dir Sorgen wegen Tabitha machst ...«
»Nicht nur wegen Tabitha.«
»... brauchst du keine Angst zu haben. Sie hat sieh in den letzten Jahren vollkommen verändert. Sie und Lawrence haben sich heute nachmittag sogar ein bißchen unterhalten. Ich glaube wirklich, daß sie die Sache mit Godfrey ganz und gar vergessen hat – sie weiß nicht mal mehr, wer er überhaupt war. Sie hat Lawrence diese freundlichen Briefe aus dem ... aus dem Heim geschickt, und er sagt, was ihn betrifft, so ist die ganze Angelegenheit vergeben und vergessen, also glaube ich nicht, daß wir heute abend von dieser Seite etwas zu befürchten haben. Die Ärzte sagen, daß sie wieder mehr oder weniger normal ist.«
Mortimer merkte, wie hohl seine Worte klangen, und ärgerte sich über sich selbst. Noch am selben Nachmittag hatte er gesehen, wie exzentrisch seine Schwester noch immer war. Er hatte sie überrascht, als er einen Spaziergang durch den hintersten, verwildertsten Teil des Parks gemacht hatte. Er war vom Hundefriedhof gekommen und wollte gerade den Krocketrasen überqueren, als er im dichten Unterholz Tabitha zu sehen glaubte. Um sie nicht zu erschrecken, trat er lautlos näher und stellte zu seiner Bestürzung fest, daß sie vor sich hin murmelte. Das Herz sank ihm: Offenbar war seine Einschätzung ihres Zustands zu optimistisch gewesen, und er hatte vielleicht zu voreilig darauf gedrungen, man solle sie an dieser Familienfeier teilnehmen lassen. Er konnte nichts von ihrem Gemurmel und Geflüster verstehen und räusperte sich höflich, worauf sie erschrocken aufschrie. Im Gebüsch raschelte es heftig, und wenige Sekunden später kam sie herausgekrochen. Sie zupfte nervös Zweige und Dornen von ihrem Kleid und brachte vor Verwirrung fast kein Wort heraus.
»Oh, Morty, ich wußte gar nicht ... Ich wollte nur ...«
»Ich wollte dir nicht nachspionieren, Tabs. Es ist nur ...«
»Nein, nein, schon gut. Ich hab einen kleinen Spaziergang gemacht, und da wollte ich ... Ich wollte mal nachsehen ... Du liebe Zeit, was mußt du von mir denken? Ich bin ganz durcheinander, und dabei bist du doch mein ...«
Ihre Stimme erstarb, und sie hüstelte hoch und nervös. Um die angespannte Stille zu durchbrechen, sagte Mortimer: »Großartig, dieser Park, nicht? Ich weiß nicht, wie sie es schaffen, ihn so gut zu pflegen.« Er holte tief Luft. »Wie der Jasmin duftet! Riechst du das?«
Tabitha hatte nicht geantwortet. Ihr Bruder hatte sich bei ihr untergehakt und war mit ihr zur Terrasse gegangen.
Rebecca gegenüber hatte er diesen Zwischenfall nicht erwähnt.
»Es ist nicht nur Tabitha. Es ist dieses ganze Haus.« Rebecca sah ihn an und blickte ihm zum erstenmal an diesem Abend tief in die Augen. »Wenn wir je hier leben müßten, würde ich sterben. Ganz bestimmt.« Sie erschauerte. »Dieses Haus hat etwas Unheimliches.«
»Warum sollten wir hier leben müssen? Was für ein absurder Gedanke!«
»Wer soll es denn übernehmen, wenn Lawrence nicht mehr da ist? Er hat keine Söhne, und du bist inzwischen sein einziger Bruder.«
Mortimer lachte ärgerlich – offensichtlich behagte ihm das Thema nicht. »Ich bezweifle sehr, daß ich Lawrence überleben werde. Er hat noch ein paar Jährchen vor sich.«
»Wahrscheinlich hast du recht«, sagte Rebecca schließlich. Sie warf einen letzten langen Blick auf das Moor, nahm dann ihre Perlenkette vom Frisiertisch und legte sie sorgfältig an. Draußen heulten hungrig die Hunde.
In der Tür, die von der Großen Halle zum Vorzimmer des Salons führte, blieben sie stehen. Rebecca hatte ihre schmale Hand in die von Mortimer gelegt. Sie sah sich einem ganzen Raum voller Winshaws gegenüber. Es waren nicht mehr als ein Dutzend, doch ihr kamen sie vor wie eine riesige, unüberschaubare Menge, deren wiehernde, blökende Stimmen zu einem einzigen Brei verschmolzen. Innerhalb von Sekunden hatte man sich auf sie und ihren Mann gestürzt. Sie wurden getrennt und von diesem oder jenem Grüppchen vereinnahmt, man tätschelte ihnen die Hand, klopfte ihnen auf die Schulter und küßte sie, man hieß sie willkommen und gratulierte ihnen, drückte ihnen ein Glas in die Hand, erkundigte sich nach ihrer Gesundheit und fragte, was es bei ihnen Neues gebe. Die Hälfte der Gesichter kannte Rebecca nicht; manchmal wußte sie nicht einmal, mit wem sie sich gerade unterhielt, und auch später blieb ihre Erinnerung an die Gespräche blaß und schemenhaft.
Doch wir sollten inzwischen die Gelegenheit nutzen und uns mit vier Mitgliedern der Familie näher bekanntmachen.
Beginnen wir mit Thomas Winshaw. Er ist fünfunddreißig und Junggeselle, und er muß sich immer noch vor seiner Mutter Olivia rechtfertigen, für die all seine glänzenden Erfolge in der Finanzwelt angesichts seines fortgesetzten Unvermögens, eine eigene Familie zu gründen, nicht zählen. Jetzt hört sie ihm mit verkniffenem Mund zu, während er sich bemüht, eine neue Entwicklung in seiner Karriere in einem besonders guten Licht darzustellen – eine Entwicklung, die sie offenbar noch dubioser als sonst findet.
»Heutzutage kann man unglaubliche Erträge erzielen, wenn man in Filme investiert, Mutter. Man muß nur einen einzigen großen Hit landen, und schon sitzt man auf einem riesigen Vermögen – genug, um ein Dutzend Reinfälle auszugleichen.«
»Wenn es dir nur um das Geld ginge, hättest du meinen Segen, und das weißt du auch«, sagt Olivia. Ihr Yorkshire-Akzent ist stärker als der ihrer Geschwister, aber ihre Mundwinkel sind ebenso humorlos nach unten verzogen. »Wenn es um Geld geht, bist du weiß Gott schon immer clever genug gewesen. Aber ich weiß von Henry, daß du ganz andere Motive hast, also versuch gar nicht erst, das zu bestreiten. Du bist hinter Schauspielerinnen her. Du willst ihnen eine Rolle versprechen können.«
»Manchmal redest du wirklich Unsinn, Mutter. Du solltest dich mal hören!«
»Ich will nur verhindern, daß irgendein Mitglied dieser Familie sich lächerlich macht. Die meisten dieser Frauen sind nichts anderes als Huren, und das Ende vom Lied wird sein, daß du dich mit einer ekligen Krankheit ansteckst.«
Doch Thomas, der für seine Mutter nichts anderes empfindet als für die meisten Menschen – nämlich eine solche Verachtung, daß er es selten für der Mühe wert hält, mit ihnen zu diskutieren –, lächelt nur. Irgend etwas an ihrer letzten Bemerkung scheint ihn zu amüsieren, und während er sich privaten Erinnerungen hingibt, bekommen seine Augen einen kalten Glanz. Er denkt gerade daran, daß seine Mutter völlig falsch liegt: Sein Interesse an jungen Schauspielerinnen, so groß es auch ist, beinhaltet keinen körperlichen Kontakt. In Wirklichkeit will er sie nicht berühren, sondern betrachten, und darum liegt der Reiz seiner neuen Rolle als Filmproduzent für Thomas hauptsächlich darin, jederzeit Zutritt zu den Studios zu haben. Er kann bei Szenen anwesend sein, die auf der Leinwand nur einen harmlosen Kitzel bewirken, bei deren Entstehung sich dem ernsthaften Voyeur aber echte Gelegenheiten bieten: Schlafzimmerszenen, Badezimmerszenen, Sonnenbadszenen, Szenen, in denen fehlende Bikinioberteile, sich auflösender Seifenschaum und fallende Handtücher eine Rolle spielen. Er hat Freunde, Spione, Günstlinge unter Schauspielern und Technikern, die ihm Bescheid geben, wenn eine solche Szene auf dem Drehplan steht. Er hat sogar schon Cutterinnen überredet, ihm Material zu überlassen, das herausgeschnitten wurde, weil man diese Szenen zu gewagt fand. (Anfangs hat Thomas nämlich in Komödien investiert, die mit eher bescheidenen Mitteln produziert wurden, in Unterhaltungsfilme von berechenbarer Popularität, mit Hauptdarstellern wie Sid James, Kenneth Connor, Jimmy Edwards und Wilfrid Hyde-White.) Aus diesem Material hat er sich seine Lieblingsbilder ausgewählt und Dias daraus gemacht, die er spätnachts, wenn all seine Angestellten nach Hause gegangen sind, an die Wand seines Büros in Cheapside projiziert. Das ist so viel sauberer, so viel persönlicher, so viel sicherer als die Mühsal, der er sich sonst unterziehen müßte: Er müßte Schauspielerinnen in sein Haus einladen und ihnen absurde Versprechungen machen – all dieser sanfte Druck, all dies Gefummel. Thomas ärgert sich über Henry, nicht so sehr, weil er ihrer Mutter ein Geheimnis verraten hat, sondern weil er zu glauben scheint, Thomas’ Motive könnten derart niedrig und gewöhnlich sein.
»Du solltest nicht auf das hören, was Henry dir erzählt«, sagt er mit einem kühlen Lächeln. »Schließlich ist er Politiker.«
Und da ist er auch schon: Henry, Thomas’ jüngerer Bruder, der bereits jetzt in dem Ruf steht, einer der ehrgeizigsten Labour-Abgeordneten seiner Generation zu sein. Die Beziehung zwischen den beiden Brüdern geht über die üblichen Blutsbande hinaus und schließt gemeinsame geschäftliche Interessen ein, denn Henry sitzt im Aufsichtsrat einiger Unternehmen, die von Thomas’ Bank großzügig unterstützt werden. Sollte jemand die Kühnheit besitzen zu behaupten, diese Tätigkeiten und die sozialistischen Ideale, für die Henry im Unterhaus so entschieden eintritt, ließen sich wohl kaum miteinander vereinbaren, so hat Henry eine ganze Reihe wohleinstudierter Entgegnungen parat. Er ist naive Fragen gewöhnt, und darum kann er auch so fröhlich lachen, als sein junger Cousin Mark ihm einen spöttischen Blick zuwirft und sagt: »Tja, du wirst dann wohl morgen in aller Frühe nach London fahren, damit du noch rechtzeitig zur Demonstration kommst, oder? Wir wissen doch alle, daß ihr Labour-Genossen mit diesen Abrüstungstypen unter einer Decke steckt.«
»Einige meiner Kollegen werden zweifellos da sein. Mich wirst du dort allerdings nicht finden. Abrüstung bringt einfach keine Stimmen. Die meisten Menschen hierzulande wissen genau, was diese Leute sind, die nach einseitiger Abrüstung schreien: ein Haufen Spinner.« Er hält inne und läßt von einem Diener ihre Champagnergläser nachfüllen. »Weißt du, was die beste Neuigkeit war, die ich diesen Monat gehört habe?«
»Daß Bertrand Russell eine Woche Knast gekriegt hat?«
Ich gebe zu, daß ich mir ein Lächeln nicht verkneifen konnte. Aber ich dachte mehr an Chruschtschow. Ich nehme an, du hast gehört, daß er wieder mit Wasserstoffbombentests angefangen hat, irgendwo in der Arktis oder so.«
»Tatsächlich?«
»Du kannst Thomas fragen, was ein paar Tage später mit den Munitionsfabrikaktien passiert ist. Die sind hochgeschossen wie Raketen. Wie Raketen. Wir haben über Nacht ein paar Hunderttausend verdient. Ich sage dir, vor ein paar Monaten, als Gagarin hier war und alle von Entspannung gefaselt haben, sah es nicht gut aus. Das hat mir ganz und gar nicht gefallen. Aber Gott sei Dank war das eine Eintagsfliege. Erst die Mauer, und dann fangen die Rußkis auch noch an, wieder mit Knallfröschen zu spielen. Es sieht so aus, als wären wir wieder im Geschäft.« Er trinkt sein Glas aus und klopft seinem Cousin liebevoll auf die Schulter. »Dir kann ich das natürlich sagen – du gehörst ja zur Familie.«
Mark Winshaw verarbeitet diese Information schweigend. Er hat, vielleicht weil er seinen Vater, Godfrey, nie kennengelernt hat, seine Cousins immer als Vaterfiguren und Vorbilder betrachtet. (Seine Mutter hat natürlich ebenfalls versucht, ihn zu führen und zu leiten und ihm ihre eigenen Werte und Wahrheiten zu vermitteln, doch hat er sie von klein auf bewußt ignoriert.) Thomas und Henry haben ihm schon eine Menge beigebracht: Wie man Geld macht und wie man die Streitigkeiten und Konflikte zwischen geringeren, schwächeren Menschen für seine eigenen Zwecke nützen kann. In ein paar Wochen wird er nach Oxford gehen, und in den Sommerferien hat er auf einem untergeordneten Posten in Thomas’ Bank in Cheapside gearbeitet.
»Es war wirklich nett von dir, ihm den Job zu geben«, sagt Mildred gerade zu Thomas. »Ich hoffe, er hat dir keinen Ärger gemacht.«
In Marks Augen steht unverhüllter Haß, doch niemand sieht es, und er sagt nichts.
»Aber ganz und gar nicht«, sagt Thomas. »Er hat sich sehr nützlich gemacht. Und er hat bei meinen Kollegen einen tiefen Eindruck hinterlassen. Einen sehr tiefen Eindruck.«
»Tatsächlich? Inwiefern?«
Thomas erzählt ihr von einer Diskussion zwischen Gesellschaftern der Bank, die sich an einem Freitag nachmittag zum Essen in der City getroffen hätten – einem Essen, zu dem Mark ebenfalls eingeladen gewesen sei. Bei dem Gespräch sei es um einen ehemaligen Gesellschafter gegangen, der sich wegen der Rolle der Bank in der Kuwait-Krise zurückgezogen habe. Thomas fühlt sich verpflichtet, Mildred die Einzelheiten dieser Krise zu erklären, denn er nimmt an, daß sie, eine Frau, nichts davon weiß. Kuwait, sagt er, sei im Juni zum unabhängigen Scheichtum erklärt worden, worauf Brigadegeneral Kassem nur eine Woche später die Absicht kundgetan habe, dieses Scheichtum seinem Land einzuverleiben, und zwar mit der Begründung, es sei schon immer ein »integraler Bestandteil« des Irak gewesen. Kuwait habe sich sogleich an die britische Regierung gewandt, mit der Bitte um militärische Unterstützung, die dann sowohl von Außenminister Lord Home als auch von Lordsiegelbewahrer Edward Heath zugesagt worden sei. Und seit der ersten Juliwoche seien mehr als sechstausend britische Soldaten von Kenia, Aden, Zypern, Deutschland und Großbritannien nach Kuwait verlegt worden, wo sie nur fünf Meilen hinter der Grenze eine sechzig Meilen lange Verteidigungslinie errichtet und sich auf einen irakischen Angriff eingerichtet hätten.
»Der springende Punkt war«, sagt Thomas, »daß einer der Juniorpartner, Pemberton-Oakes, nicht damit zurechtkam, daß wir den Irakern immer noch enorme Summen leihen, damit sie ihre Armee unterhalten können. Er sagte, sie seien unsere Feinde und wir befänden uns mehr oder weniger im Krieg mit ihnen und sollten ihnen überhaupt nicht helfen. Wir sollten aus Prinzip – ich glaube, das war das Wort, das er gebrauchte – die Kuwaitis unterstützen, auch wenn ihre Sicherheiten nicht gerade großartig seien und die Bank auf lange Sicht nicht viel daran verdienen werde. Tja, und schon war eine muntere Diskussion im Gange – der eine hat dies zu sagen, der andere jenes, und plötzlich kommt jemand auf die großartige Idee, unseren jungen Freund Mark nach seiner Meinung zu fragen.«
»Und was war seine Meinung?« fragt Mildred, und in ihrer Stimme ist ein resignierter Unterton.
Thomas schmunzelt. »Er sagte, für ihn sei der richtige Kurs ganz klar. Er meinte, wir sollten selbstverständlich beiden Seiten Geld leihen, und wenn es zum Kriegsausbruch käme, sollten wir ihnen noch mehr leihen, damit sie den Krieg so lange wie möglich führen können und immer mehr Material und Menschen verlieren und immer tiefer in unsere Schuld geraten. Du hättest ihre Gesichter sehen sollen! Wahrscheinlich hatten das alle gedacht, aber er hatte als einziger den Mumm, es auch auszusprechen.« Er wendet sich zu Mark, dessen Gesicht die ganze Zeit vollkommen ausdruckslos geblieben ist. »Mein lieber Mark, du wirst es im Bankgeschäft noch weit bringen. Noch sehr weit.«
Mark lächelt. »Ach, ehrlich gesagt glaube ich nicht, daß das etwas für mich wäre. Ich will mich mehr ins Getümmel stürzen. Trotzdem danke, daß du mir diese Gelegenheit gegeben hast. Ich hab dabei das eine oder andere gelernt.«
Er dreht sich um und durchquert den Raum und weiß, daß die Augen seiner Mutter ihm folgen.
Mortimer geht auf Dorothy Winshaw zu, die Tochter von Lawrence und Beatrice. Sie hat ein kaltes, gerötetes Gesicht und steht allein in einer Ecke. Wie immer hat sie die Lippen zu einem verdrießlichen, bösen Schmollmund verzogen.
»Ah, sieh da«, sagt Mortimer und bemüht sich, freudige Überraschung in seine Stimme zu legen. »Na, wie geht’s meiner Lieblingsnichte?« (Dorothy ist, nebenbei gesagt, seine einzige Nichte, und darum ist diese Anrede ein ganz klein wenig unaufrichtig.) »Der große Tag ist nicht mehr fern. Schon ein bißchen aufgeregt?«
»Ja, ja«, sagt Dorothy und klingt alles andere als aufgeregt. Mortimer spielt auf die Tatsache an, daß sie sich in Kürze, mit fünfundzwanzig Jahren, mit George Brunwin verheiraten wird, einem der erfolgreichsten und beliebtesten Grundbesitzer des Landes.
»Ach, nun komm schon«, sagt Mortimer. »Du fühlst dich doch sicher ... äh ...«
»Ich fühle mich genau so, wie sich jede Frau fühlen würde, die weiß, daß sie demnächst einen der größten Idioten der Welt heiraten wird«, erwidert Dorothy.
Mortimer sieht sich um, ob ihr Verlobter, der ebenfalls eingeladen ist, diese Bemerkung gehört haben könnte. Dorothy scheint das nicht zu kümmern.
»Was meinst du denn damit?«
»Ich meine damit, daß wir, wenn er nicht ganz schnell erwachsen wird und merkt, daß wir im zwanzigsten Jahrhundert leben, bettelarm sein werden.«
»Aber Brunwin leitet eine der besten Farmen weit und breit. Das weiß jeder.«
Dorothy schnaubt verächtlich. »Daß George vor zwanzig Jahren Landwirtschaft studiert hat, heißt nicht, daß er auch nur die leiseste Ahnung hat, was in der modernen Welt passiert. Du lieber Himmel, er weiß nicht mal, was ein Effizienzfaktor ist!«
»Ein Effizienzfaktor?«
»Das ist das Verhältnis«, erklärt Dorothy geduldig, als hätte sie es mit einem einfältigen Stallburschen zu tun, »zwischen dem, was man in ein Tier hineinsteckt, und dem, was man am Ende in Form von Fleisch wieder herausbekommt. Man braucht nur ein paar Nummern von Farming Express gelesen zu haben, um Bescheid zu wissen. Du hast doch bestimmt schon mal von Henry Saglio gehört, oder?«
»Äh ... ein Politiker?«
»Henry Saglio ist ein amerikanischer Hühnerfarmer, bei dem sich die englische Hausfrau nur bedanken kann. Er hat eine neue Rasse von Masthähnchen gezüchtet, die in neun Wochen dreieinhalb Pfund schwer werden, bei einem Futtereffizienzfaktor von 2,3. Er geht nach modernsten Methoden der Intensivwirtschaft vor.« Dorothy erwärmt sich für das Thema, wie es Mortimer bei ihr noch nie erlebt hat. Ihre Augen glühen. »Und George, dieser Einfaltspinsel, läßt seine Hühner noch immer unter freiem Himmel herumscharren, als wären sie Haustiere. Ganz zu schweigen von seinen Mastkälbern, die auf Stroh schlafen dürfen und wahrscheinlich mehr Auslauf kriegen als seine blöden Hunde. Und dann wundert er sich, warum sie kein gutes weißes Fleisch geben!«
»Tja, ich weiß nicht ...«, sagt Mortimer. »Vielleicht denkt er an andere Dinge. Vielleicht setzt er andere Prioritäten.«
»Andere Prioritäten?«
»Na ja, das ... Wohlergehen der Tiere. Die Atmosphäre auf seiner Farm.«
»Die Atmosphäre?«
»Manchmal gibt es im Leben Wichtigeres als den Profit, Dorothy.«
Sie starrt ihn an. Ihre patzige Antwort entspringt vielleicht der Wut darüber, daß er in einem Ton mit ihr redet, den sie von früher kennt: Es ist der Ton, in dem ein Erwachsener mit einem vertrauensvollen Kind spricht.
»Daddy hat immer schon gesagt, du und Tante Tabitha, ihr seid die Verrückten in dieser Familie.«
Sie stellt ihr Glas ab, schiebt ihren Onkel beiseite und geht mit raschen Schritten zu einem Grüppchen am anderen Ende des Raums.
Im Kinderzimmer finden wir zwei weitere Winshaws, die eine Rolle in der Familiengeschichte spielen werden. Roddy und Hilary sind neun und sieben Jahre alt. Sie haben keine Lust mehr, mit Schaukelpferden, Modelleisenbahnen, Tischtennis-Sets und Puppen zu spielen. Sie haben auch keine Lust mehr zu versuchen, Schwester Gannet zu wecken, indem sie ihr die Nase mit einer Feder kitzeln. (Die Feder stammt übrigens von einem Spatzen, den Roddy am Nachmittag mit dem Luftgewehr erlegt hat.) Sie sind kurz davor, sich aus dem Kinderzimmer zu schleichen und nach unten zu gehen, um zu lauschen – auch wenn ihnen der Gedanke an die langen, schwach beleuchteten Flure und Treppen, ehrlich gesagt, ein bißchen angst macht –, als Roddy eine Idee hat.
»Ich weiß was!« sagt er, stürzt sich auf ein kleines Tretauto und zwängt sich mit Mühe auf den Fahrersitz. »Ich bin Juri Gagarin, und das hier ist meine Raumkapsel, und ich bin gerade auf dem Mars gelandet.«
Wie jeder Junge seines Alters bewundert Roddy den jungen Kosmonauten. Vor ein paar Monaten hat er Gagarin gesehen, als dieser die Ausstellung im Earl’s Court besuchte, und Mortimer hat Roddy hochgehoben, so daß er dem Mann, der eine Reise zu den Sternen gemacht hat, sogar die Hand schütteln konnte. Jetzt sitzt er in dem viel zu kleinen Auto, beginnt mit aller Kraft zu treten und gibt gutturale Motorengeräusche von sich. »Gagarin an Bodenstation, Gagarin an Bodenstation. Können Sie mich empfangen?«
»Und wer soll ich sein?« fragt Hilary.
»Du kannst Laika sein, die russische Weltraumhündin.«
»Aber die ist doch tot. Sie ist in der Rakete gestorben. Onkel Henry hat es mir erzählt.«
»Du kannst ja einfach so tun als ob.«
Also krabbelt Hilary auf allen vieren herum, bellt ausgiebig, schnuppert an marsianischen Felsbrocken und scharrt im Staub. Nach etwa zwei Minuten hat sie genug davon. »Das ist langweilig.«
»Halt’s Maul. Major Gagarin ruft Bodenstation. Ich bin auf dem Mars gelandet und suche jetzt nach Anzeichen für intelligentes Leben. Bis jetzt sehe ich nur ... Heh, was ist das?« Auf dem Fußboden glitzert etwas. Er tritt in die Pedale, doch Hilary ist schneller als er.
»Eine halbe Krone!«
Sie hat ihre Hand auf die Münze gelegt, und ihre Augen funkeln triumphierend. Major Gagarin steigt aus seiner Raumkapsel und baut sich vor ihr auf.
»Ich hab’s zuerst gesehen. Her damit!«
»Das könnte dir so passen.«
Langsam, aber mit Bedacht, stellt Roddy seinen Fuß auf Hilarys Hand und verlagert sein Gewicht darauf. »Gib das Geld her!«
»Nein!«
Als Roddy den Druck vergrößert, schreit Hilary immer lauter. Plötzlich hört man ein Knacken – das Brechen und Splittern von Knochen. Hilary brüllt, während ihr Bruder sich bückt und das Geldstück seelenruhig und zufrieden aufhebt. Blut ist auf dem Boden. Hilary sieht es, und ihre Schreie werden schriller und durchdringender, bis sie laut genug sind, um Schwester Gannet aus ihrem Kakaoschlaf zu wecken.
Die Dinnerparty geht ihren Gang. Die Gäste haben ihren Appetit mit einer leichten Suppe aus Kürbis und Rahmkäse angeregt und kurzen Prozeß mit der in trockenem Martini gedämpften und mit einer Nesselsauce angerichteten Forelle gemacht. Während sie auf den dritten Gang warten, entschuldigt sich Lawrence, der am Kopfende des Tisches sitzt, und verläßt den Raum. Bei seiner Rückkehr bleibt er an der Mitte des Tisches bei Mortimer, dem Ehrengast, stehen, um sich diskret nach dem Befinden ihrer Schwester zu erkundigen.
»Was meinst du: Steht unsere Familienidiotin das durch?« flüstert er.
Mortimer verzieht das Gesicht und antwortet in vorwurfsvollem Ton: »Falls du Tabitha meinst, kann ich nur sagen, daß sie sich tadellos benimmt. Nicht anders, als ich es erwartet habe.«
»Ich hab euch heure nachmittag gesehen, wie ihr auf dem Krocketrasen einen kleinen Plausch gehalten habt. Du hast ein ziemlich ernstes Gesicht gemacht. Ich hoffe, es gab keine Probleme.«
»Natürlich nicht. Wir haben bloß einen Spaziergang gemacht.« Mortimer sieht eine Möglichkeit, das Thema zu wechseln. »Der Park ist übrigens großartig in Schuß. Besonders der Jasmin. Der Duft ist wirklich atemberaubend. Du mußt mir irgendwann mal dein Geheimrezept verraten.«
Lawrence lacht böse. »Manchmal glaube ich wirklich, du bist genauso verrückt wie sie. Ich kann dir versichern, daß es im ganzen Park keinen Jasmin gibt. Nicht das kleinste Zweiglein.« Er hebt den Kopf und sieht, daß eine silberne Terrine hereingetragen wird. »Ah, da kommt der nächste Gang.«
Rebecca befaßt sich gerade mit ihrem Hasenrücken in Currysauce, als sie hinter sich ein diskretes Hüsteln hört.
»Was gibt es, Pyles?«
»Wenn ich Sie kurz sprechen dürfte, Mrs. Winshaw – es handelt sich um eine Angelegenheit von einiger Dringlichkeit.« Sie folgt ihm in den Verbindungskorridor, und als sie eine Minute später zurückkehrt, ist sie leichenblaß.
»Die Kinder«, berichtet sie ihrem Mann. »Es hat im Kinderzimmer einen dummen Unfall gegeben. Hilary hat sich an der Hand verletzt. Ich muß mit ihr ins Krankenhaus.«
Mortimer erschrickt und erhebt sich halb von seinem Stuhl. »Etwas Ernstes?«
»Ich glaube nicht. Aber sie ist ganz durcheinander.«
»Ich komme mit.«
»Nein, nein, du mußt hierbleiben. Es wird nicht länger als eine Stunde dauern. Bleib hier und genieß dein Fest.«
Aber Mortimer genießt sein Fest ganz und gar nicht. Das einzige Angenehme an diesem Fest war die Anwesenheit seiner Frau. In den letzten Jahren ist Rebecca für ihn immer mehr zu einem Schutz vor seiner verhaßten Familie geworden. Jetzt, da sie fort ist, muß er sich notgedrungen den größten Teil des Abends anhören, was seine Schwester Olivia zu sagen hat, die spröde, sauertöpfische Olivia, die gnadenlos auf ihn einredet. Es geht um die Verwaltung ihres Besitzes und die Erträge ihrer Aktienpakete, um die bevorstehende Erhebung ihres Mannes in den niederen Adelsstand für seine Verdienste um die Industrie und schließlich um die politische Zukunft ihres Sohnes Henry, der wenigstens clever genug gewesen ist zu erkennen, daß die Labour Party ihm die besten Chancen bietet, mit vierzig auf einem Ministersessel zu sitzen. Mortimer nickt ergeben zu diesem Monolog und mustert zwischendurch die anderen Gesichter am Tisch: Dorothy schaufelt das Essen in sich hinein, ihr einfältiger Verlobter sitzt verdrossen neben ihr, Marks berechnender, verschlagener Blick gleitet unablässig und wachsam von einem zum anderen, die unschuldige, verwirrte Mildred erzählt Thomas zaghaft eine Anekdote, und der hört mit dem kalten Desinteresse eines Handelsbankiers zu, der gleich einem kleinen Geschäftsmann den Kredit verweigern wird. Und schließlich ist da noch Tabitha, die sich kerzengerade hält und kein Wort sagt. Mortimer bemerkt, daß sie alle paar Minuten auf ihre Taschenuhr sieht und mehr als einmal einen der Diener bittet, auf der Standuhr im Korridor nachzusehen, wie spät es ist. Im übrigen sitzt sie reglos da und starrt Lawrence unverwandt an. Es scheint fast, als warte sie auf etwas.
Kurz bevor der Kaffee serviert wird, ist Rebecca aus dem Krankenhaus zurück. Unauffällig setzt sie sich auf ihren Platz und drückt ihrem Mann beruhigend die Hand.
»Alles in Ordnung«, sagt sie. »Schwester Gannet bringt sie gerade ins Bett.«
Lawrence erhebt sich, klopft mit dem Dessertlöffel auf den Tisch und bringt einen Toast aus.
»Auf Mortimer und seinen fünfzigsten Geburtstag!« sagt er. »Gesundheit, Glück und ein langes Leben!«
Es erklingt ein gemurmeltes Echo aus »Mortimer« und »Gesundheit, Glück und langes Leben«, und die Gäste leeren ihre Gläser. Man hört ein lautes, zufriedenes Seufzen, und jemand sagt: »Es war wirklich ein besonders schöner Abend.«
Alle wenden den Kopf. Tabitha hat gesprochen.
»Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schön es ist, mal rauszukommen. Wenn nur ...« Sie runzelt die Stirn und macht ein gedankenverlorenes, trauriges Gesicht. »Ich muß immer daran denken, wie schön es wäre, wenn Godfrey heute abend unter uns sein könnte.«
Es entsteht eine peinliche Stille. Schließlich sagt Lawrence in einem Versuch jovialer Verbindlichkeit: »Ganz recht, ganz recht.«
»Er hatte Mortimer so gern. Morty war ganz eindeutig sein Lieblingsbruder. Das hat er mir oft gesagt. Mortimer war ihm viel lieber als Lawrence. Daran hat er nie einen Zweifel gelassen.« Sie runzelt abermals die Stirn und läßt ihren Blick über die Anwesenden gleiten. »Ich frage mich, wieso wohl.«
Niemand antwortet. Niemand sieht sie an.
»Ich glaube ... Ich glaube, er wußte, daß Mortimer ihm nie nach dem Leben getrachtet hat.«
Sie sieht ihre Verwandten der Reihe nach an, als suche sie nach Bestätigung. Es herrscht entsetztes, absolutes Schweigen.
Tabitha legt ihre Serviette auf den Tisch, schiebt ihren Stuhl zurück und steht mühsam auf. »Tja, für mich ist es Zeit, zu Bett zu gehen. Den Holzweg hinauf ins Federnland, wie Nanny immer sagte.«
Sie geht zur Tür, und es ist schwer zu sagen, ob sie noch zu den anderen oder nur mit sich selbst spricht. »Hinauf, hinauf, wo mein Bettchen steht, wo ich niederknie und sprech mein Gebet.« Sie bleibt stehen und dreht sich um. Ihre nächste Frage ist ohne jeden Zweifel an ihren Bruder gerichtet. »Sprichst du eigentlich noch dein Nachtgebet, Lawrence?«
Er gibt keine Antwort.
»Wenn ich du wäre, würde ich es heute abend tun.«
Rebecca fühlte nichts mehr. Sie ließ sich in die dicken Kissen zurücksinken, spreizte leicht die Beine und massierte die schmerzende Stelle an ihrem Oberschenkel. Neben ihr sank Mortimer, den Kopf schwer auf ihre Schulter gebettet, bereits in den Schlaf. Er hatte fast vierzig Minuten gebraucht. Es dauerte jedesmal länger, und obwohl er alles in allem sanft und rücksichtsvoll war, fand Rebecca diese Marathonveranstaltungen langsam etwas ermüdend. Ihr Rücken tat weh, und ihr Mund war wie ausgetrocknet, doch sie konnte sich nicht nach dem Wasserglas auf dem Nachttisch strecken, ohne ihren Mann zu stören.
Er begann schläfrig, zusammenhangslose Satzfetzen zu murmeln. Sie strich ihm über das schüttere Haar.
»... würde ich ohne dich ... so lieb ... machst alles erträglich ... alles gut ...«
»Ist ja gut«, flüsterte sie. »Morgen fahren wir nach Hause. Jetzt hast du es überstanden.«
»... hasse sie alle ... wenn du nicht da wärst ... sie manchmal am liebsten umbringen ... alle umbringen ...«
Sie hoffte, daß Hilary schlafen konnte. Drei Finger waren gebrochen. Die Geschichte von dem Unfall hatte Rebecca nicht geglaubt, nicht eine Sekunde lang. Roddy war in letzter Zeit alles zuzutrauen. Zum Beispiel diese Fotos, mit denen sie ihn erwischt hatte ... Wie sich herausgestellt hatte, waren sie ein Geschenk von Thomas gewesen, diesem Mistkerl ...
Eine halbe Stunde später, um Viertel vor zwei, schnarchte Mortimer sanft und ruhig, doch Rebecca war noch immer hellwach. Mit einemmal hörte sie Schritte auf dem Korridor. Jemand schlich an ihrer Tür vorbei.
Dann begann der Lärm. Es rumpelte und krachte – unverkennbar war ein Kampf im Gange. Es schienen zwei Männer zu sein, die ihre ganze Kraft einsetzten und was immer in Griffweite war als Waffe gebrauchten. Sie ächzten vor Anstrengung, sie schrien und fluchten. Rebecca hatte gerade ihren Morgenrock angezogen und das Licht eingeschaltet, als sie einen langgezogenen, schrecklichen Schrei vernahm, viel lauter als die Geräusche zuvor. Überall in Winshaw Towers wurde Licht gemacht, und Rebecca hörte Schritte, die in die Richtung des Aufruhrs eilten. Sie selbst blieb, vor Angst wie versteinert, wo sie war. Obgleich sie etwas Derartiges noch nie gehört hatte, wußte sie, was das gewesen war: der Todesschrei eines Menschen.
Zwei Tage später erschien in der örtlichen Zeitung folgender Artikel:
Versuchter Einbruch in Winshaw TowersHausherrtötet Einbrecher
Dramatische Szenen haben in der vergangenen Samstagnacht in Winshaw Towers zu dem tragischen Ende einer Familienfeier geführt.
Vierzehn Gäste hatten sich anläßlich des fünfzigsten Geburtstags von Mortimer Winshaw in dem dreihundert Jahre alten Anwesen seines älteren Bruders Lawrence eingefunden. Kurz nachdem man zu Bett gegangen war, drang ein bisher nicht identifizierter Mann in das Anwesen ein, was ihn wenig später das Leben kosten sollte.
Der Einbrecher verschaffte sich offenbar durch das gewöhnlich fest verschlossene Fenster der Bibliothek Zugang zum Haus. Anschließend betrat er Lawrence Winshaws Schlafzimmer, wo es zu einem heftigen Kampf kam, in dessen Verlauf Mr. Winshaw dem Einbrecher in Selbstverteidigung einen tödlichen Schlag mit einem kupfernen Rückenkratzer versetzte, der immer auf seinem Nachttisch liegt. Der Einbrecher war auf der Stelle tot.
Die Polizei hat den Angreifer, der nicht aus dieser Gegend zu stammen scheint, bislang nicht identifizieren können, ist jedoch überzeugt, daß er es auf Wertgegenstände abgesehen hatte. Ein Polizeisprecher schloß eine Anklage gegen den Hausherrn aus und fügte hinzu, Mr. Winshaw habe infolge des Zwischenfalls einen schweren Schock erlitten.
Die Ermittlungen dauern an. Wir werden unsere Leser über die weiteren Ergebnisse auf dem laufenden halten.
Am Sonntag morgen, dem Tag nach seiner Geburtstagsfeier, war Mortimer innerlich zerrissen. Sein Familiensinn – oder vielmehr jener kleine, in den abgelegenen Winkeln seines Herzens noch verborgene Rest davon – sagte ihm, er müsse bei seinem Bruder bleiben und ihm nach diesem Schock beistehen, während sich zugleich nicht verbergen ließ, daß Rebecca Winshaw Towers so bald wie möglich verlassen und zu ihrer Wohnung in Mayfair zurückkehren wollte. Letzlich fiel Mortimer die Entscheidung nicht schwer. Er konnte seiner Frau ohnehin nichts abschlagen, und außerdem waren genug Winshaws da, die sich seines Bruders annehmen und ihm über diese schwere Zeit hinweghelfen würden. Um elf Uhr stand das Gepäck in der Halle bereit, um in den silbergrauen Bentley geladen zu werden, und Mortimer war auf dem Weg, sich von Tabitha zu verabschieden, die, seit ihr der schreckliche Vorfall zu Ohren gekommen war, ihr Zimmer nicht verlassen hatte.
Als er am Ende des Hauptkorridors Pyles sah, winkte er ihn zu sich.
»Hat Dr. Quince heute morgen nach Miss Tabitha gesehen?« fragte er.
»Ja, Sir. Er hat sie recht früh aufgesucht, etwa um neun Uhr.«
»Ich verstehe. Ich möchte nicht ... Ich hoffe, das Hauspersonal denkt nicht, daß sie mit ... diesen Ereignissen irgend etwas zu tun hat.«
»Was die anderen Dienstboten denken, entzieht sich meiner Kenntnis, Sir.«
»Natürlich, natürlich. Wenn Sie bitte dafür sorgen würden, daß unser Gepäck eingeladen wird, Pyles. Ich werde mich inzwischen von meiner Schwester verabschieden.«
»Sehr wohl, Sir. Erlauben Sie mir zu bemerken, Sir: Ich glaube, Ihre Schwester hat im Augenblick Besuch.«
»Besuch?«
»Vor etwa zehn Minuten kam ein Gentleman und fragte nach ihr, Sir. Burrows hat ihm geöffnet und ihn bedauerlicherweise zu Miss Tabithas Zimmer geführt.«
»Ich verstehe. Ich werde mal nachsehen.«
Eilig stieg Mortimer die Treppen zu dem Stockwerk hinauf, in dem sich das Zimmer seiner Schwester befand, und blieb vor der Tür stehen. Drinnen war es still. Erst geraume Zeit nachdem er geklopft hatte, hörte er Tabitha mit brüchiger, ausdrucksloser Stimme »Herein!« rufen.
»Ich wollte nur auf Wiedersehen sagen«, erklärte er und überzeugte sich mit einem Blick davon, daß sie allein war.
»Auf Wiedersehen«, sagte Tabitha. Sie strickte an etwas Großem, Purpurrotem, Formlosem, und eine Ausgabe von Spitfire! lag aufgeschlagen auf dem Tisch neben ihr.
»Wir sollten uns öfter sehen«, fuhr Mortimer nervös fort. »Kommst du uns vielleicht mal in London besuchen?«
»Das bezweifle ich«, antwortete sie. »Dr. Quince war heute morgen hier, und ich weiß, was das bedeutet. Sie werden versuchen, mir das, was gestern nacht passiert ist, in die Schuhe zu schieben, und mich wieder in die Anstalt stecken.« Sie lachte und zuckte ihre knochigen Schultern. »Ach, was soll’s. Ich hab meine Chance verspielt.«
»Deine Chance ...?« Mortimer hielt inne. Er ging zum Fenster und sagte, so beiläufig wie möglich: »Na ja, es gibt da einige ... Umstände, die man sich bisher nicht erklären kann. Zum Beispiel das Fenster in der Bibliothek: Pyles schwört, daß es fest verschlossen war, und trotzdem scheint der Einbrecher, wer immer es war, nicht gewaltsam eingedrungen zu sein. Du weißt wohl nicht zufällig ...« Er sprach den Satz nicht zu Ende.
»Nun sieh dir an, was du mit deinem Geplapper angerichtet hast«, sagte Tabitha. »Ich hab eine Masche fallen lassen.«
Mortimer erkannte, daß er seine Zeit verschwendete. »Tja, dann werde ich mal ...«
»Gute Reise«, sagte Tabitha, ohne aufzusehen.
In der Tür blieb Mortimer stehen. »Übrigens«, sagte er, »wer hat dich eigentlich eben besucht?«
Sie sah ihn ausdruckslos an. »Besucht?«
»Pyles sagt, vor ein paar Minuten hat dich ein Mann besucht.«
»Nein, da hat er sich geirrt.«
»Ich verstehe.« Mortimer holte tief Luft und wollte gerade gehen, als ihm etwas auffiel. Er runzelte die Stirn und drehte sich um. »Bilde ich mir das ein, oder ist hier wirklich ein eigenartiger Geruch im Raum?« fragte er.
»Das ist Jasmin«, sagte Tabitha und sah ihn zum erstenmal strahlend an. »Herrlich, nicht?«
3
Damals war Juri mein alles überragender Held. Meine Eltern schnitten alle Fotos von ihm aus, und ich befestigte sie mit Reißnägeln an einer Wand in meinem Zimmer. Inzwischen ist sie neu tapeziert worden, aber früher konnte man, noch viele Jahre nachdem die Bilder abgenommen worden waren, die Löcher sehen, welche die Reißnägel hinterlassen haben: winzige Punkte, die in einem willkürlichen, phantastischen Muster über die Wand verteilt waren wie Sterne. Ich wußte, daß Gagarin kürzlich in London gewesen war. Ich hatte im Fernsehen gesehen, wie er durch von winkenden Menschen gesäumte Straßen gefahren war. Ich hatte gehört, daß er die Ausstellung im Earl’s Court besucht hatte, und das Wissen, daß er Hunderten von Kindern die Hand geschüttelt hatte, machte mich gelb vor Neid auf diese Glückspilze. Trotzdem war ich nicht auf den Gedanken gekommen, meine Eltern zu fragen, ob sie mit mir dorthin fahren würden. Eine Fahrt nach London wäre für meine Familie ein ebenso kühnes, ehrgeiziges Unterfangen gewesen wie eine Reise zum Mond.
Doch dann kam mein neunter Geburtstag, und mein Vater schlug zwar keine Reise zum Mond vor, aber immerhin einen kleinen Flug durch die Stratosphäre in Form eines Ausflugs nach Weston-super-Mare. Man versprach mir einen Besuch der kürzlich eröffneten Modelleisenbahn und des Aquariums und sagte, wenn das Wetter schön sei, würden wir ins Freibad gehen. Es war Mitte September, der 17. September 1961, um genau zu sein. Meine Großeltern waren ebenfalls eingeladen, und damit meine ich die Eltern meiner Mutter, denn mit denen meines Vaters hatten wir nichts zu tun. Ich wußte zwar, daß sie noch lebten, doch so weit ich zurückdenken konnte, hatten wir nie etwas von ihnen gehört. Möglicherweise hielt mein Vater Kontakt mit ihnen, ohne daß wir es merkten, auch wenn ich das bezweifle. Er zeigte seine Gefühle nie offen, und selbst heute könnte ich nicht sagen, ob er seine Eltern sehr vermißte oder nicht. Jedenfalls kam er mit Grandma und Grandpa ganz gut zurecht und hatte sich im Lauf der Jahre ein dickes Fell gegen Grandpas gutmütige, aber unablässige Sticheleien zugelegt. Ich glaube, meine Mutter hatte ihre Eltern zu diesem Ausflug eingeladen, wahrscheinlich ohne meinen Vater zu fragen. Trotzdem gab es deswegen keine Unstimmigkeiten. Meine Eltern stritten sich nie. Mein Vater murmelte bloß, er hoffe, sie würden hinten sitzen.
Doch natürlich mußten die Frauen hinten sitzen, und ich zwischen ihnen. Grandpa saß auf dem Beifahrersitz, auf dem Schoß einen Straßenatlas und auf dem Gesicht ein versonnenes, heiteres Lächeln – ein sicheres Zeichen dafür, daß mein Vater sich auf einen harten Tag gefaßt machen mußte. Sie hatten sich bereits darüber gestritten, mit welchem Wagen wir fahren sollten. Der Volkswagen meiner Großeltern war alt und unzuverlässig, aber mein Großvater ließ keine Gelegenheit aus, sich über die britischen Wagen lustig zu machen, die mein Vater, der in einem kleinen Zuliefererbetrieb arbeitete, aus Loyalität zu seinen Arbeitgebern und zu seinem Land kaufte.
»Daumen drücken«, rief Grandpa, als mein Vater den Zündschlüssel drehte, und als der Wagen beim ersten Versuch ansprang, sagte er: »Es geschehen noch Zeichen und Wunder.«
Ich hatte zum Geburtstag ein Reiseschachspiel bekommen, und Grandma und ich machten, um uns die Zeit zu vertreiben, ein paar Spiele. Keiner von uns beiden kannte die Regeln auch nur entfernt, aber das wollten wir nicht zugeben, und so behalfen wir uns mit einer Improvisation, die eine Mischung aus Dame und Tischfußball war, Meine Mutter war so nachdenklich und in sich gekehrt wie immer und sah nur aus dem Fenster; vielleicht hörte sie auch dem Gespräch der beiden Männer auf den Vordersitzen zu.
»Was ist los?« fragte Grandpa. »Versuchst du, Benzin zu sparen, oder was?«
Mein Vater reagierte nicht.
»Hier darfst du siebzig fahren«, fuhr Grandpa fort. »Ich hab vorhin das Schild gesehen.«
»Wir wollen nicht zu früh da sein. Schließlich sind wir nicht in Eile.«
»Tja, wahrscheinlich fängt diese Rostlaube an zu klappern, wenn du schneller als sechzig fährst. Außerdem wollen wir ja heil ankommen, nicht? Paß aber auf – ich glaube, der Radfahrer hinter uns will überholen.«
»Sieh mal, Michael: Kühe«, sagte meine Mutter, um mich abzulenken.
»Wo?«
»Auf der Wiese da.«
»Der Junge weiß, wie Kühe aussehen«, sagte Grandpa. »Laß ihn in Frieden. Hört ihr auch dieses Rasseln?«
Niemand hörte ein Rasseln.
»Ich höre es ganz genau. Wahrscheinlich geht gerade ein Lager oder so kaputt.« Er wandte sich an meinen Vater. »Welches Teil von diesem Wagen hast du noch mal entworfen, Ted? War es nicht der Aschenbecher?«
»Die Lenksäule«, sagte mein Vater.
»Sieh mal, Michael: Schafe.«
Wir parkten an der Promenade. Die Federwölkchen am Himmel erinnerten mich an Zuckerwatte, und die anschließende Assoziationskette führte mich zwangsläufig zu einem Verkaufsstand am Pier, wo meine Großeltern mir einen riesigen rosigen Ball dieser pappsüßen Ambrosia kauften sowie eine Zuckerstange, die ich für später aufhob. Normalerweise hätte mein Vater eine Bemerkung über die psychologisch wie zahnmedizinisch fatalen Folgen eines solchen Geschenkes gemacht, doch weil ich Geburtstag hatte, ließ er es durchgehen. Ich setzte mich auf eine niedrige Mauer mit Blick auf das Meer, machte mich über die Zuckerwatte her und genoß den köstlichen Widerspruch zwischen ihrer unvorstellbaren Süße und dem leichten Prickeln der einzelnen Fasern, bis ich drei Viertel des Balls vertilgt hatte und mir ein bißchen übel wurde. Es war nicht viel los auf der Promenade. Eingehüllt in mein Glück saß ich da und achtete nicht sonderlich auf die Passanten, doch ich erinnere mich dunkel an gutbürgerliche Ehepaare, die untergehakt vorbeispazierten, und einige ältere Leute, die zielstrebiger ausschritten und sich zum Kirchgang feingemacht hatten.
»Ich hoffe, es war kein Fehler, an einem Sonntag hierherzukommen«, flüsterte meine Mutter. »Es wäre doch schade, wenn alles geschlossen hätte.«
Grandpa bedachte meinen Vater mit einem vielsagenden Augenzwinkern; es brachte maliziöse Sympathie zum Ausdruck und gab gleichzeitig zu verstehen, daß er derlei Situationen kannte. »Da hat sie dir mal wieder schön was eingebrockt«, bemerkte er.
»So, du Geburtstagskind«, sagte meine Mutter und wischte mir den Mund mit einem Papiertaschentuch ab, »was willst du als erstes machen?«
Als erstes gingen wir ins Aquarium. Es war wahrscheinlich ein sehr schönes Aquarium, und doch kann ich mich nur ganz schwach daran erinnern. Seltsam, daß meine Familie sich so bemühte, mir dieses Amüsement zu bieten, während es doch ihre dahingesagten Worte, ihre unbedachten Gesten und Betonungen waren, die in meinem Gedächtnis haften blieben wie Fliegen auf einem Streifen Fliegenpapier. Immerhin weiß ich noch, daß der Himmel sich bereits bezog, als wir hinausfuhren, und daß der frische Meereswind es meiner Mutter schwermachte, das Picknick auf der Grünfläche am Strand zu genießen. Wir hatten die Liegestühle im Halbkreis aufgestellt, und in Gedanken sehe ich noch, wie meine Mutter aufspringt und davonfliegenden Papiertüten nachrennt oder belegte Brote austeilt und dabei mit dem wild flatternden Butterbrotpapier kämpft. Es blieb eine Menge Essen übrig, und sie bot die Reste schließlich dem Mann an, der das Geld für die Liegestühle kassieren wollte. (Wie alle Menschen ihrer Generation konnten meine Eltern sich scheinbar mühelos mit jedem beliebigen Fremden unterhalten, Ich dachte immer, daß mir diese Gabe einfach zufliegen würde – vielleicht, wenn ich meine kindliche oder jugendliche Schüchternheit abgeschüttelt hätte –, aber das geschah nie, und heute weiß ich, daß diese Leichtigkeit, die sie, wo sie auch waren, im Umgang mit anderen Menschen an den Tag legten, mehr mit jener Zeit als mit einer besonderen Reife zu tun hatte.)
»Lecker, der Schinken«, sagte der Mann. »Ich tu allerdings ganz gern ein bißchen Senf drauf.«
»Wir auch«, sagte Grandpa, »aber Seine Hochwohlgeboren mag das nicht.«
»Sie verwöhnt ihn«, sagte Grandma und lächelte in meine Richtung. »Sie verwöhnt ihn nach Strich und Faden.«
Ich tat, als hätte ich das nicht gehört, und starrte so angestrengt auf das letzte Stück selbstgebackenen Schokoladenkuchen, daß meine Mutter es mir wortlos zuschob und dabei gespielt verschwörerisch den Finger an die Lippen legte. Es war mein drittes Stück. Sie nahm beim Backen nie Blockschokolade, sondern immer nur echte Vollmilchschokolade.
Ich hatte das Gefühl, nicht mehr lange auf den versprochenen Sprung ins Wasser warten zu können, aber meine Mutter sagte, ich müsse das Essen erst verdauen. In der Hoffnung, mich meine Ungeduld vergessen zu machen, ging mein Vater mit mir zum Meer. Es war Ebbe, und die weite Schlickfläche erstreckte sich fast bis zum Horizont. Ein paar kleine Kinder watschelten entschlossen umher wie Nachwuchsentdecker, in der einen Hand ein Muschelnetz, an der anderen ein wenig begeistertes Elternteil. Wir spazierten etwa eine halbe Stunde lang ziellos umher und durften dann endlich ins Freibad gehen. Es waren nicht viele Leute da. Ein paar lagen in Liegestühlen am Beckenrand, und die wenigen, die schwammen, taten das unter ausgiebigem Prusten und Spritzen. Es herrschte ein Durcheinander aus verschiedenen Melodien: Aus den großen Lautsprechern sickerte seichte Orchestermusik und vermischte sich mit Transistorradioklängen von Cliff Richard bis zu Kenny Ball and his Jazzmen. Das Wasser glitzerte und schimmerte unwiderstehlich. Ich verstand nicht, warum die Leute flach auf dem Rücken lagen und Radio hörten, wenn direkt vor ihrer Nase eine solche Herrlichkeit, ein solches Glück lockte. Mein Vater und ich traten gleichzeitig aus den Umkleidekabinen. Damals fand ich, daß er der bei weitem stärkste und bestaussehende Mann im ganzen Freibad war, doch wenn ich heute daran zurückdenke, sehe ich, daß unsere mageren weißen Körper gleichermaßen zart und kindlich waren. Ich rannte voraus zum Beckenrand und genoß den kurzen, aber unendlich kostbaren Augenblick der Vorfreude. Ich sprang ins Wasser, und dann schrie ich.
Das Becken war nicht beheizt. Wie waren wir nur auf den Gedanken gekommen, es würde beheizt sein? Ein Speer aus Eis durchfuhr mich, und der Schock ließ mich erstarren, doch meine erste Reaktion – nicht nur auf das körperliche Gefühl, sondern auch auf die schlimmere Qual einer in Aussicht gestellten, aber dann doch verweigerten Freude – war, in Tränen auszubrechen. Wie lange ich weinte, weiß ich nicht. Mein Vater muß mich aus dem Becken gezogen haben, meine Mutter muß von der Zuschauergalerie, wo sie mit meinen Großeltern Platz genommen hatte, herbeigeeilt sein. Sie nahm mich in die Arme, und alle sahen mich an, und doch war ich untröstlich. Später sagten sie mir, es habe ausgesehen, als wollte ich nie mehr aufhören zu weinen. Irgendwie schafften sie es, mich wieder anzuziehen und nach draußen zu bugsieren, wo inzwischen drohend schwarze Regenwolken am Himmel hingen.
»So eine Unverschämtheit«, schimpfte Grandma. Sie hatte einem der Bademeister die Meinung gesagt, und das war etwas, das man niemandem wünschte. »Die müssen doch ein Schild aufhängen. Oder ein Thermometer, auf dem man die Wassertemperatur ablesen kann. Wir sollten einen Beschwerdebrief schreiben.«
»Mein armes Lämmchen«, sagte meine Mutter. Ich schluchzte noch ein bißchen. »Ted, lauf doch schnell zum Wagen und bring die Regenschirme, sonst holen wir uns noch den Tod. Wir warten hier auf dich.«
»Hier« war das Wartehäuschen einer Bushaltestelle an der Promenade. Wir vier saßen da und lauschten dem Regen, der auf das Glasdach trommelte. Grandpa murmelte: »Was für ein Schlamassel!«, ein sicheres Zeichen dafür, daß der Tag seines Erachtens dabei war, im Sturzflug in die Katastrophe abzuschmieren – was das Stichwort für mich war, mit verdoppelter Energie weiterzuheulen.
Als mein Vater mit zwei Regenschirmen und einer klein zusammengefalteten Plastikhaube zurückkehrte, sah meine Mutter ihn in stummer Panik an, doch er hatte inzwischen offenbar gründlich nachgedacht und einen klugen Einfall45
gehabt: »Sehen wir doch mal nach, ob etwas im Kino läuft.«
Das nächstgelegene und größte war das Odeon und zeigte Die nackte Geisel