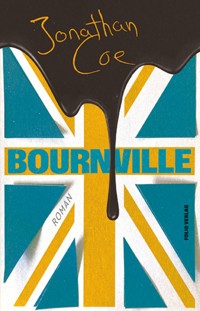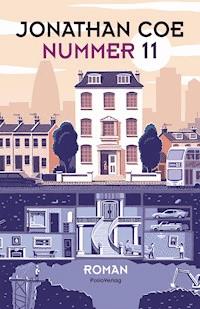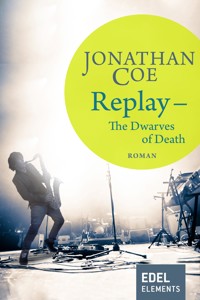Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alles beginnt am 31. Dezember 1999 in Birmingham: Benjamin Trotter, leidlich erfolgreicher Buchhalter, steht in der Mitte seines Lebens. Doch eine tiefe Unzufriedenheit und die Gewißheit, das Falsche zu tun, nagen an ihm. Noch immer trauert er Cicely nach, die vor beinahe dreißig Jahren spurlos aus seinem Leben verschwand, und noch immer schreibt er verzweifelt an einem Roman, der inzwischen über tausend Seiten stark ist. Während Benjamin zurückschaut, blickt sein Bruder Paul als Parlamentsabgeordneter ehrgeizig nach vorn. Die Affäre mit seiner Assistentin Miriam zwingt Paul und Benjamin dazu, über ihre Vergangenheit und das persönliche Glück nachzudenken. Beide Brüder müssen sich den Fragen stellen, vor denen sie so lange davongelaufen sind. Vom Autor des Bestsellers "Allein mit Shirley"!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 672
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jonathan Coe
Klassentreffen
Roman
Ins Deutsche übertragen von Henning Ahrens
Edel eBooks Ein Verlag der Edel Germany GmbH
Copyright dieser Ausgabe © 2014 by Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
Copyright der Originalausgabe © 2004 by Jonathan Coe
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel THE CLOSED CIRCLE
Ins Deutsche übersetzt von Henning Ahrens
Deutsche Übersetzung © Piper Verlag GmbH, München 2006
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Jouve
Inhaltsverzeichnis
Auf den Kalkklippen
Auf den Kalkklippen
Etretat
Dienstag, 7. Dezember 1999
Morgen
Liebste Schwester,
von hier oben hat man einen phantastischen Blick, aber leider ist es zu kalt, um viel zu schreiben. Meine Finger sind schon ganz steif. Aber ich wollte diesen Brief unbedingt noch vor meiner Rückkehr nach England beginnen, und dies ist die absolut letzte Gelegenheit.
Beschäftigt mich noch etwas, kurz bevor ich das europäische Festland verlasse? Kurz bevor ich heimkehre?
Ich suche den Horizont ab und halte Ausschau nach Omen. Ruhige See, klarer, blauer Himmel. Das muß wohl etwas zu bedeuten haben.
Offenbar kommen Leute hier rauf, um ihrem Leben ein Ende zu setzen. Ich sehe einen Jungen weiter unten auf dem Weg, der genau das vorzuhaben scheint, denn er steht gefährlich nahe am Rand der Klippen. Er steht dort schon so lange, wie ich hier auf der Bank sitze, und er trägt nur T-Shirt und Jeans. Er friert sich bestimmt zu Tode.
So verzweifelt bin ich immerhin noch nicht, auch wenn es in den letzten Wochen ein paar schlimme Tiefpunkte gegeben hat. Punkte, an denen ich nicht mehr mit mir klargekommen bin, an denen auf einmal alles außer Kontrolle geraten ist. Dieses Gefühl kennst Du bestimmt von früher. Ich bin mir ganz sicher, daß Du es kennst. Wie dem auch sei – das habe ich hinter mir. Von nun an geht es aufwärts und voran.
Etretat liegt unter mir, und ich kann den weiten Bogen des Strandes und die spitzen Dächer des Châteaus sehen, in dem ich gestern übernachtet habe. Ich habe es nicht geschafft, die Stadt zu erkunden. Wenn man jede nur denkbare Freiheit hat, macht man am Ende seltsamerweise gar nichts. Offenbar ist unbegrenzte Wahl gleich gar keine Wahl. Ich hätte ja eine sole à la dieppoise essen können, und vielleicht hätte ein zum Flirten aufgelegter Kellner mich hinterher umsonst mit Calvados versorgt. Statt dessen bin ich im Château geblieben und habe einen alten, französisch synchronisierten Film mit Gene Hackman gesehen.
Dafür gebe ich mir vier von zehn Punkten. Aber warte nur ab. Ich kann auch mehr schaffen. Ist das überhaupt eine Methode, sein Leben neu anzufangen?
Fange ich denn wirklich ein neues Leben an? Vielleicht nehme ich nach einer langen und unter dem Strich völlig ergebnislosen Unterbrechung nur ein altes wieder auf.
Auf der Fähre Pride of Portsmouth
Im Restaurant
Dienstag, 7. Dezember 1999
Später Nachmittag
Ich weiß wirklich nicht, wie man auf dieser Fährverbindung im Winter einen Gewinn erwirtschaften soll. Abgesehen von mir und dem Mann hinter der Theke – keine Ahnung, was er ist, der Steward oder Proviantmeister oder so ähnlich – ist es hier gähnend leer. Draußen ist es dunkel, und Regen spritzt an die Scheiben. Vielleicht auch nur Gischt. Jedenfalls würde ich bei dem Anblick am liebsten vor Kälte zittern, obwohl es hier drinnen warm ist, fast überheizt.
Ich schreibe diesen Brief in das postkartengroße Notizbuch, das ich mir in Venedig gekauft habe. Es hat einen festen, marmorierten, seidenblauen Einband und wunderbar dicke Seiten, die aussehen, als hätte man sie mit der Hand aufgeschnitten. Wenn ich diesen Brief beende – sollte ich ihn je beenden –, könnte ich die Seiten bestimmt heraustrennen und in einen Briefumschlag stecken. Obwohl das eigentlich Unsinn wäre, oder? Richtig in Schwung bin ich jedenfalls noch nicht. Was ich bisher zu Papier gebracht habe, ist wohl eher als Nabelschau zu bezeichnen. Eigentlich müßte ich wissen, wie ein Brief an Dich auszusehen hat, denn ich habe Dir in den zurückliegenden Jahren ja nicht umsonst Tausende und Abertausende von Wörtern geschrieben. Aber jeder neue Brief an Dich ist wie der allererste.
Ich habe so ein Gefühl, als würde dies der längste von allen werden.
Als ich mich auf den Kalkklippen hoch über Etretat auf die Bank gesetzt habe, wußte ich noch nicht, wem ich schreiben sollte, Dir oder Stefano. Ich habe mich für Dich entschieden. Du kannst stolz auf mich sein. Ich bin fest entschlossen, an meinem Vorsatz festzuhalten. Ich habe mir geschworen, mich nicht bei ihm zu melden, und an das, was man sich selbst geschworen hat, ist man am stärksten gebunden. Natürlich fällt es mir schwer, denn wir haben uns vier Monate lang täglich gesprochen, gemailt oder wenigstens gesimst. Mit einer solchen Gewohnheit kann man nicht so schnell brechen. Aber es wird bald besser, bestimmt. Im Moment bin ich noch auf Entzug. Wenn ich mein Handy anschaue, das auf dem Tisch neben der Kaffeetasse liegt, komme ich mir vor wie eine Ex-Raucherin, der man eine Schachtel Zigaretten vor die Nase hält. Ich könnte ihm einfach eine SMS schicken. Er hat mir überhaupt erst beigebracht, wie man simst. Aber das wäre Wahnsinn. Außerdem würde er mich dafür hassen. Und ich habe Angst, daß er mich hassen könnte – große Angst. Das ist meine größte Angst. Ganz schön albern, findest du nicht auch? Wo ist der Unterschied, wenn ich ihn sowieso nie wiedersehe?
Am besten, ich mache eine Liste. Listen zu machen, ist immer eine gute Verdrängungsmethode. Meine Lektionen aus der Stefano-Katastrophe:
Verheiratete Männer verlassen nur ungern Frau und Töchter für eine Single-Frau in den späten Dreißigern.Eine Affäre kann selbst ohne Sex noch weitergehen.Ein dritter Punkt fällt mir gerade nicht ein. Immerhin, das ist schon ganz brauchbar. Beide Lektionen sind wichtig. Sie kommen mir bestimmt zustatten, wenn ich mich noch einmal in so etwas hineinreite. Noch besser wäre es natürlich, wenn sie verhinderten, daß ich mich je wieder in so etwas hineinreite (hoffe ich jedenfalls).
Tja, das sieht gut aus auf Papier – ganz besonders auf diesem teuren, dicken, cremefarbenen venezianischen Papier. Leider fällt mir gerade ein Zitat ein, das Philip immer für mich parat hatte. Irgendeine morsche Stütze der Gesellschaft hat einmal in einem Anfall von Altersschwachsinn gesagt: »Ja, ich habe aus meinen Fehlern gelernt, und ich bin mir sicher, daß ich sie alle perfekt wiederholen könnte.« Ha, ha. So wird es mir vermutlich ergehen.
Vierter Kaffee des Tages
National Film Theatre Café
London, South Bank
Mittwoch, 8. Oktober 1999
Nachmittag
Da bin ich wieder, liebste Schwester, nach einer Unterbrechung von ungefähr zwanzig Stunden, und die erste Frage, die sich mir stellt, nachdem ich den ganzen Vormittag mehr oder weniger ziellos durch die Straßen gelaufen bin, ist: Wer sind all diese Leute, und was tun sie hier?
Nicht, daß ich mich besonders gut an London erinnere. Ich glaube, ich war seit sechs Jahren nicht mehr hier. Aber ich weiß noch (oder glaubte zu wissen), wo sich ein paar meiner Lieblingsläden befinden. In einer der Seitenstraßen zwischen Covent Garden und Long Acre gab es einen Kleiderladen, in dem man schöne Tücher kaufen konnte, und drei Türen weiter gab es einen Laden mit handbemalter Töpferware. Ich hatte gehofft, dort einen Aschenbecher für Dad zu finden, als eine Art Friedensangebot. (Reines Wunschdenken, klar. Es bräuchte mehr, um Frieden zu schließen ... ) Aber egal – die Sache ist die, daß es diese beiden Läden nicht mehr gibt. Statt dessen gibt es dort zwei Coffee Shops, und beide waren bis auf den letzten Platz besetzt. Da ich gerade in Italien war, bin ich daran gewöhnt, daß die Leute vierundzwanzig Stunden am Tag am Handy hängen, aber vor meiner Abreise habe ich dort drüben allen im Brustton der Überzeugung verkündet: »Ach, wißt ihr, in England machen sie das bestimmt nicht mit, nicht in diesem Ausmaß.« Warum tue ich das nur immer wieder? Warum töne ich immer wieder herum wie eine führende Expertin, obwohl ich im Grunde keine Ahnung habe? Mein Gott, inzwischen hat hier jeder eines. Die Dinger sehen aus wie ans Ohr geschraubt, wenn die Leute damit die Charing Cross Road rauf- und runterlaufen und wie Verrückte mit sich selbst brabbeln. Und wenn sie dann auch noch diese Ohrstöpsel drin haben, merkt man gar nicht mehr, daß sie telefonieren, und hält sie für Leute aus einem Projekt für betreutes Wohnen. (Von denen es hier auch ziemlich viele gibt.) Doch die Frage ist – wie schon gesagt –, wer sind all diese Leute, und was tun sie? Natürlich sollte ich aus dem Verschwinden einiger Läden keine voreiligen Schlüsse ziehen (vielleicht habe ich mich ja auch in der Straße geirrt), aber mein erster Eindruck ist, daß es in dieser Stadt eine große Anzahl von Menschen gibt, die nicht mehr arbeiten, jedenfalls nicht in dem Sinne, daß sie etwas produzieren oder verkaufen. Das gilt offenbar als ziemlich altmodisch. Statt dessen treffen sich die Leute, und sie reden. Und wenn sie sich nicht persönlich treffen und reden, reden sie meist in ihre Handys, und meist reden sie hinein, um irgendein neues Treffen zu vereinbaren. Ich wüßte wirklich brennend gern, worüber sie reden, wenn sie sich schließlich treffen. Das ist noch so ein Irrtum, den ich in Italien begangen habe. Ich habe immer wieder allen Leuten erzählt, daß die Engländer so verschlossen seien. Aber das scheint gar nicht zu stimmen – wir sind zu einer Nation von Quasselstrippen geworden. Wir sind auf einmal unglaublich gesellig. Trotzdem weiß ich immer noch nicht, was da eigentlich geredet wird. Offenbar findet im ganzen Land ein gigantisch großes, unglaublich wichtiges Gespräch statt, und ich habe das Gefühl, als einziger Mensch nicht genug zu wissen, um daran teilnehmen zu können. Worum geht es denn? Um das Fernsehprogramm vom letzten Abend? Um die Ausfuhrsperre für britisches Rindfleisch? Um die Frage; wie man den Virus besiegen kann, der beim Jahrtausendwechsel unsere Computer befallen wird?
Und noch etwas, bevor ich es vergesse: Dieses monströse Riesenrad, das jetzt neben der County Hall an der Themse steht. Was genau soll das?
Gut, das dürften genug soziologische Kommentare für heute sein. Schließlich gibt es noch mehr zu erzählen, vor allem, daß ich beschlossen habe, die bittere Pille zu schlucken und mich der Sache zu stellen usw. – und noch heute abend nach Birmingham zurückzufahren (weil die Preise der hiesigen Hotels der reine Irrsinn sind und ich mir keine weitere Nacht leisten kann). Außerdem scheint mich schon wieder ein Stück Vergangenheit eingeholt zu haben, obwohl ich noch keine 24 Stunden zurück in England bin. Und zwar in Gestalt eines Flyers, den ich in der Queen Elizabeth Hall eingesammelt habe. Dort findet am nächsten Montag eine Veranstaltung mit dem Titel »Abschied vom alten Jahrhundert« statt. Sechs »Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben« (ist da zu lesen) werden uns berichten, »was sie am Ende des zweiten Jahrtausends mit dem größtem Bedauern hinter sich lassen und was sie mit dem größtem Vergnügen abhaken«. Und wer ist die Nummer Vier auf der Liste? Nein, nicht Benjamin (obwohl wir damals alle glaubten, er würde ein berühmter Autor werden), sondern Doug Anderton, der uns – siehe da! – als »Journalist und politischer Kommentator« vorgestellt wird.
Noch ein Omen? Sagt es mir, daß ich mich nicht mutig in die Zukunft stürze, sondern die ersten, unfreiwilligen Schritte zurück in die Vergangenheit tue? Ja, um Himmels willen, ich habe Doug das letzte Mal vor ungefähr fünfzehn Jahren gesehen. Auf meiner Hochzeit. Wenn ich mich recht erinnere, war er damals ziemlich betrunken und hat mich gegen eine Wand gedrückt und mir gesagt, ich würde den Falschen heiraten. (Er hatte natürlich Recht, wenn auch in anderer Hinsicht, als er gemeint hat.) Wäre bestimmt komisch, jetzt im Publikum zu sitzen und ihn über die Angst vor dem Jahrtausendwechsel und soziale Veränderungen predigen zu hören. Vermutlich wäre es bloß eine neue Version dessen, was wir schon vor zwanzig Jahren über uns ergehen lassen mußten, wenn wir bei einer Redaktionssitzung der Schülerzeitung am Tisch versammelt waren. Außer, daß wir inzwischen graue Haare bekommen und Rückenprobleme sich einstellen.
Ob du schon graue Haare hast, liebe Miriam? Oder brauchst du dir über so etwas längst keine Sorgen mehr zu machen?
In fünfzig Minuten geht ein Zug nach Birmingham. Den muß ich unbedingt noch kriegen.
Zweiter Kaffee des Tages
Coffee Republic
New Street, Birmingham
Freitag, 10. Dezember 1999
Morgens
O Miriam – dieses Haus! Dieses furchtbare Haus. Es hat sich kein bißchen verändert. Nichts daran hat sich verändert, seit du damals verschwunden bist (und das ist fast genau ein Vierteljahrhundert her), außer, daß es kälter, leerer und bedrückender (und sauberer) ist denn je. Dad hat eine Putzfrau angestellt, die alles blitzblank hält, und wenn sie nicht zweimal pro Woche zum Staubwischen käme, würde er jetzt, nach Mums Tod, wahrscheinlich sieben Tage lang mit niemandem reden. Außerdem hat er sich ein kleines Haus in Frankreich gekauft, in dem er offenbar viel Zeit verbringt. Mittwochabend hat er mir stundenlang Fotos vom neuen Boiler und vom Faulbehälter gezeigt, die er hat einbauen lassen. Irrsinnig spannend, wie du dir vorstellen kannst. Er hat mir mehrmals angeboten, ich könne gern mal für eine Woche oder vierzehn Tage hinfahren, aber das war nicht wirklich ernst gemeint, und außerdem habe ich keine Lust. Und ich werde auch keine Nacht länger unter seinem Dach bleiben als unbedingt nötig.
Gestern abend bin ich mit Philip und Patrick essen gegangen.
Ich hatte Philip seit mehr als zwei Jahren nicht gesehen, und vermutlich ist es in dieser Situation völlig normal, daß eine Ex-Ehefrau ihren Ex-Ehemann betrachtet und sich fragt, was in Gottes Namen sie je dazu gebracht hat, diesen Mann zu heiraten. Das meine ich vor allem in physischer Hinsicht. Während meines Studiums bin ich fast ein Jahr in Mantua gewesen, 1981, glaube ich – mein Gott, ich glaube es kaum, daß ich diese Zahl schreibe! –, und damals umschwärmten mich junge Italiener, die meisten umwerfend gutaussehend, und alle haben mich angefleht, mit ihnen ins Bett zu gehen. Ein ganzer Haufen halbwüchsiger Mastroiannis in der Blüte ihrer Sexualität, die vor Begehren gestammelt haben, um es mal ganz offen zu sagen. Als Engländerin war ich für sie auf eine Art exotisch, die in Birmingham unvorstellbar gewesen wäre, und ich hätte absolut freie Wahl gehabt. Ich hätte sie alle vernaschen können, einen nach dem anderen. Und für was habe ich mich statt dessen entschieden? Oder besser: Für wen? Für Philip. Philip Chase, den blassen, vertrottelten Philip Chase mit seinem dünnen, rotblonden Bart und seiner Hornbrille, der mich eine Woche besuchen wollte und es irgendwie schaffte, mich schon am zweiten Tag ins Bett zu kriegen, und der mein Leben schließlich völlig umkrempelte, zwar nicht für immer, vermute ich mal, aber trotzdem radikal... grundlegend... ich weiß auch nicht. Mir fehlt gerade das passende Wort. Aber manchmal ist ein Wort so gut wie das andere. Ob es einfach nur daran lag, daß wir zu jung waren? Nein, das wäre ungerecht. Von allen Jungs, die ich bis dahin kennengelernt hatte, war er am offensten, am sympathischsten und am wenigsten arrogant (Doug und Benjamin kreisten auf unterschiedliche Art permanent um sich selbst!). Außerdem ist Phil unglaublich anständig: Er ist absolut verläßlich und vertrauenswürdig. Er hat unsere Scheidung wunderbar glatt über die Bühne gebracht – ein zweischneidiges Kompliment, ich weiß, aber solltest Du Dich je von jemandem scheiden lassen wollen... dann ist Philip Dein Mann.
Und Patrick, nun ja... Ich möchte Pat natürlich so oft wie möglich sehen, während ich hier bin. Er ist schon ziemlich erwachsen. Wir haben einander regelmäßig geschrieben und gemailt, und letztes Jahr ist er für ein paar Tage nach Lucca gekommen, aber trotzdem – es überrascht mich jedesmal, wie er sich verändert hat. Ich kann dir gar nicht sagen, was für ein komisches Gefühl es ist, diesen Mann anzuschauen – so kommt er mir jedenfalls vor, obwohl er erst fünfzehn ist –, diesen großen (ziemlich mageren, ziemlich blassen, ziemlich melancholischen) Mann, und gleichzeitig zu wissen, daß er früher einmal... in mir drin war, wenn du verstehst, was ich meine. Er scheint eine sehr gute Beziehung zu seinem Vater zu haben. Ich habe sie um die Unbeschwertheit beneidet, mit der sie sich unterhalten und Witze gerissen haben. Vielleicht nur männliches Getue. Aber nein, da schwang mehr mit. Ich merke, daß Philip und Carol sich gut um ihn kümmern. In der Hinsicht kann ich nicht meckern. Vielleicht bin ich ein bißchen eifersüchtig, das ja. Aber schließlich war es meine Entscheidung, noch einmal mein Glück in Italien zu versuchen und Pat bei seinem Vater zu lassen. Meine Wahl.
Und nun komme ich zur letzten Neuigkeit. In gewisser Weise ist sie am wichtigsten – vielleicht auch am verstörendsten. Ich habe Benjamin wiedergesehen. Vor zirka einer Stunde. Und unter den merkwürdigsten Umständen.
Was ich am Abend zuvor über Ben erfahren hatte, war sehr ernüchternd. Er arbeitet immer noch bei derselben Firma – inzwischen als leitender Angestellter, aber das gehört sich nach all der Zeit wohl auch so –, und er ist immer noch mit Emily verheiratet. Kinderlos, aber danach wagt inzwischen niemand mehr zu fragen. Phil hat behauptet, sie hätten alles mögliche versucht und sich sogar um ein Adoptivkind bemüht. Die Ärzte ratlos usw. usf. Offenbar ist keinem von beiden die Schuld daran zu geben (was wohl heißt, daß insgeheim jeder dem anderen die Schuld gibt). Und in Benjamins Fall verhält es sich mit den Kindern wie mit dem Schreiben: Er brütet (!) seit Jahren irgendein umwerfendes Meisterwerk aus, aber bislang hat niemand ein Wort davon gelesen. Rührenderweise sind trotzdem alle überzeugt, daß es irgendwann dieser Tage erscheinen wird.
Soweit die Einleitung. Und nun stell dir vor, wie ich im Waterstone’s in der High Street in den Geschichtsbüchern stöbere. Erst anderthalb Tage wieder da, und schon fällt mir kein besserer Zeitvertreib mehr ein. Ich stehe dicht bei der Ecke, die man für die ewigen Kaffeekonsumenten abgeteilt hat. Aus den Augenwinkeln sehe ich ein Mädchen, das mit dem Gesicht zu mir an einem Tisch sitzt – sehr hübsch, auf eine zerbrechliche Art –, und ihr gegenüber, mit dem Rücken zu mir, sitzt ein grauhaariger Mann, den ich zunächst für ihren Vater halte. Ich schätze das Mädchen auf neunzehn oder zwanzig. Ihre Kleidung ist ein bißchen à la Gothic, und sie hat wunderschönes Haar, schwarzes Haar, dick und lang und glatt, das ihr halb den Rücken hinunterreicht. Ich schenke den beiden keine weitere Beachtung, doch als ich zu einem der Büchertische gehe, sehe ich, wie sie sich bückt, um etwas aus der Tasche zu holen, und dabei rutscht ihr schwarzes T-Shirt hoch und entblößt ihre Taille, und ich bemerke, auf welche Art der Mann dies registriert – hastig, heimlich –, und da erkenne ich ihn: Es ist Benjamin. Im Anzug – ein komischer Anblick für mich, aber er muß heute natürlich arbeiten, und wahrscheinlich hat er sich nur für kurze Zeit aus dem Büro abgeseilt –, und in diesem Augenblick wirkt er völlig... Wie heißt es gleich? Diesmal gibt es ein Wort, ein Wort, das absolut treffend beschreibt, wie Männer in einer solchen Situation wirken...
Ah, jetzt fällt es mir ein: »Weggetreten«. Das Wort beschreibt ganz genau, wie Benjamin gerade wirkt.
Und dann bemerkt er mich, und die Zeit vergeht plötzlich langsamer – wie immer, wenn man jemanden sieht, mit dem man nicht rechnet und den man seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen hat, und in beiden Menschen fängt etwas an zu arbeiten, man versucht, seine Erwartungen an diesen Tag neu zu ordnen... Und dann gehe ich zu den beiden an den Tisch, und Benjamin steht auf und hält mir die Hand hin, wirklich unfaßbar, er hält mir die Hand hin, damit ich sie schütteln kann. Was ich selbstverständlich nicht tue. Ich gebe ihm statt dessen einen Kuss auf die Wange. Und er wirkt verwirrt, es scheint ihm peinlich zu sein, und er stellt mich umgehend seiner Bekannten vor, die nun auch aufsteht, und wie sich herausstellt, heißt sie Malvina.
Also – was hat all das zu bedeuten? Was geht hier vor? Nach fünf Minuten zäher Unterhaltung – deren Inhalt mir komplett entfallen ist – bin ich auch nicht klüger. Doch da sich in den letzten paar Tagen bereits ein Muster herauskristallisiert hat, habe ich plötzlich etwas in der Hand, das ich vorher nicht in der Hand hatte. Einen Flyer. Einen Flyer für eine weitere Veranstaltung am Montag, dem 13. Dezember. An dem Abend spielt Benjamins Band.
»Habt ihr die Band nicht schon vor Urzeiten aufgelöst? « frage ich.
»Wir haben uns noch mal zusammengetan«, erklärt er. »Der Pub feiert ein Jubiläum. Zwanzigjahre Live-Musik. Wir haben dort immer gespielt, und man hat uns um einen letzten Auftritt gebeten.«
Ich schaue wieder auf den Flyer und lächele. Jetzt fällt mir auch der Name von Benjamins Band ein – »Saps at Sea«. Eigentlich der Titel eines Filmes mit Laurel und Hardy, wie er mir einmal erzählt hat. Wäre schon lustig, die Band wieder zu hören, obwohl seine Musik eigentlich nicht mein Fall war. Doch ich meine es ehrlich, als ich sage: »Wenn ich noch da bin, komme ich. Aber vielleicht bin ich dann schon weg aus Birmingham.«
»Ach, komm doch bitte«, sagt Benjamin. »Bitte komm.«
Dann geben wir das übliche, förmliche Zeug von uns, wie schön, dich wiedergesehen zu haben und so weiter, und im nächsten Moment bin ich draußen, ohne daß ich mich noch einmal umgeschaut hätte. Ja, gut – einmal habe ich mich doch umgeschaut. Lange genug, um zu sehen, wie Benjamin sich zu Malvina beugt – die er mir als ›Bekannte‹ vorgestellt hat, mehr habe ich nicht über sie erfahren –, ihr den Flyer zeigt und ihr etwas dazu erzählt. Sie berühren sich über den Tisch hinweg beinahe an der Stirn. Und als ich so schnell wie möglich verschwinde, denke ich nur: Benjamin, Benjamin, wie kannst du das der Frau antun, mit der du seit sechzehn Jahren verheiratet bist?
In meinem alten Schlafzimmer
St Laurence Road
Northfield
Samstag, 11. Dezember 1999
Nachts
Langsam wird diese Reise zum Albtraum. Ich zittere am ganzen Körper, obwohl die Sache schon drei Stunden her ist. Dad sitzt unten und liest einen dieser grauenhaften, alten Romane von Alistair Maclean, auf die er so wild ist. Er hatte keinen Funken Mitgefühl. War offenbar der Ansicht, es wäre meine eigene Schuld. Ich kann wirklich keine Minute länger in diesem Haus bleiben. Morgen verschwinde ich von hier und suche mir eine neue Bleibe.
Ich erzähl dir kurz, was passiert ist. Heute hatte ich große Sehnsucht nach Pat. Er sollte vormittags für seine Schule Fußball spielen, es war ein Auswärtsspiel gegen eine Mannschaft in Malvern. Also habe ich angeboten, ihn bei Philip und Carol abzuholen und selbst dorthin zu fahren. Dad hat mir sein Auto geliehen, etwas unwillig; offenbar traute er mir nicht so recht.
Wir sind auf der Bristol Road nach Süden gefahren und in Longbridge rechts abgebogen, um über Rubery zur M5 zu kommen. Allein mit Pat im Auto zu sitzen, war ziemlich merkwürdig – merkwürdiger, als es hätte sein sollen. Er ist schon sehr still, mein Sohn. Vielleicht ist er nur in meiner Anwesenheit so still, aber das kann nicht der ganze Grund sein. Er ist natürlich eher introvertiert – das ist ja auch in Ordnung. Als er dann doch etwas sagte, ging es um ein Thema, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hätte – das hat mich so umgehauen. Er fing an, über dich zu reden, Miriam. Er wollte wissen, wann ich dich zuletzt gesehen habe und wie Mum und Dad mit deinem Verschwinden zurechtgekommen seien. Zuerst war ich sprachlos. Ich wußte überhaupt nicht, was ich sagen sollte. Wir waren ja nicht im Verlauf eines Gesprächs auf das Thema gekommen, sondern er hatte es aus heiterem Himmel angeschnitten. Was sollte ich antworten? Ich habe ihm nur gesagt, daß alles sehr lange her sei und daß die Wahrheit wohl nie mehr ans Licht käme.
Damit mußten wir leben, wir mußten es akzeptieren und irgendwie verarbeiten. Es war ein Kampf – sowohl Dad als auch ich haben damit gerungen, auf unsere jeweilige Art, jeden Tag unseres Lebens. Was sollte ich ihm sonst sagen?
Danach war er wieder eine ganze Weile still, und ich auch. Um ehrlich zu sein, hatte mich dieses kurze Gespräch sehr aufgewühlt. Ich hatte geglaubt, wir würden über die Schule oder die Chancen für das Fußballspiel reden. Statt dessen ging es um seine Tante, die zehn Jahre vor seiner Geburt spurlos verschwunden war.
Ich versuchte, mich auf den Verkehr zu konzentrieren und nicht mehr darüber nachzudenken.
In den paar Tagen, die ich jetzt hier bin, ist mir noch etwas an diesem Land aufgefallen, Miriam. Man kann den Zustand einer Nation daran erkennen, wie die Leute Auto fahren, und in dieser Hinsicht hat sich England in den letzten paar Jahren sehr verändert. Ich bin ja in Italien gewesen, dem Heimatland der aggressiven Autofahrer. Ich kenne das. Ich bin es gewohnt, daß man knapp vor meiner Stoßstange einschert, daß ich in unübersichtlichen Kurven überholt werde, daß mir Leute zubrüllen, mein Bruder sei ein Hurensohn, wenn ich zu langsam fahre. Damit kann ich umgehen. All das ist nicht ernst gemeint. Hier passiert inzwischen das gleiche – nur, daß es in Wirklichkeit nicht das gleiche ist. Es gibt einen entscheidenden Unterschied: Die Leute meinen es offenbar ernst.
Vor einigen Monaten habe ich im Corriere della Sera einen Artikel mit der Überschrift »Apathisches England« gelesen. Darin hieß es, die Leute hätten einen kollektiven Seufzer getan und aufgehört, sich Gedanken über Politik zu machen, seit Tony Blair, ein netter Typ, der offenbar wisse, was er tue, mit einer so überwältigenden Mehrheit ins Amt gewählt worden sei. Der Verfasser des Artikels schaffte es sogar, das Ganze mit dem Tod von Prinzessin Diana in Verbindung zu bringen. Wie, weiß ich nicht mehr, ich weiß nur noch, daß es mir damals etwas konstruiert vorkam. Aber vielleicht hatte er in gewisser Weise recht. Nur, daß er nicht zum Kern der Sache vorgedrungen ist. Denn wenn man an der Oberfläche dieser Apathie kratzte, fände man darunter etwas völlig anderes – eine furchtbare, aufgestaute Frustration.
Wir waren nur knapp zwanzig Minuten auf dem Motorway, aber diese zwanzig Minuten haben mir schon etwas gezeigt. Auf dem Motorway sind die Leute anders gefahren. Nicht, daß sie schneller gefahren wären als früher – ich fahre ja selbst ziemlich schnell –, aber in ihrer Fahrweise kam eine Wut zum Ausdruck. Sie fuhren dicht auf und betätigten die Lichthupe, wenn jemand etwas zu lange auf der Überholspur blieb. Außerdem scheint es jetzt eine Spezies von Fahrern zu geben, die die Mittelspur gepachtet haben und sich nicht von dort vertreiben lassen, was alle anderen zur Weißglut bringt: Man klebt an der Stoßstange dieser Fahrer, und wenn sie nach einer Weile immer noch keinen Platz machen, überholt man sie und schert gefährlich dicht vor ihnen ein. Dann gibt es noch Fahrer, die mit siebzig Meilen pro Stunde zufrieden dahinzuckeln, aber urplötzlich auf achtzig oder fünfundachtzig beschleunigen, wenn jemand an ihnen vorbeizuziehen droht, als wäre es eine Beleidigung, wenn ein mickriger Punto ihren schicken Megane überholt. Das wollen sie sich nicht bieten lassen, offenbar verletzt diese Vorstellung zutiefst ihren Stolz. Kann sein, daß ich übertreibe, aber bestimmt nicht sehr. Es war ja ein Samstagvormittag, und die meisten Leute wollten vermutlich einkaufen oder einfach nur einen Ausflug machen, und trotzdem hat sich auf dem Motorway eine Wut aufgestaut. Die Stimmung war gereizt, und ich glaube, man hätte uns von der Straße gefegt, wenn irgendein Fahrer auch nur einen dummen Fehler gemacht hätte.
Wie dem auch sei: Wir kamen zur Schule, und die Schlacht begann. Patrick hat irgendwo im Mittelfeld gespielt, und das Spiel schien seine ganze Aufmerksamkeit zu beanspruchen. Er wußte natürlich, daß ich zusah, und deshalb hat er einen auf hart und erwachsen gemacht, aber zugleich hat er sich mit gerunzelter Stirn voll und ganz auf das Spiel konzentriert, und diese Miene hat ihn mindestens fünf Jahre jünger wirken lassen und mir fast das Herz gebrochen. Er hat gut gespielt. Sicher, ich habe keine Ahnung von Fußball, aber ich hatte den Eindruck, als spielte er gut. Seine Mannschaft hat mit 3:1 gewonnen. Ich stand anderthalb Stunden an der Seitenlinie und wäre fast erfroren – auf dem Spielfeld war noch Raureif –, aber es hat sich gelohnt. Ich habe bei Patrick einiges nachzuholen, und dies war ein Anfang, keine Frage. Ich hatte angenommen, daß wir hinterher irgendwo etwas zu Mittag äßen, aber Patrick hatte offenbar andere Pläne. Er wollte mit seinen Schulkameraden im Bus mitfahren, und danach wollte er noch mit zu einem Freund, zu Simon, dem Torwart. Das kam natürlich überraschend, aber ich konnte schlecht nein sagen. Innerhalb weniger Minuten hatten die Jungs sich geduscht, dann war der Bus weg, und plötzlich stand ich allein mitten in Malvern. Und mußte den restlichen Tag totschlagen.
Damit wäre ich wieder bei meiner üblichen Befindlichkeit: der Einsamkeit der alleinstehenden Frau. Zuviel Zeit für mich allein, zu wenig Gesellschaft. Was sollte ich tun? Ich habe in einem Pub in der Worcester Road etwas getrunken und ein Sandwich gegessen, und nachmittags habe ich eine Runde in den Hügeln gedreht. Das hat mich beruhigt und für einen klaren Kopf gesorgt. Vielleicht bin ich ja ein Mensch, der sich nur dann einigermaßen glücklich fühlt, wenn er halb einen Hügel hinauf ist. Auf jeden Fall habe ich in den letzten Wochen viel Zeit damit verbracht, diverse Aussichtspunkte zu erklimmen. Vielleicht bin ich ja an einen Punkt meines Lebens gelangt, an dem ich diese olympische Perspektive brauche. Vielleicht hat mich die Affäre mit Stefano so tief erschüttert, daß ich wieder das Große und Ganze in den Blick bekommen muß. Heute war das Große und Ganze ziemlich ganz und groß. Ob du dich an diesen Blick erinnern könntest, wenn du je wieder hier stündest, Miriam? Früher, als Kinder, sind wir oft mit Mum und Dad hierhergekommen. Das waren eiskalte Picknicks mit Schinken-Sandwiches und Thermosflaschen, wir hockten auf dem Steilabbruch vor einem hohen Felsen, weil es dort geschützter war, und unter uns erstreckten sich die Felder unter dem grauen Himmel der Midlands. Ich weiß noch, daß es in einem unzugänglicheren Teil des Hanges eine kleine Höhle gab, und irgendwo habe ich noch ein Foto, das uns davor zeigt, wir tragen beide einen grünen Anorak und haben uns die Kapuze über den Kopf gezogen. Ich glaube, Dad hat fast alle Fotos weggeworfen, auf denen du zu sehen bist, aber ein paar konnte ich retten. Aus den Trümmern geborgen. Inzwischen habe ich manchmal das Gefühl, als hätten wir beide furchtbare Angst vor ihm gehabt, die ganze Zeit, und vielleicht hat uns diese Angst so zusammengeschweißt.
Meine Erinnerungen sind deshalb aber nicht unglücklich. Im Gegenteil. Sie sind mir so kostbar, daß ich den Gedanken an sie kaum ertrage.
Ich glaube nicht, daß du all das einfach so hinter dir lassen konntest. Das wäre doch unbegreiflich. Das hättest du nicht getan, Miriam, oder? Mich im Stich lassen? Das will ich nicht glauben, obwohl die andere Möglichkeit viel schlimmer wäre.
Nach halb vier, und es wird schon dunkel. Zeit, mich aufzuraffen, nach Hause zu fahren und einen weiteren Abend mit Dad zu verbringen. Den letzten, wie ich beschlossen habe. Wenn es besser liefe, hätte ich vielleicht Weihnachten mit ihm gefeiert, aber daran ist nicht zu denken. Wir kommen einfach nicht miteinander klar. Ich muß mir eine andere Bleibe suchen. Vielleicht kann ich mit Pat irgendwo hinfahren. Mal schauen.
Also bin ich auf dem Heimweg. Ich habe Dad versprochen, etwas zum Abendessen zu besorgen, und halte deshalb kurz in Worcester, um Steak zu kaufen. Er mag Steak. Betrachtet es sogar als seine patriotische Pflicht, es so roh und so oft wie möglich zu verspeisen, seit die Franzosen den Einfuhrstop verhängt haben. Typisch Dad, wirklich. Dann verlasse ich die Randbezirke von Worcester, und ich hatte schon ein bißchen Ärger, weil mich jemand im Kreisverkehr überholen wollte, und ich werde wieder nervös, weil ich das Gefühl bekomme, als wären im Augenblick alle Autofahrer überreizt. Und als ich weiter auf der Ausfallstraße fahre, habe ich plötzlich ein sehr langsam fahrendes Auto vor der Nase. Inzwischen sind die Straßenlaternen an, und ich kann sehen, daß ein Mann am Steuer sitzt, er ist allein unterwegs, und er scheint nicht besonders alt zu sein. Er fährt so langsam, weil er mit dem Handy telefoniert. Sonst würde er vermutlich rasen, denn er hat einen schicken Wagen – einen Sportwagen von Mazda. Doch sein Telefongespräch scheint ihn ziemlich abzulenken. Er hat nur eine Hand am Steuer und zieht immer wieder nach links rüber. Hier ist Tempo vierzig erlaubt, aber er fährt nur ungefähr sechsundzwanzig Meilen pro Stunde. Mich ärgert nicht, daß ich vom Gas gehen muß, sondern mich ärgert, daß das, was er tut, so gefährlich und leichtsinnig ist. Darf man in diesem Land überhaupt beim Autofahren mit dem Handy telefonieren? (In Italien ist es verboten – obwohl das natürlich niemanden kümmert.) Was wäre, wenn ihm ein Kind vor das Auto liefe? Er beschleunigt kurz und bremst dann wieder ab, völlig abrupt und ohne ersichtlichen Grund, und ich fahre ihm fast auf die Stoßstange. Offensichtlich hat er noch nicht bemerkt, daß ich hinter ihm bin. Ich trete auf die Bremse, und die Einkaufstüte fliegt vom Beifahrersitz, alle Sachen liegen auf dem Boden. Toll. Und jetzt gibt er wieder Gas. Ich überlege, ob ich besser anhalte und die Sachen wieder in die Tüte tue, entscheide mich aber dagegen. Statt dessen beobachte ich den Fahrer vor mir mit unfreiwilliger Faszination. Offenbar ist das Gespräch gerade besonders angeregt, denn er gestikuliert mit der Hand. Er hat überhaupt keine Hand mehr am Steuer! Ich beschließe, hier so schnell wie möglich zu verschwinden: Sollte es einen Unfall geben, will ich nichts damit zu tun haben. An dieser Stelle ist die Straße zweispurig, sie führt durch die äußersten Randbezirke der Stadt, und gerade kommt uns kein Auto entgegen. Ganz ungefährlich ist es nicht, aber ich habe die Nase voll von diesem Clown. Also blinke ich und setze zum Überholen an. Da er schon wieder langsamer geworden ist, dürfte es sich nur um Sekunden handeln.
Doch als ich ihn überhole, merkt er, was los ist, und es paßt ihm gar nicht. Ohne sein Handy loszulassen, drückt er das Gaspedal durch und beginnt, mich zu jagen. Ich bin immer noch schneller als er, aber Dads Rover hat nicht besonders viele PS, und das Überholen dauert länger, als mir lieb ist, und nun kommt mir auch noch ein Lkw entgegen. Während ich laut über die Sturköpfigkeit dieses Macho-Idioten fluche, schalte ich runter in den dritten Gang, gebe Vollgas und rase mit fünfundvierzig bis fünfzig Meilen pro Stunde dahin und ordne mich im allerletzten Moment vor dem Mazda ein. Der Lkw ist schon ganz nahe und blendet erbost auf.
Das war es. Besser: Das wäre es gewesen, wenn ich beim Überholen nicht zwei Dummheiten begangen hätte. Zum einen habe ich zu dem Mann mit dem Handy geschaut und für ein, zwei Sekunden Blickkontakt hergestellt. Und zum anderen habe ich ihn angehupt.
Mein Hupen war nur schwach und mädchenhaft. Ich weiß gar nicht genau, warum ich gehupt habe. Wahrscheinlich war es meine halbherzige Art, ihm zu sagen: »Du Wichser!« Aber es hatte eine sofortige, völlig verblüffende Wirkung. Offenbar hatte er das Gespräch beendet und sein Handy auf den Beifahrersitz geworfen, denn Sekunden später ist er direkt hinter mir – zehn Zentimeter von meiner Stoßstange entfernt, schätze ich –, und sein Fernlicht ist so grell, daß es mich im Rückspiegel blendet, und ich höre, wie sein Motor aufheult. Ein richtig wütendes Heulen. Und auf einmal habe ich Angst. Gräßliche Angst. Also gebe ich Gas, um ihm zu entkommen – und bin schnell bei lächerlichen sechzig Meilen pro Stunde –, doch er fällt nicht zurück. Er klebt mir immer noch an der Stoßstange. Ich überlege, kurz auf die Bremse zu treten, um ihn zu erschrecken und zu zwingen, mehr Abstand zu halten, wage es aber nicht und bezweifele auch, daß es funktionieren würde. Ich glaube eher, daß er mir hinten reinführe.
Vermutlich dauert all das nur Sekunden, obwohl es mir viel länger vorkommt. Und schließlich verläßt mich das Glück. Wir kommen zu einer Ampel, vor der die Straße vierspurig wird, und die Ampel ist rot. Ich halte auf der Innenspur, und der Mazda-Mann hält mit kreischenden Bremsen neben mir und reißt die Handbremse hoch, und im nächsten Moment springt er aus dem Auto. Erwartet habe ich einen Idioten mit Holzfällerkreuz und einem Hals, der breiter ist als der Kopf, aber das Männchen mißt nicht einmal einen Meter sechzig. Mehr habe ich nicht vor Augen, denn was danach passiert ist, verschwimmt in meiner Erinnerung. Zuerst hämmert er gegen meine Scheibe. Für einen langen, schrecklichen Augenblick sehe ich ihm ins Gesicht, dann starre ich geradeaus, ich will, daß die Ampel auf Grün springt, mein Herz schlägt so wild, als wollte es platzen. Dann brüllt er rum – das übliche Zeug, beschissene Nutte, beschissene Schlampe, ich höre es nicht richtig, für mich ist alles nur weißes Rauschen –, und dann halte ich das Warten nicht mehr aus und fahre bei Rot über die Kreuzung, weil ich glaube, sie wäre frei, doch von links kommt plötzlich ein Auto, und der Fahrer muß ausweichen und tritt voll auf die Bremse, und dann hupt er laut, aber das höre ich bald nicht mehr, weil ich wie eine Wahnsinnige davonrase, keine Ahnung, wie schnell, und erst nach einer guten Meile, als ich längst aus der Stadt raus bin, frage ich mich, warum die Windschutzscheibe auf meiner Seite naß ist, obwohl es gar nicht regnet, und dann begreife ich, daß der Typ daraufgespuckt hat, bevor ich losgebraust bin. Seine letzte Rache.
Vor dem Motorway gab es einige Parkplätze, doch ich hielt nicht an, aus Angst, er könnte mir folgen und, wenn er mich sähe, noch einmal neben mir halten, um mich so richtig fertigzumachen. Also fuhr ich weiter, obwohl das verrückt war, denn ich heulte und zitterte den ganzen Weg bis Birmingham und hielt in den Rückspiegeln ständig nach einem Mazda MX-5 Ausschau, der mit aufgeblendeten Scheinwerfern von hinten auf mich zugerast kam, bereit zum Gefecht.
Vielleicht wären manche Frauen umgekehrt und hätten es dem Typen in gleicher Münze heimgezahlt. Aber ich weiß genau, daß er tätlich geworden wäre, wenn ich die Scheibe runtergekurbelt hätte. Er stand neben sich, er hat regelrecht getobt. Ich habe noch nie jemanden erlebt...
Hier habe ich kurz aufgehört zu schreiben. Eigentlich wollte ich dir sagen, daß ich noch nie einen Mann in einer solchen Verfassung erlebt habe. Aber das stimmt nicht. Wie gesagt: Ich habe sein Gesicht nur kurz gesehen, aber lange genug, um ihm in die Augen schauen zu können, ja und diesen Haß hab ich schon einmal in den Augen eines Mannes gesehen – ein einziges Mal. Vor ein paar Monaten in Italien. Aber das ist eine andere Geschichte, und ich hebe sie besser für einen anderen Tag auf, weil meine Hände vom vielen Schreiben schon ganz steif sind.
Wie still dieses Haus ist. Das ist mir gerade zum erstenmal aufgefallen. Mir wurde bewußt, daß das Kratzen des Stiftes das einzige Geräusch war.
Schlaf gut, süße Miriam. Morgen erfährst du mehr.
In meinem alten Schlafzimmer
St Laurence Road
Northfield
Sonntag, 12. Dezember 1999
Vormittag
Na, große Schwester, kannst du erraten, wo Dad steckt und warum ich das Haus für ein, zwei Stunden für mich allein habe? Natürlich kannst du das. Er ist in der Kirche! Versucht, einen besseren Menschen aus sich zu machen. Wirklich eine ausgezeichnete Idee, aber die Erfolgsaussichten dürften gegen Null tendieren. Trotzdem geht er seit sechzig Jahren jede Woche in die Kirche (er hat mich heute beim Frühstück noch einmal daran erinnert), und wenn du mich fragst, hat er damit bisher nichts Nennenswertes erreicht. Wenn die Kirche auch nach sechzig Jahren nicht mehr zustande bringt, sollten wir unser Geld zurückverlangen, ehrlich.
Ach – es lohnt die Gedanken gar nicht. Außerdem muß ich nur noch eine Mahlzeit mit ihm durchstehen – das gefürchtete sonntägliche Mittagessen –, und danach bin ich weg. Ich habe beschlossen, mich schamlos zu verwöhnen, und im Hyatt Regency ein Zimmer für zwei Nächte gebucht. Es ist das edelste unter den neuen Hotels in Birmingham: über zwanzig Stockwerke, direkt neben der neuen Symphony Hall und Brindley Place. Am Freitag bin ich dort herumgelaufen, und ich habe diesen Teil der Stadt kaum wiedererkannt, so sehr hat er sich seit den Siebzigern verändert. Damals war das ganze Gelände an den Kanälen eine Einöde. Jetzt gibt es dort eine Bar neben der anderen, und Cafés gibt es auch, und alles war brechend voll. Und wie es hier inzwischen üblich zu sein scheint, hat man sich wieder getroffen und geredet.
Aber vielleicht weißt du das ja schon. Vielleicht bist du im letzten oder vorletzten Jahr selbst dort gewesen. Vielleicht warst du sogar am Freitagvormittag dort und hast mit ein paar Freunden einen Kaffee in der All Bar One getrunken. Wer weiß?
Obwohl ich das Gesicht des Mannes, der mich gestern wegen meines Hupens beschimpft und bespuckt hat, nur für einen Sekundenbruchteil gesehen habe, muß ich immer wieder daran denken. Ich habe doch angedeutet, daß es mich an ein Erlebnis erinnert, das ich in diesem Sommer in Italien hatte, oder? Damals habe ich zum erstenmal einen Mann so ausrasten sehen. Ein schrecklicher Anblick (eigentlich habe ich es nicht nur beobachtet, sondern war dabei), nur daß die Folgen viel schlimmer waren, weil es dazu führte, daß ich mit Stefano zusammengekommen bin. Und schau nur, wohin mich das gebracht hat.
Es kommt mir vor, als wäre das schon eine Ewigkeit her.
Lucca liegt mitten in den Hügeln, aber die im Nordwesten der Stadt finde ich am schönsten. Dort wurde ziemlich weit oben auf einem Hügel, von dem man einen grandiosen Blick auf die Stadt hat (eine der schönsten Städte Italiens), ein altes Bauernhaus von innen und außen komplett saniert. Auftraggeber war ein britischer Geschäftsmann namens Murray – jedenfalls hat er die Kosten getragen. Die Arbeiten wurden von seiner Frau beaufsichtigt, Liz, und der Architekt und Projektleiter hieß Stefano. Liz konnte kein Italienisch, Stefano konnte kein Englisch, und da kam ich ins Spiel. Ich wurde geholt, um alles zu übersetzen – Gespräche und Papierkram –, und so wurde Liz Murray für sechs Monate zu meiner Arbeitgeberin.
Es ist ein ziemlicher Schock, wenn man einen Vertrag bei jemandem unterschreibt und zwei Tage später merkt, daß man es mit einer Teufelin von Boss zu tun hat. Liz als mies gelaunt und unflätig zu beschreiben, reicht bei weitem nicht aus. Sie war eine hochnäsige Kuh aus North London, die für alle Leute, die für sie arbeiteten – und offenbar auch für den Rest der Menschheit –, nur Verachtung empfand. Ob sie je selbst gearbeitet hatte, konnte ich nicht herausfinden. Auf jeden Fall ließ sie für nichts ein besonderes Talent erkennen, außer Leute herumzukommandieren, und in Angst und Schrecken zu versetzen. Zum Glück war mein Job klar definiert, und ich machte ihn gut oder bewies wenigstens Kompetenz. Liz hat sich zwar nie bei mir bedankt und mir außerdem immer das Gefühl gegeben, nur ihr Lakai zu sein, aber angeschrien hat sie mich nie. Stefano hingegen mußte die schlimmsten Beschimpfungen über sich ergehen lassen (die ich natürlich alle übersetzen mußte) und die Arbeiter auch. Schließlich hatten sie die Nase voll.
Ich weiß noch, daß es an einem Mittwoch passierte, einem Mittwoch gegen Ende August. Für fünf Uhr nachmittags war eine Besichtigung der Baustelle angesetzt.
Stefano, Liz und ich fuhren getrennt dorthin. Gianni, dessen Firma die Bauarbeiten durchführte, wartete schon auf uns. Er hatte mit vier anderen Männern den ganzen Tag geschuftet, sie waren schweißgebadet und gereizt. Die Fertigstellung der Arbeiten hatte sich schon um Wochen verzögert, und vermutlich wollten alle Urlaub haben wie der Rest Italiens. Es war unbeschreiblich heiß. Bei einer solchen Hitze sollte niemand arbeiten müssen. Trotzdem hatten sie (meiner Meinung nach) in den letzten Wochen unglaublich viel geschafft. Sie hatten das Becken eines riesigen Swimmingpools ausgehoben und fast vollständig gefliest. Allein das Fliesen hatte drei Tage gedauert. Sie hatten fünf Quadratzentimeter große Porzellanfliesen benutzt, jede in einem etwas anderen Blau. Es sah beeindruckend aus. Trotzdem schien es ein Problem zu geben.
»Was soll das?« fuhr Liz Gianni an und zeigte auf die Fliesen.
Ich übersetzte für ihn, und er antwortete: »Das sind die Fliesen, die Sie haben wollten.«
Sie sagte: »Sie sind zu groß.«
Er sagte: »Nein, Sie wollten fünf Zentimeter.«
Stefano trat vor und blätterte in seinen Unterlagen.
»Stimmt«, sagte er. »Die Bestellung ist fünf Wochen her.«
Liz sagte zu Gianni: »Aber seitdem habe ich meine Meinung geändert. Wir haben darüber gesprochen.«
Er sagte: »Ja, wir haben gesprochen. Sie konnten sich nicht entscheiden, also haben wir weitergemacht wie geplant.«
Liz sagte: »Ich hatte mich entschieden. Ich wollte kleinere Fliesen als diese. Drei Quadratzentimeter.«
Während sie stritten, schien Gianni langsam zu dämmern, was sie von ihm verlangte. Sie verlangte, daß er und seine Männer alle Fliesen abschlügen, Tausende neuer bestellten und wieder von vorn begännen. Und noch dazu auf seine Kosten, denn sie beharrte darauf, ihn mündlich angewiesen zu haben, die kleineren Fliesen zu benutzen.
»Nein!« sagte er. »Nein! Unmöglich! Sie ruinieren mich.«
Ich übersetzte für Liz, und sie antwortete: »Ist mir egal. Es ist Ihr Fehler. Sie haben mir nicht zugehört.«
»Aber Sie haben nicht klargemacht...«, sagte Gianni.
»Keine Widerworte, Sie beschissener Idiot. Ich weiß, was ich gesagt habe.«
Ich übersetzte, ließ allerdings »beschissener« aus.
Gianni war immer noch außer sich vor Wut. »Ich bin kein Idiot. Wenn hier jemand bescheuert ist, dann Sie. Sie ändern ständig Ihre Meinung.«
»Wie können Sie es wagen! Wie können Sie es wagen, mir die Schuld für Ihre Faulheit und Ihre eigene, verfickte Unfähigkeit zu geben?«
»Das kann ich nicht tun. Das wäre das Ende meines Betriebs, und ich muß eine Familie ernähren. Seien Sie vernünftig.«
»Wen interessiert das? Wen kratzt das?«
»Dämliches Weib! Dämlich! Sie haben fünf Zentimeter gesagt! Hier steht es schwarz auf weiß.«
»Wir haben es geändert, Sie Kretin. Wir haben darüber gesprochen, und ich habe drei Zentimeter gesagt, und Sie haben gesagt, Sie würden daran denken.«
»Das ist nie schriftlich festgehalten worden.«
»Aber nur, weil ich so dumm war zu glauben, Sie würden es im Kopf behalten, Sie Volltrottel von einem Fettsack. Ich dachte, drei Zentimeter könnten Sie leicht behalten, weil Ihr Schwanz genausolang ist.«
Sie wartete, daß ich übersetzte. Ich sagte: »Das übersetze ich nicht.«
»Ich bezahle Sie dafür«, erwiderte sie spitz, »daß Sie alles übersetzen, was ich sage. Machen Sie schon. Übersetzen Sie jedes einzelne Wort.«
Ich senkte die Stimme und übersetzte Liz’ letzten Satz. Und gleich darauf geschah es: Mit Gianni ging eine erstaunliche Verwandlung vor sich – mit diesem großen, sanften, netten Mann. Auf einmal waren seine Augen voller Hass, und ohne nachzudenken riss er ein Werkzeug aus der neben ihm stehenden Kiste – es war ein Meißel, ein riesiger Meißel – und sprang auf seine Auftraggeberin zu und brüllte sie an, er brüllte unverständliche Worte der Wut und mußte von seinen Arbeitskollegen zurückgehalten werden, schaffte es aber noch, Liz einen Schlag auf den Mund zu verpassen. Worauf sie mit blutenden Lippen ins Haus rannte, in die Küche, die gerade einen Wasseranschluss bekommen hatte, und ein paar Minuten später hörten wir sie wegfahren, ohne daß sie mit einem von uns noch ein Wort gesprochen hätte.
Danach packten die Männer schweigend und routiniert ihr Werkzeug ein. Stefano und Gianni führten in einer stillen Ecke des Gartens, im Schatten einer Zypresse, ein langes Gespräch. Ich hatte Stefano gefragt, ob ich fahren könne, doch er hatte geantwortet, es wäre schön, wenn ich noch ein bißchen bliebe. Ich saß ungefähr zwanzig Minuten in der zukünftigen Loggia und wartete, und als Stefano sein Gespräch mit dem Bauunternehmer beendet hatte, kam er zu mir und sagte: »Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich brauche nach dieser Sache einen Drink – möchten Sie mitkommen?«
Wir fuhren zu einem Restaurant, das nicht weit entfernt vom Bauernhaus an der Landstraße lag und ebenfalls einen Blick auf Lucca bot, und wir saßen einige Stunden auf der Terrasse und tranken Grappa und Wein, aßen Pasta und unterhielten uns, bis die Sonne unterzugehen begann, und mir fiel auf, wie gut er aussah, wie sanft sein Blick war und wie fröhlich und kindlich er lachte, wobei er jedesmal die Schultern schüttelte, und er sagte mir, er wäre unglaublich erleichtert, wenn Liz ihn feuerte, denn sie sei die schlimmste Kundin, die er je gehabt habe, und der Streß mit ihr gebe ihm fast den Rest, und das könne er jetzt gar nicht gebrauchen, denn von allem anderen abgesehen habe er große Eheprobleme. Nachdem er das gesagt hatte, blieben wir stumm, als wüßten wir beide nicht, wie ihm das hatte herausrutschen können. Dann erzählte er mir, daß er seit sieben Jahren verheiratet sei und eine vierjährige Tochter namens Annamaria habe, aber nicht wisse, wie lange es mit seiner Frau noch gutgehe, weil sie ihn betrogen habe, und obwohl sie ihre Affäre inzwischen beendet habe, sei er immer noch tief verletzt, die Sache verletze ihn schlimmer als alles andere, was ihm im Leben widerfahren sei, und er wisse nicht, ob er ihr je vergeben oder je wieder das gleiche für sie empfinden könne wie zuvor. Ich nickte und murmelte etwas Teilnahmsvolles und sprach tröstende Worte, aber selbst da, ganz am Anfang, war ich zu blind und machte mir zuviel vor, um mir eingestehen zu können, daß ich bei seinen Worten innerlich jubelte, daß ich genau das hatte hören wollen. Am Ende des Abends gab er mir auf dem Parkplatz des Restaurants einen Kuß – er küßte mich auf die Wange, es war nicht nur freundschaftlich, denn er fuhr mir dabei sanft übers Haar, und ich fragte ihn, ob er meine Handy-Nummer wolle, und er erinnerte mich daran, daß er sie ja längst habe, sie stehe auf meiner Visitenkarte, und er sagte, er wolle mich bald wieder anrufen.
Er meldete sich am nächsten Vormittag bei mir, und abends gingen wir wieder essen.
Leben im Luxus
Hyatt Regency Hotel
Birmingham
13. Dezember 1999
Spätnachts
In diesem Hotel bin ich wieder zu mir selbst gekommen. Keine Ahnung, wieso, denn ich war nie besonders gut darin, mit den Augen zu klimpern und das hilfsbedürftige Frauchen zu spielen. Doch als ich gestern nachmittag hier ankam – und wohl ziemlich fertig aussah –, nur mit ein paar Kleidern, die ich in eine Reisetasche gestopft hatte (den Rest meiner Sachen habe ich erst einmal bei Dad gelassen), stand einer der Junior-Manager hinter der Rezeption, und er hat mir einen riesigen Gefallen getan. Er sagte, im Moment seien alle Vorstandssuiten frei, und ich könne gern eine davon haben. Und ich kann dir sagen, liebe Schwester, es ist herrlich. Nach vier grauenhaften Tagen in Dads puritanisch kargem Haushalt kann ich mich endlich entspannen und das Leben genießen. Die eine Hälfte der Zeit habe ich im Bad verbracht, die andere Hälfte damit, die Minibar zu plündern. Das will natürlich alles bezahlt sein, aber es ist der letzte kleine Luxus, den ich mir gönne, bevor ich mich ernsthaft daranbegebe, mein Leben neu zu ordnen. Jetzt glitzern die Lichter Birminghams unter mir, und ich habe plötzlich das Gefühl, als stünde mir die ganze Welt offen.
Ich erzähle Dir jetzt noch von diesem Abend, dann lasse ich Dich in Frieden.
Also: Vor ein paar Stunden beschließe ich, doch so anständig zu sein, mir Benjamins Band anzuhören. Der Pub, in dem sie spielen, The Glass and Bottle, liegt nur fünf Minuten zu Fuß von hier am Kanal. Phil und Patrick werden da sein und auch Emily – höchste Zeit, mal wieder mit ihr zu reden. Es besteht keine Gefahr, Doug Anderton über den Weg zu laufen, weil er gerade in London in der Queen Elizabeth Hall (natürlich ein etwas prestigeträchtigeres Etablissement als The Glass and Bottle, diesen Gedanken kann ich mir dann doch nicht verkneifen, aber was soll’s) vom alten Jahrhundert Abschied nimmt. Also habe ich im Grunde keine Ausrede dafür, dem Konzert fernzubleiben.
Trotzdem überlege ich unterwegs, warum ich mich innerlich dagegen sträube, mich heute abend unter das Publikum zu mischen. Es hat weder mit meinem Musikgeschmack noch mit dem Gefühl zu tun, daß es auf eine etwas morbide Art nostalgisch werden könnte. Ich versuche, ehrlich mit mir selbst zu sein, und ich weiß, daß es – wenigstens teilweise – daran liegt, daß ich in der Schulzeit ein bißchen in Benjamin verknallt war und es noch jetzt, nach all den Jahren, komisch fand, ihm im Buchladen über den Weg zu laufen. Nicht nur wegen seiner Bekannten oder weil deutlich war, daß ich bei etwas störte, das mehr als nur ein Treffen zweier guter Freunde war. Nein, da war noch etwas, und eigentlich kann ich es kaum fassen, weil ich seit mehr als zehn Jahren keinen Gedanken mehr an Benjamin verschwendet habe (wirklich), aber trotzdem war es da – ein zäher, kleiner Rest dessen, was ich einmal für ihn empfunden habe. Das ist doch ärgerlich – und auch irgendwie deprimierend, oder? Und es ist wirklich die letzte Erkenntnis, die ich im Moment gebrauchen kann. Im Moment ist es für meine Gesundheit, für mein seelisches Gleichgewicht und für mein Überleben am wichtigsten, daß ich Stefano so rasch und vollständig wie möglich vergesse. Aber wenn das unmöglich ist? Wenn diese Gefühle nie vergehen? Bin ich da nur ein Einzelfall – ein hoffnungsloser Einzelfall –, oder hat im Grunde jeder das gleiche Problem?
Ich stoße die Pubtür auf und vertausche das frostige Dunkel des Kanalufers mit einer Flut von Licht und warmer Luft und einem lauten Durcheinander von Stimmen.
Patrick sieht mich sofort, kommt zu mir, gibt mir einen dicken Kuss. Phil unterhält sich mit Emily. Wir fallen einander in die Arme. Hi, Emily, toll, dich zu sehen, ist ja eine Ewigkeit her und so weiter und so fort. Sie hat sich kein bißchen verändert. Keine grauen Haare (oder sie hat einen erstklassigen Friseur), immer noch eine gute Figur, sie wirkt sogar weniger pummelig als früher. (Gemeinerweise denke ich, daß es für kinderlose Frauen leichter ist, nicht aus den Fugen zu gehen.) Ich bitte um eine Bloody Mary, und Phil geht sie holen. (Man hat schon gemerkt, daß Patrick noch mindeijährig ist – leicht zu merken, um ehrlich zu sein –, und weigert sich, ihn zu bedienen.)
Der Pub ist ziemlich voll. »Sind alle wegen der Musik hier?« frage ich. Philip nickt. Er hat gute Laune, ist stolz, daß so viele Leute wegen Benjamin gekommen sind. Ich habe ja schon erzählt, daß Philip immer der anständigste von uns allen war. Die Demographie der Menge zu bestimmen, ist nicht schwierig: fast alles Männer, kurz vor dem mittleren Alter. Überall Bauchansatz. Die meisten Bandmitglieder haben inzwischen allerdings Familie, und deshalb gibt es auch Ehefrauen und einige verwirrt aussehende Teenager. Insgesamt sind es ungefähr sechzig oder siebzig Leute. Sie bilden Grüppchen und streben langsam der Bühne hinten in der Ecke des Pubs zu, auf der sich die Band bereitmacht. Benjamin sitzt an seinem Keyboard, runzelt konzentriert die Stirn, auf der ihm schon der Schweiß steht, drückt Knöpfe. Die Decke ist niedrig, und wahrscheinlich ist es heiß dort oben im Scheinwerferlicht. Ich sehe mich nach Malvina, seiner Bekannten, um und entdecke sie in einer anderen Ecke, sie sitzt allein an einem Tisch. Wir haben kurz Blickkontakt, mehr nicht. Ich weiß nicht, was sich hier gehört. Sie geht auf niemanden zu, wahrscheinlich sieht sie die Leute hier zum erstenmal. Soll ich sie vorstellen? Nein, zu riskant – ich möchte eine Situation, die schon ambivalent ist, nicht noch schwieriger machen. Ich frage mich, ob Emily von dieser Frau weiß, ob Benjamin ihr je von ihr erzählt hat. Ich wette, nicht. Emily betrachtet ihn gerade, wie er auf der Bühne sitzt, sie ist wie gebannt, sie verehrt ihren Helden. Er schließt ein Keyboard an einen Verstärker an und stellt einen Klavierstuhl auf, mehr nicht. Er bastelt kein Streichholzmodell von Westminster Abbey, er hackt auch keine Skulptur aus einem Eisblock oder so etwas in der Art. Trotzdem bewundert sie ihn immer noch und das nach sechzehn Jahren Ehe. Ich hätte wirklich nie damit gerechnet, daß die beiden es so lange miteinander aushalten. Aber irgendwie ist es nachvollziehbar: Benjamin sind Trennungen immer schwergefallen, weil er Streit und alles Schwierige haßt. Sein unausgesprochenes Lebensmotto lautet: Hauptsache, ich habe meine Ruhe, und das Leben mit Emily dürfte tatsächlich sehr ruhig sein. Aber eigentlich passen sie nicht gut zusammen. Ich fand immer, daß Benjamin sehr um sich selbst kreist. Damit meine ich nicht, daß er eigennützig oder (bewußt) verletzend wäre, sondern daß er sich seiner selbst sehr stark bewußt ist – im guten Sinne – und im Grunde keine andere Gesellschaft außer der eigenen braucht. Auf jeden Fall gibt er sich nicht uneingeschränkt hin. Emily ist da ganz anders. Sie hat Freude daran, sich ihren Freunden voll und ganz hinzugeben, und ich schätze, daß sie sich in einer Beziehung oder Ehe vorbehaltlos öffnet und hingibt und nichts von sich zurückhält. Sie hat weder Geheimnisse noch seelische Sperrbezirke. Und ich könnte mir vorstellen, daß es sie irgendwann frustiert hat – soviel von sich zu geben und von Benjamin so wenig zu bekommen. In all den Jahren muß sie solche Enttäuschungen immer wieder erlebt haben, es geht gar nicht anders. Nicht nur, was die Kinder betrifft, die fehlenden Kinder. Ich meine die kleinen Enttäuschungen. Die kleinen Arten, all die vielen Arten, auf die Benjamin sie hat hängen lassen. Im Laufe der Jahre.
Ich weiß, daß ich recht habe. Ich weiß, daß ich richtig liege, was die beiden betrifft. Später am Abend sehe ich es in Emilys Augen.
Der Gig (heißt das so? Es ist ein Wort, das ich nie wirklich ernst nehmen konnte) klappt prima. Ich habe die Band in den Achtzigern ein paarmal gehört, und ich weiß noch, daß mir ihre Musik schon damals ziemlich altmodisch vorkam. Sie spielten diese langen, funkigen Instrumentals, Jahre, bevor der Begriff »Acid Jazz« geprägt wurde, und diese Art von Musik wieder angesagt war. Damals kam sie mir bloß seltsam und anachronistisch vor. Doch heute abend gefällt sie mir sehr. Tolle Percussion – ich glaube, der Drummer hat mit Benjamin in einer Bank oder so gearbeitet, das war die Keimzelle der Band. Auf jeden Fall spielt er gut, genau wie der Bassist, und über diesem soliden Fundament weben Benjamin, der Gitarrist und der Saxophonist schöne, leicht melancholische Melodien (Benjamins Handschrift, vermute ich mal) und improvisieren klug und gekonnt. Keine selbstverliebten Soli, kein langes Herumgereite auf den immer gleichen zwei Akkorden, das das Publikum langweilt und zur Bar abwandern läßt. Nach den ersten zwei oder drei Stücken hören die Leute sogar auf, verlegen im Rhythmus mit den Füßen zu tappen und sich auf der Stelle zu bewegen. Sie tanzen! Wirklich, sie tanzen! Selbst Philip, der zwar ein Vorbild an Anstand und Nettigkeit sein mag, aber bestimmt kein Travolta auf der Tanzfläche ist. Emily tanzt mit vollem Einsatz. Sie ist erstaunlich beweglich. Sie tanzt wirklich mit Leidenschaft und hat ihren Spaß. Sie hat eine ganze Schar Freunde mitgebracht (»Kirchenkreisleute«, wie Phil meint), und mitten in einem Stück, das gerade den ersten Höhepunkt hinter sich hat und wieder ruhiger geworden ist, wendet sie sich, während die Leute klatschen und jubeln, einem dieser Freunde zu – einem großen, schmalhüftigen, gutaussehenden Mann –, und er beugt sich zu ihr hinab, und sie ruft: »Ich habe dir doch gesagt, daß sie gut sind, oder? Ich habe doch gesagt, daß sie phantastisch sind.«
Sie sieht so glücklich aus.
Ich kann mich nicht überwinden zu tanzen. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht, weil die letzten Tage so seltsam gewesen sind und die letzten paar Monate mich auf eine so lange und anstrengende emotionale Reise geführt haben.