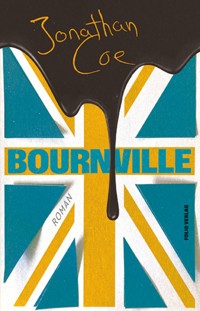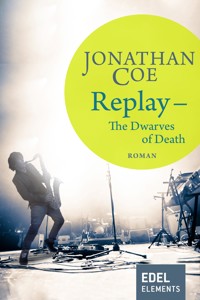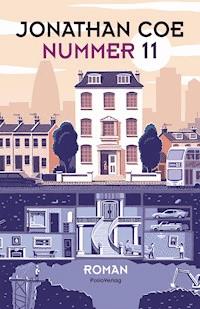
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folio Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Transfer Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Geschichten, die den Wahnsinn bezeugen – ein irrwitziges Sittenbild Großbritanniens. Rachel und Alison, Freundinnen aus Kindertagen, machen sich auf eine Reise in das fremde, irreale Herz Großbritanniens. Hilflos, mitgerissen von Strömen, die sie weder verstehen noch beeinflussen können, fnden die beiden eine von der Realität enttäuschte, doch den Reality-Shows innig zugetane Nation vor. Sie treffen auf moralisch bankrotte Bankiers, deren Keller mit Privatkinos, Hallenbädern und Weinlagern aufgemöbelt sind, und auf Menschen, die an der städtischen Essenstafel Schlange stehen. Mittendrin residiert eine alteingesessene Familie, die nichts für das eigene Land tut, aber alle Kraft darauf verwendet, dass das Land alles für ihren persönlichen Proft tut.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Foto © Valeria Cardi
DER AUTOR
Jonathan Coe, 1961 in Birmingham geboren, studierte in Cambridge und Warwick, lebt in London. Er zählt zu den wichtigsten und witzigsten lebenden zeitgenössischen britischen Autoren.
Seine Bücher sind in viele Sprachen übersetzt: u. a. Die Familie Winshaw, Das Haus des Schlafes, Die ungeheuerliche Einsamkeit des Maxwell Sim.
Zahlreiche Auszeichnungen, u. a. Prix Médicis, Ordre des Arts et des Lettres.
JONATHAN COE
NUMMER 11
Roman
Aus dem Englischen von Karin Fleischanderl
„Es gibt nämlich einen Punkt“ – er beugte sich vor und zeigte mit der Spritze auf Michael –, „wo Gier und Wahnsinn praktisch nicht mehr zu unterscheiden sind. Man könnte fast sagen, sie sind ein und dasselbe. Und es gibt einen anderen Punkt, wo die Bereitschaft, Gier zu tolerieren, friedlich neben ihr zu leben und sie sogar zu unterstützen, ebenfalls zu einer Art Wahnsinn wird.“
Jonathan Coe, Allein mit Shirley (1995)
Der schwarze Turm
„In einem anderen Teil unserer Weltgibt es Schatten und Dunkelheit.“
Tony Blair in einer Rede vor dem US-Kongress am 17. Juli 2003
1.
Schwarz und glänzend ragte der runde Turm in den schiefergrauen Oktoberhimmel. Als Rachel und ihr Bruder sich ihm aus dem Osten über das Moor näherten, stellten sie fest, dass er von zwei blattlosen, skelettförmigen Eschen umrahmt wurde. Es war ein windstiller Nachmittag, kurz vor der Dämmerung. Sie gingen auf die Bäume zu, dort würden sie sich wie gewöhnlich auf die Bank setzen, die dazwischen stand, und auf die nicht weit entfernte Ortschaft Beverley zurückblicken, auf die ordentlichen Häusergruppen und die riesigen, identischen, grauen Türme des Münsters.
Nicholas ließ sich auf die Bank fallen. Rachel hingegen, die damals erst sechs war, acht Jahre jünger als er, konnte es gar nicht erwarten, zu dem schwarzen Turm hinzulaufen, in seine Nähe zu gelangen. Während ihr Bruder sich ausruhte, rannte sie weiter, stapfte durch den von den Kühen zertrampelten Schlamm rund um den Sockel des Turms, bis sie direkt davor stand und ihre Hand auf die glänzenden schwarzen Ziegel legen konnte. Mit beiden Handflächen am Turm schaute sie nach oben und konnte es nach wie vor nicht fassen, wie groß er war und dass er eine perfekte, glänzende Kurve beschrieb, sich vor dem bedrohlichen Himmel, über den zwei krächzende Krähen endlos im Kreis flogen, nach hinten zu neigen schien.
„Was war das früher einmal?“, fragte sie.
Nicholas war ihr gefolgt. Er zuckte mit den Achseln.
„Keine Ahnung. Vielleicht so eine Art Windmühle.“
„Glaubst du, wir können hineingehen?“
„Es ist zugemauert.“
Eine Holzbank lief rund um den Sockel des Turms, und Rachel setzte sich neben Nicholas und starrte in seine abwesenden blassblauen Augen, die zwar kalt waren, ihr aber dennoch das Gefühl gaben, dass sie sich glücklich schätzen konnte, einen älteren, derart gutaussehenden und selbstsicheren Bruder zu haben. Sie hoffte, eines Tages genauso blonde Haare, einen genauso wohlgeformten Mund und eine genauso flaumbedeckte, reine Haut zu haben wie er. Sie schmiegte sich an seine Schulter, so nah, wie sie sich traute. Sie wollte ihn nicht bedrängen, ihm nicht zu sehr zeigen, dass er der Einzige war, der ihr in dieser merkwürdigen und fremden Stadt Sicherheit gab.
„Ist dir vielleicht kalt?“, fragte er und schaute zu ihr hinunter.
„Ein bisschen.“ Sie rückte etwas zur Seite. „Ist es warm, dort, wo sie sind?“
„Natürlich. Es hat doch keinen Sinn, in ein Land auf Urlaub zu fahren, wo es kalt ist, oder?“
„Ich wünschte, sie hätten uns mitgenommen“, sagte Rachel sehnsüchtig.
„Haben sie aber nicht. Basta.“
Sie schwiegen eine Zeitlang; jeder versuchte für sich das Rätsel zu lösen, warum ihre Eltern mitten im Jahr ohne sie auf Urlaub gefahren waren. Als die Kälte zu stechen begann, sprang Nicholas auf.
„Los“, sagte er. „Besichtigen wir die Kathedrale, bevor es finster wird?“
„Es ist ein Münster, keine Kathedrale“, sagte Rachel.
„Egal. Eine große alte Kirche eben, egal, wie du sie nennst.“
Er ging schnell davon, und Rachel lief ihm nach und versuchte mit ihm Schritt zu halten, doch lange bevor sie die Hauptstraße erreicht hatten, blieben sie stehen; sie sahen, dass ihnen zwei Personen entgegenkamen. Eine saß in einem Rollstuhl; offenbar eine sehr alte Frau, die man aufgrund des kalten Nachmittags in mehrere Schichten dicker Wolldecken eingewickelt hatte. Ihre Züge waren kaum zu erkennen, ihr Kopf hing müde herab, und ihr Gesicht wurde zum Großteil von einem Seidenschal bedeckt. Je länger die Kinder sie betrachteten, desto mehr waren sie davon überzeugt, dass sie schlief. Der Stuhl wurde unsanft von einem jugendlich wirkenden Mann geschoben, er trug eine Motorradkluft und irgendetwas saß auf seinem linken Vorderarm. Zuerst war nicht zu erkennen, was dieses „etwas“ war, doch je näher die Gestalten kamen, desto deutlicher wurde es – obwohl das völlig unwahrscheinlich war –, dass es ein Vogel war. Die Ahnung bestätigte sich plötzlich auf dramatische Weise, als das Tier seine Flügel beeindruckend weit spannte und vor dem Hintergrund des grauen Himmels träge flatterte. In diesem Augenblick wirkte die schwarze Silhouette eher wie ein fantastisches Mischwesen aus der Mythologie denn wie ein echter Vogel, wie irgendein Vogel, den Rachel je gesehen hatte.
Nicholas bewegte sich nicht, und Rachel neben ihm fasste ihn an der Hand, sie genoss seinen schwachen Händedruck, sogar durch die dicken, kratzigen Wollfäustlinge spürte sie die Kälte seiner Hand. Unschlüssig, was sie tun sollten, beobachteten sie den Mann in der Lederkluft, er stellte den Rollstuhl ab und sagte ein paar Worte zu dem Vogel, der folgsam von seinem Arm auf einen Griff des Rollstuhls hüpfte. Der Mann, der nun beide Arme frei hatte, überprüfte, ob die alte, ihm anvertraute Dame nicht fror und ob sie bequem saß, zupfte an den Decken und stopfte sie noch sorgfältiger zwischen sie und den Stuhl. Dann wandte er sich dem Vogel zu.
Rachel ging weiter und versuchte ihren Bruder mitzuziehen.
„Was tust du?“
„Ich dachte, du wolltest weitergehen.“
„Schon. Aber vielleicht ist es gefährlich.“
Der Mann hatte ein Stück Schnur herausgeholt, an dessen Ende etwas befestigt war, und ließ sie langsam über seinem Kopf kreisen. Die Straße war in diesem Augenblick kaum befahren, und der Nachmittag war so ruhig, dass die beiden Kinder das regelmäßige laute Geräusch – SWUSCH – der durch die Luft sausenden Schur ganz deutlich hörten. Sie hörten sogar das Flattern des Turmfalken (mittlerweile war es klar, dass es ein Turmfalke war), als er aufflog, um den Köder zu schnappen; mit tödlicher Präzision stürzte er sich immer wieder auf das Fleischstück am Ende der Schnur, doch im letzten Augenblick zog der Mann sie mit großer Kraft und Kunstfertigkeit zurück, weshalb er sie immer wieder verfehlte. Immer wenn der Vogel den Köder verfehlte, tauchte er nach unten, flog tiefer und gewann wieder gleichmäßig an Höhe, schwang sich empor, bis er den Höhepunkt der Flugbahn erreicht hatte, dort stand er ganz kurz still, trudelte und stürzte sich wieder mit übernatürlicher Geschwindigkeit und Präzision nach unten, in Richtung des begehrten Fleischstücks, das im allerletzten Augenblick seinem begehrlich aufgerissenen Schnabel entrissen wurde.
Nachdem dieses betörende Ritual zwei- oder dreimal wiederholt worden war, gingen Nicholas und Rachel vorsichtig weiter. Der Mann stand mitten auf dem Weg und ließ den Köder über seinem Kopf kreisen, deshalb wichen sie ein wenig aus – zumindest so weit, dass sie nicht von der kreisenden Schnur erfasst wurden. Nicht weit genug für den Falkner, er brüllte sie wütend an, ohne den Blick auch nur eine Sekunde von dem Falken abzuwenden.
„Geht mir aus dem Weg. Geht mir verdammt noch mal aus dem Weg!“
Nicht die Wut überraschte die Kinder. Sondern der Ton der Stimme: hoch, schrill und eindeutig weiblich. Jetzt waren sie nur noch ein paar Meter von der strammen, konzentrierten Gestalt in Motorradkluft entfernt, und der Irrtum war offensichtlich. Es war eine Frau: Grob geschätzt war sie so fünfundvierzig – allerdings waren sie nicht sehr gut darin, das Alter von Erwachsenen zu schätzen. Ihr Gesicht war bleich, die Wangen waren eingesunken, sie trug einen strengen und kompromisslosen Bürstenschnitt. Die Ohren und die Nase waren gepierct, mit allerlei Silberringen und -steckern versehen. Ein fahles, blaugrünes Tattoo von ungewisser Größe bedeckte offenbar einen Großteil ihres Nackens und Halses. Zweifellos die furchterregendste Frau, die Rachel je gesehen hatte. Sogar Nicholas schien erschrocken. Abgesehen von ihrem irritierenden Äußeren war da der zunehmend ärgerliche Ton in ihrer Stimme angesichts der Kühnheit, wenn nicht gar Frechheit der Kinder, die es wagten, auf das Territorium vorzudringen, das sie offenbar als ihr Eigentum und das des Vogels betrachtete. „Verschwindet! Haut ab!“, schrie sie. „Geht mir aus dem Weg! Habt ihr denn keine Augen im Kopf!“
Nicholas packte seine Schwester fester an der Hand und bog scharf nach links ab, sodass sie die Gefahrenzone verließen. Sie gingen immer schneller, bis sie nahezu rannten. Erst in einem Sicherheitsabstand von ungefähr zwanzig Metern blieben sie stehen und drehten sich ein letztes Mal um. Es war ein Gemälde, ein Anblick, der sich Rachels Gedächtnis auf immer und ewig einbrannte: die „Verrückte Vogelfrau“ (wie sie sie von nun an nannten), die mit wütender Energie und Konzentration den Köder über ihrem Kopf kreisen ließ, die unglaubliche Schnelligkeit und Selbstverständlichkeit, mit der sich der Vogel auf die Beute stürzte und dann wieder emporflog, unermüdlich, obwohl er immer wieder leer ausging; im Hintergrund der hohe, unerbittliche, sich krümmende schwarze Turm; und davor die alte Dame im Rollstuhl, die jetzt ganz wach war. Mit hellen, leuchtenden Augen folgte sie den Bewegungen des Vogels, ihre grellrot geschminkten Lippen verzogen sich zu einem begeisterten Lächeln, während sie den immer wieder aufs Neue herabstoßenden Vogel anfeuerte: „Los, Tabitha! Hol es dir. Komm runter und hol dir das Fleisch. Runter, Tabitha, runter!“
Rachel mochte den Anblick des Münsters überhaupt nicht. Als sie sich vom nördlichen Innenhof her dem Haupttor näherten, war es fast Viertel nach vier und es dämmerte bereits. Die dünnen Nebelschwaden, die den ganzen Tag durch die Straßen und zwischen den Häusern dahingezogen waren, verfärbten sich im schwindenden Licht bläulich, schraubten und wanden sich um die Straßenlaternen mit ihren verschwommenen gelben Aureolen. Als Rachel widerwillig auf das Münster zuging, senkte sich ein noch dunkleres, trüberes blauschwarzes Licht herab und breitete sich aus, sodass dessen Mauern kaum noch zu sehen waren: Die bedrohlich näher kommende, schwere Kirche schien ein einschüchterndes Flüstern von sich zu geben. Die Kälte, die sich zum ersten Mal auf der Westwood-Weide, am Fuße des schwarzen Turms, bemerkbar gemacht hatte, kroch ihr jetzt in die Knochen und nahm sie unbarmherzig in Besitz, die Knochen selbst schienen mittlerweile aus Eis zu bestehen. Sie zog den Dufflecoat enger um ihren zitternden Körper, vergrub die Hände ganz tief in den mit Bonbonpapier gefüllten Taschen, doch nichts konnte sie vor dieser Kälte schützen. Gleich darauf zwangen Kälte und Angst sie, stehen zu bleiben, nur ein paar Meter von dem Tor entfernt.
„Was ist jetzt wieder los?“, fragte Nicholas sauer.
„Müssen wir unbedingt hinein?“
„Warum nicht? Deshalb sind wir ja so weit gegangen.“
Rachel zögerte noch immer. Ihr Unbehagen angesichts der Vorstellung, durch das Tor des Münsters zu treten, wuchs unerklärlicherweise und verwandelte sich in Panik. Nicholas nahm sie wieder an der Hand, doch diesmal hatte die Geste nichts Tröstliches; er zerrte sie zur Tür.
Einen Augenblick später standen sie im Dunkeln. Zumindest waren sie durch das Tor getreten und standen in einem kleinen Vestibül, doch bevor sie weitergingen, passierte etwas Seltsames. Sie hatten geglaubt, in dem engen Raum allein zu sein, doch plötzlich trat leise und ohne Vorwarnung eine Gestalt aus dem Dunkeln. Wahrscheinlich aus einem finsteren, entfernten Winkel. Der Mann stand ganz plötzlich vor ihnen und seine Schritte auf den Fliesen waren so geräuschlos gewesen, dass Rachel unwillkürlich einen Schrei ausstieß.
„Tut mir leid“, sagte er zu dem kleinen Mädchen, „habe ich dich erschreckt?“
Es war ein kleiner, auffälliger Mann: Sein Haar war albinoweiß, seine Haut fast durchscheinend hell und er hatte keine Augenbrauen. Er trug einen schäbigen braunen Regenmantel über einem hellgrauen Anzug, und dazu eine sehr breite braune Krawatte, wie sie vielleicht vor fünfundzwanzig Jahren, in den Siebzigern, modern gewesen war.
„Kann ich was für euch tun?“, fragte er. Sein Tonfall war freundlich, aber auch bedrohlich. Er lispelte leicht, was Rachel an das Zischen einer Schlange erinnerte.
„Wir wollten gerade hineingehen und uns ein wenig umsehen“, sagte Nicholas.
„Das Münster ist schon zu“, sagte der Mann. „Um vier wird es geschlossen.“
Ein warmes Gefühl der Erleichterung durchflutete Rachels Körper. Sie mussten nicht hineingehen. Sie würden umdrehen und nach Hause gehen; zum Haus ihrer Großeltern, ebenfalls eine Art Sanktuarium. Der Albtraum blieb ihr erspart.
„Ach. Na dann“, sagte Nicholas enttäuscht.
Der Mann zögerte.
„Na geht schon hinein“, sagte er mit einem Lächeln und einem unheimlichen Blinzeln. „Ihr dürft euch ein paar Minuten lang umsehen. Sie sperren nicht gleich zu.“
„Sind Sie sicher? Das ist aber sehr freundlich von Ihnen.“
„Kein Problem, Junge. Wenn wer fragt, sagt einfach, Teddy hat gesagt, es sei okay.“
„Teddy?“
„Teddy Henderson. Der Hilfswärter. Jeder kennt mich hier.“ Er bemerkte, dass die Kinder zögerten. „Los! Worauf wartet ihr?“
„Okay. Danke!“
Und schon war Nicholas durch das Haupttor getreten, und Rachel musste sich entscheiden, ob sie ihm folgen oder mit dem lächelnden Mr Henderson im Vestibül stehen bleiben sollte. Im Grunde hatte sie keine Wahl. Ohne einen weiteren Blick auf den unheimlichen Fremden zu werfen, holte sie tief Luft und folgte ihrem Bruder.
Draußen vor dem Münster und im Vestibül war es still gewesen, doch in dem großen Kirchenschiff umgab Rachel eine Stille ganz anderer Art. Sie war überwältigend. Rachel hielt einen Augenblick lang inne, lauschte, saugte die Stille auf, hielt den Atem an. Dann ging sie Richtung Mittelgang, und in dem stillen Gewölbe klangen selbst die vorsichtigen, leisen Schritte wie die eines Eindringlings. Sie blickte sich nach Nicholas um, sah ihn jedoch nicht. Die Kälte und die Dunkelheit bedrückten sie. Die Wände wurden von ein paar schwachen Lämpchen erhellt, und in den Leuchtern oben in der Nähe der Kanzel brannten ein paar Kerzen. Aber nichts konnte das Gefühl beschwichtigen, sich in einer überwältigenden Düsterkeit und einer außerirdischen Stille zu befinden. Wohin war Nicholas verschwunden? Rachel ging schnell den Mittelgang hinunter, schaute ängstlich nach rechts und links. Er konnte nicht weit sein: Sicher würde sie ihn gleich finden. Sie war schon fast beim Chorgestühl, als ein Geräusch ihr Blut gefrieren ließ, ein Geräusch, als würde etwas zufallen, laut und lang widerhallend. Das Geräusch einer zufallenden Tür. Sie wirbelte herum. War es das Haupttor? Hatte Mr Henderson zugesperrt und war nach Hause gegangen? Eine ihrer frühesten und wildesten Ängste bestand darin, nach Einbruch der Dunkelheit irgendwo eingesperrt zu werden und die Nacht an einem fremden und einsamen Ort verbringen zu müssen. Stand ihr das jetzt bevor? Am liebsten wäre sie zum Tor gegangen und hätte nachgesehen, doch sie blieb wie angewurzelt stehen. Sie war wie gelähmt. Tränen schossen ihr in die Augen, und ihr Körper verkrampfte sich, krümmte sich vor Angst.
Sie spürte eine Bewegung hinter sich, hörte Stimmen, Flüstern. Sie schnellte herum und glaubte zwei Gestalten zu erkennen, die sich im Schatten des Chorgestühls unterhielten. Sie holte tief Luft und mit dem Mut der Verzweiflung rief sie: „Wer ist da?“
Nach ein paar Sekunden schwiegen die Stimmen und eine der Gestalten trat vor. Es war Nicholas. Rachel hielt sich gerade noch zurück, um nicht vor Glück laut aufzuschreien. Sie rannte zu ihm hin und umarmte ihn. Er umarmte sie auch, aber in seiner Geste lagen Kälte und Sorge. Er blickte nicht zu ihr hinunter, schien kaum wahrzunehmen, dass sie sich an ihn klammerte. Gleich darauf befreite er sich – stieß sie weg – und dann drehte er sich wieder zu der Stelle um, wo er mit jemandem gesprochen hatte, mit gerunzelter Stirn, als ob er etwas Besorgniserregendes gehört hätte.
„Wo warst du?“, fragte Rachel sanft und vorwurfsvoll. Er antwortete nicht, sie fragte: „Wer war das? Mit wem hast du gerade gesprochen?“
„Mit einer der Wärterinnen.“ Nicholas starrte noch immer in den hinteren Teil der Kirche. Dann schüttelte er den Kopf und sagte gleichzeitig forsch und nervös: „Los, wir sollten gehen. Das war keine gute Idee.“
Er ging zum Haupttor, Rachel trottete hinter ihm her, konnte kaum Schritt halten.
„Nick, warte! Kannst du nicht langsamer gehen?“
Die Tür des Vestibüls stand noch immer offen, aber das Haupttor, das hinausführte, war schon geschlossen.
„Es ist zu!“, sagte Nick sinnloserweise, nachdem er die Klinke ein paarmal nach unten gedrückt hatte.
„Ich weiß. Ich habe gehört, wie er zugesperrt hat. Der Mann mit den komischen Haaren.“
„Komm.“
Er ging wieder in Richtung des Chorgestühls und sie hastete hinter ihm her.
„Wohin gehen wir? Wie kommen wir jetzt hinaus?“
„Es gibt noch einen Weg. Eine kleine Tür auf einem Gang. Das hat mir die Frau gesagt.“
Selbst Rachel bemerkte jetzt den panischen Ton in der Stimme ihres Bruders; und das machte ihr noch mehr Angst als alles andere. Sie wusste, wenn Nicholas Angst hatte, lief etwas völlig schief.
„Weißt du noch, wo sie ist? Sie könnte uns den Weg hinaus zeigen.“
„Keine Ahnung, wo sie ist.“
Die Kerzen waren jetzt gelöscht, und mit einem Knacksen, das, von den Wänden des Münsters verstärkt, ein hundertfaches Echo verursachte, gingen alle Lichter aus. Dunkelheit umgab sie. Da war nur noch ein winziger schwach leuchtender Lichtpunkt an der Nordseite des Kirchenschiffs.
„Los“, sagte Nicholas, „das ist wohl die Tür.“
Sie versuchte ihn wieder an der Hand zu packen, aber er war schon weg. Diesmal rannte sie, um Schritt mit ihm zu halten. Innerhalb von Sekunden hatten sie eine rundbogige Tür erreicht, sie führte auf einen engen, niedrigen Gang, an dessen Ende sich eine Tür mit der Aufschrift „Notausgang“ befand.
„Puh – da ist sie“, sagte Nicholas. „Gleich haben wir’s geschafft.“
Sie folgte ihm auf den schmalen Gang, aber anstatt die Tür zu öffnen, lehnte er sich heftig atmend an die Wand, um sich zu beruhigen.
„Was ist?“, fragte Rachel. Ihr Bruder gab keine Antwort, und deshalb folgte sie einer Ahnung und stellte eine präzisere Frage: „Es hat etwas mit dem zu tun, was die Frau gesagt hat, nicht wahr? Was hat sie zu dir gesagt?“
Nicholas drehte sich zu ihr um, und seine Stimme senkte sich zu einem verschwörerischen Flüstern. „Sie hat mich gefragt, was ich hier tue, und ich habe geantwortet, Mr Henderson hätte uns hereingelassen und gesagt, es sei okay, wenn wir uns ein wenig umschauten. Aber sie sagte, das sei unmöglich. Sie sagte …“
Er verstummte. Rachel war wie gelähmt, sie konnte nicht sprechen, starrte unbeweglich ihren Bruder an, ihre Augen warteten auf eine Erklärung.
Schließlich schluckte Nicholas hart und beendete den Satz, in einem einerseits weicheren, andererseits eindringlicheren Flüsterton denn je: „Sie sagte: Das kann nicht sein. Teddy Henderson ist vor mehr als zehn Jahren gestorben.“
Er blickte zu ihr hinunter, wartete auf ihre Reaktion. Sie erwiderte seinen Blick, ihr Blick war fest und ausdruckslos. Offenbar hatte sie nicht ganz verstanden, was er gesagt hatte. Es war zu schrecklich. Aber langsam sickerte es in sie ein. Ihre Augen weiteten sich und sie presste entsetzt die Hände auf den Mund.
„Du meinst … du meinst …?“
Nicholas nickte langsam und dann drückte er schweigend die Klinke des Notausgangs, riss sie auf und war auch schon draußen. Er war draußen in der eiskalten Oktoberluft und rannte den Weg hinunter, der zum nördlichen Innenhof und zurück zu den Läden und in Sicherheit führte. Er ließ Rachel weit zurück, und erst als er im Eingang eines Süßwarengeschäfts innehielt, um Atem zu schöpfen, holte sie ihn ein. Panisch, verwirrt und kopflos war sie über die Straßen gelaufen; aber sie erinnerte sich gar nicht mehr daran. Jetzt stand sie da und sah, wie Nicholas sich krümmte, wie seine Schultern bebten. Wie üblich hätte sie ihn am liebsten umarmt, sich an ihn geklammert, doch diesmal hielt sie etwas zurück. Irgendetwas machte sie zunehmend argwöhnisch. Sie sah ihn genauer an. Als ihr Herzschlag langsamer und regelmäßiger wurde, kehrte auch ihre Fähigkeit zu vernünftigem Denken zurück. Die Erkenntnis traf sie mit voller Wucht. Seine Schultern bebten nicht vor Angst, sondern vor Lachen. Nicholas lachte – stumm, unwillkürlich, unaufhörlich. Sie konnte sich noch immer nicht vorstellen, was ihn derart zum Lachen brachte. Offenbar war das eine irrationale Reaktion auf die ausgestandene Angst.
„Was ist los?“, fragte sie ihn. „Was ist so komisch?“
Nicholas richtete sich auf und blickte auf sie hinunter. Er lachte so sehr, dass seine Augen tränten und er keine zusammenhängenden Worte hervorbrachte.
„Dein Gesicht … dein Gesicht“, stieß er schließlich hervor. „Dein Gesicht, als ich dir die Geschichte erzählt habe.“
„Was für eine Geschichte?“
„Ach, mein Gott, das war unbezahlbar.“ Sein Lachen verebbte und er bemerkte, dass ihn seine kleine Schwester noch immer verwirrt anstarrte. „Die Geschichte“, wiederholte er, „über den Typ, der uns in die Kirche hineingelassen hat.“
„Du meinst den Geist?“
Nicholas brach wieder in Lachen aus. „Nein, du Mongo“, sagte er, „Das war kein Geist. Das habe ich erfunden.“
„Aber die Frau, mit der du gesprochen hast, sagte doch …“
„Sie hat mir nur gesagt, wie wir hinauskommen.“
„Also was …“
Und dann begriff sie endlich. Sie begriff, was für einen grausamen Streich er ihr gespielt hatte. Der Junge, dem sie vertraute, von dem sie glaubte, er als Einziger könne sie trösten, hatte ihr einen tödlichen Schrecken eingejagt. Von all den Schrecken des heutigen Tages war das der schlimmste.
Doch sie schrie nicht, brach nicht in Tränen aus und brüllte ihn auch nicht an. Stattdessen überkam sie eine Art Benommenheit und sie sagte nur:
„Du bist schrecklich und ich hasse dich.“
Sie drehte sich um und ging weg, in irgendeine Richtung. Bis zum heutigen Tag weiß sie nicht genau, wie sie zum Haus ihrer Großeltern zurückgefunden hat.
2.
Das Paradox besteht darin: Meiner geistigen Gesundheit zuliebe muss ich annehmen, dass ich verrückt werde.
Worin bestünde die Alternative? Die Alternative bestünde darin zu glauben, dass das Ding, das ich gestern Nacht gesehen habe, wirklich ist. Und wenn ich das glaubte, würde ich aus Angst davor ebenfalls den Verstand verlieren. Anders gesagt, ich sitze in der Falle. Ich sitze zwischen zwei Stühlen, ich muss mich zwischen zwei Wegen entscheiden, und beide führen in den Wahnsinn.
Es ist die Ruhe. Die Stille und die Leere. Deshalb ist es so weit mit mir gekommen. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass in einem Haus mitten in einer Großstadt derart große Stille herrschen kann. Natürlich habe ich mich wochenlang mit dem Baulärm draußen abfinden müssen, mit dem Lärm der unablässig unter der Erde schürfenden und grabenden Männer. Aber das ist jetzt so gut wie vorbei, und nachts, wenn sie nach Hause gegangen sind, senkt sich wieder Stille herab. Und dann beginnt meine Fantasie zu arbeiten (ich klammere mich an den Gedanken, dass es tatsächlich nur Fantasie ist), und in der Dunkelheit und in der Stille denke ich allmählich, dass ich Dinge hören kann: ein Schaben, ein Rascheln. Bewegungen im Inneren der Erde. Das, was ich gestern gesehen habe, war nur eine vorübergehende Erscheinung, gerade mal ein paar Sekunden, eine Bewegung ganz hinten im dunklen Garten, und dann war das Ding, das Wesen, ganz kurz deutlich zu sehen, aber es kann unmöglich real sein. Der Anblick kann nur eine Erinnerung sein, die mich aufs Neue verfolgt, und aus diesem Grund habe ich beschlossen, die Erinnerung genauer zu prüfen, festzustellen, was ich daraus lernen kann, ihre geheime Botschaft zu verstehen.
Aber ich beginne auch aus einem anderen Grund zu schreiben, aus einem ziemlich banalen Grund, und zwar, weil ich mich langweile, und gewiss hat mich die Langeweile – die Langeweile und sonst nichts – in den Wahnsinn getrieben, mir diese absurden Visionen beschert. Ich brauche eine Aufgabe, eine Beschäftigung (natürlich habe ich gehofft, meine Arbeit für diese Familie könnte eine solche Beschäftigung sein, aber bis jetzt war es ein sehr merkwürdiger Job, ganz anders als erwartet). Deshalb habe ich beschlossen, dass meine Aufgabe darin besteht, etwas zu schreiben. Seit meinem ersten Jahr in Oxford habe ich nichts Ernsthaftes mehr geschrieben, obwohl Laura, kurz bevor sie gegangen ist, mir gesagt hat, ich solle weiterschreiben, meine Texte gefielen ihr, sie hielte mich für talentiert. Aus ihrem Mund bedeutete das viel. Es bedeutete alles.
Außerdem hat Laura mir gesagt, beim Schreiben müsse man organisiert sein. Man solle von vorne beginnen und alles der Reihe nach erzählen. Genau wie sie, nehme ich mal an, als sie mir die Geschichte von ihrem Mann und dem „Kristallgarten“ erzählt hat. Aber offenbar halte ich mich nicht sehr an ihre Ratschläge.
Schon gut. Ich werde also mit dem Gefasel aufhören und versuchen, einen weiteren Besuch bei meinen Großeltern in Beverley im Sommer 2003 zu beschreiben. Diesmal war ich nicht mit meinem Bruder dort, sondern mit Alison, meiner lieben Freundin Alison, die ich nach Jahren unerklärlicher Distanz und Entfremdung endlich wiedergefunden habe, und mit der mich jetzt wieder eine kostbare Freundschaft verbindet. Eigentlich ist das unsere Geschichte, die Geschichte, wie wir einander nahekamen, bevor wir uns aufgrund merkwürdiger – um nicht zu sagen, lächerlicher – Kräfte entfremdeten. Und es ist auch die Geschichte von –
Aber nein, ich will nicht zu viel verraten. Beginnen wir von vorne.
3.
Am Freitag, den 18. Juli 2003, 8:30 Uhr, fand die Polizei in Oxfordshire die Leiche des UNO-Waffeninspektors Dr. David Kelly. Sie wurde in einem Waldstück am Harrowdown Hill gefunden, nördlich des Dorfes Longworth, in einer Entfernung von weniger als einer Meile, an einem nur zu Fuß erreichbaren Ort. Dr. Kelly machte hier manchmal seinen Nachmittagsspaziergang. Die Behörden kamen ziemlich rasch zu dem Schluss, dass es sich um Selbstmord handelte.
Sein Tod erregte große öffentliche Aufmerksamkeit. Um die Unterstützung Großbritanniens bei der Invasion der USA im Irak zu erhalten, hatte Tony Blair den Briten einzureden versucht, Saddam Husseins Regime stelle eine massive Bedrohung für die nationale Sicherheit dar. In einem Regierungsdossier war die Behauptung aufgestellt worden, Saddam Hussein sei im Besitz von Massenvernichtungswaffen, die innerhalb von 45 Minuten gefechtsbereit wären. Nach einem Interview mit Dr. Kelly hatte eine BBC-Journalistin in einem Bericht behauptet, diese Behauptung sei unrealistisch und das Dossier sei frisiert worden, um den Kriegseintritt zu unterstützten. Aufgrund des allgemeinen Verdachts, Dr. Kelly, Großbritanniens führender internationaler Waffeninspektor, sei die Quelle dieses Berichts, wurde er augenblicklich zur umstrittenen und politisch unbequemen Figur.
Keine Ahnung, warum ich so oft über den Tod David Kellys nachdenke. Ich glaube, weil ich damals zehn Jahre alt war und zum ersten Mal Nachrichten von nationaler Tragweite zur Kenntnis nahm. Und vielleicht auch, weil damit ein schreckliches Bild verbunden war: die Einsamkeit seines Todes, die Leiche, die viele Stunden später in einem abgelegenen, stillen und menschenleeren Waldstück gefunden worden war. Oder wegen der Reaktion meiner Großeltern. Sie gaben mir zu verstehen, dass dies kein gewöhnlicher Tod war, dass er Konsequenzen haben würde. Dass das Land von Unbehagen und Misstrauen erschüttert wurde. Dass Großbritannien von nun an anders sein würde. Unruhig, von Gespenstern heimgesucht.
Zum ersten Mal hörte ich in den Sechs-Uhr-Nachrichten davon, genau an dem Tag, als Alison und ich in Beverley angekommen waren. Wir waren noch nicht lange da. Grandad hatte uns in Leeds abgeholt, und wir hatten uns tränenreich und besorgt von unseren Müttern verabschiedet, die an diesem Abend gemeinsam zu einer Urlaubsreise aufbrechen würden. Im Haus meiner Großeltern gingen Alison und ich sofort hinauf in das Schlafzimmer, in dem ich schon so oft gewesen war, manchmal allein, manchmal mit meinem Bruder. Im Nu hatten wir die Koffer ausgepackt, dann lief Alison hinaus in den Garten, und ich folgte ihr gleich darauf, doch offenbar warf ich zuerst noch einen Blick ins Wohnzimmer, um meinen Großeltern eine Frage zu stellen. Da sprangen mich die Nachrichten an. Meine Großeltern starrten gebannt auf den Fernseher. Wenn ich Erwachsene so sehe, lasse ich sie für gewöhnlich in Ruhe, doch diesmal fesselte mich der Bericht. Ich ging hinein und setzte mich auf das Sofa neben Gran, sie bemerkte mich nicht einmal. Der Fernsehreporter kommentierte mit unheilvoller Stimme Hubschrauberaufnahmen eines grünen Waldfleckens auf dem englischen Land. Auf dem Bildschirm und im Wohnzimmer herrschte eine Atmosphäre, wie ich sie noch nie zuvor gespürt (oder zumindest nicht zur Kenntnis genommen) hatte: spannungsgeladen, erwartungsvoll, geschockt und besorgt. Ich saß schweigend und abwartend da, ich verstand nicht wirklich, was geschehen war, außer, dass ein Mann gestorben war, ein Doktor, der in Oxfordshire gewohnt und etwas mit dem Irak und Waffen zu tun hatte, und dass alle deswegen sehr aufgeregt und besorgt waren.
Nach dem Bericht drehte sich Grandad zu Gran um und sagte: „Nun, das war’s wohl, was? Jetzt hat er Blut an seinen Händen.“
Gran antwortete nichts. Sie stand – langsam und mühevoll – auf und schlurfte in die Küche. Ich stand ebenfalls auf und folgte ihr.
„Was heißt das?“, fragte ich.
„Was, Schatz?“, sagte sie und drehte sich um.
„Was Grandad gesagt hat. Über wen hat er gesprochen?“
Sie verzog das Gesicht und machte sich wieder an die Arbeit. „Ach, du solltest ihn gar nicht beachten. Er sitzt immer auf dem hohen Ross.“
Das war nicht gerade eine zufriedenstellende Antwort, aber bevor ich sie bitten konnte, sich etwas deutlicher auszudrücken, kam Grandad in die Küche und sagte vorwurfsvoll: „Warum hast du mir nicht gesagt, dass du Tee machst? Du weißt doch, dass ich dir das abnehmen soll. Du sollst dich von den beiden Mädchen nicht rumhetzen lassen.“
Verärgert sagte sie: „Wie oft soll ich es dir noch sagen? Ich lass mich nicht rumhetzen.“
„Wie auch immer“, sagte Grandad. „Du solltest dich schonen. Lass mich es machen.“
Ich ließ sie zanken und rief Alison, und dann saßen wir zu viert am Küchentisch und aßen Toast mit Sardinen und Tomaten. Grandad war schlecht gelaunt und wortkarg. Ich dachte noch immer über die Geschichte aus den Nachrichten nach, über den Doktor, den man tot aufgefunden hatte, an einen Baum in Oxfordshire gelehnt, wo auch immer das war. Und darüber, was Grandad über den anderen mir unbekannten Mann gesagt hatte, der nun Blut an seinen Händen hatte. Das war alles sehr verwirrend und geheimnisvoll. Nur Gran und Alison unterhielten sich. Gran fragte sie, was sie die Woche über tun wolle, und Alison antwortete, sie habe sich noch gar keine Gedanken darüber gemacht und es sei ihr auch ziemlich egal. „Ich hoffe nur, dass es dir hier nicht zu langweilig ist“, sagte Gran. „Du bist hier nicht in der Großstadt.“ Mit „Großstadt“ meinte sie Leeds, offenbar stellte sie sich die Stadt als pulsierende Metropole vor, allerdings war der Stadtteil, in dem Alison und ich wohnten, das genaue Gegenteil.
Ein paar Minuten später, als wir gemeinsam draußen im Garten waren, fragte mich Alison: „Was sollen wir hier wirklich eine Woche lang machen? Ich will deine Großeltern ja nicht beleidigen, aber sie sind doch ein wenig … alt?“
„Keine Ahnung“, antwortete ich achselzuckend. „Wir werden schon was finden. In der Nähe gibt es ein großes Moor mit Wäldern und Bäumen und allem Möglichen.“ Alison schien nicht allzu beeindruckt. „Ach – und außerdem gibt es eine Bücherei.“
„Eine Bücherei? Großartig. Ein Woche lang Bücher lesen.“
„Ich wette, die haben auch CDs und so was.“
Alison brachte mich auf die Palme. Immerhin hatten wir ihr mit der Einladung einen Gefallen getan. Sie war ja nicht gerade meine beste Freundin.
„Was ist in dem Schuppen?“, fragte sie.
„Schauen wir hinein.“
Wir stöberten eine Zeitlang in Grandads angebautem Schuppen herum, aber die Ausbeute war gering. Wir fanden einen Cricketschläger und ein paar sehr alte Tennisbälle; in dem Augenblick, als ich eine Art Springschnur aus der hintersten Ecke holen wollte, sah ich etwas. Ich stieß einen Schrei aus und lief hinaus auf den Rasen.
„Was ist los?“, fragte sie und kam mir nach.
„Da hinten sind Spinnen. Die kann ich nicht ausstehen.“
„Wirklich? Was ist an Spinnen so schrecklich?“
„Hast du noch nie was von Arachnophobie gehört?“, fragte ich.
Wahrscheinlich nicht. Sie sagte nur: „Du bist genauso schlimm wie meine Mutter. Sie dreht durch, wenn sie Spinnen sieht, vor allem große. Einmal ist sie sogar in Ohnmacht gefallen. Echt.“
Für sie war das eindeutig Hysterie, doch ich hatte Verständnis für sie. Da ich nicht länger darüber nachdenken wollte, schaute ich mich um und sagte: „Glaubst du, wir könnten auf diesen Baum klettern?“
Wir gingen nach ganz hinten in den Garten, um ihn uns genauer anzusehen. Dabei stellte ich fest, dass das Haus meiner Großeltern von vorne zwar bescheiden wirkte, der Garten hinten jedoch ziemlich groß war. Der Rasen war in zwei Streifen unterteilt, und beide stiegen leicht an, sodass die Stelle, wo der Baum stand, etwas erhöht lag, fast auf derselben Höhe wie das erste Stockwerk des Hauses.
Keine Ahnung, warum ich vorgeschlagen hatte, auf den Baum zu klettern. In der Bücherei bei mir zu Hause borgte ich mir gern altmodische Kinderbücher aus, die Art von Geschichten, in denen Mittelschichtkinder frei auf dem Land herumlaufen, picknicken, Baumhäuser bauen und Verbrecher aus der Gegend schnappen, die sich dort verstecken. In diesem Universum waren Bäume zum Klettern da. Also warum sollten Alison und ich nicht hinaufklettern? Es war ein Pflaumenbaum (wie Gran mir später erzählte), und viele kräftige Äste reichten fast bis zum Boden, aber für zwei Stadtkinder wie Alison und mich, die in Häusern ohne nennenswerte Gärten wohnten, war das ein erschreckendes Vorhaben.
Alison kletterte als Erste hinauf, sie fackelte nicht lange und schwang sich auf einen Ast im oberen Viertel des Baums. Nachdem ich ein paar Sekunden lang gezögert hatte, kletterte ich ihr nach.
„Cool“, sagte sie, als wir nebeneinander auf dem Ast saßen und auf unser neues Reich blickten.
Von hier aus hatten wir einen guten Blick auf die angrenzenden Gärten und die ganze Nachbarschaft. Auf beiden Seiten befanden sich gepflegte Gärten, die genauso aussahen wie der meiner Großeltern: gemähte Rasen, Teiche mit Seerosen, Gartenmöbel – Zeugen ein und desselben bescheidenen, bequemen, ereignislosen Lebens. Im Nachbargarten saß ein Ehepaar, das ungefähr so alt war wie Gran und Grandad, an einem weißen Plastikgartentisch, sie tranken Weißwein und naschten Pringles aus einer Tupperware-Box. Sie sahen zu uns auf und Alison winkte ihnen freundlich zu und rief: „Hallo!“ Der Mann schaute nur, aber die Frau erhob die Hand zu einem vorsichtigen Gruß.
Ich weiß nicht, wie lang wir dort oben saßen. Es war lustig. Es war ein langer, warmer, milder Juliabend und wir hätten ewig da sitzen können. Nach einer Weile schaute Alison auf die Uhr.
„In einer Minute starten unsere Mütter“, sagte sie.
„Wollt ihr Mädchen einen Kuchen?“
Gran rief uns von der Hintertür zu. Ich kletterte als Erste hinunter, sehr langsam und vorsichtig. Alison hingegen sprang aus einer Höhe von eineinhalb Metern und landete heftig auf ihrem linken Bein.
„Au! Fuck! Verdammt!“
Ich starrte sie erschrocken an und errötete. Um nichts in der Welt hätte ich mich getraut, das F-Wort zu verwenden, auch wenn keine Erwachsenen anwesend waren. Aber wir hatten keine Zeit, über schön sprechen nachzudenken. Offenbar hatte sie sich wirklich verletzt. Fürs Erste konnte sie nicht einmal aufstehen.
„Ich hole Gran.“
Ich lief hinein und kam mit beiden Großeltern zurück. Gemeinsam halfen wir Alison auf die Beine, und dann humpelte sie, auf unsere Schultern gestützt, ins Haus.
„Runter mit den Jeans“, sagte Gran, als sich Alison vor Schmerz zusammenzuckend auf einen Küchenstuhl fallen ließ. „Lass dich anschauen.“ Grandad ging hinter uns auf und ab, aber Gran warf ihm einen scharfen Blick zu und bedeutete ihm zu verschwinden. Als er noch immer nicht verstand, sagte sie: „Los, Jim – mach dich rar.“
Als Grandad sah, wie Alison ihre Jeans auszog, verstand er endlich. „Ich gehe … etwas Luft schnappen“, murmelte er.
Gran untersuchte ausgiebig Alisons Bein, konnte jedoch nichts Außergewöhnliches entdecken. „Nun, kein blauer Fleck“, sagte sie. „Und ich sehe auch keine Kratzer. Hier ist es jedoch ein bisschen geschwollen.“ Sie legte einen Finger auf eine Stelle genau über dem Knie und drückte sanft.
Alison zuckte wieder zusammen. „Das habe ich schon eine Weile“, sagte sie. „Ich glaube nicht, dass es was Schlimmes ist.“
Gran rieb die Schwellung mit Salbe ein, danach beschloss Alison, dass sie von den Outdoor-Aktivitäten genug hatte, und blieb drinnen und sah fern. Ich ging wieder hinaus in den Garten und sah, dass sich Grandad über den Gartenzaun hinweg mit seinem Nachbarn unterhielt: dem, dessen Frau uns zugewinkt hatte.
„Hallo“, sagte der rotgesichtige, weißhaarige Mann und strahlte mich an. „Du bist Rachel, nicht wahr?“
„Ja.“
„Ich erinnere mich, als du das letzte Mal hier warst. Meine Güte, seit damals bist du aber ordentlich gewachsen. Und diesmal“, sagte der Mann, „hast du deine kleine schwarze Freundin mitgenommen.“
Das verblüffte mich wirklich. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, Alison so zu beschreiben, es hatte auch noch nie jemand ihre Hautfarbe erwähnt. Mir blieb also nichts anderes übrig, als noch einmal doof „danke“ zu sagen und mich zu fragen, warum mich dieser sonderbare Mann so freundlich anlachte.
4.
Der Tod ist endgültig. Ich weiß, das ist eine banale Feststellung, aber wahrscheinlich will ich damit sagen, dass ich das in dieser Woche in Beverley zum ersten Mal so richtig zur Kenntnis nahm. Und wahrscheinlich ist das der wahre Grund, warum mir David Kellys Tod in Erinnerung geblieben ist. Zum ersten Mal kam mir die Realität des Todes zu Bewusstsein. Es war sozusagen der erste Tod in meiner Familie.
Bis dahin hatte ich so gut wie nichts über den Irakkrieg gewusst, aber nun hatte sich etwas verändert, eine Grenze war überschritten worden. Ein guter Mann war gestorben und das konnte nicht rückgängig gemacht werden. Und an den Händen unseres Premierministers (ich wusste jetzt, dass Grandad über ihn gesprochen hatte) klebte Blut.
„Man kann alles Mögliche über sie sagen“, sagte er zu mir, „aber Mrs Thatcher hätte so etwas nie zugelassen. Sie war eine große Dame.“
„Hat er schon wieder von diesem schrecklichen Weib geredet?“, fragte Gran, als wir gemeinsam das Geschirr abwuschen. „Ich wünschte, er würde mal die Platte wechseln.“
Sie nörgelte immer an Grandad rum, stellte ich fest, trotzdem schienen sie einander viel mehr zu lieben, als meine Mutter und mein Vater es getan hatten (Mum und Dad hatten sich mittlerweile getrennt. Der gemeinsame Urlaub – als man mich mit meinem Bruder nach Beverley geschickt hatte – war meines Wissens der letzte Versuch gewesen, die Ehe zu kitten. Natürlich hatte es nicht geklappt und kurz darauf hatten sie sich getrennt.). Es fiel mir auf, dass Grandad Gran nicht aus den Augen ließ und dass er ihr nicht erlaubte, auch nur annähernd anstrengende Arbeiten zu verrichten.
„War Gran krank oder sonst was?“, fragte ich ihn eines Tages am Anfang unseres Besuchs.
„Wie kommst du darauf?“, sagte er, ohne von seinem Kreuzworträtsel im Telegraph aufzublicken.
„Keine Ahnung. Du lässt sie nichts tun. Als ich letztes Jahr Windpocken hatte, war Mum nachher genauso.“
Jetzt sah er mich an. „Vor ein paar Wochen hatte sie so einen … komischen Schwächeanfall. Der Arzt hat mich gebeten, ein Auge auf sie zu haben, das ist alles …“
Jetzt stelle ich fest, dass diese Redeweise typisch für Grandad war. Was er als „komischen Schwächeanfall“ bezeichnete, war in Wirklichkeit ein epileptischer Anfall gewesen, danach war Gran (nach einer Wartezeit von vier Wochen) zu einem Kopfscan ins Krankenhaus eingeliefert worden. Jetzt warteten sie auf das Ergebnis, aber beide waren sich bewusst, dass es unter Umständen schlechte Nachrichten geben würde. Ein Hirntumor war die wahrscheinlichste Erklärung für den Anfall, an einem krebsartigen Gliom starben viele Patienten innerhalb weniger Monate.
Natürlich verstand ich damals nichts davon. Ich wusste nicht, dass der Schatten des Todes mit seiner schrecklichen Endgültigkeit ganz plötzlich, ohne gerufen worden zu sein, auf das Leben der beiden gefallen war und sie bedrohte. Doch zumindest eines bemerkte ich. Ich bemerkte, dass Gran und Grandad einander mehr zugetan waren als alle Erwachsenen, die ich kannte, und das äußerte sich nicht nur als ständiges Bedürfnis nach körperlicher Nähe, als Weigerung, den anderen aus den Augen zu lassen, sondern auch als ständiger Zustand – ich kann es nicht besser ausdrücken – des einander Neckens. Fast jedes Wort, das sie aneinander richteten, berührte einen Nerv, brachte eine misslaunige Reaktion hervor; doch das war bloß Ausdruck ihrer beinahe unerträglichen Angst als auch der neu erwachten Liebe angesichts des eventuellen Verlusts.
Wie gesagt blieb mir das alles verborgen; ihre Gefühlsäußerungen nahm ich allerdings zur Kenntnis. Was mich in den ersten Tagen unseres Aufenthalts an Alison ärgerte, war, wie unsensibel sie auf ihre Umwelt reagierte. Als sie eines Nachmittags beobachtete, wie meine Großeltern im Garten saßen, Tee tranken und zwischen den Plastikstühlen Händchen hielten, sagte sie: „Schau dir die beiden an. Hoffen wir, dass wir nie so werden, was?“ Sie ließ keine Gelegenheit aus, festzustellen, wie alt und hinfällig sie ihr vorkamen.
Ich merkte bald, dass wir wenig gemeinsam hatten. Unsere Mütter waren befreundet, nicht wir. Während der Schulzeit sahen wir einander nicht so oft, dass wir einander auf die Nerven hätten gehen können; jetzt, wo wir gemeinsam in einem Haus lebten und sogar ein Schlafzimmer teilten, stand unsere Freundschaft bereits auf dem Spiel. Außerdem ärgerte mich an ihr, dass sie alle meine Gefühle kommentierte und versuchte, sie zu ihren eigenen zu machen. David Kellys Tod war ein typisches Beispiel.
„Was tust du gerade?“, fragte sie mich eines Samstagmorgens, als sie mich nach dem Frühstück im Wohnzimmer sitzen sah, wo ich versuchte, aus Grandads Daily Telegraph schlau zu werden.
Es war ziemlich eindeutig, was ich tat. „Ich lese die Zeitung.“
„Seit wann interessierst du dich für Nachrichten?“
„Wusstest du eigentlich, dass es in den letzten Monaten Krieg gegeben hat?“
„Natürlich“, sagte Alison, „Es gibt immer einen Krieg. Meine Mum sagt, Kriege sind dumm, und die Leute sind dumm.“
„Nun, diesmal hatten wir keine andere Wahl. Wir mussten Krieg führen, denn der Irak hatte Atomwaffen, die auf uns gerichtet waren, sie hätten uns innerhalb von 45 Minuten vernichten können.“
„Ich bitte dich. Wer sagt das?“
„Tony Blair.“
Zum ersten Mal zeigte Alison einen Anflug von Interesse. Sie zeigte auf das Titelblatt der Zeitung. „Wer ist dann der Typ da?“
Ich erklärte – so gut ich konnte und nach bestem Wissen und Gewissen –, wer David Kelly war und unter welchen Umständen er gestorben war. Mitten in meiner etwas lückenhaften Erklärung bemerkte ich, dass Alison schon das Interesse verloren hatte; aber sie spürte, dass mich die Geschichte aufwühlte, und sie wollte meine Sorge teilen, entweder um mir nahe zu sein oder um sie zu ihrer eigenen zu machen. Also stürzte sie sich auf ein Detail: den Fund von Dr. Kellys Leiche, die in einem einsamen Waldstück auf einem Hügel an einem Baum gelehnt hatte.
„Wow, das ist gruselig“, sagte sie, wobei sie, was mich anbelangte, völlig schief lag. „Stell dir das vor. Du gehst am Morgen spazieren, führst deinen Hund aus, und plötzlich … findest du so was, vor dir auf dem Weg.“
„Aber niemand weiß genau, warum er es getan hat“, sagte ich. „Grandad sagt, es ist Tony Blairs Schuld, aber er hasst Tony Blair sowieso …“
Das war Alison egal. Sie wollte nur über das außergewöhnliche Bild sprechen, das sich in ihrem Kopf festgesetzt hatte wie eine Szene aus einem Horrorfilm.
„Fuck“, sagte sie. „Da würde ich durchdrehen. Einfach so eine Leiche finden. Mitten im Nirgendwo.“
Ich starrte sie an und verspürte plötzlich Hass. Schon wieder verwendete sie dieses Wort – im Haus meiner Großeltern. Ich wollte etwas sagen und ärgerte mich, weil mir die richtigen Worte nicht einfielen. Ich war ein Feigling. Ein Angsthase.
5.
Alison besaß ein Gerät, das mir damals im wahrsten Sinne des Wortes als magisch erschien. Es hieß iPod, war nicht viel größer als eine Zündholzschachtel und dennoch imstande, Abertausende Songs zu speichern; man konnte sie überallhin mitnehmen und jederzeit anhören. Es war schön weiß und hatte in der Mitte ein Rad, wenn man mit dem Finger daran drehte, machte es ein klickendes Geräusch.
Ich fand es bedauerlich, dass sich Alison trotz der Speicherkapazität des iPods immer nur ein Album anhörte. Sie hörte es sich immer wieder an, und wenn sie es sich gerade mal nicht anhörte, forderte sie stattdessen mich auf, es anzuhören.
„Deine Mutter hat eine hübsche Stimme“, beteuerte ich, pulte die wachsartigen Kopfhörer aus meinen Ohren und gab ihr das Gerät zurück. In Wirklichkeit war mir der Song, den sie mir zum x-ten Mal vorspielte, ziemlich egal. Ich war in dieser Hinsicht frühreif, mich interessierte vor allem klassische Musik, und meine Lieblings-CD zu Hause war eine Aufnahme von Faurés Requiem.
„Sie hat den Song in Top of the Pops gesungen“, sagte Alison.
„Das hast du mir schon gesagt.“
„Sie ist ziemlich berühmt.“
„Ich weiß. Hast du gesagt. Allerdings … (das wollte ich schon seit einiger Zeit loswerden, wusste jedoch nicht, wie ich es taktvoll über die Bühne bringen sollte) … ist das schon eine Weile her, oder?“
„Na und?“, schmollte Alison und stopfte den iPod in den kleinen Ranzen, den sie dabeihatte. „Sie singt noch immer. Macht Demo-Aufnahmen und so Zeug. Sie kann jederzeit zurück in das Business.“
Es war spät am Nachmittag und wir saßen am Fuße des schwarzen Turms, mit dem Rücken an den glänzenden Ziegeln. Wir waren in den letzten Tagen ziemlich mutig geworden, wir erkundeten die Gegend und blieben fast bis zum Einbruch der Dunkelheit im Freien. Meistens gingen wir Richtung Westwood, den Wald, den wir inzwischen gut kannten, allerdings war es uns Stadtkindern nach wie vor ein wenig unheimlich, dass wir in diesem ausgedehnten Moor- und Waldland frei und völlig nach Belieben herumstreifen konnten. Wir kamen gern hierher, weil wir hofften, die „Verrückte Vogelfrau“ zu sehen, die ich Alison ausführlich beschrieben hatte. Ich war ihr vor vier Jahren nur einmal flüchtig begegnet, doch ihr Bild hatte sich meinem Gedächtnis auf immer und ewig eingebrannt. Gran und Grandad zufolge lebte sie noch immer in Beverley, in einem großen Haus, das sie von der an den Rollstuhl gefesselten alten Frau geerbt hatte. Ihr wirklicher Name war anscheinend Ms Barton.
„Die Leute scheinen sie nicht sehr zu mögen“, sagte ich zu Alison.
„Sie sagen, sie hätte das Haus nicht erben sollen. Gran sagt, irgendetwas daran war faul.“
„Faul? Was genau meinst du?“
„Keine Ahnung.“
„Vielleicht … vielleicht hat sie die alte Frau umgebracht. Um das Haus in die Finger zu kriegen.“
Typisch Alison, dachte ich. Albern und übertrieben. „Sei nicht blöd“, sagte ich, worauf Alison verstummte. Aus Angst, sie beleidigt zu haben, und weil ich nicht wollte, dass das Gespräch abbrach, fügte ich hinzu: „Den Vogel hat sie auch nicht mehr.“
„Dann wird sie wohl nicht mehr hierherkommen“, sagte Alison und stand auf. „Los, gehen wir.“
„Okay.“ Ich wollte nach Hause, um mir im Fernsehen eine meiner Lieblings-Comedy-Sendungen anzusehen. „Es ist ohnehin fast neun.“
„Elf Uhr in Korfu“, sagte Alison, allerdings ohne sich zu beeilen. Ich musste langsamer gehen, damit sie Schritt halten konnte. „Fast Schlafenszeit. Ich möchte wissen, ob eine von unseren Müttern schon einen Treffer gelandet hat.“
„Einen Treffer?“ Ich verstand nicht. „Ich glaube nicht, dass sie zum Spielen oder sonst was auf Urlaub gefahren sind.“
Alison lachte schmutzig und arrogant. „Komm schon, Rache. Nicht einmal du kannst so naiv sein.“ Und, als ich noch immer verwirrt dreinschaute: „Wozu, glaubst du, sind sie gemeinsam auf Urlaub gefahren?“
„Keine Ahnung … Jeder braucht hin und wieder mal Urlaub.“
„Sie sind beide Single. Sie sind beide seit Jahren Single. Kapierst du es nicht? Sie sind auf der Suche nach Männern.“
Die Vorstellung erschreckte mich und machte mich wütend. „Sei nicht so ekelhaft“, sagte ich.
„Was daran ist ekelhaft?“
„Halt den Mund, Alison. Du nervst.“
„Wach endlich auf.“
„Du weißt nicht mal, worüber du redest.“ Ich kämpfte mit den Tränen.
„Und ob ich das weiß. Und ich sehe auch nichts Schlechtes daran. Warum sollte deine Mutter nicht für eine Woche ins Ausland fahren und ihre Zeit damit verbringen, einen griechischen Kellner zu vögeln, wenn sie das will?“
Ein paar Sekunden herrschte eisige Stille zwischen uns. Dann knallte ich ihr eine, mitten auf die Wange. Sie schrie vor Schmerz auf und nahm ihren Kopf in die Hände, und als sie so dastand, rempelte ich sie um. Dann brach ich in Tränen aus und rannte in Richtung Zuhause. Als ich mich umblickte, saß sie noch immer da, auf dem gelben versengten Gras, mit der Hand an der Wange, und starrte mir nach.
Ich kam nicht dazu, meine Comedy-Sendung im Fernsehen anzusehen, denn als ich nach Hause kam, schaute sich Grandad auf einem anderen Sender eine politische Sendung an. Sie schien ihn richtig wütend zu machen, doch das hielt ihn nicht davon ab, weiterzuschauen, im Gegenteil. Es war ein Bericht über Menschenhandel und Zwangsarbeit im gegenwärtigen Großbritannien. Natürlich hatte ich diese Ausdrücke noch nie zuvor gehört. Und als die Off-Stimme über Immigranten sprach, die unter denselben Bedingungen arbeiteten wie Sklaven, staunte ich, denn bei dem Wort „Sklaverei“ stellte ich mir römische Galeerensklaven vor, die Ketten trugen und von muskulösen Wächtern mit nacktem Oberkörper ausgepeitscht wurden. Doch in gewisser Weise war das Thema dieser Sendung genauso schrecklich. Bald hatte ich die Nase voll von den endlosen Geschichten über Bauarbeiter und Erntehelfer, die Tag und Nacht schufteten und zu zwanzigst in hässlichen Zimmern zusammengepfercht waren.
„Skandalös“, sagte Grandad immer wieder, aber noch bevor ich zustimmen konnte, gab er mir zu verstehen, dass er etwas ganz anderes meinte. „Woche um Woche füttert uns die BBC mit dieser linksradikalen Propaganda. Wenn die Letten und Litauer die britischen Jobs nicht mögen, sollen sie doch nach Hause fahren und sich bessere suchen. Wusstest du, dass es in Selby einen Laden gibt, der ausschließlich polnisches Essen verkauft?“
Ich glaube, diese Frage war an Gran gerichtet, doch die war vor einiger Zeit aus dem Zimmer gegangen. Da Grandad ohnehin kein Publikum brauchte, verließ ich ebenfalls das Zimmer und ging hinauf ins Schlafzimmer. Alison war noch nicht zurück, unter normalen Umständen hätte mir das Sorgen bereitet, aber ich war noch immer so wütend auf sie, dass es mir egal war.
Offenbar schlief ich augenblicklich ein. Der Himmel im Spalt zwischen den Vorhängen war noch immer dunkelblau, als mich eine Hand an der Schulter packte und wachrüttelte. Schlaftrunken öffnete ich die Augen. Natürlich war es Alison.
„Was? Was tust du? Ich habe geschlafen.“
„Ich weiß, aber es ist wichtig.“
Widerwillig setzte ich mich auf. Kaum hatte ich meine Augen etwas weiter geöffnet, bemerkte ich, dass Alison zitterte.
„Was ist los?“
„Ich habe eine gesehen, Rache“, sagte sie mit bebender Stimme, „ich habe gerade eine gesehen, im Wald.“
„Was?“
„Eine Leiche.“
Wir sahen einander an. Ich sagte nichts.
„Gerade eben“, fügte sie hinzu. Als ob es dadurch glaubhafter geworden wäre.
Ich legte mich wieder hin und drehte mich zur Wand.
„Alison, das ist lächerlich.“
„Rachel, ich habe wirklich eine gesehen.“
Ich drehte mich wieder um und starrte sie an.
„Ein Leiche, ja? Im Wald? Genau wie der Mann in der Zeitung. Lehnte sie an einem Baum?“
„Ja“, sagte Alison, und in ihrer Stimme lagen jetzt eine derartige Verzweiflung und eine derartige Insistenz, dass ich ihr allmählich glaubte.
„Das kann nicht sein“, sagte ich dennoch. „Auf keinen Fall.“
„Es war verdammt furchterregend. Sein Kopf … plumpste zu Boden, als ich hinkam, es war, als ob er mich ansähe. Seine Augen waren offen. Er hatte viele lange, graue, verfilzte Haare. Seine Haut war gelblich – von Falten durchfurcht. Er war so dünn …“
Ich setzte mich wieder auf und sah sie aufmerksam an. Ich war ja schon einmal einem ähnlichen Streich auf den Leim gegangen.
„Was ist das da in deiner Hand?“, fragte ich.
Alison hielt eine einzelne Spielkarte.
„Die habe ich im Wald aufgehoben“, sagte sie. „Da waren ganz viele davon, überall um ihn herum verstreut.“
Ich nahm ihr die Karte aus der Hand. Auf der Rückseite hatte sie ein Muster aus gelben und schwarzen Diamanten. Als ich die Karte umdrehte, sah ich eine gezeichnete Spinne. Ein groteskes, widerwärtiges Ding, es stand aufrecht auf zwei Beinen und fuchtelte mit den anderen wild in der Luft, als ob sie jemanden zu einem Kampf herausfordern wollte. Vor dem glänzend schwarzen Hintergrund der Karte hob sich der blassgrüne Unterleib der Spinne auf unangenehm deutliche Weise ab. Der Künstler hatte ihr Dutzende borstige Haare auf den Bauch gemalt, und an ihrem unteren Ende – ein Detail, das mich besonders anwiderte – hing ein fleischiger, mit irgendeiner Flüssigkeit gefüllter Beutel. Obwohl die Zeichnung simpel und wie ein Cartoon war, war sie trotzdem über die Maßen realistisch.
Schaudernd gab ich Alison die Karte zurück, und sie umarmte mich, vergrub ihren Kopf an meinem Hals und hielt mich fest. Sie zitterte noch immer am ganzen Körper, und von dem Moment an blieb mir nichts anderes übrig, als ihr alles zu glauben.
6.
Das ist der Baum“, sagte sie, „genau hier.“
„Bist du dir sicher?“
Es war am nächsten Morgen, einem herrlich warmen und sonnigen Morgen. Als wir den kleinen Flecken mit im Moor versunkenen Bäumen am Ostrand des Westwoods in Augenschein nahmen, strömte das Sonnenlicht durch das Blätterdach, und das Licht, das zu uns durchdrang, war köstlich kühl, limettengrün. Die Luft war frisch und die einzigen Geräusche waren gelegentliches Vogelzwitschern und das ferne Summen des Verkehrs. Ein Ort, wie geschaffen dafür, ein Picknick zu machen oder unter einem Baum zu liegen und ein Buch zu lesen. Wir hingegen suchten eine Leiche.
„Da ist nichts“, sagte ich mit Nachdruck, nachdem wir ein paar Sekunden dagestanden und auf das nackte Wiesenstück gestarrt hatten. Hin und wieder schadet es nicht, auf das Augenscheinliche hinzuweisen.
„Sie ist weg“, sagte Alison zustimmend.
Was sollten wir jetzt tun? Ich hatte genug Kinderabenteuergeschichten und Sherlock-Holmes-Krimis gelesen, um zu wissen, dass man unter solchen Umständen ein ganz genaues Prozedere befolgen musste. Ich kniete mich hin und untersuchte den Boden.
„Was tust du?“, fragte Alison.
„Ich suche Spuren.“
Alison hockte sich neben mich. „Was für Spuren?“
„Keine Ahnung.“ Ich überlegte mir, ob ich Fußspuren und Fingerabdrücke erwähnen sollte, doch das erschien mir ziemlich altmodisch. Dann erinnerte ich mich an etwas, das ich vor kurzem in einer Fernsehsendung gesehen hatte. „DNA“, sagte ich verschwörerisch, „an einem Tatort findet man immer DNA.“
„Okay.“
Wir begannen den Boden sorgfältig zu untersuchen, wir schoben die Grashalme mit unseren Fingerspitzen auseinander.
„Wie sieht DNA aus?“, fragte Alison.
„Irgendwie … schleimig, glaube ich.“ Ich hatte nicht die leiseste Ahnung, wovon ich sprach. „Schleimig und durchsichtig.“
„Nun, so was sehe ich nicht.“
Alison war nicht so geduldig wie ich. Bald stand sie wieder auf, blickte sich suchend um, ohne zu wissen, wonach sie suchte. Ich zog eine Schnute und machte weiter. Vielleicht würde ich etwas anderes Wichtiges finden … einen abgerissenen Knopf oder einen Stofffetzen. Oder vielleicht war das auch totale Zeitverschwendung: Vielleicht gehörte das zu dem Streich, den Alison mir spielte, als Rache für die Ohrfeige, die ich ihr gestern Abend gegeben hatte; sie hatte sie noch gar nicht erwähnt und ich musste mich noch entschuldigen.
Bald war sie verschwunden. Ich wusste nicht, wo sie hingegangen war; ich wusste nur, dass der Wald noch stiller war als sonst. Sogar die Vögel schienen das Singen eingestellt zu haben, und obwohl die Straße bloß ein paar hundert Meter weit weg war, hörte ich kein einziges Auto. Als ein Zweig oder ein Ast knackste, klang es fast wie ein Gewehrschuss. Ich richtete mich auf und blickte mich sorgfältig um, in jede Richtung. Niemand da.
„Alison?“, rief ich.
Keine Antwort.
Ich verharrte noch ein paar Minuten im Knien. Wieder absolute Stille. Natürlich war es bloß ein von Ast zu Ast hüpfender Vogel gewesen oder vielleicht ein Hase (wir hatten in den letzten Tagen ein paar gesehen), oder vielleicht spielte Alison ein anstrengendes Versteckspiel. Kein Grund, deswegen nervös zu werden. Ich beschloss, weiter Spuren zu suchen.
Das zweite Geräusch war lauter als das erste und schien von einer ungefähr zehn Meter entfernten Stelle zu meiner Linken zu kommen. Es war lauter als das Knacksen eines Astes, es klang eindeutig wie ein Schritt im Unterholz. Gleichzeitig sah ich – oder glaubte zu sehen –, wie ein Schatten oder eine Gestalt im Gebüsch vorbeihuschte. Das Wispern einer Bewegung, nicht mehr. Dann war plötzlich wieder alles still und ruhig.
Alison. Es musste sie gewesen sein. Was für ein Spiel trieb sie?
„Alison?“, rief ich. „Alison, wo bist du?“
Allmählich ging mir das auf die Nerven. Oder besser gesagt, ich tat mein Bestes, es nervig zu finden, während ich zu ignorieren versuchte, wie sehr mein Herz zu schlagen begonnen und sich auf meiner Stirn ein Schweißfilm gebildet hatte. Langsam und vorsichtig stand ich auf, ich achtete darauf, so wenige Geräusche wie möglich zu verursachen. Ich schaute wieder in Richtung des Gebüschs, wo ich vermeintlich ein Geräusch gehört und eine rasche Bewegung gesehen hatte. Die Versuchung, einfach davonzurennen, wurde sehr stark. Aber ich beschloss, keine jähen Bewegungen zu machen. Mit einer sehr vorsichtigen und durchdachten Bewegung drehte ich mich um 180 Grad und entfernte mich von dem Gebüsch und der Gefahr, die mein fiebriger Geist darin gesehen hatte. Noch ein Dutzend Schritte und ich würde die dicht mit Bäumen und Büschen bewachsene Stelle hinter mir gelassen haben und mich in einem etwas lichteren Waldstück befinden. Dann, erst dann, würde ich zu laufen beginnen.
Doch schon nach wenigen Schritten bemerkte ich etwas und blieb stehen. Zwischen den Ästen eines Busches, auf Augenhöhe, hing noch eine Spielkarte: genau wie die, die Alison gefunden hatte, doch diesmal war keine Spinne darauf, sondern ein Fisch. Ein blau-gelb gestreifter Fisch vor einem glänzend schwarzen Hintergrund. Wie die Spinne hatte auch der Fisch aufgrund der schematischen comicartigen Darstellung etwas Merkwürdiges, wenn nicht gar Abstoßendes an sich: die Art und Weise, wie seine Augen hervortraten und sein Mund doof runterhing. War das die Spur, die ich unbewusst gesucht hatte? Ich konnte mir nicht vorstellen, was die Spielkarten mit Alisons makabrer Begegnung letzte Nacht im Wald zu tun haben sollten, doch im Augenblick erschien es mir als außerordentlich wichtig, das eventuelle Beweisstück zu sichern. Ich streckte die Hand aus, aber die Karte war zu weit weg. Zum Verrücktwerden. Ich machte einen Schritt nach vorn und stellte mich auf die Zehenspitzen. Wenn ich mich noch weiter reckte, fiel ich sicher um. Aber jetzt konnte ich sie fast berühren. Noch ein Zentimeter und ich konnte sie mit zwei Fingern packen.
Doch da tauchte aus dem Nichts eine andere Hand – die Hand eines Erwachsenen – auf, schnellte in Richtung der Karte vor und schnappte sie sich.
Ich rang nach Luft und wirbelte herum. Und da stand sie, direkt hinter mir. Ihr Gesicht war rot vor Wut. Ihre kurzgeschorenen Haare, ihre Piercings und ihr tätowierter Hals und Nacken waren wie immer. Ihr Blick aus grauen Augen durchbohrte mich.
Die „Verrückte Vogelfrau“.
„Die gehört mir, danke sehr“, sagte sie.
Keine Ahnung, woher sie gekommen war, doch jetzt stand Alison neben mir. Zu Tode erschrocken betrachteten wir die Erscheinung. Wir starrten sie an, sie starrte zurück, und keine von uns sagte ein Wort. Es war ein Wettbewerb im Starren. Das Schweigen des Waldes lag schwer auf uns.
„Liegen noch mehr davon herum?“, fragte sie schließlich.
„Ich … glaube nicht, Miss“, sagte Alison zögerlich.
„Ihr müsst sie mir zurückgeben. Alle. Und ihr dürft niemandem davon erzählen.“
„Ja, Miss“, sagten wir einstimmig.
„Gut. Und jetzt haut ab.“
Wir rührten uns nicht von der Stelle. Wir waren zu geschockt.
„Augenblicklich!“, schrie sie.
Und schon waren wir weg, wir rannten so schnell wir konnten aus dem Wald, quer über das Westwood-Gelände, auf der Suche nach Sicherheit, unsere kleinen Körper bestanden aus wirbelnden Beinen und rudernden Armen und unsere flüchtenden Gestalten schrumpften zu einem winzigen Pünktchen vor dem Hintergrund des ewigen, unergründlichen schwarzen Turms.
7.
Das Haus meiner Großeltern bot leider nicht die Zuflucht, die wir uns erwartet hatten. Als wir nach Hause kamen, war das Wohnzimmer voller Leute. Genauer gesagt, voller alter Leute. Überall, wo man hinschaute, silbergraue Haare und Teetassen. Nach einem Blick auf die Versammlung (Grandad und sein Nachbar waren die Einzigen, die ich erkannte) verzogen wir uns in die Küche, wo Gran gerade Schokoladen- und Butterkekse auf Servierteller legte.
„Was ist da drin los?“, fragte ich.
„Der Conservative Club aus dem Ort“, sagte sie. „Wir waren dran mit der Einladung.“
„Sie sehen aus wie ein Haufen Dinosaurier“, sagte Alison.
„Kümmere dich nicht um sie“, sagte Gran. „Würdet ihr das bitte hineintragen? Ich brauche eine Verschnaufpause.“
Sie drückte uns je einen Teller mit Keksen in die Hand und wir machten uns aufgeregt daran, eine Runde durch das Zimmer zu drehen. Als wir hineingingen, hielt Grandads Nachbar (der, wie ich später herausfand, Mr Sparks hieß) eine Rede über Landstreicherei, ebenfalls ein Wort, das ich noch nie gehört hatte.