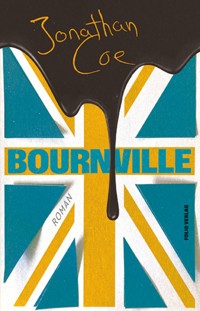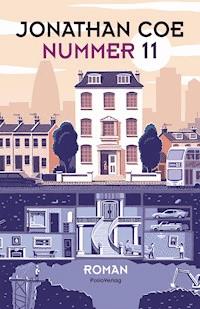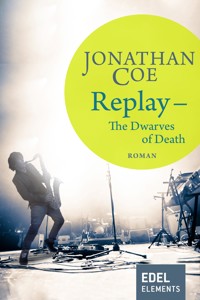Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine phantastische Heraufbeschwörung der 70er Jahre – eine Komödie, bei der einem das Lachen im Hals stecken bleibt... Mitten in den wilden Siebzigern gehen die vier Freunde Trotter, Harding, Anderton und Chase in Birmingham zur Schule, in einem England, das Lady Di, Tony Blair und Handys noch nicht kennt, dafür aber Roxy Music, Vinylplatten und Schlaghosen. Als Redakteure der Schülerzeitung versuchen die vier, eher schlecht als recht, sich auf dem laufenden zu halten und zu begreifen, was es auf sich hat mit Rassismus, Klassenkampf und Punk Rock. Doch im Privaten sind es ganz andere Dinge, die ihnen Kopfzerbrechen bereiten, zum Beispiel die Sache mit Cicely Boyd ... "Brillant, witzig, unerbittlich wahrheitssuchend." (Evening Standard)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 596
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jonathan Coe
Erste Riten
Roman
Edel eBooks Ein Verlag der Edel Germany GmbH
Copyright dieser Ausgabe © 2014 by Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel HE ROTTERS' CLUB
Copyright der Originalausgabe © 2001 by Jonathan Coe
Ins Deutsche übertragen von Sky Nonhoff
Copyright der deutschen Übersetzung © Piper Verlag GmbH, München 2002
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Jouve
Inhaltsverzeichnis
An einem blauschwarzen, sternklaren Abend im Jahr 2003 gingen zwei junge Leute in Berlin zum Abendessen. Sie hieβen Sophie und Patrick.
Die beiden waren sich nie zuvor begegnet. Sophie war mit ihrer Mutter nach Berlin gereist, Patrick mit seinem Vater. Sophies Mutter und Patricks Vater waren früher einmal flüchtig befreundet gewesen, aber das war schon ewig her. Vorübergehend war Patricks Vater in Sophies Mutter verknallt gewesen, als sie noch zur Schule gingen. Zuletzt hatten sie vor 29 Jahren miteinander gesprochen.
– Wo sind sie wohl hingegangen? fragte Sophie.
– In irgendeinen Club. Ne Techno-Disco wahrscheinlich.
– Meinst du das ernst?
– Natürlich nicht. Mein Vater war noch nie in seinem Leben in einem Club. Seine neueste Platte ist von Barclay James Harvest.
– Von wem?
– Genau.
Sophie und Patrick starrten aus dem Fenster, als der riesige, hellerleuchtete Glas-Beton-Kasten des neuen Reichstags in den Blick rückte. Das Restaurant im Fernsehturm über dem Alexanderplatz drehte sich schneller als erwartet. Offenbar war die Geschwindigkeit seit der Wiedervereinigung verdoppelt worden.
– Was ist mit deiner Mutter? fragte Patrick. Geht’s ihr wieder besser?
– Ach, das war nichts. Sie hat sich im Hotel ein bißchen hingelegt. Danach war alles wieder okay. Wir sind dann noch einkaufen gegangen. Hier, den Rock hab ich gekriegt.
– Sieht echt toll aus.
– Na ja, wenn das mit Mum nicht passiert wär, hätte dein Dad sie bestimmt nicht erkannt.
– Nein, wahrscheinlich nicht.
– Und wir würden jetzt nicht hier sitzen. Muß wohl so was wie Schicksal sein.
Es war schon eine merkwürdige Situation. Ihre Eltern waren einander spontan um den Hals gefallen, obwohl es so lange her war, daß sie befreundet gewesen waren. Mit einer Art freudiger Erleichterung hatten sie ihr Wiedersehen gefeiert, als würde diese zufällige Begegnung in einem Berliner Kaffeehaus eine Brücke über die vergangenen Jahrzehnte schlagen, die Jahre vergessen machen, in denen sie sich nicht gesehen hatten. Dies wiederum führte dazu, daß sich eine leichte Befangenheit in Sophies und Patricks Zusammentreffen mischte. Sie hatten nichts gemein, von der Vergangenheit ihrer Eltern abgesehen.
– Spricht dein Vater oft über seine Schulzeit? fragte Sophie.
– Wo du’s grad sagst. Hat er eigentlich nie getan. Aber jetzt sind ein paar Leute von damals wieder aufgetaucht. Zum Beispiel war da einer, der hieß...
– Harding?
– Ja. Du hast von ihm gehört?
– Ein bißchen. Ich wüßte gern mehr.
– Erzähl ich dir. Außerdem erwähnt Dad manchmal deinen
Onkel. Deinen Onkel Benjamin.
– Ja, klar. Sie waren ziemlich gute Freunde, nicht wahr?
– Und wie.
– Wußtest du, daß sie mal zusammen in einer Band gespielt haben?
– Davon hat er nichts gesagt.
– Und von der Schülerzeitung, für die sie geschrieben haben?
– Davon auch nichts.
– Ich weiß das alles von meiner Mutter. Sie kann sich haargenau an damals erinnern.
Und dann begann Sophie zu erzählen. Es war schwierig, einen Anfang zu finden. Die Ära, über die sie sprachen, schien zu den dunkelsten Kapiteln der Weltgeschichte zu gehören. Sie sah ihn an und sagte:
– Hast du dir schon mal vorzustellen versucht, wie es war, bevor du geboren wurdest?
– Was meinst du? Als ich noch in der Gebärmutter war?
– Nein. Wie die Welt aussah, bevor du kamst.
– Nicht so richtig. Ich hab keine Phantasie für so was.
– Aber an bestimmte Dinge von früher erinnerst du dich schon. Sagen wir mal, an John Major.
– Schwammig.
– Na ja, so war er ja auch. Und Margaret Thatcher?
– Nein. Ich war... fünf oder sechs, als sie zurücktrat. Wieso fragst du mich das?
– Weil wir noch weiter in der Zeit zurückgehen müssen. Viel weiter.
Sophie hielt inne. Ein Stirnrunzeln überschattete ihr Gesicht.
– Ich kann dir das alles erzählen, aber vielleicht findest du es auch bloß öde. Es ist eine Geschichte ohne Ende. Sie hört mittendrin auf. Ich hab keine Ahnung, wie sie ausgeht.
– Vielleicht kann ich ja das eine oder andere ergänzen.
– Ja? Würdest du?
– Na klar.
Zum ersten Mal lächelten sie einander an. Während die von Baukränen beherrschte Skyline Berlins hinter ihr in Sicht kam, betrachtete Patrick Sophies Züge, die anmutige Kurve ihres Kinns, die langen schwarzen Wimpern, während ein unklares Gefühl in ihm aufstieg, ein Gefühl der Dankbarkeit, daß er sie getroffen hatte, vermischt mit einem Funken Neugier, was die Zukunft für ihn bereithalten mochte.
Sophie goß sich Mineralwasser aus einer marineblauen Flasche ein und sagte:
– Dann laß uns anfangen, Patrick. Laß uns die Zeit zurückdrehen, dahin, wo alles anfing. In einem Land, das wir beide wahrscheinlich gar nicht erkennen würden. England im Jahr 1973.
– Meinst du wirklich, daß das damals so anders war?
– Total anders. Denk doch mal nach! Eine Welt ohne Handys und Videos und Playstations. Es gab nicht mal Faxgeräte. Eine Welt ohne Prinzessin Diana oder Tony Blair, eine Welt, in der niemand je an einen Krieg im Kosovo oder Irak gedacht hätte. Damals gab es nur drei Fernsehprogramme, Patrick. Drei! Und die Gewerkschaften waren so mächtig, daß sie einen Sender einfach mal so eben für einen Abend abschalten konnten. Manchmal mußten die Leute sogar ohne Strom auskommen. Stell dir das mal vor!
Die Kleine und der Freak
1
Winter
Stell dir das mal vor!
15. November 1973. Ein Donnerstagabend, Nieselregen, der sacht gegen die Fensterläden fällt, während die Familie sich im Wohnzimmer versammelt hat. Alle außer Colin, der unterwegs zu einem Termin ist und seiner Frau und den Kindern Bescheid gegeben hat, daß sie nicht auf ihn zu warten brauchen. Eine schmiedeeiserne Stehlampe spendet mattes Licht. Im Kohleofen zischt es.
Sheila Trotter liest in der Daily Mail: »Die Treue zu halten, in guten und in bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit – dies ist die Grundlage, die Ehepaare auch in schwierigen Zeiten zusammenstehen läβt.«
Lois liest Sounds: »Er, 18, Katzenfan, sucht Girl aus London, das auch auf Sabbath steht. Nur Freaks bitte.«
Paul, schon damals frühreif, liest in Unten am Fluß: »Der Anblick eines Flugzeugs wird Stammesangehörige in entlegensten Gebieten Afrikas wider Erwarten wohl kaum verwundern; ein solcher Anblick liegt außerhalb ihrer Vorstellungskraft.«
Was Benjamin angeht... Er sitzt wahrscheinlich gerade am Eßtisch und macht seine Hausarbeiten; mit gerunzelter Stirn und konzentriert vorgeschobener Zunge. (Eine Eigenart unserer Familie: Meine Mutter sieht genauso aus, wenn sie vor ihrem Laptop hockt.) Geschichte vielleicht. Jedenfalls etwas, das ihm nicht leicht von der Hand geht. Sein Blick schweift zur Uhr auf dem Kaminsims. Systematiker, der er ist, hat er sich ein Zeitlimit gesetzt. Noch zehn Minuten. Zehn Minuten, um zur Lösung der Aufgabe zu kommen.
Ich tue mein Bestes, Patrick, ganz ehrlich. Aber es ist gar nicht so einfach, die Geschichte meiner Familie zu erzählen. Onkel Benjamins Geschichte, um genau zu sein.
Ich bin nicht mal sicher, ob das wirklich der optimale Anfang ist. Aber wahrscheinlich ist es egal, wo man beginnt, und ich habe mich für diesen Abend entschieden. Einen Novemberabend vor fast dreißig Jahren, der bereits dunkel den Winter ankündigt.
Den 15. November 1973.
Lange Gesprächspausen waren an der Tagesordnung. Sonderlich viel wurde in der Familie nie geredet. Alle waren einander ein Rätsel, und nicht zuletzt wohl auch sich selbst; bis auf Lois natürlich. Ihre Bedürfnisse waren simpel und klar umrissen, und am Ende wurde sie dafür bestraft. Na ja, jedenfalls sehe ich das so.
Ich glaube nicht, daß sie besonders hochtrabende Ansprüche ans Leben hatte. Ich glaube, sie wollte einfach Leute um sich herum haben, ein bißchen Unterhaltung. Bei der Familie hätte durchaus eine Plaudertasche aus ihr werden können; aber sie war keine von denen, die dauernd mit kichernden Freundinnen um die Häuser zog. Sie wußte genau, was sie wollte, da bin ich mir ganz sicher; schon damals, obwohl sie gerade erst sechzehn war. Und sie wußte auch, wo sie danach Ausschau halten mußte. Seit ihr Bruder jeden Donnerstag auf dem Heimweg von der Schule das neue Sounds kaufte, war es zu ihrem verstohlenen wöchentlichen Ritual geworden, so zu tun, als würde sie die Anzeigen für Poster und Klamotten (»Arbeiterhemden aus Baumwolle in Schwarz, Blau, Knallrot, Bordeaux — besonders stark im Partnerlook«) auf den letzten Seiten studieren, obwohl ihre wahre Aufmerksamkeit den Kontaktanzeigen galt. Was sie wollte, war ein Mann.
Sie hatte mittlerweile fast alle Anzeigen durch. Langsam begann sie zu verzweifeln.
»Flippiger Typ (20) sucht verrücktes Girl (16 und drüber) zwecks Partnerschaft. Stehe auf Quo und Zep.«
Nee, das war’s auch nicht. Wollte sie überhaupt einen flippigen Typ? Und ging sie tatsächlich als verrückt durch? Wer waren eigentlich Quo und Zep?
»Supertyp sucht Klassegirl (17-28), das ihm schreibt. Fan von Tull und Pink Floyd.«
»Zwei Freaks suchen anschmiegsame Bräute, 16 und drüber:«
»Kerl (20), Umgebung Kidderminster, sucht attraktive(s) Girl(s).«
Kidderminster lag nur ein paar Meilen entfernt, daher hätte er durchaus etwas sein können, wäre da nicht der in Klammern angegebene Plural gewesen. Den hatte sie durchschaut! Der wollte seinen Spaß und sonst gar nichts. Obwohl das in gewisser Weise sogar vorzuziehen war, verglichen mit der Hoffnungslosigkeit, die in vielen der anderen Anzeigen mitschwang.
»Enttäuschter, einsamer Typ (21), langes dunkles Haar, sucht Kontakt zu rücksichtsvollem, einfühlsamem Girl mit kreativer Ader; progressiv, Folk, Kunst.«
»Einsamer, unattraktiver M (22) sucht weibliche Gefährtin. Aussehen nicht wichtig. Moodies, BJH, Camel etc.«
»Einsamer Who- und Floyd-Fan sucht Freundin für Love & Peace. Kreis Stockport.«
Ihre Mutter legte die Zeitung beiseite und sagte: »Möchte jemand eine Tasse Tee? Limonade?«
Als sie in die Küche gegangen war, legte Paul seine Kaninchensaga weg und griff nach der Daily Mail. Mit müdem, skeptischem Gesichtsausdruck begann er zu lesen.
»Girl für Trip nach Indien gesucht. Start Ende Dez.«
»Girls gesucht, die etwas von der Welt sehen wollen. Bitte schreibt unter...«
Ja, sie wollte etwas von der Welt sehen, jetzt, da sie direkt dran dachte. Der Wunsch war langsam in ihr gewachsen, verstärkt durch Reisesendungen im Fernsehen und Farbfotos in der Beilage der Sunday Times, die ihr zeigten, daß es jenseits der Ortsgrenzen von Longbridge ein ganzes Universum zu entdecken gab, jenseits der Busstation, an der sie immer auf den 62er wartete, jenseits Birminghams und sogar jenseits Englands. Ja, natürlich wollte sie es sehen; und ihre Eindrücke mit jemandem teilen. Sie sehnte sich nach jemandem, der ihre Hand hielt, während der Mond über dem Tadsch Mahal aufging. Sie sehnte sich danach, geküßt zu werden, sanft, aber ganz, ganz lange, vor der atemberaubenden Kulisse der kanadischen Rockies. Sie sehnte sich danach, Ayers Rock im Morgengrauen zu erklimmen. Sie sehnte sich nach jemandem, der um ihre Hand anhielt, während die untergehende Sonne ihre blutroten Finger über den rosa gefärbten Minaretten der Alhambra ausstreckte.
»Motorroller-Boy aus Leeds, okay aussehend, sucht Freundin (17 – 21) für Disco und Konzerte. Bitte mit Foto.«
»Freundin gesucht, Alter egal, aber nicht über 1,50 m. Beantworte alle Zuschriften.«
»Fertig.«
Benjamin schloß sein Aufgabenheft und zog eine Riesenshow ab, während er seine Stifte und Bücher in seiner Schultasche verstaute. Sein Physikbuch fiel langsam auseinander, daher hatte er es mit einem Stück Rauhfaser eingebunden, das von den Tapezierarbeiten im Wohnzimmer vor zwei Jahren übriggeblieben war. Auf sein Englischbuch hatte er einen großen Fuß gekritzelt, der aussah wie der am Schluß des Monty-Python-Vorspanns.
»So, das war’s für heute.« Er stand über seiner Schwester, die sich auf dem Sofa ausgestreckt hatte. »Komm, gib wieder her.«
Es hatte ihm noch nie in den Kram gepaßt, wenn Lois das Sounds eher als er zu lesen bekam. Offenbar neidete er ihr den privilegierten Zugang zu höchst geheimen Informationen. Tatsächlich aber waren ihr die Artikel vollkommen egal, denen sein verschärftes Augenmerk galt. Meist waren ihr schon die Überschriften ein Rätsel: »Beefheart kommt im Mai«, »Heep mit neuem Album«, »Auflösungsgerüchte um Fanny«.
»Was ist ein Freak?« fragte sie, als sie ihm das Magazin zurückgab.
Benjamin lachte hämisch und zeigte auf ihren neunjährigen Bruder, der mit amüsiert-herablassendem Gesichtsausdruck die Daily Mail studierte. »Da drüben sitzt einer.«
»Weiß ich. Aber ein echter Freak – ich meine, das bedeutet doch irgendwas.«
Benjamin erwiderte nichts; womit es ihm gelang, den Eindruck zu erwecken, daß er die Antwort nur zu gut kannte, wenngleich er es aus irgendwelchen Gründen vorzog, sie nicht öffentlich zu machen. Die meisten Leute betrachteten ihn als klugen Kopf, auch wenn er ganz offensichtlich das genaue Gegenteil davon war. Er schien eine bestimmte Ausstrahlung zu haben, eine nur so vor Selbstbewußtsein strotzende Aura, die ihm irrtümlich als jugendliche Reife ausgelegt wurde.
»Mutter«, sagte Paul, als sie mit seiner Limonade zurückkam, »wieso kaufen wir eigentlich diese Zeitung?«
Sheila starrte ihn seltsam verstimmt an. Sie hatte ihn x-mal gebeten, sie »Mum« und nicht »Mutter« zu nennen.
»Einfach so«, sagte sie. »Warum nicht?«
Paul blätterte durch die Seiten. »Da stehen doch nichts als Platitüden und Kauderwelsch drin.«
Benjamin und Lois prusteten los. »Ich dachte, Kauderwelsch war ein australisches Tier«, sagte sie.
»Der fast nie gesichtete Kauderwelsch«, sagte Benjamin und gab ein paar Trötgeräusche von sich, die dem sagenhaften Tier alle Ehre gemacht hätten.
»Nehmen wir nur mal diesen Leitartikel«, fuhr Paul unbeeindruckt fort. »Es ist immer noch ein unvergleichliches historisches Schauspiel, das die Herzen aller Briten bewegt. Nichts auf der Welt rührt uns mehr als eine königliche Hochzeit.«
»Und?« Sheila gab einen Löffel Zucker in ihren Tee. »Ich bin auch nicht mit allem einverstanden, was ich da drin lese.«
»Als Prinzessin Anne und Mark Philips durch das Portal von Westminster Abbey schritten, breitete sich jenes erhabene Lächeln auf ihren Gesichtern aus, wie es nur wahrhaft seligen Menschen eigen ist. Ich brauch ’ne Kotztüte, aber schnell! Das Gebetbuch mag dreihundert Jahre alt sein, doch seine Gelübde strahlen so hell wie das gestrige Sonnenlicht. Ich muß mich übergeben! Die Treue zu halten, in guten und in bösen Tagen...«
»Schluß jetzt, Herr Neunmalklug!« Das Beben in Sheilas Stimme reichte aus, einen Augenblick lang die Unruhe hörbar zu machen, die ihr jüngster Sohn in ihr auslöste. »Trink das jetzt aus, und dann ab ins Bett!«
Jetzt ging es erst richtig los, als Benjamin lautstark ins Geschehen eingriff, aber Lois hörte gar nicht mehr zu. Das war bestimmt nicht die Art von Verständigung, nach der sie sich sehnte. Sie kehrte ihnen den Rücken und zog sich in ihr Zimmer zurück, in ihre Welt der romantischen Tagträume, ein Königreich unendlicher Schönheit und unbegrenzter Möglichkeiten. Was das neue Sounds anging, war sie doch noch fündig geworden. Sie brauchte auch kein weiteres Mal mehr nachzusehen, da die Chiffre-Nummer ganz einfach zu behalten (247, die Wellenlänge, auf der man Radio One empfangen konnte) und die Anzeige ihrer Wahl von geradezu makelloser, magischer Schlichtheit war. Vielleicht war das der Grund, warum sie wußte, daß sie für sie bestimmt war, nur für sie allein.
»Langhaariger Freak sucht Girl. Birmingham und Umgebung.«
2
Unterdessen saß Lois’ Vater Colin in einem Pub namens »The Bull’s Head« in King’s Norton. Sein Chef, Jack Forrest, war an die Bar gegangen, um drei Pints Brew XI zu besorgen, worauf Colin gezwungen war, die stockende Konversation mit Bill Anderton zu gestalten, einem Betriebsrat aus dem British-Leyland-Werk in Longbridge. Das vierte Mitglied der Runde, Roy Slater, war noch nicht eingetroffen. Colin empfand es als echte Erleichterung, als Jack von der Bar zurückkam.
»Cheers«, prosteten sich die drei zu. Nachdem sie die Gläser wieder abgesetzt hatten, ließen sie einen kollektiven Seufzer hören und wischten sich den Schaum von den Oberlippen. Dann schwiegen sie für einen Augenblick.
»Übrigens, das ist ein völlig formloses Treffen«, sagte Jack Forrest plötzlich, als das Schweigen eine Spur zu lang und unbehaglich geworden war.
»Ja, absolut formlos«, sagte Colin.
»Ist mir recht«, sagte Bill. »Ist mir nur recht.«
Ganz formlos nippten sie an ihrem Bier. Colin ließ seinen Blick durch den Pub schweifen, um eine Bemerkung über die Dekoration loszuwerden, aber dann fiel ihm keine ein. Bill Anderton starrte in sein Bier.
»Ein echt gutes Bier haben die hier«, sagte Jack.
»Hm?« sagte Bill.
»Ich sagte, ein echt gutes Bier haben die hier.«
»Nicht übel«, sagte Bill. »Hab schon schlechteres getrunken.«
Das war natürlich in jenen Tagen, als Männer noch nicht gelernt hatten, offen über ihre Gefühle zu sprechen. In den Tagen, als kooperative Meetings zwischen Management und Belegschaft noch nicht zum Firmenalltag gehörten. In gewisser Hinsicht waren sie Pioniere, diese drei.
Colin übernahm die nächste Runde; von Roy war immer noch nichts zu sehen. So saßen sie da und tranken ihre Pints, während sich ihre Gesichter matt auf den Tischplatten spiegelten. Die Tische waren dunkelbraun, dunkler als dunkelbraun, schokoladenbraun, Sorte Zartbitter. Die Wände waren in einem helleren Braun gestrichen, Vollmilch. Der Teppichboden war braun, durchsetzt von kleinen Sechsecken in einem leicht anderen Braun. Die Decke hätte eigentlich grauweiß sein sollen, war aber tatsächlich braun, gebeizt vom Nikotin einer Million filterloser Zigaretten. Die meisten der Wagen auf dem Parkplatz draußen waren braun, so wie auch die Kleidung der Bedienungen. Niemand im Pub bemerkte, daß der Raum von brauner Farbe beherrscht wurde, und falls doch, war es niemandem eine Bemerkung wert. Es waren braune Zeiten.
»Tja, Leute«, sagte Jack Forrest, »seid ihr inzwischen drauf gekommen?«
»Worauf?« sagte Bill.
»Warum wir heute abend hier sind«, sagte Jack. »Ich hab euch nicht zufällig ausgesucht. Genausogut hätte ich jeden anderen Personalmanager oder Betriebsrat hierher bitten können. Hab ich aber nicht getan. Es hat schon seinen Grund, warum gerade ihr beiden hier seid.«
Bill und Colin wechselten einen Blick.
»Ihr habt was gemeinsam, versteht ihr.« Selbstzufrieden musterte er die beiden. »Kommt ihr drauf, was ich meine?«
Sie zuckten mit den Schultern.
»Eure Kids gehen zur selben Schule.«
Colin war der erste, der ein Lächeln über die Lippen brachte.
»Anderton – na klar. Mein Ben hat einen Freund namens Anderton. Sie sind in derselben Klasse. Er hat schon öfter von ihm gesprochen.« Etwas beinah Herzliches lag in seinem Blick, als er Bill ansah. »Ach, das ist Ihr Junge.«
»Genau. Duggie. Und Ihr Sohn ist also Bent.«
Colin schien das zu verwirren, wenn nicht sogar zu empören. »Nein, Ben«, berichtigte er. »Ben Trotter. Kurz für Benjamin.«
»Ich weiß, wie er heißt«, sagte Bill. »Aber so nennen sie ihn eben. Bent Rotter. Na, haben Sie’s kapiert?«1
Colin verzog gekränkt den Mund. »Kinder können sehr grausam sein«, sagte er.
Jack lächelte versöhnlich in die Runde. »Na, das sagt wohl einiges über das Land, in dem wir leben«, sagte er. »England in den Siebzigern. Die alten Gegensätze spielen keine Rolle mehr. Wir leben in einem Land, wo ein Gewerkschaftler und ein aufstrebender junger Angestellter – die nächste Beförderung steht schon ins Haus, was, Colin? – ihre Söhne auf dieselbe Schule schicken können, ohne daß sich jemand etwas dabei denkt. Beides helle Köpfe, beide pfiffig genug, um die Aufnahmeprüfung zu bestehen, tja, und jetzt gehen sie zusammen auf die Penne. Und was sagt uns das über den Klassenkampf? Daß er vorbei ist. Waffenstillstand. Friedenszeiten.« Er griff nach seinem Bier und hielt es feierlich in die Höhe. »Chancengleichheit.«
Colin murmelte zustimmend und nippte an seinem Glas. Bill sagte keinen Ton; seiner Meinung nach existierte der Klassenkampf wie eh und je, und auch in Ted Heaths ach so gleichberechtigten Siebzigern ging es immer noch mit Zähnen und Klauen zur Sache, aber er war nicht in der Stimmung, jetzt eine Diskussion vom Zaun zu brechen. An diesem Abend gingen ihm andere Dinge durch den Kopf. Er griff in seine Jackentasche, tastete nach dem Scheck und fragte sich erneut, ob er jetzt völlig irre wurde.
Vielleicht war es ein Fehler gewesen, auch Roy Slater einzuladen. Das Problem mit Slater war, daß er von allen gehaßt wurde, Bill Anderton eingeschlossen, der eigentlich ein bißchen mehr Solidarität mit seinem Waffengefährten hätte zeigen können. In Bills Augen jedoch war Slater ein Betriebsrat der übelsten Sorte. Er hatte null Talent für Verhandlungen, kein Einfühlungsvermögen für die Interessen der Leute, die er repräsentieren sollte, und nicht den blassesten Schimmer von politischen Zusammenhängen. Er war bloß ein Schaumschläger, der nichts als Ärger machte, immer auf die nächste Konfrontation aus, wobei er ein ums andere Mal den kürzeren zog. In der Gewerkschaft war er eine unbedeutende Nummer, irgendwo ganz unten auf der Hierarchieleiter in Longbridge. Normalerweise begegnete Bill ihm mit reservierter Höflichkeit, doch heute abend konnte er sich nicht darauf beschränken; es war Ehrensache, daß sie den Machenschaften des Managements gemeinsam die Stirn boten. Allein dieser Umstand reichte schon, daß er sich fragte, was für ein Spiel Jack mit ihnen trieb. So brachte man doch nur die Opposition auseinander – indem man zwei Leute zusammenspannte, die sich noch nie hatten ausstehen können.
»Gar nicht so übel, das hier, was?« sagte Roy, wobei er Bill grob in die Rippen stieß, während sie die in rotes Leder eingebundenen Speisekarten studierten. Inzwischen waren sie in ein Berni Inn an der Stratford Road umgesiedelt.
»Nun machen Sie sich mal nicht gleich naß, Slater«, sagte Bill und zog seine Lesebrille hervor. »Umsonst gibt’s gar nichts in diesem Geschäft, falls Sie’s noch nicht bemerkt haben.«
»Laß mich bei dieser Gelegenheit bemerken, daß du da absolut falsch liegst«, sagte Jack. »Alle hier Anwesenden sind meine Gäste, und jeder kann bestellen, was immer er will. Die Rechnung übernimmt British Leyland, über Kosten reden wir hier also nicht. Also los, Leute. Jeder nach seinem Gusto.«
Roy bestellte Filetsteak und Pommes frites; Colin bestellte Filetsteak und Pommes frites; Bill bestellte Filetsteak, Pommes frites und Erbsen, und Jack, der in den Ferien immer nach Südfrankreich fuhr, bestellte Filetsteak mit Pommes frites, Erbsen und Champignons, eine besondere Note, die den anderen nicht verborgen blieb. Während sie auf ihr Essen warteten, versuchte Jack ein Gespräch über die ehelichen Aussichten von Prinzessin Anne und Captain Mark Philips in Gang zu bringen, ohne großen Erfolg allerdings. Roy schien keine Meinung zum Thema zu haben, Bill interessierte es nicht (»Brot und Spiele, Jack, Brot und Spiele«), und Colin war abgelenkt. Er starrte hinaus ins Dunkel, über den Parkplatz in die stockdüstere Nacht, und niemand hätte sagen können, worüber er nachdachte. Ob er sich Sorgen machte wegen Ben und seines Spitznamens? Vermißte er Sheila und das leise Zischen des Kohleofens? Oder sehnte er sich einfach nur zurück nach den alten Zeiten in der Konstruktionsabteilung, ehe er seinen jetzigen Job angenommen hatte, diese verdammte Stelle, die wie ein Aufstieg ausgesehen hatte und so schnell zum Alptraum geworden war?
»So funktioniert das nicht, Jack«, sagte Bill gerade. Sein Ton war freundlich, aber streitlustig, schon leicht angeheitert durch sein fünftes Bier. »Du schaffst die soziale Ungerechtigkeit nicht aus der Welt, indem du den Feind ab und zu zum Abendessen einlädst.«
»Ach, vergiß es, Bill. Das ist bloß der Anfang. In ein paar Jahren wird die Mitbestimmung der Arbeitnehmer Gesetz sein. Teil der Regierungspolitik, verstehst du?«
»Welcher Regierung?«
»Egal welcher. Macht keinen Unterschied. Ich sage dir, wir stehen vor dem Beginn einer neuen Ära. Arbeitgeber und Arbeitnehmer – deren gewählte Vertreter, um genau zu sein – werden zusammen am Tisch sitzen und gemeinsam Entscheidungen treffen. Die Firmenziele gemeinsam entwickeln. Vereinigte Interessen. Gemeinsame Grundlagen. Darauf arbeiten wir hin. Und wir müssen es schaffen. Die dauernden Konflikte blockieren unsere Industrie.«
»Mann«, sagte Slater plötzlich und ohne ersichtlichen Grund, »das ist wirklich ein verdammt gutes Steak.« Sein Essen war zuerst gekommen, und er hatte nicht auf die anderen gewartet. »Gebt mir das jeden Tag der Woche, und wir können miteinander reden. Ihr versteht schon, was ich meine.«
Bill schenkte ihm keine Beachtung. »Jack, der Punkt ist doch, daß die Konflikte nicht einfach so aus heiterem Himmel entstehen. Und das scheint eure Seite nicht zu begreifen. Ich rede von Mißständen. Echten, unerträglichen Mißständen.«
»Auch darum werden wir uns gemeinsam kümmern.«
Bill hielt inne und sah sein Gegenüber mit schmalen Augen an, während er an seinem Bier nippte. Die Kellnerin kam mit dem Essen, und für einen Moment war er abgelenkt, einmal vom Anblick seines Steaks, dann vom Anblick ihrer Beine, der in feinstes Nylon gehüllten Schenkel, der Verlockung ihres von einer weißen Bluse umschmeichelten Körpers. Der Mensch war eben doch ein Gewohnheitstier. Er zwang sich zum Wegsehen und konzentrierte sich wieder auf Jack, der seine Pommes frites mit Salz und Ketchup eindeckte, als gäbe es morgen keines mehr. Bill schnitt ein Stück von seinem Steak ab, ließ es sich auf der Zunge zergehen (zu Hause bekam man so etwas nicht) und sagte dann: »Wo das hinführen wird, sieht ja wohl ein Blinder.«
»Was meinst du?«
»Ist doch alles bloß Taktik. Teile und herrsche. Ein paar Angestellte werden in die Chefetage geladen, dürfen mit am Konferenztisch sitzen und sich wichtig fühlen. Man weiht sie in ein paar Interna ein – nichts Entscheidendes, bloß ein paar Bröckchen, damit sie glauben, sie wären mit im Boot. Und plötzlich fühlen die sich gebauchpinselt und fangen an, die Dinge aus dem Blickwinkel der Konzernleitung zu sehen, während diejenigen, für die sie sich eigentlich einsetzen sollen... tja, während die sich langsam fragen, warum diese Burschen den halben Tag oben bei den Bossen verbringen und nicht unten am Fließband, wo die wirklichen Probleme sind. So ähnlich wird’s doch laufen, stimmt’s nicht, Jack?«
Kopfschüttelnd legte Jack Forrest sein Besteck hin und sagte zu Colin: »Hast du das gehört? Ich meine, wie sollen wir dagegen ankommen? Diese ewige Gewerkschafter-Paranoia.«
»Jetzt hör mal zu, Genosse«, nuschelte Roy, den Mund voller Pommes frites, in Bills Richtung. »Wenn die beiden Gentlemen uns bei ’nem guten Dinner ab und zu mal ihre Ansichten verklickern wollen, wo liegt das Problem? Nehmen, was man kriegen kann, darum geht’s doch, Mann. Jeder ist sich selbst der Nächste, das ist doch wohl klar.«
»Gut gesprochen«, sagte Bill. »Wie eine echte Säule der Arbeiterschaft.«
»Was meinst du, Colin?«
Colin sah nervös zu seinem Boss hinüber. Er haßte Auseinandersetzungen dieser Art die sowieso zu nichts führten.
»Es sind die Streiks, die immer wieder den Fortschritt der Firma beeinträchtigen«, sagte er schließlich, an seinen Teller gewandt, während er zögernd seine feste Überzeugung kundtat, auch wenn er diese erst aus den tiefsten Tiefen seiner Weltanschauung zutage fördern mußte. »Ich weiß nicht, ob wir sie durch die erwähnten Maßnahmen beenden können, aber trotzdem muß endlich Schluß sein mit den pausenlosen Streiks. In Deutschland, Italien oder Japan gibt es diese Probleme nicht. Nur hier bei uns.«
Bill hielt im Essen inne und starrte Colin mit nachdenklichem, bohrendem Blick an. Er hätte eine Menge Antworten parat gehabt, doch er sagte nur: »Ich frage mich, worüber sich Ihr Sohn und meiner auf dem Nachhauseweg unterhalten.«
Jack nutzte die Gelegenheit, eine leichtere Note in das Gespräch zu bringen: »Über Mädchen und Popmusik wahrscheinlich«, sagte er, worauf Bill klein beigab und sich auf sein Steak und das nächste Bier konzentrierte. Ein Steak war schließlich ein Steak, Punkt.
Bill und Roy, die in dieselbe Richtung mußten, waren gezwungen, sich ein Minicab nach Hause zu teilen. Roy zog eine Grimasse, als er den Turbanträger hinter dem Steuer sah, und wandte sich zu seinem Begleiter, um irgend einen ausländerfeindlichen Schwachsinn abzusondern, doch Bill ließ sich darauf nicht ein. Er ließ Roy hinten einsteigen und machte es sich demonstrativ auf dem Beifahrersitz bequem, wo er die zwanzigminütige Fahrt mit dem Fahrer verplauderte. Er erfuhr, daß dessen Familie, Einwanderer der zweiten Generation, in Small Heath wohnte; daß es ihnen in Birmingham gefiel, weil es so viele Parks gab und die Berge nicht weit entfernt waren; daß sein älterer Sohn Medizin studierte, der jüngere aber Probleme mit Schlägern in der Schule hatte.
Als eine kurze Gesprächspause entstand, beugte sich Roy nach vorn und sagte zu Bill: »Was sollte das vorhin? Was Sie zu Trotter gesagt haben. Worüber sich Ihre Kids auf dem Nachhauseweg unterhalten?«
»Bloß so eine Bemerkung«, antwortete Bill.
»Ihre Söhne gehen also auf die gleiche Schule, stimmt’s?«
»Was geht Sie das an, Slater?«
»Trotters Junge geht doch aufs King William’s. Diese Scheiß-reiche-Söhnchen-Akademie in Edgbaston.«
»Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Und Schulgeld bezahlen wir auch nicht. Die Schule wird staatlich subventioniert. Er ist ein heller Kopf, das ist alles. Ich sorge nur dafür, daß er die besten Startchancen hat.«
Roy erwiderte nichts darauf, lehnte sich aber zufrieden zurück, offenbar in dem Glauben, daß er einen Kratzer im Lack des Kollegen entdeckt hatte. Abgesehen von einem hingeworfenen »Good bye«, wechselten sie kein Wort mehr miteinander.
Als Bill nach Hause kam, stellte er fest, daß Irene bereits ins Bett gegangen war. Er zog eine finstere Miene, als er den Papierkram auf dem Eßtisch sah, und beschloß, die Erledigung auf morgen zu verschieben. Es war fast Mitternacht. Er zog den Scheck aus seiner Jackentasche und begutachtete ihn ein weiteres Mal im Schein der Leselampe.
Er irritierte ihn immer noch. Ein Scheck vom Stiftungsfonds über 145 Pfund, ausgestellt auf einen Namen, den er nicht entziffern konnte. Nicht unterzeichnet von Harry, dem Vorsitzenden, oder von Miriam, der äußerst attraktiven Sekretärin (apropos, war das seine blühende Phantasie, oder hatte sie ihn während des gestrigen Meetings tatsächlich dauernd angestarrt?), sondern von ihm selbst. Und trotzdem konnte er sich nicht daran erinnern. Darüber hinaus hatte die Bank den Scheck zurückgeschickt, weil der Betrag nur in Buchstaben, nicht aber als Zahl eingetragen worden war; ein Fehler, der ihm sicher nicht unterlaufen wäre. Es sei denn, der Job wuchs ihm langsam über den Kopf. Es sei denn, er hielt den Druck nicht mehr aus.
Er legte den Scheck auf die Ablage in seinem Büro und trank noch ein Bier, bevor er zu Bett ging.
Jack Forrest und Colin hatten sich auf dem Parkplatz des Restaurants voneinander verabschiedet. Jack war eher zwiespältiger Meinung über den Abend. »Ob uns das weitergebracht hat? Was meinst du?« Sein Atem bildete kleine Wolkenfetzen in der Winterluft. Es würde Frost geben.
»Ich denke schon«, sagte Colin, der immer versuchte, die Dinge von der positiven Seite zu sehen. »Ich würde sagen, es war durchaus...«
»Konstruktiv?«
»Ja, genau.«
»Gut. Ja, ich glaube, du hast recht. Konstruktiv, das war es.« Er rieb sich die Hände. »Da liegt was in der Luft, hm? Hoffentlich hat meine Frau die zweite Decke rausgelegt.«
3
Mittwoch nachmittags hatten sie eine Doppelstunde Englisch bei einem Schotten namens Mr. Fletcher, der extrem nuschelte, obwohl schon sein Akzent schwer genug zu verstehen war; sie verdächtigten ihn, Alkoholiker zu sein. Die meisten hatten eine Heidenangst vor Mr. Fletcher, weil er sofort zu brüllen anfing, wenn er die Nerven verlor, und die verlor er in jeder Stunde, manchmal sogar zwei- oder dreimal. Der einzige, der sich nicht vor ihm zu fürchten schien, war Harding. Andererseits fragten sich alle – speziell Benjamin – schon lange, was Harding überhaupt Angst einjagen mochte.
Doppelstunden waren anders. Wenn nach 40 Minuten die Glocke schrillte, mußte man sitzen bleiben, als sei nichts passiert. Meist redete der Lehrer einfach weiter, wie um zu betonen, daß das Läuten keine besondere Beachtung verdiente, da ohnehin erst die halbe Zeit verstrichen war, wobei es mühsam war, die Aufmerksamkeit der Jungen während dieser Minuten aufrechtzuerhalten, wenn draußen die Korridore von Hunderten jugendlicher Füße dröhnten, während der Rest der Schule von Klassenzimmer zu Klassenzimmer rannte. Langsam verhallte der Donner der Schritte, das Schlagen der Türen, dann kehrte wieder Stille ein, worauf es keine Ausflucht mehr gab, sich dem gebetsmühlenartigen Sermon von Mr. Fletcher weiter zu entziehen.
»Das war eine Meisterleistung, Spinks, eine veritable Meisterleistung«, sagte er, während drei Jungen mit hochroten Gesichtern an ihre Tische zurückkehrten. Sarkasmus, unbeleckt von Humor oder Wärme, war die wesentliche Geisteshaltung Mr. Fletchers. »Wenn Hollywood an die Verfilmung vom Fänger im Roggen geht, wirst du ganz sicher den Holden Caulfield spielen. Bei deinem Dialekt werden sie die Handlung allerdings nach Birmingham verlegen. Tja, die Rolle kann sich Peter Fonda wohl abschminken. Nun ja...« – er hob die Stimme, um das Gelächter zu ersticken, das sich sowieso nicht erhob – »... wer sind die nächsten? Trotter, Harding, Anderton, Chase. Hört sich an wie eine vermaledeite Anwaltskanzlei. Was habt ihr für uns vorbereitet?«
Die drei Angesprochenen erhoben sich (Harding hatte vor ein paar Minuten gebeten, austreten zu dürfen, und wurde jeden Moment zurück erwartet), und Philip Chase, der inoffizielle Sprecher der Gruppe, verkündete: »Die Gerichtsszene aus Wer die Nachtigall stört, Sir. Von mir und Trotter dramatisiert.«
»Von Trotter und mir, Chase. Nur der Esel nennt sich zuerst.«
»Ja, Sir. Ich spiele Atticus Finch, den Angeklagten.«
»Den Verteidiger, nicht den Angeklagten.«
»Ja. Entschuldigen Sie, Sir. Anderton spielt Mr. Gilmer, den, äh... den Staatsanwalt. Trotter spielt Richter Taylor, und Harding...«
In genau diesem Augenblick wurde die Klassentür aufgerissen, und Harding kehrte unter allgemeinem Gejohle zum Unterricht zurück.
»Harding spielt Tom Robinson, Sir.«
Die Erklärung war völlig überflüssig, da Hardings Make-up Bände sprach. Sein Gesicht war unter einer Maske aus blauschwarzer Tinte verschwunden. Er mußte das Fläschchen in seiner Tasche versteckt haben, als er zur Toilette gegangen war. Es handelte sich um einen erstaunlichen Anblick, nicht zuletzt aufgrund der durchscheinend blassen Ringe um seine Augen, aber auch, weil er aus irgendeinem unerfindlichen Grund seine Nase ausgelassen hatte, die nun wie ein weißes Ausrufezeichen aus seinen Zügen ragte. Die Klasse rastete aus. Der Raum gellte vor hysterischem Gelächter, wie ein Vogelhaus zur Fütterungszeit, bis das Getöse nach einer ohrenbetäubenden halben Minute in etwas überging, das wie schweres Maschinengewehrfeuer klang, als die 22 Jungen die Deckel ihrer Tische in einer Woge der Begeisterung wieder und wieder herunterknallen ließen. Mr. Fletcher verzog keine Miene, während er darauf wartete, daß sich der Tumult wieder legte; der Geduldsfaden riß ihm erst, als Harding den Bogen überspannte und sich von den Beifallsstürmen dazu hinreißen ließ, mit wedelnden Händen und ausgestreckten Fingern vor der Tafel auf und ab zu stolzieren – eine Darbietung, die sich weniger Al Jolson als der wöchentlichen TV-Ausstrahlung der Black and White Minstrel Show verdankte. Mr. Fletcher erhob sich und klopfte barsch auf sein Pult.
»Ruhe jetzt!«
Als sie später zusammen an der Bushaltestelle standen, kamen Chase, Trotter und Anderton überein, daß dies eine saudumme Idee ihres Freundes gewesen war, die sie von vornherein hätten unterbinden müssen. Der Spaß hatte sich ins genaue Gegenteil verkehrt, und nun hatte jeder die Aufgabe, sechs Seiten zum Thema »Rassische Stereotypen« zu schreiben, die am nächsten Morgen um neun in Mr. Fletchers Fach zu liegen hatten; es war insbesondere eine Niederlage für Benjamin, der sonst nie irgendwelche Strafen aufgebrummt bekam. Harding selbst mußte am Samstagmorgen zum Nachsitzen kommen. Umrundet von Fans, stand er an der Bushaltestelle auf der anderen Straßenseite (Harding wohnte im Norden Birminghams, in Sutton Coldfield), immer noch Reste seiner Kriegsbemalung im Gesicht; die anschließend erzwungene Wäsche hatte nicht verhindert, daß ein ozeanblauer Schimmer zurückgeblieben war. Wenigstens die Hälfte seines Publikums war weiblich, wie Benjamin beobachtete. Die Mädchenschule befand sich auf demselben Gelände, und obwohl kaum offizieller Kontakt zwischen den beiden Schulen bestand – erst ab der elften Klasse gab es gemeinsame Unternehmungen –, kam es im Bus auf dem Nachhauseweg häufig zu Begegnungen zwischen den Geschlechtern. Harding hatte offenbar keinen Mangel an Verehrerinnen; er war nicht im mindesten zerknirscht und sonnte sich im Schein seiner wachsenden Popularität.
Benjamin und seine Freunde waren blaß vor Neid. Die Mädchen auf ihrer Seite der Haltestelle blieben ganz unter sich, warfen höchstens mal einen spöttischen Blick in ihre Richtung, verhielten sich aber sonst so abweisend, daß es schon an Feindseligkeit grenzte. Auch Lois wäre es nicht im Traum eingefallen, in solchen Momenten mit ihrem Bruder zu sprechen, auch wenn sie nur ein paar Schritte voneinander trennten. Von der kratzbürstigen Zuneigung, die sie zu Hause füreinander hegten, blieb nichts als peinliche Verlegenheit, sobald ihre Freundinnen in der Nähe waren. Es war schlimm genug, daß man sie »die Rotters« nannte, ein Spitzname, mit dem sie sich abfinden mußten, seit jemandem aufgefallen war, daß man ihre Namen zu »Bent Rotter« und »Lowest Rotter«2 verballhornen konnte. Noch schlimmer aber war, daß Benjamin immer noch seine Schuluniform tragen mußte, während Lois, jetzt in der zehnten Klasse, dank der liberaleren Vorschriften an der Mädchenschule anziehen konnte, was sie wollte. (Heute trug sie ihren langen Jeansmantel mit dickem weißem Pelzkragen über einem gerippten Acrylrolli und mit Stickereien verzierten Jeans.) Dieser Umstand hatte die Kluft zwischen ihnen noch vergrößert, so daß ein unvoreingenommener Umgang miteinander vollkommen unmöglich war, bevor sie nicht wieder in der unbeobachteten Abgeschiedenheit ihres Elternhauses angekommen waren.
»Wird ’ne lange Nacht, was, Jungs?« sagte eine tiefe Stimme hinter ihnen. Als sie sich umdrehten, stand ihr alter Feind Culpepper vor ihnen: Captain des Football-Juniorenteams, Captain des Cricket-Juniorenteams, Möchtegern-Champion und schon seit Ewigkeiten Zielscheibe ihres Gespötts. Wie immer hatte er seine Bücher und seine Sportsachen in derselben ausgebeulten Sporttasche verstaut, aus der der Griff seines Squash-Schlägers hervorragte wie ein erigierter Penis. »Sechs Seiten jeder, stimmt’s? Da sitzt ihr bestimmt noch morgen früh dran.«
»Verpiß dich, Culpepper«, sagte Anderton.
»Uuuh«, gab er mit gespieltem Respekt zurück. »Wahnsinn! Da hast du’s mir aber gegeben!«
»War doch bloß ein Gag, mehr nicht«, sagte Benjamin. »Und du hast genauso gelacht wie alle anderen.«
»Ihr seid doch selbst schuld«, sagte Culpepper und wischte sich die Nase, wobei sich zeigte, daß selbst seine Taschentücher mit seinem Monogramm bestickt waren – nicht, daß sich jemand darüber gewundert hätte. »Fletcher ist ein abartiger alter liberaler Softie. Der läßt Nigger nicht so einfach durch den Kakao ziehen.«
»So was sagt man nicht«, sagte Chase. »Und das weißt du ganz genau.«
»Was? Nigger?« sagte Culpepper und genoß die Wirkung, die die beiden Silben bei ihnen erzielten. »Wieso nicht? Genauso steht’s in dem Roman. Harper Lee hat’s doch selbst geschrieben.«
»Das ist was anderes.«
»Okay, okay. Bimbo. Schuhbürste. Schwarze Sau.« Nachdem es ihm nicht gelang, sie damit zu provozieren, fügte er hinzu: »Ist doch eh ein Scheißbuch. Wieso müssen wir so was lesen? Ich fall da jedenfalls nicht drauf rein. Ist doch alles Propaganda.«
»Ist uns echt schnurz, was du denkst«, sagte Anderton, und um das zu unterstreichen, wandten sie sich von ihm ab und steckten die Köpfe zusammen. Wie immer redeten sie über Musik. Anderton gab fast sein gesamtes Taschengeld für Platten aus und hatte unlängst Stranded von Roxy Music erstanden. Er versuchte, Chase die Scheibe schmackhaft zu machen; dagegen könne er seine abartigen Genesis-Alben in die Tonne treten. Benjamin hörte halbherzig zu. Beide Bands ließen ihn kalt, ebenso wie das Eric-Clapton-Tape, das ihm seine Eltern zum Geburtstag geschenkt hatten. Er war auf der Suche nach etwas Neuem, das über Rockmusik hinausging... und davon abgesehen, wurde er gerade von etwas abgelenkt, das an der gegenüberliegenden Haltestelle vor sich ging. Offenbar redete Harding mit – unglaublich, aber wahr: er redete wirklich mit ihr – Cicely Boyd, der gertenschlanken Göttin, die in der Juniorengruppe der Theaterwerkstatt den Ton angab. Wie war das möglich? Ihre Unnahbarkeit war legendär, und trotzdem stand sie da mit großen Augen und offenem Mund, während er mit Händen und Füßen die Highlights seines letzten Streichs zum Besten gab. Wie vor den Kopf gestoßen, sah Benjamin den beiden zu, als sie, noch unglaublicher, an einem Finger leckte und über seine Wange rieb, um etwas von den Tintenresten zu entfernen.
Er stieß seine Freunde in die Rippen. »Seht euch das an.«
Die musikalische Debatte war vergessen.
»Verdammte Tat!«
»Scheiße...«
Selbst Anderton, den anderen in Sachen Sexualpolitik allemal eine Nasenlänge voraus, war sprachlos angesichts der Lässigkeit, mit der Harding den Jackpot knackte. Und es gab offensichtlich nichts, was sie tun konnten – außer zu glotzen, bis Sekunden später der 62er eintraf und sie zum Oberdeck hinaufstiegen, den einen oder anderen sehnsüchtigen Blick über die Schulter inbegriffen.
»Der hat Nerven«, sagte Chase, als der Bus sich wieder in Bewegung setzte. »Dabei war’s doch seine Idee. Jetzt haben wir den Ärger, und er sahnt ab.«
»Die Idee an sich war doch schon bekloppt«, sagte Anderton. »Ich hab’s ja gleich gesagt, aber ihr hört mir ja nie zu. Die Rolle hätte sowieso nur einer spielen dürfen. Richards.«
»Aber der ist nicht in unserer Klasse.«
»Genau. Deshalb hätten wir das Ganze von vornherein abblasen sollen.«
Richards war der einzige schwarze Schüler ihres Jahrgangs; tatsächlich sogar der einzige schwarze Schüler an der ganzen Schule. Der hochgewachsene, leicht melancholisch wirkende Junge stammte aus der Karibik, wohnte am Rand von Handsworth und war neu am King William’s. Anderton war übrigens der einzige, der ihn Richards nannte. Die anderen 95 Jungen des Jahrgangs riefen ihn »Rastus«.
»Da arbeiten wir stundenlang an der Szene«, maulte Chase, »und dann können wir sie nicht mal aufführen.«
»Pech.«
Der Bus quetschte sich durch den Verkehr in Selly Oak und fädelte sich dann auf die breitere Bristol Road South ein, auf der es schneller weiterging. Chases Haltestelle kam zuerst, kurz vor Northfield, und als er ausstieg, passierte etwas Seltsames. Das Mädchen, das hinter ihnen gesessen hatte – ein Mädchen, das sie unzählige Male gesehen hatten, ohne daß sie ihnen je aufgefallen wäre –, stieg hinter ihm die Stufen hinunter, doch just in dem Moment, bevor sie verschwand, warf sie einen Blick in Benjamins Richtung. Es war ein vieldeutiger Blick: unauffällig, heimlich, aber eben doch nicht ganz verstohlen. Er blieb zwei oder drei Sekunden an Benjamin haften; die Augen unter der dunklen Ponyfrisur musterten ihn ganz genau, und der Anflug eines Lächelns spielte um ihre vollen Lippen. Noch ein, zwei Jahre, dann hätte Benjamin vielleicht verstanden, daß sie mit ihm flirtete. Doch jetzt verwirrte ihn ihr Blick nur, löste eine Kettenreaktion verschiedenster Gefühle aus, die ihn wie einen Ölgötzen zu ihr herüberstarren ließen. Bevor er auch nur eine Miene regen konnte, war sie verschwunden.
»Wer war das?« fragte er.
»Sie heißt Newman oder so ähnlich. Claire Newman, glaube ich. Wieso, stehst du auf sie?«
Benjamin antwortete nicht. Statt dessen sah er neugierig nach draußen, wo Chase ihr die St. Lawrence Road hinunter folgte. Er ging unnatürlich langsam, wahrscheinlich, weil er zu schüchtern war, sie zu überholen. Zu dem Zeitpunkt hätte man sich kaum vorstellen können, daß sie eines Tages Freunde werden würden, geschweige denn, wenn auch nur kurz und glücklos, Mann und Frau.
Das Mädchen hieß tatsächlich Claire Newman. Darüber hinaus hatte sie eine ältere Schwester namens Miriam, die als Sekretärin bei British Leyland in Longbridge arbeitete.
Als Claire an diesem Nachmittag nach Hause kam, war das Haus verlassen; ihre Eltern und ihre Schwester waren noch bei der Arbeit. Sie stellte die Schultasche auf den Küchentisch, holte sich ein paar Cracker aus einer Keksdose und strich Butter und Frischkäse darauf. Sie nahm sich einen Teller für die Cracker und ging nach oben. Bevor sie das Zimmer ihrer Schwester betrat, blieb sie auf dem obersten Treppenabsatz stehen. Es war wunderbar still im Haus. Genau die richtige Atmosphäre für böse Taten.
Miriam versteckte ihr Tagebuch unter einer Kommode, zusammen mit einem roten Männerhemd aus Nylon, das sie offenbar aus sentimentalen Gründen aufbewahrte, und einem satten Vorrat Pillenpackungen. Claire hatte das Versteck zwei Wochen zuvor entdeckt und war mittlerweile bestens informiert über das Privatleben ihrer Schwester, das neuerdings ziemlich aufregend geworden war. Sie zog das Tagebuch hervor, stellte den Teller neben sich auf den Boden und hockte sich im Schneidersitz daneben. Sie leckte sich den Frischkäse von den Fingern und blätterte gespannt zur letzten Seite.
Ihre Augen huschten über den neuesten Eintrag, der sich aber als Enttäuschung erwies. Dann war also nichts passiert in der Zwischenzeit: Miriams aktuelle Amour war immer noch Phantasie. Doch zumindest wurden die Details immer aufschlußreicher.
20. November
War gestern abend bei einem weiteren Meeting der Stiftung. Die üblichen Anwesenden (Victor das Ekel inbegriffen). Mr. Anderton diesmal nicht vorne, sondern gegenüber von mir. Ich führte Protokoll, wie immer. Er sah mich an, so wie die vorherigen Male auch, und ich erwiderte seinen Blick. Es konnte gar nicht klarer sein, was er dachte; unglaublich, daß keiner was merkte. Ich glaube, er ist ziemlich alt, aber so irre sexy, daß ich mich kein Stück konzentrieren konnte und die Hälfte nicht mitbekam. Ich will, will, will, daß er mich tkcif, und ich weiß, daß er es auch will. Dann fast die ganze Nacht wach gelegen und mir vorgestellt, auf welche Weisen er mich nekcif könnte und wie sich das anfühlen würde. Wir müβten es irgendwo in der Fabrik tun, zum Beispiel in den Duschen, wo die Männer sich nach der Schicht waschen gehen. Ich stellte mir vor, wie wir es da drin tun, wie er meinen Rock hochschiebt und mich tkcel, bis ich komme. Ich muß unbedingt mit ihm sprechen. Er kann mich haben, und ich weiß, daß er es genauso will, wenn nicht noch mehr. Ich bin bestimmt nicht die erste, aber das macht mir nichts. Es muß endlich passieren, sonst vergehe ich noch vor Sehnsucht.
Unten fiel die Küchentür ins Schloß. Claire schob das Tagebuch in sein Versteck zurück und rappelte sich hoch. Wahrscheinlich war ihre Mutter aus der Anwaltskanzlei zurück, in der sie arbeitete. Wahrscheinlich hatte sie unterwegs noch im Supermarkt eingekauft und brauchte jetzt bestimmt Hilfe beim Auspacken.
4
Frühling
Einige Wochen später, am Nachmittag des 13. Februar 1974, war alles still am Werk in Longbridge. Die Bristol Road, zu dieser Tageszeit sonst von parkenden Autos gesäumt, war so gut wie ausgestorben. Irene Anderton genoß die seltsame Ruhe, als sie, den schweren Korb mit den Lebensmitteln in der Hand, vom Einkauf zurückkam. Sie nahm den Korb in die andere Hand und winkte der Streikpostenkette am Südeingang zu; einige der Männer erkannten sie und winkten zurück. Ein jähes Stolzgefühl durchdrang ihre Brust. Ihr Mann bedeutete diesen Menschen etwas; er war ein Held für sie. Ohne ihn als Anführer hatten sie keine Chance. Sie ging den Hügel zur Bushaltestelle hinauf. Es war ein langer Weg, aber manchmal verzichtete sie darauf, den Bus zu nehmen, und heute war ein besonders schöner Tag, dank der angenehmen Stille, die sich über die ganze Gegend gebreitet hatte. Sonst machte man sich gar nicht bewußt, was für einen Lärm die Montagebänder verursachten, die den ganzen Tag hinter den Fabriktoren ratterten. Man war so daran gewöhnt, daß es einem erst auffiel, wenn sie stillstanden.
Sie kaufte eine Evening Mail beim Zeitungshändler und blätterte sie auf einer Bank im Cofton Park durch. Sie hielt sich jedoch nicht lange auf; es dämmerte bereits, und es wurde kalt. Es war ein eisiger Winter gewesen. In einem Artikel zum Streik wurde auch Bill erwähnt, obwohl er nicht abgebildet war. Doch das war bestimmt ganz in seinem Sinne.
Als sie nach Hause kam, saß er am Eßtisch, Stapel von Unterlagen vor sich. Wie immer steckte er bis über beide Ohren in Arbeit. Wenn er eines an den Zeitungen haßte, dann, daß sie bei jedem Streik sofort unterstellten, den Arbeitern ginge es sowieso nur darum, im Pub herumzuhängen oder sich zu Hause auf die faule Haut zu legen. Bill wäre nie auf die Idee gekommen, etwas Derartiges zu tun. Als Betriebsratsvorsitzender hatte er sich dauernd mit neuem Papierkrieg auseinanderzusetzen; es war einfach nie Land in Sicht. Oft brütete er bis Mitternacht über seinen Unterlagen, und auch von den Versammlungen kam er immer erst spät nach Hause. Sie glaubte nicht, daß einer von den Werksbossen auch nur annähernd so hart arbeitete. Die hatten nicht den blassesten Schimmer von dem, was er tat. Zwar verbrachte er immer weniger Zeit am Fließband, aber das konnte man ihm nicht vorwerfen. Er hatte jetzt andere Verpflichtungen, die schwer auf seinen Schultern lasteten. Kein Wunder, daß er langsam graue Haare bekam, wenn auch nur ganz leicht um die Schläfen.
Er war immer noch ein sehr gutaussehender Mann. Nicht schlecht für einen, der auf die Vierzig zuging.
Sie gab ihm einen Kuß auf die Stirn. »Magst du einen Tee, Schatz?«
Er lehnte sich zurück, reckte sich und legte den Federhalter aus der Hand. »Das wär prima.« Er wies auf die ungelesene Korrespondenz. »Mein Gott, man wird einfach nie fertig.«
»Du schaffst das schon«, sagte sie. »Ist Duggie schon da?«
Bill zog ein genervtes, wenn auch nicht völlig verständnisloses Gesicht. »Seit einer Viertelstunde. Er hat sich gleich nach oben verzogen. Er war wieder im Plattenladen. Er wollte sich vorbeischleichen, aber ich hab die Tüte gesehen.«
Wie aufs Stichwort tönte ein dumpfer Drumbeat durch die Zimmerdecke. Reggae, obwohl weder Bill noch Irene in der Lage gewesen wären, ihn als solchen zu identifizieren. Bob Marley übrigens.
»Ich sag ihm, er soll die Musik leiser machen. So kannst du doch nicht arbeiten.«
Mit dieser Ankündigung ging sie nach oben, während Bill sich wieder dem Brief widmete, den er bei ihrem Eintreffen verstohlen unter einen anderen geschoben hatte. Was gar nicht nötig gewesen wäre; aber eigentlich ging es auch nicht so sehr um den Inhalt, sondern um die Gewissensbisse, die in ihm aufkamen, sobald Miriams Name im Spiel war oder er an sie denken mußte. Er wußte, daß er sich mit der Sache keinen Gefallen tat. Dennoch: Wenn er nur an ihren geschmeidigen Körper dachte, die sinnlichen Brüste, die sich verlangend an ihn preßten ... Und sie war inzwischen die neunte – oder sogar schon die zehnte? Traurig, was er nach achtzehn Jahren Ehe auf dem Kerbholz hatte. Die meisten hatte er bei der Arbeit kennengelernt, Schreibkräfte oder Näherinnen; was wohl aus diesem Rotschopf aus der Kantine geworden war... Nicht zu vergessen diese Reise nach Italien vor zwei Jahren, während der er die Fiat-Werke in Turin besucht hatte und abends in der Hotelbar diese Paola kennengelernt hatte, wirklich ein wunderschönes Mädchen... Doch mit Miriam war es irgendwie anders, leidenschaftlicher, zugleich einfacher und komplizierter als bei seinen anderen Affären. In gewisser Weise machte sie ihm sogar angst, wenngleich er sich dies bislang nicht eingestanden hatte.
Wiederum konnte er seinen Ärger kaum unterdrücken, als er den Brief ein weiteres Mal las.
Verehrter Genosse Anderton,
hiermit möchte ich mich über die Arbeit von Miss Newman als Sekretärin des Stiftungskomitees beschweren.
Miss Newman ist keine gute Sekretärin. Sie kommt ihren Pflichten nicht in angemessener Weise nach.
An dieser Stelle möchte ich insbesondere Miss Newmans auffällige Unaufmerksamkeit ansprechen. Bei den Sitzungen des Stiftungskomitees läßt sich diese Abwesenheit ein ums andere Mal beobachten. Offenbar gehen ihr Dinge durch den Kopf, die mit ihren Obliegenheiten als Sekretärin nichts zu tun haben. Ich erspare mir hier Einlassungen, worum es sich bei diesen Dingen handeln könnte.
Ich habe im Rahmen des Stiftungskomitees eine Reihe von Vorschlägen und Eingaben zu Gehör gebracht, die durch Miss Newmans Verschulden nicht zu Protokoll genommen worden sind. Dies gilt auch für andere Mitglieder des Komitees, insbesondere aber für mich. Meines Erachtens kommt Miss Newman ihren Pflichten in keiner Weise nach.
Ich wende mich in dieser Angelegenheit dringlich an Dich, Genosse Anderton, und schlage hiermit vor, Miss Newman mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben zu entbinden. Ihre Stellung als Schreibkraft im Werkssekretariat bleibt davon selbstverständlich unberührt. Obwohl ich sie auch nicht für eine gute Stenotypistin halte.
Mit genossenschaftlichen Grüßen, Victor Gibbs
Bill wischte sich über die Stirn und gähnte; eine Gebärde, die bei ihm eher Anspannung als Müdigkeit signalisierte. Das hatte ihm gerade noch gefehlt – dieser Schnüffler, der ihm das Leben mit seinen Beanstandungen und hinterlistigen Anspielungen noch schwerer machte. Wie kam dieser Mann dazu, Miriam – und ihm – dergleichen zu unterstellen? Keine Frage, sie hatten ein Lächeln zuviel ausgetauscht, sich wohl einmal für den Bruchteil einer Sekunde zu lang in die Augen geschaut. Mehr war nicht nötig gewesen. Trotzdem fand er es bezeichnend, daß dies ausgerechnet Gibbs ins Auge gestochen war.
Das Stiftungskomitee war ins Leben gerufen worden, um soziale Einrichtungen, hauptsächlich Schulen und Krankenhäuser, mit kleinen Spenden aus dem Gewerkschaftsfonds zu unterstützen; Victor Gibbs fungierte als Schatzmeister des Komitees. Er arbeitete als Buchhalter im Controlling, einer von diesen geleckten Typen in Schlips und Kragen, bei dem der anbiedernde Gebrauch der Anrede »Genosse« pure Speichelleckerei darstellte – fast schon eine Beleidigung, was Bill anging. Er kam aus dem Süden von Yorkshire, ein sauertöpfischer, unfreundlicher Griesgram; bedeutsamer war allerdings, daß er auch ein Betrüger zu sein schien. Bill war sich dessen inzwischen so gut wie sicher – jedenfalls fand er keine andere Erklärung für jenen mysteriösen, mit seiner Unterschrift versehenen Scheck, den die Bank vor drei Monaten hatte zurückgehen lassen. Seine Unterschrift war gefälscht worden; wenn auch ziemlich perfekt, wie er einräumen mußte. Seitdem hatte Bill der Bank mehrere Besuche abgestattet, um die Zahlungen des Komitees zu überprüfen, und war dabei auf drei weitere, auf denselben Empfänger ausgestellte Schecks gestoßen, von denen zwei Miriams und einer seine Unterschrift trugen. Wiederum handelte es sich um fast perfekte Fälschungen, die Bill jedoch nicht hinters Licht führen konnten; Gibbs mußte verrückt sein, wenn er glaubte, daß er damit durchkommen würde. Auf alle Fälle war Bill froh, seinem Instinkt gefolgt zu sein, daß er abgewartet und weiterer Beweise geharrt hatte. Damit saß er am längeren Hebel. Falls Gibbs weiter Ärger wegen Miriam machte, würde er ihm zeigen, was eine Harke war. Die miese Tour würde er ihm heimzahlen; und zwar doppelt und dreifach.
Bill heftete den Brief sorgfältig ab. Die Ehre einer Antwort wäre zuviel des Guten gewesen, aber vernichten wollte er ihn auch nicht. Zu gegebener Zeit mochte das Schreiben noch mehr als nützlich sein. Darüber hinaus hatte er es sich zum Prinzip gemacht, niemals Dokumente zu vernichten. Er war dabei, ein Archiv des Klassenkampfs zusammenzustellen, in dem jedes noch so winzige Detail zählte und das für kommende Generationen von unschätzbarem Wert sein würde. Sein Plan war, es irgendwann einer Universitätsbibliothek zu vermachen.
Die Musik oben war leiser gestellt worden. Er hörte, wie Irene und Doug miteinander stritten; keine von den heftigen Auseinandersetzungen, die es manchmal gab, nur ein bißchen Gemecker und Gemaule. Das war okay. Die beiden kamen gut miteinander aus. Seine Familie war völlig intakt. Nur er trug immer weniger dazu bei.
Die nächsten Blätter auf dem Stapel standen in engem Zusammenhang: ein Zettel, auf den er letzte Woche am Schwarzen Brett in der Kantine gestoßen war, und ein gedrucktes Flugblatt, das kürzlich im Werk die Runde gemacht hatte.
Auf dem handgeschriebenen Zettel stand:
Bei dem Flugblatt handelte es sich um den Erguß einer Vereinigung, die sich »Bund aller Briten« nannte, eines ultrarechten Ablegers der National Front, aber noch schlechter organisiert. Bill fand ihre Propaganda einfach nur armselig und hätte sie normalerweise sofort dem Papierkorb überantwortet. Doch es gab Gerüchte, daß diese Gruppe hinter dem Anschlag auf zwei asiatische Teenager steckte, die halb totgeschlagen vor einem Imbiß in Moseley aufgefunden worden waren; man mußte sich diesen Auswüchsen stellen, bevor die Welle der Gewalt auch auf das Werk übergriff.
Angewidert überflog er die ersten Zeilen.
Britische Arbeiter!
Wacht auf und schließt euch zusammen.
Eure Arbeitsplätze sind bedroht. Eure Heimat und euer Lebensunterhalt stehen auf dem Spiel.
Eure Existenz ist so bedroht wie nie zuvor.
Weder Heath noch Wilson, noch Thorpe haben den Mumm, der Einwanderungswelle der Farbigen endlich Einhalt zu gebieten. Sie alle sind Sklaven jener liberalen Gesinnung, die die Schwarzen nicht bloß toleriert, sondern auch noch über die hier geborenen Engländer stellt. Sie rollen den Schwarzen die roten Teppiche aus und scheren sich einen Dreck darum, daß wir unsere Häuser und Jobs verlieren. Wenn ihr euch umseht, werdet ihr feststellen, daß sich die Zahl der Schwarzen überall verzehnfacht hat. Wir MÜSSEN mit ihnen zusammenarbeiten, ohne daß uns jemand gefragt hat, ob wir das überhaupt WOLLEN. Wenn das auch eure Meinung ist, hier noch ein paar wissenschaftliche FAKTEN:
1. Schwarze sind nicht genauso intelligent wie Weiße. Ihr Gehirn ist genetisch nicht im selben Maße entwickelt. Wie also sollen sie für die gleiche Arbeit geeignet sein?
2. Schwarze sind von Natur aus fauler als Weiße. Weshalb sonst haben wir Engländer uns Afrika und Indien untertan gemacht statt umgekehrt? Weil die weiße Rasse den Schwarzen überlegen ist. Historische
FAKTEN.
3. Schwarze kennen nicht dieselbe Hygiene wie wir. Und trotzdem sollen wir mit ihnen an denselben Plätzen arbeiten, in derselben Kantine essen, sogar dieselbe Toilette benutzen. Welche Auswirkungen hat das auf unsere Gesundheit? Welche Krankheiten werden dadurch verbreitet? Und weit und breit ist niemand, der sich darum kümmert.
Bill las nicht weiter. Er verwandte ohnehin schon zuviel Zeit auf die Organisation von Diskussionsrunden und anderen Veranstaltungen, um diesem Unsinn entgegenzuwirken. Selbst die Infoblätter der Gewerkschaft zum Thema Rassismus mußte er in den meisten Fällen selbst verfassen. Diese Schmierereien deprimierten ihn einfach nur. Alle machten es sich so hundserbärmlich einfach. Dauernd fanden die Leute irgendwelche Gründe, um sich gegenseitig an die Kehle zu gehen, statt sich als Arbeiterschaft gegen den gemeinsamen Feind zu verbünden. Manchmal schienen ihm alle Anstrengungen einfach bloß für die Katz zu sein.
Seine düstere Stimmung – durch seine Gewissensbisse wegen Miriam noch verstärkt – hellte sich ein paar Minuten später durch das Fernsehprogramm minimal auf. Irene hatte ihm seinen Tee gebracht, stark und mit viel Zucker, und zusammen sahen sie sich vom Sofa aus die Lokalnachrichten an; ihre Hand lag zärtlich auf seinem Knie (entweder schien sie es nicht zu bemerken, oder es machte ihr nichts aus, daß er diese Gesten nie erwiderte). Der dritte Bericht war über den Streik in Longbridge.
»Dann waren ja die Leute vom Fernsehen da«, sagte Irene. »Haben sie mit dir gesprochen?«
»Nein, sie waren schon weg, als ich kam. Aber ich glaube sowieso nicht, daß sie ...«
Er brach mittendrin ab und fluchte wie ein Fuhrkutscher, außer sich vor Wut, als Roy Slater – verdammt noch mal, Slater, das Arschloch! – auf dem Bildschirm in das Mikro eines Reporters sprach. Wie, in drei Teufels Namen, hatte Slater es hingekriegt, als erster vor die Kameras zu kommen? Was fiel ihm ein, sich über den Arbeitskampf auszulassen, bevor überhaupt eine offizielle Absprache getroffen worden war?
»Die von oben nehmen uns doch bloß aus«, sagte Slater mit seiner schroffen, ausdruckslosen Stimme. »Jedesmal, wenn sie ihre Versprechungen einschränken, geht das auf Kosten unserer Lohntüten. Das kann so nicht weitergehen. Es muß ...«
»Darum geht’s doch gar nicht, du Idiot!« rief Bill. »Mit den Löhnen hat der Streik doch gar nichts zu tun!«
»Womit denn?« sagte Doug, der, angelockt vom Geräusch des Fernsehers, in der Wohnzimmertür aufgetaucht war.
»Diese verdammte Pfeife!« Einen Augenblick lang war Bill sprachlos vor Wut. »Es geht um Recht und Unrecht«, erklärte er dann, wenn auch weniger seinem Sohn als einem nicht vorhandenen Fernsehpublikum. »Sie haben die Löhne gekürzt, weil sie die Körperpflege nach der Schicht nicht länger als Arbeitszeit anerkennen. Es geht um das Recht auf Sauberkeit und Hygiene.«
»... und wenn es ewig dauert«, war Slater auf dem Bildschirm zu hören. »Wir wollen unser Geld. Wir haben ein Recht auf unser Geld. Und wir werden ...«
»Es geht nicht um dein verdammtes Scheißgeld!« brüllte Bill, während er sich mit der Hand durch das langsam schütter werdende Haar fuhr. »Der hat doch nicht den blassesten Schimmer! Der weiß doch überhaupt nicht, wovon er redet!«
»Ist das nicht dieser muffige Typ«, warf Irene ein, »der letztens im Club so grob zu mir war? Als du Drinks holen warst?«
»So ist der doch immer. Eine ganz linke Bazille. Was fällt dem eigentlich ein, sich zum Sprecher von...« Er wurde vom schrillen Läuten des Telefons unterbrochen. Bill erhob sich. »Da hast du’s. Jede Wette, das ist Kevin. Der hat das bestimmt auch gesehen. Und jetzt ist Schluß mit lustig.« Er nahm den Hörer ab und bellte: »Hallo?«
Es war nicht Kevin. Es war Miriam.
»Hallo, Bill. Bist du allein?«
Ab und zu war er immer noch in der Lage, sich selbst zu überraschen; er brauchte nur ein oder zwei Sekunden, um den Schock zu verdauen, dann war er wieder ganz Herr der Lage.
»Oh, hallo, Kev. Ja, hab ich auch gesehen. Tja... was meinst du dazu? Wie sollen wir jetzt vorgehen?«
Auch Miriam war inzwischen an diese Art Versteckspiel gewöhnt. »Ich rufe wegen morgen abend an, Bill. Hast du Zeit?«