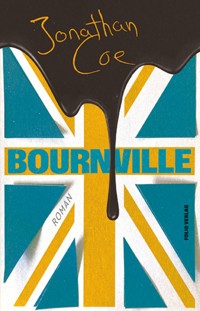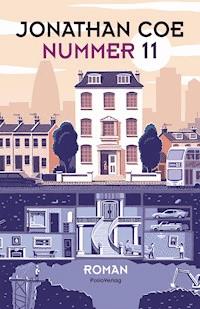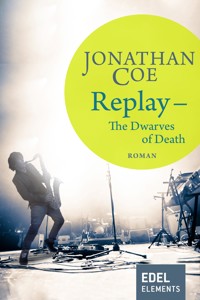Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Kulisse: ein düsteres Schloß in England am Meer, einst luxuriöses Studentenwohnheim, jetzt eine Klinik für Patienten mit Schlafstörungen, geleitet von dem exzentrischen Doktor Dudden. Hier treffen aufgrund seltsamer Zufälle ehemalige Studenten wieder aufeinander, jeder mit seinem individuellen Schlafproblem. In einer brillanten Tour de force voller Komik und Raffinesse führt Jonathan Coe in diesem Nachtstück durch die Verwirrung der Gefühle und Besessenheiten. Ein Roman, der vom Schlafen und Wachsein handelt, vom Träumen und vom Erinnern, von der Sehnsucht und der Jagd nach Liebe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jonathan Coe
Das Haus des Schlafes
Roman
Edel eBooks Ein Verlag der Edel Germany GmbH
Copyright dieser Ausgabe © 2014 by Edel Germany GmbH
Neumühlen 17, 22763 Hamburg
Copyright der Originalausgabe © 1997 by Jonathan Coe
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel THE HOUSE OF SLEEP
Ins Deutsche übersetzt von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann
Copyright der deutschen Übersetzung © Piper Verlag GmbH, München 1998
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Jouve
Inhaltsverzeichnis
»Ich bringe manchmal die Zeit durcheinander. Wenn man seinen emotionalen Mittelpunkt verliert«, sie hörte auf zu sprechen, kämpfte mit sich, fuhr heiser fort, »dann passiert so etwas. Äonen – Bruchteile von Sekunden – sie wechseln sich ab. Man gerät außerhalb der üblichen Art von Zeitrechnung...«
Rosamond Lehmann, Der begrabene Tag
Anmerkung des Autors
Die Romankapitel mit ungeraden Zahlen spielen hauptsächlich in den Jahren 1983 – 84.
Die Kapitel mit geraden Zahlen spielen in den letzten beiden Juniwochen 1996.
Wach
1
Es war ihr letzter Streit, soviel war klar. Doch obwohl er ihn seit Tagen, vielleicht sogar Wochen hatte kommen sehen, war die Welle aus Zorn und Unmut, die jetzt in ihm hochstieg, durch nichts aufzuhalten. Sie hatte unrecht gehabt und es nicht zugeben wollen. Jedes Argument, das er vorgebracht hatte, jeder Versuch, mit Vernunft eine Einigung zu erzielen, war von ihr entstellt, verdreht und gegen ihn verwandt worden. Was fiel ihr ein, seinen absolut harmlosen Abend mit Jennifer im Half Moon so aufzubauschen? Was fiel ihr ein, sein Geschenk als »jämmerlich« zu bezeichnen und zu behaupten, er hätte es ihr mit einem »hinterhältigen« Blick überreicht? Und wie kam sie dazu, das Gespräch auf seine Mutter – ausgerechnet seine Mutter – zu bringen und ihm vorzuwerfen, er würde sie zu oft besuchen? Als wollte sie seine Reife, ja seine Männlichkeit in Frage stellen ...
Er starrte blicklos vor sich hin, nahm weder seine Umgebung noch die anderen Fußgänger wahr.
»Miststück«, dachte er, als ihm alles erneut durch den Kopf ging. Und dann zischte er laut, mit zusammengebissenen Zähnen: »Miststück!«
Danach fühlte er sich besser.
Riesig, grau und imposant stand Ashdown auf einer Landzunge, etwa zwanzig Meter von den steilen Felsklippen entfernt, und das seit über einhundert Jahren. Den ganzen Tag lang umsegelten die Möwen seine Dachspitzen und Türmchen, schrien sich heiser. Den ganzen Tag und die ganze Nacht lang warfen sich die Wellen wie verrückt gegen die steinerne Barrikade, schickten ein endloses Tosen wie von starkem Straßenverkehr durch die eisigen Räume des alten Hauses und das Labyrinth aus widerhallenden Korridoren. Sogar in den verlassensten Teilen von Ashdown – und das Gebäude stand jetzt fast ganz leer – herrschte niemals völlige Stille. Die noch am ehesten bewohnbaren Räume drängten sich im ersten und zweiten Stock, mit Blick aufs Meer, und wurden tagsüber von kaltem Sonnenlicht durchflutet. Die Küche im Erdgeschoß war lang und L-förmig, mit einer niedrigen Decke; sie hatte nur drei kleine Fenster und war ständig in Dunkelheit getaucht. Ashdowns rauhe, den Naturgewalten trotzende Schönheit ließ nicht vermuten, daß das Haus praktisch unbewohnbar war. Seine ältesten und nächsten Nachbarn konnten sich erinnern, wenn auch nur schwerlich glauben, daß es einmal ein Privatsitz gewesen war, in dem eine nur acht – oder neunköpfige Familie gelebt hatte. Doch zwei Jahrzehnte zuvor war es von der neuen Universität erstanden worden und beherbergte nun etwa zwei Dutzend Studenten – eine wechselnde Belegschaft, so veränderlich wie der Ozean, der sich zu Ashdowns Füßen bis hin zum Horizont erstreckte, in einem ungesunden Grün und getrieben von ewiger Unrast.
Vielleicht hatten die vier Fremden an ihrem Tisch sie gefragt, ob sie sich dazusetzen dürften, vielleicht aber auch nicht. Sarah wußte es nicht mehr. Jetzt schien eine hitzige Diskussion anzufangen, aber sie verstand nicht, was gesagt wurde, obgleich sie ihre Stimmen wahrnahm, die sich in wütender Gegenrede hoben und senkten. Das, was sie in ihrem Kopf hörte und sah, war im Augenblick realer. Ein einziges gehässiges Wort. Augen, die vor gleichgültigem Haß glühten. Das Gefühl, nicht angesprochen, sondern angespuckt worden zu sein. Eine Begegnung, die – zwei Sekunden? – weniger? – gedauert hatte, die ihr aber seit über einer Stunde nicht mehr aus dem Kopf ging. Das Wort – diese Augen: Sie würde sie nicht mehr loswerden, vorerst nicht. Selbst jetzt, während die Stimmen um sie herum lauter und lebhafter wurden, spürte sie eine weitere Welle von Panik in sich aufsteigen. Sie schloß die Augen, plötzlich schwach vor Ekel.
Hätte er sie angegriffen, fragte sie sich, wenn die High Street nicht so belebt gewesen wäre? Sie in einen Hauseingang gezogen? Ihr an der Kleidung gezerrt?
Sie hob ihren Kaffeebecher, hielt ihn wenige Zentimeter von ihrem Mund entfernt, blickte hinein. Sie starrte auf die ölige Oberfläche, die merklich flimmerte. Sie umfaßte den Becher fester. Die Flüssigkeit beruhigte sich. Ihre Hände zitterten nicht mehr. Der Augenblick verging.
Eine andere Möglichkeit: War alles nur ein Traum gewesen?
»Pinter!« war das erste Wort der Diskussion, das ihre Aufmerksamkeit erregte. Sie zwang sich, die Sprecherin anzuschauen und sich zu konzentrieren.
Der Name war in einem müden, ungläubigen Tonfall ausgesprochen worden, von einer Frau, die in der einen Hand ein Glas Apfelsaft und in der anderen eine halbaufgerauchte Zigarette hielt. Sie hatte kurzes, tiefschwarzes Haar, ein markantes Kinn und lebendige dunkle Augen. Sarah erinnerte sich vage, sie schon öfter im Café Valladon gesehen zu haben, aber sie kannte ihren Namen nicht. Später sollte sie erfahren, daß sie Veronica hieß.
»Das ist mal wieder typisch«, fügte die Frau hinzu. Dann schloß sie die Augen, als sie an ihrer Zigarette zog. Sie lächelte, nahm das Streitgespräch vielleicht weniger ernst als der hagere, bleiche, ernst dreinblickende Student ihr gegenüber.
»Alle Leute die nicht das geringste vom Theater verstehen«, fuhr Veronica fort, »tun so, als ob Pinter einer der ganz Großen wäre.«
»Okay«, sagte der Student. »Ich gebe zu, daß er überschätzt wird. Der Meinung bin ich auch. Genau das bestätigt meinen Standpunkt.«
»Es bestätigt deinen Standpunkt?«
»Die britische Theatertradition nach dem Kriege«, sagte der Student, »ist derart etioliert, daß –«
»Wie bitte?« sagte eine australische Stimme neben ihm. »Sie ist was?«
»Etioliert«, sagte der Student. »Derart etioliert, daß es nur einen Dramatiker gibt, der –«
»Etioliert?« sagte der Australier.
»Vergiß es«, sagte Veronica, und ihr Lächeln wurde breiter. »Er will nur Eindruck schinden.«
»Was heißt denn das?«
»Guck doch im Wörterbuch nach«, entgegnete der Student barsch. »Jedenfalls gibt es meiner Ansicht nach im britischen Nachkriegstheater nur einen Dramatiker, der überhaupt Anspruch auf Größe erheben kann, und selbst der wird überschätzt. Gewaltig überschätzt. Ergo, das Theater ist am Ende.«
»Ergo?« sagte der Australier.
»Es ist passé. Es hat nichts zu bieten. Es spielt in der gegenwärtigen Kultur keine Rolle, weder in diesem Land noch sonstwo.«
»Na und – willst du damit sagen, daß ich meine Zeit verschwende?« fragte Veronica. »Daß ich im Widerspruch stehe zu dem ganzen... beherrschenden Diskurs?«
»Absolut. Du solltest sofort den Studiengang wechseln und Film studieren.«
»Wie du.«
»Wie ich.«
»Tja, das ist interessant«, sagte Veronica. »Ich meine, überleg doch nur mal, von was für Voraussetzungen du ausgehst. Erstens gehst du davon aus, daß ich, nur weil ich mich fürs Theater interessiere, Theaterwissenschaft studiere. Falsch: Ich studiere Volkswirtschaft. Und dann deine Überzeugung, daß du im Besitz irgendeiner absoluten Wahrheit bist: Ich... na ja, ich finde, das ist eine sehr männliche Eigenschaft, mehr kann ich dazu nicht sagen.«
»Ich bin nun mal ein Mann«, entgegnete der Student.
»Es ist ebenfalls bezeichnend, daß Pinter dein Lieblingsdramatiker ist.«
»Wieso ist das bezeichnend?«
»Weil er Theaterstücke für kleine Jungs schreibt. Clevere kleine Jungs.«
»Aber Kunst ist universell: Alle wahren Schriftsteller sind Hermaphroditen.«
»Ha!« Veronica lachte mit amüsierter Verachtung. Sie drückte ihre Zigarette aus. »Okay, willst du über Geschlechtsfragen reden?«
»Ich dachte, wir reden über Kultur.«
»Das eine ist von dem anderen nicht zu trennen. Alles ist geschlechtsspezifisch.«
Jetzt lachte der Student. »Das ist eine der banalsten Äußerungen, die ich je gehört habe. Du willst doch nur deshalb über Geschlechtsfragen reden, weil du Angst hast, über Werte zu reden.«
»Pinter gefällt nur Männern«, sagte Veronica. »Und warum gefällt er Männern? Weil seine Stücke den frauenfeindlichen Teil der männlichen Psyche ansprechen.«
»Ich bin kein Frauenfeind.«
»Oh doch, das bist du. Alle Männer hassen Frauen.«
»Das glaubst du doch selbst nicht.«
»Und ob ich das glaube.«
»Dann hältst du wohl auch alle Männer für potentielle Vergewaltiger?«
»Ja.«
»Das ist noch so eine nichtssagende Äußerung.«
»Sie sagt allerhand, und zwar klar und deutlich. Alle Männer haben die Anlage zum Vergewaltiger.«
»Alle Männer haben die Mittel zum Vergewaltiger. Das ist wohl kaum das gleiche.«
»Ich rede nicht davon, daß alle Männer die dazu erforderliche... Ausstattung haben. Ich will sagen, daß es keinen Mann auf der Welt gibt, der nicht in irgendeinem dunklen Winkel seiner Seele tiefen Groll – und Eifersucht – auf unsere Stärken verspürt, und daß dieser Groll manchmal in Haß übergeht, der sich durchaus in Gewalt entladen kann.«
Nach dieser Rede entstand eine kurze Pause. Der Student wollte etwas sagen, stockte jedoch. Dann setzte er erneut an, überlegte es sich aber anders. Schließlich brachte er nur heraus: »Ja, aber dafür hast du keine Beweise.«
»Die Beweise sind überall um uns herum.«
»Ja, aber du hast keinen objektiven Beweis.«
»Objektivität«, sagte Veronica, die sich eine neue Zigarette anzündete, »ist männliche Subjektivität.«
Das Schweigen, das diese lapidare Bemerkung auslöste, war länger als das erste und irgendwie ehrfürchtig. Es wurde schließlich von Sarah selbst gebrochen.
»Ich finde, sie hat recht«, sagte sie.
Alle am Tisch wandten sich ihr zu.
»Ich meine nicht das mit der Objektivität – zumindest habe ich noch nie so darüber nachgedacht –, aber daß alle Männer im Grunde feindselig sind und daß man nie wissen kann, wann die Feindseligkeit... ausbricht.«
Veronica blickte ihr in die Augen. »Danke«, sagte sie, bevor sie sich wieder dem Studenten zuwandte. »Siehst du? Unterstützung von allen Seiten.«
Er zuckte die Achseln. »Frauensolidarität, mehr nicht.«
»Nein, mir ist das nämlich gerade passiert, wißt ihr?« Die unsichere Dringlichkeit in Sarahs Stimme ließ die anderen aufhorchen. »Genau das, worüber ihr redet.« Sie senkte den Blick und sah, wie sich ihre Augen dunkel in der schwarzen Oberfläche des Kaffees spiegelten. »Tut mir leid, ich weiß ja nicht mal, wie ihr heißt. Und ich weiß auch nicht, warum ich das gesagt habe. Ich glaube, ich muß los.«
Sie stand auf und merkte erst jetzt, daß sie in einer Ecke eingekeilt war, die Tischkante gegen die Oberschenkel gedrückt. Sich eilig an dem Australier und dem ernsten Studenten vorbeizuquetschen war ein mühseliges Unterfangen. Ihr Gesicht war hochrot. Sie war sicher, daß alle sie beobachteten, als wäre sie eine Verrückte. Niemand sagte etwas, als sie zur Kasse ging, doch als sie bezahlte (Slattery, der Cafébesitzer, saß mit seinem Intellektuellenblick gleichgültig in der Ecke), spürte sie eine Hand auf der Schulter, drehte sich um und sah, wie Veronica sie anlächelte. Das Lächeln war zaghaft, sympathisch – ganz anders als das herausfordernde Lächeln, das sie ihren Gegnern am Tisch gezeigt hatte.
»Hör mal«, sagte sie, »ich kenne dich nicht und weiß auch nicht, was dir passiert ist, aber... wenn du drüber reden willst, jederzeit.«
»Danke«, sagte Sarah.
»In welchem Studienjahr bist du?«
»Im vierten.«
»Oh – dann hast du dein erstes Examen schon hinter dir, nicht?«
Sarah nickte.
»Und wohnst du auf dem Campus?«
»Nein. Oben in Ashdown.«
»Ach. Naja, vielleicht laufen wir uns ja doch irgendwann noch mal über den Weg.«
»Bestimmt.«
Sarah hastete nach draußen, bevor diese freundliche, einschüchternde Frau noch mehr sagen konnte. Nach dem dunklen, verrauchten Café war das Sonnenlicht plötzlich blendend grell, die Luft frisch und salzig. Sie sah vereinzelt Leute auf der Straße, die ihre Einkäufe machten. Unter normalen Umständen wäre es ein idealer Tag gewesen, um an den Klippen entlang nach Hause zu gehen: ein langer Spaziergang, und überwiegend bergauf, aber die Mühe lohnte sich, denn wenn man ankam, schmerzten einem angenehm die Glieder, und die Lunge war mit der reinen, dünnen Luft gefüllt. Aber heute war kein normaler Tag, und ihr war unbehaglich zumute bei dem Gedanken an die vielen einsamen Wegabschnitte, auf denen sie damit rechnen mußte, daß ihr irgendein Mann entgegenkam oder auf einer der Bänke saß und sie unverfroren beobachtete, während sie vorbeihastete.
Für das Geld, mit dem sie eine Woche lang das Abendessen hätte bezahlen können, nahm sie sich ein Taxi, war im Nu zu Hause und lag dann den ganzen Nachmittag im Bett, ohne daß sich die Erstarrung löste.
ANALYTIKER: Was an dem Spielfanden Sie so beunruhigend?
PATIENTIN: Ich weiß nicht, ob »Spiel« das richtige Wort ist.
ANALYTIKER: Das Wort haben Sie vorhin selbst benutzt.
PATIENTIN: Ja. Ich weiß nur nicht, ob es der richtige Ausdruck ist. Ich glaube, ich habe gemeint...
ANALYTIKER: Das ist im Augenblick nicht so wichtig. Hat er Ihnen je körperliche Schmerzen zugefügt?
PATIENTIN: Nein. Nein, er hat mir nie wirklich weh getan.
ANALYTIKER: Aber Sie haben gedacht, er könnte Ihnen weh tun.
PATIENTIN: Das mag sein – irgendwo im tiefsten Innern.
ANALYTIKER: Und hat er das gewußt? Hat er gewußt, daß Sie gedacht haben, er könnte Ihnen weh tun, eines Tages? Ging es bei dem Spiel im Grunde darum?
PATIENTIN: Ja, durchaus möglich.
ANALYTIKER: Für ihn? Oder für Sie beide?
Sarah war schon wieder im Bett, als Gregory aus der Kneipe zurückkam. Am frühen Abend war sie kurz aufgestanden, hatte sich ihren Bademantel angezogen und war nach unten in die Küche getappt. Aber selbst dort war sie noch immer nervös und seltsam schreckhaft. Die Küche selbst war leer, und aus dem Zimmer am Ende des Korridors konnte sie die Geräusche einer amerikanischen Fernsehserie hören – Dallas oder Unter der Sonne Kaliforniens. In der Annahme, daß sie allein war, öffnete sie eine Dose Pilzsuppe und goß den Inhalt in einen Topf. Dann machte sie den Gasherd an, der, uneinsehbar vom Rest des L-förmigen Raumes, hinten in der Ecke stand. Sie rührte die Suppe mit einem schweren Holzlöffel um, was sie erstaunlich beruhigend fand. Sie rührte dreimal im Uhrzeigersinn, dann dreimal in die andere Richtung, immer und immer wieder, beobachtete, wie sich Muster bildeten und allmählich wieder in der dickflüssigen Masse verschwanden. Sie war so vertieft in ihre Aufgabe, daß sie zusammenfuhr, als eine Männerstimme fragte: »Wo habt ihr denn hier Kaffee?« Sie stieß einen kurzen, hohen Schrei aus und wirbelte herum.
Der Mann kam um die Ecke, sah sie und machte einen Schritt nach hinten.
»Entschuldigung, ich hab gedacht, du wüßtest, daß ich hier bin.«
Sie sagte: »Nein, wußte ich nicht.«
»Ich wollte dich nicht erschrecken.«
Er hatte ein freundliches Gesicht: Das war das erste, was ihr auffiel. Und als zweites fiel ihr auf, daß er aussah, als hätte er geweint – und zwar gerade erst. Er setzte sich an den Küchentisch, um seinen Kaffee zu trinken, und sie setzte sich ihm gegenüber, um ihre Suppe zu essen. Sie schielte kurz zu ihm hinüber und hätte schwören können, daß ihm eine Träne die Wange hinablief.
»Alles in Ordnung?« fragte sie. Es gab nicht viele Studienanfänger in Ashdown, aber sie fragte sich, ob er vielleicht gerade erst an die Uni gekommen war und schon Heimweh hatte.
Wie sich herausstellte, war das nicht der Fall. Er studierte Sprachen im dritten Jahr und war erst tags zuvor in Ashdown eingezogen. Der Grund für seine Traurigkeit war ein Telefongespräch mit seiner Mutter, die ihn ein paar Stunden zuvor von zu Hause angerufen hatte, um ihm mitzuteilen, daß Muriel, die Hauskatze, am Morgen überfahren worden war – von einem Milchwagen unten an der Auffahrt zum Haus. Es war ihm sichtlich peinlich, daß ihn das so mitnahm, aber Sarah mochte ihn dafür. Doch um ihn nicht noch mehr in Verlegenheit zu bringen, wechselte sie möglichst rasch das Thema und erzählte ihm, daß er nicht der einzige war, der einen schlechten Tag hinter sich hatte.
»Wieso, was ist dir denn passiert?« fragte er.
Erst später wunderte sich Sarah darüber, daß sie, was sonst nicht ihre Art war, ganz offen mit jemandem gesprochen hatte, den sie kaum kannte, den sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal nach seinem Namen gefragt hatte. Dennoch schilderte sie ihm ihre seltsame Begegnung mit dem wildfremden Mann, der sie ohne erkennbaren Grund wütend angefunkelt und Miststück genannt hatte. Der Neuling hörte aufmerksam zu, während er an seinem Kaffee nippte. Erstaunlich, dachte Sarah, genau die richtige Mischung von besorgter Anteilnahme (denn er schien zu verstehen, wie beängstigend der Vorfall für sie gewesen sein mußte) und beruhigender Heiterkeit (denn er ermutigte sie gleichzeitig, die Sache als Gefühlsausbruch irgendeines armseligen Exzentrikers abzutun). Sie erzählte ihm von dem Gespräch, das sie im Café Valladon mitgehört hatte, daß es plötzlich um das Thema Frauenfeindlichkeit gegangen sei und daß sie nicht anders gekonnt habe, als sich einzuschalten.
»Das Thema ist zur Zeit angesagt«, pflichtete er bei. »Hier an der Uni gibt es eine heftige antifeministische Reaktion.« Er erzählte ihr, daß der neue Fachbereich für Frauenstudien vor kurzem von einem Sprüher verschandelt worden sei: Irgendwer war in die Räumlichkeiten eingebrochen und hatte in großen Buchstaben die Worte »Tod den Schwestern« an die Wände gesprüht.
Obwohl es Sarah sehr guttat, sich mit ihm zu unterhalten, wurde sie allmählich müde. Manchmal überkam sie eine Art Müdigkeit, die, gemessen an anderen Leuten, wohl extrem war, und ein – oder zweimal war sie sogar während einer Unterhaltung eingeschlafen. Sie wollte vermeiden, daß ihr das jetzt wieder passierte. Sie wollte auf jeden Fall einen guten Eindruck hinterlassen.
»Ich glaube, ich muß ins Bett«, sagte sie, stand auf und spülte ihre Suppentasse unter kaltem Wasser ab. »Aber es war nett, dich kennenzulernen. Schön, daß du jetzt auch hier wohnst. Ich könnte mir vorstellen, daß wir Freunde werden.«
»Ich hoffe es.«
»Übrigens, ich heiße Sarah.«
»Ich bin Robert.«
Sie lächelten einander an. Sarah fuhr sich mit der Hand durchs Haar, hielt eine Strähne fest und zog leicht daran. Robert fiel die Geste auf, und er merkte sie sich.
Sarah ging nach oben in ihr Zimmer und schlief ein oder zwei Stunden, bis Gregory sie aufweckte, als er hereinkam und das Deckenlicht einschaltete. Blinzelnd schaute Sarah auf den Wecker. Es war früher, als sie gedacht hatte: erst Viertel nach zehn.
»Schon zurück?« sagte sie.
Er hatte ihr den Rücken zugewandt, während er irgend etwas in eine Schublade legte, und brummte: »Wie du siehst.«
»Ich dachte, du würdest später kommen, schließlich ist es der letzte Abend, wo ihr noch mal alle zusammen seid. Ich hab gedacht, ihr würdet groß feiern.«
Das Herbsttrimester hatte gerade begonnen, und Gregory war nur aus seinem Heimatort Dundee hergekommen, um einige Sachen zu holen, ein paar alte Freunde zu sehen und die letzten Tage mit Sarah zu verbringen. Sie hatten im Juli beide ihren Bachelor-Abschluß gemacht. Ende der Woche würde er in London sein Medizinpraktikum beginnen und sich auf Psychiatrie spezialisieren. Sarah blieb noch ein weiteres Jahr an der Uni, um ihr Examen als Grundschulpädagogin zu machen.
»Hab morgen einen anstrengenden Tag«, sagte er, während er am Fußende des Bettes saß und sich einen Schuh auszog. »Muß früh raus.« Zum erstenmal huschten seine Augen zu ihr. »Du siehst ziemlich erledigt aus.«
Sarah erzählte ihm von dem Mann, der sie auf der Straße beschimpft hatte, worauf er zunächst erwiderte: »Aber das macht keinen Sinn. Wieso sollte jemand so was tun?«
»Ich vermute, weil ich eine Frau bin«, sagte Sarah. »Das hat gereicht.«
»Bist du sicher, daß er dich gemeint hat?«
»Es war sonst niemand da.« Gregory mühte sich mit einem verknoteten Schnürsenkel ab, daher betonte sie: »Ich war ziemlich aus der Fassung.«
»Laß dich doch von so was nicht fertigmachen.« Als er den Schnürsenkel gelöst hatte, tastete er nach ihrem Fußknöchel und drückte ihn unter der Bettdecke. »Ich dachte, das hätten wir hinter uns. Du bist doch jetzt ein großes Mädchen.« Er blickte sie stirnrunzelnd an. »Ist das wirklich passiert?«
»Ich denke, ja.«
»Hmm... aber du bist dir nicht sicher. Vielleicht sollte ich es doch aufschreiben.«
Gregory setzte sich an den Frisiertisch und holte aus der obersten Schublade ein Heft. Er kritzelte ein paar Worte hinein, lehnte sich dann zurück und blätterte die Seiten durch. Sein Gesicht im Spiegel zeigte ein zufriedenes Lächeln.
»Weißt du, ich kann wirklich von Glück sagen, daß wir uns begegnet sind«, sagte er. »Wieviel Material ich durch dich schon zusammenhabe. Ich meine, ich weiß, das ist nicht der einzige Grund, aber... überleg doch nur, was ich dadurch für einen Vorsprung vor den anderen habe.«
»Fängst du nicht ein bißchen früh an, so zu denken?« sagte Sarah.
»Unsinn. Wer wirklich der erste sein will, kann nicht früh genug starten.«
»Das ist aber doch kein Wettkampf, oder?«
»Es gibt Gewinner und Verlierer im großen Wettkampf des Lebens, wie bei jedem anderen auch«, sagte Gregory. Er hatte das Heft weggelegt und zog jetzt sein Hemd aus. »Wie oft habe ich dir das schon gesagt?«
Zu ihrer eigenen Verwunderung nahm Sarah die Frage ernst. »Ich schätze, an die fünfzehn – bis zwanzigmal.«
»Da hast du’s«, sagte Gregory, offensichtlich sehr zufrieden mit seiner Statistik. »Und das gilt auch für alles andere – selbst für die Wohnungssuche. Ich meine, man glaubt es kaum, aber Frank geht in einer Woche nach London, und er hat noch nicht mal eine Wohnung.« Er lachte ungläubig. »Wie erklärst du dir so was?«
»Na ja«, sagte Sarah, »vielleicht hat er einfach nicht das Glück, daß sein Vater in der Lage ist, ihm eine Wohnung in Victoria zu kaufen.«
»Pimlico. Nicht Victoria.«
»Was ist der Unterschied?«
»Etwa zwanzigtausend Pfund zum Beispiel. Wir haben die Lage sehr sorgfältig ausgesucht. Die Klinik ist gut zu erreichen. Ausgezeichnete Gegend.« Anscheinend spürte er Sarahs unausgesprochene Verachtung, denn er fügte hinzu: »Herrje noch mal, ich hätte gedacht, du würdest dich darüber freuen. Schließlich wirst du jedes Wochenende dort verbringen, oder nicht?«
»Wirklich?«
»Das nehme ich doch an.«
»Du weißt, daß ich Unterrichtsstunden vorbereiten muß und so. Ich muß in diesem Jahr jede Menge Unterricht geben. Ich habe bestimmt viel zu tun.«
»Ich kann mir nicht vorstellen, daß es so zeitaufwendig ist, ein bißchen Unterricht vorzubereiten.«
»Manche Leute müssen nicht hart arbeiten. Ich schon. Ich bin ein Arbeitstier.«
Gregory setzte sich neben sie auf das Bett. »Weißt du, du hast ein echtes Problem mit deinem Selbstwertgefühl«, sagte er. »Ist dir eigentlich nie der Gedanke gekommen, daß du vielleicht deshalb keinen Erfolg hast?«
Sarah brauchte einen Moment, um das zu verdauen, aber sie spürte keine Wut in sich aufsteigen. Statt dessen mußte sie wieder an die Situation in der Küche denken. »Ich habe heute einen von den Neuen kennengelernt«, sagte sie. »Er heißt Robert. Er scheint ganz nett zu sein. Hast du ihn schon kennengelernt?«
»Nein.« Gregory hatte sich inzwischen bis auf die Unterhose ausgezogen, fuhr geistesabwesend mit der Hand vorn über Sarahs Nachthemd und ließ sie auf ihrer Brust liegen.
»Du hast nicht mit ihm gesprochen oder so?«
Er seufzte. »Sarah, morgen reise ich ab. Ich werde in London leben. Wieso sollte ich meine Zeit damit verschwenden, Leute kennenzulernen, die ich nie wiedersehen werde?«
Er zog die Unterhose aus, legte sich auf Sarah und zog ihr Nachthemd so weit herunter, daß ihre Brüste entblößt waren. Dann zwickte er beide Brustwarzen gleichzeitig. Sarah studierte seine Miene, während er das tat, und überlegte, wann sie einen ähnlichen Ausdruck schon mal bei ihm gesehen hatte: Seine gerunzelte Stirn zeugte sowohl von Ungeduld als auch von Konzentration, fast so wie neulich abend, als sie beobachtet hatte, wie er bei dem Fernseher unten im Haus an den Kontrast – und Bildlaufreglern herumgedreht hatte, um ein gutes Bild für die Zehn-Uhr-Nachrichten zu bekommen. Das, so erinnerte sie sich, hatte etwa zwei Minuten gedauert, aber nicht einmal die Hälfte der Zeit war um, als er ihre schmalen Handgelenke nahm, ihr die Arme über dem Kopf auf das Kopfkissen drückte und rasch in sie eindrang. Sie war trocken und eng und fand das Gefühl unangenehm.
»Gregory«, sagte sie, »ich bin wirklich nicht in Stimmung. Ich bin sogar absolut nicht in Stimmung.«
»Keine Sorge, es dauert nicht lange.«
»Nein.« Sie packte seine Hüften und stoppte ihre Auf und-Ab-Bewegungen. »Ich will nicht.«
»Aber wir hatten doch schon das Vorspiel und alles.« Er blickte verletzt, ungläubig.
»Raus«, sagte Sarah.
»Wo raus – aus dir, dem Bett oder dem Zimmer?« Seine Verwirrung schien echt.
»Erst einmal aus mir.«
Er starrte sie ein, zwei Sekunden lang an, schnalzte dann entnervt mit der Zunge und zog sich rüde mit den Worten zurück: »Du kannst manchmal richtig rücksichtslos sein.« Aber er blieb auf ihr liegen, und sie wußte, was jetzt kommen würde. »Mach mal die Augen zu.«
Sie starrte ihn an, trotzig, aber machtlos.
»Ich sehe was, was du nicht siehst.«
»Gregory, nein. Jetzt nicht.«
»Los. Ich weiß doch, daß es dir gefällt.«
»Es gefällt mir überhaupt nicht. Es hat mir nie gefallen. Wie oft muß ich dir noch sagen, daß es mir nie gefallen hat?«
»Es ist bloß ein Spiel, Sarah. Es geht um Vertrauen. Du vertraust mir doch, oder?«
»Hör auf«, sagte sie. Noch immer hielt er ihre beiden Hände mit einer Hand umschlossen und auf das Kopfkissen gedrückt. Seine andere Hand näherte sich jetzt ihrem Gesicht, Zeige – und Mittelfinger ausgestreckt.
»Komm schon«, sagte er. »Zeig mir, daß du mir vertraust. Schließ die Augen.«
Die beiden Fingerspitzen waren jetzt so nahe, daß ihr gar nichts anderes übrigblieb: Sie schloß die Augen reflexartig und kniff sie ganz fest zu. Sogleich spürte sie den Druck seiner beiden Finger – zunächst sanft – auf ihren geschützten Augäpfeln, und dann versteifte sie sich, als sich vertrautes Entsetzen in ihr rührte. Sie hatte eine Methode entwickelt, mit diesem Gefühl fertigzuwerden, indem sie sämtliche Gedanken aus ihrem Kopf verbannte, die mit dem gegenwärtigen Augenblick zu tun hatten. Die Zeit blieb für Sarah stehen, als Gregory sich über sie beugte, und wenn sie überhaupt an etwas dachte, dann an die, wie es ihr (im Moment) erschien, ferne Vergangenheit: an den Anfang ihrer Beziehung, als sie noch gern mit ihm zusammen war, bevor sie sich in diesen unaufhörlichen Kreislauf von Streitigkeiten und eigentümlichen Schlafzimmerritualen verstrickt hatten.
Wie hatte es mit ihnen nur so weit kommen können?
Sie erinnerte sich noch lebhaft daran, wie sie sich kennengelernt hatten, während der Pause eines Konzerts in der Bar des Arts Centre. Sie hatte eigentlich gar nicht vorgehabt, in das Konzert zu gehen, aber es waren extrem wenige Eintrittskarten verkauft worden, und das Personal an der Kasse hatte sich gezwungen gesehen, kurz vor Konzertbeginn Freikarten an Passanten zu verteilen, damit dem Gastkünstler die Peinlichkeit erspart blieb, vor einem fast leeren Haus zu spielen. Auf dem Programm stand Die Kunst der Fuge von Johann Sebastian Bach, ein Werk, das Sarah bis dahin nicht gekannt hatte und das ausschließlich auf dem Cembalo gespielt wurde. In Sarahs Reihe war nur noch ein weiterer Platz besetzt: ein großer, schlaksiger Student, der kerzengerade dasaß. Er trug das dunkle Haar in einem seriösen Kurzhaarschnitt, hatte ein Tweedjackett an, eine alte Schulkrawatte und eine Weste mit Taschenuhr und lauschte der Musik mit starrer Konzentration. Hin und wieder seufzte er laut auf oder schnalzte aus keinem erkennbaren Grund ärgerlich mit der Zunge. Da er anscheinend keinerlei Notiz von Sarah nahm, war sie sehr überrascht, als er sich in der Pause zu ihr an den Tisch setzte, und noch überraschter, als er sie nach zwei oder drei Minuten unbehaglichen Schweigens mit seinem knappen schottischen Akzent ansprach: »Groteske Tempi im elften Kontrapunkt, finden Sie nicht auch?«
Es waren die seltsamsten, unverständlichsten Worte, die jemals an sie gerichtet worden waren, aber sie führten immerhin zu einer Art Unterhaltung, und die wiederum führte zu einer Art Beziehung. In den ganzen anderthalb Jahren an der Universität hatte Sarah keinen Freund gehabt, und ihr soziales Leben, wenn man es überhaupt so nennen konnte, bestand im Grunde darin, gelegentlich mit einer größeren Gruppe Kommilitonen, die sie nie (wie sie meinte) voll in ihrer Mitte aufgenommen hatten, abends durch die Kneipen zu ziehen. Daß Gregory sie zum Essen einlud, mit ihr ins Kino oder ins Theater ging, war zunächst eine neue und beglückende Erfahrung. Meistens gingen sie ins Konzert, und auch als ihr auffiel, daß Gregory eher trockene, akademische und emotionslose Musik bevorzugte, so ließ sie sich doch nicht davon irritieren. Jedenfalls so lange nicht, bis sie feststellte, daß er bei der Liebe genau die gleichen Eigenschaften an den Tag legte.
Als Sarah etwa sechs Wochen mit Gregory zusammen war und das erstemal mit ihm schlief, war sie noch Jungfrau. Es war ein schwieriges und schmerzhaftes Erlebnis, wie sie es auch erwartet hatte: Nicht erwartet hatte sie allerdings, daß die Male darauf ebenso wenig lustvoll waren. Gregory offenbarte im Bett die gleiche kühle, intelligente Effizienz, die er an den strengen Bachschen Fugen so bewunderte. Zärtlichkeit, Flexibilität, Ausdruckskraft und Tempovariationen gehörten nicht zu seinem Repertoire. Das Beste, das Sarah erwarten konnte – das Beste, auf das sie sich nach mehreren Monaten Beischlaf mit ihm freuen konnte –, war der Augenblick postkoitaler Ermattung, wenn Gregory, nach vollbrachter Tat und seiner Energien beraubt, manchmal einen schmeichelnden, vertraulichen Ton anschlug, den sie untypisch und ergötzlich fand. Bei einem dieser Male hatte er ihr eine unerwartete Frage gestellt.
Sie lagen zusammen im Bett, mitten in einer ruhigen, stickigen Nacht, eng umschlungen, ihr Kopf an seiner Schulter. Und Gregory hatte sie gefragt, wie aus heiterem Himmel, welchen Teil seines Körpers sie für den schönsten halte. Sarah hatte überrascht zu ihm hochgeblickt und erwidert, daß sie nicht sicher sei, daß sie darüber nachdenken müsse, und dann hatte er, zu ihrer großen Erleichterung (denn sie fand, um ehrlich zu sein, keinen Teil seines Körpers besonders schön) gesagt: »Willst du wissen, welcher Teil deines Körpers am schönsten ist?« Und sie hatte gesagt: »Ja, sag’s mir«, aber er hatte sie eine Weile raten lassen, und sie waren kichernd die naheliegendsten Möglichkeiten durchgegangen, aber alle waren falsch, und schließlich hatte sie aufgegeben, und dann hatte Gregory sie angelächelt und leise gesagt: »Deine Augenlider.« Zuerst wollte sie ihm nicht glauben, aber er hatte gesagt: »Das kommt daher, weil du deine Augenlider nie siehst und nie sehen wirst, es sei denn, ich mache ein Foto davon« (aber er hatte nie ein Foto gemacht), woraufhin sie fragte: »Na, und wann hast du meine Augenlider so gut kennengelernt?«, und er antwortete: »Während du geschlafen hast. Ich sehe dir gern beim Schlafen zu.« Und das war die erste Andeutung, der erste Hinweis darauf, daß er gern am Bett anderer Leute stand und sie im Schlaf beobachtete, etwas, das sie zunächst interessant gefunden hatte, als Ausdruck eines neugierigen Verstandes, bis es ihr schließlich irgendwie bedrohlich erschien, fast fetischistisch, dieses Verlangen, Menschen zu beobachten, die hilflos, ohne Bewußtsein dalagen, während er, der Beobachter, seinen wachen Geist vollständig unter Kontrolle hatte.
Danach fiel es ihr schwerer einzuschlafen, wußte sie doch, daß er jederzeit in der Nacht aufstehen und ihr schlafendes Gesicht im Mondschein betrachten konnte. (Und das war, bevor sie sein Interesse noch mehr geweckt hatte, indem sie ihm von ihren Träumen erzählte, ihren Träumen, die so real waren, daß sie sie manchmal nicht von den Ereignissen ihres wachen Lebens unterscheiden konnte.) Aber sie gewöhnte sich an den Gedanken, wie man sich, so vermutete sie, an die meisten Gedanken gewöhnt, und das Wissen darum, daß Gregory sie vielleicht beobachtete, bescherte ihr in den Monaten darauf (oder waren es Wochen?) keine ernsten Schlafstörungen – bis sie eines Tages im Dezember frühmorgens schreiend aufwachte, aus einem ihrer häufigen Alpträume, in denen Frösche vorkamen. Diesmal ging es um einen riesigen Frosch, der an der Ringstraße auf dem Campus hockte. Als sie an ihm vorbeieilen wollte, hatte er sie entsetzlich angequakt und sich dann mit den beiden Spitzen seiner gegabelten Zunge an ihre Augenlider geheftet. Sarah hatte sich abgemüht, aus dem Alptraum zu erwachen, doch dann in noch größerer Panik losgeschrien, als ihr klarwurde, daß der Traum zwar vorüber war, der Druck auf ihren Augenlidern aber nicht nachließ: Irgendwer oder irgend etwas haftete tatsächlich an ihnen. Sie versuchte die Augen zu öffnen, doch es gelang ihr nicht. Als das Hindernis plötzlich entfernt wurde und sie die Augen öffnete, sah sie Gregory dicht neben ihr sitzen, das aufmerksame Gesicht ihr zugeneigt, die eine Hand – Zeige – und Mittelfinger ausgestreckt – nur wenige Zentimeter vor ihren Augen.
»Was zum Teufel hast du da gemacht?« fragte sie etwa zehn Minuten später, als sie hellwach war, ihr Atem und Herzschlag sich wieder beruhigt hatten und sie endlich sicher war, daß sich keine Riesenfrösche im Zimmer versteckten. »Was hast du da vorhin gemacht?«
»Nichts«, sagte Gregory. »Ich habe dich bloß beobachtet.«
»Du hast mich angefaßt«, sagte Sarah.
»Ich wollte dich nicht aufwecken.«
»Na, dann hättest du mir deine dämlichen Finger nicht auf die Augen legen sollen.«
Nach einer Pause murmelte Gregory: »Tut mir leid«, ganz leise – zart – und drückte ihre Hand. Dann beugte er sich vor und küßte sie. »Ich wollte dich nicht wecken«, wiederholte er. »Ich mußte sie einfach berühren. Es ist unglaublich...« Im Halbdunkel des Schlafzimmers konnte sie sein Lächeln ahnen. »Da ist so viel Leben hinter deinen Augen, wenn du schläfst: Ich konnte es sehen. Und ich wollte es berühren. Ich konnte es spüren, in meinen Fingerspitzen.« Er fügte hinzu: »Es war nicht das erste Mal, weißt du.«
»Ja, aber... es hat mir angst gemacht. Es war so real.« Leicht vorwurfsvoll fügte sie hinzu: »Du hast ganz schön fest gedrückt.«
Er lächelte wieder. »Ja, aber du vertraust mir doch, oder? Daß ich dir nicht weh tue.«
Sie spürte, wie ihre Hand gedrückt, ihr Handgelenk gestreichelt wurde. »Wahrscheinlich.«
»Wahrscheinlich?«
Die Last seines verletzten Schweigens war unerträglich. »Ja, natürlich vertraue ich dir. Aber darum geht es nicht.«
»Darum geht es sehr wohl. Was glaubst du denn, was ich mit dir anstellen wollte?«
Während er das sagte, hielt er seine Hand wieder ganz dicht vor ihr Gesicht. Ihre Augenlider schlossen sich wie von selbst. Und er drückte mit den Fingerspitzen dagegen.
»Ich sehe was, was du nicht siehst«, flüsterte er. »Du hast doch keine Angst, oder?«
»Nein«, sagte Sarah skeptisch.
Dann drückte er fester.
»Und jetzt?«
Und so hatte es angefangen, dieses »Spiel«, wie sie es schließlich nannten, das mehr und mehr zum Tragen kam, wenn sie miteinander schliefen; schließlich spielten sie es (das heißt, Gregory, denn Sarah war immer nur passiv beteiligt) nicht nur nach, sondern sogar während des Beischlafs, so daß Gregory nicht selten zum Höhepunkt kam, während er auf ihr lag, seine Hand über ihrem Gesicht schwebend, Zeige – und Mittelfinger immer fester, immer drängender gegen ihre geschlossenen Augenlider gedrückt.
An all das erinnerte Sarah sich jetzt in den wenigen Augenblicken, die sie heute abend unter Gregory lag, während er ein weiteres Mal diese Position einnahm. Zum letzten Mal, wie sich erweisen sollte: Denn in einer plötzlichen übermächtigen Regung von Widerstand schrie sie ein dünnes, letztes »Nein!« und stieß Gregory mit einer Kraft, die sie beide überraschte, von sich runter, so daß er vom Bett fiel und nackt über den Boden rollte.
»Himmel Herrgott, Frau!«
Sarah stieg aus dem Bett und zog sich ihr Nachthemd über.
»Was soll der Scheiß?«
Jetzt nahm sie ihren Bademantel vom Haken an der Tür und schlüpfte hinein, hektisch nach den Ärmeln suchend. Gregory kniete neben dem Bett, atemlos, hielt sich die Stirn und rang nach Luft.
»Bekomme ich nun eine Antwort, oder nicht?«
Sarah öffnete wortlos die Tür und lief über den Korridor ins Badezimmer. Sie schloß die Tür ab, setzte sich auf den Klodeckel und weinte und wiegte sich ein Weilchen vor und zurück. Allmählich ließ das Weinen nach. Sie wusch sich das Gesicht mit kaltem Wasser und betrachtete sich im Spiegel. Ihre Augen waren rotgerändert, und ihr Mund hatte einen ungewohnten, entschlossenen Zug. Sie fing an, die passenden Sätze einzuüben.
Gregory, es tut mir leid, aber mir reicht’s.
Ich glaube, es ist besser, wenn wir uns nicht mehr sehen.
Es funktioniert einfach nicht mit uns.
Ich denke, wir sollten versuchen, von nun an einfach Freunde zu sein.
Seltsam, jetzt, da sie sich die Worte zurechtgelegt hatte, freute sie sich geradezu darauf, sie auszusprechen; besser gesagt, sie spürte bereits, wie in ihr schwach und zaghaft die Genugtuung darüber aufkeimte, wenigstens eine von Gregorys festverwurzelten Überzeugungen erschüttert zu haben. In fünf Minuten, so sagte sie sich, würde alles vorbei sein; und plötzlich kam es ihr unglaublich vor, daß eine Beziehung, die sich seit mittlerweile über einem Jahr dahingeschleppt hatte und die ihr sehr viel Freude beschert hatte, aber – vor allem in den letzten Monaten – auch sehr viel Frustration, in wenigen Augenblicken beendet werden konnte, mit ein paar wohlgewählten Sätzen. Womit sie – ja, was eigentlich gewinnen würde? Freiheit, vermutlich, die Freiheit, andere erfolgreichere Freundschaften einzugehen (für einen Augenblick kamen ihr die Namen und Gesichter von Robert und – zu ihrem Erstaunen, das jedoch ohne nähere Untersuchung wieder vorüberging – Veronica in den Sinn). Doch das war reine Spekulation. Vorläufig konnte sie nur unmittelbare emotionale Vernichtung voraussehen: Gefühlsleere, Dunkelheit. Und doch erschien ihr jetzt sogar diese Aussicht verlockend.
Dunkelheit umgab sie, als sie langsam die Schlafzimmertür öffnete und in den Raum trat. Dunkelheit und Stille – nicht einmal das Geräusch seines Atmens. Sie tastete nach dem Lichtschalter, überlegte es sich aber anders. Statt dessen räusperte sie sich und sagte schwach:
»Gregory?«
Augenblicklich ging die Nachttischlampe an, und er saß im Bett und starrte sie an, die Arme verschränkt, die Pyjamajacke – wie immer – bis zum Hals zugeknöpft. Bevor sie auch nur ein Wort sagen konnte, hatte er bereits zu einem kurzen, deutlich artikulierten, ausdruckslosen Monolog angesetzt: »Sarah, ich habe dir nur eines zu sagen, und ich werde es jetzt sagen, und zwar so rasch und freundlich wie möglich, um dir unnötigen Schmerz zu ersparen. Dein Verhalten heute abend hat einen Verdacht bestätigt, der schon seit einiger Zeit in mir keimt: der Verdacht, daß du – um es einmal deutlich zu sagen – ganz und gar nicht die geeignete Partnerin für mich bist, mit der ich gerne den Rest meines Lebens zusammen sein würde. Ich fühle mich daher verpflichtet, dir mitzuteilen, daß unsere Beziehung beendet ist, und zwar von diesem Augenblick an. Da ich von dir um diese Uhrzeit nicht erwarten kann, daß du dich um eine andere Möglichkeit kümmerst, gestatte ich dir, diese Nacht, und nur diese eine Nacht noch mit mir in einem Bett zu schlafen. Meine Entscheidung in dieser Hinsicht steht nicht zur Debatte, und jetzt, da ich sie dir mitgeteilt habe, möchte ich dich nur noch daran erinnern, daß ich morgen eine lange Autofahrt vor mir habe und ich von dir schon allein deshalb eines erwarte: Laß mich in Ruhe« – und an dieser Stelle schaltete er das Licht aus – »schlafen.«
2
Hier, über eine Strecke von wenigen hundert Metern, bemühte sich die Stadt plötzlich, ihre Küstenlage zu nutzen und sich endlich wie ein Urlaubsort zu gebärden. Zwanzig Badehütten, in schäbigem Blaßgelb, – grün und – blau gestrichen, standen zwischen Promenade und Strand. Ein Kiosk verkaufte Eis und Zuckerwatte. Liegestühle waren zu mieten. Doch das alles wirkte irgendwie oberflächlich, halbherzig. Es verpuffte, noch bevor es richtig begonnen hatte. Nur wenige Urlauber kamen hierher; nur wenige Zimmer in den unterschiedlichen Pensionen mit Meerblick waren belegt, selbst im sogenannten Hochsommer. Und heute, an diesem warmen, windigen Sonntag nachmittag Ende Juni, an dem weggeworfene Chipstüten trostlos gegen die Rauhputzwände der öffentlichen Toilette wehten und Möwen über den schwappenden Wellen der steigenden Flut tanzten, waren am Strand nur zwei Gestalten zu sehen. Eine vor ihnen, eine junge Frau um die Zwanzig mit langem, dünnem, tiefschwarzem Haar, stand, die nackten Arme verschränkt, nur wenige Schritte vom Wasser entfernt und blickte hinaus aufs Meer. Die andere, die vielleicht fünfzehn oder zwanzig Jahre älter war, saß auf einer Bank in der Nähe der Strandhütten, den Mantel ordentlich neben sich gefaltet, einen kleinen Koffer zu ihren Füßen, die Augen geschlossen, das Gesicht der Sonne zugeneigt, die ab und zu durchkam.
Die jüngere Frau drehte sich um und ging über den Kieselstrand zurück. Sie blieb stehen, bückte sich, nahm einen merkwürdig geformten Stein auf, warf ihn dann aber wieder fort. Sie trat versehentlich gegen eine Cola-Dose, und bei dem Geräusch merkte sie wieder, was für ein stiller Nachmittag es war.
Die ältere Frau hörte das Geräusch, öffnete die Augen und blickte sich um.
Es gab drei Bänke, doch eine war mutwillig zerstört worden, fast völlig auseinandergenommen, und daher nicht mehr zu benutzen, und die andere wurde gänzlich von der ausgestreckten, schlafenden Gestalt eines Mannes im mittleren Alter in Beschlag genommen. Er hatte ein rotes Gesicht und einen struppigen Bart, seine Kleidung roch ranzig, die rechte Hand hielt eine Dose Apfelwein umklammert.
Aber die jüngere Frau wollte sich trotzdem hinsetzen.
»Stört es Sie, wenn ich mich dazusetze?« mußte sie schließlich fragen.
Die ältere Frau lächelte, schüttelte den Kopf und legte ihren Mantel beiseite.
Die beiden Frauen saßen da, schweigend.
Die ältere Frau war müde. Sie war mit ihrem Koffer den ganzen Weg vom Bahnhof zum Strand zu Fuß. Sie schwitzte stark, und sie hatte den leisen Verdacht, daß ihre Schuhe, die sie erst zwei Wochen zuvor gekauft hatte, eine halbe Nummer zu klein waren. Sie hatte sie ausgezogen, als sie sich auf die Bank setzte, und festgestellt, daß die nackten Füße feuerrote Striemen bekommen hatten, die erst jetzt allmählich verblaßten. Immer wieder beugte und streckte sie die Zehen, die die Freiheit genossen, bis sie merkte, daß die jüngere Frau ihr auf die Zehen starrte – mit einer Art ehrfürchtiger Faszination. Augenblicklich legte sie die Füße übereinander und versteckte sie unter der Bank. Sie konnte ihre plumpen, männlichen Füße und dicken Knöchel nicht ausstehen, und wie die Leute immer daraufstarrten – vor allem Frauen und vor allem (wie in diesem Fall) Frauen, die sie selbst attraktiv fand.
Die jüngere Frau blickte sie verlegen an und lächelte, schüchtern, entschuldigend. Jetzt war klar: Sie würden miteinander reden.
»Falls Sie ein Zimmer suchen«, wagte die jüngere Frau sich vor, »könnte ich Ihnen vielleicht helfen. Ich kann Ihnen da was empfehlen.«
»Ach ja?«
Sie nannte den Namen einer nahegelegenen Pension.
»Und wodurch unterscheidet sie sich von den anderen?«
Die jüngere Frau lachte. »Durch nichts eigentlich. Nur daß sie von meiner Mutter geführt wird.«
Die andere Frau lächelte. »Vielen Dank jedenfalls, aber ich suche kein Zimmer.«
»Oh. Ich dachte nur, wegen des Koffers ...«
»Ich war weg«, sagte die ältere Frau. »Ich komme gerade vom Bahnhof.«
Irgend etwas an der Art, wie sie das sagte – irgend etwas an der Formulierung »Ich war weg«, – ließ die jüngere Frau vermuten, daß sie nicht bloß einen Urlaub meinte. Es klang eher nach einer längeren Zeit im Exil.
»Ach ja?« sagte sie. »Eine lange Reise?«
»Zwei Wochen Italien. San Remo. Sehr schön.«
Also hatte sie sich geirrt.
»Dann wohnen Sie hier?«
Allmählich fand die ältere Frau diese Fragen recht direkt. Ein abwegiger Gedanke schoß ihr durch den Kopf: War es möglich – war es vielleicht möglich –, daß die andere versuchte, sie anzumachen?
Sie beschloß, die Hypothese zu überprüfen, indem sie ganz offen war, jede gewünschte Information lieferte. Mal sehen, was dann passieren würde.
»Etwa drei Meilen von hier an der Küste«, sagte sie. »In der Dudden Clinic. Ich arbeite dort.«
»Wirklich? Sie sind Ärztin?«
»Psychologin.« Sie wühlte in ihrer Tasche nach einem Kleenex, wischte sich die Stirn ab. »Kennen Sie die Klinik?«
»Ich denke, ja. Die gibt’s noch nicht lange, oder?«
»Gut zwei,Jahre.«
»Was für... eine Klinik ist das?«
»Wir behandeln Menschen mit Schlafstörungen. Das heißt, wir versuchen es.«
»Sie meinen – Leute, die im Schlaf sprechen und so?«
»Leute, die im Schlaf sprechen, Leute, die schlafwandeln, Leute, die zuviel schlafen, Leute, die nicht genug schlafen, Leute, die im Schlaf vergessen zu atmen, Leute, die schreckliche-Träume haben ... und so weiter.«
»Ich habe früher im Schlaf gesprochen.«
»Das tun viele Kinder.« Die ältere Frau sah auf die Uhr: In vier Minuten sollte an der Haltestelle auf der Küstenstraße ein Bus kommen. Sie beugte sich vor und zwängte die Schuhe an ihre wehen Füße. Dann griff sie in ihre Handtasche und sagte: »Hier – ich gebe Ihnen meine Karte. Man kann ja nie wissen, vielleicht möchten Sie uns ja mal besuchen. Sie sind herzlich willkommen, wenn Sie sich auf mich berufen.«
Die jüngere Frau wußte nicht, was sie sagen sollte. Sie hatte nie eine Visitenkarte überreicht bekommen.
»Vielen Dank«, brachte sie heraus, als sie die Karte nahm.
Sie meinte, als die ältere Frau sich verabschiedete, in deren Augen Enttäuschung zu lesen: nicht bloß eine vorübergehende Enttäuschung, wie man sie empfindet, wenn eine schwache Erwartung nicht erfüllt wird, sondern etwas Tieferes und Beständigeres. Sie hielt den Rücken gebeugt, während sie sich mit ihrem Koffer entfernte. Die jüngere Frau sah auf die Karte in ihrer Hand und las: »Dr. C. J. Madison, Psychologin, The Dudden Clinic«. Darunter waren einige Fax – und Telefonnummern.
Die ältere Frau hatte vergessen, sich nach ihrem Namen zu erkundigen. Aber sie hätte ihn ohnehin nicht verraten.
Als sie im Eilschritt zur Pension ihrer Mutter zurückging, schwirrte ihr der Kopf.
Riesig, grau und imposant stand Ashdown auf einer Landzunge, etwa zwanzig Meter von den steilen Felsklippen entfernt, und das seit über einhundert Jahren. Den ganzen Tag lang umsegelten die Möwen seine Dachspitzen und Türmchen, schrien sich heiser. Den ganzen Tag und die ganze Nacht lang warfen sich die Wellen wie verrückt gegen die steinerne Barrikade, schickten ein endloses Tosen wie von starkem Straßenverkehr durch die eisigen Räume des alten Hauses und das Labyrinth aus widerhallenden Korridoren. Sogar in den verlassensten Teilen von Ashdown – und das Gebäude stand jetzt fast ganz leer – herrschte niemals völlige Stille. Die noch am ehesten bewohnbaren Räume drängten sich im ersten und zweiten Stock, mit Blick aufs Meer, und wurden tagsüber von kaltem Sonnenlicht durchflutet. Die Küche im Erdgeschoß war lang und L-förmig, mit einer niedrigen Decke; sie hatte nur drei kleine Fenster und war ständig in Dunkelheit getaucht. Ashdowns rauhe, den Naturgewalten trotzende Schönheit ließ nicht vermuten, daß das Haus praktisch unbewohnbar war. Seine ältesten und nächsten Nachbarn konnten sich erinnern, wenn auch nur schwerlich glauben, daß es einmal ein Privatsitz gewesen war, in dem eine nur acht – oder neunköpfige Familie gelebt hatte. Doch drei Jahrzehnte zuvor war es von der neuen Universität erstanden und als Studentenwohnheim genutzt worden. Dann wurden die Studenten ausquartiert, und das Haus ging an Dr. Dudden, der dort seine Privatklinik und sein Schlaflabor einrichtete. Die Klinik hatte Platz für dreizehn Patienten – eine wechselnde Belegschaft, so veränderlich wie der Ozean, der sich zu Ashdowns Füßen bis hin zum Horizont erstreckte, in einem ungesunden Grün und getrieben von ewiger Unrast.
Am nächsten Morgen stand Dr. Dudden vor dem Raum, in dem seine Kollegin mit drei Patienten ein Seminar abhielt, und lauschte durch die geschlossene Tür. Sein Körper erstarrte förmlich vor Mißbilligung: Die Atmosphäre klang geradezu ausgelassen. Fast pausenlos plapperten die Stimmen durcheinander, nur hin und wieder unterbrochen von dröhnenden Lachsalven, und zwischendurch konnte er deutlich Dr. Madisons typisches Glucksen vernehmen. Dann hörte er, wie sie einen Monolog vom Stapel ließ, der vielleicht eine halbe Minute dauerte, diesmal gefolgt von nicht enden wollenden Wellen kreischenden Gelächters, begleitet von dumpfen Schlägen auf Tische und all den anderen Geräuschen hilfloser Heiterkeit. Zornbebend trat Dr. Dudden von der Tür zurück. Seit geraumer Zeit ging das Gerücht, daß Dr. Madisons Patienten ihre Seminare regelrecht genossen, und das hier war der konkrete Beweis. Es war empörend und obendrein unwissenschaftlich. Es konnte keinesfalls geduldet werden.
Am Mittag rief er Dr. Madison in sein Büro – ein düsterer Raum im hinteren Teil des Hauses mit Blick auf einen ungepflegten Garten. Ein komplizierter Kalender mit Stundenplan nahm die Hälfte der größten Wand ein, und daneben hing ein Grundriß des Hauses, auf dem die Tagesräume und Schlafzimmer eingezeichnet waren und die Namen der Patienten standen, mit denen die Räume zur Zeit belegt waren. Es gab vier Regale, allesamt mit Lehrbüchern und gebundenen Fachzeitschriften gefüllt, und die übrigen Wände waren mit Postern von pharmazeutischen Firmen und amerikanischen Softwareherstellern tapeziert – dekoriert wäre wohl kaum der richtige Ausdruck. Aus einem Kassettenrecorder erklangen leise barocke Cembaloklänge.
Seine erste Frage war: »Haben Sie die SBFs mitgebracht?«
In dem Schlaf Bewußtseins-Fragebogen, einer Erfindung von ihm, mußten die Patienten jeden Morgen auf einer Skala von eins bis fünf einstufen, wie sie in der vergangenen Nacht geschlafen hatten. Sie wurden gefragt, ob sie vor dem Einschlafen beunruhigende Gedanken gehabt hatten, nachts zum Klo gegangen waren, Herzklopfen, Beinkrämpfe oder Alpträume hatten, ob sie zwischendurch längere Zeit wachgelegen hatten – und über achtzig weitere Fragen. Der Fragebogen sollte jeden Morgen zu Beginn der Sitzung ausgefüllt werden und als Gesprächsgrundlage dienen.
»Nein«, sagte Dr. Madison.
»Das erstaunt mich sehr.«
»Wir hatten nicht die Zeit, sie alle auszufüllen.«
»Das erstaunt mich noch mehr«, sagte Dr. Dudden. »Denn nach dem, was ich hören konnte, schienen Sie genug Zeit zu haben, um Witze zu erzählen und zu kichern und zu tratschen wie ein Haufen Waschfrauen.«
Waschfrauen? dachte Dr. Madison, sagte aber nichts dazu.
»Da Sie nicht bei uns im Raum waren«, sagte sie, »gehe ich davon aus, daß Sie an der Tür gelauscht haben. Und da Sie an der Tür gelauscht haben, gehe ich davon aus, daß Sie nicht verstehen konnten, worüber gesprochen wurde. Hätten Sie das, wäre Ihnen sicherlich klargeworden, daß es voll und ganz im Interesse der Klinik war.«
Sie betonte die Worte »im Interesse der Klinik« mit leicht eisiger Stimme, was Dr. Dudden entweder nicht wahrnahm oder lieber nicht wahrnehmen wollte.
»Das«, sagte er, »stelle ich ja gar nicht in Abrede. Ich glaube gern, daß Sie sich während dieser... Plaudereien auf das entscheidende Thema beschränken. Aber ich darf Sie wohl daran erinnern, daß Sie hier – von mir – angestellt sind, um unser Thema als Psychologin und nicht als Kabarettistin in Angriff zu nehmen.«
»Ich verstehe nicht ganz«, sagte Dr. Madison und strich geistesabwesend ihren Rock glatt.
»Vor wenigen Minuten habe ich mit Miss Granger gesprochen, die heute morgen in Ihrem Seminar war. Ich habe sie gefragt, was denn so erheiternd gewesen sei, und nach einigem Zögern hat sie es mir erzählt. Tatsächlich hat sie eine Bemerkung von Ihnen wiederholt.« Er beugte sich vor und las von dem Notizblock auf seinem Schreibtisch ab. »Jeden Dienstag lädt Dr. Dudden die Patienten in seiner Klinik zu einer seiner Vorlesungen an der Universität ein. Diese Woche war es so langweilig, daß selbst die Narkoleptiker bis zum Schluß wachgeblieben sind.« Er blickte auf. »Streiten Sie diese Bemerkung ab?«
»Nein.«
»Sie denken wahrscheinlich, daß ich mich persönlich beleidigt fühle. Und dem ist auch tatsächlich so, aber darum geht es mir hier nicht.«
»Es war bloß ein Witz.«
»Oh, das ist mir klar. Sie dürfen mir glauben, Dr. Madison, daß ich sehr wohl imstande bin, einen Witz zu erkennen. Darf ich Sie fragen, ob Sie auch die Narkolepsie – um Ihren Ausdruck zu verwenden – für einen Witz halten oder ob Sie sie – was ich offen gestanden tue – für eine ernste psychophysiologische Erkrankung halten, die für die Betroffenen äußerst traumatisch und quälend ist?«
»Narkolepsie ist mein Spezialgebiet, Doktor, und zwar seit vielen Jahren. Das wissen Sie ganz genau. Ich verstehe daher nicht, wie Sie mein Engagement bei der Behandlung der Erkrankung – die Ernsthaftigkeit meines Engagements -in Frage stellen können.« Sie seufzte. »Abgesehen davon ist Ihnen doch sicherlich bewußt, daß durch Lachen ausgelöste Kataplexie eines der unangenehmsten und gesellschaftlich peinlichsten Symptome des Syndroms ist. Die Workshops sollen den Patienten helfen, damit umzugehen: Sie sollen lernen, wieder unbeschwerter zu lachen. Meiner Ansicht nach ist Humor ein absolut unerläßliches therapeutisches Mittel in diesem Prozeß.«
»Eine findige Erklärung«, sagte Dr. Dudden nach einer Pause. »Aber keine befriedigende.« Er verschränkte die Arme und drehte seinen Schreibtischsessel leicht zur Seite, so daß er sie nicht mehr direkt ansprach. »Sie erinnern sich, daß ich heute morgen einen Gesprächskreis hatte mit vier Patienten, die an chronischer Schlaflosigkeit leiden. Wissen Sie, was Sie gehört hätten, wenn Sie dabei an meiner Tür gehorcht hätten?«
»Wahrscheinlich Schnarchen«, entfuhr es Dr. Madison, bevor sie sich hätte beherrschen können.
Dr. Duddens Mundwinkel zuckten kurz; ansonsten zeigte er keinerlei Reaktion.
»Wie ich sehe, steht Schlaf-Apnoe ebenfalls auf Ihrer Liste geeigneter Heiterkeitsthemen. Das muß ich mir notieren.« Er tat sogar so, als würde er etwas auf seinen Notizblock kritzeln, während Dr. Madison mit wachsender Verwunderung zusah. Dann sagte er: »Nein, Sie hätten das Kratzen von Bleistiften auf Papier gehört, während vier Schlaf-Bewußtseins-Fragebögen ordnungsgemäß ausgefüllt wurden, und dann Stimmen, und zwar immer nur eine auf einmal, und in vernünftigem und ruhigem Ton, während die Ergebnisse der Fragebögen verglichen und analysiert wurden.«
Dr. Madison befand, daß es nun wirklich reichte, und stand auf, in der Hoffnung, dem Grauen entfliehen zu können.
»Ich verstehe, was Sie meinen, Dr. Dudden. Wenn das alles ist...«
»Leider nein. Bitte setzen Sie sich.« Er wartete demonstrativ ab, bis sie wieder Platz genommen hatte. »Ich möchte Sie daran erinnern, daß Sie Dr. Goldsmith heute nachmittag bei dem Vorgespräch mit Mr. Worth assistieren sollen. Ist das klar?«
»Es ist mir klar, aber leider unmöglich. Ich habe schon etliche Termine und einen erheblichen Arbeitsrückstand –«
»Verstehe.« Er nahm einen Bleistift und tippte damit auf den Schreibtisch, während seine Wangen sich vor Ärger röteten. »Sie halten also an Ihren Einwänden fest, nicht wahr?«
»Einwände, Dr. Dudden?«
»Sie haben bereits unmißverständlich klargemacht, was Sie von dem Neuzugang halten. Oder haben Sie unser Gespräch kurz vor Ihrer Abreise vergessen?«
Dr. Madison hatte es ganz und gar nicht vergessen, zumal es die letzte einer langen Reihe zunehmend heftiger Konfrontationen gewesen war. Dr. Dudden hatte ihr in einer kürzlich erschienenen Ausgabe des Independent einen Artikel gezeigt, den ein freier Journalist namens Terry Worth offenbar für eine Anzahl überregionaler Zeitungen geschrieben hatte. Gewöhnlich schrieb er über Filme, ließ sich aber manchmal auch über allgemeinere Themen aus. In diesem Artikel hatte er seine Absicht angekündigt, an einem Wettbewerb teilzunehmen, der in einem Londoner Programmkino im Rahmen eines zehntägigen »Cinethons« veranstaltet werden sollte. Während dieser Veranstaltung wurden täglich rund um die Uhr ununterbrochen Filme gezeigt, und der Zuschauer, der die meisten Filme hintereinander durchhielt, sollte einen Preis bekommen. Worth hatte behauptet, er als Langzeitschlafloser würde es schaffen, alle 134 Filme hindurch wach zu bleiben, und Dr. Dudden hatte nach der Lektüre des Artikels umgehend bei der Zeitung angerufen und sich mit Worth in Verbindung gesetzt.
»Überlegen Sie doch bloß mal, was das für unsere Forschung bedeuten könnte«, hatte er Dr. Madison vorgeschwärmt. »Wir lassen ihn sofort nach der Veranstaltung auf schnellstem Wege hierherbringen. Legen ihn direkt in ein Bett und dann – Sieben-Elektroden, um Schlafstörung und -struktur zu messen ... sechzehn Kanäle zur Aufzeichnung des EEG... manuelle Auswertung der Schlafaufzeichnung anhand der Pupillenbeobachtung... vollständiger Schlaffragebogen natürlich. Es ist eine einmalige Gelegenheit um festzustellen, wie es sich auf den Trauminhalt auswirkt, wenn man ununterbrochen Medienbildern ausgesetzt ist.«
»Und das ist der einzige Grund?« hatte Dr. Madison gefragt.
»Das reicht doch wohl als Grund, oder etwa nicht? Worauf wollen Sie hinaus?«
»Ich hab mich nur gefragt, ob Sie dabei vielleicht auch die Publicity im Auge haben. Wird Mr. Worth für seine Behandlung bezahlen?«
»Das tut nichts zur Sache.«
»Und wird er einen Artikel über uns schreiben? Ist das Teil der Abmachung?«
»Es gibt keine Abmachung, Dr. Madison. Ich finde die Andeutung höchst unangebracht. Und selbst wenn es eine Abmachung gäbe, sollten Sie bedenken, daß diese Klinik überwiegend eine private Einrichtung ist, daß wir auf die Finanzierung durch die Patienten selbst angewiesen sind und daß der Gedanke, ab und an in bescheidenem Maße etwas Werbung für uns zu machen, an sich nicht verwerflich ist.« Er hatte eine Seite in seinem Terminplaner aufgeschlagen, die bereits mit einem blauen Band gekennzeichnet war. »Mr. Worth trifft Montag in zwei Wochen hier ein, am späten Vormittag. Wie ich sehe, kommen Sie einen Tag davor aus dem Urlaub zurück, daher schlage ich vor, daß Sie und Dr. Goldsmith am Nachmittag das Einführungsgespräch mit ihm führen. Ich trage Sie dafür ein, ja?«
»Wenn Sie unbedingt wollen«, hatte sie mit einem gleichgültigen Achselzucken gesagt; und an diese unverschämte Bemerkung und Geste mußte Dr. Dudden jetzt wieder denken, als er Dr. Madison über den Schreibtisch hinweg anstarrte, fast bebend vor Wut.
»Glauben Sie nur nicht«, sagte er leise, »bilden Sie sich bloß nicht ein, daß meine Gutmütigkeit unerschöpflich ist.«
»Der Gedanke ist mir nie gekommen«, erwiderte Dr. Madison.
Nach einigen Schweigesekunden begriff sie, daß das Gespräch beendet war. Sie ging und schloß sachte die Tür hinter sich.
Dr. Madison war noch wach, als sie kurz nach Mitternacht durch das offene Flügelfenster, das die warme Brise hereinließ und ihr Zimmer in schimmerndes Mondlicht tauchte, Schritte auf der Terrasse vor dem Haus hörte. Sie zog ihren Morgenmantel über und spähte durchs Fenster. Draußen stand ein Mann, an die Brüstung gelehnt, und rauchte eine Zigarette. Sie glimmte golden auf, als er einen Zug nahm, ein stecknadelkopfgroßer Lichtpunkt, der gleich wieder erlosch. Er hatte nichts Beängstigendes an sich. Er sah nicht wie ein Eindringling aus. Sie beschloß, der Sache auf den Grund zu gehen.
Auf dem Weg nach unten begegnete sie Lorna, einer der technischen Assistentinnen, die mit besorgter Miene über den Korridor gehastet kam.
»Ich wollte gerade Dr. Dudden wecken«, sagte sie. »Es ist was Merkwürdiges passiert. Ich habe den Patienten in Zimmer neun vor etwa einer Stunde in seinem Bett an die Geräte angeschlossen. Eine Zeitlang habe ich ihn beobachtet, und es deutete nichts darauf hin, daß er einschlafen würde, aber es schien ihm gutzugehen. Er lag ganz still da. Dann bin ich gegangen, um mir eine Tasse Tee zu machen, und als ich zurückkam, war er verschwunden.«
»Verschwunden? Sie meinen, er hat sich alle Elektroden selbst abgemacht?«
»Ich denke, ja.«
»Zimmer neun – da ist doch Mr. Worth untergebracht worden, nicht?«
Sie eilte zu dem betreffenden Zimmer und fand alles so vor, wie Lorna es beschrieben hatte: das Bett leer, die Laken zerwühlt und am Kopfende des Bettes ein Gewirr von Elektroden, die das Kopfkissen mit Kleber verschmiert hatten. Das war äußerst ungewöhnlich. Es kam zwar häufig vor, daß schlaflose Patienten mitten in der Nacht aufstehen wollten, aber nur selten, daß einer der Wachsamkeit der Assistenten entwischte und die Sache selbst in die Hand nahm.
»Keine Sorge«, sagte Dr. Madison. »Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Ich rede mit ihm.«
»Und Dr. Dudden?«
»Wecken Sie ihn nicht. Ich finde, er braucht nichts davon zu wissen.«