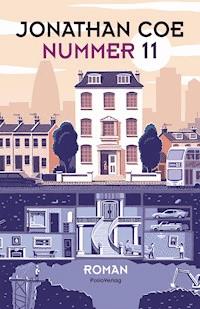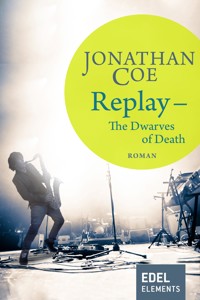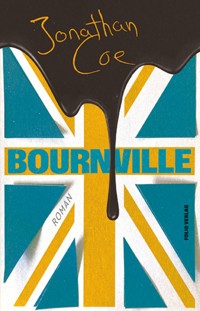
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folio Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Transfer Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Ein großes Familienepos, das Erinnerungen weckt und uns lachen lässt – humorvoll, melancholisch und berührend. Die Krönung Elizabeths II., Wembley 1966, der "Schokoladenkrieg" zwischen England und der EU, James Bond und Prinzessin Diana, Brexit und Pandemie – das sind einige der Fixpunkte im langen Leben der Mary Lamb und ihrer weitverzweigten Familie. Mary ist Herz und Zentrum dieses Romans, als Tochter, Mutter und Großmutter. Das Beispiel von Marys Familie zeigt die Zerrissenheit Englands und gleichzeitig dessen Fähigkeit, in Krisensituationen zusammenzustehen. Nationalismus, latenter Rassismus, Tories oder Labour – die politischen Konflikte ziehen sich auch quer durch die Familie Lamb. Vielstimmig hören wir von Träumen, Enttäuschungen, aber auch vom Glück und der Liebe, die von Mary und den Ihren in der Kleinstadt Bournville gelebt werden. Der neue Roman von Bestsellerautor Jonathan Coe
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 531
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ein großes Familienepos, das Erinnerungen weckt und uns lachen lässt — humorvoll, melancholisch und berührend.
Die Krönung Elizabeths II., Wembley 1966, der „Schokoladenkrieg“ zwischen England und der EU, James Bond und Prinzessin Diana, Brexit und Pandemie – das sind einige der Fixpunkte im langen Leben der Mary Lamb und ihrer weitverzweigten Familie. Mary ist Herz und Zentrum dieses Romans, als Tochter, Mutter und Großmutter. Das Beispiel von Marys Familie zeigt die Zerrissenheit Englands und gleichzeitig dessen Fähigkeit, in Krisensituationen zusammenzustehen.
Nationalismus, latenter Rassismus, Tories oder Labour – die politischen Konflikte ziehen sich auch quer durch die Familie Lamb. Vielstimmig hören wir von Träumen, Enttäuschungen, aber auch vom Glück und der Liebe, die von Mary und den Ihren in der Kleinstadt Bournville gelebt werden.
Foto: Stuart Simpson
Jonathan Coe, 1961 in Birmingham geboren, studierte am Trinity College in Cambridge und lehrte an der Universität von Warwick. Sein Interesse galt lange sowohl der Literatur als auch der Musik. So spielte er u. a. Keyboard für das feministische Kabarett „Wanda and the Willy Warmers“. Seine humorvollen und satirisch geprägten Romane stellen zumeist soziale Fragen in den Mittelpunkt. Zahlreiche Auszeichnungen, darunter der Preis des Europäischen Buches 2019. Seine Bücher wurden verfilmt und in viele Sprachen übersetzt. Bei Folio sind auf Deutsch erschienen: Nummer 11 (2017), der Brexit-Roman und Bestseller Middle England (2020) sowie Mr. Wilder & ich (2021).
Cathrine Hornung übersetzt aus dem Englischen und Italienischen. Für Folio hat sie Baret Magarian, Valeria Parrella und Massimo Carlotto ins Deutsche übertragen.
Juliane Gräbener-Müller übersetzt aus dem Englischen und Französischen. Sie lebt und arbeitet in Bammental bei Heidelberg.
Jonathan Coe
BOURNVILLE
Ein Roman in sieben Ereignissen
Aus dem Englischen von Cathrine Hornung und Juliane Gräbener-Müller
Für Graham Caveney
Inhalt
Prolog
März 2020
Eins
Die Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa. 8. Mai 1945
Zwei
Die Krönung von Königin Elizabeth II. 2. Juni 1953
Drei
Das Finale der Fußballweltmeisterschaft, England gegen Westdeutschland. 30. Juli 1966
Vier
Die Investitur von Charles, Prinz von Wales. 1. Juli 1969
Fünf
Die Hochzeit von Charles, Prinz von Wales, und Lady Diana Spencer. 29. Juli 1981
Sechs
Die Beisetzung von Diana, Prinzessin von Wales 6. September 1997
Sieben
Die Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag des Kriegsendes in Europa. 8. Mai 2020
Anmerkungen des Autors
Prolog
März 2020
In der Ankunftshalle des Wiener Flughafens herrschte so wenig Betrieb, dass Lorna sie gleich erkannte, obwohl sie sich noch nie begegnet waren. Sie hatte kurzes braunes Haar, eine knabenhafte Figur und braune Augen, die aufleuchteten, als Lorna hinter ihrem riesigen Instrumentenkoffer hervorlugte und sagte:
„Susanne, stimmt’s?“
„Hallo“, sagte Susanne, wobei sie das Wort mehr sang als sprach. Nach kurzem Zögern umarmte sie Lorna zur Begrüßung. „Das dürfen wir doch noch, oder?“
„Klar dürfen wir das.“
„Ich bin so froh, dass du endlich hier bist.“
„Ich auch“, sagte Lorna automatisch. Aber es stimmte.
„Wie war dein Flug?“
„Gut. Ziemlich ruhig.“
„Ich bin mit dem Auto da.“ Mit plötzlicher Sorge musterte sie den glänzenden schwarzen Koffer, in dem sich Lornas Kontrabass befand, und sagte: „Hoffentlich ist es nicht zu klein.“
Draußen war es beinahe kalt genug für Schnee, und die Straßenlaternen warfen hier und da bernsteingelbe Koronen in die Nacht. Auf dem Weg zum Parkplatz erkundigte sich Susanne genauer nach dem Flug (wurde am Flughafen die Temperatur gemessen?), fragte Lorna, ob sie Hunger habe (hatte sie nicht), und erläuterte ihr kurz den Ablauf der nächsten Tage. Lorna und Mark würden im selben Hotel wohnen, aber er würde aus Edinburgh einfliegen und erst am nächsten Vormittag in Wien ankommen. Ihr Auftritt würde um 21 Uhr beginnen, und am Tag darauf würden sie mit dem Zug weiter nach München fahren.
„Ich kann zu den Konzerten in Deutschland nicht mitkommen“, sagte sie, „so leid es mir tut. Das Label hat einfach nicht die Mittel, um mir die Reise zu bezahlen. Wir machen alles auf Sparflamme. Deshalb wirst du auch mit diesem Auto abgeholt und nicht mit einer Stretchlimousine.“
Sie meinte ihren eigenen Wagen, einen zehn Jahre alten Volvo-Kombi, der mit Kratzern und Dellen übersät war und keinen besonders vertrauenerweckenden Eindruck auf Lorna machte.
„Das müsste gehen“, meinte Lorna, aber als sie das Wageninnere in Augenschein nahm, stieß sie auf ein unerwartetes Problem. Auf der Rückbank befand sich ein Kindersitz, umgeben von Dingen, wie sie nur jemand hinterlassen kann, für den Kinderbetreuung oberste Priorität besitzt – Feuchttücher, Keksreste, Plastikspielzeug, Schnuller –, aber noch beunruhigender war, dass jeder verbleibende Quadratzentimeter mit Toilettenpapier besetzt schien, das in Zehnerrollen verpackt war. Es waren bestimmt zwanzig Packungen.
„Tut mir leid“, sagte Susanne. „Lass mich einfach … also, mal schauen, was wir tun können.“
Sie versuchten zunächst, den Bass durch die Heckklappe ins Auto zu bekommen, aber er stieß sogleich auf eine massive Wand aus Klopapierrollen. Lorna nahm neun oder zehn Packungen heraus und legte sie auf den Asphalt, aber trotzdem konnten sie den Hals des Basses nicht durch die ganzen Packungen Toilettenpapier auf dem Rücksitz schieben. Also nahmen sie weitere Rollen vom Sitz und stapelten sie neben dem Auto und gemeinsam schafften sie es, den Bass tief ins Innere zu manövrieren, vorbei am Kindersitz, sodass sein Kopf fast gegen die Windschutzscheibe stieß und die Heckklappe gerade noch zuging. Der Versuch, sämtliche Klopapierrollen um ihn herum zu packen, scheiterte jedoch.
„Vielleicht sollten wir das Instrument aus dem Koffer nehmen“, sagte Susanne, „und den Koffer mit Klopapier füllen … Nein, ich glaube nicht, dass das funktioniert.“
Schließlich lösten sie das Problem, indem Lorna auf dem Beifahrersitz Platz nahm, ihre Wange gegen den Hals der Bassgeige gepresst, und Susanne acht oder neun Packungen Klopapier auf ihren Schoß lud, bis der Turm das Dach des Wagens berührte.
„Ist das einigermaßen verkehrssicher?“, fragte sie besorgt, als sie losfuhr und die fast leeren Straßen Richtung Stadtzentrum einschlug.
„Klar“, sagte Lorna. „Die sind wie ein Airbag. Wenn wir einen Unfall bauen, retten sie mir wahrscheinlich das Leben.“
„Es sieht nicht sonderlich bequem aus. Tut mir echt leid.“
„Kein Problem, das geht schon.“ Nach einer Pause sagte Lorna: „Also, die Frage drängt sich irgendwie auf … Wieso hast du so viel Klopapier gekauft?“
Susanne warf ihr einen erstaunten Blick zu, als läge die Antwort auf der Hand. „Ich hielt es einfach für ratsam, mich einzudecken. Gut, vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben, aber trotzdem … Man kann ja nicht vorsichtig genug sein, oder?“ Sie hielt an einer Ampel und fuhr weiter. Aber sie merkte, dass Lorna ihre Erklärung nicht wirklich verstand. „Wegen dem Virus“, fügte sie hinzu, um keinen Zweifel aufkommen zu lassen.
„Glaubst du, dass es so ernst ist?“
„Wer weiß! Aber ja, ich denke schon. Hast du die Berichte aus Wuhan gesehen? Und jetzt riegeln sie ganz Italien ab.“
„Ja, das habe ich gehört“, sagte Lorna. „Aber so etwas werden sie hier doch nicht machen, oder? Ich meine, es besteht doch keine Gefahr, dass das Konzert morgen abgesagt wird?“
„Oh nein, das glaube ich nicht. Es ist bereits ausverkauft, weißt du. Es ist kein großer Saal – zweihundert Plätze oder so –, aber für ein Jazzkonzert ist das ziemlich gut. Und morgen früh will ein Journalist von so einer Website mit dir sprechen. Das Interesse ist also groß. Alles wird reibungslos ablaufen, keine Sorge.“
Lorna stand die Erleichterung ins Gesicht geschrieben. Das hier war eine große Sache für sie. Es war das erste Mal, dass sie und Mark außerhalb des Vereinigten Königreichs auftraten; das erste Mal, dass sie auf Tournee gingen; Lornas erster Verdienst mit Musik seit über einem Jahr. Im normalen Leben war sie eine von vier Frauen, die an der Rezeption eines fünfzehnstöckigen Bürogebäudes im Zentrum von Birmingham arbeiteten. Ihre Kolleginnen hatten eine vage Vorstellung davon, was sie in ihrer Freizeit machte, aber sie wären erstaunt gewesen, wenn sie gewusst hätten, wie weit sie es mit ihrer Musik gebracht hatte: dass man sie dafür bezahlte, dass sie nach Österreich und Deutschland reiste, dass man sie in Hotels unterbrachte, dass ein Journalist (großer Gott, sogar ein Journalist von einer Website) sie interviewen wollte. Lorna hatte sich seit Wochen auf die Tournee gefreut, auf sie hingelebt. Es würde ihr das Herz brechen, wenn dieses seltsame kleine Virus alle Pläne über den Haufen werfen würde.
Susanne setzte sie im Hotel ab und versprach, am nächsten Morgen gleich nach dem Frühstück vorbeizukommen. Es war eine preiswerte Unterkunft, einige Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Die Zimmer waren winzig, aber Lorna war einfach nur froh, dort zu sein. Eine halbe Stunde oder länger lag sie auf dem Bett und dachte nach. Sie fragte sich, wer wohl auf die Idee gekommen war, ein derart kleines Zimmer mit Neonlicht auszustatten, das noch dazu nicht gedimmt werden konnte. Sie fragte sich, warum sie sich für ein Instrument entschieden hatte, das mehr Platz im Raum beanspruchte als sie selbst und das beinahe im Aufzug stecken geblieben wäre. Vor allem aber fragte sie sich, warum jemand auf die weltweite Ausbreitung eines Virus mit dem Kauf von zweihundert Rollen Klopapier reagierte. War das wirklich die größte Angst der Menschen: dass sie sich eines Tages aufgrund einer schrecklichen Wirtschaftskrise oder einer Krise des Gesundheitssystems oder einer drohenden Klimakatastrophe nicht mehr den Hintern wischen konnten?
Sie schaute auf die Uhr. Halb zehn. Halb neun in Birmingham. Das war eine gute Zeit, um zu Hause anzurufen. Mit „zu Hause“ meinte sie das Vereinigte Königreich, aber sie hatte nicht vor, ihren Mann Donny anzurufen, der jetzt sicher mit seinen Freunden unterwegs war. Sie wollte auch nicht ihre Eltern anrufen, die verreist waren und die zwangsweise Verlängerung ihres Urlaubs nutzten, nachdem Großbritannien schlussendlich aus der EU ausgetreten war und alle britischen Europaabgeordneten ihren Job verloren hatten. Nein, es war Gran, die bestimmt schon darauf wartete, von ihr zu hören. Lorna hatte versprochen, mit ihr zu skypen, sobald sie in Wien gelandet war. Gran, für die jeder Flug eine potenzielle Katastrophe war, ein Flugzeugabsturz, der nur darauf wartete, einzutreten, würde in einem Zustand verhaltener Unruhe zu Hause sitzen, bis Lorna anrief, um ihr mitzuteilen, dass sie wieder festen Boden unter den Füßen hatte.
Sie setzte sich im Bett auf und öffnete ihren Laptop, ein billiges Gerät aus dem zwielichtigen Elektronikladen bei ihr um die Ecke, das ihr aber bislang gute Dienste geleistet hatte. Da es in ihrem Zimmer weder einen Schreibtisch noch einen anderen Tisch gab, legte sie ein Kissen auf den Schoß, stellte den Computer darauf und klickte auf den Skype-Nutzernamen ihrer Großmutter. Wie immer kam keine Antwort. Das war nie der Fall. Warum versuchte sie es immer wieder auf diese Weise? Man musste Gran erst auf dem Festnetz anrufen. Festnetz und Briefe: Moderneren Kommunikationsformen traute Gran nicht, aber sie hatte sich damit abgefunden, dass es sie gab. Seit sechs Jahren besaß sie ein Tablet – es war ein Geschenk zu ihrem achtzigsten Geburtstag gewesen –, aber sie wusste nicht so recht, wie sie damit umgehen sollte. Man musste sie auf dem Festnetz und gleichzeitig auf Skype anrufen und sie Schritt für Schritt durch den Vorgang führen. Das musste man jedes Mal tun.
Als das Brimborium schließlich vorbei war, erschien auf Lornas Laptop das übliche Bild: die obere Hälfte von Grans Stirn.
„Kannst du das Tablet in einem anderen Winkel halten?“, fragte sie. „Kipp es zu dir runter.“
Das Bild schwankte heftig und kippte in die falsche Richtung. Jetzt sah sie nur noch Grans Haare, dauergewellt und blond gefärbt wie immer.
„Ist das besser?“
„Nicht so richtig.“
„Ich kann dich gut sehen.“
„Das liegt daran, dass ich die Kamera an der richtigen Stelle habe. Egal, Gran, das macht nichts.“
„Ich sehe dich.“
„Gut.“
„Wir können uns doch trotzdem unterhalten.“
„Yep, können wir.“
„Wo bist du?“
„In meinem Hotelzimmer.“
„In Venedig?“
„In Wien.“
„Ach ja, richtig. Es sieht sehr hübsch aus.“
„Ja, es ist ganz gemütlich.“
„Wie war dein Flug?“
„Gut.“
„Keine Probleme?“
„Nein, keine Probleme. Wie geht es dir, Gran?“
„Mir geht’s gut. Ich habe gerade die Nachrichten gesehen.“
„Und?“
„Es ist ein bisschen beunruhigend, um ehrlich zu sein. Alles dreht sich um dieses Virus.“
„Ich weiß. Hier reden sie auch darüber. Die Frau, die mich vom Flughafen abgeholt hat, hatte ungefähr zweihundert Klopapierrollen in ihrem Auto.“
„Zweihundert – was?“
„Klopapierrollen.“
„Wie lächerlich.“
„Vielleicht solltest du auch ein paar besorgen.“
„Warum in aller Welt sollte ich das tun?“
„Oder ein paar zusätzliche Dosen Bohnen oder Suppe.“
„Unsinn. Die Leute übertreiben manchmal. Wie auch immer, Jack kauft normalerweise für mich ein, oder Martin. Sie können mir alles besorgen, was ich brauche, es gibt keine Engpässe.“
„Vermutlich nicht. Es ist nur so, dass … Offenbar weiß niemand, was passieren wird.“
„Glaubst du, dass wir es hier kriegen? Das Virus.“
„In Italien haben sie es schon.“
„Das habe ich gesehen. Alle sollen zu Hause bleiben. Es wird wie die Pest werden, stimmt’s? Der Schwarze Tod und der ganze Kokolores.“
Lorna schmunzelte. Das war eins von Grans Lieblingswörtern. Sie verwendete es ständig, ohne dass es ihr bewusst war. Niemand außer ihr hätte den Schwarzen Tod als „Kokolores“ bezeichnet.
„Du sollst einfach nur auf dich aufpassen, mehr nicht“, sagte Lorna. „Bleib zu Hause und sei vorsichtig.“
„Keine Sorge“, sagte Gran. „Ich gehe nirgendwohin.“
*
Den nächsten Vormittag verbrachte Lorna in einem Café in der Nähe des Hotels, wo sie frühstückte, ihr Interview gab und dann Susanne auf einen weiteren Kaffee traf. Das Interview war anstrengend: Sie hatte keinerlei Übung darin, mit Journalisten zu reden. Der Typ war ein fröhlicher Hipster Anfang dreißig, der perfekt Englisch sprach und anscheinend mehr an Boris Johnson und dem Brexit interessiert war als an Harmonien und Basslinien. Als es ihr schließlich gelang, das Gespräch auf ein anderes Thema – die Musik – zu lenken, redete sie hauptsächlich über die Mitglieder ihrer Familie: über ihren Onkel Peter, der im BBC Symphony Orchestra Geige spielte, und dann natürlich über Gran. „Ich glaube, meine Musikalität verdanke ich hauptsächlich meiner Großmutter, Mary Lamb“, sagte sie. „Sie ist eine wunderbare Pianistin. Wahrscheinlich hätte sie sogar Konzertpianistin werden können. Aber stattdessen wurde sie Hausfrau und Mutter, und am Ende spielte sie einmal pro Woche ‚Jerusalem‘ beim örtlichen WI.“ Daraufhin brauchte sie eine Weile, um zu erklären, was das Women’s Institute war, und als sie damit fertig war, hatte sie das Gefühl, dass ihr ursprünglicher Punkt verloren gegangen war. Schade, dass Mark nicht dabei sein konnte, dachte sie. Er hatte viel mehr Erfahrung mit solchen Dingen und war immer so witzig und ungehobelt. Die Stimmung wäre viel lockerer gewesen.
Doch Mark traf erst um 13.30 Uhr im Hotel ein, woraufhin er und Lorna sich sofort auf die Suche nach etwas zu essen machten. Die meisten Restaurants in diesem Bezirk waren charakterlose Fast-Food-Lokale. Sie gingen etwa zehn Minuten, bis sie etwas fanden, das eher traditionell aussah: ein düsteres Interieur mit flackernden Kerzen, schweren Eichentischen und Speisekarten ohne englische Übersetzung. Wochen später erinnerte sich Lorna daran, dass die Stimmung an diesem Tag in dem Restaurant und in der Stadt merkwürdig unruhig war: Eine gewisse Spannung lag in der Luft, als dämmerte den Menschen langsam, dass irgendeine Veränderung, ein unbekanntes, unmittelbar bevorstehendes Ereignis ihr tägliches Leben in einer Weise aus dem Gleichgewicht werfen würde, die sie noch nicht verstanden und auf die sie nicht vorbereitet waren. Die allgemeine Verunsicherung war schwer zu beschreiben, aber greifbar.
Lorna bestellte einen Salat und ein Mineralwasser; Mark nahm ein Gulasch und zwei Bier. Seine Ernährung machte ihr Sorgen.
„Schau nicht so missbilligend“, sagte er. „Ich muss essen, um bei Kräften zu bleiben. Und in Schottland ist es kalt, weißt du. Man braucht eine Menge Speck am Leib, um dort zu überleben.“
Sie erzählte ihm von dem Interview. „Er wollte wissen, wie wir uns kennengelernt haben.“
Mark hielt inne, die Gabel auf halbem Weg zum Mund.
„Ich weiß nicht mehr, wie wir uns kennengelernt haben“, sagte er.
„Natürlich weißt du das noch. Du bist zu uns ins College gekommen. Wir hatten alle Gelegenheit, mit dir Musik zu machen.“
„Ach ja, stimmt“, sagte er, wobei sein Interesse eher dem aufgespießten Stück Fleisch auf seiner Gabel galt.
„Ich war die Beste“, sagte Lorna und wartete darauf, dass Mark bestätigend nickte. Tat er nicht. „Zumindest hast du gesagt, dass ich die Beste war.“
„Natürlich warst du die Beste“, sagte er kauend.
„Danach sind wir etwas trinken gegangen. Du hast mich gefragt, welches deiner Alben mir am besten gefällt, und ich habe gesagt, dass ich bis zu diesem Tag noch nie von dir gehört hatte.“
„Daran erinnere ich mich. Ich war gleichermaßen entzückt über deine Offenheit und entsetzt über deine Unwissenheit.“
„Und dann haben wir einfach … losgelegt.“
„Losgelegt“ hieß, dass sie in der darauffolgenden Woche ein paar Stunden zusammen in der Wohnung in Tufnell Park, in der Mark damals wohnte, gespielt hatten. Danach begannen sie, aus der Ferne Aufnahmen zu machen – Mark schickte ihr die Dateien aus seinem Heimstudio in Edinburgh, Lorna fügte die Bassstimme zu Hause hinzu. Auf diese Weise hatten sie viele Stunden Musik angesammelt, die schließlich zu einem siebzigminütigen Album für Marks österreichisches Plattenlabel destilliert wurden. Auf diese Weise hatten sie einen Stil entwickelt, bei dem die langsamen, atmosphärischen Drones, die Mark meditativ seiner Gitarre entlockte, durch Lornas Beiträge am Bass untermalt und bereichert wurden. Sie betrachtete ihr Instrument als melodisch und spielte oft mit dem Bogen. Dass sie innerhalb so kurzer Zeit von einer vielversprechenden Studentin zu einer Musikerin mit Plattenvertrag avanciert war, konnte sie kaum glauben, aber tatsächlich funktionierte die Zusammenarbeit – bei ihr und Mark hatte es von Anfang an klick gemacht –, und obwohl die britische Presse nicht interessiert war und sie nur mit Mühe Auftritte im eigenen Land bekamen, hatte sich ihr Album im restlichen Europa gut verkauft, und da waren sie nun, in Wien, der ersten Station einer sechstägigen Tournee, und gaben ihr Bestes, um die Essenz dieser Studioaufnahmen in einem Live-Setting wiederzugeben. An diesem Abend, als Mark zur Halbzeit ihres Programms eins seiner Solos spielte und Lorna vom Bühnenrand aus zusah, staunte sie wieder einmal darüber, wie dieser Mann – dieser übergewichtige, unflätige, nachlässig gekleidete, insgesamt recht schäbig aussehende Mann – wie ein Engel Musik machen konnte, wenn er wollte, wie er es schaffte, die Gitarre mit Fingern und Pedalen wie ein ganzes Orchester klingen zu lassen, wie er den Raum mit komplexen Harmonien und Obertönen und fragmentierten Melodielinien füllte, die das junge Publikum in eine Art ekstatische Trance versetzten.
„Ein erbärmlicher Haufen von Wichsern war das heute Abend“, sagte er zu Lorna, als sie anschließend zusammen beim Abendessen saßen.
„Was redest du da? Sie waren begeistert.“
„Ich hatte nicht das Gefühl, viel von ihnen zurückzubekommen“, sagte er. „Ich habe schon lebhaftere Leute in einem Leichenschauhaus gesehen.“
Susanne sah zerknirscht aus, als wäre sie persönlich für das Verhalten des Publikums verantwortlich, daher beeilte sich Lorna, sie zu beruhigen:
„Hör nicht auf ihn. Es war ein tolles Publikum. Ein fantastischer Abend. Das ist seine Art, sich zu bedanken, ob du es glaubst oder nicht.“
Zum Essen hatte sich Ludwig, der Besitzer des Plattenlabels, zu ihnen gesellt. Er hatte sie in ein Lokal namens Café Engländer geführt, das allerdings nichts Englisches an sich hatte: Das Essen war österreichisch und wurde in großzügigen Portionen serviert, darunter ein Schnitzel, das über den Tellerrand hing und groß genug aussah, um selbst Marks Appetit zu stillen.
„Seht euch das an!“, sagte er mit leuchtenden Augen.
Susanne und Ludwig strahlten, stolz darauf, dass ihre nationale Küche auf solche Begeisterung stieß. Nur Lorna, die wieder einen Salat bestellt hatte, blickte skeptisch drein.
„Das ist ungefähr ein Dreiviertelkalb“, flüsterte sie Mark zu, damit die anderen es nicht hören konnten. „Jemand wie du sollte so etwas nicht essen.“
„Jemand wie ich?“, fragte er und nahm sich Kartoffelsalat. „Du meinst jemand, der so fett ist wie ich?“
„Das habe ich nicht gesagt. Ich würde dich nie fett nennen.“
„Gut“, sagte Mark. „Ich bin nämlich nicht fett. Mein Arzt meint, ich sei krankhaft übergewichtig.“
Nach ihrem fast zweistündigen Auftritt hätten Mark und Lorna ein lockeres Gespräch bevorzugt, aber das war nicht Ludwigs Art. Er war Ende fünfzig, hatte gepflegtes graues Haar, einen sorgfältig gestutzten Bart, einen scharfen Verstand und eine elegante und präzise Ausdrucksweise. Kaum stand das Essen auf dem Tisch, kam er auf die britische Politik zu sprechen.
„Wie Sie wissen, Mark, bin ich ein überzeugter Anglophiler. Ich kam 1977 zum ersten Mal nach London, in der Hochphase des Punk. Ich mochte die Musik nicht besonders, aber das Lebensgefühl war faszinierend für einen jungen Mann, der in Salzburg aufgewachsen war, einer ultrakonservativen Stadt ohne jede Gegenkultur, und wenn es sie gab, habe ich davon nichts mitbekommen. Ich weiß noch, dass die Briten in dem Jahr das Silberne Thronjubiläum der Queen feierten, und eine Zeit lang sang man entweder die Nationalhymne oder „God Save the Queen“ von den Sex Pistols. Es war irgendwie bezeichnend für das Land, dass diese beiden Songs zur gleichen Zeit in aller Munde waren. Ich glaube, damals habe ich auch diesen James-Bond-Film gesehen, Der Spion, der mich liebte, und das Publikum jubelte, als sich sein Fallschirm öffnete und einen Union Jack enthüllte. Typisch britisch! Sie schmeicheln sich selbst und lachen gleichzeitig über sich selbst. Ich blieb drei Monate in London, und am Ende dieser Zeit war ich in alles verliebt, was ich dort fand: britische Musik, britische Literatur, britisches Fernsehen, britischen Humor – ich fing sogar an, das Essen zu mögen. Ich spürte, dass es dort eine Energie und einen Erfindungsreichtum wie sonst nirgendwo in Europa gab, noch dazu ohne Selbstgefälligkeit, mit dieser außergewöhnlichen Ironie, die den Briten so eigen ist. Und jetzt macht dieselbe Generation … was? Für den Brexit und für Boris Johnson stimmen! Was ist bloß mit ihnen geschehen?“
Bevor Mark oder Lorna eine Antwort auf diese schwierige Frage geben konnten, fuhr er fort:
„Das geht nicht nur mir so. Diese Frage stellen wir uns alle. Wir reden hier über ein kluges Land, ein Land, zu dem wir alle aufschauen konnten. Und jetzt habt ihr etwas getan, das euch, soweit sich das beurteilen lässt, schwächer und isolierter macht, und dennoch scheint ihr mit euch zufrieden zu sein. Und dann setzt ihr auch noch diesen Witzbold an die Spitze. Was ist bloß los mit euch?“
Mark schaute zu Lorna und fragte: „Wo soll man da anfangen?“
„Vermutlich sollte man damit anfangen“, sagte sie, „dass London und England nicht dasselbe sind.“
„Stimmt“, sagte Ludwig. „Das ist wahr.“
„Und England und der Rest des Vereinigten Königreichs sind auch nicht dasselbe“, fügte Mark hinzu. „Ich bin nicht ohne Grund nach Edinburgh gezogen.“
„Das leuchtet mir auch ein. Aber trotzdem bist du im Herzen Engländer, oder?“
„So würde ich mich nicht definieren. Es ist nicht meine Kernidentität.“
„Ich glaube nicht“, sagte Lorna, ihre Worte sorgfältig wählend, „dass es so etwas wie einen typischen Engländer gibt.“
„Also, ich würde zu gern einen finden“, sagte Ludwig. „Und dann würde ich ihm zwei Fragen stellen: Dieser neue Weg, den ihr in den letzten Jahren eingeschlagen habt – warum genau habt ihr ihn gewählt? Und warum habt ihr euch ausgerechnet diesen Mann ausgesucht, um ihn zu beschreiten?“
In diesem Moment summte Susannes Mobiltelefon. Sie tippte auf das Display, um die SMS zu lesen.
„Wow“, sagte sie. „Sieht so aus, als wärt ihr gerade noch rechtzeitig gekommen.“
„Was meinst du?“
„Eine Nachricht vom Veranstalter. Auf Anweisung der Stadtverwaltung schließen sie ab morgen ihre Türen. Keine öffentlichen Veranstaltungen mehr. Keine Versammlungen mit mehr als fünfzig Personen.“
Die anderen nahmen diese Information zunächst schweigend auf. Die Stimmung war plötzlich düster.
„Tja, das musste ja so kommen“, sagte Ludwig. „Sie reden schon seit Tagen davon.“
„Wenigstens ist es kein totaler Lockdown, wie in Italien“, sagte Susanne.
„Das kommt bestimmt noch“, versicherte Ludwig.
„Wohin fahren wir morgen?“, fragte Mark. „München?“
„Ich werde mich gleich morgen früh mit dem Veranstalter in Verbindung setzen“, sagte Susanne, „und euch mitteilen, was sie sagen. Aber ich bin mir sicher, dass es kein Problem geben wird.“
Lorna aß von ihrem Salat und nahm ein paar Schlucke Weißwein. Er war süßer, als sie es gewohnt war, und ging runter wie Honig. Sie sah sich im Lokal um und dachte, was für ein schöner Moment das für sie war: so anders als ihr Leben in Handsworth, so anders als ihr Arbeitsalltag – eine Welt voller einladender Gesichter, gleichgesinnter Menschen, Freundlichkeit und Gemütlichkeit. Sie hoffte, dass ihr dieser Moment nicht entrissen würde, bevor sie Zeit hatte, ihn auszukosten.
*
Am nächsten Morgen brachte Susanne sie zum Westbahnhof, um sie pünktlich in den Acht-Uhr-Zug zu setzen. Inzwischen sah sie besorgt aus. Mark und Lorna hatten auf ihrer Tournee noch fünf Stationen vor sich: München, Hannover, Hamburg, Berlin und Leipzig. Es schien nun wahrscheinlich, dass zumindest ein paar dieser Auftritte abgesagt werden würden, obgleich jedes deutsche Bundesland diese Entscheidung unabhängig und nach eigenem Gutdünken traf.
„Das Problem ist, wenn eins der Länder vorprescht, sehen sich die anderen gezwungen, zu folgen. Und ich werde nicht dort sein, um sicherzustellen, dass bei euch alles glatt läuft.“
„Wir kommen schon klar“, sagte Mark. „Wenn sie dichtmachen, ziehen wir uns einfach warm an und spielen im Freien. Improvisieren. Mark Irwin und Lorna Simes unplugged.“
„Oh, das würde ich ungern verpassen!“, sagte Susanne.
„Wir nehmen es auf, und du kannst es als Live-Album rausbringen.“
Sie lächelte tapfer. Dann schickte sie sich an, Lorna zum Abschied zu umarmen, wie sie es keine sechsunddreißig Stunden zuvor am Flughafen zur Begrüßung getan hatte. Doch im letzten Moment überlegten es sich beide anders und machten stattdessen jene unbeholfene Geste, die inzwischen üblich war, und stießen kurz ihre Ellbogen gegeneinander, was sich wie ein schwacher Abklatsch einer normalen menschlichen Berührung anfühlte. Mark wollte davon nichts wissen. Er legte seine Arme um Susanne und drückte sie etwa zehn Sekunden lang gegen seinen weichen, vorstehenden Bauch.
„Sorry, aber kein blödes Virus sollte uns davon abhalten, unsere Gefühle zu zeigen“, sagte er. „Du warst großartig. Lade uns wieder ein, wenn du kannst, ja?“
„Unbedingt. Bald wird alles wieder normal sein und dann kommt ihr zurück.“
„Super.“
Er küsste sie auf die Stirn, und dann begannen er und Lorna mit dem mühsamen Verladen ihrer Sachen in den Zug.
Es war eine vierstündige Reise, und Lorna genoss jede Minute davon. Die Spätwintersonne schien hell und die Landschaft verwandelte sich, während sie die Grenze von Österreich nach Deutschland überquerten. Wie eine Touristin machte sie Dutzende von Fotos von den schneebedeckten bayerischen Alpen und den Städtchen und Dörfern, die sich an die Berghänge schmiegten. Sie schickte ein paar Bilder an Donny und Gran, aber keiner von beiden antwortete. Auf dem Fensterplatz ihr gegenüber döste Mark vor sich hin, schnarchte gelegentlich und wachte dann mit einem Ruck auf. Lorna vermutete, dass er in der Nacht zuvor wenig geschlafen hatte. Er war nach dem Abendessen nicht mit ihr ins Hotel zurückgegangen, sondern hatte über eine Dating-App einen Typ gefunden und war zu einem Club gefahren, um ihn zu treffen. Sie fragte lieber nicht nach, was dann passiert war.
Neben dem schlafenden Mark saß eine schlanke, gut gekleidete Frau, die in einer deutschen Ausgabe der Vogue blätterte. Lorna sah fasziniert zu, wie sie mit einiger Mühe die Seiten umblätterte, denn sie trug dünne beige Lederhandschuhe. Obwohl es im Abteil warm war und die Frau ihren Mantel und ihre Jacke ausgezogen hatte, behielt sie die Handschuhe während der gesamten Fahrt an.
*
Das Virus verfolgte sie weiter durch Deutschland. In München, Hannover, Hamburg und Berlin hatten sie noch Glück: Die Spielstätten blieben geöffnet, bis ihr Auftritt vorbei war, aber am darauffolgenden Tag schlossen nacheinander alle vier ihre Türen. Der Ablauf war jeden Abend derselbe: Soundcheck, gefolgt von einem Auftritt, gefolgt von einem raschen Abendessen mit den Veranstaltern. Bei diesen Mahlzeiten kamen sie stets auf das Virus zu sprechen, auf die Maßnahmen, die von den staatlichen Behörden angekündigt wurden, auf neue Begriffe wie „Social Distancing“ und „Herdenimmunität“, die die Leute jetzt wie Experten gebrauchten, auf die Epidemie nervöser Witze über das Händewaschen und den Namaste-Gruß und das Vermeiden des Händeschüttelns, auf die beängstigenden Berichte über den Lockdown in Wuhan, auf Spekulationen darüber, wie Italien mit seinem Lockdown zurechtkommen würde und ob andere europäische Länder bald nachziehen würden. Diese Gespräche waren meist locker und unbeschwert, mit einem Unterton ungläubiger Besorgnis, einem Gefühl, dass die Dinge, über die sie sprachen, nicht wirklich geschehen konnten oder im Geschehen begriffen waren. Die Veranstalter hatten auch mit unmittelbaren, praktischen Sorgen zu kämpfen: wie lange diese Schließungen andauern würden, wie sie ihr Personal und die Miete bezahlen sollten, ob sie genügend Geld auf dem Konto hatten, um die bevorstehende Krise zu überstehen. Es waren beunruhigende Gespräche, wenn man darüber nachdachte, aber Wein und Essen, Lachen und menschliche Wärme machten sie nicht nur erträglich, sondern angenehm.
Der Gig in Berlin war wahrscheinlich der beste von allen. Mark lief an diesem Abend zur Höchstform auf. Fast schien es, als wüsste er, dass dies ihr vorerst letzter Auftritt sein würde, und er nutzte die Gelegenheit, um noch einmal alles zu geben, verlor sich in der Musik, gab sich ihr völlig hin, mit einer Versunkenheit und Selbstvergessenheit, die Lorna nicht für möglich gehalten hätte. Sein Spiel war auch großzügig: großzügig ihr gegenüber. Als Bassistin hätte sie nur eine unterstützende Rolle spielen können, aber das ließ er nie zu, gab ihr immer das Gefühl, eine gleichberechtigte Partnerin zu sein. Aber an diesem Abend wusste sie, dass er auf einem anderen Level spielte und sie nicht in der Lage war, mit seinen gelassenen Improvisationen, seinem wunderbaren Flow mitzuhalten. Das war in Ordnung. Es war ein Privileg, an seiner Seite zu sein. Sie spielten an einem seltsamen Ort, dem Keller eines Plattenladens im ehemaligen Ostberlin, nicht weit vom Fernsehturm entfernt. Der Raum fasste höchstens siebzig Zuschauer und war zum Bersten voll. Hin und wieder ertappte sich Lorna dabei, wie sie in die dicht gedrängte Menge junger Berliner blickte und daran dachte, wie sie ein- und ausatmeten, sich gegenseitig berührten, die Stühle berührten und dann die Stühle berührten, die von anderen berührt worden waren, manchmal sogar husteten, und sie stellte sich vor, wie dieser winzige tödliche Organismus, der gerade erst in ihr Bewusstsein gedrungen war, von einer Person zur anderen sprang, von Wirt zu Wirt, auf der Suche nach seiner nächsten Bleibe, der nächsten Gelegenheit, sich zu vermehren und zu töten. In solchen Augenblicken merkte sie, dass ihre Konzentration schwand und sie Mark im Stich ließ, dass sie den Vertrauenspakt brach, der zwischen zwei Musikern auf der Bühne besteht. Rasch riss sie sich zusammen und versuchte, sich wieder auf ihr Spiel zu konzentrieren. Ein paar Mal kam es vor, dass sie und Mark gleichzeitig dasselbe Maß an Intensität erreichten, und dann, nur für wenige Sekunden, geschah etwas Magisches, und während dieser kostbaren Momente vergaßen sie und das Publikum alles um sich herum, die Zeit stand still, und so etwas wie Glückseligkeit erfüllte den Raum. Das waren die Momente, für die sie lebte, aber manchmal spielten sie ein komplettes Programm, ohne dass sich ein solcher Rausch einstellte. An diesem Abend in Berlin hatten sie Glück: Das Nirwana war zum Greifen nah, und als sie anschließend zum Essen gingen, waren sie noch immer in Hochstimmung.
Doch als Mark und Lorna am nächsten Morgen in Leipzig eintrafen, wartete im Hotel eine Nachricht auf sie: Der Auftritt an diesem Abend, der letzte der Tournee, war abgesagt worden.
Sie standen niedergeschlagen in der Lobby und fühlten sich fehl am Platz. Lorna klammerte sich an ihren riesigen glänzenden Instrumentenkoffer, dessen Größe noch absurder erschien als sonst.
Sie riefen Susanne an, die ihr Mitgefühl bekundete. „Ich hab euch ja gesagt, dass das passieren würde“, meinte sie. Sie bot ihnen an, einen Rückflug für denselben Tag zu buchen, aber sie wussten, dass dies zusätzliche Kosten verursachen würde, die sich die Plattenfirma nicht leisten konnte.
„Nicht nötig“, sagte Mark. „Wir werden einfach abhängen und morgen früh den Flug nehmen, den du für uns gebucht hast. Mach dir keine Sorgen um uns, wir kommen schon klar. Heute Nachmittag schauen wir uns eben die Stadt an.“
Lorna wusste, dass ihr nichts anderes übrigblieb als Sightseeing, aber ihre Begeisterung hielt sich in Grenzen. Natürlich hatten sie unter den gegebenen Umständen Glück, sehr viel Glück gehabt – schließlich hatten sie die Tournee fast zu Ende gebracht und nur einen einzigen Auftritt verpasst; dennoch war die Enttäuschung groß. Sie ließ Mark seinen Spaziergang machen (wo auch immer er ihn hinführen würde) und blieb in ihrem Hotelzimmer, wo sie zwischen den Fernsehkanälen hin und her zappte, bis sie beschloss, ein letztes Mal Gran anzurufen. Die Nachrichten über das Virus waren inzwischen ziemlich besorgniserregend. Lorna bekam richtig Angst, den Leuten zu nahe zu kommen, ihre Hände zu schütteln, angeatmet zu werden, sich anzustecken. Was Gran betraf, so war sie sechsundachtzig, und obwohl sie (abgesehen von ihrem Aneurysma) fit und gesund war, würde sie eine Infektion wahrscheinlich nicht so leicht wegstecken. Sie schien neuerdings eine recht unbekümmerte Einstellung zu ihrer Gesundheit zu haben, und Lorna hielt es für angebracht, ihr klarzumachen, dass sie in den kommenden Wochen unbedingt vorsichtig sein musste.
Diesmal ertönte der Skype-Ton nur drei oder vier Mal, bevor am anderen Ende eine Antwort kam. Und zur Abwechslung war es nicht die hohe, faltige Stirn von Gran, die zitternd auf dem Bildschirm erschien, sondern das Gesicht von Peter, dem jüngeren Bruder ihres Vaters – vollständig sichtbar und perfekt zentriert.
„Oh, hallo“, sagte sie. „Ich wusste nicht, dass du zu Besuch bist.“
„Ich habe mich erst heute Morgen dazu entschlossen“, sagte er.
„Bist du von Kew hochgefahren?“
„Ja, ich bin vor einer Stunde angekommen.“
Onkel Peter lebte allein in einem kleinen Reihenhaus, etwa eine halbe Meile von Kew Gardens im Südwesten Londons entfernt. Es war eine zweistündige Fahrt zu seiner Mutter, aber er fuhr regelmäßig hin, alle zwei oder drei Wochen. Sie war seit mehr als sieben Jahren Witwe, und obwohl sie sich inzwischen daran gewöhnt hatte, wusste er – genau wie Lorna –, dass es Phasen gab, in denen sie die Einsamkeit nur schwer ertragen konnte. Er hielt es für seine Pflicht, sie zu besuchen, wann immer er konnte.
„Du möchtest bestimmt mit Gran sprechen“, sagte er. „Ich hole sie.“
Lorna starrte auf den Schirm, der leer blieb, bis ein großer, stattlicher Kater, dessen Fell eine lebhafte Collage aus schwarzen und weißen Flecken war, auf der Bildfläche erschien und mit vorwurfsvollen grünen Augen in die Kamera blickte, bevor er sich umdrehte und ihr schamlos sein Hinterteil präsentierte. „Charlie, geh vom Tisch runter!“, hörte sie Peter sagen, und eine Hand streckte sich aus, um das mauzende Geschöpf, Grans treuen Begleiter, sanft aus dem Blickfeld zu befördern. Danach füllten zwei Gesichter den Bildschirm, den Peter auf Querformat gedreht hatte. Gran sah sehr zufrieden aus. Ihre Augen leuchteten vor Glück, in der Gesellschaft ihres jüngsten Sohnes zu sein. Es lag auch ein Hauch von Triumph darin.
„Sieh mal, wer heute Morgen vor meiner Tür stand“, sagte sie.
„Das ist schön“, sagte Lorna. „Wie lange bleibt er denn?“
„Du bleibst doch über Nacht, oder?“, sagte Gran, an Peter gewandt.
„Oh ja.“ Dann fragte er Lorna: „Und wo bist du gerade?“
„In Leipzig“, sagte sie. „Aber der Gig heute Abend wurde abgesagt.“
„Oh nein! Etwa wegen dem Virus?“
„Hier macht alles dicht, in ganz Deutschland.“
„Sei bloß vorsichtig“, sagte Gran. „Atme keine Keime ein. Und wasch dir immer die Hände. Das müssen wir anscheinend alle tun. Ständig die Hände waschen.“
„Ich habe in zwei Wochen ein Konzert“, sagte Peter. „Ich frage mich, ob das stattfinden wird.“
„Kommst du morgen trotzdem nach Hause?“, fragte Gran.
„Ja.“
„Donny wird bestimmt froh sein, dich gesund und munter wiederzuhaben. Was fängst du mit dem restlichen Tag an?“
„Ich weiß noch nicht.“
„Du solltest die Familiengräber besuchen“, sagte Peter unvermittelt.
„Was?“
„Irgendwo in Leipzig sind Mitglieder unserer Familie begraben.“
„Wirklich?“
„Ja. Das stimmt doch, Mum?“
„Also, davon weiß ich nichts. Aber dein Urgroßvater“, sagte sie zu Lorna, „war Deutscher.“
„Wirklich?“, sagte Lorna. „Du meinst, dein Vater?“
„Nein, nicht mein Vater. Großvaters Vater.“
Peter funkte dazwischen, um sie zu korrigieren: „Nicht sein Vater. Sein Großvater.“
Gran sah kurz verwirrt aus und stimmte dann zu: „Ach ja. Großvaters Großvater.“
„Also mein Ur-Urgroßvater“, sagte Lorna.
Gran wandte sich hilfesuchend an Peter: „Stimmt das?“
„Stimmt. Du meinst Carl.“
„Genau. Carl. Geoffreys Großvater.“
„Und der kam aus Leipzig?“, fragte Lorna.
„Ach, das weiß ich nicht. Aber er hatte einen starken deutschen Akzent. Ich habe ihn kaum verstanden.“
„Ja, er kam aus Leipzig“, sagte Peter mit Nachdruck. „Ich habe den Stammbaum erstellt.“
„Wie hieß er mit Nachnamen?“, fragte Lorna, plötzlich angetan von der Vorstellung, alte Friedhöfe zu besuchen und die Gräber vergessener Vorfahren ausfindig zu machen.
„Schmidt“, sagte Peter. „Carl Schmidt.“
„Oh“, sagte Lorna. „Das grenzt es nicht besonders ein.“
„Nein. Eher eine Nadel im Heuhaufen.“
„Vielleicht sollte ich einfach in ein Museum gehen.“
„Gute Idee.“
„Sei ja vorsichtig“, sagte Gran. „Und wasch dir um Himmels willen die Hände.“
Sie verabschiedeten sich von Lorna und Gran ging in die Küche, um Tee zu machen, bereits die dritte Kanne an diesem Tag. Peter folgte ihr und stellte sich ans Küchenfenster, während sie mit Tassen und Teebeuteln hantierte. Er blickte hinaus in den Garten: Die Blumenbeete, auf denen er als Junge herumgetrampelt war und deswegen Schelte bekommen hatte; das abschüssige Rasenstück, auf dem er Schlitten gefahren war, wenn der Winter sich zu Schnee herabließ; der wuchernde Essigbaum, dessen skelettartigen Äste und lindgrünen Blätter ihm während langer Lesenachmittage und Tagträume so vertraut geworden waren; eine ganze Miniaturlandschaft, die er seit seinem zehnten Lebensjahr kannte und die sich in den darauffolgenden neunundvierzig Jahren kaum verändert hatte. Die Familie war 1971 hierhergezogen. Zuvor hatten sie ein paar Meilen entfernt in Bournville gelebt, wo seine Mutter zur Welt gekommen war und ihre eigene Kindheit verbracht hatte. Sie würde dieses Haus nie verlassen, da war er sich sicher, obwohl es viel zu groß für sie war. „Ich werde hier sterben“, pflegte sie neuerdings zu sagen, als hätte sie das Gefühl, dass dieses Ereignis näher rückte. Unweit ihres Herzens wuchs ein Aortenaneurysma, eine Aussackung der Hauptschlagader. Stück um Stück, Millimeter um Millimeter, Jahr für Jahr. Es war inoperabel, hatte der Herzspezialist zu ihr gesagt.
„Wird es platzen?“, hatte sie ihn gefragt.
„Vielleicht“, hatte er geantwortet. „In einem Jahr, oder in zwei Jahren, oder in fünf oder zehn. Vielleicht haben Sie Glück.“
„Und was passiert, wenn es platzt?“, hatte sie gefragt.
„Das“, hatte er gesagt, „nennt man dann ein ‚letales Ereignis‘.“
Seitdem bezeichnete sie das Aneurysma als ihre „tickende Zeitbombe“. Sie konnte nichts tun, außer ihr Leben fortzuführen, den Umstand zu verfluchen, dass sie nicht mehr Auto fahren durfte, und das Beste zu hoffen. Oder zu hoffen, dass sie vorher an etwas anderem starb, denn in ihrem Alter musste es einen doch erwischen, oder? Eher früher als später. Sie hatte nie viel über die Zukunft nachgedacht und genauso wenig gefiel es ihr, in der Vergangenheit zu schwelgen. Sie lebte im Hier und Jetzt, eine Strategie, die ihr fast ein ganzes Jahrhundert lang gut bekommen war.
Peter fand diese Neigung seiner Mutter, nur in der Gegenwart zu leben, dennoch frustrierend. In den letzten Jahren hatte er ein ausgeprägtes Interesse an der Familiengeschichte entwickelt, eine Besessenheit, die mit dem Tod seines Vaters begonnen und sich noch verstärkt hatte, seit seine Beziehung in die Brüche gegangen war und er wieder allein lebte und zu viel Zeit hatte. Er durchsuchte Archive im Internet und sichtete bei jedem Besuch die Unterlagen im Haus seiner Mutter, aber die Quelle, die er unbedingt anzapfen wollte, waren ihre Erinnerungen, und dieses Unterfangen erwies sich als harte Nuss. Nicht, weil ihr Gedächtnis nachließ, sondern weil die Vergangenheit ein Thema war, das sie offenbar nicht interessierte.
Jedes bisschen Information, das er ihr entlocken konnte, wurde ihm nur widerwillig gewährt, und doch war sie die letzte Überlebende ihrer Generation, die Einzige, die sich noch an Familiengeschichten aus den 1940er- und 50er-Jahren erinnerte. Was konnte sie ihm zum Beispiel über den vergessenen Carl Schmidt, den Großvater ihres verstorbenen Mannes, erzählen, der in den 1890er-Jahren unter mysteriösen Umständen nach Birmingham gekommen war und dort zwei Weltkriege erlebt hatte – Kriege, in denen sein Heimatland der Feind gewesen war? Wie stand er dazu? Was für ein Mensch war er?
„Ach, ich kann mich kaum an ihn erinnern“, sagte sie. „Ich war ja noch so jung. Aber er wirkte sehr streng und furchterregend. Ich hatte schreckliche Angst vor ihm.“
Sie saß mit Charlie auf dem Schoß in einem Sessel am Erkerfenster und griff nach dem Daily Telegraph, der beim Kreuzworträtsel aufgeschlagen war. Der Kater schnurrte zufrieden in seinem Fleckchen Sonnenschein.
„Also, mal sehen …“, sagte sie. „sieben waagerecht, ‚en vogue‘ – sieben Buchstaben, beginnend mit M.“
Es war ein plumper Versuch, das Thema zu wechseln, was Peter nicht hinnahm.
„An irgendwas musst du dich doch erinnern“, sagte er.
„Modisch“, sagte Gran und schrieb es mit Bleistift in die Kästchen.
„Ich meine, wann bist du ihm zum ersten Mal begegnet?“
Sie seufzte, denn sie wusste, dass Peter keine Ruhe geben würde, wenn er sie auf diese Weise bedrängte.
„Also, das weiß ich noch genau.“
„Wann war das?“
„Bei Kriegsende.“
„Also so um 1944, 1945?“
„Oh nein, ich meine ganz am Ende.“ Sie nahm einen vorsichtigen Schluck Tee, der noch zu heiß war. „Als alles vorbei war“, sagte sie. „Victory-in-Europe-Day und der ganze Kokolores.“
EINS
Die Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa
8. Mai 1945
1
Die Luft roch nicht nach Schokolade, aber Schokolade lag in der Luft. Man brauchte die Fabrik, die mitten im Dorf stand, nicht näher zu bezeichnen: Sie wurde einfach nur „das Werk“ genannt. Und in diesem Werk stellten sie Schokolade her. Seit mehr als sechzig Jahren wurde dort Schokolade hergestellt. John Cadbury hatte 1824 sein erstes Geschäft im Zentrum von Birmingham eröffnet, wo er gemahlene Kakaobohnen für heiße Schokolade verkaufte. Genau wie seine Brüder war er ein gläubiger Quäker und betrachtete das Getränk daher nicht nur als nahrhaften Bestandteil des Frühstücks, sondern auch als gesunden Ersatz für Alkohol zu jeder Tageszeit. Der Betrieb war stetig gewachsen, die Belegschaft hatte sich vervielfacht, größere Räumlichkeiten wurden erworben, und 1879 beschlossen seine Söhne, die Produktion von Birmingham aufs Land zu verlegen. Das Gelände, das sie auswählten, bestand damals größtenteils aus hügeligem Weideland. Ihre Vision: Industrie und Natur sollten im Einklang, in Symbiose, in gegenseitiger Abhängigkeit existieren. Am Anfang war die Fabrik klein. Ein einstöckiges, rotes Backsteingebäude, das von drei Seiten durch großzügige Fenster lichtdurchflutet war und den Blick auf die Grünflächen ringsum freigab. Neben der Fabrik befanden sich Sportplätze, Gärten und ein Kinderspielplatz. Das Stadtzentrum schien hier weit weg zu sein. Der Ort bezeichnete sich selbst als Dorf und fühlte sich auch so an. Die Arbeiter mussten von weither anfahren und trafen am Bahnhof ein, der damals noch Stirchley Street hieß. Das konnte nicht lange gut gehen, denn Ende des 19. Jahrhunderts war die Zahl der Beschäftigten im Werk von zweihundert auf mehr als zweieinhalbtausend gestiegen. Im Jahr 1895 erwarb das Unternehmen weitere Grundstücke rund um die Fabrikgebäude, und schon bald standen den Arbeitern größere Freizeitgelände und ein Kricketplatz zur Verfügung. Doch damit waren die Ambitionen der Familie Cadbury nicht erschöpft. Ihre Vorstellung vom Wohnen: erschwingliche Häuser, gut gebaute Häuser, Häuser mit weitläufigen Gärten, in denen Bäume gepflanzt und Obst und Gemüse angebaut werden konnten. Das Quäkertum stand nach wie vor im Mittelpunkt ihres Projekts, und ihr Ziel war „die Verbesserung der Lebensbedingungen der Arbeiterklasse und der werktätigen Bevölkerung in und um Birmingham durch die Bereitstellung besserer Wohnungen mit Gärten und Freiflächen, die der Erholung dienen“. Wann immer es möglich war, kauften sie weitere Grundstücke in diesem Landstrich südlich von Birmingham auf, um zu verhindern, dass sie profitgierigen, weniger visionären Unternehmern in die Hände fielen. Und so wuchs das Dorf, streckte sich, dehnte sich aus, brachte Triebe hervor, gedieh wie eine Pflanze, bis es Hunderte von Hektar umfasste und aus mehr als zweitausend Häusern bestand, von denen viele, wenngleich nicht alle, von Cadbury-Arbeitern bewohnt wurden, und obwohl es bald ringsum von anderen, gewöhnlicheren Vorstädten umgeben und begrenzt war, von Stirchley und Cotteridge und Small Heath und King’s Heath und King’s Norton und West Heath und Northfield und Weoley Castle und Selly Oak, verlor dieses Dorf dennoch nie seinen Charakter. Das Zentrum war der Dorfanger. In der Nähe des Angers stand die Grundschule mit ihrem Glockenturm, von dem das berühmte Glockenspiel erklang. Um die Schule herum verliefen die Woodbrooke Road, die Thorn Road und die Linden Road, Durchgangsstraßen, die, wie viel Verkehr sie in den kommenden Jahren auch erdulden mussten, irgendwie stets die Ruhe bewahrten, eine pastorale Erinnerung an Schatten und Laub, wie sie schon in ihren Namen anklang.
Wie sollte er heißen, dieser besondere Ort? Man hätte meinen können, dass das Dorf mit seinen Cottages und Spielplätzen, seinem Bootsteich und den Kricketspielern mit ihren weißen Fahnen ein Archetyp, ja fast schon die Parodie einer bestimmten Vorstellung von Englishness war. Der kleine Bach, der sich durch sein Zentrum schlängelte, wurde Bourn genannt, und viele erwarteten, dass Bournbrook der Ortsname sein würde. Aber dies war ein Dorf, das auf Unternehmertum gegründet war, und dieses Unternehmertum bestand darin, Schokolade zu verkaufen, und selbst in den Herzen der Cadburys, dieser Pioniere der britischen Schokoladenherstellung, hielt sich hartnäckig das Gefühl, dass ihr heimisches Produkt mit der Konkurrenz vom Kontinent nicht mithalten konnte. Hatte feinste Schokolade nicht etwas durch und durch Europäisches an sich? Die Bohnen selbst stammten natürlich seit jeher aus den entlegensten Winkeln des Empire – daran war nichts Unbritisches –, aber die Methode, sie in genießbare Schokolade zu verwandeln, war von einem Holländer erfunden worden, und es war eine allgemein anerkannte (wenngleich unausgesprochene) Tatsache, dass die Franzosen, die Belgier und die Schweizer die Herstellung von Schokolade seither nahezu perfektioniert hatten. Wenn die Cadbury-Schokolade auf diesem Gebiet jemals ein ernsthafter Konkurrent sein wollte, musste ihr Markenname einen Hauch von europäischer Raffinesse und kontinentaler Kultiviertheit verströmen.
Man beschloss also, dass „Bournbrook“ nicht genug war, und entschied sich für eine elegantere Variante: Bournville. Der Name eines Dorfes, das nicht nur auf Schokolade gegründet worden war und sich ihr verschrieben hatte, sondern das regelrecht von Schokolade herbeigeträumt worden war.
2
Am Morgen des 7. Mai, einem Montag, gab es noch immer keine eindeutigen Nachrichten. Der Krieg war offenbar zu Ende, aber der Frieden hatte noch nicht begonnen. Die Menschen wurden ungeduldig und warteten auf eine Verlautbarung: Sollten sie weiter zur Arbeit gehen? Wann durften sie endlich feiern? Nach fast sechs Jahren der Opfer und Entbehrungen war es wohl nicht zu viel verlangt, ein paar Lieder anzustimmen und Freudenfeuer zu entzünden und die Pubs länger geöffnet zu lassen. Samuels Nachbar, Mr. Farthing, sagte im Gespräch über den Zaun hinweg, es sei eine verdammte Schande (entschuldigen Sie seine Ausdrucksweise), und Sam stimmte ihm zu und meinte, die Regierung würde sich Ärger einhandeln, wenn sie ihnen nicht gestattete, ein bisschen über die Stränge zu schlagen und sich zu amüsieren. Die Leute würden sich bei den nächsten Wahlen daran erinnern.
Doll hatte ihre Meinungen über Politik, wurde aber nie gebeten, sich an solchen Gesprächen zu beteiligen. Während ihr Mann und Mr. Farthing am Gartenzaun die Welt zurechtrückten, warf sie einen Blick auf die Standuhr im Flur und holte ihren Besen aus dem Schrank unter der Treppe hervor. Sie war ein Gewohnheitsmensch. An jedem Werktag ging sie um drei viertel elf nach draußen, um die Stufen vor der Haustür zu fegen, und zwar aus einem ganz bestimmten Grund: Um diese Zeit hatten die Kinder in der Schule auf der anderen Straßenseite große Pause. Doll ging gern kurz vor Beginn hinaus, um erst einmal ein paar Minuten lang die gewohnte, tiefe Stille von Bournville zu dieser Stunde zu genießen. Dann hörte sie, wie der Lehrer mit der Handglocke läutete, und gleich darauf ging es los: das langsam anschwellende Gewirr heller Stimmen, erst gedämpft und undeutlich, dann plötzlich aus voller Kehle, wenn die Portale der Schule aufgerissen wurden und siebenundachtzig Kinder auf den Schulhof stürmten. Doll liebte die Stille, die den größten Teil des Tages in ihrem Dorf herrschte, aber noch mehr liebte sie den Klang der nächsten fünfzehn Minuten. Sie liebte den Lärm der Kinder, die sich gegenseitig beim Namen riefen, das aufgeregte Kreischen, die Reime und Necklieder und die Laute des Seilspringens. Keins dieser Geräusche war deutlich zu hören oder von den anderen zu unterscheiden: Alles verschmolz zu einem Chor, einem wunderbar chaotischen Medley kindlicher Stimmen (zumal Doll wusste – und das trug erheblich zu ihrem Vergnügen bei –, dass die Stimme ihrer eigenen Tochter auch irgendwo dazwischen war, obwohl sie sie nicht ausmachen konnte). Wie sie mit dem Besen in der Hand vor der Haustür stand und dem Geschrei der Kinder lauschte, hatte Doll das Gefühl, sich gleichzeitig in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft zu befinden: Es erinnerte sie an ihre eigene Kindheit, ihre eigene Schulzeit vor mehr als dreißig Jahren, an die kleine Volksschule in Wellington, Shropshire, eine ferne und doch lebendige Erinnerung, aber es erinnerte sie auch daran, dass diese schreienden und singenden Kinder diejenigen waren, die die Last der kommenden Jahre auf ihren Schultern tragen würden, die das Land nach sechsjähriger Bedrängnis wiederaufbauen und die Erinnerung an den Krieg begraben würden. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft: Das war es, was sie hörte, als sie den Stimmen der Kinder auf dem Pausenhof lauschte. Wie ein murmelnder Fluss, wie die einsetzende Flut, ein ferner Kontrapunkt zum Zisch, Zisch, Zisch ihres Besens auf der Treppe, eine körperlose Stimme, die ihr immer wieder das Mantra ins Ohr flüsterte: Alles verändert sich, und alles bleibt beim Alten.
*
Als Gewohnheitsmensch trat Doll auch am nächsten Morgen um drei viertel elf vor die Tür, wohl wissend, dass sie diesmal keine Kinder hören würde. Die Schulen blieben heute geschlossen. Doch selbst an diesem bedeutsamen Morgen erschien ihr die Stille in Bournville durchdringender denn je. Am Abend zuvor war endlich die Ankündigung im Radio gekommen: zwei Tage Feierlichkeiten. Aber wer erwartet hatte, dass auf den Bürgersteigen dieser beschaulichen, von Bäumen gesäumten Straßen mit ihren endlosen Reihen ruhiger, gleichmütiger Häuser spontane Freudentänze und feuchtfröhlicher Rabatz losbrechen würden, hatte sich getäuscht. Die Straßen waren, wenn überhaupt, noch leerer als sonst, und die Stille war, wenn überhaupt, noch vollkommener. Sie wurde erst durchbrochen, als Doll mit dem Fegen fertig war und gerade wieder hineingehen wollte. In diesem Moment hörte sie Schritte auf dem Gehweg, und als sie sich umdrehte, um zu sehen, wem sie gehörten, sah sie Mr. Tucker aus Nummer 18 vorbeigehen. Trotz der Hitze trug er seine schwarze Melone und seinen dicksten Kammgarnmantel.
„Morgen, Mr. T.“, sagte sie, begierig auf ein Schwätzchen. „Wieso sind Sie denn fürs Büro gekleidet? Hat man es Ihnen nicht gesagt?“
„Hat man nicht“, erwiderte er in seiner üblichen gezierten und entrüsteten Art. „Ich bin wie immer mit der Straßenbahn in die Stadt gefahren, und erst als ich am Büro ankam, habe ich gemerkt, dass etwas nicht stimmte. Die Eingangstür war verschlossen und es gab keine Erklärung dafür. Sie hätten wenigstens einen Zettel an die Tür hängen können. Das wäre nicht zu viel verlangt gewesen.“
„Wie ärgerlich. Jetzt sind Sie ganz umsonst in die Stadt gefahren. Wahrscheinlich sind sie davon ausgegangen, dass alle über das Radio davon erfahren würden.“
„Ich besitze kein Radio“, sagte Mr. Tucker.
„Tja. Aber wenigstens haben Sie jetzt zwei Tage frei und können sich mit den anderen amüsieren. Heute Abend gibt es ein Freudenfeuer in Rowheath.“
„Mir wird etwas Besseres einfallen“, sagte Mr. Tucker. „Das dürfte nicht allzu schwer sein.“
Er wollte sich gerade auf den Weg machen, aber selbst ihm war aufgefallen, dass Doll irgendwie anders aussah als sonst, und er kam nicht umhin, sie darauf anzusprechen: „Mrs. Clarke – was, wenn ich fragen darf, haben Sie da auf dem Kopf?“
Er meinte ein Blatt Zeitungspapier, das zu einem groben dreieckigen Etwas gefaltet und mit roten, weißen und blauen Streifen verziert war und auf Dolls kastanienbraunem Haar saß.
„Das ist ein Hut“, sagte sie. „Mary bastelt sie schon den ganzen Morgen. Soll ich sie bitten, einen für Sie zu machen?“
„Danke, nein“, sagte er. „Natürlich darf jetzt gefeiert werden, aber nichtsdestotrotz gibt es so etwas wie Würde. Die sollte man nicht verlieren.“
Er ging weiter und stolperte kurz über die Wurzel der Linde, die aus dem Gehweg hervorwuchs. Doll verkniff sich ein Lachen, als er versuchte, so zu tun, als wäre nichts geschehen, und seinen Weg fortsetzte. Sie sah ihm nach und dachte, dass er zwar merkwürdig war, aber niemanden störte, weil er allein in der Nummer 18 wohnte und nie Lärm oder Schwierigkeiten machte, seinen Garten in Ordnung hielt und sämtliche Fenster- und Türrahmen alle zwei oder drei Jahre frisch strich. Sie hatten wirklich Glück mit den Nachbarn. Bournville war ein niveauvoller Ort. Die Leute hier waren etwas Besseres, und das war wichtig für Doll, die in ihren drei wesentlichen Glaubenssätzen nie einen Widerspruch gesehen hatte: ihrem Christentum, ihrem Sozialismus und ihrem Snobismus.
Sie sah, wie Mr. Tucker die Haustür aufschloss, sich noch einmal umdrehte und einen letzten verächtlichen Blick auf ihren Papierhut warf, bevor er im Haus verschwand. Seine Schritte waren fast lautlos gewesen, aber jetzt, wo er weg war, kehrte sogleich die vollkommene, unheimliche Stille zurück.
Welch seltsame Atmosphäre heute im Dorf herrschte. Alle wirkten unruhig, einerseits aufgeregt, andererseits erschöpft, als wären sie hin- und hergerissen zwischen der Freude darüber, dass der Krieg endlich vorbei war, und der Freiheit, sich einzugestehen, was für eine Qual er gewesen war, wobei Letzteres dazu einlud, in eine müde Depression zu verfallen. Doll war nervös. Sie freute sich auf das Feuer in Rowheath am Abend, aber was sollten sie bis dahin tun? Wie sollten sie den Tag rumbringen? Sam war angewiesen worden, sich freizunehmen, und saß im Wohnzimmer, in Marys Comicheft vertieft. Zurück im Haus, warf Doll einen Blick durch die Wohnzimmertür und war zunächst verärgert, als sie sah, wie er sich auf dem Sessel fläzte, ohne sie zu bemerken, und fröhlich einen Comic für Zehnjährige las. Doch das Lächeln in seinem Gesicht, das kindliche Leuchten in seinen Augen, während er den neuesten Heldentaten von Desperate Dan und seinem enormen Appetit auf Fleischpasteten folgte, stimmte sie milde. Der Gedanke, dass er im Herzen noch ein kleiner Junge war, machte sie froh, und er hatte sich dieses alberne kleine Vergnügen wahrlich verdient, nach allem, was er in den letzten Jahren durchgemacht hatte, nach all den Nächten, die er auf dem Dach des Werks verbracht hatte, um nach Bränden in der Stadt Ausschau zu halten, während die Flugzeuge heranflogen, wo er eigentlich gemütlich bei ihr im warmen Bett hätte liegen sollen. (In den meisten Nächten war es nicht ihr Mann gewesen, der ihr Bett teilte und sich an die Rundungen ihres Körpers schmiegte, wie es sich gehörte, sondern Mary, die zusammengerollt schlief und ihren Teddybären an die sich langsam hebende und senkende Brust drückte, um Doll mit dem regelmäßigen Auf und Ab ihres arglosen, pfeifenden Atems in einen unruhigen Schlummer zu wiegen.) Anstatt ihn also zu tadeln, sagte sie nur neckend:
„Du holst wohl die Lektüre deiner Kindheit nach, was?“
Sam legte den Comic mit schuldbewusstem Gesicht zur Seite.
„Wolltest du nicht anfangen, Geschichtsbücher zu lesen? Und es noch mal mit Krieg und Frieden versuchen?“
„Mach ich auch. Sobald ich Zeit habe.“
Doll nahm ihm den Comic aus der Hand.
„Korky, der Kater“, las sie und rezitierte dann den ersten Vers der Bildergeschichte: „Korky ging zur Jagd / Und was meinst du wohl, geschah? / Er spürte den besten Braten auf / Noch eh er sich’s versah.“ Sie ließ das Heft zurück in den Schoß ihres Mannes fallen. „Ein erwachsener Mann, der so etwas liest!“
„Bist du deswegen reingekommen? Um mich runterzuputzen?“
„Nein, ich wollte sehen, was Mary treibt. Ich dachte, sie macht Hüte.“
„Sie ist fertig. Ist hinaus in den Garten gegangen.“
„Aber sie kann nicht den ganzen Tag draußen herumsitzen. Sie hat noch etwas zu tun.“
„Um Himmels willen, Weib“, rief Sam verärgert, „heute ist ein besonderer Tag. Alle sollten feiern.“
„Aber Mrs. Barker kommt um halb sechs, wie jeden Dienstag. Und ich habe Mary schon seit Tagen nicht mehr üben gehört.“ Sie ging zum Klavier, öffnete den Deckel des Hockers und holte ein paar Notenblätter aus dem Stauraum. „Siehst du? Sie hat ihren Beethoven nicht angerührt.“
Widerstrebend legte Sam den Comic beiseite und stand auf.
„Ich werde mal mit ihr reden“, sagte er. Es hatte keinen Sinn, das Doll zu überlassen. Sie würde das Mädchen nur aufregen, und dann würde es ein Gezeter geben.
Mit der Pfeife in der Hand schlenderte er durch den Flur, die Küche und dann durch den kleinen glasüberdachten Bereich, den sie großspurig „Veranda“ nannten, bevor er in den Garten hinaustrat. Mary saß unter dem Apfelbaum auf der plumpen Holzbank, die Sam vor ein paar Jahren selbst entworfen und gezimmert hatte, und die erstaunlicherweise noch nicht zusammengebrochen oder auseinandergefallen war. Mit dreidimensionalen Dingen konnte er nicht so gut umgehen. Zeichnen war seine Stärke.
Er setzte sich neben seine Tochter und zündete die Pfeife an, dann reichte er Mary die Tabakdose und erlaubte ihr, sie unter die Nase zu halten und das kräftige, berauschende Aroma einzuatmen. Sie liebte den Duft seines Tabaks.
„Hast du keine Lust zu lesen?“, fragte er und wies mit dem Kinn auf das ungeöffnete Buch, das auf ihrem Schoß lag.
„Ich denke über etwas Wichtiges nach“, sagte das Mädchen feierlich.
„Aha.“ Sam zog ein paar Mal an seiner Pfeife, um sie in Gang zu bringen. „Tja, das kommt nicht alle Tage vor. Worüber denkst du denn nach?“
„Ich habe mich gefragt, wie man ihn am besten töten kann. Ob er an einem Laternenpfahl aufgehängt oder lebendig verbrannt werden sollte.“
Sam sah seine Tochter erstaunt an. Normalerweise hegte sie keine sadistischen Neigungen.
„Du meinst wohl den ollen Adolf. Über den brauchst du dir keine Gedanken mehr zu machen. Im Radio haben sie gesagt, er sei tot.“
„Nein, nicht Hitler“, sagte Mary mit verächtlichem Schnauben. „Der ist mir schnurz. Ich meine Beethoven. Ich will, dass er leidet.“
„Beethoven ist schon seit Ewigkeiten tot“, sagte ihr Vater. „Und überhaupt, was hat er dir denn getan?“
„Er hat dieses Stück geschrieben. Diese blöde Ecossaise. Letzte Woche habe ich sie geübt und geübt, aber sie klang trotzdem falsch, und diese Woche habe ich überhaupt nicht geübt, und Mrs. Barker wird böse auf mich sein. Warum kommt sie überhaupt? Ich dachte, heute wäre ein Feiertag.“
„Es ist ein Feiertag. Das heißt aber nicht, dass alles stillsteht. Das Leben geht weiter. Wenn wir in den letzten Jahren etwas gelernt haben, dann das.“
„Ich wette, keine meiner Freundinnen hat heute Klavierunterricht.“
„Na ja, sie können nicht so gut Klavier spielen wie du. Es ist eine Verantwortung, weißt du. Wenn du in ein paar Jahren vor vollen Rängen in der Royal Albert Hall spielst, wirst du froh sein, dass du geübt hast.“
„Ich werde nie gut genug sein, um in der Royal Albert Hall zu spielen“, erwiderte Mary verdrießlich.
Sam gab ihr einen Klaps auf das Knie. „Geh einfach rein und übe ein paar Minuten, ja? Dann ist deine Mutter glücklich, und wir haben alle unsere Ruhe.“
Das Mädchen stand mit einem schweren Seufzer auf und stapfte davon. Samuel blieb auf der Bank sitzen, genoss in aller Ruhe seine Pfeife und lauschte dann Marys tödlichem Kampf mit Beethoven, doch schon bald erschien Doll auf der Veranda und scheuchte ihn erneut auf. Diesmal war es der Garten, der anscheinend seine Aufmerksamkeit erforderte, und unter dem unerbittlichen Blick seiner Frau musste er die nächste Stunde auf Händen und Knien Setzlinge auslichten, Kohl säen und Kartoffelpflanzen anhäufeln. Es war eine anstrengende Arbeit, die ihn außer Atem und ins Schwitzen brachte und zwei große Erdflecken an den Knien seiner Hose hinterließ. Er war gerade fertig, als Doll (die ihn ein paar Minuten zuvor endlich in Ruhe gelassen hatte) mit einem unerwarteten Besucher auf die Veranda trat.
„Hallo Jim.“ Sam kämpfte sich auf die Beine, wischte seine Hand an der Hose ab und streckte sie Dolls Schwager entgegen. „Das ist ja mal ’ne Überraschung. Hat Gwen dich heute von der Leine gelassen?“
„Kann man so sagen. Sie hat drei Nachbarinnen zu Besuch, die in der Küche Tee trinken und gackern wie die Hühner. Da hab ich gedacht, ich mach mich aus dem Staub und versuche, dich zu ’nem Pint zu überreden.“
„Ein Pint?“
„Ja.“
„Du meinst ein Bier?“
„Genau.“
Sam war peinlich berührt. „Also, weißt du, Jim, wir haben nichts im Haus. Doll findet …“
„Ich habe nicht hier gemeint. Ich tauch doch nicht uneingeladen bei dir auf und verlange auch noch was zu trinken! Ich dachte, wir könnten ins Pub gehen.“