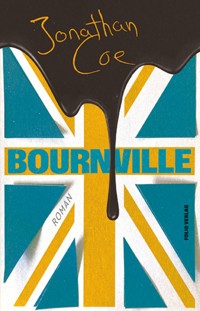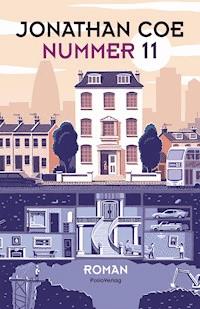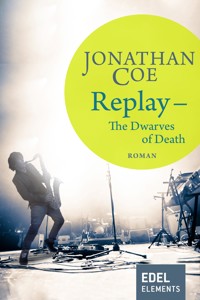Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ted und Robin lieben Katharine. Selbst Ted und Katharines Heirat konnte dem subtilen Dreiecksverhältnis nichts anhaben. Doch Jahre der Trennung haben sie einander entfremdet: Ted ist geschäftlich erfolgreich, während Robin seit Jahren vor den Bruchstücken seiner Dissertation sitzt... Ein hinreißender Roman vom Autor des Bestsellers " Allein mit Shirley"!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jonathan Coe
Ein Hauch von Liebe
Roman
Ins Deutsche übertragen von Anette Grube
Edel eBooks Ein Verlag der Edel Germany GmbH
Copyright dieser Ausgabe © 2014 by Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel A TOUCH OF LOVE
Copyright der Originalausgabe © Jonathan Coe 1989
Ins Deutsche übersetzt von Anette Grube
Copyright der deutschen Übersetzung © Piper Verlag GmbH, München 1997
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Jouve
Inhaltsverzeichnis
TEIL EINS
Ein intellektuelles Verhältnis
Dienstag, 17. April 1986
»Liebling, sei nicht albern, selbstverständlich wird es keinen Atomkrieg geben.«
...
»Ich komm jetzt zur Ausfahrt 21 und sollte in ungefähr zwanzig Minuten in Coventry sein. Ich muß zur Universität.«
...
»Vergiß, was er gesagt hat. Er weiß nicht, wovon er redet. Die Welt wird regiert von geistig gesunden, vernünftigen Menschen so wie du und ich.«
...
»Du fehlst mir auch. Gib Peter einen Kuß von mir. Und sag ihm –«
...
»Was? Nein, auf der Gegenfahrbahn hat ein Wahnsinniger überholt. Der ist mindestens hundertvierzig gefahren. Ich frag mich, warum die Polizei da nicht einschreitet.«
...
»Ich weiß nicht, ob ich noch Zeit habe, bei ihm vorbeizuschauen. Nicht, wenn ich heute abend zu Hause sein will.«
...
»Und worüber soll ich mich mit ihm unterhalten? Ich hab ihn seit Jahren nicht mehr gesehen. Ich kann mich kaum noch erinnern, wie er aussieht.«
...
»Nein, ich sehe nicht ein, warum wir ihm unser Urlaubshäuschen zur Verfügung stellen sollen. Wir haben es schließlich für uns gekauft und nicht, um es an Fremde zu vermieten.«
...
»Was soll das heißen: er hat merkwürdig geklungen?«
...
»Liebling, er weiß nicht, wovon er redet. Libyen, Syrien, Amerika, Rußland – es ist eine hochkomplizierte Situation. Wenn du wirklich glaubst, daß die ganze Welt in einen Krieg schlittert, dann... dann komm ich natürlich nach Hause.«
...
»In Ordnung, gib mir seine Adresse.«
...
»Ja, ich werde heute abend bei ihm vorbeischauen, nach der Universität. Das heißt, daß ich wahrscheinlich nicht vor zehn nach Hause kommen werde. Vielleicht auch später. Nein, ich werd’s schon finden, ich hab einen Stadtplan.«
...
»Mach dich nicht verrückt. Wenn es dich so aufregt, dann schau eben keine Nachrichten. Vergiß, was er gesagt hat.«
...
»Ich werd ihm das mit unserem Häuschen erklären. Ich bezweifle, daß mit ihm irgendwas nicht stimmt. Vielleicht ist er einfach überarbeitet. Du weißt doch, wie Studenten sind, wochenlang tun sie nichts, und dann arbeiten sie nächtelang durch.«
...
»Mach dir keine Gedanken. Ich werd vorbeischauen.«
...
»Du mir auch.«
...
»Küßchen.«
An der Ausfahrt 21 bog Ted ab und fuhr auf die M69. Das Wichtigste war, das hatte er schnell begriffen, gute Beziehungen zu den Kunden zu unterhalten. Er hegte kaum Hoffnung, in der Universität erneut etwas verkaufen zu können, aber er hatte seit Wochen nicht mehr mit Dr. Fowler gesprochen und wollte sich erkundigen, ob das neue System einwandfrei arbeitete. Nachdem er sich vergewissert hatte, daß die mittlere Spur frei war, gestattete er sich einen Blick auf den Beifahrersitz und die Aktenmappe, in der er die persönlichen Daten seiner Kunden archivierte. Mit der linken Hand schlug er den Buchstaben F auf. Fowler, Dr. Stepheh. Verheiratet, zwei Kinder: Paul und Nicola. Nicola war am 24. März beim Zahnarzt gewesen. Zwei Extraktionen. Das sollte ihm einen Ansatzpunkt bieten. (»Steve! Freut mich, Sie zu sehen. Hab gedacht, ich schau schnell vorbei. War gerade in der Gegend. Wie geht’s Ihrer Frau und den Kindern? Nicky hat doch hoffentlich keine Probleme mit den Zähnen mehr? Wunderbar. Freut mich zu hören...«)
Kurz vor fünf traf er auf dem Universitätsgelände ein, aber Dr. Fowler war bereits nach Hause gegangen. Einem Zettel an seiner Tür war zu entnehmen, daß er Ratsuchenden am nächsten Morgen wieder zur Verfügung stehen würde.
Ted kehrte auf Umwegen zum Parkplatz zurück, er war überrascht, wie sehr er den sonnigen Spätnachmittag und die ungewohnte Erfahrung genoß, von Menschen umgeben zu sein, die jünger waren als er. Bei seinem Wagen angekommen, stieg er nicht ein, sondern setzte sich auf die Motorhaube und sah sich um. Er hatte sich auf das Treffen mit Dr. Fowler mit der mentalen Unbeirrbarkeit vorbereitet, die ihm kürzlich zum zweitenmal in Folge den begehrten ›Verkäufer des Jahres‹-Preis der Firma eingebracht hatte, so daß er erst jetzt in der Lage war, ernsthaft über Katharines Anruf nachzudenken. Die Aussichten, die sich daraus ergaben, waren nicht erfreulich. Er wollte Robin nicht wirklich wiedersehen: hätte er es gewollt, hätte er sich schon früher, anläßlich eines seiner Besuche in der Universität, bei ihm gemeldet. Und am allerwenigsten wollte er derjenige sein, der sich um ihn kümmern mußte, sollte tatsächlich, wie Katharine vermutet hatte, irgend etwas mit ihm nicht stimmen.
Aber sie neigte stets dazu, zu übertreiben.
Ted setzte sich einer Situation nicht gern ungewappnet aus; und sein Unbehagen, so wurde ihm klar, ließ sich zum Teil mit der Unzulänglichkeit seiner Daten erklären. Robin wiederzusehen, ohne zu wissen, wie er die letzten vier Jahre verbracht hatte, wäre so, als er würde sich mit einem Fremden treffen.
Er dachte eine Weile nach, holte seine Aktenmappe aus dem Auto und schlug den Buchstaben G auf. Die Blätter raschelten leise in der Brise. Schnell hatte er alles, was ihm zu seinem alten Freund einfiel, notiert.
Grant, Robin.
Studienabschluß in Cambridge 1981.
Zum letztenmal gesehen anläßlich unserer Hochzeit 1982. Hat jedes Jahr eine Weihnachtskarte und den Familienrundbrief bekommen (Weiß er deshalb von unserem Häuschen?)
Familie: Vater, Mutter, eine Schwester.
Schreibt derzeit an seiner Doktorarbeit – seit 4 (?) Jahren. Klingt angeblich ›merkwürdig‹ oder ›depressiv‹. Behauptet, Ferien zu brauchen.
Reagiert heftig auf die Ereignisse der letzten beiden Tage: sagt, daß die Bomber nicht nach Libyen hätten geschickt werden dürfen.
Ted legte den Stift aus der Hand, runzelte die Stirn, und seine Stimmung verdüsterte sich noch mehr. Die Menschen konnten sich in vier Jahren gewaltig verändern. Er hoffte, daß man mit Robin auch noch über etwas anderes als Politik reden konnte.
Als er die südwestlichen Randbezirke von Coventry erreichte, hielt Ted an, um in seinem Straßenatlas nachzuschlagen, und mußte feststellen, daß die maßgebliche Seite fehlte. Der Rücken des Buches war gebrochen, und seit über einem Monat wollte er ein neues kaufen: er konnte niemand anderem als sich selbst die Schuld in die Schuhe schieben. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als einen Passanten um Auskunft zu bitten. Erst einmal war er jedoch nicht abgeneigt, auf gut Glück durch die baumgesäumten Straßen zu fahren, die Häuser zu betrachten und beifällig auf das Vogelgezwitscher zu horchen, das sich mit der Musik seines gekonnten Herauf- und Herunterschaltens vermischte. Alles, um den Augenblick der Ankunft hinauszuzögern.
Nach ein paar Minuten und nachdem er an mehreren Fußgängern vorbeigekommen war, die ihm aus unterschiedlichen irrationalen Gründen nicht gerade sympathisch erschienen, fiel sein Blick auf eine junge Frau, die auf seiner Seite der Straße schnell dahinging, den Rücken ihm zugewandt. Er fuhr gleichauf und drückte auf die Hupe. Die Frau erschrak und drehte sich zu ihm um; und Ted mußte bestürzt feststellen, daß sie Inderin war. Jetzt hätte er womöglich Schwierigkeiten, sich verständlich zu machen. Aber es war zu spät; sie näherte sich bereits seinem geöffneten Fenster.
»Ja?« sagte sie grimmig.
Er blickte in ein Paar dunkler, großer Augen, die ihn wütend ansahen. Einen Augenblick lang fühlte er sich überrumpelt, und plötzlich war er sich einer starken, lebhaften Persönlichkeit bewußt, die sich seiner widersetzte. Unfähig, ihrem Blick standzuhalten, schaute er weg und bemerkte, daß er an der linken Manschette einen Knopf verloren hatte.
»Ich dachte, vielleicht könnten Sie mir sagen«, setzte er an, »wo die –« er nannte die Straße, in der Robin wohnte – »ist.«
»Wie bitte?« sagte die Frau mehr, wie Ted durchaus hätte auffallen können, überrascht als verständnislos.
»Hier.« Er kramte in der Aktenmappe und fand den Zettel, auf den er die Adresse geschrieben hatte, als er nach dem Gespräch mit Katharine am Straßenrand angehalten hatte. Er hielt ihn ihr hin.
»Von dort komme ich gerade«, sagte sie. »Wollen Sie Robin besuchen?«
»Ja.«
»Gleich um die Ecke hinter Ihnen. Ich hoffe, Sie werden mehr Spaß haben als ich.«
Sie wandte sich ab und ging davon, die Hände in den Taschen, der Mantel zugeknöpft, obwohl der Abend noch warm war. Ted war zuerst sprachlos, aber innerhalb weniger Sekunden gelang es ihm, sich aus dem Fenster zu lehnen und ihr nachzurufen: »Robin Grant? Sie kennen ihn? Sind Sie eine Freundin von ihm?«
Die Frau blieb weder stehen, noch verlangsamte sie den Schritt, sie erhob nicht einmal die Stimme, so daß ihre Antwort kaum hörbar war.
»Woher soll ich das wissen?«
Ted sah ihrer kleiner werdenden Gestalt nach, bis sein Blick verschwamm. Er war wie betäubt vor Verwirrung. Dann wendete er langsam und widerstrebender als je zuvor den Wagen, indem er dreimal zurücksetzte, und fuhr die Seitenstraße entlang, die sie ihm genannt hatte.
Die Adresse auf dem Zettel stellte sich als großes graues Reihenhaus heraus, von dem die Farbe abblätterte und das lediglich durch einen schmalen, trostlosen, vernachlässigten Garten von der Straße getrennt war. Ted stieg aus und schloß den Wagen ab. Die Straße war menschenleer, gesprenkelt vom warmen Licht der Abendsonne. Er warf sich das Jackett über die Schulter, lockerte die Krawatte, schritt beherzt zur Haustür und klingelte bei ›Grant, R.‹.
Eine Weile lang rührte sich nichts. Dann hörte er von weit weg das Geräusch einer sich öffnenden Tür, Schritte, sah einen Schatten hinter der Milchglasscheibe und schließlich, als die Tür aufgemacht wurde, ein bleiches, unbekanntes, unrasiertes Gesicht.
»Robin?«
»Komm rein.«
»Du hast mit Katharine telefoniert. Hat sie dir gesagt, daß ich komme?«
»Ja. Komm rein.«
Wortlos führte Robin ihn aus dem hellen Licht in einen düsteren Gang, vorbei am Fuß einer steilen Treppe und durch eine Tür rechter Hand. In seiner Wohnung war es noch dunkler: die Vorhänge waren zugezogen, und die Luft war trocken und verraucht. Nachdem sich Teds Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, nahm er die Einzelheiten eines spärlich eingerichteten Ein-Zimmer-Apartments wahr, das ungemachte Bett an der Wand, auf dem Boden verstreute Kleidungsstücke, zwei bis in die letzte Ritze vollgestopfte Bücherregale und einen Schreibtisch, auf dem nichts lag außer einem Kugelschreiber und drei kleinen, aufeinander gestapelten roten Notizbüchern. Auf dem Kaminsims stand ein Radio, in dem das Vierte Programm lief: eine teilnahmslose Stimme berichtete über die Ereignisse des Tages in Tripolis und Westminster.
»Hast du nicht so schnell mit mir gerechnet?« fragte Ted.
»Tut mir leid. Ich hab nicht auf die Zeit geachtet. Setz dich.«
Er räumte ein Sofa frei, indem er einen Haufen Hemden und Unterhosen auf den Boden warf.
»Tja, Robin«, sagte Ted, sah ihn an und fragte sich, warum er nicht anständig angezogen war (er trug lediglich einen roten Frotteebademantel und Slipper), »wir sehen uns unter veränderten Umständen wieder.«
»Wie geht es Kate?« fragte er.
»Ach, gut. Wirklich gut. Komisch«, fuhr er fort, um das plötzliche verlegene Schweigen zu brechen, »ich hab eben angehalten, um nach der Richtung zu fragen, und hab mit einer Freundin von dir gesprochen.«
»Ja?«
»Ja. Sie wirkte etwas... asiatisch..«
»Sie heißt Aparna.«
»Sie sieht bemerkenswert aus, fand ich. Sie war gerade bei dir, oder?«
»Ja.«
»Also, an Freunden scheint es dir ja nicht zu mangeln, Robin.«
»Wir haben gestritten.«
»Ja? Nicht ernsthaft, hoffe ich?«
»Doch, ernsthaft. Über ein Buch.«
Wieder herrschte Schweigen. Ted, Meister der manipulativen Gesprächsführung, Experte darin, anderen Geheimnisse zu entlocken, hatte Schwierigkeiten, mit dem lustlosen Minimalismus von Robins Antworten zurechtzukommen. Glücklicherweise wechselte Robin das Thema.
»Jedenfalls habe ich mit Kate über euer Häuschen gesprochen, und sie meinte, es würde keine Probleme geben. Hast du die Schlüssel mitgebracht?«
Ted war zu verblüfft, um zu antworten. Robin setzte sich ihm gegenüber aufs Bett und sprach weiter (seine Stimme kalt, angestrengt, ausdruckslos): »Weißt du, ich glaube, wenn ich nicht die Möglichkeit hätte, irgendwo anders hinzugehen, würde ich verrückt werden. Oder etwas ähnliches. Ich fühle mich immer so müde. Ich glaube, ich brauche Schlaf. Ich glaube, ich muß mich ausruhen. Ich habe das Gefühl, daß ich reden muß. Ich muß mit jemandem sprechen. Ich muß hier weg. Ich muß allein sein. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, was ich tue. Die letzten paar Tage weiß ich einfach nicht, was ich getan habe. Ich weiß nicht, wo ich gewesen bin. Ich war in einem Geschäft. Ich habe eine Tube Zahnpasta genommen und bin damit rausgegangen. Die Frau mußte mir nachlaufen. Sie hat gesagt: Sie haben nicht bezahlt. Ich hab mich am Finger verletzt. Ich bin auf der Treppe ausgerutscht und hab mich verletzt. Ich fühle mich erschöpft. Mir ist kalt, und ich habe Hunger. Ich habe immer Hunger. Ich habe eine tiefgekühlte Pie in den Ofen geschoben, und als ich eine halbe Stunde später wieder hinging, habe ich festgestellt, daß ich den Ofen nicht eingeschaltet hatte. Ich hatte es vergessen. Statt dessen mußte ich Brot essen. Ich kann einfach nicht glauben, was ich im Radio gehört habe. Sie hat ihn unsere Luftstützpunkte benutzen lassen. Sie haben unsere Stützpunkte benutzt, um Libyen zu bombardieren. Ich habe Angst. Ich muß hier weg. Und ich wollte schon immer mal wieder in den Lake District. Dort ist es ruhig und sauber, und ich verbinde damit Erinnerungen. Früher bin ich immer mit meiner Familie dort hingefahren. Mit meinen Eltern und meiner Schwester. Während der letzten Tage habe ich oft daran gedacht, wie sehr ich meine Familie vermisse. Wie dumm es von mir ist, mich einfach so von ihnen abzukapseln. Wenn ich nicht in dein Häuschen könnte, würde ich ihnen schreiben und sie fragen, ob ich nach Hause kommen und eine Weile bei ihnen bleiben kann. Aber so ist es besser. Viel besser.«
Ein Mann mit einem empfindsameren Herzen als Ted hätte sich von dieser Ansprache vielleicht erweichen lassen. Ja, notfalls hätte sich sogar Ted erweichen lassen, hätte er zugehört. Statt dessen betrachtete er Robins verwahrlostes Zimmer und dachte an sein Häuschen im Lake District, und unterdessen verstärkte sich seine Entschlossenheit. Sie hatten das Häuschen mit der Erbschaft gekauft, die ihnen Katharines Mutter hinterlassen hatte, als sie 1983 starb. Die Frage, was sie mit dem Geld tun sollten, war Gegenstand mehrerer langer und heftiger Auseinandersetzungen gewesen, an die er sich jetzt mit einiger Wehmut erinnerte. Schließlich setzte er sich durch, und der Lake District gewann die Oberhand über Cornwall. Der Einsatz körperlicher Gewalt war nicht nötig gewesen. Das Häuschen befand sich an der Hauptstraße zwischen Torver und Coniston; zwischen ihm und einer großartigen Aussicht auf das Wasser stand lediglich ein knapp einen Kilometer breiter, dichter Kiefernwald. Ted und Katharine hatten anfänglich befürchtet, daß sie von den Einheimischen als Eindringlinge betrachtet würden, aber sie hatten sich problemlos in die Gemeinde integriert: ihre einzigen Nachbarn, die Burnets, die ihnen gegenüber auf der anderen Straßenseite wohnten, erwiesen sich als reizendes Paar aus Harrow, das jederzeit zu einer Partie Bridge bereit war. Ted war nicht gewillt, seine Stellung bei diesen Menschen durch die Ankunft dieses anrüchigen Bekannten zu kompromittieren, der definitiv keine Ahnung hatte, wie mit einem Eigenheim umzugehen war. Sein Auge – so sehr daran gewöhnt, Katharines Bemühen in dieser Hinsicht wachsam zu verfolgen-hatte schnell am Dreck auf Robins Fußleisten, an der Asche auf dem Teppich und an den vergessenen Spinnweben in den Ecken Anstoß genommen. Nicht, daß er diesen Tatbestand als Grund für eine Absage hätte anführen können, natürlich nicht. Er mußte sich eine kleine Notlüge einfallen lassen.
»Also, so wie die Dinge liegen, Robin«, sagte er, »war Katharine etwas voreilig. Sie scheint vergessen zu haben, daß meine Mutter im Augenblick dort ist. Sie will mindestens einen Monat bleiben.«
Robin starrte ihn schweigend an, seine Miene ausdruckslos, sein Blick starr. Ted fragte sich, ob er seine Erklärung, die seiner Meinung nach sehr einleuchtend geklungen hatte, gehört, aufgenommen und verstanden hatte. Er versuchte, eine Frage zu formulieren – »Ist das in Ordnung?« oder »Du siehst doch das Problem, oder?« –, aber die Worte wollten ihm nicht über die Lippen kommen. Was er sich schließlich selbst sagen hörte, war: »Tja – wie wär’s mit was zu essen?«
In der Küche fand sich nichts außer einem Rest Margarine und einer halbleeren Packung mit alten Butterkeksen. Ted ging los, um einen Fish-and-Chips-Stand zu suchen. Da er seit Jahren nicht mehr bei einem Fish-and-Chips-Stand gewesen war, überraschte es ihn, über drei Pfund zahlen zu müssen. Der Besitzer informierte ihn, daß solche Preise an der Tagesordnung seien, sogar im Norden. Als er in die Wohnung zurückkehrte, hatte Robin weder, wie gebeten, für sauberes Besteck gesorgt noch zwei Teller vorgewärmt, sondern saß an seinem Schreibtisch und schrieb einen Brief.
»Tut mir leid«, sagte er. »Ich dachte nicht, daß du so schnell zurück wärst.«
Ted schickte ihn in die Küche und nutzte seine Abwesenheit, um heimlich einen Blick auf den Brief zu werfen. Er war an seine Mutter adressiert und begann folgendermaßen:
Es wird Dich wahrscheinlich überraschen, aber ich habe vor, nach Hause zu kommen und eine Weile bei Euch zu bleiben. Ich hoffe, daß Euch diese Idee zusagt, weil ich weiß, daß wir in letzter Zeit kaum Kontakt miteinander hatten, aber ich habe mir gedacht, daß es sehr nett wäre, Euch beide wiederzusehen. Mir scheint, daß ich in letzter Zeit häufig die falsche Richtung eingeschlagen habe, und ich muß unbedingt von hier weg und die Dinge überdenken. Ich habe mich wohl nicht gerade klar ausgedrückt, aber ich werde versuchen, die Sache zu erklären...
Mehr hatte er nicht geschrieben. Ted las den Brief verwirrt ein zweites Mal, als Robin zurückkam. In dem Bestreben, nicht als neugierig zu gelten, gab er vor, auf die roten Notizbücher gestarrt zu haben.
»Was steht da drin?« fragte er und deutete darauf.
»Geschichten«, sagte Robin. Er reichte Ted einen lauwarmen Teller, ein Messer und eine Gabel.
»Du schreibst also immer noch?«
»Ab und zu.«
»Ich habe noch die Ausgabe der College-Zeitschrift«, sagte Ted und kicherte erinnerungsträchtig. »Du weißt schon, für die wir beide was geschrieben haben. Du hast eine Geschichte geschrieben und ich einen kurzen Artikel.«
»Ich erinnere mich nicht.«
»Mein Artikel ging über objektorientiertes Programmieren. Die Leute fanden ihn ziemlich lustig.«
Robin schüttelte den Kopf und begann, mit den Fingern Chips zu essen.
»Wovon handeln die Geschichten?«
»Ach«, sagte Robin müde, »das ist eine Serie von Geschichten, an der ich seit geraumer Zeit arbeite. Ich weiß wirklich nicht, warum ich mir die Mühe mache. Es sind vier Geschichten, die miteinander in Beziehung stehen. Sie handeln von Sex und Freundschaft und von Entscheidungsfreiheit und solchen Dingen.«
»Vier?« sagte Ted. »Ich sehe nur drei.«
»Aparna hat eine. Ich wollte, daß sie sie liest: sie hat sie heute nachmittag mitgenommen.« Er riß ein Stück Kabeljau auseinander und kaute unlustig ein, zwei Bissen. Dann fügte er aus heiterem Himmel hinzu: »Man sollte gründlich nachdenken, bevor man etwas sagt. Findest du nicht auch?«
»Wie bitte?«
»Ich sagte, man sollte gründlich nachdenken, bevor man etwas sagt.«
»Wie meinst du das?«
Er beugte sich vor, erneut ernst und gesprächig.
»Ich meine, daß ein Wort eine tödliche Waffe sein kann.« Nach diesem Satz hielt er inne, offenbar zufrieden damit. »Ein Wort kann das Werk von einer Million anderen zerstören. Ein falsches Wort kann alles ruinieren: eine Familie, eine Ehe, eine Freundschaft.«
Ted wollte ihn fragen, warum er glaubte, etwas über die Ehe zu wissen, entschied sich jedoch dagegen.
»Ich verstehe nicht ganz«, sagte er.
»Ich habe gerade daran gedacht, wie leicht es heute war, Aparna zu verärgern. Sie hat mir ein Buch gezeigt.« Er schob ein für alle Mal seinen Teller beiseite. »Es war ein neues Buch, ein gebundenes, Es war klar, daß es nicht aus der Bibliothek stammte, deshalb zog ich sie auf. Ich sagte: ›Seit wann können sich Leute wie wir Bücher wie dieses leisten?‹ Dann erklärte sie mir, daß es ein Geschenk war, eine der Autorinnen ist eine Freundin von ihr. Ich nahm das Buch und sah mir die Titelseite an, und da standen zwei Namen, ein englischer und ein indischer. Ich deutete auf den indischen Namen und sagte: ›Vermutlich ist das deine Freundin.‹ Und daraufhin starrte sie mich an, nahm mir geflissentlich das Buch aus der Hand und sagte: ›Du hast gerade eben viel über dich selbst verraten.‹«
Ted stand vor einem Rätsel. Er überlegte gründlich und schnell, bestrebt, sich nicht in eine peinliche Situation zu bringen. Was war los mit diesem Mann, daß sie einander so oft mißverstanden? Freundschaft, so hatte er immer geglaubt, war ein intellektuelles Verhältnis, wie auch die Ehe. Katharine und er verstanden sich nicht nur, sobald sie miteinander sprachen, sondern häufig verstanden sie sich bereits, bevor sie sprachen. Manchmal wußte er, was sie dachte, bevor sie es sagte. Oft wußte sie, was er denken würde, bevor er überhaupt angefangen hatte, nachzudenken. Intellektuelle Kompatibilität war zu einer Konstanten seines Lebens geworden, zu einer Gegebenheit, einer Gewohnheit, einer Selbstverständlichkeit wie der Firmenwagen, wie das Gewächshaus – für das er, wie ihm jetzt einfiel, am Wochenende drei neue Glasscheiben kaufen mußte.
Welchen Zweck sollte diese abstruse Anekdote erfüllen? Der Knackpunkt war vermutlich, daß eine Autorin des Buches Inderin war und es Aparna aus irgendeinem Grund kränkte, mit ihr in Verbindung gebracht zu werden. Aber Aparna war doch bestimmt selbst Inderin? Sie hatte diesen komisch klingenden Namen. Ihre Haut war, wollte man das Kind beim Namen nennen, dunkel. Ebenso ihr Haar. Sie hatte zugegebenermaßen keinen roten Punkt in der Mitte der Stirn, aber das ließe sich vermutlich leicht erklären. Warum wollte eine Inderin nicht mit einer anderen Inderin in Verbindung gebracht werden, nur weil sie beide Inderinnen waren?
Er wandte sich mit dieser Frage, so gut er sie formulieren konnte, an Robin.
»Das ist nicht so einfach«, sagte Robin. »Ich kenne sie seit vier Jahren. Sie ist genauso lange hier wie ich. Oder sogar noch länger. Sechs, sieben Jahre.« Er hielt inne, als ob er es nicht mehr gewohnt wäre, den Leuten etwas zu erklären. »Als sie hier ankam, war sie stolz, Inderin zu sein. Sie gab sogar damit an. Du hast gesehen, wie sie heute angezogen war – so hat sie sich nicht immer angezogen. Sie war damals beliebt: so beliebt, daß ich eifersüchtig war. Aber sie hatte immer Zeit für mich. Wir standen uns sehr nahe, auf gewisse Weise. Trotzdem – wenn wir vor der Bibliothek standen und miteinander redeten, kam alle paar Sekunden jemand vorbei, sagte hallo und blieb stehen, um mit ihr zu plaudern. Ich bin kaum noch zu Wort gekommen. Und nicht nur Studenten, sondern auch Professoren, Lehrbeauftragte, Bibliothekarinnen, die Leute aus der Kantine. Du kannst es dir nicht vorstellen. Was du heute gesehen hast, war ein Schatten ihrer selbst. Sie lebt jetzt allein. In einem Hochhaus auf der anderen Seite der Stadt. Im vierzehnten Stock. Ich bin der einzige, der sie noch besucht. Alle anderen haben sie vergessen. Sie ging ihnen auf die Nerven.«
Ein Schweigen legte sich auf sie, das, so schien es Ted, potentiell unendlich war.
»Und?« fragte er.
»Rassismus ist nicht notwendigerweise offenkundig. Er muß auch nicht aus heiterem Himmel entstehen, und es gibt ihn überall. Sie hatte es satt, als Ausländerin zu gelten; sie hatte es satt, daß das das erste war, was den Leuten an ihr auffiel. Sie ist hierhergekommen, um zu arbeiten und zu promovieren, und dann mußte sie feststellen, daß die Leute sie benutzten, um ihrem Leben ein bißchen Farbe zu verleihen. ›Ihr bißchen Exotik‹, nannte sie es. Sie hat schwer darum gekämpft, ernst genommen zu werden, aber es hat nicht funktioniert. Und jetzt meint sie, daß ich auch nicht anders bin. Daß sogar ich so von ihr denke. Und jetzt ist sie hart, mit mir und allen anderen; aber ich kann mich an diese Freundlichkeit, diese Warmherzigkeit erinnern, die ich bei niemand anderem gefunden habe.«
Ted, der keine Ahnung hatte, was er dazu sagen sollte, begann die Teller wegzuräumen.
»Hast du irgendwann einmal das Gefühl gehabt«, sagte Robin, »daß du dein ganzes Leben lang die falschen Entscheidungen getroffen hast? Oder schlimmer noch, daß du nie wirklich Entscheidungen getroffen hast? Daß es Zeiten gegeben hat, in denen du in der Lage gewesen wärst – jemandem zu helfen, zum Beispiel, aber nicht genug Mut hattest, es auch zu tun? Ja?«
Ted blieb auf der Schwelle zur Küche stehen und sagte: »Du bist im Augenblick nicht gerade in Hochform, stimmt’s, Robin?«
Robin folgte ihm und sah zu, wie er die Teller ins Spülbecken stellte.
»Oder noch schlimmer: Hast du dich jemals gefragt, wozu man überhaupt Entscheidungen treffen soll, wenn die Welt von Wahnsinnigen regiert wird und wir alle von Interessen abhängig sind, die wir nicht kontrollieren können, und wir nicht wissen, wann etwas Schreckliches passieren wird, ein Krieg oder so?«
»Du hast natürlich vollkommen recht. Aber, Robin«, Ted drehte sich um und sagte ganz unvermutet, »hast du Nadel und Faden? Ich hab einen Knopf verloren.«
»Ja. In der Kommodenschublade.«
Sie kehrten ins Zimmer zurück. Ted fand eine Nadel und eine Rolle weißes Baumwollgarn und versuchte, den Faden einzufädeln.
»Red weiter«, sagte er. »Ich höre jedes Wort, das du sagst.«
»Ich habe einfach das Gefühl... daß ich weg und von vorne anfangen muß. Hast du manchmal das Gefühl?«
»Manchmal.« Die Nadel hatte ein sehr kleines Öhr, und Ted hatte Schwierigkeiten, den Faden einzufädeln.
»Ich meine, ich weiß einfach nicht, wo die letzten paar Jahre hin sind. Mir scheint, ich habe nichts erreicht, weder in persönlicher Hinsicht noch in akademischer oder in kreativer. Mir scheint, ich habe vollkommen die Richtung verloren.«
»Ich verstehe.« Er steckte ein Ende des Fadens in den Mund, damit es naß wurde und ihm das Einfädeln dann hoffentlich leichterfiele.
»Meine Familie sehe ich nie. Von meiner Schwester höre ich nichts mehr. An der Universität gibt es heutzutage keine Stellen mehr. Ich weiß nicht, wozu ich überhaupt promovieren soll. Meine Beziehungen zu Frauen waren eine einzige Katastrophe. Ich sehe immer nur die negative Seite der Dinge. Alles scheint unzulänglich zu sein. Alles scheint sinnlos und vergeblich zu sein. Kennst du dieses Gefühl?«
Ted, dem es gelungen war einzufädeln und der in der Tasche seines Hemds einen Ersatzknopf gefunden hatte, zog jetzt das Hemd aus. Als er es sich über den Kopf streifte, antwortete er.
»Sprich weiter. Ich weiß, wovon du redest.«
»Ich habe dieses Buch gelesen. Es hat... ich glaube, es hat einiges von dem geklärt, was ich möglicherweise gerade durchmache. Diese Frau, sie redet viel über das ›Ich‹, die Bedeutung des ›Ichs‹. Das – Gefühl persönlicher Identität. Du weißt schon, das Gefühl für dich selbst, für die Person, die du bist.«
»Ja, natürlich.« Ted schüttelte mißbilligend den Kopf. Er hatte keinen richtigen Knoten gemacht, der Faden war aus dem Öhr gerutscht, und jetzt mußte er wieder von vorn anfangen.
»Hörst du mir zu?«
»Selbstverständlich höre ich dir zu. Hast du was dagegen, wenn ich kurz das Licht anmache? Ich kämpfe hier mit Schwierigkeiten.«
»Also, was meinst du?« sagte er, als Ted aufstand, um das Licht einzuschalten.
»Wie, was meine ich?«
»Was meinst du, daß ich tun soll?«
»Tja.« Ted nahm erneut den Faden in den Mund und sagte dann: »Vielleicht ist dein Problem, daß du einsam bist. Hast du schon mal daran gedacht, dir eine Freundin zuzulegen?«
»Was?«
»Na, du weißt schon, jemand, der deine Wohnung sauberhält und dir abends Gesellschaft leistet. Nicht so jemand wie Aparna, die immer nur streitet. Jemand, der stabil ist und dir den Rücken stärkt.«
»Und was sollte mir das nützen?«
Ted hörte den verächtlichen Unterton in seiner Stimme, und obwohl er damit beschäftigt war, einen Knoten zu machen, sah er auf. Er sagte mit großem Ernst: »Ich weiß nur eins, Robin. Ich war erst wirklich glücklich, nachdem ich Katharine geheiratet habe.«
Robin wich seinem Blick aus. »Ich will nie wieder was mit einer Frau zu tun haben«, sagte er und ging aus dem Zimmer.
Ted legte die Nadel aus der Hand, dachte über diese Worte nach und beschloß, sie in seiner Akte zwecks späterer Verwendung zu notieren, denn sie bestätigten oder vielmehr erinnerten ihn an eine persönliche Theorie über Robin, der er einst angehangen hatte. Tatsächlich war es Katharine gewesen, die sie als erste formuliert hatte, damals in Cambridge. »Red keinen Unsinn«, hatte er gesagt, »Robin ist so normal wie du und ich.« Mit der Zeit jedoch schien ihm diese Vermutung immer plausibler, und Ted hatte seinen anfänglichen Abscheu überwunden. Auf merkwürdige Art hatte sie ihn sogar mit der engen Freundschaft, die zwischen Katharine und Robin bestand, versöhnt, mit dem augenfälligen Vergnügen, das sie an der Gesellschaft des jeweils anderen fanden. Gegen Ende ihres letzten Sommersemesters wurden die drei fast immer zusammen gesehen. Und einmal hatte Katharine zu ihm gesagt:»Das würde auch erklären, warum er so sensibel ist.«
»Sensibel?«
»Ja. Sie sind immer die Sensibelsten.«
In der Folge hatte er Robin gefragt, ob er auch glaube, daß sie immer die Sensibelsten seien, und er hatte geantwortet, ja, das sei oft der Fall, und er hatte hinzugefügt, daß einige der Menschen, die er am meisten bewunderte, homosexuell waren; was Ted damals als ein schockierendes Eingeständnis erschienen war. Aber er hatte sich gesagt: Macht nichts, er hat einfach nur weniger Glück gehabt als der Rest von uns, und dieser Anfall von Liberalismus hatte Anlaß gegeben zu nachhaltigem insgeheimen Schulterklopfen. Es gab jedoch selbstverständlich Grenzen. Zum Beispiel hätte er Peter nie allein in einem Zimmer mit Robin gelassen. Ted war der Überzeugung, daß man, wenn es um Kinder ging, nicht vorsichtig genug sein konnte.
Robin kam zurück und zog die Vorhänge am Fenster vor seinem Schreibtisch auf. Es dunkelte bereits.
»Wahrscheinlich mußt du bald zurückfahren.«
»Ich hab gerade darüber nachgedacht«, sagte Ted. Er hatte gedacht, daß es ihm gelegen käme, wenn er am nächsten Morgen bei Dr. Fowler vorbeischauen könnte; in diesem Fall müßte er diesen trostlosen Teil der Welt mindestens einen Monat lang nicht mehr aufsuchen. Und er hatte gedacht, daß er hier, so ekelhaft das Ambiente von Robins Wohnung auch war, vielleicht übernachten könnte. »Dir scheint’s nicht gerade hervorragend zu gehen, und es gibt keinen Grund, warum ich heute noch nach Hause muß. Ist es dir recht, wenn ich Katharine anrufe und ihr sage, daß ich erst morgen zurückkomme?«
»Wenn du willst«, sagte Robin.
Das war nicht gerade der Wortschwall der Dankbarkeit, den Ted erwartet hatte.
»Dann könnten wir noch etwas trinken gehen. Meinst du, daß dich das aufheitern würde? Und ich könnte eine deiner Geschichten lesen.«
»In Ordnung. Ich zieh mich an.«
Robin nahm die am wenigsten verschmutzten Kleidungsstücke mit in die Küche und zog sich um, während Ted telefonierte. Er kehrte rechtzeitig zurück, um noch die letzten Worte des Gesprächs zu hören.
»Wer ist Peter?« fragte er.