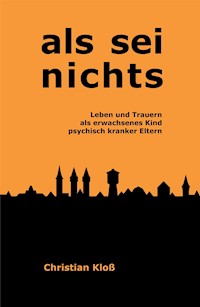
25,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ich bin elf Jahre alt, als mir meine Mutter die Nachricht überbringt: "Der Papa ist tot." Er hatte sich vor einen Zug geworfen. Es beginnen zwanzig Jahre außerordentlicher Belastungen, der Suche nach Liebe und Anerkennung sowie der Stigmatisierung, Tabuisierung und eigenen Verdrängung. Denn wenige Jahre nach dem Tod des Vaters sollte ich auch meine Mutter verlieren. Die paranoide Schizophrenie lässt sie nicht mehr meine Mutter sein. Als ich 31 bin, finden wir sie tot im Wohnzimmer auf der Couch: vermutlich Selbstmord mit Schlaftabletten. Ich brauche lange, um zu begreifen, dass ich nicht nur meine Eltern, sondern auch das Unbeschwerte meiner Kindheit und Jugend verloren hatte. Erst mit Anfang zwanzig kann ich mich auf den langen Weg machen, erwachsen zu werden in einer Welt, die mir das Gefühl vermittelt, als sei nichts. Eine Autobiografie. In schonungslosen Worten und unterfüttert mit Reflexionen, führt Christian Kloß dem Leser das Aufwachsen als Kind von psychisch erkrankten Eltern vor Augen. Mit zwei Suiziden und der von der betroffenen Mutter nicht akzeptierten Psychose, schildert der Autor einen in seiner Härte außergewöhnlichen Fall. Dabei lässt er seine therapeutischen Erfahrungen einfließen, um den betroffenen Lesern - auch im erwachsenen Alter - eine Rückmeldung zu ihrer Situation geben zu können. Scham, Ängste und Trauer werden dabei ebenso behandelt wie auch alltägliche Herausforderungen des aufwachsenden Jugendlichen: soziale Beziehungen, Berufswahl oder Freizeitgestaltung. Mit seinem Buch stößt Christian Kloß in den Kern des problematischen Aufwachsens von Kindern mit psychisch erkrankten Eltern vor: die Suche nach der eigenen Identität und der Frage "Wer bin ich?".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 617
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
In schonungslosen Worten und unterfüttert mit Reflexionen führt Christian Kloß dem Leser das Aufwachsen als Kind von psychisch erkrankten Eltern vor Augen. Mit zwei Suiziden und der von der betroffenen Mutter nicht akzeptierten Psychose, schildert der Autor einen in seiner Härte außergewöhnlichen Fall. Dabei lässt er seine therapeutischen Erfahrungen einfließen, um den betroffenen Lesern – auch im erwachsenen Alter – eine Rückmeldung zu ihrer Situation geben zu können. Scham, Ängste und Trauer werden ebenso behandelt wie auch alltägliche Herausforderungen des aufwachsenden Jugendlichen: soziale Beziehungen, Berufswahl oder Freizeitgestaltung. Mit seinem Buch stößt Christian Kloß in den Kern des problematischen Aufwachsens von Kindern mit psychisch erkrankten Eltern vor: die Suche nach der eigenen Identität und der Frage „Wer bin ich?“.
Autor
Dr. Christian Kloß, geboren in Südwestdeutschland, hat in seiner Heimatregion die erste Selbsthilfegruppe für „Erwachsene Kinder psychisch kranker Eltern“ im Umkreis von 100 Kilometern gegründet. Danach arbeitete er in verschiedenen, vorwiegend aus Fachleuten bestehenden Arbeitsgemeinschaften bei Fachtagungen und Veröffentlichungen mit und ist seitdem als Referent im Rahmen von Vorträgen, Workshops und Podiumsdiskussionen sowie als Mitgründer und Mitglied des Vorstands von „Seelenerbe e.V. – Verein für erwachsene Kinder psychisch erkrankter Eltern“ engagiert. Zum Selbstschutz muss er weitere persönliche Daten zurückhalten, weil das Thema nach wie vor in der breiten Öffentlichkeit zu sehr stigmatisiert ist.
Christian Kloß ist u.a. in folgenden Beiträgen zum Thema vertreten:
Schmidt-Biesalski, Angelika (2009): „Familie in der Krise: Kinder psychisch kranker Eltern“ (anonymisiert), TV-Dokumentation, ZDF: „Menschen – das Magazin“ (Sendetermin: 14. März 2009).
Kloß, Christian (2012): Unterstützung für Kinder psychisch kranker Eltern: Liebe, Entlastung, Trauer, in: Bauer, Ullrich et al. (Hg.): Prävention für Familien mit psychisch erkranktem Elternteil, Wiesbaden: Springer VS, S. 13-22.
Welke, Dunja (2016): „Dass ich nicht ersticke am Leisesein. Psychisch kranke Eltern und ihre Kinder“, rbb Kulturradio: Kulturtermin ( Sendetermin: 14. Juni 2016).
Bergemann, Wiebke (2016): „Allein trotz Eltern“, in: Psychologie Heute, Heft 12/2016, S. 38-42.
Christian Kloß
Als sei nichts
Leben und Trauern als erwachsenes Kind psychisch kranker Eltern
Eine Autobiografie
© 2017 Christian Kloß
1. Auflage
Umschlaggestaltung: Christian Kloß
Lektorat, Korrektorat: Nils Daniel Peiler, Alexandra Funk
Satz: Kerstin Heidemann
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN Hardcover: 978-3-7345-7040-7
ISBN e-Book: 978-3-7345-7041-4
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Als sei nichts
Für mich
INHALT
1. Prolog und einleitende Entschuldigung
2. Blumen
JUGEND: VERDRÄNGUNG
3. Der Tod des Vaters
4. Das Nichttrauern in der Familie
5. Die Grundschulzeit
6. Keine Freunde – Freunde
7. Das Gymnasium
8. Die Großeltern väterlicherseits
9. Die Großeltern mütterlicherseits – und der Beginn der Krankheit
10. Fremde Klinikerfahrungen
11. Die Nachbarschaft der zivilgesellschaftlichen Verantwortung
12. Freizeit: Musik und Sport
13. Zivildienst, Arbeiten, Australien, München
STUDIUM: BEWUSSTSEIN
14. Den Spaß wieder finden
15. Der Weg zur Besserung
16. Therapie: Das Sortieren der Puzzleteile
17. Romantische Liebesbeziehungen
18. Trauerfeier Opa
19. Brief aus den USA
20. Weihnachten auf den Straßen der Stadt
21. Die Klinik
22. Keiner hilft – also Selbsthilfe
23. Sommernächte
24. Angst und Pillen
25. Scham und Wut
26. Empathie und Distanz
SUCHE: ERWACHSEN WERDEN
27. Trauerfeier Mutter
28. Das Verhältnis zweier Brüder
29. Weihnachten in der Schweiz
30. Berufswahl oder Identität
31. Angst im Alltag
32. Epilog: Trauern, um Erwachsen zu werden
„Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich; jede unglückliche Familie jedoch ist auf ihre besondere Weise unglücklich.“
Leo Tolstoi, Anna Karenina, 1877–78
„Ich fand’s immer einfacher, wenn man jemanden hat, an den man sich lehnen kann, oder an den man sich halten kann, oder gegen den man angehen kann. Oder wo man sagen kann: ‚Dir zeig ich jetzt nochmal, wie toll ich bin.‘ - Und auf einmal ist das nicht mehr da.“
Ben Becker, WDR, Kölner Treff, 11. Oktober 2013( zum Tod des Schauspielers Otto Sander, der Beckers Ziehvater war)
1
Prolog und einleitende Entschuldigung
Die kranken Eltern nehmen den Kindern das Vertrauen in die Welt und in sich selbst – oder können es ihnen erst gar nicht geben. Ohne dieses Vertrauen, diesen Glauben daran, dass alles gut werden wird, erscheinen alle Dinge und Bemühungen, alle Absichten und Pläne sinnlos. Alles fühlt sich hoffnungslos an, das eigene Leben fühlt sich hoffnungslos an, weil man das Vertrauen in sich selbst, den Glauben an sich selbst nicht (mehr) hat. Kinder psychisch kranker Eltern erreichen also einen inneren Zustand von Hoffnungslosigkeit oder gar Zynismus, den normalerweise Erwachsene erst durch herbe Rückschläge und Verluste, durch große Niederlagen und Einbußen erfahren. Sie entwickeln sich in eine Welt hinein, der sie aus ihrer Sicht von Beginn an (oder sehr früh) nicht mehr viel Hoffnung abgewinnen können – weil sie ihr nicht (mehr) vertrauen können.
Daher fällt ihnen das Hoffen auf oder das Annehmen von Liebe, die ihnen direkt und offen zugetragen wird, aber auch das Annehmen von Glück und Erfolg so unglaublich schwer. Denn sie glauben einfach nicht mehr, dass dies tatsächlich möglich ist. Selbst wenn es also stattfindet, glauben sie es nicht bzw. misstrauen diesem so sehr, dass auch der positive Effekt nicht wirklich eintreten kann.
Der Weg ist also, dieses annehmen zu können. Doch bevor das Annehmen möglich ist, muss darüber nachgedacht, muss darüber reflektiert werden. Doch Reflexionsfähigkeit ist eine Gabe. Sie ist letztlich der Grund, warum es den viel zitierten Dummen nicht besser geht. Denn diese wissen nicht, wie sie mit ihren Belastungen umgehen sollen, haben aber dennoch die gleichen Probleme wie alle anderen. Ist es aber so, dass die Reflexion quasi immer da ist, immer mitläuft, nie zur Ruhe kommt, so kann man sich ein geruhsames Leben nur schwerlich vorstellen, denn immer wird man beobachtet von sich selbst. Gerade wenn der Leidensdruck groß ist, drängen sich Fragen auf, die zum nachdenken führen. Doch Nachdenken kann auch als „im Kopf sein“ verstanden werden, dann ist dieses Nachdenken und Formulieren von Gedanken zugleich auch Flucht vor den eigenen Gefühlen, die noch immer zu schmerzvoll sind. Ich werde also im Folgenden immer aus der versteckten Rückhand der Reflexion heraus schießen, werde von dort meine Anmerkungen anbringen und alles – wirklich alles – vorher durch diese unsägliche Schleife gedacht haben, bevor daraus auch nur eine Zeile Text entstanden ist. Und daher muss ich sagen, dass alles auch anders sein könnte, dass es nur meine subjektive Empfindung, meine Gedanken, meine Interpretation, kurz: das Ergebnis meiner Reflexion ist, was ich zu Gehör bringen möchte. So meine ich vielleicht, es sei nie jemand auf mich zugekommen, habe mich nie gefragt oder sich gekümmert. Was aber, wenn dies doch geschah, ich aber einfach nicht in der Lage war, dieses Angebot, diese Chance, dieses Glück wahrzunehmen oder annehmen zu wollen?
Dann stehe ich wohl dumm da als der große Schreihals und muss mich meiner Falschaussage schämen. Ist also alles nicht so gemeint? Ist alles eigentlich nur ein Fingerzeig und nicht mehr? Will ich damit gar nicht ernst genommen werden, will keinen erschrecken, will nichts falsch machen? Dann will ich also nicht ich sein? Stattdessen will ich mich a priori, geradezu prophylaktisch, schon mal erklären, ja, mich eigentlich entschuldigen, falls, es könnte sein, dass ich, eventuell, wie gesagt: Es könnte sein, doch etwas Falsches, etwas Anstößiges oder einfach nur Mist erzählt habe. Nicht entschuldigen aber möchte ich mich für meine Wut! Diese habe ich mir hart erkämpft durch Reflexion. Daher haue ich im Folgenden auch ab und an auf die Kacke – weil es sich richtig (und gut) anfühlt, seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen.
Wenn ich so zurückblicke, wie ich nicht selten meine Sätze formuliert habe, dann fällt mir im Rahmen der Reflexion folgende Art der umständlichen Konstruktion auf: Erst eine Art Vorrede bevor der eigentliche Inhalt kommt. Ein Umstand, der andere zum Ausruf: „Get to the point!“ verleitet hat. Warum also hier diese Entschuldigung im Vorhinein? Warum dies, da doch gerade auf die Reflexionsfähigkeit hingewiesen wurde, vor deren Hintergrund gesagt werden könnte, dass das eigene Verhalten erkannt wurde und der „Fehler“ damit einfach unterlassen werden könnte, indem diese Einleitung nicht geschrieben und indem einfach direkt drauflos formuliert wird? So könnte man durchaus fragen. Der Grund aber ist folgender: Es ist einer der Aspekte, die als alles überspannender Bindebogen mein bisheriges Leben charakterisieren und damit eine Zwanghaftigkeit ausdrücken, die hinter all den nun noch kommenden Sätzen steht.
Das Moment der Entschuldigung, der rechtfertigende Grundton einer jeden Äußerung gerade in der direkten Rede prägt mein Gefühl, prägt mein Ich. Und da es im Folgenden um weitere dieser Aspekte geht, die da lauten Angst, Scham, Kompensation und so weiter, wo sonst hätte der Faden der vorauseilenden Entschuldigung besser eingesponnen werden können als direkt am Anfang? Vielleicht schaffe ich es ja, diesen Aspekt beim Schreiben völlig oder wenigstens soweit abzulegen, dass sich nicht auch noch der Leser dazu hingerissen fühlt, völlig entnervt „Nun komm endlich zum Punkt, Junge!“ zwischen die Seiten zu rufen. Dann wäre etwas geglückt, an das ich jetzt, beim Verfassen dieser Zeilen, noch nicht so recht glauben mag: Dass sich der Text gut und flüssig, vielleicht sogar unterhaltsam, aber vor allem erkenntnisreich lesen lässt. Und um gerade Letzteres soll es gehen, denn wie jede Schrift hat auch diese im Zuge ihrer Veröffentlichung eine politische Konnotation, denn sie ist eine weitere Meinung im Konzert der demokratischen, pluralistischen Willensbildung. Ob sie Gehör findet, soll Problem der PR-Menschen und Kommunikationswissenschaftler bleiben, aber was gehört werden soll, liegt zuallererst in den Händen des Autors. Dieser hat völlig autokratisch entschieden, einen Einblick in sein Innerstes zu geben, in seine Welt, in sein Leben, denn er hält diesen für mitteilungswürdig – was lange nicht der Fall war.
Und damit bin ich wieder bei der Entschuldigung, denn das beständige Bedürfnis nach (vorauseilender) Entschuldigung geht einher mit dem Gefühl der eigenen Wertlosigkeit, der nicht empfundenen Einzigartigkeit und dem daraus resultierenden Empfinden, nicht wirklich vorankommen zu können oder zu dürfen, also mit weiteren Aspekten, die in der einen oder anderen Form in den vorliegenden Seiten eine Rolle spielen werden.
Es ist die Geschichte eines Kindes psychisch kranker Eltern und hat in dieser Form auch einen politischen sowie einen befreienden Charakter. Die Befreiung besteht in der Öffentlichmachung des Themas, des schlichten Aussprechens. In dieser Hinsicht, man muss es leider sagen, stehen wir in Deutschland anderen Nationen um einiges nach. Und damit wird es politisch, denn mit dem Aussprechen und Benennen von Zuständen sind immer Meinungen und oftmals Forderungen verbunden.
Die Liste nach Forderungen, so ließe sich an dieser Stelle fortführen, ist lang. Sie reicht von präventiven Maßnahmen über Früherkennungs- und Patenschaftsprojekte bis hin zur alles umfassenden und (jetzt noch?) geradezu utopisch erscheinenden Möglichkeit der direkten Aussprache und des Sich-Erkennengebens in der Öffentlichkeit. Kurzum, um das tolerantere und zivilgesellschaftlich verantwortungsbewusstere Umgehen mit psychischen Erkrankungen und dem Blick darüber hinaus – denn die Kinder, von denen hier die Rede ist, sind nicht psychisch krank.
Für diese – hoffentlich – künftige Umsetzung soll hiermit der Blick auf die Kinder selbst geschärft werden und zwar in zweierlei Form: geschärft für all jene, die sich der Thematik überhaupt nicht oder nur bedingt bewusst sind oder waren und einfach mehr erfahren möchten, seien es professionelle Fachkräfte oder Freunde, Eltern, Großeltern und Nachbarn; und geschärft natürlich für alle Kinder psychisch Kranker, die sich selbst suchen, weil sie sich auf der langen, viel zu früh beginnenden und viel zu beschwerlichen Reise selbst verloren haben.
Wer bin ich?
Was fühle ich?
Was ist normal?
Wie kann ich mir helfen?
Wem darf ich in die Fresse hauen?
Für diese und viele andere Fragen soll dieses Buch eine Reflexionsfläche bieten.
2
Blumen
Einmal an Weihnachten schenkte ich meiner Mutter zwei Kerzenleuchter, die ich bei Tchibo gekauft hatte. Ich sah die Leuchter in der Fernsehwerbung und dachte, dass sie mir gefielen und billig waren sie auch noch! Ich kaufte zwei Paar, eins für mich und eins für Mami, verpackte ihre Leuchter und brachte sie am Weihnachtsnachmittag mit. Abends war Bescherung und ich dachte, ich hätte eigentlich ein gutes Geschenk – okay, von Tchibo, aber die Leuchter fand ich wirklich nicht schlecht. Meine Mutter öffnete das Geschenk und ich spürte sofort, dass sie ihr nicht gefielen. Nicht nur das, sie sagte auch noch: „Ach, die aus dem Fernsehen...“ Plötzlich kam ich mir billig vor. Schlimmer noch, ich fühlte mich, als hätte ich meine Mutter unter Wert verkauft und das hatte ich ja auch! Später stellte sich heraus, dass sie sich die Leuchter selbst schon gekauft hatte.
Klar, ein Geschenk muss nicht teuer sein, aber es sollte auch kein billiger Schachzug sein. Von da an war es Zeit für die Blumen. Und Blumen bereiteten ihr Freude. In den folgenden Jahren stand ich also zu ihrem Geburtstag, zum Muttertag und zu Weihnachten in diesem schicken Blumenladen bei mir um die Ecke. Wahrscheinlich war ich dort der einzige, der unter dreißig war und dennoch mehr Euro als er Lenze zählte, in Blumen investierte. Die Verkäuferinnen schauten mich auch immer etwas komisch an, wie aus einer Mischung zwischen erstaunt und irritiert, aber auch irgendwie freudig. Ich stand dann immer zwischen all den Blumen herum und deutete auf die Sorten, die ich wollte, nachdem ich meistens mit „rot und gelb“ die Grundrichtung bestimmt hatte.
Meine Mutter mochte rot und gelb – auch hier war sie, so könnte man sagen, in der Vergangenheit stecken geblieben. Natürlich kann jeder seinen Geschmack haben, aber gibt es nicht auch Neues, das einem gefallen kann? Ich jedenfalls musste auch bei den Blumen erst noch dazulernen. Anfangs sagte ich mehr aus Verlegenheit „rot und gelb“, weil mir das auch gefällt. Soviel zum Faktum, dass ich der Sohn meiner Mutter bin! Irgendwann aber sah ich einmal eine Frau im Blumengeschäft einen wirklich sagenhaften Strauß mitnehmen. Vor meinen Augen wurde dieses grazile Etwas zusammenstellt und gebunden. Dabei spielte vor allem eine ganz bestimmte langstielige Blume eine Rolle. Natürlich weiß ich nicht, wie die heißt, aber man erkennt sie ganz leicht daran, dass sie diesen massiv wirkenden Stängel hat, der innen hohl ist. Oft habe ich auch schon gesehen, wie sich manche einfach nur eine einzige dieser Blumen in ein Glas stellen – mein Therapeut zum Beispiel. Sieht auch gut aus! Aber in diesem Straußarrangement war es einfach toll. Diese Dame wusste genau, was sie wollte. Sie wählte fünf oder sechs von diesen langstieligen Wunderblumen in weiß aus – in weiß! Die Blumenfrau nahm noch das passende Grünzeug, was ja überhaupt erst einen solchen Strauß wirklich zur Geltung bringt. Das Grünzeug macht’s! Der halbfertige Strauß schwebte so einige Minuten vor mir in der Luft hin und her, immer wurde noch etwas dazugenommen und doch sah er geradezu filigran aus, so anmutig standen die Blütenstängel in die Luft. Er war groß und anmutig, und dennoch nicht überladen.
„KLING!“ machte die Kasse und über vierzig Euro landeten auf dem Ladentisch. Ich schluckte und entschied mich für „rot gelb“. Doch diese anmutige weiße Blütenpracht ging mir nicht aus dem Kopf und bei der nächsten Gelegenheit, an Weihnachten, war ich mir sicher, was es zu kreieren galt – vierzig Euro hin oder her! Ich wollte auch meiner Mutter nahe sein, wollte mit meinem Geschenk etwas ausdrücken – dass ich sie liebe! Ich wollte nicht nur eine menschliche Reaktion wecken (für mich selbst, aber auch für sie), sondern ich wollte ihr zeigen, dass sie nicht alleine ist, gerade weil sie sich ja so isoliert vorkommen musste.
Eine meiner Tanten aus den USA sagte einmal, ich solle meiner Mutter zeigen, was ich für sie empfinde. Die Tante hatte Recht, denn ich sollte nicht nur, ich wollte auch. Durch diesen Rat warf ich einen Teil meiner Ressentiments über Bord. Nicht alles, denn immer noch war ich natürlich auch gehemmt, mich meiner Mutter vorbehaltlos zu nähern. Zu groß waren die Momente der Enttäuschung und Verletzungen. Aber ich sah in diesem Moment ein, dass es da nicht mehr allzu viele Momente geben wird, in denen ich ihr einfach nah sein könnte. Wie viele Jahre waren schon ins Land gezogen, in denen dieser verkrampfte Schmerz alles andere, alles Menschliche zwischen uns erstarren ließ? Auch wenn es nur ein kurzer Moment wäre und er so erscheinen müsste, als würde ich alles andere negieren, so wollte ich wenigstens für diese wenigen, kurzen Momente im Jahr einmal mein Herz öffnen, ganz gleich wie die Reaktion sein würde.
Dazu gehörte also auch, sich innerlich darauf vorzubereiten, dass der nächste Moment der Enttäuschung als Sohn nicht fern sein würde. Irgendetwas, das wusste ich, würde passieren, was diesen kurzen Moment, so ich ihn denn herbeiführen könnte, wie ungeschehen erscheinen lassen würde. Irgend ein Wort, eine Geste, oder einfach gar nichts, das blanke Nichts, würden wieder in die alte Kerbe des Jungen schlagen und das verschmähte Kind würde sich wieder unverstanden und frustriert vorkommen. So leitete ich die Blumenphase ein. Nachdem ich aus den USA zurückkam, begann mein erster Besuch bei meiner Mutter damit, sie zu umarmen. Ein komisches Gefühl. Sie roch unmöglich, hatte sich vielleicht seit Tagen nicht mehr gewaschen. Ihr Aufzug war, wie ich ihn seit Jahren kannte: ein Pullover, wochenlang getragen oder schlecht gewaschen, auf dem sich Flecken befanden; die Haare offen und ungepflegt; die Füße entweder barfuß oder in kleinen weißen Söckchen, aber auf jeden Fall in diesen seltsamen Hausschuhen, die sie wahrscheinlich im Supermarkt kaufte und die man… ja, woher kannte man solche Hausschuhe? Ich habe sie immer nur bei meiner Mutter wahrgenommen. Positiv ausgedrückt, könnte man sagen, dass es die Hausschuhe von Arzthelferinnen waren. Weiß waren sie und hatten eine perforierte Oberfläche, lauter kleine Löcher, und sie waren alt und auf der Seite schon aufgerissen.
Wenn es kühler war, hatte meine Mutter meistens noch eine Turnhose an. An Weihnachten war dies wahrscheinlicher, aber weil das weiße Weihnachten mit den entsprechenden Temperaturen auch nicht mehr das war, was es mal gewesen ist, standen die Chancen gut, dass ich meiner Mutter nur in Unterhose begegnete. So saß sie ja immer in der Küche und blickte starr in Richtung Haustür. Ich hatte sie also im Arm und auch für sie schien es seltsam zu sein. Etwas ganz Neues! Mein Sohn kehrt zurück und mag mich, umarmt mich, küsst mich! Denn einen Kuss gab ich ihr dann auch noch. Es war eine kleine Überwindung für mich, nicht wegen ihrer Erscheinung oder weil sie roch, sondern weil es so ungewöhnlich war. Das Normalste der Welt zwischen Mutter und Sohn hatte ich seit beinahe fünfzehn Jahren unterlassen.
Ganz egal, was andere meinen, ich halte dies für eine normale Sache, die so sein sollte, bei aller notwendigen und gesunden Abnabelung vom Elternhaus. Dass es sie auch irritierte, merkte ich daran, dass sie sich nach einer kurzen Sekunde der Umarmung wieder lösen wollte, doch ich hielt sie fest und sie hatte damit nicht gerechnet. Aber da braucht sich eine Mutter nicht lange orientieren, Umarmungen haben Mütter drauf, sofern sie wenigstens einmal richtig Mutter gewesen sind und das war sie. Sie war ja nicht von vornherein krank – sonst wäre ich wahrscheinlich selbst schon sehr früh auch psychotisch geworden, hätte mir gar schon früh das Leben genommen. So standen wir da und umarmten uns und es war für einen Moment Ruhe.
Irgendwann wurde ihr es aber unangenehm, so hatte ich das Gefühl. Nun, man soll ja nicht gleich zu Anfang übertreiben. Aber dieser Akt der Umarmung und des Kusses wurde bei uns dann zum Ritual. Ein schönes Ritual. Plötzlich verstand ich auch, wie andere Menschen in Form dieses Rituals, in Form von Zuneigung, kommunizierten! Es war eine machtvolle Art der Kommunikation. Wenn sie mir mal wieder so arg auf die Nerven ging, dass ich es schon nach wenigen Minuten nicht mehr aushielt und einfach nur weg musste, dann entzog ich ihr diesen Akt, nahm am Ritual nicht teil. Mensch, so machen das Menschen, auch wenn sie vielleicht dabei nicht halb soviel denken und reflektieren wie ich. Was meiner Meinung nach nur zeigt, wie normal das eigentlich ist und sein sollte: Umarmen! Zack! Und schon ist mehr gesagt als mit jedem Gedicht! Und man muss eigentlich gar nicht dabei denken! Im Gegenteil, aufs Fühlen kommt es an. Umgekehrt war es auch eine Bekräftigung der Zuneigung, auch wenn dies bei meiner Mutter irgendwie nicht so ganz den Boden zu treffen schien, auf den ich dieses Saatkorn gerne hätte fallen sehen. Ich erreichte sie zwar für einen kurzen Moment, aber der kleine Junge, der ich mal war, stand immer noch da und hätte gerne mehr. Er hätte gerne seine Mutter zurück, eine, die noch mehr geben konnte als diesen kurzen Moment. Doch das musste ausbleiben, das wusste wiederum der große Junge. So kam ich dann Jahre später mit diesem Filigranstrauß zurück. Weiß wäre auch möglich und vor allem schön gewesen, aber ich setzte natürlich auf Rot. Doch der Schuss ging nach hinten los. Mit dieser seltsam anmutenden Pflanze konnte meine Mutter nichts anfangen. Sie war enttäuscht, hätte lieber einen guten alten Blumenstrauß – in rot und gelb – gehabt, vierzig Euro hin oder her. Ich war auch enttäuscht. Am nächsten Tag ging ich zu Freunden, bei denen ich eingeladen war. Einen gleichen Strauß, den ich ebenfalls zuvor gekauft hatte, brachte ich der Dame des Hauses als Zeichen meiner Ehrerbietung mit und diese war darüber mehr als verzückt. Scheinbar eine ihrer Lieblingsblumen.
Dieses Kontrastprogramm erinnerte mich natürlich sofort an meine Mutter und ich wusste nicht mehr, was ich sagen sollte. Im nächsten Jahr kehrte ich wieder zum altbekannten Strauß zurück – Rosen, so hatte ich herausgefunden, waren mehr ihr Ding. Auch gut. Unser Ritual hatte auch weiter Bestand, ja sie forderte den Kuss immer nonverbal ein. Gerne. Ich war froh, dass ich dies geschafft hatte, dass ich mich im Erwachsenenalter meiner Mutter als Mutter nähern und sie so erfahren konnte. Und ich glaube, sie war auch froh. Es waren und blieben kurze Momente, aber ich war froh darum und bin es noch heute. Es war eines von jenen Dingen, von denen man sich wünscht, sie getan zu haben, so dass man es nicht bereut, wenn es dazu ein für alle Mal zu spät geworden ist.
JUGEND VERDRÄNGUNG
3
Der Tod des Vaters
Als ich 11 Jahre alt war, brachte sich mein Vater um. Das heißt, erstmal war er einfach weg. Meine Mutter ließ meinen Bruder und mich zunächst im Dunkeln und mein Bruder erfuhr die Nachricht erst später von unserem Großvater. Wie er das empfand, kann ich nicht sagen und schon gar nicht, wie es ihm in der Zeit der Ungewissheit ergangen sein muss. Ich erfuhr es immerhin direkt von meiner Mutter. Die Erinnerung beginnt direkt an meinem Schreibtisch mit meiner Mutter, die sich schon tränenüberströmt daran macht, mir die Hiobsbotschaft zu überbringen. Ich weiß nicht, was jetzt kommt, aber es deutet sich nichts Gutes an.
Sie sagt, dass sie mir etwas sagen möchte und es klingen ihre Worte im Ohr: „Der Papa ist tot.“ Ich konnte diesen Satz eigentlich auswendig, doch jetzt, da ich ihn niederschreiben will, bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob sie „Papa“, „Papi“ oder „Vati“ oder „Dein“, „Unser“ oder „Der“ sagte. Seltsam, dass ich mich daran nicht mehr erinnere und seltsam auch, dass mir die Genauigkeit so wichtig ist. Dann sagte sie: „Er hat sich umgebracht.“
Ich sitze an meinem Schreibtisch und bin beschämt, meine Mutter so heftig weinen zu sehen. Mein Blick ist irritiert auf den Schreibtisch gerichtet und ich bin schon da mit der Situation überfordert. Während sie kniend neben mir schluchzt, höre ich ihre Worte und mein Blick geht nach innen. Ich weiß nicht, welche Reaktion ich gezeigt habe – vielleicht habe ich meinen Arm um sie gelegt – aber ich blieb dabei sitzen auf meinem Stuhl.
Dabei formte sich ein Gedanke von solcher Klarheit, dass ich diesen niemals vergessen werde: Jetzt muss ich selbst dafür sorgen, eine erfüllte Kindheit zu haben! Es war der Beginn einer rasanten Fahrstuhlfahrt ins vermeintliche Erwachsenwerden.
Ich wurde mit einem Mal aus den sanften Ebenen der unbewussten Kindheit in die kalten Höhen der bewussten Erwachsenenwelt gerissen. Als ob mir eine Liste zum Abhaken der zu erledigenden Dinge gegeben wurde, so hakte ich im Geiste all jenes ab, das nun nicht mehr sein, nicht mehr möglich wird. Bilder, wie etwa das Fußballspielen mit dem Vater, gemeinsames Herumtollen und ähnliches streiften mein inneres Auge und wurden sofort als „nicht mehr“ kategorisiert.
Es war die totale Verdrängung und der starre Blick nach vorne. Vielleicht die einzige Rettung für einen 11-Jährigen, damit umzugehen, jedoch zugleich der Beginn eines Dolchstoßes, der mich sechs Jahre später ins Straucheln bringen, aber dessen blutige Spur erst über ein Jahrzehnt später für mich sichtbar werden sollte.
Und so fühlte ich mich stark, es war wie ein Weckruf für ein neues Leben, wie etwas Besonderes, wie nicht von dieser Welt, wie ein Stempel auf der Stirn, wie andauerndes Adrenalin, wie das Werden zum Wolf, wie der Hüter eines Geheimnisses, wie das Zentrum des Universums – und wie die zermürbende Stille des einsamen Überlebenden. Nein, ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte.
Einige Wochen später spielte ich im Schulhof mit Klassenkameraden mit einem Tennisball „Ausscheiderles“: Man schießt den Ball abwechselnd an eine Betonwand und wer mit nur einem Schuss die Bande nicht trifft, scheidet aus. Der vom Schmutz schon dunkelgrüne Ball flitzt über die Betonplatten des Schulhofes, wir haben es eilig, denn es ist nur die kleine Pause, aber zu dritt kann man da ein Spielchen wagen, ohne den Spaß zu verlieren. Da kommt plötzlich Sandra über die Wiese zwischen Realschule und Gymnasium herübergerannt. Ich habe sie kaum wahrgenommen, so weit war die Wiese weg von unserem Ende des Schulhofs, aber als plötzlich die Worte durch die Luft schießen, ist sie mit einem Mal ganz nah und ich höre sie noch wie im Echo rufen: „Hey, Christian, stimmt es, dass Dein Vater sich umgebracht hat?“
Kam sie deshalb den Weg von der Realschule herübergerannt? Hatte sie mich gesehen und wollte diese Frage unbedingt geklärt haben? Oder war es reiner Zufall und sie war einfach gerade in der Nähe? Ich habe das nie gefragt und wollte es wahrscheinlich auch nicht. Jedenfalls trat mit dieser herausgerufenen Frage eine beklemmende Stille zwischen uns ein, die meine beiden Schulkameraden, denen ich nichts erzählt hatte, hilflos um sich blicken ließ. Dann aber folgte eine Intervention von einem der beiden, indem er so etwas sagte wie: „So was kannst Du doch nicht fragen!“ Also wussten sie offenbar etwas – und Sandra wurde angeklagt für ihre Direktheit. Ich aber hatte noch nie etwas übrig für das Verschweigen der Wahrheit und setzte sofort mit meiner Antwort nach, um zum einen die peinliche Spannung zu lösen, aber auch, um nicht den Eindruck zu erwecken, mich vor meiner eigenen Geschichte zu drücken.
Obwohl diese Beschreibung klingen muss wie die Darstellung eines Menschen, der sich in voller Größe seinem Schicksal stellt und lieber den Schmerz wählt, als das versuchte Gleiten durch sanftere Wogen der vermiedenen Taktlosigkeit und des Schein-Wahrens, so, als ob schon eine Art abschließender Friede mit allem geschlossen wurde, so täuscht dies grundlegend. Diese vermeintliche, taktvolle Distanz in der Antwort auf Sandras drängende, mädchenhaft neugierige Frage, war eigentlich nichts anderes als der Gipfel emotionaler Verdrängungsleistung. Eine Nähe zum eigenen Ich, zum inneren Selbst, mir also selbst in die Augen zu schauen und zu akzeptieren, war einfach nicht möglich. Vielmehr war es ein Schein-Wahren, aber ein verzweifeltes, das auf ganz dünnen Beinen steht. Und ich bin geneigt zu sagen: Dumm nur, dass es mich nicht von eben diesen geholt hat.
Diese kleine Szene bildet zugleich Zusammenhänge meines gesamten späteren Lebens ab: Die auf den ersten Blick eher verständliche, empörte Reaktion der Schulkameraden auf Sandras Unverhohlenheit kann auch als Unfähigkeit, bornierte Reserviertheit, falsche Scham oder übertriebene Angst gedeutet werden. Denn keiner meiner Mitschüler hatte zuvor auch nur einen Ton gesagt. Damit wurde meine Situation gleichsam nicht anerkannt, weil verschwiegen. Das kann auch damit zu tun haben, dass ich in der Grundschule und der späteren Unterstufe des Gymnasiums wenig Freunde hatte, kurzum also nicht gerade beliebt war. Und wer, wenn nicht Heranwachsende, sind in ihrem Umgang und Zeigen der gegenseitigen Sympathien – als auch Antipathien – deutlicher?
Dieses Schema jedenfalls setzte sich leider fort. So wussten auch Erwachsene nicht, wie sie mit mir umgehen sollten. Zwar gab es rühmliche Ausnahmen, wie etwa eine Deutschlehrerin, die den Versuch der Aussprache unternahm, aber zum einen ist der richtige Umgang mit dieser Situation schwer und zum anderen habe ich konsequent abgeblockt, wenn es hieß: „Wie geht’s Dir?“. „Gut“, sagte ich und ließ dieser Deutschlehrerin gar nicht die Chance, zu mir durchzudringen. So kann ein Klima der Unsicherheit und Tabuisierung, der Unwissenheit und fehlenden Aufklärung zu zumindest unfruchtbarem Handeln verstärkend beitragen. Auch wenn niemandem eine Selbstverständlichkeit im Umgang mit dem Thema Freitod abverlangt werden kann, so trägt jedenfalls das genaue Gegenteil davon, nämlich Außeralltäglichkeit, und zwar ganz egal, auf was sich diese dann beziehen mag, zur faktischen Erhöhung der Wahrscheinlichkeit bei, dass falsch gehandelt wird. Wie aber geht man richtig mit einem 11-Jährigen um, dessen Elternteil sich kürzlich das Leben genommen hat?
4
Das Nichttrauern in der Familie
Bevor mir meine Mutter den Tod meines Vaters mitteilte, gab es mehrere Tage, an denen unser Vater einfach nicht da war. Wir wurden damit getröstet, dass er unterwegs sei und noch käme. Es stellte sich heraus, dass wir warten mussten, weil unser Vater schlicht nicht identifiziert werden konnte, aber das erfuhr ich erst viel später. Mein Vater machte sich eines Nachts oder Tages auf den Weg in den Westteil der Stadt, in dem sich der örtliche Kleinstadtbahnhof befand. Dort warf er sich vor einen vorbeirasenden Zug.
Von einem Leichnam war dann nicht mehr zu sprechen und die Unkenntlichkeit so groß, dass die Polizei in der Zeit vor der DNA-Analyse lange rätselte, wer der Tote sein könnte. Und als dann die Vermisstenmeldung durch meine Mutter eintraf, wurde nach verwertbaren Hinweisen gesucht, die einen Zusammenhang herstellten konnten.
Dieser Zusammenhang war schließlich eine Zigarettenschachtel, die er bei sich trug. Es war die gleiche Marke, die er damals rauchte. Ein dürftiger Zusammenhang und damals wollte ich auch nicht mehr wissen. Heute aber würde ich gerne die ganze Geschichte kennen. So war es also die Zigarettenschachtel, die Klarheit brachte.
Unser Vater hatte keinen Abschiedsbrief hinterlassen und wenn doch, so hat ihn unsere Mutter vor uns verborgen. Ausgehend von der Vorgeschichte, die sich in unserem Haus zutrug, gab es wohl keinen alles auslösenden Grund. Vielmehr war sein Selbstmord kein ultimativer Akt aus einem einzigen Grund, sondern aus vielen Aspekten zusammengesetzt. Es war einfach zu viel und für meinen Vater nicht mehr tragbar. Es muss für ihn einfach keinen Ausweg mehr gegeben haben aus einem Zusammenhang, der so belastend für ihn gewesen sein muss, dass ihm der Freitod als die einzig erlösende Tat erschien. Nur aus welchem Zusammenhang wollte er heraus? Ich habe erlebt, wie sich meine Eltern stritten und es war daraufhin keine Erklärung gekommen, die mich befriedigt hat.
Ich habe mitbekommen, dass sich die Probleme meines Vaters am Arbeitsplatz immer mehr ausbreiteten. So hörte ich von meinem Großvater die Geschichte, dass sein Schwiegersohn eines Tages von seinem Arbeitgeber im Rahmen eines Projektes dazu aufgefordert wurde, einen Wagen mit spezieller Antriebstechnik zu Testzwecken in der Region zu bewegen. Statt die Fahrt wie erwartet zu machen, fuhr er bei seiner in der Nähe lebenden Mutter vorbei und trank Kaffee. Jahre später erfuhr ich, dass die eheliche Beziehung meiner Eltern schon sehr früh auf wackligen Füßen stand, was sich – vielleicht ausschließlich oder auch unter anderem – auf sexuelle Kontexte bezog. So machte mein Vater bereits kurz nach der Eheschließung einer gemeinsamen Freundin deutliche Avancen, die diese jedoch abblockte. Auch war das Verhältnis zu seiner eigenen Mutter sehr belastet, worauf ich später noch eingehen werde.
Jahre später führte mich mein Interesse an der Vergangenheit meines Vaters zu dessen Arzt. Ich wusste, dass er mit diesem über Jahre hinweg intensive Gespräche führte und der Arzt doch einiges wissen musste. Im Detail bekam ich leider keine Auskunft, aber die Quintessenz war, dass mein Vater Anzeichen von psychischen Störungen aufwies. So waren seine Sätze, so der Arzt, zwar in der Diktion klar und deutlich, der Gesamtzusammenhang aber eher verwirrend und konfus. Mein Vater orientierte sich auf der Suche nach der Lösung seiner Probleme irgendwann auch immer mehr an alternativen Sichtweisen. Davon zeugen zahllose seiner Bücher, die von transzendenten Wahrnehmungen, verschwörungstheoretischen Kontexten und alternativmedizinischen Praktiken handelten. So versuchte er seine Probleme zu lösen, seine Fragen zu beantworten.
Er wollte über seinen Beruf als Chemielaborant hinauskommen, indem er versuchte, das Abendabitur zu bestehen. Aber er fand keine Antwort und keine Lösung. Seine Weltsicht schien sich in ihrer Komplexität immer mehr von der Realität abzuwenden. Er versuchte es, doch wenn er wirklich krank war, dann lagen dort, wo er suchte, keine Antworten. Immer erschien er beim Arzt erst kurz vor Praxisschluss, um die volle Aufmerksamkeit zu bekommen und auch die Zeit ausdehnen zu können. Aber auf die Ratschläge des Arztes ging er offenbar nicht ein. Insofern war er Opfer im Rahmen seiner Unfähigkeit, am Kern seiner Probleme anzusetzen. Diese Beschreibung trifft zu, wenn man die Überlegung der eigenen psychischen Störung ernst nimmt. Wenn man sie nicht ernst nimmt, so bestanden dennoch andere Zusammenhänge, die darauf hinweisen, dass viele Probleme selbst verschuldet waren.
Auch schien mein Vater im Umgang mit seinen Söhnen überfordert. So war er über die Unterschiedlichkeit zwischen mir und meinem Bruder so erzürnt, dass er meinen Bruder an den Haaren packte und mit einer Hand in die Luft hob. Mein Großvater beobachtete diese Szene und stellte meinen Vater dann zur Rede. Mich erschreckt dabei nicht nur die erzieherische Unfähigkeit meines Vaters und dessen physisch gewaltsames Potenzial, das dahintersteckt, sondern auch der reflexartige Verdrängungsmechanismus, der dahinterstecken muss, dass mein Bruder, der an den eigenen Haaren in der Luft baumelte, nichts mehr davon wusste. Vielleicht war er zu klein und dennoch, ich selbst habe etwas Ähnliches erfahren, in dem sich die Ausweglosigkeit meines Vaters widerspiegelte. Als ich etwa acht Jahre alt war, waren wir bereits in unser neues Haus eingezogen, das aber stellenweise noch einer Baustelle glich. Ich sprang zwischen den Gerätschaften herum und meinem Vater wurde es mit mir dann zu bunt, so dass ich mich in mein Zimmer flüchtete und auf mein Bett warf. Mein Vater rannte mir hinterher und prügelte in mir bis dato unbekannter Härte auf meinen Rücken ein. Ich weinte. Und irgendwie begann ich zu verstehen, wie ich ihn in Rage versetzt haben musste. Er schlug hart und lange. Vor allem lange. Diese Länge war es, die mein „Verständnis“ weckte. Am selben Tag noch entschuldigte er sich für seine Tat und ich vergab ihm, denn natürlich wollte ich meinen Vater nicht verlieren und natürlich wollte ich ihn schützen. Und natürlich wollte ich, dass alles wieder gut wird. Alles.
Tatsächlich anzuerkennen, was mir von meinem Vater zugefügt wurde und es auch dementsprechend zu benennen und vor allem die damit zusammenhängenden adäquaten Gefühle zu fühlen, aber war mir nicht möglich. Selbst bei körperlicher Gewalt, die insofern einfacher begreifbar ist, weil man mit dem Finger darauf deuten kann. Wie aber steht es um den Tod meines Vaters? Wie steht es um dessen Entscheidung, mit seinem Suizid nicht nur sich selbst von seinen Lasten zu befreien, sondern damit zugleich auch enorme Lasten auf die Schultern seiner Söhne zu legen, indem er ihnen viele, viele, ja unendliche einzelne Momente der väterlichen Entlastung vorenthält? Wie steht es darum? Habe ich damit abgeschlossen, habe darauf auf gesunde Distanz gehen können in der Zwischenzeit? – Nein.
Somit wurde zunächst nichts gut. Auch deshalb, weil unsere Familie mit Rückschlägen nicht wirklich umging. Aktionismus prägte stattdessen das Tagesgeschäft. Man musste also etwas tun, um sich abzulenken. Was das fehlende Umgehen mit Rückschlägen angeht, so war ich nicht auf der Beerdigung meines Vaters. Ich mache meine Mutter dafür verantwortlich, weiß aber gar nicht, warum sie dies „entschied“. Vielleicht war es die gängige Auffassung, dass man Kinder unter einem bestimmten Alter besser nicht mit auf Beerdigungen nimmt, vielleicht hatte ihr auch jemand dazu geraten.
Sie fragte mich, ob ich auf die Beerdigung gehen wollte oder nicht: „Du musst nicht, wenn Du nicht willst.“ Aber ich spürte, dass es mehr ihr Wunsch war, dass ich nicht gehe, als umgekehrt. So gehorchte ich und sagte: „Ich bleibe zu Hause“, obwohl ich eigentlich mitwollte.
Heute fühle ich mich betrogen um die Chance, bei der Beerdigung meines eigenen Vaters dabei gewesen zu sein und um die Chance, eine Verarbeitung zu beginnen und auch zu begreifen. Wurden solche Zeremonien nicht aus diesem Grunde eingerichtet? Das langsame Herablassen des Sarges, der Wurf der Erde und der Segen des Geistlichen sind symbolische Akte, die den Beteiligten helfen sollen, mit dem eigenen Leben voranschreiten zu können. Wie soll man dann damit beginnen, wenn alle anderen nur diesen einen Weg kennen und gehen, man selbst aber plötzlich darin erfinderisch sein muss, einen neuen Weg zu finden?
Zugleich war mir auch als junger Teenager klar, dass ich nicht das verbriefte Recht auf Chefsessel und Legosteine hatte. Aber darf ich als Kind nicht Verständnis und Einfühlungsvermögen von meiner Mutter erwarten? Muss sie mir das nicht geben, weil ich sonst nicht lernen kann, dass ich ernst genommen werde und weil ich sonst kein Vertrauen aufbauen kann, dass ich verstanden werde und dass es völlig in Ordnung ist, Wünsche zu haben und wie man als heranwachsender Mensch damit umgeht, wenn diese nicht erfüllt werden können, aus welchen Gründen auch immer?
Vor diesem Hintergrund also, vor der Vernachlässigung meiner emotionalen Situation, meiner Empfindungen und emotionalen Bedürfnisse, vor diesem Hintergrund fand der Umgang mit dem Tod meines Vaters statt. Auch hierbei wurde ich alleine gelassen, auch hier kam keiner auf mich zu und auch hier kam es daher zu keiner Kommunikation, zu keiner Aussprache, zu keinem Versuch, sich gegenseitig zu verstehen.
5
Die Grundschulzeit
In der Grundschule sowie später im Gymnasium hatte ich nicht viele Freunde. Eigentlich fing das schon im Kindergarten an. So erzählte mir mein Großvater, wie er sich jedes Mal auf dem Weg zum Kindergarten fragte, was ich denn heute wohl wieder angestellt hätte. Ich war eher bekannt als Unruhestifter denn als braves Kind. Einmal brach ich mir beim Sturz von einem Baum beide Handgelenke. Weil es Sonntag war, mussten wir in die Notambulanz und dort wurden meine Unterarme vollständig in schweren Gips eingekleidet, weil die in der Notambulanz keinen Kindergips machen. Als ich dann mit diesen dicken Unterarmen in meinem Kindergarten erschien, durfte ich nur unter dem Versprechen hinein, niemanden mit meinem Gips zu schlagen.
Das erschien mir damals unverständlich und ich war empört. Nie hatte ich auch nur einen Gedanken gehegt; meine Arme waren mir im gebrochenen Zustand viel zu wertvoll, da wollte ich nicht auch noch das Risiko eingehen, diese weiter zu beschädigen. Wahrscheinlich kam es den Erzieherinnen gerade recht, mir mal zu zeigen, wo der Hammer hängt. Ähnlich radikal wurde mir meine Identität geraubt. So wurden wir gebeten, Säuglingsbilder von uns selbst mitzubringen. Diese sollten dann mit Namen beschriftet und auf ein großes Plakat geklebt werden.
Ich nahm also zwei Bilder aus meinem Fotoalbum zur Auswahl mit. Im Kindergarten legte ich die Bilder vor und war stolz darüber, wirkliche Prachtexemplare von Abbildungen mitgebracht zu haben. Doch die Kindergärtnerin sah auf dem einen Bild mich und auf dem anderen meinen Bruder. Ich verstand die Welt nicht mehr. Wie konnte diese Frau behaupten, mein Bild besser zu kennen als ich? Was war geschehen? Der Grund war einfach: Mein Bruder, der natürlich im gleichen Kindergarten war, hatte kein Bild von sich!
Es gab einfach keine Fotos über das Aufwachsen meines Bruders. Während ich ein ganzes Fotoalbum besaß, mit abgeschnittener erster Haarlocke, mit Eintragungen darüber, wann die ersten Zähne kamen und das erste Wort gesprochen wurde, so bekam mein Bruder von seinem Paten zur Taufe zwar ein solches Album geschenkt, doch es blieb leer. Und auch sonst sucht man nach Bildern, auf denen mein Bruder jünger als neun Jahre ist, vergeblich. Unser Vater hat einfach keine gemacht. Er hatte kein Interesse daran und hielt meinen Bruder wohl für nicht wertvoll, für nicht liebenswert genug. Seine Konzentration richtete sich vorwiegend auf mich und er war von meinem Bruder enttäuscht. Von mir wiederum war er begeistert, hielt mich für etwas Besonderes (ähnlich mein Großvater, der mich später ständig mit der fixen Idee nervte, ich müsse doch eine Begabtenschule besuchen). Mein Vater also behandelte seine Söhne unterschiedlich und der Gipfel war der schon angesprochene Moment, in dem er meinen Bruder an den Haaren packte und in die Luft hob, als Ausdruck seines Frustes. Was muss es für ein verzweifelter Kampf meines Bruders gewesen sein, sich seine eigene Identität aufzubauen? Ständig die Anzeichen zu verkraften, dass er unterschiedlich behandelt wurde, dass ein anderer bevorzugt wird?
Diesen Ausfall an Zuneigung und Sorge versuchte später unser Großvater zu kompensieren, allerdings war er aufgrund der Unterschiede zwischen den Generationen nur mäßig erfolgreich. Mir wiederum wurde im Kindergarten so mein Bild weggenommen und darunter mit Filzstift der Name meines Bruders gesetzt – und ich kam mir verraten vor. Später nahm ich dieses Bild und strich den Filzstift dick mit Bleistift aus und klebte es zurück in mein Album. Dort kann man besichtigen, dass ich es tatsächlich auf dem Bild bin, denn daneben finden sich Aufnahmen der gleichen Situation.
So ging die Kindergartenzeit dahin bis zur Einschulung. Zuvor hatte ich einen meiner wenigen wachen Momente, als ich gefragt wurde, ob ich denn in die Schule möchte, oder lieber noch ein Jahr im Kindergarten bleiben will. Die Antwort war für mich klar: „Ich will noch spielen!“ Daher wurde ich erst mit sieben Jahren eingeschult und blieb der Schreihals und Störenfried, der ich schon zuvor war. Aber ich erbrachte meine schulischen Leistungen und so gab es nichts zu meckern. Auch schlug ich nie dermaßen über die Stränge, dass etwa wegen grobem Fehlverhalten meine Eltern einbestellt werden mussten – zumindest nicht meines Wissens. Die andere Seite der Medaille jedoch war meine chronische Unbeliebtheit, die mir erst gegen Ende der Grundschule deutlich wurde. Damals kam ich zum ersten Mal mit dem Begriff „Party“ in Kontakt. Eigentlich ging es um eine Geburtstagsfeier einer Klassenkameradin, aber sie sagte eben nicht „Geburtstagsfeier“, die irgendwann um drei Uhr losgeht und bei der um acht alle wieder zu Hause sind. Nein! Sie sagte „Party“ und damit war sofort klar, hier wurde richtig gefeiert und dass das eine große Sache ist, bei der man dabei gewesen sein musste.
Das Ganze ging viel später erst los und alle konnten übernachten und alle waren eingeladen! Alle, außer ich und Mohammed, der einzige Ausländer der Klasse. Mit dieser Direktheit und der darin liegenden Grausamkeit von Grundschülern wurde ich also zurückgewiesen. Und das tat sehr weh, aber ich verdrängte dieses Gefühl und konnte auch nicht verstehen, was vor sich ging. War ich tatsächlich so schlimm? Mir ging alles recht leicht von der Hand. Ich war überdurchschnittlich gut in allen Fächern, dazu ein passabler Sportler und demnach irgendwie nicht in die Schranken zu weisen. Aber ich ließ andere oft auflaufen, wenn sie meiner Meinung nach zu doof waren, das eine oder andere zu erledigen oder schlicht zu kapieren. Ich hatte also selbst meine eigene Art der Direktheit eines Grundschülers. So kam ich schnell in Konflikte und hatte auch ein paar Schlägereien, in denen ich dann allerdings unterlegen war. Wirklich „mit Überzeugung“ jemandem körperlich weh zu tun, war also nie mein Ding. Vielmehr war pure Angst die Triebfeder, denn zu echter Grausamkeit fehlte mir die Einstellung.
Einmal beobachtete ich eine Streiterei auf dem Schulhof, in der einer der wenigen Ausländer unserer Schule verprügelt wurde und der Junge war hoffnungslos unterlegen. Ich stand daneben und konnte nur zuschauen, ohne dabei die Freude der Überlegenheit zu teilen. Stattdessen tat mir dieser Junge leid und ich wurde richtig traurig beim Anblick der Qual – doch ich konnte nichts tun. Zwar traf mich das Gefühl des Alleingelassenseins und irgendwie fühlte ich mit, aber die Courage, mich für ihn einzusetzen, hatte ich nicht – aber ebenso auch nicht das Bedürfnis, mitzumischen. Ich fühlte mich mit einem Mal ähnlich alleine wie dieser Junge, auch wenn ich mich sonst in keiner Weise mit ihm oder seinem Lebensstil identifizierte. Daher traf mich die Ausgrenzung bei der Party auch doppelt hart, denn plötzlich fand ich mich in einer Kategorie wieder, von der ich bis dahin überzeugt war, nicht dazuzugehören.
Heute verwundert mich vielmehr, dass ich diese Erinnerung noch immer so deutlich vor Augen habe. Warum kann ich diese Empfindungen noch so klar rekonstruieren? Vielleicht war es kein Einzelfall und stattdessen schon im Alter von acht Jahren charakteristisch für mich? Vielleicht habe ich schon damals öfter diese Ausgrenzung gespürt? Vielleicht also liegt in der Grundschulzeit – oder gar noch früher – der Startpunkt eines Kampfes, der sich wie das Geflecht eines dichten Gewebes durch mein folgendes Lebens ziehen sollte.
Ein Kampf, den ich letztlich verlieren, für den ich einen hohen Preis zahlen sollte, denn er war von Beginn an aussichtslos. Und dennoch ging ich in ihn hinein, weil ich nicht wusste, was eigentlich vor sich ging. Ich kämpfte für die Veränderung der Wahrheit, für die Kreation von Ressourcen, die es gar nicht gab. Ich kämpfte für Liebe, wo keine oder nur bedingt welche gegeben werden konnte. Ich kämpfte für Verständnis, wo blanke Ratlosigkeit war. Ich kämpfte für Mitgefühl, wo kalte Apathie herrschte. Ich kämpfte für Aufmerksamkeit, wo unüberwindbare Ablenkung mir keinen Zugang gewährte. Ich kämpfte gegen alle Symptome, die mit der psychischen Erkrankung meiner Eltern einhergingen.
6
Keine Freunde – Freunde
Dieser Kampf setzte sich im Gymnasium fort. Doch zunächst feierte ich Erfolge auf anderem Gebiet. So hatte ich plötzlich den Eindruck, als könnte ich meine Umgebung viel genauer wahrnehmen, als könnte ich die Zusammenhänge besser lesen und wäre mir dieser viel bewusster. Es kam mir so vor, als hatte der Tod meines Vaters für mich eine Art „Weckrufcharakter“. Nach diesem Weckruf machte ich mich viel bewusster daran, Freunde zu finden, und ich hatte gar das Gefühl, dies steuern zu können. Ich spürte, wie ich durch bewusstes Handeln mein Verhältnis zu meinen Mitschülern soweit verbessern konnte, dass Freundschaften entstanden. Zugleich fühlte ich mich voraus, so, als hätte ich einen Vorsprung. Ich spürte ein gewisses Verständnis von der Welt, die mich umgab, zu besitzen und das gab mir ein gutes Gefühl. Doch ich ließ mein neu gewonnenes Bewusstsein niemals durchblicken, auch wenn ich mir damit sehr erwachsen vorkam. Doch das sollte sich als Fehlinterpretation herausstellen, denn 15 Jahre später stellte ich fest, dass Erwachsensein nicht bedeutet, irgendwelche Verantwortung zu übernehmen, sondern „für sich selber sorgen zu können“.
Damals aber fühlte ich mich weiter entwickelt als meine Mitschüler und meinte, diesen etwas voraus zu haben. So gewann ich mehr und mehr Freunde unter meinen Mitschülern, wenngleich immer noch Einladungen zu bestimmten Partys ausblieben. Natürlich war ich auch kein Liebling, so wurden die wahrscheinlich allseits bekannten Feindschaften zu Mitschülern aus der selben Stufe oder der nächsthöheren gepflegt, was aber nicht hieß, dass ich mir immer unterlegen vorkam, ja geradezu Angst hatte, diese Feindschaften könnten in der einen oder anderen tatsächlichen Konfrontation münden. Über den Eindruck aber, dass ich meine Welt beeinflussen konnte, entwickelte sich das Leitprinzip meines weiteren Schülerlebens. Daneben aber entwickelte sich ein Leistungsprinzip im Kontext von zwischenmenschlicher Liebe und Zuneigung.
Ich meinte, dass man Liebe mit den Mitteln der Leistung erreichen kann, weil ich zu Hause zwei Elternteile (und dann nur noch ein Elternteil) hatte, die nicht mehr in der Lage waren, auf meine Bedürfnisse einzugehen, die mich nicht richtig verstanden und um deren Liebe ich als Sohn dennoch kämpfte. Wo sonst hätte ich danach suchen sollen? Von wem sonst wollte ich als Kind Anerkennung und Zuneigung, Liebe und Geborgenheit, wenn nicht von den eigenen Eltern? Ist es nicht zweitranging, was andere von einem halten, wenn die Reaktion der eigenen Eltern ausbleibt oder aber negativ ist? Welche Tricks stellen Kinder an, um sich die unbedingte Aufmerksamkeit der Mutter und des Vaters zu sichern? Gibt es größere Enttäuschungen als das Nichterscheinen der Mutter zum eigenen Theater-, Konzert- oder Sportauftritt? So hatte ich gelernt, mich durch Leistung bemerkbar zu machen, ja, mich geradezu aufzuzwingen, sodass ich gar nicht erst übersehen werden konnte.
Diese Art der rational gelenkten Beeinflussung meiner Mitmenschen führte aber weg von der Fähigkeit, emotional oder empathisch zu handeln, weil ich darüber meinen Kontakt zu den eigenen Gefühlen verloren hatte. So setzte sich der Verdrängungsprozess, dessen einleitende Zäsur mit dem Tod meines Vaters begann, in der Schulzeit über die Flucht auf die kognitiven und reflexiven Wege fort. Beinahe so, als würde ich mich an den eignen Haaren aus meinem Alltag befreien und dabei auf eine parallele Bahn zum eigentlichen Leben setzen. Ich war zwar da, aber nie dabei. Ich sah dem Leben von dieser Bahn aus zu und fühlte mich distanziert.
Zunächst aber fühlte ich mich gut, weil ich den Eindruck hatte, die Kontrolle zu haben und in der Schule lief es ja auch okay. Doch dieser Zustand hielt nicht an, denn ich entfernte mich immer mehr von mir selbst und das entfernte mich auch immer mehr von anderen. Denn wie soll man mit anderen in Kontakt kommen, wenn man mit sich selbst nicht in Kontakt ist? Zwar konnte ich lustige Sachen erzählen und Fußball spielen, aber das Gefühl des Außenseiters, nie richtig dabei zu sein, wurde immer stärker.
Einen echten Kontakt zu anderen Menschen herzustellen, fiel mir immer schwerer, von echter zwischenmenschlicher Nähe ganz zu schweigen. Stattdessen war ich mit meiner Verdrängungsarbeit beschäftigt. Mein empfundener Vorsprung schmolz dahin und spätestens in der 12. Klasse hatte ich das Gefühl, nichts mehr vom Leben zu verstehen, während andere einfach so dahin zu spazieren schienen. Während andere lebten, erschien mir alles so unsagbar sinnlos und fragwürdig, sodass ich von Genuss und Dabeisein gar nicht mehr sprechen konnte.
Vieles machte mich zornig und ich fühlte mich unausgeglichen und überfordert, so, als ob ich es verpasst hatte, auf den entscheidenden Zug aufzuspringen und nicht wusste, wie ich diesen wechseln konnte. Hatte ich noch wenige Jahre zuvor das Gefühl, sagen zu können „Du willst etwas über die Welt, über das Leben wissen? Frage mich!“, so machte sich jetzt eine Art alles ablehnenden Ärgers breit, den ich mit mechanischer Pflichterfüllung auszugleichen versuchte. Ich fühlte mich abgehängt und gesellschaftlich ausgegrenzt, obwohl ich überall teilnehmen durfte und äußerlich nichts dafür sprach.
Das Perfide daran war, dass ich diese Gefühle nicht erkannte und daher auch nichts tun konnte, aber dass etwas nicht stimmte, war eigentlich offensichtlich: Während andere ihre quälenden Lebensfragen in der Familie diskutierten und dort ihre Unsicherheiten in der einen oder anderen Weise behandelten, war ich damit völlig alleingelassen. Im Klub der Kinder mit Eltern, im Klub der Familien konnte ich nicht mehr mitkommen. Es war beinahe ein Gefühl, als hätten andere Zugang zu Geheimnissen, die sie mit mir nicht teilen wollten. Das merkte man schon daran, dass Freunde von mir zu bestimmten Themen schlicht die Meinung des Vaters wiederholten und diese dann als ihre eigene darstellten, ohne die damit verbundenen Argumente wirklich verinnerlicht zu haben, dass sie einer tieferen Diskussion standgehalten hätten. Stattdessen wurde eher auswendiggelernt, so erschien es mir. Aber wie soll man das beweisen? Und soll man das überhaupt anführen? Ist es nicht legitim, sich der Quelle anderer Meinungen zu bedienen?
Was aber tatsächlich bei anderen zu Hause besprochen wurde, welche Prozesse dort abliefen und was es zu bedenken gab, das blieb mir auch bei hartnäckigem Nachfragen verschlossen. Und ich fragte nach! Ich zwängte mich in den Kommunikationsstrom von Freunden und deren Eltern, versuchte, daraus etwas abzuzweigen, um von diesem Strom der Informationen und Erkenntnisse auch kosten zu dürfen. Aber das geht nur zu einem bestimmten Grade, denn die innerfamiliären Kommunikationscodes sind zugleich auch Schutzfunktionen gegen die Offenlegung von „Betriebsgeheimnissen“.
Sie fungieren als wichtige Grundlage sowohl zum Funktionieren der Erziehung als auch der Aufrechterhaltung der familiären Bande überhaupt. Bei mir waren die Bande zerrissen und die Ausfälle und Missstände meiner familiären Situation zeigten sich immer deutlicher und die Konsequenzen traten immer spürbarer zu Tage. Zugleich tat ich alles, mir dieser Zusammenhänge nicht bewusst werden zu wollen, indem ich sie verdrängte. So schlugen sich die Konsequenzen der damit einhergehenden Belastungen unweigerlich nieder.
Das Übernehmen von Verantwortung ist dabei das eine, etwa dass ich als 15-Jähriger bei defekter Heizung den Installateur bestellen und beaufsichtigen durfte. Viel mehr belastete mich, dass ich nicht die Möglichkeit hatte, eine Person zu konsultieren, die verlässlich ist in ihrer psychischen Konstitution und mir eine vertrauensvolle Rückmeldung geben konnte. Das kam mir als krasse Benachteiligung vor, zugleich wollte ich diese Benachteiligung nicht wahrhaben. Ich verdrängte so resolut, dass sich das in körperlichen Phänomenen niederschlug: Ich wurde dauernd krank.
7
Das Gymnasium
Eines Tages unterbreitete mir meine Mutter den Plan, dass wir bald mit dem Rektor meiner Schule zusammenziehen würden. Zugegeben, eine reizvolle Vorstellung für einen Sechstklässler, war sie doch verbunden mit einem Statusanstieg, mit einem Gefühl der Anerkennung. Aber ich blieb skeptisch und wartete ab, was passieren würde, denn zu unglaubwürdig, wenn auch schmeichelhaft, erschien mir diese Entwicklung. Vielleicht ging mir das auch etwas zu schnell, denn die Familientrauer zum Tod meines Vaters fehlte mir. Nicht, dass ich es nicht auch gewünscht hätte, sofort mit dem Rektor zusammen eine „neue Familie“ zu sein, aber meine Skepsis sollte berechtigt sein. Denn auch nach einiger Zeit passierte immer noch nichts, außer den ständig aufs Neue vorgetragenen Aussagen meiner Mutter: „Ja, es wird bald passieren, wir treffen ihn bald…“ Stattdessen fing sie an, meinen Rektor zu belästigen.
Sie stand nachts vor seinem Haus und warf Steine ans Fenster oder überraschte ihn des Sonntags mit einem Kuchen in der Hand vor seiner Haustür. Von alldem erfuhr ich erst viel später. Ich spürte, dass eine Art Kampf stattfand, ein Bedrängen – und das bereitete mir Unbehagen. Damit verwandelte sich die freudige Erwartung in bedrückende Scham und auch Angst, denn die Aktionen meiner Mutter fanden immer mehr zur Nachtzeit statt. Irgendwann stattete der Rektor meinen Großeltern einen Besuch ab, um diese über die Ereignisse und Aktionen ihrer Tochter aufzuklären.
Leider stieß er dort auf meine von Scham erfüllte Großmutter, deren Reaktion vorwiegend darin bestand, sich selbst die empfundene Schmach, die die eigene Tochter über die Familie gebracht hatte, nicht einzugestehen, und die darauf eine „Es wird schon wieder werden“-Haltung einnahm. Eine Haltung, die sich als fatal herausstellen sollte, denn es geschah daraufhin nichts, was in irgendeiner Weise zur Behandlung meiner Mutter geführt hätte, und dem sollte auch so bleiben.
Im Laufe der Zeit entwickelte meine Mutter ihre Psychose immer weiter und die Anzeichen für eine geistige Krankheit verdeutlichten sich in ihren Ausprägungen: Sie sprach zu Menschen, die nicht im Raum waren, sie beschimpfte die Nachbarn und gute Bekannte und warf ihnen Verschwörungen vor, deren Aktionen alleine gegen unsere Familie gerichtet seien. Bei all dem ging mir mein Rektor nicht aus dem Kopf. Meine Mutter hatte ihre Idee noch immer nicht ganz vergessen und von Zeit zu Zeit sah ich ihn im Schulgebäude – und er sah mich. Aber erkannte er mich auch? Wusste er, wer ich war? Wusste er, wer meine Mutter war? Ich fragte mich, was er wusste und ich fragte mich, wie ich mich ihm gegenüber verhalten sollte. Doch darauf hatte ich keine Antwort und versuchte nur, so gut wie möglich den Anschein des normalen Schülers zu wahren, um hinsichtlich meiner familiären Situation nicht aufzufallen. Stattdessen wünschte ich mir vor allem, dass er auf mich zukommt und sagt „Ja, ich weiß um Deine Situation“ und dass er sagt „Ich kann Dir leider nicht helfen, aber ich weiß, dass es schwer für Dich sein muss.“ Dass er also nichts anderes ausdrückt als: „Ich sehe Dich.“ Doch mein Wunsch blieb unerfüllt.
Stattdessen lief er durch die Flure des Gymnasiums, als sei ich ein weiterer unter den vielen unbekannten Schülern und das versetzte mich in tiefe Unsicherheit, weil sich dadurch der Eindruck verschärfte, dass sich meine Situation nicht wirklich von der anderer Kinder unterscheidet und dass es gewollt ist, so zu tun, als sei nichts. Auch sonst kam niemand auf mich zu: weder die Nachbarn, noch die Eltern von Mitschülern, noch das Jugendamt, als meine Mutter Jahre später zwangseingewiesen wurde. Waren sie alle selbst überfordert? – Ich weiß es nicht. Kamen sie vielleicht doch auf mich zu, doch ich ließ sie nicht gewähren? – Ich weiß es nicht.
Es fiel mir schwer, die damalige Lage zu beurteilen, aber ich weiß, dass ich nie von meinem Rektor angesprochen wurde, denn wenn einen der eigene Rektor anspricht, dann vergisst man das als Schüler in der Regel nicht. Ich weiß auch, dass ich mir sehr verloren und wie ein Einzelkämpfer vorkam, der alle Verantwortung selbst zu tragen hat. Auf die Frage „Wie geht es Dir?“ habe ich in der Regel abgeblockt und gesagt: „Gut.“ Was soll der andere dann darauf sagen? Vielmehr hätte es einer Initiative von außen bedurft, die darin besteht, nicht zu fragen, sondern zu sagen, wie es mir geht. Nicht „Wie geht es Dir?“, sondern „Ich weiß, Dir geht es nicht gut.“ Aber wer traut sich dies im Alltag? Wer ist die richtige Person, dies zu tun? Mir war einfach das „Gesehenwerden“ des Rektors wichtig, dass er mich also anerkennt. Aber die Erfüllung dieses Wunsches scheiterte an den gesellschaftlichen Konventionen.
Meine Mutter löste sehr viel Scham in mir aus, aber auch das konnte ich wegen meiner ganzen Verdrängungsleistung erst gar nicht wahrnehmen. Daneben war es belastend, dass sie nicht in der Lage war, adäquat mit einem pubertierenden Jungen klarzukommen. Stattdessen waren eklatante Grenzüberschreitungen und damit einhergehende Verletzungen der Privatsphäre an der Tagesordnung und vernünftiges Argumentieren war gar nicht mehr möglich. Etwa war sie gegen alle Freiheiten, die mir als Jugendlicher zustanden. Als ich mit 14 abends das Haus verlassen wollte, musste ich nach Ihrer Meinung 16 sein, war ich 16, musste ich 18 sein und war ich erst 18, musste ich 21 sein, um etwas tun zu dürfen. Als ich endlich 21 war, wurde mir das nächtliche Herumtreiben schlicht als moralisch verwerflich dargestellt, weil man das „einfach nicht macht“, wie sie sagte. Damit gelingt einem kein gutes Gefühl von Freiheit, Freizeit und Freude, denn immer wenn ich weg war, wurde das entweder im Vor- oder im Nachhinein verurteilt. Keine Erfahrung war einfach in Ordnung, keine Absicht einfach nur gut, weil es meine war. Letztlich wollte mich meine Mutter einfach nur klein und vor allem bei sich halten, begründet auf ihrer Paranoia. Sie hatte also auch ihre Bedürfnisse und Befürchtungen, aber mich erreichten sie in Form von Freiheitsbegrenzung, schlechtem Gewissen und Scham. Außerdem: Ist es Aufgabe eines 15-Jährigen, sich um die Bedürfnisse seiner Eltern zu kümmern? Ich glaube nicht! Vielmehr hat dieser 15-Jährige doch – verdammt noch Mal – das Recht, die wildesten Dinge anzustellen. Natürlich soll er sich nicht in Gefahr begeben, aber darf die elterliche Fürsorge in der Erstickung des Lebens- und Erlebnistriebes dieses Jugendlichen münden?
Für mich blieb nur die Flucht. Jedes Mal versuchte ich, ungehört aus meinem Zimmer zu entkommen. Ich schloss meine Zimmertür ab, öffnete mein Fenster und stieg durch dieses aus dem Haus. Nachts stieg ich auf die gleiche Weise wieder ein und entriegelte die Tür. So entschwand ich für wenige Stunden aus der häuslichen Hölle, um mich zu vergnügen und das hielt ich für legitim, denn andere durften das ja auch. War Alkohol im Spiel? Ja. Waren Drogen im Spiel? Nein. Hatte ich Angst vor Drogen anderer Art? Ja. Ich kannte nicht nur meine, sondern auch die Grenzen. Ich war „gut erzogen“, oder besser: Ich hatte gut aufgepasst und war deshalb soweit angepasst, dass ich mich nie in wirkliche Gefahr begab.
Das schlimmste der Gefühle war die unbeabsichtigte Entzündung eines von der Stadt errichteten Holzhäuschens, dessen tragender Pfahl Feuer fing. Ein Bauer entdeckte die Tat und alarmierte die Feuerwehr. Unsere nächtliche Flucht blieb unentdeckt und der tragende Pfahl war zukünftig mit Beton ummantelt. Aber bei all dem war ich nie wirklich frei und unbeschwert bei der Sache. Vor allem begann nach jeder Rückkehr wieder die „häusliche Hölle.“ Ich hörte meine Mutter jede Nacht ein ums andere Mal weinen. Sie beschuldigte fremde Menschen, schrie, dass sie endlich in Ruhe gelassen werden wolle. Bat und bettelte um das Ende ihres Leids, das darin bestand, von anderen kontrolliert zu werden. Sie weinte laut und rief nach Hilfe. Plötzlich öffnete sie meine Zimmertür und warnte mich vor den fremden Mächten, vor denen ich mich hüten solle und drohte diesen Mächten in ihrer Verzweiflung schließlich damit, sich selbst das Leben zu nehmen.





























