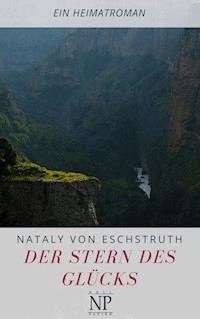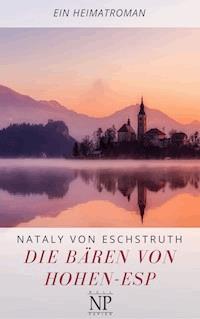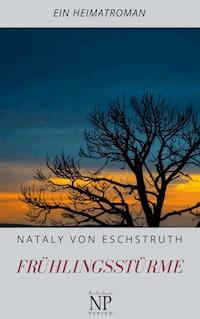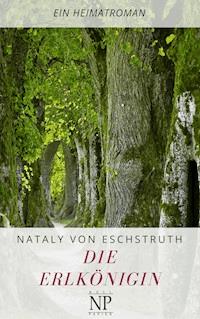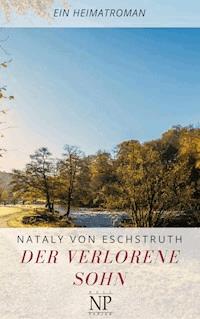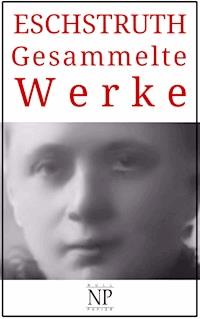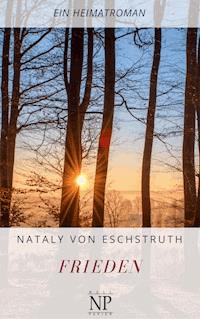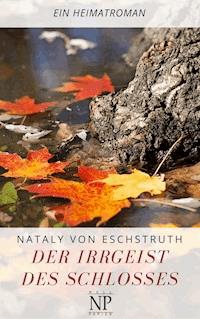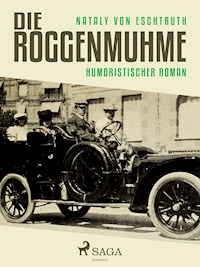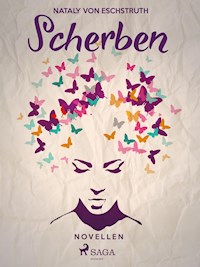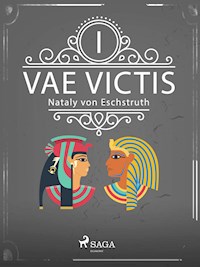1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine stille, klare Winternacht. Der Vollmond schwebt am wolkenlosen Himmel, die Sterne funkeln und blitzen, wie ein schimmerndes Märchengebild liegt der bereifte Wald.
Die Berge ragen an drei Seiten hoch und schroff empor und treten nur nach Süden hin breiter auseinander, um einem langestreckten, lieblichen Tal Platz zu schaffen, einer herrlichen, fruchtbaren und meilenweiten Talebene, welche wie ein kleines Paradies inmitten des Hochgebirges hingestreckt liegt.
Mächtige Waldungen ziehen sich an den Berghängen empor und dehnen sich noch meilenweit im Tale hin, durchschnitten von dem krausen Silberband eines Flüßchens, welches hell und wild von den Felsen herabschäumt und geschwätzig in die fremde Welt hineinsprudelt. Selbst jetzt hat der Frost vergeblich die glitzernden Arme nach ihm ausgestreckt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2026
Ähnliche
Am Ziel
Roman
von
Nataly von Eschstruth
© 2026 Librorium Editions
ISBN : 9782387410528
I.
Es drängen und jagen die Menschen so viel —
Nach einem entfernten, verschleierten Ziel,
Ob sie’s erreichen? —
A. Müller.
E
ine stille, klare Winternacht. Der Vollmond schwebt am wolkenlosen Himmel, die Sterne funkeln und blitzen, wie ein schimmerndes Märchengebild liegt der bereifte Wald.
Die Berge ragen an drei Seiten hoch und schroff empor und treten nur nach Süden hin breiter auseinander, um einem langestreckten, lieblichen Tal Platz zu schaffen, einer herrlichen, fruchtbaren und meilenweiten Talebene, welche wie ein kleines Paradies inmitten des Hochgebirges hingestreckt liegt.
Mächtige Waldungen ziehen sich an den Berghängen empor und dehnen sich noch meilenweit im Tale hin, durchschnitten von dem krausen Silberband eines Flüßchens, welches hell und wild von den Felsen herabschäumt und geschwätzig in die fremde Welt hineinsprudelt. Selbst jetzt hat der Frost vergeblich die glitzernden Arme nach ihm ausgestreckt.
Wie ein ausgelassenes Kind windet es sich und huscht unter ihnen hindurch, unbekümmert, ob sich die Felsblöcke, welche zeitweise drohend seinen Weg sperren, mit einer schimmernden Decke überziehen, ob die Weiden am Ufersaum plötzlich ausschauen wie alte, gebeugte Männer, deren Bart und Haupthaar silbern im Winde weht.
Flüßleins Weg führt gar zu schroff bergab, es kann sich nicht aufhalten, weder im Sommer, wo die rotgetupften Forellchen durch seine klaren, kalten Schaumwellen schießen, noch im Winter, wo die Schneeflocken auf seinem Scheitel tanzen, — es muß hinaus in die Welt, um von der Pracht und der Herrlichkeit des Hochgebirges zu erzählen, von den grauen, schlüftigen Felsen, in deren Höhlen der Sturmwind wohnt und um deren Stirn ein Kranz von Edelweiß blüht, — von den Gletschern und Schneefirnen, welche die Sonne lieben und vor Sehnsucht nach der Scheidenden glühen und flammen wie Purpur und Blut, — von den dunklen Tannen und Kiefern, welche ernst und schweigsam hinab zum Tal schauen, von den weichen Moosteppichen auf den Matten, auf denen mit klugen, scheuen Blicken die Gemsen äsen und der junge Senn und Jägersbursch die Alpenrose für ihr Dirnei daheim pflücken!
Auch von dem schönen, alten Schloß verkündet das Flüßchen, dem trutzigen Herrensitz, welcher in gemächlicher Höhe seinen Wartturm aus den Eichwipfeln hebt und ihm schon seit gar vielen, langen Jahren bekannt ist, damals schon, als ein Pfalzgraf seinen Grundstein legte, zum »Lug ins Land« und Schutz und Schirm des friedlichen Völkleins, welches das Tal besiedelte.
Da spiegelte sich gar manch buntes, wechselvolles Bild in den Flußwellen, das wandelte sich mit jedem Menschenalter, bald froh und sonnig, bald trüb und dunkler Schatten voll.
Die Geschlechter sanken in das Grab, Mauern und Türme brannten und fielen ein, — aber neue Generationen blühten empor, und aus Schutt und Trümmern stiegen neue Hallen und Säle empor.
So war es auch zuletzt wieder fein hergerichtet und ausgebaut, als der Großvater des jetzt darin lebenden Grafen den alten Bau zum Jagdschlößlein und als Sommeridylle angekauft hatte.
Da knallten die Büchsen im Wald und die mächtigen Hirsche setzten in wilder Flucht über die aufschäumenden Wellen des kleinen Flusses, — es gab jeden Sommer ein lustiges Leben im Schloß, das verhallte und verklang, sobald der Herbststurm das Laub von den Bäumen riß und hub aufs neue an, wenn der Auerhahn auf knospendem Ast um seiner Liebsten Gunst und Minne warb.
Im Winter hatte Schloß Kochenhall stets einsam und verlassen im tiefen Schlaf gelegen, selten daß Burgwart, Jäger und Verwalter mit ihren Familien aus dem Schloßhof und ihrem stillen, weltentrückten Heim herauskamen; die Wege waren verschneit, das nächste Dorf lag immerhin weit ab, und wer da zu Fuße gehen mußte, der tat es nur in höchster Not.
Um so wunderlicher deuchte es dem kleinen Fluß, daß in diesem Jahre die Fensteraugen von Kochenhall Abend für Abend zu dem stillen Tal herniederblitzten, gleichviel, ob der Herbst ins Land zog, ob der November schon ganz plötzlich einen grimmen Frost und Schneefall mit sich brachte.
Der junge Graf Thum, welcher mit seiner Gemahlin zu Anfang September in Kochenhall eingetroffen war mit vieler Dienerschaft, Wagen und Pferden, um mit etlichen Gästen die Herbstjagden abzuhalten, schien die Abreise in diesem Jahre total vergessen zu haben.
Und das hatte seinen guten Grund.
In der Residenz, welche das gräfliche Paar bewohnte, war, wie leider schon so oft, eine heftige Typhusepidemie ausgebrochen, welche die Rückkehr nach M. vorläufig unmöglich machte.
Da die Gräfin sich leidend fühlte und die Anstrengungen einer erneuten Badereise oder eines Aufenthalts in dem Süden scheute, zog sie es vor, in Kochenhall zu verbleiben, bis die Gefahr einer Ansteckung in M. vorüber sei. In wenigen Wochen pflegte man gewöhnlich der unheimlichen Seuche Herr zu werden, das wußte Graf Thum, und war darum um so betroffener, als Woche um Woche verstrich, ohne günstigere Nachrichten aus M. zu bringen. Je längere Zeit aber verging, um so unmöglicher war es für die Gräfin zu reisen, und als man sich eines Morgens in dem stillen, hochgelegenen Schloß »eingeschneit« fand, beschloß das gräfliche Paar nun wohl oder übel den Aufenthalt in Kochenhall über den ganzen Winter auszudehnen und traf dementsprechend alle so wichtigen und eiligen Vorbereitungen.
Dem Reichtum ist nichts unmöglich, auch nicht, auf einsamem Bergschloß eine Haushaltung unter erschwerenden Umständen zur Winterszeit einzurichten.
Die Equipage mit dem eleganten Viererzug fand auch über verschneite Pfade ihren Weg, und sie brachte alle jene Personen, welche auf Kochenhall nötig wurden, herzu, — den Arzt, die Wärterinnen und die Amme, und über die altertümliche Zugbrücke rollten die Gepäckwagen, welche Vorräte in das Schloß schafften, als sollte es einer jahrelangen Belagerung standhalten!
Und nun war es eine stille, klare Winternacht, in Kochenhall leuchtete Licht aus allen Fenstern, bis weit in das schlummernde, schneeweiße Tal hinab, so daß die schlanken Rehe staunend im Park standen, den fremden Glanz anzustarren.
Gräfin Theodora aber lag in den spitzenbesetzten Kissen des seidenen Himmelbettes, mit geschlossenen Augen und einem feinen, scharfen Schmerzenszug um die blassen Lippen, still und regungslos, — »heldenhaft mutig!« wie der Arzt im Nebenzimmer dem Grafen zuflüsterte, als dieser seine unruhige Promenade über den dicken Smyrnateppich einen Augenblick unterbrach, um die feuchtperlende Stirn mit dem breitkantigen Sporttaschentuch zu trocknen.
Die Gräfin schlief nicht. Ihre Gedanken waren lebendiger und erregter wie je.
Sie dachte zurück.
Vor vier Jahren war es gewesen, als sie, die vielgefeierte, bildschöne Tochter des Generals von Teutin ihre Hand dem Grafen Alexis von Thum gereicht hatte.
Sie war stolz und glücklich, hochbefriedigt gewesen, denn ihr Gatte besaß alles, was eines Weibes Herz begehren kann, stattliche Jugend, ritterlichen Edelsinn, ein frisches, liebenswürdiges Wesen, welches sein männlich hübsches, offenes Gesicht charakterisierte, und last not least einen uralten Grafentitel, ein enormes Vermögen, welches diesem Titel auch die nötigen Mittel garantierte.
Ja, Graf Alexis war wohl die beste Partie des ganzen Landes, — und hätte wohl jedes Weib vollkommen glücklich und zufrieden gemacht, nur nicht eine Theodora Teutin.
Nicht daß ihre Ehe eine unglückliche gewesen! Die Gräfin liebte ihren Gemahl und erkannte all seine Vorzüge in rückhaltloser Weise an, ja sie hätte wohl nichts zu tadeln und nichts mehr zu wünschen gehabt, wenn … ja, wenn dieses »wenn« nicht gewesen wäre! Theodora von Teutin war kein Durchschnittscharakter, sie war ein eigenartiges Wesen, welches nicht den Pfad all der harmlosen, lebensfrohen, toleranten Mitschwestern ging. Ein Erbteil ihres Vaters war ihr in die Wiege gelegt und begleitete sie wie ein grauer Schatten auf ihrem sonnigen Lebensweg, — der Ehrgeiz, wie er wohl die Brust strebender Männer durchflammt, selten aber Frauenherzen höher schlagen läßt.
Und was den Ehrgeiz jedweder andern Dame voll befriedigt hätte, die reiche Gräfin von Thum zu sein, das deuchte ihr im Gegenteil nur die goldene Schale, auf welcher Besseres serviert werden mußte — Macht! Stellung! Einfluß!
Just diese aber besaß Graf Alexis nicht. Er war ein reicher Mann, — mehr aber nicht. Von nachsichtigen Eltern erzogen, hatte er nur das Notwendigste gelernt, was zur Bildung eines vornehmen Menschen nötig ist, der Sport überwog die Kenntnisse, und die heitere Lebensfreudigkeit den Ernst, welcher studiert, strebt, ringt und sich ein hohes Ziel setzt. Der einzige Beruf, welchem Graf Alexis sich gewidmet hätte, wäre derjenige des Offiziers gewesen.
Er hatte auch bereits sein Fähnrich-Examen gemacht, als eine sehr heftig auftretende Blinddarmentzündung ihm das Reiten auf Jahre hinaus unmöglich machte, und da der anstrengende Dienst in einem Gardegrenadierregiment erst recht Schwierigkeiten bereitete, so sah der junge Graf mit einem heiteren Lächeln und ohne die geringsten Seelenkämpfe von einem Eintritt in die Armee ab und lebte fröhlich und guter Dinge als freier Mann von seinen Renten.
Und das war der Gifttropfen, welcher in den Freudenbecher der Gräfin fiel.
Die Tatenlosigkeit ihres Mannes deuchte ihr geradezu unbegreiflich!
Wie war es möglich, daß ein begabter Mensch müßig durch das Leben bummelte, ohne den brennenden Wunsch zu hegen, auf der Leiter des Ruhms emporzusteigen, hoch — immer höher bis zu einem schwindelnden Ziel, von welchem man auf seine Mitmenschen herabblickt wie der Adler auf das Gewürm, welches ohnmächtig am Boden kriecht!
Gräfin Theodora empfand es als unerträgliche Qual, ja geradezu als Schmach, daß sie bei allen Festen, wo die Form und Etikette waltete, hinter den meisten Frauen zurückstand, deren Gatten eine Stellung in der Welt einnahmen. Ihre Titel und Mittel sprachen in diesem Falle so gar nicht mit, und alle Exzellenzen, Generalinnen bis zur Majorin herab hatten den Vortritt vor Gräfin Thum, welche nicht einmal bei Hofe die Vorrechte der Landstandsdamen genoß, da die Thumschen Besitzungen in Osterreich und der Schweiz lagen, der Graf aber eine Vorliebe für die Residenz M. besaß und infolgedessen seinen dauernden Wohnsitz dort genommen hatte.
Anfänglich hatte Gräfin Theodora sich diese »Schattenexistenz« nicht so schlimm gedacht. Ihr reiches, gastfreies Haus vereinigte die erste und vornehmste Gesellschaft, man rechnete es sich zur Ehre an, in den Thumschen Salons zu Hause zu sein, denn das gräfliche Paar war ungemein beliebt und fraglos der Mittelpunkt der Gesellschaft.
Bei Hofe so wohl gelitten, daß die hohen Herrschaften es nicht verschmähten, zu den glänzenden Festen im Hause des Grafen zu erscheinen, von den Künstlern wegen ihrer imposanten Schönheit geradezu gefeiert und umworben, blieb dennoch im Herzen der Gräfin ein feiner Stachel zurück. Sie war unbefriedigt, sie entbehrte just das, was sie am leidenschaftlichsten ersehnte.
Mit der ärmsten Exzellenz hätte sie getauscht, hätte all ihre Reichtümer freudig dahingegeben für das eine stolze Bewußtsein, einen Mann zu besitzen, welcher eine hervorragende Stellung einnimmt, eine Frau zu sein, welche erhobenen Hauptes voranschreitet, während die andern fein demütig folgen.
Der Graf ahnte nicht, wie bitter ernst es seiner jungen Frau mit dem Strebertum war. Er hielt ihren Ehrgeiz für eine fixe Idee, eine jener pikanten kleinen Schrullen, mit welchen sich schöne Frauen gern interessant machen. Er lachte sie aus, wenn er sie in ihrem Boudoir antraf, russische oder italienische Vokabeln lernend, Kunstgeschichte treibend oder gar über einer Generalstabsarbeit grübelnd, welche ein guter Freund »mit den himbeerfarbenen Streifen« ihr voll freudigen Entzückens aufgezeichnet hatte.
»Ich glaube wahrhaftig, Frauchen, du willst noch General oder Professor werden!« scherzte er, sich behaglich in einen Sessel werfend, das Bein überschlagend, daß der elegante seidene Strumpf über dem Lackschuh sichtbar ward, und die Zigarette mit weißer, ringgeschmückter Hand zu Munde führend: »O ja, ich glaube du würdest famos mit einer Division oder gar einem Armeekorps fertig! Das Schicksal hat einen groben Schnitzer begangen, dich als Weiblein in die Wiege zu legen, wenngleich ich persönlich ihm von ganzem Herzen dankbar dafür bin!«
Und der Sprecher zog die schöne, energische Hand seiner Frau galant an die Lippen und blickte sie aus seinen blauen Augen so fröhlich an, wie ein Kind, welches mit sich und der ganzen Welt zufrieden ist.
Die Gräfin schlang in aufwallender Empfindung die Arme um ihn.
»Alexis! Du hältst mich für eine hohe Stellung geboren, — hast du denn gar nicht den Trieb und Wunsch, mich einmal zur Exzellenz zu machen?«
Er lachte schallend auf. »Nein, Schatz! Etwas so Vergebliches, was wir beide kaum noch erleben würden, wünsche ich mir nicht!«
»Nicht mehr erleben?!«
»Nun — wenn ich jetzt noch als Leutnant oder Studiosus anfangen wollte — was meinst du wohl, wie lange ich klettern müßte, bis ich die Exzellenz erreicht hätte?«
Sie seufzte tief auf und preßte momentan die Lippen herb und schmerzlich zusammen. Dann nickte sie mit starrem Blick vor sich hin und strich mit der kühlen, schlanken Hand leicht über sein elegant gescheiteltes Haar.
»Ja, ja, ich sehe es ein, — es ist zu spät. — Du kannst das Versäumte nicht mehr nachholen. Aber Alexis« — sie richtete sich empor, ihr Auge blitzte auf und ihre Brust hob sich unter tiefem Atemzug — »wenn ich einmal einen Sohn haben werde — — der soll alles erreichen, was mein glühendes Sehnen umsonst erstrebt!«
»Hoffen wir es, liebes Herz!«
»Er soll lernen — lernen — lernen!!« Wie ein Aufschrei klangs von ihren Lippen, mit welchem das harmlose Lächeln des Grafen seltsam kontrastierte.
»Armer Junge«, scherzte er, »welch ein Glück für ihn, wenn er als Mädchen zu Welt käme!«
»Glück? Das nennst du Glück?« rief sie erregt, »fühlst du dich etwa glücklich ohne Stellung und Beruf?« —
Er dehnte behaglich die Arme; das silberne Armband mit dem Georgsdukaten blitzte an seinem Handgelenk. »Unendlich glücklich!« versicherte er, und seine weißen, gesunden Zähne blinkten durch den blonden Schnurrbart und seine Augen strahlten wie wolkenloser Sommerhimmel. — »Ich sage dir, Theo, — unsagbar glücklich! Ohne Ärger, ohne Sorgen, ohne Schinderei und Abhetzerei — ach, es ist schön, wenn man sein eigener Herr ist! Langweilen tue ich mich nicht, ich arbeite an unserer Familiengeschichte, ich interessiere mich für die Neubauten auf den Gütern, ich wirke in allen möglichen Vereinen … ja, potz Wetter! da fällt mir ja mein Kriegerverein ein! Wollen eine hübsche, patriotische Feier haben, die Veteranen sollen noch einmal Lorbeeren für anno 13 pflücken! Gut, daß ich daran denke, will gleich mal zum Tivoli hinausfahren.« — —
Der Sprecher küßte das schöne, stolze, steinerne Gesicht seiner Gemahlin und schritt pfeifend aus der Tür, — die Gräfin aber stützte mit finsterem Blick das Haupt in die Hand.
Ja, es war zu spät! — Für den Vater zu spät — für den Sohn nicht.
Ach, daß sie die Mutter eines Sohnes würde! Wie wollte sie Funken des Ehrgeizes in sein junges Herz streuen, wie wollte sie nur noch dem einen Ziele leben — durch den Sohn zu erreichen, was ihr durch den Gatten versagt blieb! — Macht! Stellung! Ehre! Einfluß! Dem Sohn soll es einst werden, und seiner Mutter soll er es verdanken! Wie ein Schrei der Sehnsucht ging es durch das stolze, ehrgeizige Frauenherz, und doch vergingen noch drei Jahre, ehe sie voll jauchzenden Triumphs die Wiege für den Heißersehnten bereiten konnte.
Vier Jahre war sie vermählt — alles was sie für ihren Gatten in dieser Zeit erreicht hatte, war der Titel eines Kammerherrn, das war ein bescheidenes Ziel, — dem Sohn soll es weiter gesteckt werden, — hoch und weit! Oh, ihr schwindelt es selbst, wenn sie im Geist die Höhe sieht, auf welcher ihr Fleisch und Blut doch noch mal triumphieren soll.
Exzellenz auf jeden Fall! Als Minister — als Feldmarschall — als Kanzler — gleichviel! Nur Exzellenz! Sie ist verliebt in diesen Titel, sie erblickt in ihm das Ziel aller Wünsche. — Ein Sohn! —
Herr des Himmels — und wenn es eine Tochter würde?
Die Gräfin fröstelt und beißt die Zähne noch fester zusammen.
Ihre Seufzer zittern durch das stille, nächtliche Gemach und die alte Frau am Fußende des Himmelbettes erhebt sich leise und blickt prüfend in das schöne, bleiche Antlitz der jungen Frau.
Nur noch eine kurze Spanne Zeit — nur noch der letzte Sturm nach der Ruhe — dann weiß sie es, ob ein Sohn das Ziel erreichen wird!
Ein Sohn! — ach nur ein Sohn!
»Ihre Frau Gemahlin hat sich absolut einen Stammhalter bestellt, Herr Graf!« flüstert der Arzt lächelnd im Nebenzimmer. »Teilen Sie diesen Wunsch, oder darf ich auch eine kleine Komtesse bringen?«
Alexis strahlt über das ganze Gesicht! »Bringen Sie es nur! Was es ist — das ist mir ganz egal! Ja, ich glaube beinahe, ein Mädel würde mir noch mehr Spaß machen! Ich gehöre nicht zu den ungalanten Männern, die nur in Söhnen ihren Stolz erblicken! Eine Tochter würde ich noch zärtlicher, noch inniger lieben, als wie meinesgleichen! Schon als Ebenbild der Mutter würde sie mir willkommener sein wie ein Junge, welcher als höflicher junger Mann stets den Damen den Vortritt lassen muß. Erst ein Mädel! Was später kommt, können meinetwegen sechs Jungens sein!«
Die Herren nicken sich zu und lächeln, die Uhr verkündet die zweite Stunde — und der Graf füllt eigenhändig die Tasse des Arztes mit dem starken Kaffee, welchen er vorläufig dem Sekt vorzieht.
Draußen glitzern die Sterne und der Mond wirft spiegelnde Bilder über die schneeige Pracht des Gebirges; die Rehe im Park schrecken plötzlich zusammen und fliehen in schützendes Tannengebüsch — —
Ein Böllerschuß kracht von dem Schloß — noch einer — und abermals einer —
Und wie ein Jauchzen und Jubeln geht es durch das Schloß: Ein Sohn! ein Sohn! — Es rollt in den Bergen und weckt das schlaftrunkene Echo — ein Schuß — noch ein Schuß — und die Leute im Dorf drunten, welche zuerst erschreckt aus den Kissen gefahren, lächeln und drehen sich behaglich auf die andere Seite.
»Auf Kochenhall ist ein Sohn geboren! Du liebe Zeit, wie wird sich die Gräfin freuen!«
Behagliches Dämmerlicht herrschte in dem eleganten Salon der Gräfin Theodora.
Kochenhall ist ein uralter Bau und kennt nicht die zierlichen Boudoirs moderner Villen und Paläste, in seinen Mauern dehnen sich große, weite, viereckige Gemächer, mit getäfelten Decken, welche meist so niedrig sind, daß man Mühe hatte, die Kronleuchter aufzuhängen. Nur im Waffensaal, der Ahnengalerie und dem großen, neu ausgebauten Speisesaal hat man die Plafonds um eine ganze Etage emporgerückt, und die kleinen, gewölbten Fenster mit den zwölffach geteilten und in Blei gefaßten Scheiben zu hohen, hellen, kirchenartigen Bogen erweitert.
Die altertümlichen Gemächer hat man jedoch in ihrem altertümlichen Burgstyl belassen, und Gräfin Theodora hat sich ein großes Eckzimmer zu ihrem Salon gewählt, welches durch einen achteckigen Giebelausbau, der gleich einem Schwalbennest an den Mauern über der steil niederfallenden Felswand schwebt, etwas ganz besonders Behagliches und Trauliches bekommt.
Giebel und Erkerchen, Türmchen mit trutziger Krenelierung1 sind überall an dem winklichen Gemäuer angeklext und gewähren zumeist die herrlichste Rundsicht über das Tal und das Hochgebirge, welches seine imposanten Schneehäupter hoch in die Wolken hebt.
In dem offenen, altmodisch überdachten Kamin flammt ein gewaltiges Holzfeuer, dieweil der unentbehrliche »Amerikaner«2 hinter hohem Eisengitter versteckt, dieses »Dekorationsfeuer« durch wohltuende Wärme nachdrücklich unterstützt.
Wohl prangen an den Wänden alte Gobelins und geschnitzte Wappentafeln, schmiedeeiserne Leuchter und dunkelgebräunte Paneele, — auch mächtige Sitztruhen, uralte Sessel und Schränke füllen die Ecken, aber dazwischen hat man dennoch bequeme und moderne Möbel geschoben, ohne welche eine verwöhnte Dame kein wahres Behagen finden kann. Der vortreffliche Geschmack der Gräfin hat allerdings diese neumodischen Eindringlinge möglichst in den Rahmen der alten Bergfeste hineingepaßt, hat die Bezüge der einzelnen Polsterstücke in denkbar ältesten Brokatmustern und -Farben herstellen lassen, und ist es ihr gelungen, trotz der Verschiedenartigkeit eine entzückende Harmonie zu schaffen, welche den Zauber des alten Burgzimmers in nichts zerstört und dennoch den Ansprüchen der Jetztzeit Rechnung trägt.
Gräfin Theodora war stets eine auffallend schöne Frau gewesen, für manchen Geschmack freilich etwas zu marmorkühl und regelmäßig, wie eine klassische Statue, welche von ihrem Sockel herabgestiegen, zwischen Menschen zu wandeln, — jetzt aber, als ihr der heißersehnte Sohn im Arme lag und sie wieder und wieder mit langem, forschendem, beinahe prüfendem Blick sein kleines Gesicht umfaßte, jetzt erst schien wahres Leben in ihren Adern zu pulsieren und ihre Schönheit voll erblüht zu sein.
Ein ganz neuer Ausdruck triumphierenden Stolzes lag auf dem ehedem so kühlen und gleichgültigen Gesicht, eine jauchzende Genugtuung, ein brennendes Interesse, welches warmen Purpur in ihre Wangen trieb.
Die dunklen Augen leuchteten seelenvoller, befriedigter wie zuvor, und um die Lippen spielte ein Lächeln sieghafter Freude, wie bei einem Menschen, welcher nach langem, ungeduldigem Harren endlich die Kampfbahn betreten kann, an deren Ende das heißersehnte Ziel winkt. Die junge Mutter lag bequem auf einem Diwan gebettet, in der eleganten, von Spitzen und Bändern umwogten Matinee schier königlich anzuschauen, und sie reichte der harrenden Kinderfrau mit strahlendem Blick ihren Sohn zurück, noch einen langen, beinahe weihevollen Kuß auf die kleine Stirn drückend.
Und dann, als man den Kleinen zum Schlaf hinaustrug, lehnte sie wie in träumerischem Sinnen das Haupt zurück und ihr Blick flog hinüber zu der schlanken, vornehmen Gestalt ihres Mannes, welcher vor wenig Augenblicken den Platz an ihrer Seite verlassen, um in den kleinen Erker zu treten.
Die Hände lässig in die Taschen seiner Joppe versteckt, ganz leise eine heitere Melodie durch die Zähne pfeifend, stand Graf Alexis und blickte voll innigen Behagens in die herrliche, weißverschneite Landschaft hinaus.
Der Sturm pfiff und schrillte um die Mauern und Söller, Schneeflocken wirbelten in tollem Tanz durch die Luft und drunten im Dorf blitzten die ersten Lichter auf, hie und da tönte ein schwacher Klang der Betglocke vom Schloßturm, und vom Wald herauf rauschten die Wipfel wie ferne Meeresbrandung.
»Weißt du, Liebling, daß ich Kochenhall im Winter schön finde, schöner beinahe wie im Sommer?« sagte er plötzlich und trat wieder neben den Diwan der Gräfin zurück. »Etwas so Urgemütliches wie solch ein Verschneitsein gibt es kaum wieder! Es ist einmal etwas anderes, so ganz anderes um diese Stille und Einsamkeit, als wie in der Residenz daheim! Theater und Konzert gibt’s freilich nicht — und doch ist solch ein Wunderbild im Hochgebirge auch ein Schauspiel, wie es majestätischer kaum zu finden ist, und der Schneesturm ist ein Konzert, welches kein Kapellmeister in gleicher Großartigkeit zustande bringt. — Solch ein Winteridyll auf Kochenhall ist wundervoll! Wirkt wie Karmelitergeist, welcher den Magen stärkt und Hunger macht! Was meinst du, Theo, wie das Leben nachher in M. schmecken wird? Herrlich! Man hat an allem, was einem mit der Zeit langweilig geworden, wieder neue und doppelte Freude! Und darum will ich dir einen Vorschlag machen: wir wollen jedes Jahr bis nach Weihnachten hier bleiben! Als Medizin und Lebenselixier! Und last not least als ein Wintermärchen, welches wir als verzauberte Königskinder träumen! In M. muß ich dich mit einer endlosen Schar von Verehrern teilen, hier aber gehörst du mir allein, Theodora, und darum liebe ich Kochenhall als Schutzwarte meines Glücks.«
Der Sprecher küßte voll zärtlicher Galanterie die weiße, brillantblitzende Hand, welche in der seinen lag, und die Gräfin neigte das Haupt lächelnd gegen seine Schulter.
»Gut, Alexis, dein Wunsch soll mir Befehl sein, ich will dir jedes Jahr in Kochenhall neue Rosen der Liebe und des Glücks aus Schnee und Eis erblühen lassen, ich will gern bis nach Weihnachten hier bleiben und dir jedwedes Opfer bringen, welches die Einsamkeit von mir verlangt — aber, ich verlange dafür eine Gegenleistung, welche du, lieber Schwärmer, mir hoffentlich nicht versagst …?« —
Der Graf blickte lebhaft auf, sein Auge leuchtete, beinahe ungestüm drückte er die Lippen auf ihr Antlitz.
»Endlich, endlich einmal ein Wunsch!« lachte er, »Gott sei Dank, Theodora, daß du mir auch einmal Gelegenheit gibst, Wachs in deinen Händen zu sein!«
»Wenn man alles hat, bleibt kein Wunsch mehr!« scherzte sie, »du hast mich mit allem was das Herz begehrt, derart überschüttet, daß ich bisher nur deiner Generosität wehren mußte!«
»Nun, und jetzt?«
»Jetzt möchte ich nur deiner Güte zuvorkommen und bitten, ehe du gewährst!«
»Alles, Herzliebste, alles!«
Sie sah plötzlich ernst zu ihm auf und drückte seine Hand fester. »Es ist ein seltsamer, ja ich möchte wohl sagen, ein ungebührlicher Wunsch, welchen ich äußern möchte«, sagte sie leise, »denn ich weiß, daß ich damit in deine Rechte eingreife! Dennoch versuche ich es und hoffe auf deine Zustimmung.« — Sie zögerte momentan und blickte forschend in seine etwas erstaunt schauenden Augen. »Es betrifft unsern Sohn. Du weißt, wie unaussprechlich ich mir den Knaben wünschte, wie meine ganze Seele an dem Verlangen, einen Stammhalter zu besitzen, krankte. Nun ist mein Sehnen gestillt, er ist mein geworden! Mein und dein! — Man hat mir stets gesagt, daß ich viel Talent zum ›regieren‹ besitze —«
Er unterbrach sie lächelnd: »Das unterschreibe ich! Wessen Herz beherrschest du nicht? — Das Schicksal tat einen argen Mißgriff, daß es dich nicht in eine Fürstenwiege legte, denn deine kluge, energische kleine Hand ist dazu geschaffen, die Zügel der Regierung zu führen, und doch bin ich ihm für diesen Mißgriff so dankbar, denn er sicherte mir deinen Besitz!«
»Schmeichler! Ich werde dich beim Wort nehmen. Gut; ich glaube selber, daß mir hervorragende pädagogische und beherrschende Talente gegeben sind. Ich bin überzeugt, daß ich die nötige Energie habe, einen Sohn zu einem hervorragenden Mann zu erziehen, und darum bitte ich dich mit aller Dringlichkeit, Alexis, vertraue mir unsern Sohn an, laß mich seine Erziehung leiten, über sein Tun und Lassen bestimmen, ihm ein Ziel setzen, was er mit Gottes und meiner Hülfe auch wahrlich erreichen soll!«
Die Sprecherin sah ernst, beinahe feierlich, mit wundersam blitzenden Augen zu ihm empor, Graf Thum aber lachte sorglos und sichtlich amüsiert auf und schlug in ihre dargebotene Hand ein.
»Aha! Minister oder Feldmarschall! Exzellenz auf alle Fälle! Topp, es soll gelten! Ich glaube selber, daß du es viel besser verstehen wirst wie ich, aus dem Schlingel etwas zu machen! — Gott sei Lob und Dank, daß ich nicht in seiner Haut stecke! Was wird der arme Kerl ochsen müssen!!«
Theodora überhörte die letzten Worte. »Gut, ich habe dein Versprechen!« sagte sie feierlich, »und ›ein Mann ein Wort‹. — Nun wird es meine erste Pflicht sein, schon jetzt den Lebensweg meines Sohnes nach Kräften zu ebnen und vorzubereiten, denn meine Ansicht ist es: die Schicksale eines Menschen können und müssen beeinflußt werden, soll er das Ziel erreichen, welches man ihm steckt und als sein Glück erachtet!«
»Aber weißt du denn, Liebste, ob Rang, Stellung, Macht und Ehre auch wirklich das Glück des Kindes sein werden?« warf Graf Alexis mit jäh aufkeimender Besorgnis ein. »Wir Menschen sind so individuell veranlagt, und was der eine Glück nennt — deucht dem andern eine Strafe!«
Die Gräfin richtete sich stolz empor. »Es müßte nicht mein Fleisch und Blut sein, wenn er so völlig den Sinn seiner Mutter verleugnen wollte! Außerdem kann man durch richtige Erziehung und Anleitung schon frühzeitig Interessen in Kindern wecken, welche ihnen sonst fern bleiben würden. Ein Bäumlein wächst, je nachdem es der Gärtner pflanzt, zustutzt und ihm fruchtbringende Zweige okuliert. Sei unbesorgt, Alexis; wenn du unsern Sohn meiner Leitung anvertraust, und nicht mit entgegengesetzten Plänen und Ansichten die Erziehung beeinflussest, wird er alle Hoffnungen dereinst erfüllen, welche ich seit der ersten Stunde seiner Geburt in ihn setzte!«
»Gebe Gott, daß du das rechte willst und erreichst, Theodora. Ich habe absolut keinen Sinn und kein Verständnis für Kindererziehung, und es ist mir tausendmal lieber, unsern Jungen unter deinen Händen, als unter denen eines fremden Erziehers zu wissen!«
»Ich danke dir, Alexis!« Die Gräfin drückte ihm mit aufleuchtendem Blick die Hand und fuhr dann lebhaft fort: »Vor allen Dingen wollen wir schon jetzt an des Knaben Zukunft denken und für hohe und einflußreiche Paten sorgen — —«
»Ach, hältst du das bei einem Grafen Thum für notwendig?«
»Fraglos. Es gibt Situationen im Leben eines Mannes, wo weder Namen noch Geld allein etwas helfen, sondern lediglich nur Konnexionen von Nutzen sein können. Je einflußreichere Hände die Leiter halten, desto schneller und höher steigen diejenigen, welche Karriere machen wollen!«
Der Graf lächelte abermals. »Aha! Das zielt wieder auf die Exzellenz!! Gut, Frauchen, diese Vorlage wird ebenfalls ohne Debatte angenommen. Und wen gedenkst du zu Gevatter zu bitten?«
Theodora legte ihr schönes Haupt zurück und schloß momentan die unruhig flackernden Augen.
»Vor allen Dingen den Kronprinz Eckbrecht!« sagte sie schnell und sicher. »Er wird nach menschlicher Berechnung die Regierung übernommen haben, wenn unser Sohn erwachsen ist und seiner Protektion bedarf!«
»Vortrefflich! Ich bin auch überzeugt, daß der hohe Herr, welcher dich stets durch besondere Gunst und mich durch sein nachsichtiges Wohlwollen auszeichnete, die Patenstelle annehmen wird. Der Junge muß dann selbstredend auch Eckbrecht getauft werden?«
»Ohne Frage. Der Name muß stets an die angenehme Tatsache erinnern!«
»Und ferner? Wen willst du noch?«
»Die Verwandten zähle ich nicht besonders auf, ich nenne nur noch Major von Golfers …«
»Golfers?! — bless me — wie kommst du auf diesen unliebenswürdigsten aller Grobiane?!«
Die Gräfin lächelte.
»Man nennt ihn den zukünftigen Kriegsminister; er ist einer unsrer hervorragendsten Generalstäbler und wird gerade im Zenith seiner Macht und Karriere stehen, wenn unser Sohn seiner bedarf!«
»Hut ab, du Diplomatin! Ich sehe ein, du mischt dem Jungen die Karten schon jetzt mit einer Virtuosität, daß er fraglos das Spiel dereinst gewinnen muß! Was ist los, Johann?« Der Sprecher wandte sich nach der Tür, zwischen deren Portieren ein alter, weißhaariger Diener erschien und respektvoll stramm stehen blieb.
»Befehl, Herr Graf. Der Oberförster Schill hat soeben einen Boten geschickt mit der Meldung, daß im Tal, am Kochlerkessel, ein Rudel Schwarzwild eingespurt ist. Er läßt anfragen, ob der Herr Graf an einem Treiben teilnehmen wollten, und ob es paßte, wenn gleich morgen losgegangen würde?«
Der Schloßherr von Kochenhall war lebhaft aufgesprungen: »Famos! Ausgezeichnet! Die Kochler Tannen sind königliches Gebiet?«
»Befehl, Herr Graf. Der Herr Oberförster hält die Jagd selber ab!«
»Wen hat er geschickt?«
»Den Steigertoni, Euer Gnaden!«
»Auf dem Korridor draußen?«
»In der Gesindeküche, Herr Graf; er war durchfroren und wärmt sich am Herd!«
»Gut, gut, — sorgen Sie nachher für ihn, daß er beköstigt wird. Ich komme mit Ihnen, um den Burschen selber zu sprechen.«
Graf Thum küßte hastig die Hand seiner jungen Gemahlin. »Entschuldige mich für ein paar Minuten, dearest love — ich stehe sofort wieder zu deiner Verfügung!«
Er verließ hastig das Zimmer; Theodora lehnte das Haupt in die seidenen Kissen zurück und schloß die Augen.
Ein Lächeln hoher Zufriedenheit spielte um ihre Lippen. Ihr Wunsch war erfüllt. Sie hielt das Lebensbuch ihres Sohnes in der Hand und schrieb mit energischen Lettern sein Schicksal hinein, — so weit es in eines Menschen Hand gegeben. Und ihres Sohnes Glanz und Ehre, Macht und Stellung sollten sie dereinst entschädigen für das inhaltlose Leben, zu welchem sie selber verurteilt war. Nun wurzelt all ihr Interesse, all ihr Hoffen und Streben in der Zukunft des Sohnes, und sie wird ihn gängeln und leiten, heben und stützen, ihn treiben und fördern bis hoch empor zum Ziel!
II.
Ei, was für ’nen prächtigen Bub’ hab’ ich!
Die Händlein so drall
Und die Lenden so prall
Und das Näschen so fein
Und das Mündchen so klein!
Ludwig Löwenstein.
N
ahe am Dorf drunten, im Laubwald, welcher seitlich den Kochenhaller Schloßberg säumt, liegt die königliche Oberförsterei.
Still und einsam ist es in dem geräumigen Haus geworden, seit Susanne Schill, die blühendfrische Tochter des Oberförsters, den Vater verlassen hat, um ihrem schmucken Herzliebsten, dem königlichen Feldjägerleutnant Seehofer, als glückstrahlendes Weib in die neue Heimat zu folgen.
Da war das Lachen und Singen im Forsthaus verklungen.
Der alte Herr ging nachdenklich und mit ernst gefurchter Stirn umher, hatte sich noch den Philax und die Waldine zur Gesellschaft in seine Stube geholt, obwohl der Feldmann und die Juno bereits die Ofenecke zu Erb und Lehn erhalten hatten, hing noch ein paar Käfige mit Dompfaffen und Zeisigen mehr am Fenster auf und doch wollte das frohe, lustige Leben nicht wieder Einkehr halten.
Frau Zirblerin, die rüstige alte Wirtschafterin, ging auch umher, als sei ihr die Butter vom Brot genommen, seit die Susanne aus dem Hause war, — sie schalt nicht mehr über die Hunde und Jägerburschen, sie grollte nicht mehr, wenn der alte Herr den Pfeifenkopf auf die frischgescheuerten Dielen ausklopfte, sie verlangte nicht mehr voll würdiger Energie »alleweil ein Rehplatterl am liebsten«, — sie schlich wehmütig Trepp auf, Trepp ab, lüftete dem Susei das Zimmerchen alle Tag, als ob’s jeden Augenblick wiederkommen müßt, das liebe Dirnei, und hatte verweinte Augen, wenn die alte Stine, welche von der Post wegen die Briefe austrug, an der Oberförsterei vorbeikraxelte, ohne mit einem Schreiben von Susei einzusprechen.
Zuerst hatte auch das dralle, blauäugige Roseli, die als Magd im Forsthaus diente, gezwitschert und jubiliert wie ein Finkenweibchen, als aber im Herbst ihr Wastl3 sich hatte stellen und als Rekrut fort müssen, da war es auch mit des Roselis Freud’ zu Ende! Wenn es daran dachte, wie der Wastl ihm zum letztenmal das Gesicht abbusselt und gesprochen hatte: »Ich muß jetzt fort; sei zufrieden, Roseli, und bleib’ in Frieden zurück«, ach, dann gingen ihm sofort wieder die Augen über, und wann die Zirblerin es anließ: »Was flennst, du Dalk mit deinem alten Weibergetrenz?« — dann schlug es nur in großem Jammer die Hände zusammen und rief: »Kreuzunglücklich bin ich! und kreuzunglücklich sind wir alle miteinander!«
Da hatte die Zirblerin auch schweigend nach dem Schürzenzipfel gegriffen: »das schon!« und hatte mit viel Lärm und Geräusch in der Küche herumhantiert.
Sollte sie’s auch nicht? — Sie hatte die Susei von ihrem ersten Lebenstage an auf den Armen gewiegt, und die Kleine lieb gehabt wie ein eignes Kind, und als die Oberförsterin vor Jahr und Tag an dem bösen Sturz aus dem Schlitten gestorben war, da hatte sie Mutterstelle bei dem armen verwaisten Dirnei vertreten und mit der Zeit gar geglaubt, sie habe die Kleine fein selber geboren und sei ihm mit Leib und Seel’ eine Mutter geworden.
Nun war der Herbst da, das bunte Laub bedeckte fußhoch den Waldboden, und die Berge droben hatten weiße Mäntel umgehängt, da zogen die Sennen mit dem schmuckbekränzten Vieh bergab zu Tal und machten sichs bequem zur langen Winterrast.
Den Pfad empor aber war die alte Stine gekeucht, sie trug in einem Sacktuch all die geschnitzten Löffel und Quirle, welche ihr Großsohn, der Gaisbub, auf der Alm droben während der Sommerzeit geschnitzt hatte. Die Alte lachte über das ganze, sonnegebräunte, wetterharte Gesicht und hielt schon von weitem der Zirblerin ein Schreiben entgegen.
»Endlich kommt’s, das Brieferl«, rief sie, »das g’freut mich damisch.«
Die Wirtschafterin ward dunkelrot vor Entzücken als sie Suseis Handschrift erblickte. Sie faßte das Briefchen sorgsam mit dem Schürzenzipfel und murmelte mit feuchtem Blick, wie sie es früher so oft getan, wenn ihr schmuckes Pflegekind durch irgend eine Liebestat ihr das Herz im Leibe lachen ließ: »O du mein lieb’s Dirnei!« und dann winkte sie wohlbehäbig der Stine und schob sie mit der linken Hand über die Schwelle: »Verschnauf’ ein bisserl’. Ich hab einen Guglhopf ’backen, daß’s eine Freud’ ist! Ich geb’ dir gleich ein großmächtig’s Stück davon, wo die mehrsten Weinbeerln einbacken sind und auch Kaffee dazu! Geh eini!« —
Das ließ sich das alte Botenweiblein nicht zweimal sagen, sondern stampfte mit ihren Nägelschuhen eilig in die Küche, der verheißenen Herrlichkeiten froh zu werden; die Zirblerin aber trat mit glänzenden Augen über die Schwelle, in des Oberförsters Arbeitszimmer und bot den Brief dar, mit einer Miene, als habe sie damit ein Königreich zu geben!
Die Nachricht, die der Brief brachte, war in des alten Herrn und der Zirblerin Augen vielleicht noch mehr wert, wie solch ein Stück Land und Leute, welches nicht jederzeit ein Freudenquell für seinen Herrscher bildet; der Susei Zeilen jedoch glichen einem wahren Wirbelsturm der Wonne, welcher urplötzlich unter das Dach fegt und das unterste im Haus zu oberst kehrt!
Du lieber Gott! war das eine Überraschung, war das eine Herzensfreude!
Selbst dem alten, wetterfesten Oberförster wurden die Augen feucht vor Glückseligkeit, und die Zirblerin hielt sich zwischen Lachen und Weinen ihren Kopf und rief nur ein um das andere Mal: »O du mein! O du mein! Das Susei kommt heim und bringt uns noch was mit!!« Und das war wirklich und wahrlich so.
Die junge Frau Feldjägerleutnant schrieb einen langen Brief und teilte dem Vater mit, daß ihr Mann ganz urplötzlich mit wichtigen Briefen als Kurier nach Petersburg geschickt sei. Was die Reise im Grunde noch bezwecke, wisse sie selber nicht, das sei Dienstgeheimnis, aber ihr Oswald bleibe diesmal viel länger fort, ja, es könne vielleicht ein Vierteljahr ins Land gehen, ehe er wieder dauernd daheim bleiben könne. Da sei es ihr bang, so allein in der fremden, großen Stadt, wo sie gar keine treue Seele wisse. Auch Oswald sorge sich, sie ohne Schutz und Schirm zurückzulassen, umsomehr, als grade ihr schweres Stündlein in diese Zeit der Trennung falle.
Nun sei sie zu dem Entschluß gekommen, für die lange Zeit heimzureisen, dem frohen Ereignis im Forsthaus, unter der Zirblerin treuer Pflege entgegenzusehen.
Der Vater möge ihr doch bis R. entgegenkommen und sie an der Bahn in Empfang nehmen, und die liebe, gute Zirblerin möge ihr die Wochenstube fein behaglich herrichten und die alte Holzwiege vom Boden holen und blankputzen lassen! …« —
Ach, war es denn nur möglich? nur zu glauben?
Sollte es wahrlich noch mal in dem stillen, öden Forsthaus lebendig werden?
Ja, nun klang es wieder hell und lustig durch die verlassenen Räume!
Das Roseli sang und jubilierte auch wieder, denn es war arg kinderlieb und triumphierte: »Nun sind’s die auf dem Schloß doch nit allein! Jetzt kommt’s auch zu uns, so ein liebs Kleines! O du mein, wenn’s doch ein recht fesches g’sundes Bübel wär’!«
»Du dalketes Ding! Ein kleines Dirnei ist uns wohl grad so lieb«, schalt die Zirblerin, denn schelten und anbarschen tat sie jetzt auch wieder, und die Jägerburschen und Waldläufer atmeten nunmehr fröhlich auf, wenn die Alte mal wieder bös Wetter machte, denn ihre gedrückte, trübselige Miene, mit der sie bislang einhergeschlichen war, hatte sie mehr geängstigt und bekümmert, wie ihr zornmütiges Aufbegehren, welches ja niemals so ernsthaft gemeint war, wie’s aussah. Nun begann wieder ein rühriges Leben und Treiben in dem alten Forsthaus, ein Scheuern und Putzen, Fegen und Lüften, ein geheimnisvolles Hinundher in dem ehemaligen Jungfernstübchen der Frau Leutnant!
Vom Boden herab schleppten die Zirblerin und Roseli die mächtige Wiege auf den breitgeschnitzten Kufen, bürsteten, wuschen und polierten das gedunkelte Holz, bis es glänzte wie nagelneu; das rote Herz in dem gemalten Blumenkranz war recht abgeblichen, darum kam der alte Hiesel4, der Waldläufer, welcher bei einer Bärenhatz vor Jahren zu Schaden gekommen war und nun mit seinem Stelzbein als wohlbrauchbarer, stets hülfsbereiter Einleger im Forsthaus herumhumpelte, mit einem roten Farbentöpfchen und pinselte das verblaßte Herz neu über, daß es feuerrot brannte, so recht in »Wonnen flammte«, daß es nun wieder zu Ehren kommen und der Susei ihr Kindli schaukeln sollte.
Der Hiesel pfiff dabei die schönsten Liedchen und Schnadahüpfeln, die ihm nur einfallen wollten und dachte: »Na wart’, du Bübli, du klein’s, wenn du einmal da drin liegst, dann will ich dir schon aufwarten als echter Jager mit einem G’stanzel!« Und er hub mit rauher, altersschwach zitternder Stimme an:
Wann ich geh’ auf die Pirsch,
Schieß’ ein Reh oder ein Hirsch
Oder ein Fuchs oder ein Has
Aber schießen tu ich was!—
Juchhu!
Und dabei schwang er die Kufen und lachte, daß der graue Schnauzbart sich wie Keilerborsten sträubte, und tätschelte die Wiege mit der schwieligen Hand und bischberte: »Na, sei fein stad, mein Bübli, mein lieb’s, ich hör’ ja gleich auf!«
In die Tür war indessen leise die Zirblerin getreten, die stand da und preßte die frisch gestopften Kinderbettchen vor staunender Überraschung an sich und schaute auf den Alten, als traue sie ihren Augen und Ohren nicht. Dann aber ging ein sonniges Lachen über ihr breitknochiges Gesicht; sie drückte das Kinn steif an den Hals, daß es zwei feiste Falten schlug und nickte wohlbehäbig vor sich hin.
»Bist noch alleweil der alte Streichmacher, Hiesel; na, aber keine Schand’ ist es nit, was du da g’rad g’macht hast. Geh’ in die Kuchel und laß dir vom Roseli ein Glas Enzian einschenken. Dafür kommst aber auch, wenn’s Bübli wirklich da drin liegt, und singst ihm was schönes vor!«
»Mir ist’s recht!« schmunzelte Hiesel und zog eine dunkle Holzbüchse aus der Tasche, schraubte sie auf, daß es quietschte, und bot sie der Alten dar.
»Mit Verlaub, Zirblerin, eine Lieb’ für eine Treu’! Da schnupf’ sie einmal. Ist ihr vergunnt.« Da schnupfte die Bäuerin und der Alte schnupfte auch, und sie standen sich beide gegenüber, blinzelten ins Licht, schnitten ein paar wunderliche Gesichter und niesten gar herzhaft los, einmal, zweimal, hazi! — Das war eine Wohltat und schaffte Luft im Hirnkastel. Die Wiege schaukelte von allein weiter und die beiden Alten reichten sich wehmütig die Hand.
»Das ist zuviel für uns, das Glück!« Und der Hiesel nickte und fuhr mit dem Handrücken über die Augen: »Das druckt ein’ z’samm!« sagte er, und stelzte tief ergriffen zur Tür hinaus, sich das Glas Enzianschnaps einschenken zu lassen, ehe die Zirblerin ihre Gutheit reuen möchte.
Endlich war’s so weit.
Das ganze Haus roch nach Kuchen und Schmalz, die Diele war so blitzblank gescheuert und mit grünen Tannenzweiglein bestreut, daß man glauben konnte, auch im Hause drinnen sei frischer Schnee gefallen.
Die mächtigen Kachelöfen waren noch einmal so vollgestopft wie sonst, daß die Bratäpfel in der Röhre krieschten und dampften und sicher verbrannt wären, wenn der Hiesel im letzten Moment nicht noch nach dem Rechten geschaut hätte!
Endlich klingelte es den verschneiten Weg empor. Die beiden Forstgehülfen standen an den Tannen droben und schwenkten mit frischem Juhschrei die grünen Hüte, und die alte Stine, die just des Weg’s kam, stand still und fuchtelte in ihres Herzens Freude mit den Armen durch die Luft.
»Grüß dich Gott, Susei!« — schrie sie, so laut sie es konnte, der Oberförster nickte ihr mit strahlenden Augen zu und die junge Frau beugte sich vor und winkte fröhlich mit der Hand.
Ja, nun kam sie! Und die Zirblerin klopfte die Schürze ab und schritt gravitätisch herzu, hob die Frau Leutnant selber aus dem Schlitten, behutsam und vorsichtig, als fasse sie ein rohes Ei, und sagte dann barsch: »Trampelt’s mir nit das Schneewasser auf den Fußboden!« — denn sie hielt es nicht für schicklich, weich zu sein und zu flennen, sondern wollte dem jungen Weiblein zeigen, daß sie voll reputierlicher Würde nach wie vor dem Hause vorstand.
Frau Seehofer umarmte und herzte aber die Alte, als ob sie ihr das zärtlichste Willkommen gesagt hätte, und da hielt das »barsche Getu’« nimmer stand, die Zirblerin hing am Hals ihres Lieblings und weinte lachend ihre dicksten Freudentränen. Wie schmuck und schön sah die junge Frau aus, so recht wie eine Rose, welche sich eben frisch erschließt, und ganz so fröhlich und guter Dinge wie ehemals, als sie noch die langen, flachsblonden Zöpfe keck im Nacken schwang. Jetzt waren sie sittsam hochgenestelt, und die Kleidung war städtisch und elegant, wie es einer Frau Leutnant zukommt. — Frau Susanne aber trat alsbald vor das hohe Kleiderspind in ihrer Mädchenstube, schloß es auf und blickte mit leuchtenden Augen auf die feschen, kurzen Röcklein, das Miederleibchen und Fürtuch, welches noch darin hing.
»Über ein paar Wochen zieh’ ich’s wieder an, Zirblerin« sagte sie »es gehört nun mal zu den Bergen, und man schreitet ganz anders aus und hantiert viel flinker in diesem lieben Zeug!« —
Ja, in ein paar Wochen!
Wär’s nur erst so weit!
Aber die Zeit flog plötzlich dahin, als das fröhliche Lachen der Susei wieder durchs Haus klang, und dann kamen ein paar Tage, wo die junge Frau still und ernsthaft sinnig in ihrem Stüblein stand, die Arme in heißer Sehnsucht am Fensterlein ausbreitete und mit dem Blick weit hinaus, bis zum fernen Rußland schaute.
»Ach, daß du hier wärest, du herzlieber Mann!« flüsterte sie und an ihren langen Wimpern zitterte es feucht. Die Nacht kam herauf, die kalte, sternklare Winternacht, und als vom Schloß Kochenhall die Böllerschüsse krachten, da stand auch der Oberförster Schill und dankte dem Himmel mit gefalteten Händen für den Enkelsohn, welchen er ihm geschenkt.
Die Roseli aber stürmte in stolzem Übermut vor das Forsthaus und schwenkte die Arme gegen das Schloß.
»Spreizt’s euch nit gar so arg«, schrie sie durch den Schneesturm. »Wir haben auch ein Bübli, und was für eins!«
Und sie lachte und flog dem alten Hiesel an den Hals, im Triumphe wiederholend:
»Ein Bub ist’s, ein Mordsbub! Und uns g’hört er, gelt?«
»Selb ist wahr!« nickte der Hiesel und schluchzte und schluckte die Rührung tapfer hinab. »Und zu Maria Lichtmeß schenk’ ich dem Bübli mein Stutzen — schau, Roseli, ich selber kann ihn fein doch nimmermehr auf die Alm ’nauftrag’n.«
III.
Es ist das Glück ein eigen Ding
Und war’s zu allen Tagen,
Und jagtest du um der Erde Ring.
Du könntest es nicht erjagen.
G
ott gesegne ihm seinen Schlaf und geb’ ihm ein ruhiges G’müt!« sagte die Zirblerin, und sie bekreuzigte erst das Büblein und dann sich, zog die dicken Federbetten hoch empor, daß die kleinen, drallen Händchen darunter verschwanden, und stieß die Wiege fürsorglich noch einmal an.
Dann wandte sie sich zu dem Hiesel, welcher auf der Ofenbank saß und die kalte Pfeife von einem Mundwinkel in den andern schob.
»Jetzt schlaft’s, das Hascherl«, nickte sie ihm zu, »und ich geh’ und bring’ die Hendeln aufs Feuer. Kannst mir ein bisserl ein Holz schichten, Hiesel, der Lausbub, der Toni, hat’s meiste schon verdalkt.«
Der Alte schüttelte den Kopf und rückte das verschlissene, grüne Filzhütlein mit dem Adlerflaum ein wenig zur Seite. Selbst in der Stube ließ er sein geliebtes »Grünei« nicht mehr vom Haupte, und das geschah nicht etwa, weil der Hiesel ein despektierliches Mannsbild und »grantiger Aufbegehrer« gewesen, sondern weil sich sein Haupthaar schon allzusehr gemausert hatte und nimmer nachwachsen wollte.
Da fror es den Hiesel auf dem kahlen Schädel, und besonders im Winter, wenn es durch alle Fugen und Ritzen pfiff, dann kam dem Alten ein Hauptweh an, wie dazumal, als er beim Almerkirchtag sein Hütel, mit dem großen Buschen dran, in die Luft geworfen hatte und nachher nimmer wußte wo’s lag, bis er sich am andern Morgen mit ihm unter einem Scheunendach oder im Weggraben zusammenfand und sich seufzend den Schädel hielt: »O du mein! ist das aber ein Brand!«
Jetzt kam solches Weh aber nicht mehr vom Suff und Gespring, sondern ganz allein vom Schneewind und dem Kahlsein, und drum ließ der Hiesel sein Lodenhütel nimmer vom Haupt, nicht am Tag und nicht zur Nacht, wenn’s auch alleweil speckiger und schäbiger ward. —
Und man kannte das schon und hielt den Hiesel und das Hütli für eins, oder für ein Paar, das mitsammen alt und morsch werden will. Nun saß der Alte auf der Ofenbank und schüttelte sehr obstinat den Kopf zu der Zirblerin Worten:
»Wenn Ihr geht’s und ich geh’, wer schaut da nachher auf’s Bübli?« fragte er gedehnt.
»Das Würmerl schlaft, da sind alle Engerln bei ihm!«
»Ja mein, was weiß denn so ein Engerl von einem kleinen Kind und seiner Ruh«, meinte der Hiesel, abermals den Kopf schüttelnd. »Hab’ ich’s gestern nit selber g’seh’n, wie das Waldmannerl ’naufg’sprung ist und das Bübli schier z’sammendruckt hat?«
»Hiesel, tu’ dich nit mit den Engerln versünden! Das Waldmannerl wird haben fein ausspionieren wollen, wie’s unserm Bübli da geht.«
»Ja, freilich! So ein Vieh schnappt auch gleich zu, wenn ein Patscherl vom Kind herausschaut aus der Wiegen. Wenn die Seehoferin schlaft und der Herr nit daheim ist, so sitz halt ich fein beim Bübli und halt’ Wach’. Geh’ die Zirblerin nur getrost zu ihre Hendeln und rupf’ sie’s, ich bleib’ fein still auf mein’ Posten.«
Und er stelzte herzu, setzte sich auf einen Holzschemel neben die Wiege und zog sein krummes Holzmesser und einen dicken Span aus der Tasche, um eifrig drauf los zu schnitzeln und mit keinem Blick mehr nach der Zirblerin hinzuschauen.
Die stand noch einen Augenblick und druckste, ob sie des Alten Narrheit wohl solle durchgehen lassen, dann aber ging ein zufriedenes Lächeln über ihr Gesicht und sie wandte sich zur Tür.
»Vergebt’s dem Hiesel seine Sünd’, liebe Engerln, und nehmt es nit für ungut, daß wir euch das Bübli nit allein anvertrauen. Aber der Hiesel hat recht, gegen den Waldmann und den Phylax könnt’s ihr mit euren kleinen Patscherln nit aufkommen«, betete sie und traute den lieben Englein auch Einsicht genug zu, in diesem Falle nicht übelnehmisch zu sein.
Und dann ging sie in die Küche und setzte sich nieder, einen tüchtigen Zimmtkuchen anzurühren, denn seit die Susei wieder auf war, da galt’s, ihr ordentlich was zu gute zu tun, und Kuchen aß sie seit jeher für ihr Leben gern.
Kaum aber, daß sie ein Weilchen mit Mehl, Milch und Eiern hantiert hatte, ward die Tür jäh aufgerissen und das Roseli stürzte über die Schwelle, ganz verstört und außer sich, warf sich auf einen Schemel und schlug in wilder Angst die Hände vor der Brust zusammen, als müßte es etwas Unsichtbares festhalten.
»Er kommt! er kommt!« schrie es verzweifelt, »o Jessas, und wird’s uns ja weghol’n!!« —
Die Zirblerin ließ vor Schreck beinahe die Schüssel fallen: »Bist narrisch, Roseli, oder gar besessen? Was schwätzst du für Zeug zusammen?«
Das Roseli aber deutete nur schweigend und aufstöhnend nach dem Fenster, und als die Zirblerin sich vorbog, da schlug auch sie nur die Hände zusammen und schrie auf: »O mein, der Leutnant! Jetzt ist’s aus mit dem Susei und dem Bübli! — ganz aus!«
»Sag ich’s net«, triumphierte die Dirn, »jetzt werdet Ihr auch käsweiß im Gesicht. Ja, wenn er die Susei allein heimholen tät; aber, ich verwett’ meine Seligkeit, justament aufs Bübli hat er’s abg’sehn.«
»Ist ja der Vater zum Kleinen,« murmelte die Zirblerin und setzte sich schwer nieder, denn die Knie zitterten ihr, »und was ihm rechtmäßig zusteht, das steht ihm zu. Aber ich mein’ gleich, der Schnaufer bleibt mir aus! Red’ nix, Roseli, sondern rühr’ den Guglhupfteig ordentlich ab; jetzt ist er erst recht notwendig.«
Nach wenigen Minuten schlug die Haustür, schnelle Schritte tönten über die Diele und verklangen in dem Zimmer des Oberförsters, und dann ein lauter, jubelnder Anruf, ein Lachen und Sprechen … und abermals nach ein paar Minuten ein heller, silberheller Freudenschrei aus der Susei Munde.
Die Zirblerin aber nickte wehmütig vor sich hin. Nun war’s geschehen, nun hatte das Susei ihn wieder. Anfänglich hatte sie’s gemacht, wie bei einem bösen Spuk. »Wenn man nit hinschaut, kommt’s auch nit!« und so hatte sie gar keine Notiz von dem heimkehrenden Feldjägerleutnant genommen und in ihrer Herzensangst gehofft, das Unheil dadurch noch zu parieren, aber es hatte nichts genutzt, der Vater »ihres« Bübleins war gekommen, und daß er kam, sich sein Fleisch und Blut zu holen, das stand wohl fest.
»Ich laß’s aber nit aus, ich kann’s ja gar nit lassen!« schluchzte sie plötzlich auf, erhob sich und stürmte die Stiege empor zum Bübli, und das Roseli schien nur auf einen solchen Ausbruch der Herzensangst gelauert zu haben, denn es schleuderte die Kuchenschüssel weit von sich und folgte wehklagend der Matrone.
Der Hiesel saß seelenvergnügt neben der Wiege und freute sich über die Maßen, daß sein lieb’s Hascherl nicht eingeschlafen war, wie es die Zirblerin behauptet.
Er schaukelte das Bettchen so kräftig, wie es sein gesunder Fuß nur vermochte, hatte das grüne Hütel keck auf das linke Ohr gerückt und pfiff mit zahnlosem Mund, so gut es noch angeh’n wollte, den schönsten Steierischen, der ihm noch im Ohre lag.
Und damit das Büblein ja nimmer an langer Weile leide, machte er obendrein mit den beiden braunknochigen, wetterharten Händen die schönsten Häslein und Männlein, und war heilig überzeugt, daß der Kleine, welcher just drei Wochen alt war, schon eine sakrische Kurzweil darüber empfände.
Das Bübli lag auch wirklich ganz still und riß die großen, braunen Guckerln weit auf und bewegte die drallen kleinen Fäuste auf dem dicken Federbett, als wolle es alles nachahmen, was der vergnügte alte Mann ihm mit Pfeifen, Schnalzen und Fingerspiel vormachte.
Und mitten in diesen seligen Frieden hinein platzten die beiden erschreckten Weibsleute wie Blitz und Knall.
Anfänglich verstand es der Hiesel gar nicht, was sie da lamentierten, er wehrte nur ingrimmig das Roseli ab, welches sich mit Wehgeschrei über die Wiege warf, als müsse es ihren Inhalt mit dem eigenen Leibe gegen jeden räuberischen Überfall schützen, als er aber begriffen hatte, um was es sich handelte, da sprang er auf und schob mit wildblitzenden Augen das Grünhütel vollends auf Krakehl, hob die Fäuste und rief zornmutig: »Unser ist das Bübli, unser bleibt das Bübli! Kreuzschwerenot noch einmal, den möcht’ ich seh’n, der uns das Bübli anrührt, den will ich z’sammenraufen, daß er’s nimmermehr probiert!«
»Hiesel, bist gescheit? Sei doch stad, sag’ ich« schüttelte die Zirblerin verweisend das Haupt: »Was der Seehofer ist, so ist er ja der Vater zu dem Kleinen und hat daher ein Recht daran!«
»O du mein! d’rauf hab’ ich ganz vergessen!« stöhnte der Hiesel und sank reumütig auf den Schemel zurück und legte die Hand über die Augen: »Hab’ vermeint, die Susei hätt’ ihn allein gebracht. Ja, der Vater! Auf den hab’ ich freilich in den Tod hinein vergessen!«
»O Jessas, und da hör’ ich s’ schon auf der Stiegen —«
»Die Susei bringt ihn, ’s ist ja ihr ganzer Stolz …«
»Und mein ganzes Glück! Ohne das Bübli bin ich ein Lump!«
»Nimm dich zusamm’, Hiesel, ich bin auch nit besser!«
Und dabei schlug die Zirblerin die Schürze vor die Augen und schluchzte zum Herzbrechen und das Roseli hub ein furchtbares Lamentieren an und der Hiesel stützte den Kopf und deckte die Hand über die Augen: »O du mein! O du mein!« In demselben Augenblick ward die Tür geöffnet, die schlanke, stattliche Gestalt des jungen Feldjägers, sein selig lachendes Weib im Arm — gefolgt von dem stolzen Großvater, trat ein und wollte mit jubelndem »Grüß Gott!« zu der Wiege stürmen, als er vor dem Anblick der drei wehklagenden Menschen betroffen zurückprallte.
Das Susei hatte auch einen Augenblick gestutzt, dann eilte sie mit leisem Schreckensschrei zur Wiege und riß ihr Kind aus den Kissen empor.
»Was ist es mit dem Jungen? Herr des Himmels, ist er krank, ist ihm was geschehen?«
Und voll verzehrender Angst flog ihr Blick über den Liebling hin.
Das Büblein aber zappelte und schien hocherfreut, daß man es aufgenommen, und Susanne schaute angstvoll fragend auf die Zirblerin und wiederholte dringender noch: — »Warum seid ihr alle so außer euch? — Was ist geschehen? — Sagt’s!«
Da schluchzte die Alte und suchte vergeblich nach Worten, der Hiesel aber erhob sich, lupfte das Grünei und nahm die kalte Pfeife aus dem Mund.
»Schaut’s, Frau, so viel Wehleid im Herzen hab’n, das ist ein hartes Los! Wir alle hab’n das Bübli gern g’habt und hab’n’s betreut, und jetzt ist alles aus! Na, in Gottesnamen, ich bet’ schon für dich und für’s Bübli, und unser Herrgott wird uns ja nit verlassen!«
»Aber Hiesel, dein Geschwätz hat ja keinen Verstand!« rief der Oberförster ärgerlich dazwischen. »Red’ du, Zirblerin, was giebt’s?«
»O du mein,« stöhnte die Alte und wischte ihre Tränen ab, »so schön ist halt alles g’wesen, so schön, und jetzt bin ich ein elendiges Leut’!«
»Sakra! Was für ein narrisches Geschwätz! — Seid’s alle mitsamm’ verruckt worden?«
»Dem Jungen fehlt ja nichts — er ist ganz gesund!«
»Selb ist er schon,« nickte Roseli energisch, »aber was nutzt das? Da kommt der Herr Vater und nimmt sich sein Weib und sein Bübli und geht damit fort und laßt uns allein — —«
Ein schallendes Gelächter ertönte. »Gott sei Lob und Dank — weiter war’s nichts?« lachte Seehofer, griff sein Söhnlein und herzte und drückte und küßte es voll Seligkeit: »O ihr wunderlichen, treuen Seelen, davon kann ja jetzt noch gar keine Rede sein! Ich habe mich ja nur freigemacht, um unsern Jungen taufen zu helfen, — und dann muß ich wieder fort und lasse Frau und Kind noch bis zum Frühjahr bei euch!«
Ei wie flogen da die Schürzen von den Augen, wie stürmten die beiden Weibsleute auf den Sprecher zu und haschten nach seinen Händen, und der Hiesel warf den Hut in die Luft und tat einen Juchzer, daß ihm das Waldmannerl kläffend an den Stelzfuß fuhr.
»Aber Zirblerin!« lachte die Susei nun auch, hoch aufatmend, »bist du denn ganz von Sinnen gewesen? Wie sollt’ ich denn mit diesem kleinen Wurm bei diesem Schnee und Eis reisen?«
»O du mein! Darauf hatt’ ich ganz vergessen!« schüttelte die Alte zwischen Lachen und Weinen den Kopf, und schlug sich vor die Stirn und rief: »Ganz damisch bin ich! In meiner Angst hab’ ich mich nicht recht auskennt! Na freilich, als ob Ihr bei so einem Wetter hättet wegfahren können! Aber das Roseli mit seinem Getrenz’ hat mich so narrisch g’macht. Heilige Mutter Gottes! Und die Hendeln am Feuer und das Geschmalzte!« und noch einmal den Arm des glückseligen jungen Vaters tätschelnd, wiederholte sie recht eindringlich: »Na, und jetzt einen schönen Grüß Gott und Willkomm, Herr, gelt, Ihr seid’s nit bös, daß mir das ehedem in der Gurgel stecken blieb’n ist!«
Der Feldjäger nickte ihr schelmisch zu und blinzte sie an. »G’froren hat mich am Weg, Zirblerin, und da hab’ ich mir immer denkt: Ob s’ wohl noch vom selbigen ang’setzten Kranawitter hat? Und ein’ Hunger hab’ ich dazu, daß ich gar nit bös bin, wenn ein paar Hendeln schon am Herd steh’n.«
Da lachte die Alte in ihrer Freude hell auf und schob das schwarze Kopftuch, welches bei allem Lamentieren hintab gerutscht war, wieder zu Ehren. Ihr Gesicht sah dunkelrot aus, vom Weinen, von der Verlegenheit und nun von der Freude.
»Gott gesegne Euch den Appetit! Gleich wird alles bei’nander sein!« sprach’s und hastete aus der Stube.
Das Roseli hatte sich schon zuvor eilends davon gemacht und deckte schämig die Schürze vor sein Gesicht und wisperte vor sich hin: »O Jegerl, so eine Dummheit! Hab’ ich denkt, er will’s Bübli holen und nachher ist er g’rad im Gegenteil ein Mann, vor dem man Respekt haben muß.« Und damit rührte das Dirnei den Kuchen, daß er Blasen schlug, und legte einen Haufen Späne in das Feuer, daß die Flammen über die Pfanne loderten.
Dieweil nun die Zirblerin und das Roseli Reißaus genommen und in ihrer Schämigkeit gar nicht mehr an das Bübli dachten, stand der Hiesel stumm und grad wie eine Schildwacht neben der Wiege und schaute leuchtenden Auges auf das junge Elternpaar und den Großvater Oberförster, welche sich gar nicht an ihrem Ersten satt sehen konnten, ihn auf den Armen wiegten und genug der Ähnlichkeiten an ihm finden konnten. Bald sollte er dem Großvater wie aus den Augen geschnitten, bald ganz das Ebenbild des Vaters oder der Mutter sein, und während solch ein Schauen und Bewundern gar kein Ende nahm, rumorten die Weibsleute drunten in der Küche, deckten den Tisch und waren reumütigen Eifers voll, bis die Zirblerin endlich wieder auf der Schwelle stand und dem Feldjägerleutnant gravitätisch zunickte: »So, jetzt haltet Euren Einzug; alles ist gericht’!« Da legte Seehofer seinen Knaben in die Wiege zurück, aber er blickte sich dabei suchend nach dem Roseli um und sagte: »Wer bleibt denn bei dem Jungen, wenn wir zu Tisch gehen?«
Susei lachte in sich hinein, der Hiesel aber reckte sich mit toternstem Gesicht noch höher empor, schob die Pfeife von einem Mundwinkel in den andern und sagte: »Mit Verlaub, Herr, das bin ich!«
»Was der Hiesel? Potztausend, Alter, versteht er es denn, solch ein Büblein zu warten?«
Da zuckte es über das wetterbraune Gesicht des Waldläufers. »Mein’ schon,« nickte er selbstbewußt, »fragt’s nur die Frau, wann das Hascherl am schnellsten Ruh’ giebt. Gelt? Wenn der Hiesel eins singt oder gar sein hölzernes G’lachter holt und ihm eins aufspielt. Geht’s nur essen, ich bleib schon da derweil. Ihr seid’s der Herr, ich bin der Waldläufer, der Hiesel!«
Susei strich dem Sprecher freundlich mit der Hand über die Wange.
»Wohl wohl; aber das kreuzbravste Leut bist auch, Hiesel, und wenn das Bübli bei dir ist, nachher liegt’s da wie in Abrahams Schoß.« — Der Seehofer klopfte dem Alten auf die Schulter und lobte ihn, und der Oberförster nickte ihm zu und sagte: »Jetzt weiß ich doch, wozu so ein Stelzbein noch gut ist!«
Und dann gingen sie hinab und es ward wieder still bei der Wiege.
Der Hiesel aber sah aus, wie ein Triumphator, setzte sich abermals auf den Schemel nieder und steckte dem Bübli, welches über seine plötzliche Verlassenheit justament anfangen wollte, herb zu schreien, den süßen Lutschbeutel in den Mund.