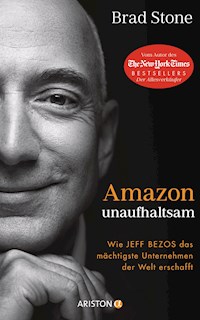
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ariston
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die einzigartige Geschichte von Jeff Bezos
Amazon hat es geschafft, von Seattle aus jeden Haushalt der Welt zu erreichen. Zunächst mit einem unschlagbaren Online-Shopping-Angebot, dann durch eine gnadenlose Expansion in sämtliche Bereiche unseres Lebens: Smart-Home-Angebote, Cloud-Computing-Lösungen, Logistikdienstleistungen, Lebensmittellieferungen – sogar unser Fernsehprogramm stellt der Online-Riese mit einem Lächeln bereit.
Was hat dieses Unternehmen vor, das in den vergangenen zehn Jahren seine Mitarbeiterzahl verfünffacht und seinen Unternehmenswert auf über eine Billion US-Dollar geschraubt hat? Oder besser: Was treibt Jeff Bezos an, den Wirtschaftsführer, der weltweit ebenso respektiert wie gefürchtet ist? Mit Amazon hat er eine Macht erschaffen, die unsere Welt am Laufen hält, sie versorgt und kontrolliert.
Bloomberg-Journalist und New-York-Times-Bestseller-Autor Brad Stone zeichnet in seinem neuen Buch das facettenreiche Porträt des Mannes und seines weltumspannenden Unternehmens, ohne das wir uns unser Leben kaum mehr vorstellen können.
»Brad Stone ist ein zuverlässiger und einnehmender Chronist einer der größten Mächte unserer Zeit.« Jon Meacham, Pulitzer-Prize-Gewinner und Autor mehrerer #1 New-York-Times-Bestseller
»Brad Stone beschreibt, wie es dem Technologie-Titanen und wichtigsten Unternehmen der Welt gelingen konnte, nicht nur den weltweiten Handel, sondern auch Washington, Hollywood, das Weltall und Ihr Gehirn einzunehmen.« Rana Foroohar, Autorin von Makers and Takers und Don’t Be Evil
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 756
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zum Buch:
Wer glaubt, soziale Medien hätten den größten Einfluss auf unsere Gesellschaft, hat noch nicht Alexa gefragt ...
Der Online-Riese mit dem kleinen »a« hat es geschafft, von Seattle aus jeden Haushalt der Welt zu erreichen. Zunächst mit einem unschlagbaren Online-Shopping-Angebot, dann durch eine gnadenlose Expansion in sämtliche Bereiche unseres Lebens: Smart-Home-Angebote, Cloud-Computing-Lösungen, Logistikdienstleistungen, Lebensmittellieferungen - sogar unser Fernsehprogramm stellt Amazon mit einem Lächeln bereit.
Was hat dieses Unternehmen vor, das in den vergangenen zehn Jahren seine Mitarbeiterzahl verfünffacht und seinen Unternehmenswert auf über eine Billion US-Dollar geschraubt hat?
Oder besser: Was treibt Jeff Bezos an, den Wirtschaftsführer, der weltweit ebenso respektiert wie gefürchtet ist? Mit Amazon hat er eine Macht erschaffen, die unsere Welt am Laufen hält, sie versorgt und kontrolliert.
Bloomberg-Journalist und New-York-Times-Bestseller-Autor Brad Stone zeichnet in seinem neuen Buch das facettenreiche Porträt des Mannes und seines weltumspannenden Unternehmens, ohne das wir uns unser Leben gar nicht mehr vorstellen können.
Zum Autor:
Brad Stone ist einer der profiliertesten Wirtschaftsjournalisten der USA. Bevor er bei »Bloomberg Businessweek« in San Francisco anheuerte, schrieb er für die altehrwürdige »New York Times« und »Newsweek«. Seine umfassenden Kontakte zu Freunden und Feinden der Netzgrößen Apple, Google, Facebook und natürlich Amazon ermöglichen ihm unvergleichliche Einsichten hinter die Kulissen der Tech-Welt. Von »Der Allesverkäufer«, Stones Buch über den Aufstieg Amazons zum dominierenden Online-Händler unserer Zeit, wurden weltweit über eine halbe Million Exemplare verkauft. »Amazon unaufhaltsam« hat das Zeug, diese Zahlen zu toppen.
Brad Stone
Amazon unaufhaltsam
Wie Jeff Bezos das mächtigste Unternehmen der Welt erschafft
Aus dem Amerikanischen von
Claudia Arlinghaus, Ariane Böckler, Bernhard Josef und Inge Wehrmann
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel
»Amazon Unbound« bei Simon & Schuster.
All Rights Reserved. Published by arrangement with the original publisher, Simon & Schuster, Inc.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter www.dnb.de abrufbar.
Der Abdruck der Zitate auf S. 9 erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Verlage:
Graham Moore, übersetzt aus dem Englischen von Kirsten Riesselmann, Die letzten Tage der Nacht, © 2018 Bastei Lübbe AG, Köln.
John Steinbeck, übersetzt aus dem Englischen von Rudolf Frank, Die Straße der Ölsardinen, © 1992 Paul Zsolnay Verlag GmbH, Wien.
Aus dem Amerikanischen von
Claudia Arlinghaus, Ariane Böckler, Bernhard Josef und Inge Wehrmann
© 2021 by Brad Stone
© 2021 Ariston Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten
Redaktion: Jordan T. A. Wegberg
Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich,
unter Verwendung eines Fotos von © John Keatley/Redux
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN: 978-3-641-25840-5V001
Für meinen Vater, Robert Stone
Inhalt
Einleitung
Teil I
Erfindung als A und O
Kapitel 1: Der Über-Produktmanager
Kapitel 2: Langweilig genug, um keine Aufmerksamkeit zu erregen
Kapitel 3: Cowboys und Killer
Kapitel 4: Das Jahr der kleinlauten Skeptiker
Kapitel 5: »Die Demokratie stirbt im Dunkeln«
Kapitel 6: Angriff auf Hollywood
Teil II
Leverage
Kapitel 7: Die Auswahlmaschine
Kapitel 8: Amazons Zukunft ist CRaP
Kapitel 9: Die letzte Meile
Kapitel 10: Die Goldgrube im eigenen Hinterhof
Kapitel 11: Gradatim Ferociter
Teil III
Unbesiegbarkeit
Kapitel 12: Betriebslizenz
Kapitel 13: Komplikationen
Kapitel 14: Tag der Abrechnung
Kapitel 15: Pandemie
Danksagung
Anmerkungen
Register
»Sein Genie lag nicht darin, etwas zu erfinden, sondern ein System der Erfindung zu erfinden. Dutzende Forscher, Ingenieure, Entwickler und Tüftler arbeiteten unter seiner Ägide, in einem sorgfältig hierarchisch strukturierten Unternehmen, das er gegründet hatte und überwachte.«
Graham Moore, übersetzt aus dem Englischen von Kirsten Riesselmann, Die letzten Tage der Nacht
»Mir war von jeher verwunderlich«, führte Doc aus: »alles, was wir an Menschen bewundern: Edelmut, Güte, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Anstand, Mitgefühl, Herz führen in unserm Gesellschaftssystem nur zu Fehlschlägen. Während alle Eigenschaften, die wir angeblich verachten, Härte, Raffsucht, Selbstsucht und Charakterlosigkeit, zum Erfolg beitragen. Jenen guten Eigenschaften gilt die Bewunderung der Menschen, doch was sie mit Vorliebe produzieren, sind diese grundschlechten.«
John Steinbeck, übersetzt aus dem Englischen von Rudolf Frank, Die Straße der Ölsardinen
Einleitung
Es war eine Versammlung im geschlossenen Raum, die kurz darauf schon etwas Anachronistisches haben sollte, vergleichbar mit dem Brauch einer vergessenen Zivilisation. An einem Sonntagabend im November 2019, einen Monat bevor das Auftauchen von Covid-19 im chinesischen Wuhan die schlimmste Pandemie der Neuzeit lostrat, traf sich im Rahmen einer Gala Prominenz aus Politik, Medien, Kunst und Wirtschaft in der National Portrait Gallery der Smithsonian Institution in Washington. Michelle Obama, Hillary Clinton, Nancy Pelosi und Hunderte weiterer geladener Gäste drängten sich im überdachten Patio des Museums. Gekommen waren sie zur feierlichen Aufnahme von sechs neuen Porträts amerikanischer Ikonen in die permanente Sammlung des Instituts, unter anderem des Komponisten und Texters des Musicals Hamilton, Lin-Manuel Miranda, der Vogue-Herausgeberin Anna Wintour sowie eines der reichsten Menschen der Welt – des Amazon-Gründers und CEO Jeff Bezos.
Bezos’ lebensechtes Porträt des Fotorealisten Robert McCurdy zeigte ihn vor einer nüchternen weißen Leinwand, mit gestärktem weißem Hemd, Silberkrawatte und dem durchdringenden Blick, der seine Beschäftigten ein Vierteljahrhundert lang aus der Fassung gebracht hatte. In seiner Ansprache zur Entgegennahme des Portrait of a Nation Prize, der für die Hingabe an »Leistung, Kreativität, Individualität, Einsichten und Genie« verliehen wird, dankte Bezos dem großen Kreis von Familie und Kollegen im Publikum und schlug dann, wie bei all seinen Auftritten in der Öffentlichkeit, betont bescheidene Töne an.
»Mein Leben fußt auf einer langen Serie von Fehlern«, sagte er nach einer eloquenten Vorstellung durch seinen ältesten Sohn, den 19-jährigen Preston Bezos. »Dafür bin ich ja gewissermaßen berühmt in der Geschäftswelt. Wie viele von Ihnen hier haben ein Fire Phone?« Schallendes Gelächter, dann Stille – der Flop von Amazons Smartphone hatte es 2014 zu trauriger Berühmtheit gebracht. »Eben, keiner, nicht einer von Ihnen. Danke«, sagte er unter weiterem Gelächter.
»Was immer ich Interessantes gemacht habe, was immer ich Wichtiges gemacht habe, was immer ich zum Nutzen anderer gemacht habe, es kam dazu in einer Kaskade von Experimenten und Fehlschlägen«, fuhr Bezos fort. »Ich trage die Narben von allen, von Kopf bis Fuß.« McCurdy, so erzählte er, habe er sich aus einer Reihe von Mappen ausgesucht, die ihm das Museum vorgelegt hatte, weil er jemanden wollte, der ihn »hyperrealistisch« malte, »mit jedem Makel, jedem Schönheitsfehler, jeder Narbe, die ich nur habe«.
Das Publikum reagierte auf Bezos’ Rede stürmisch mit stehenden Ovationen. Es war nun mal solch ein Abend. Earth, Wind & Fire spielten, die Gäste tranken und tanzten, der Komiker James Corden überreichte Wintour die Auszeichnung als sie selbst: mit blonder Perücke, dunkler Sonnenbrille und Mantel mit Pelzbesatz. »Sagen Sie doch Jeff Bezos, er soll mir Kaffee holen!«, improvisierte er unter dem entzückten Kreischen der betuchten Gäste.
Abseits der elitären Veranstaltung freilich gestaltete sich die Einstellung gegenüber Amazon und seinem CEO im sechsundzwanzigsten Jahr des Unternehmens nicht ganz so unkompliziert. Amazon boomte, aber mit angeschlagenem Ruf. Wo immer die Firma beklatscht wurde, waren auch kritische Dissonanzen zu hören. So sehr Amazon bewundert, von seinen Kunden gar heiß geliebt wurde, so sehr misstraute man vielerorts der Heimlichtuerei hinsichtlich der Absichten des Unternehmens, und das schwindelerregende Vermögen seines Gründers vor dem Hintergrund der Misere seiner Beschäftigten an der Basis warf besorgniserregende Fragen über die asymmetrische Verteilung von Geld und Macht auf. Amazon war nicht länger nur die inspirierende Erfolgsstory eines Unternehmens, sondern ein Volksentscheid über die Gesellschaft und die Verantwortung, die ein Großkonzern gegenüber seinen Beschäftigten, seiner Gemeinschaft und der Unverletzlichkeit unseres fragilen Planeten trägt.
Bezos hatte Letzteres mit seiner Climate Pledge anzugehen versucht, Amazons Versprechen, bis 2040 klimaneutral zu werden, zehn Jahre vor der vom Pariser Klimaabkommen gesetzten Frist. Kritiker beharkten Amazon, seine CO2-Bilanz – den Beitrag des Unternehmens zur rasanten Erwärmung der Planeten – offenzulegen wie andere Firmen auch. Amazons Nachhaltigkeitsabteilung hatte jahrelang an effizienteren Standards für seine Gebäude und den verschwenderischen Umgang mit Verpackungsmaterial laboriert. Aber nur deren Ergebnisse herauszugeben und wie andere Unternehmen einen CO2-Bericht zu veröffentlichen genügte nicht. Bezos bestand darauf, dass Amazon das Problem kreativ anging, sodass der Konzern womöglich gar als Vorreiter gelten würde und seine millionenstarke weltweite Kundschaft beim Klick auf »Jetzt kaufen« kein schlechtes Gewissen zu haben bräuchte.
Einen konkreten Ansatz für die Erfüllung dieses hehren Ziels freilich gab es nicht, insbesondere angesichts von Amazons wachsender Armada umweltverschmutzender Flugzeuge, Trucks und Vans.1 Aber Bezos wollte mit seinem Klimaversprechen an die Öffentlichkeit gehen und andere Unternehmen mit großer Geste zur Mitunterzeichnung auffordern. Einer firmenintern diskutierten Idee zufolge sollte er die Initiative mit einem Video bekannt geben, das er auf einer der Polarkappen aufzeichnen wollte. Sowohl in Amazons Nachhaltigkeits- als auch in der PR-Abteilung zerbrach man sich einige Tage lang den Kopf darüber, wie dieser ebenso komplexe wie kohlenstoffintensive Albtraum von einem PR-Stunt über die Bühne zu bringen wäre – bis man zu ihrer Erleichterung davon Abstand nahm. Man entschied sich für die weit besser erreichbaren und obendrein wärmeren Gefilde des National Press Club in Washington.
Am Morgen des 19. September 2019, zwei Monate vor der Gala im Smithsonian, versammelten sich mehrere Dutzend Presseleute zu einer der eher seltenen Audienzen bei Amazons CEO. Bezos saß auf einem kleinen Podium, zusammen mit Christiana Figueres, der ehemaligen Generalsekretärin des Sekretariats der UN-Klimarahmenkonvention. »Vorhersagen von Klimawissenschaftlern von vor gerade mal fünf Jahren«, so begann er, »erweisen sich als falsch. Die arktischen Eisdecken schmelzen um 70 Prozent schneller als vor fünf Jahren vorhergesagt. Die Weltmeere erwärmen sich um 40 Prozent schneller.« Als Beitrag zur Erfüllung seiner neuen Ziele, so fuhr er fort, würde Amazon seine geschäftlichen Aktivitäten zu 100 Prozent auf erneuerbare Energien umstellen. Der erste Schritt wäre eine Bestellung von 100.000 Elektrovans bei Rivian Automotive, einem von Amazon mitfinanzierten Start-up in Plymouth, Michigan.
In der folgenden Q&A-Runde fragte einer der Reporter Bezos nach einer Gruppe von Arbeitern, die sich unter dem Motto »Amazon-Angestellte für Klimagerechtigkeit« organisiert hätten. Sie forderten unter anderem, dass der Konzern nicht länger klimaleugnende Politiker unterstützte und sein Cloud-Computing-Geschäft CO2-neutralen Unternehmen übertrug.2 »Ich halte das für völlig verständlich«, sagte Bezos zu den Bedenken der Gruppe, merkte jedoch an, dass er nicht all ihre Forderungen teile. »Wir wollen doch nicht die Tragik der Allmende wiederholen. Wir müssen hierbei alle an einem Strang ziehen.« Einige Monate später, inmitten der Covid-19-Pandemie, feuerte Amazon zwei Wortführer der Gruppe.
Ich war bei der Audienz selbst mit im Publikum und hob die Hand, um Bezos die letzte Frage des Vormittags zu stellen: Ob er denn zuversichtlich sei, dass die Menschheit rasch genug handeln könnte, um den schlimmsten Szenarien der Erderwärmung zu entgehen? »Ich bin von Natur aus optimistisch«, sagte er und fixierte mich dabei mit dem Laserblick, denn der Maler Robert McCurdy so gut getroffen hatte. »Wenn man etwas mit Findigkeit, mit Fantasie angeht, wenn man sich zu etwas entschließt und die Leidenschaft zum Zug kommt, wenn man sich starke Ziele setzt – dann glaube ich wirklich, dass man sich aus jeder Zwangslage befreien kann. Genau das müssen wir Menschen jetzt tun. Ich glaube, wir schaffen das. Ich bin sicher, wir schaffen das.«
Aus seiner Antwort sprach der absolute Glaube an die fundamentalen Tugenden der Technik und die Fähigkeit der klügsten und entschlossensten Innovatoren, uns aus welcher Patsche auch immer zu manövrieren. Wenigstens in diesem Augenblick wirkte er wie der alte Jeff und ganz und gar nicht wie der Milliardär, Gründer und Chef eines Unternehmens, das die Welt – je nach Perspektive – entweder in eine aufregende Zukunft führt oder das auf immer die kraftspendende Sonne fairen Wettbewerbs zu verdunkeln droht.
Heute verkauft Amazon so gut wie alles und liefert es prompt, betreibt über seine Rechenzentren einen Gutteil des Internets, streamt Filme und Fernsehserien in unsere Wohnzimmer und vertreibt eine beliebte Kollektion sprachgesteuerter Lautsprecher. Vor knapp dreißig Jahren jedoch war Amazon gerade mal eine Idee, die im 40. Stock eines Wolkenkratzers in Midtown Manhattan die Runde machte. Für den Fall, dass Sie mit dieser fundamentalen Internetlegende nicht vertraut sein sollten, sei sie hier kurz erzählt:
Zu seinem Dreißigsten gelobte sich Jeffrey Preston Bezos, den Weg des Unternehmers zu gehen; er hängte seinen hoch dotierten Job beim renommierten Wall-Street-Hedgefonds D. E. Shaw an den Nagel, um ein auf den ersten Blick bescheidenes Geschäft in Form eines Online-Buchversands aufzuziehen. Mit seiner 24-jährigen Gattin MacKenzie flog er nach Fort Worth, holte dort den 88er Chevy Blazer der Familie aus der Lagerhalle und bat seine Frau, einfach in Richtung Nordwesten zu fahren, während er neben ihr, den Laptop auf dem Schoß, mit seiner Tabellenkalkulationssoftware Hochrechnungen anzustellen begann. Das war 1994, das für das Internet paläolithische Jahr.
Er begann sein Start-up etwas außerhalb von Seattle, in der Garage eines kleinen Ranch-Style-Bungalows mit nichts weiter als einem alten Kanonenofen in der Mitte, und baute seine ersten beiden Schreibtische eigenhändig aus zwei Holztüren aus dem Heimwerkermarkt zu je 60 Dollar. Er nannte seine Firma zuerst Cadabra Inc., kam ins Wanken, überlegte Bookmall.com, Aard.com und Relentless.com, bevor er schließlich zu dem Schluss kam, dass der Welt größter Fluss die weltweit größte Auswahl an Büchern wohl am besten traf: Amazon.com.
Er finanzierte das Start-up zunächst selbst, zusammen mit einer 245.000-Dollar-Investition seiner treusorgenden Eltern Jackie und Mike. Als die Website 1995 online ging, befand Amazon sich sofort mitten im Wirbelwind der eben aufkommenden Begeisterung für eine neue Technologie namens World Wide Web. Man verzeichnete bei den Bestellungen wöchentliche Zuwachsraten von 30, 40, 50 Prozent, was freilich jeden Versuch einer sorgfältigen Planung unterminierte und das erste Häuflein eklektischer Beschäftigter zu einem derart rasenden Tempo zwang, dass die Beteiligten später hinsichtlich dieser Anfangszeit eine greifbare kollektive Amnesie befiel. Die ersten potenziellen Geldgeber schreckten größtenteils vor der Investition zurück, misstrauisch einerseits dem Internet gegenüber, andererseits gegenüber diesem selbstbewussten jungen Geek von der Ostküste mit dem bekloppten Lachen, das eher nach einem Bellen klang. 1996 jedoch nahmen sich Risikokapitalgeber aus dem Silicon Valley des Start-ups an. Der plötzliche Geldsegen legte einen Schalter im Gehirn des künftigen CEO um – was einen draufgängerischen Eifer wilder Ambitionen und fieberhafter Dominanzträume auslöste.
Das erste firmeninterne Motto lautete »Get Big Fast«. Amazons rasantes Wachstum während des Dot.com-Booms Ende der 1990er-Jahre, wie man ihn später nennen sollte, war phänomenal. Bezos stellte neue Manager ein, eröffnete neue Verteilungszentren, inszenierte 1997 medienträchtig einen Börsengang und erwehrte sich der verzweifelten Klage seines ersten Rivalen, der Buchkette Barnes & Noble. Seiner Ansicht nach war Amazon als »Marke« formbar nach Art von Richard Bransons Virgin, und so stürzte er sich kopfüber in neue Produktkategorien wie CDs, DVDs, Spielzeug und elektronisches Gerät. »Wir fliegen mit dem Teil hier noch auf den Mond«, sagte er seinem CEO-Kollegen Howard Schultz, dem damaligen Chef von Starbucks.
Bezos wollte eigene Erfolgsmaßstäbe setzen, ohne die Einmischung ungeduldiger Außenseiter. Und so formulierte er seine operative Philosophie in seinem ersten Aktionärsbrief, in dem er gelobte, sich nicht auf unmittelbare finanzielle Gewinne oder die Befriedigung kurzsichtiger Forderungen der Wall Street, sondern auf die Erhöhung des Cashflows und einen wachsenden Marktanteil zu konzentrieren. Er versprach treuen Aktionären langfristigen Wert. »Heute ist Tag eins für das Internet und, wenn wir alles richtig machen, auch für Amazon.com«, schrieb er und prägte damit die legendäre Wendung »Day One«, die firmenintern bei Amazon künftig für die Notwendigkeit permanenter Neuerung, schneller Entscheidungen und das eifrige Aufgreifen breiterer technologischer Trends stehen sollte. Investoren stellten sich ein und trieben den Wert der Aktie in unvorstellbare Höhen. Der CEO wurde Millionär und Prominenter. Er erschien als »Person des Jahres« auf dem Cover von Time, wo sein kahles Haupt etwas dusselig aus einem Karton voll bunter Verpackungschips ragt.
Hinter den Kulissen jedoch ging es drunter und drüber. Amazons verschwenderische Investitionen in andere Dot.com-Start-ups liefen schief, eine ganze Reihe von Akquisitionen hatte nichts gebracht, und viele der ersten Angestellten, die man traditionellen Einzelhändlern wie Walmart abgeworben hatte, suchten nach einem befremdeten Blick auf das Chaos das Weite. Die ersten Versandzentren waren über die Weihnachtsfeiertage derart überfordert, dass Angestellte aus Seattle jeden Dezember ihren Schreibtisch verlassen, die Ärmel hochkrempeln und an der Front mit anpacken, das heißt Geschenke verpacken mussten, wozu sie paarweise in frugalen Hotelzimmern einquartiert wurden.
Die nächsten beiden Jahre über verlor die Firma Geld an allen Ecken und Enden und wäre während des Platzens der Dot.com-Blase um ein Haar baden gegangen. Ein Finanzblatt bedachte das Unternehmen mit dem Beinamen »Amazon.bomb« und erklärte dazu: »Investoren kommen langsam, aber sicher dahinter, dass diese Märchenaktie ihre Probleme hat.« Was an der Firma haften blieb. Bezos wurde allgemein belächelt und musste sich 2001 sogar letztlich unbegründeten Ermittlungen der Börsenaufsicht wegen Insiderhandels stellen. Ein ganz bestimmter Analyst sorgte immer wieder für Schlagzeilen mit wiederholten Vorhersagen, dass dem Unternehmen jeden Augenblick das Geld ausgehen würde. Damals war Amazon bereits in ein ehemaliges Art-déco-Krankenhaus des Veteranenamts auf einer Anhöhe mit Blick auf das Zentrum von Seattle gezogen. Als im Februar 2001 das Nisqually-Erdbeben den pazifischen Nordwesten erschütterte, regnete es dort Ziegelbrocken und Mörtel, was sich wie eine düstere Prophezeiung ausnahm. Bezos und seine Angestellten flüchteten sich unter ihre Schreibtische aus dicken Türen.
Amazons Aktie sank in die Einstelligkeit; mit den Träumen vom schnellen Vermögen war es aus. Der damals 37-jährige Bezos kritzelte »Ich bin nicht mein Aktienkurs!« auf ein Whiteboard in seinem Büro und legte beim Service für seine Kundschaft zu, so etwa mit einer Blitzauslieferung des jüngsten Harry-Potter-Romans noch am Tag des Erscheinens.
Die Angestellten hatten Angst, aber Bezos schien Eiswasser in den Adern zu haben. Durch eine gut getimte Schuldenemission und eine Finanzspritze über 100 Millionen Dollar vom Online-Dienst AOL im Sommer 2001 bekam die Firma genügend Geld zusammen, um ihren Verpflichtungen nachzukommen und dem Schicksal der meisten anderen Dot.coms zu entgehen. Als Amazon die Kosten schließlich weit genug reduziert hatte, um das Frühjahrsquartal 2003 mit einem Gewinn abzuschließen, versteckte der nachtragende CEO mit dem Akronym milliravi in der Ergebnismeldung einen Insiderscherz auf Kosten des Analysten, der bereits Amazons Ableben prophezeit hatte.3
Das Unternehmen hatte überlebt, nur schien es einfach nichts Besonderes mehr zu haben. Der große Rivale unter den Online-Händlern – eBay – hatte weit mehr Produkte im Angebot; die Discounterkette Walmart war billiger; Googles wachsende Suchmaschine zog die besten Ingenieure der Welt ebenso an wie die Online-Shopper, um dann Amazon für die Platzierung von Werbung in den Suchergebnissen zur Kasse zu bitten, damit Bezos’ Unternehmen seine Kundschaft zurückbekam.
Was folgte, war eine der bemerkenswertesten Trendwenden der Wirtschaftsgeschichte. Nachdem Bezos nicht mit eBays Erfolg in Sachen Online-Auktionen gleichziehen konnte, öffnete Bezos Amazon für Fremdverkäufer und ermöglichte ihnen, ihre Waren neben seinen eigenen Produkten zu präsentieren – sollten die Kunden entscheiden, von wem sie was kauften. Dann hatte er eine Erleuchtung bezüglich des Circulus virtuosus beziehungsweise des Schwungrads, das sein Geschäft antrieb. Indem firmenfremde Verkäufer und eine zusätzliche Auswahl von Produkten mit ins Angebot genommen wurden, zog Amazon nicht nur neue Kundschaft an, sondern kassierte obendrein Provisionen für diese Verkäufe, mit denen sich die Preise senken oder eine schnellere Lieferung unterstützen ließen. Das zog weitere Kundschaft und diese wiederum neue Verkäufer an. Wenn man in irgendeinen Teil dieser Kette investierte, so Bezos’ Kalkül, ließe der Kreislauf sich beschleunigen.
Darüber hinaus stellte Bezos mit Jeff Wilke einen Manager des Avionik-Riesen AlliedSignal ein. Wilke war Bezos nicht ganz unähnlich: altklug, ehrgeizig und hauptsächlich auf die Zufriedenheit des Kunden ausgerichtet, praktisch vor allem anderen, einschließlich der Gefühle seiner Angestellten. Zusammen modelten die beiden Amazons Lagerhäuser um, nannten sie »Fulfillment Centers (Erfüllungszentren)« und schrieben ihre Logistiksoftware von Grund auf um. Die Fähigkeit, Kundenbestellungen effizient und voraussagbar zu erfüllen, erlaubte Amazon, in immer neue Produktkategorien – wie etwa Schmuck und Kleidung – zu expandieren; und schließlich führte man für 79 Dollar jährlich mit Amazon Prime die verlockende Zwei-Tages-Liefergarantie ein.
Mit Andy Jassy, einem anderen gleichgesinnten Manager, expandierte Bezos in eine sogar noch überraschendere Richtung. Als er bei der Beschäftigung mit der Arbeitsweise seiner Ingenieure verstand, welche Erfahrung sein Unternehmen beim Aufbau einer Computerinfrastruktur gesammelt hatte, die selbst enormen saisonalen Traffic-Spitzen standhalten konnte, kam ihm mit den Amazon Web Services eine ganz neue Geschäftsidee. Der Gedanke dahinter war der, Amazons gewaltige Rechenleistung an andere Organisationen zu verkaufen, die online Zugang dazu hätten und damit ihre eigenen Arbeitsabläufe wirtschaftlich durchführen könnten.
Der Businessplan wollte vielen nicht so recht einleuchten, selbst vielen von Amazons eigenen Angestellten und einigen aus dem Board. Aber der mittlerweile 42-jährige Bezos glaubte daran; das Projekt bis ins Kleinste managend, schickt er den AWS-Teamchefs außerordentlich detaillierte Empfehlungen und Zielvorgaben, oft noch spät in der Nacht. »Es muss sich unendlich skalieren lassen, und das ohne geplante Ausfallzeiten«, sagte er den leidgeprüften Ingenieuren, die mit dem Projekt beschäftigt waren. »Unendlich!«
Gleichzeitig war Bezos entsetzt über Apples rasanten Zuwachs beim Verkauf von Musik über seinen iPod-Player und iTunes-Store. Besorgt über ein ähnliches Eindringen Apples ins Buchgeschäft initiierte er ein geheimes Projekt zur Entwicklung von Amazons eigenem E-Book-Reader, der schließlich als Kindle auf den Markt kam. Kollegen hielten es für verrückt, dass ein fortwährend Geld verlierendes Unternehmen wie Amazon auch noch Gadgets herstellen sollte. »Ich weiß sehr gut, wie schwierig das ist«, sagte Bezos ihnen, »aber wir lernen das schon.«
Er vertraute das Projekt Steve Kessel an, den er von seiner Verantwortung als Leiter von Amazons Buchgeschäft abzog. Er gab ihm die Anweisung, vorzugehen, »als wollten Sie den ganzen traditionellen Buchhandel arbeitslos machen«. Die daraus resultierenden Scharmützel mit traditionellen Verlegern um die Konditionen für den neuen E-Book-Markt zogen sich über Jahre hinweg und brachten Amazon den Vorwurf räuberischen Verhaltens ein. Paradoxerweise führten sie auch zu einer Kartellklage gegen fünf große Verleger und Apple, denen man illegale Absprachen zur Festlegung der Preise für E-Books oberhalb von Kindles Standardverkaufspreis von 9,99 Dollar vorwarf.
Das Zusammentreffen der drei genannten Initiativen – Fulfillment Center, AWS und Kindle – machte Amazon einmal mehr zum Liebling der Wall Street. 2008 überholte Amazon eBay bei der Marktkapitalisierung und wurde bald in einem Atemzug mit Google, Apple und Facebook, einem vielversprechenden Neuling aus dem Silicon Valley, genannt. Dann setzte Bezos alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel ein, um Walmart den Rang abzulaufen und zwei eben aufkommende Online-Rivalen aufzukaufen: den Schuhhändler Zappos und Quidsi, einen Verkäufer von Verbrauchsgütern, dem die beliebte Windel-Website Diapers.com gehörte. Kartellrechtlich waren diese Deals rasch genehmigt – Entscheidungen, denen man später, im Lichte von Amazons wachsender Macht, skeptisch begegnen sollte.
Wie sich herausstellte, steckte hinter dem zunehmend fitten CEO mit dem mittlerweile rasierten Haupt weit mehr, als man ihm zugetraut hätte. Er war ein begieriger Leser, führte Führungskräfte durch Diskussionen von Titeln wie Clayton Christensens The Innovator’s Dilemma und hatte eine tiefe Aversion dagegen, irgendetwas auf konventionelle Weise anzugehen. Angestellte wurden angehalten, für seine vierzehn Führungsprinzipien zu stehen, so etwa Kundenfixierung, Sparsamkeit oder höchste Ansprüche an Bewerber; außerdem sollten sie diese täglich bei ihren Entscheidungen berücksichtigen: bei Neueinstellungen, bei Beförderungen, ja selbst bei belanglosen Veränderungen am einen oder anderen Produkt.
PowerPoint-Präsentationen mit ihren zahllosen Stichpunkten und unausgegorenen Gedankengängen waren in der Firma verboten, so beliebt sie beim Rest der amerikanischen Geschäftswelt auch sein mochten. Stattdessen begannen alle Meetings mit einer geradezu meditativen Lektüre datenschwangerer sechsseitiger Dokumente, die intern als »Narrative« bekannt sind. Der Akt des Geschäftsaufbaus war bei Amazon ein redaktioneller Prozess, alle Papiere erfuhren zahlreiche Revisionen, immer wieder wurde über die Bedeutung selbst einzelner Wörter debattiert; es gab dazu akribische Anmerkungen von der Führungsriege, vor allem von Bezos selbst. Arbeitsgruppen bei Amazon wurden in kleine, wendige Einheiten aufgeteilt, die man als Zwei-Pizzen-Teams bezeichnete (weil sie klein genug waren, um sie mit zwei Pizzen satt zu bekommen); sie waren zur flinken Arbeit angehalten, zuweilen auch in Konkurrenz miteinander.
Was diese ungewöhnliche, dezentralisierte Unternehmenskultur auf keinen Fall duldete, waren Kompromisse zwischen Tempo und Qualität. So schnell man auch zu arbeiten hatte, es durfte dabei nichts kaputtgehen – nichts! Zielvorgaben, Verantwortlichkeiten und Deadlines kamen von oben, Metriken wurden von unten nach oben durchgegeben. Die Tools dazu waren wöchentliche beziehungsweise vierteljährliche Geschäftsberichte sowie halbjährliche unternehmensweite – als OP1 (im Spätsommer) und OP2 (nach dem Weihnachtsgeschäft) bekannte – Performance-Reviews. Dabei wurde die Leistung der einzelnen Teams durch das S-Team (senior team) beurteilt, also durch Bezos’ sakrosankten, mit seelenverwandten Mathegenies besetzten Führungsrat. An der Spitze von alledem saß Bezos selbst, der vielversprechende neue Projekte durchdachte und sich um Teams mit enttäuschenden Resultaten kümmerte; beides erledigte er mit derselben Konzentration, denselben hohen Maßstäben, die er bereits von Anfang an in die Firma eingebracht hatte. Nichts war für ihn selbstverständlich, schon gar nicht Amazons wachsender Erfolg.
Legendär waren seine ungehaltenen Ausbrüche gegenüber Angestellten, die seinen Standards nicht gerecht wurden. »Warum verschwenden Sie mein Leben?«, fragte er sarkastisch Untergebene, von denen er sich enttäuscht sah. Oder er vernichtete sie mit einem: »Sorry, hab ich heute meine Dämlich-Pillen geschluckt?« So enervierend der brutale Führungsstil und die markante Unternehmenskultur auch für viele seiner Leute sein mochten, sie erwiesen sich ganz eindeutig als effektiv. Im Frühjahr 2011 schätzte man Amazon auf 80 Milliarden Dollar. Der Wertzuwachs seines Aktienpakets hatte den 47-jährigen Bezos auf Platz 30 der weltweit reichsten Personen katapultiert; sein Vermögen betrug damals 18,1 Milliarden Dollar.4
Dieser überdimensionale Erfolg begann Aufmerksamkeit zu erregen. Die Behörden einiger US-Bundesstaaten merkten plötzlich, dass die wachsende Flut an steuerfreien Verkäufen über das Internet der Staatskasse beträchtliche Mittel entzog; entsprechend sorgten die einzelnen Gesetzgeber dafür, dass künftig auch Online-Händler Umsatzsteuer zu zahlen hatten; sie schlossen damit ein Schlupfloch, das man – noch vor dem Internet – für Versandhäuser geschaffen hatte. Bezos war durchaus bereit, für so einen erheblichen Preisvorteil gegenüber seinen Offline-Rivalen in die Schlacht zu ziehen; er unterstützte sogar eine kalifornische Wählerinitiative mit dem Ziel, dort ein neues Gesetz abzubügeln, das Online-Händler zum Aufschlag der Mehrwertsteuer zwingen sollte. Mitten im Schlachtgetümmel änderte er jedoch plötzlich die Richtung; die Vermeidung der Umsatzsteuer hatte dem Unternehmen durchaus Probleme beschert, weil man sich bei der Eröffnung neuer Zentren einschränken und selbst die Angestellten bei Geschäftsreisen aufpassen mussten, wo sie hindurften und wohin nicht. Indem er schließlich ebenfalls Mehrwertsteuer aufschlug, gab Bezos zwar seinen Preisvorteil auf, handelte aber wie immer auf lange Sicht: Amazon konnte damit Büros und Fulfillment Centers auch in den bevölkerungsreicheren Bundesstaaten einrichten, was ihn seinen Kunden weit näher brachte. Unter dem Strich legte er damit das Fundament für die größte Expansion der Wirtschaftsgeschichte.
Amazon breitete sich in jede nur erdenkliche Richtung aus, sowohl online als auch am Standort. Die Firma zog von einem über ganz Seattle verteilten Sammelsurium von Büros in einen noch in Entwicklung begriffenen Bürobezirk am südlichen Zipfel von Lake Union, wo der Amazon-Campus fast ein Dutzend Gebäude umfasst. Die anonymen Flyer, die Anfang 2012 in der Gegend von South Lake Union auftauchten, hatten einen abfälligen Namen für das wachsende Heer von Angestellten mit den markanten Namensschildern, das die Gegend mit Beschlag zu belegen begann: »Am-holes«.5 Es waren die ersten Vorboten einer wachsenden Spannung zwischen dem Unternehmen und der eher linken Blue-Collar-Bevölkerung seiner Heimatstadt.
Bei den Widrigkeiten, über die er triumphiert hatte, sah Jeff Bezos derlei negative Presse – wie etwa die alte »Amazon-bomb«-Titelgeschichte in Barron’s – gern an den Wänden seines Büros, damit er und seine Leute die Angst nicht verloren und entsprechend motiviert blieben. »Wir haben immer noch Tag eins!«, erinnerte er in jenem Frühjahr seine Angestellten und Investoren pflichtbewusst im Aktionärsbrief. Immerhin gab es, wollte man das nahezu endlose Sortiment an physischen und digitalen Produkten in den virtuellen Regalen des »Everything Store« (dt: Der Allesverkäufer) noch erweitern, noch weit mehr zu tun.
Ich habe im Oktober 2013 ein Buch mit diesem Titel herausgebracht, mitten in der wachsenden Welle weltweiter Faszination für Amazon. Es war der Erklärungsversuch einer klassischen modernen Unternehmensgeschichte – wie der Impresario des Online-Buchhandels sich des so gut wie sicheren Ruins erwehrte und dabei nicht nur den Einzelhandel, sondern auch die digitalen Medien und IT-Abteilungen von Unternehmen auf den Kopf stellte.
Das Buch wurde überwiegend positiv aufgenommen, auch wenn einige negative Rezensionen es zu trauriger Berühmtheit brachten. »Ich wollte das Buch mögen«, schrieb MacKenzie Bezos in ihrer bösen Ein-Stern-Bewertung des Buches auf Amazon.com. Sie unterstellte Sachfehler und ein »einseitiges und irreführendes Porträt der Menschen wie der Kultur bei Amazon«; außerdem kritisierte sie, dass ich die Jünger ihres Gatten, die nach seinen Maximen und seinem Führungsstil handelten, als »Jeff-Bots« bezeichnet hatte. Später erfuhr ich dann, dass Bezos sich an der Art und Weise störte, wie ich seinen leiblichen Vater aufgespürt hatte, den mittlerweile verstorbenen Ted Jorgensen. Er hatte seine Familie verlassen, als Bezos gerade mal laufen lernte, und gar nicht gewusst, was aus seinem Sohn geworden war, bis ich 42 Jahre später bei ihm vorbeikam.
Ich hatte damals gedacht, alles über Amazons Aufstieg gesagt zu haben, was es dazu zu sagen gab. Dann jedoch passierte etwas Merkwürdiges. 2014 brachte Amazon den ersten Echo heraus, einen sprachgesteuerten Lautsprecher zur Bedienung von Alexa, Amazons virtueller Assistentin. Das Produkt war ein Riesenerfolg und verkaufte sich in den nächsten fünf Jahren über 100 Millionen Mal, was nicht nur eine neue Welle sprachgesteuerter Informationstechnik lostrat, sondern auch Amazons Fehlschlag in Sachen Gadgets – mit dem Fire Phone – wieder wettmachte. Amazon zog damit von der Haustür direkt ins Wohnzimmer der Kundschaft ein und hatte Zugang zu einer breiten Palette von Wünschen und Fragen sowie potenziell auch zum intimsten Gespräch.
Um etwa dieselbe Zeit erweiterte Amazons AWS-Abteilung ihr Datenbankangebot, um auch Großunternehmen und Behörden in die ätherische Zukunft namens »Cloud« zu locken. Im Frühjahr 2015 gab man zum ersten Mal das Geschäftsergebnis für AWS bekannt, deren Profitabilität und Wachstum die Investoren derart überraschten, dass die Bekanntgabe eine weitere Runde fieberhafter Begeisterung für die Amazon-Aktie lostrat.
Einige Tage darauf eröffnete Amazon in Seattle mit Amazon Go den ersten Prototyp eines Ladengeschäfts, das sich auch tatsächlich betreten ließ. Mithilfe eines Bilderkennungssystems und künstlicher Intelligenz wurde das Konto der Kunden beim Verlassen des Geschäfts automatisch mit ihren Einkäufen belastet, ohne dass sie an einer Kasse anstehen mussten. Außerdem expandierte das Unternehmen geografisch, unter anderem nach Indien und Mexiko, was nicht nur ungeheure Summen verschlang, sondern auch zur direkten Konkurrenz mit Walmart führte, dem an Verkaufszahlen gemessen größten Konzern der Welt. Inzwischen hatten auch die Amazon Studios, seine Investition in Hollywood, erste kritische Erfolge wie Transparent, The Marvelous Mrs. Maisel und Jack Ryan verbucht, neben einigen ausgesprochenen Flops wie etwa Woody Allens Crisis in Six Scenes. Damit rangierte Amazon im Rennen um die Neudefinition des Heimunterhaltungsmarkts einer neuen Ära direkt hinter Netflix, der Nummer eins der Branche.
Darüber hinaus verpasste Amazon auch seinem Stammgeschäft eine Verjüngungskur. Amazon Marketplace, wo unabhängige Verkäufer ihre Waren über Amazon.com vertreiben können, explodierte geradezu unter einer Flut von Niedrigpreisprodukten aus China (darunter auch Fälschungen und Billigkopien). 2015 überholte der Gesamtwert der auf dem Marktplatz verkauften Produkte erstmals die Summe der von Amazon auf der eigenen Site verkauften Einheiten. 2017 erwarb Amazon dann auch noch die Bio-Kette Whole Foods Market, was dem legendären Lebensmittelhändler die unliebsame Übernahme durch aktivistische Investoren ersparte und Amazons bis dato eher erfolglosen Einstiegsversuchen ins Lebensmittelgeschäft Auftrieb gab.
Auch Amazons Auslieferungsaktivitäten bekamen ein Makeover: ein eigenes Netz von Sortierzentren, Fahrern und Frachtmaschinen mit dem Amazon-Prime-Logo machte das Unternehmen unabhängiger von Partnern wie UPS. Und schließlich hauchte man auch dem Werbegeschäft neues Leben ein, indem man Anzeigen in seine Suchergebnisse schaltete, ganz so, wie Google das ein Jahrzehnt früher zu Amazons großem Ärger vorgemacht hatte; auch das brachte dem Unternehmen profitable neue Umsätze ein.
Das Unternehmen, über das ich mein Buch geschrieben hatte, war Ende 2012 an die 120 Milliarden Dollar wert gewesen. Amazons Marktkapitalisierung berührte im Herbst 2018 zum ersten Mal die Billionengrenze und war damit in kaum sechs Jahren um das Achtfachte gestiegen; Anfang 2020 überschritt man diese Grenze schließlich, und das allem Anschein nach für immer. Mein Amazon hatte unter 150.000 Angestellte; Ende 2020 beschäftigte das Unternehmen erstaunliche 1,3 Millionen. Ich hatte noch über den Kindle-Konzern geschrieben; jetzt war es der Alexa-Konzern. Und der Cloud-Konzern. Und ein Hollywood-Studio. Und ein Produzent von Videospielen, ein Robotics-Hersteller, Inhaber einer Lebensmittelkette und so weiter und so fort.
Während Amazon Investoren und Kunden bezirzte, manövrierte sich das Unternehmen auch ins Zentrum eines erbitterten politischen Ringens, das durchaus das Zeug hatte, den Marktkapitalismus neu zu definieren. Nach Ansicht seiner vehementesten Kritiker hatte eine derart unverfrorene Anhäufung von Macht und Reichtum auch ihren Preis; sie verschlimmerte die Einkommensungleichheit und verschlechterte die Chancen von Arbeitern ebenso wie die von lokalen Einzelhändlern.
»Die großen Tech-Unternehmen von heute haben zu viel Macht – zu viel Macht über unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft und über unsere Demokratie«, schrieb die Senatorin Elizabeth Warren 2019 zu Beginn ihres erfolglosen Anlaufs auf das Präsidentenamt. »Amazon vernichtet kleine Firmen, indem es die Produkte kopiert, die diese auf dem Amazon Marketplace verkaufen, und dann eine eigene markengeschützte Version davon verkauft.« Sie drängte darauf, Jeff Bezos zur Aufteilung seines kunstvollen Unternehmensgebildes zu zwingen und Zappos und Whole Foods Market auszugliedern.6
Mit der Veränderung von Amazon ging auch mit Bezos selbst eine bestürzende Veränderung vor.
In den Anfangsjahren des Unternehmens trug er für gewöhnlich gebügelte Khakihosen und marineblaue Hemden mit Button-down-Kragen; wenn er mit dem Segway durchs Büro fuhr, hallte sein Lachen in den Fluren wider. Er lebte mit seiner Frau und den vier Kindern in dem Nobelvorort Medina, direkt am Lake Washington, und er achtete sorgsam auf die Privatsphäre der Familie. Trotz seines wachsenden Reichtums schien er wenig Interesse am Sammeln von Kostbarkeiten zu haben. Ihn interessierten weder gepflegte Oldtimer noch auf exklusiven Auktionen teuer ersteigerte Gemälde; niemand hätte ihm eine Begeisterung für Luxusjachten unterstellt. Nur sein Privatjet schien bei ihm offene Begeisterung auszulösen, da sich so eine Ressource sparen ließ, die er mit Geld nicht kaufen konnte, nämlich Zeit.
Gegen Ende der Zehnerjahre gehörte Bezos, der unmodische, zielbewusste Geek, größtenteils der Vergangenheit an. Selbst der halb reformierte Nerd vom Fire-Phone-Launch 2014, der so sichtlich Freude daran gehabt hatte, die technischen Spezifikationen seines unglückseligen Smartphones aufzuzählen, war nicht mehr da.
Nachdem er das Image des ungelenken, wenn auch selbstbewussten Geeks abgestreift hatte, tauchte Bezos als Wirtschaftskapitän auf, als große Nummer, den zunächst eine fast mystische Aura von Unbesiegbarkeit zu umgeben schien. Im Sommer 2017 wurde Bezos die reichste Person der Welt, eine mathematische Folge von Amazons steigendem Börsenwert und dem im Vergleich langsamer wachsenden Vermögen von Microsoft-Mitbegründer Bill Gates, der sein Geld in philanthropische Projekte steckte, ein Prozess, der bei Bezos noch nicht so recht ins Rollen gekommen war. Als Bezos an die Spitze der Reichenliste kletterte, ging ein bei der renommierten Sun-Valley-Konferenz von Allen & Company geschossenes Foto durch die Presse, auf dem er mit modischer Garrett-Leight-Klappsonnenbrille, kurzärmeligem Polohemd und Daunenweste zu sehen war, die den Blick auf ein Paar muskulöser Arme freigab. Das Foto ging schlagartig rund um die Welt. Jeff Bezos war mit einem Mal der Action-Hero der Wirtschaftswelt.
Zunächst hätten selbst Insider schwer sagen können, wie sehr Bezos sich tatsächlich verändert hatte. Kollegen meinten, er sei nach wie vor in die Einzelheiten von Amazons neuen Projekten – wie etwa Alexa – vertieft. Allerdings beanspruchte jetzt auch anderes seine Zeit, so etwa seine noch eher zaghaften philanthropischen Bemühungen, die aufs Neue erwachten Ambitionen hinsichtlich seiner Weltraumfirma Blue Origin und die Washington Post, jene renommierte Zeitung, die er 2013 gekauft hatte und die immer wieder zur Zielscheibe des ungestümen Präsidenten Donald J. Trump geworden war.
Jamie Dimon, CEO von JPMorgan und langjähriger Freund von Bezos, meinte: »Der Jeff, den ich kenne, ist immer noch derselbe alte Jeff.« Als Dimon jedoch mit Bezos in Foren wie dem Business Council zusammenarbeitete, einer Washingtoner Organisation, die sich mehrmals im Jahr zu politischen Diskussionen trifft, und bei Haven Healthcare, dem gescheiterten Gemeinschaftsprojekt von Amazon, JPMorgan und Berkshire Hathaway zur Senkung ihrer betrieblichen Gesundheitsaufwendungen, fiel ihm auf, dass sein Freund langsam den Blick zu öffnen schien: »Jeff war wie ein Kind im Süßwarenladen. Es war alles neu für ihn. Er hatte sich so lange auf Amazon konzentriert. Dann kam allmählich der Weltbürger durch.«
Für andere wies Bezos’ Metamorphose auf etwas ganz anderes hin, nämlich auf die Hybris, die mit einem so unvorstellbaren Erfolg einhergeht. Im Herbst 2017 wies er Amazon an, einen Wettbewerb auszurichten: unter dem Namen HQ2 sollten sich mehrere nordamerikanische Städte als Standort für ein zweites Amazon-Hauptquartier bewerben. Der beispiellose öffentliche Wettbewerb zwischen 238 Regionen, die sich schier überschlugen, um den Tech-Riesen anzuziehen, sorgte siebzehn Monate lang für ungeheuren Wirbel. New York City und Northern Virginia galten bereits als Sieger, nur war inzwischen die politische Stimmung umgeschlagen, und dem Unternehmen wehte ein scharfer Wind um die Ohren, nicht zuletzt der satten lokalen Steueranreize wegen, um die Amazon warb. Progressive Gesetzgeber in Queens wie etwa die beliebte Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez und ihre Verbündeten bei den Gewerkschaften sorgten für so viel Ärger, dass Amazon sein Angebot zur Eröffnung des Büros in Long Island City, New York, zurückzog.
Von da an nahm die Geschichte eine sogar noch merkwürdigere Wendung. Im Januar 2019 gab Bezos per Twitter zu jedermanns Überraschung die Scheidung von MacKenzie bekannt, der Frau, mit der er 27 Jahre verheiratet gewesen war; selbst Leute aus dem engsten Bekanntenkreis des Paars waren wie vor den Kopf geschlagen. Tags darauf brachte das berüchtigte Sensationsblatt National Enquirer eine elfseitige Story über Bezos’ Affäre mit der Fernsehberühmtheit Lauren Sánchez, komplett mit der einen oder anderen schlüpfrigen privaten SMS des Paars. Bezos verlangte eine Untersuchung, wie das Blatt an die Texte und die intimen Fotos der beiden gekommen war. Im Lauf des folgenden Jahres wuchs das geschmacklose Drama sich weiter aus, bis schließlich Vorwürfe weltweiter Spionage und Andeutungen auf eine Verschwörung dazukamen, in die angeblich Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman involviert war. Wie kommt einer der diszipliniertesten Männer der Welt nur in eine solche Situation?, fragte sich damals insgeheim so mancher Manager in Bezos’ eigenem Haus.
Amazons Gründer hatte plötzlich in den Augen der Öffentlichkeit viele Gesichter: Investor, zweifelsohne der kompetenteste CEO der Welt, Raumfahrtunternehmer, Zeitungsretter und lautstarker Verfechter einer freien Presse – aber auch ein bedrohlicher Monopolist, Feind kleiner Geschäftsleute, Ausbeuter von Lagerhausarbeitern und jetzt auch noch Objekt der Begierde einer lüsternen Boulevardpresse. Entsprechend breit war auch das Spektrum der Reaktionen auf seine Ankündigung im Februar 2021, dass er sich künftig bei Amazon mehr um neue Produkte und Projekte und um seine anderen Interessen kümmern und deshalb den Posten als CEO seinem langjährigen Stellvertreter Andy Jassy übergeben wolle; er selbst würde den geschäftsführenden Vorsitz im Vorstand übernehmen.
Trotz all dem Optimismus in Bezug auf Lösungen für das Klimaproblem, den er bei der Pressekonferenz zur Vorstellung seines Klimaversprechens an den Tag gelegt hatte, war dies eindeutig nicht mehr der alte Jeff. So entschloss ich mich denn, die vorliegende Fortsetzung zu schreiben, um herauszufinden, wie Amazon in so kurzer Zeit derart groß hatte werden können. Ich wollte einmal mehr die kritische Frage stellen, ob Amazon und Jeff Bezos der wirtschaftlichen Konkurrenz, der modernen Gesellschaft und letztlich auch unserem Planeten zuträglich sind.
Ich erledigte diese Aufgabe mit Unterstützung von Amazon, der Washington Post und Blue Origin, wo man mir zahlreiche Interviews mit dem Management ermöglichte. Trotz wiederholter Anfragen und persönlicher Bittgesuche entschied Amazon sich letztlich doch dagegen, mir Bezos selbst zur Verfügung zu stellen. Ich sprach jedoch mit Hunderten von gegenwärtigen und ehemaligen Mitarbeitern, Partnern, Konkurrenten und vielen anderen, die vom Wirbelsturm um Jeff Bezos und dessen zahlreiche Unternehmungen und persönliche Dramen mitgerissen wurden.
Das Resultat ist dieses Buch. Es ist die Geschichte eines dynamischen CEO, der für eine Unternehmenskultur sorgte, die fruchtbar genug war, um ungeachtet der eigenen Größe ihre Bürokratie um der Erfindung aufregender neuer Produkte willen infrage zu stellen. Das Buch erzählt darüber hinaus, wie ein führendes Tech-Unternehmen im Verlauf eines einzigen Jahrzehnts so allmächtig werden konnte, dass so mancher sich Sorgen zu machen begann, das sprichwörtliche Spielfeld könnte sich endgültig zu Ungunsten der Kleinen neigen. Und es zeigt außerdem auf, wie einer der größten Geschäftsmänner der Welt vom Weg abzukommen schien und ihn dann wiederzufinden versuchte – inmitten einer entsetzlichen weltweiten Pandemie, die sowohl seine Macht weiter vergrößerte als auch seinen Profit.
Dieses Buch beschäftigt sich mit einer Periode der Wirtschaftsgeschichte, in der für die Platzhirsche unter den Weltkonzernen die alten Gesetze nicht mehr zu gelten scheinen. Außerdem geht es der Frage nach, was genau denn da nun passierte, als ein Mann und sein ungeheures Imperium sich kurz vor der totalen Entfesselung sahen.
Teil I
Erfindung als A und O
31. Dezember 2010
Jahresnettoumsatz:
34,20 Milliarden $
Voll- und Teilzeitbeschäftigte:
33.700
Marktkapitalisierung zum Jahresende:
80,46 Milliarden $
Jeff Bezos’ Nettovermögen zum Jahresende:
15,86 Milliarden $
Jeff Bezos’ Whiteboard-Skizze eines sprachgesteuerten Lautsprechers, Ende 2010
Kapitel 1:
Der Über-Produktmanager
Das knappe Dutzend Gebäude, die Amazon 2010 in Seattles aufstrebendem Bezirk South Lake Union bezog, unterschied sich nicht groß von anderen Bauten ringsum. Von der Architektur her völlig nichtssagend, verwiesen darüber hinaus – auf ausdrücklichen Wunsch des CEO – weder Schilder noch Schriftzüge auf die Präsenz eines ikonischen Internetunternehmens mit fast 35 Milliarden Dollar Jahresumsatz. Eine derart ostentative Selbstdarstellung, so hatte Jeff Bezos den Kollegen gesagt, wäre allenfalls kontraproduktiv. Wer bereits geschäftlich mit dem Unternehmen zu tun hätte, wüsste ohnehin, wo es zu finden sei, und alle anderen – allen voran lästige Reporter, die einem der Executives aufzulauern versuchten – kamen so vielleicht nicht gleich darauf.
Während die rund um die Kreuzung Terry Avenue North und Harrison Street gruppierten Bürogebäude von außen weitgehend anonym waren, zeigte ihr Inneres ganz eindeutig die spezifischen Merkmale einer so einzigartigen wie eigenwilligen Unternehmenskultur. Die Beschäftigten trugen Namensschilder um den Hals, deren Farbe die Zahl der Dienstjahre im Unternehmen verriet (blau für unter fünf, gelb für zwischen fünf und zehn und rot für bis zu fünfzehn Jahre); Büros und Aufzüge schmückten Plakate mit Bezos’ vierzehn geheiligten Führungsprinzipien.
Bezos war hier allgegenwärtig. Schon die äußere Erscheinung des 46-Jährigen stand für Amazons einzigartige operative Ideologie. So gab sich der CEO zum Beispiel große Mühe, Amazons Führungsprinzip Nummer 10 – Sparsamkeit – zu illustrieren. Mehr mit weniger erreichen. Einschränkungen führen zu Einfallsreichtum, Selbstgenügsamkeit und Erfindungsgabe. Pluspunkte gibt es weder für zunehmende Budgets oder Fixkosten noch für mehr Personal. Meist fuhr ihn seine Gattin MacKenzie im Honda Minivan der beiden zur Arbeit, und wenn er mit Kollegen in seiner eigenen Dassault Falcon 900EX unterwegs war, wies er immer wieder mal darauf hin: Nicht etwa Amazon, sondern er selbst bezahle den Flug.
Wenn Bezos selbst sich eines seiner Führungsprinzipien besonders zu Herzen nahm, dann war es das Prinzip Nummer 8: »Think Big«: Klein zu denken ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wahre Führer schaffen und kommunizieren eine kühne Richtung, die zu Ergebnissen führt. Sie denken anders und blicken um Ecken auf der Suche nach Möglichkeiten, dem Kunden zu dienen. 2010 war Amazon ein erfolgreicher Online-Händler, ein kommender Cloud-Provider und ein E-Book-Pionier. Bezos’ Vision von seinem Unternehmen war jedoch weitaus größer. Sein Aktionärsbrief in diesem Jahr war ein Lobgesang auf zwei esoterische Computerdisziplinen, die Amazon eben erst zu erforschen begann: KünstlicheIntelligenz und Maschinenlernen. Er begann mit einer Liste unheimlich obskurer Begriffe wie »naiver Bayes’scher Schätzer«, »Klatschprotokolle« und »Daten-Sharding«. »Neues zu erfinden ist in unserer DNA verankert«, so schrieb Bezos, »und Technologie ist das fundamentale Werkzeug, mit dem wir jeden Aspekt des Erlebnisses, das wir unseren Kunden bieten, weiterentwickeln und verbessern.«
Bezos stellte sich diese technologischen Möglichkeiten nicht nur vor. Er gab sich darüber hinaus auch alle Mühe, Amazons nächste Produktgeneration an der denkbar fernsten Grenze des Machbaren zu positionieren. Er begann damals intensiver denn je mit den Ingenieuren im Lab126 zusammenzuarbeiten, Amazons F&E-Tochter im Silicon Valley, wo man mit dem Kindle auch das erste Gadget der Firma entwickelt hatte. In einer Reihe fieberhafter Brainstorming-Sessions stieß er mehrere Projekte zur Komplementierung des Kindle und der kommenden Kindle Fire-Tablets an, die firmenintern als Projekt A bekannt waren.
Projekt B, aus dem schließlich Amazons glückloses Fire Phone wurde, sollte mithilfe einer Gruppe nach vorn gerichteter Kameras und Infrarotlicht ein scheinbar dreidimensionales Bild auf das Display des Smartphones zaubern. Projekt C – »Shimmer« – sah aus wie eine Schreibtischlampe und sollte eine Art Hologramm entweder auf die Tischplatte oder an die Decke projizieren. Es ging jedoch seiner viel zu hohen Kosten wegen nie an den Start.
Bezos hatte eigene bis eigenartige Vorstellungen von der Interaktion der Kundschaft mit diesen Geräten. Die mit der dritten Version des Kindle befassten Ingenieure erfuhren das, als sie ihm das für den E-Book-Reader geplante Mikrofon auszureden versuchten, für dessen Benutzung Features noch nicht einmal angedacht waren. Der CEO jedoch blieb hart, das Mikrofon blieb. »Ich bekam damals die Antwort, dass wir Jeffs Ansicht nach in Zukunft mit unseren Geräten sprechen werden«, sagte Sam Bowen, der damals für die Hardware des Kindle verantwortlich war, »was sich für mich eher nach Star Trek anhörte als nach Realität.«
Die Designer konnten Bezos schließlich dazu bringen, das Mikrofon bei künftigen Versionen des Kindle wegzulassen, aber er hielt an seinem Glauben an die Unvermeidlichkeit des »Conversational Computing«, der sprachlichen Interaktion mit dem Computer, fest; die künstliche Intelligenz, davon war er überzeugt, würde dies ermöglichen. Es kam in all seinen SciFi-Favoriten vor, von Star Trek (»Computer, öffne Kanal!«) bis hin zu Autoren wie Arthur C. Clarke, Isaac Asimov und Robert A. Heinlein, deren Werke zu Hunderten in der Bibliothek seines Seegrundstücks in Medina stehen. Während andere diese Klassiker lasen und von alternativen Realitäten gerade mal träumten, schien Bezos die Bücher als Entwürfe für eine aufregende Zukunft zu sehen. Seinen Gipfelpunkt sollte dies in einem Produkt finden, welches das kommende Jahrzehnt bestimmen würde: einem zylindrischen Lautsprecher, der eine Welle von Nachahmern fand, unser Verständnis von Privatsphäre herausforderte und für ein neues Bild von Amazon sorgte, weil die Firma in den Augen der Öffentlichkeit fortan nicht mehr nur ein Riese im Internethandel war, sondern ein findiges Tech-Unternehmen, das die Grenzen der Informatik selbst verschob.
Die erste Anregung dazu kam aus dem Lab126 und firmierte unter dem Codenamen Projekt D. Letztendlich sollte es als Amazon Echo bekannt werden, vor allem aber unter dem Namen seiner virtuellen Assistentin Alexa.
Wie einige andere Amazon-Projekte auch lassen sich die Ursprünge von Projekt D auf Diskussionen zwischen Bezos und seinem »Technischen Berater« oder TB zurückführen, einem vielversprechenden Executive, der – von Bezos handverlesen – dem CEO praktisch auf Schritt und Tritt zu folgen hatte. Zu den Aufgaben des TB gehörte es unter anderem, sich bei Meetings Notizen zu machen, den ersten Entwurf des alljährlichen Aktionärsbriefs aufzusetzen und beim Meister über ein Jahr lang in eine von enger Interaktion geprägte Lehre zu gehen.
Von 2009 bis 2011 hatte diese Rolle der Amazon-Executive Greg Hart inne, ein Veteran aus der Anfangszeit, als Amazons Angebot noch auf Bücher, Musik, DVDs und Videospiele beschränkt war. In Seattle geboren, hatte Hart das Williams College in Western Massachusetts besucht, um dann nach einem kurzen Zwischenspiel in der Werbebranche – zur Zeit der Dämmerung der Grunge-Ära – mit Spitzbärtchen und einer Schwäche für Flanellhemden nach Hause zurückzukehren. Zu Bezos’ »Schatten« erkoren, war das Bärtchen verschwunden und Hart ein aufgehender Stern am Unternehmenshimmel. »Man kommt sich ein bisschen wie ein Assistenzcoach vor, der John Wooden zuguckt, wissen Sie, dem womöglich größten Basketball-Coach aller Zeiten«, sagte Hart über seine Zeit als TB.
Hart erinnerte sich daran, sich mit Bezos eines Tages Ende 2010 im Blue Moon Burgers in Seattle über Spracherkennung unterhalten zu haben. Beim Mittagessen hatte Hart seiner Begeisterung für die Google-Sprachsuchfunktion seines Android-Handys Luft gemacht. »Pizza in der Nähe«, sagte er und zeigte Bezos dann die Liste der Links zu nahe gelegenen Pizzerien auf dem Display. »Jeff war ein bisschen skeptisch gegenüber dem Einsatz von so was auf Handys, weil er dachte, das wäre im Beisein anderer vielleicht peinlich«, erinnerte sich Hart. Aber sie unterhielten sich darüber, dass die Technologie endlich gut genug für Diktat und Suche zu werden begann.
Was Bezos damals ebenfalls aufregend fand, war Amazons wachsendes Geschäft mit der Cloud. Ständig fragte er seine Executives: »Was tun Sie eigentlich zur Unterstützung der AWS?« Angeregt durch die Gespräche mit Hart und anderen über die Möglichkeiten von Computern mit Spracherkennung schickte er schließlich Hart sowie dem Vice President für Geräte Ian Freed und Senior Vice President Steve Kessel am 4. Januar 2011 eine E-Mail, in der er die beiden Themen miteinander verband: »Wir sollten ein intelligentes 20-Dollar-Gerät für die Cloud bauen, das ausschließlich von unserer Stimme gesteuert wird.« Es war zunächst nur eine weitere Idee vom Boss, der einen unerschöpflichen Vorrat von Einfällen zu haben schien.
Bezos und seine Leute spielten einige Tage per E-Mail mit der Idee, aber da man keine konkreten Schritte unternahm, hätte das Ganze durchaus wieder im Sande verlaufen können. Einige Wochen später dann traf Hart sich mit Bezos in einem Konferenzraum im 6. Stock von Amazons Hauptquartier Day One North, um über seine künftige Laufbahn zu sprechen. Seine Zeit als TB neigte sich ihrem Ende zu, also diskutierten sie einige Möglichkeiten, im Unternehmen neue Initiativen zu leiten, darunter die eine oder andere Position im Bereich Videostreaming oder Werbung. Bezos notierte sich ihre Ideen auf einem Whiteboard, fügte noch einige eigene hinzu und klopfte dann alle nach seinen üblichen Kriterien auf ihre Vorzüge ab: Wenn sie funktionieren, wird dann Big Business daraus? Würde man sich eine Gelegenheit vergeben, wenn das Unternehmen sie jetzt nicht mit Nachdruck verfolgte? Schließlich hatten Bezos und Hart alle Punkte der Liste bis auf einen gestrichen: Bezos’ Idee für einen sprachgesteuerten Cloud-Computer.
»Jeff, ich habe keine Erfahrung mit Hardware, und das größte Softwareteam, das ich je geleitet habe, hatte gerade mal vierzig Leute«, erinnerte Hart sich, gesagt zu haben.
»Du machst das schon«, sagte Bezos ihm.
Hart dankte ihm für das Vertrauen und gab nach: »Okay, schön, ich hoffe nur, du denkst daran, wenn wir mal Mist bauen.«
Bevor sie auseinandergingen, illustrierte Bezos noch seine Idee für einen displaylosen sprachgesteuerten Computer mit einer Skizze auf dem Whiteboard. Die erste bildliche Darstellung von Alexa zeigte die Lautsprecherbox, ein Mikrofon und eine Stummtaste. Außerdem identifizierte die Skizze noch die Herausforderung, das Gerät irgendwie ins WLAN einzubinden, schließlich wäre es von sich aus nicht in der Lage, auf gesprochene Kommandos zu hören. Hart schoss mit dem Smartphone ein Foto von der Skizze.
Bezos blieb dem Projekt aufs Engste verbunden, beriet sich jeden zweiten Tag mit dem Team, traf detaillierte Entscheidungen hinsichtlich des Produkts und genehmigte die Investition von Hunderten von Millionen Dollar in das Projekt, bevor der erste Echo auf den Markt kam. Seine Mitarbeiter bezeichneten ihn – nach dem deutschen Präfix – als Über-Produktmanager.
Die eigentliche Leitung des Teams jedoch hatte Greg Hart im Kindle-Gebäude – »Fiona« – gleich auf der Bezos’ Büro gegenüberliegenden Straßenseite. Im Verlauf der nächsten Monate heuerte Hart eine kleine Gruppe von Leuten aus dem Unternehmen, aber auch von außerhalb an; er schickte den Kandidaten E-Mails mit dem Motto »Join the mission« in der Betreffzeile. Beim Einstellungsgespräch selbst stellte er dann Fragen wie die folgende: »Wie würden Sie einen Kindle für Blinde bauen?« Von Geheimhaltung nicht weniger besessen als sein Boss, weigerte Hart sich, den Kandidaten Näheres über das Produkt zu sagen, an dem sie arbeiten sollten. Einer von ihnen erinnerte sich, die Vermutung geäußert zu haben, dass es sich um Amazons Smartphone handele, über das allenthalben Gerüchte im Umlauf waren, worauf Hart ihm geantwortet hätte: »An dem arbeitet ein anderes Team. Das hier ist was viel Interessanteres.«
Einer der ersten Ausgewählten war der hauseigene Ingenieur Al Lindsay, der an der ursprünglichen Software für die sprachgesteuerte Telefonauskunft von US West mitgearbeitet hatte. Lindsay verbrachte die ersten drei Wochen des Projekts in seiner Ferienhütte in Kanada, wo er in einem sechsseitigen Narrativ schilderte, wie externe Entwickler ihre eigenen sprachgesteuerten Apps für das Gerät schreiben könnten. Ein anderer Mitarbeiter aus den eigenen Reihen war der Amazon-Manager John Thimsen, der zum Leiter der technischen Entwicklung gemacht wurde und der Initiative den offiziellen Decknamen »Doppler« gab, nach Projekt D. »Also, wenn ich mal ehrlich sein will, ich glaube nicht, dass anfangs auch nur einer an den Erfolg geglaubt hat«, sagte mir Thimsen. »Aber auf halbem Weg waren wir dann dank Greg alle zu Gläubigen geworden.«
Die ursprüngliche Crew machte sich, der Ungeduld des Chefs Rechnung tragend, mit fieberhafter Dringlichkeit ans Werk. So unrealistisch das war, Bezos wollte mit seinem Gerät in sechs bis zwölf Monaten auf den Markt. Er hatte guten Grund für seine Eile. Am 4. Oktober 2011, das Doppler-Team hatte sich eben eingearbeitet, stellte Apple mit iPhone 4S eine virtuelle Assistentin vor: Siri. Es war das letzte Herzensprojekt des Apple-Mitgründers Steve Jobs, der tags darauf seinem Krebsleiden erlag. Dass Apple, damals wieder im Aufschwung, ebenfalls die Idee für einen sprachgesteuerten Assistenten gehabt hatte, gab Hart und seinen Leuten zwar recht, war aber gleichzeitig auch entmutigend, da Siri, wenn auch zunächst mit gemischten Bewertungen, die Erste auf dem Markt war. Das Team bei Amazon versuchte, sich Mut zuzusprechen, indem man sich sagte, dass man mit Doppler etwas Einzigartiges, weil vom Smartphone Unabhängiges schuf. Ein noch wichtigeres Unterscheidungsmerkmal freilich war, dass Siri künftig ohne Steve Jobs’ aktive Unterstützung würde auskommen müssen, während Alexa sich der von Bezos und einer nachgerade manischen Aufmerksamkeit im ganzen Unternehmen erfreute.
Zur Beschleunigung der Entwicklung und um den Zielen ihres CEO nachzukommen, begannen Hart und seine Crew sich nach Start-ups zum Aufkaufen umzusehen. Diese Aufgabe war alles andere als einfach. Der Bostoner Sprachgigant Nuance, dessen Technologie Apple für Siri in Lizenz gekauft hatte, war im Lauf der Jahre durch den Aufkauf der Top-Riege unter den amerikanischen Sprachsoftwareunternehmen gewachsen. Die Doppler-Executives versuchten in Erfahrung zu bringen, welche der verbliebenen Start-ups vielversprechend waren, indem sie potenzielle Kandidaten baten, ihnen den Titelkatalog des Kindle mit einer Sprachsteuerung zu versehen, um sich dann ihre Ergebnisse und Methoden anzusehen. Die Suche führte in den nächsten beiden Jahren in rasanter Folge zu einer Reihe von Akquisitionen, die letztlich für Alexas Gehirn und sogar für das Timbre ihrer Stimme verantwortlich waren.
Das erste Unternehmen, das Amazon kaufte, war Yap, ein Start-up mit einer Belegschaft von gerade mal zwanzig Leuten in Charlotte, North Carolina. Hier übersetzte man menschliche Sprache – wie etwa Voicemails – in Text, ohne auf ein geheim gehaltenes Heer menschlicher Transkriptoren in Niedriglohnländern angewiesen zu sein. Obwohl später so einiges von Yaps Technologie auf der Strecke blieb, sollten seine Ingenieure zur Entwicklung der Technologie beitragen, die alles, was die Kundschaft zu Doppler sagte, in ein maschinenlesbares Format übertrug. Während des langen Werbens um die Firma setzten Amazons Executives Yaps Geschäftsleitung arg zu mit ihrer Geheimhaltung dessen, worum es bei dem Projekt denn nun ging. Selbst als Al Lindsay eine Woche nach Abschluss des Deals mit Yaps Ingenieuren zu einer Fachtagung ins italienische Florenz reiste, bestand er darauf, dass sie so tun sollten, als würden sie ihn nicht kennen, damit niemand Amazons plötzliches Interesse an Sprachtechnologie mitbekam.
Nachdem der Kauf für rund 25 Millionen Dollar unter Dach und Fach gebracht war, entließ Amazon die Unternehmensgründer, behielt aber die sprechwissenschaftliche Gruppe in Cambridge, Massachusetts, und legte damit das Fundament zu einem neuen F&E-Ableger am Kendall Square, ganz in der Nähe des MIT. Die Ingenieure von Yap flogen schließlich nach Seattle und saßen dann im Erdgeschoss von Fiona in einem Konferenzraum mit zugezogenen Jalousien und verschlossenen Türen. Dort beschrieb ihnen Greg Hart »dieses kleine Gerät, etwa von der Größe einer Cola-Dose, das zu Hause auf dem Tisch stehen sollte und dem man in natürlicher Sprache Fragen stellen könnte, ein intelligenter Assistent sozusagen«, erinnerte sich der Vice President für Forschung von Yap, Jeff Adams, der auf zwanzig Jahre in der Spracherkennungsbranche zurückblicken kann. »Die Hälfte meines Teams verdrehte die Augen und meinte: ›Ach du meine Güte, worauf haben wir uns da eingelassen?‹«
Nach dem Meeting versuchte Adams Hart und Lindsay vorsichtig beizubringen, wie unrealistisch ihre Vorstellungen seien. Die meisten Fachleute waren sich darin einig, dass »Fernfeld-Spracherkennung«, das heißt, Sprache aus einer Entfernung von bis zu zehn Metern zu erkennen, womöglich auch noch bei Stimmengewirr und Hintergrundgeräuschen, die Möglichkeiten der etablierten Informatik weit überstieg. Töne würden von Oberflächen wie Wänden und Decken reflektiert, und die dabei entstehenden Echos würden einen Computer verwirren. Amazons Executives reagierten mit Bezos’ Entschlossenheit. »Im Grunde sagten die mir: ›Ist uns egal. Stellt mehr Leute ein. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Löst das Problem‹«, erinnerte sich Adams. »Die waren unerschütterlich.«
Einige Monate nach dem Ankauf von Yap erwarben Greg Hart und Kollegen ein weiteres Teil des Doppler-Puzzles. Technisch gesehen handelte es sich dabei um das Gegenstück zu Yap, wo man Sprache in Text übersetzte. Stattdessen beschäftigte sich das polnische Start-up Ivona mit computergenerierter Sprache, die der menschlichen Stimme zum Verwechseln ähnlich war.
Ivona war 2001 von Lukasz Osowski gegründet worden, einem Informatikstudenten der Technischen Hochschule Danzig. Osowskis Auffassung nach könnte eine sogenannte »Text-to-Speech«-Engine digitale Texte mit einer natürlichen Stimme vorlesen und so sehbehinderten Polen das geschriebene Wort nahebringen. Zusammen mit Michal Kaszczuk, einem etwas jüngeren Studienkollegen, zerlegte er Tonaufnahmen von Texten, die von Schauspielern eingesprochen worden waren, in – als Diphone bezeichnete – Wortfragmente, um sie dann in unterschiedlichen Kombinationen zu verketten (»konkatenieren«); heraus kamen dabei annähernd natürlich klingende Wörter und Sätze, die der Schauspieler nie von sich gegeben hatte.
Die Gründer von Ivona bekamen bald einen ersten Eindruck von der Macht ihrer Technologie. Noch als Studenten bezahlten sie den beliebten polnischen Schauspieler Jacek Labijak dafür, stundenlang Texte zu sprechen, die sie aufzeichneten, um eine Datenbank aus Lauten beziehungsweise ein Diphon-Inventar aufzubauen. Ergebnis ihrer Mühe war ein erstes Produkt, Spiker, das sich rasch zu Polens meistverkaufter Computerstimme mauserte. Im Lauf der nächsten Jahre setzte man sie in U-Bahnen, Aufzügen und für automatisierte Telefonkampagnen ein. Labijak hörte sich bald überall und erhielt sogar regelmäßig Anrufe mit seiner eigenen Stimme, in denen er sich zum Beispiel aufgefordert sah, bei anstehenden Wahlen einen bestimmten Kandidaten zu wählen. Spaßvögel manipulierten die Software, um ihm allerhand ungebührliches Zeug in den Mund zu legen, und stellten die Clips online, wo seine Kinder sie dann entdeckten. Ivonas Gründer mussten daraufhin den Vertrag mit dem Schauspieler neu verhandeln, nachdem er ihnen erbost die Rechte an seiner Stimme zu entziehen versuchte.7 (Noch heute ist »Jacek« eine der polnischen Stimmen im Angebot von Amazon Polly, einem Service von AWS, der gedruckte Texte in Audio konvertiert.)
Ab 2006 nahm Ivona an der jährlichen Blizzard Challenge teil, einem von der Carnegie Mellon University veranstalteten Wettbewerb für die natürlichste Computerstimme, den das Unternehmen wiederholt gewann. Bis 2012 brachte Ivona es auf zwanzig weitere Sprachen und hatte über vierzig Stimmen im Programm. Nachdem sie von dem Start-up erfahren hatten, machten Greg Hart und Al Lindsay auf ihrem Europatrip auf der Suche nach brauchbaren Firmen einen Abstecher nach Danzig. »Schon beim ersten Schritt in ihr Büro war uns klar, dass das ein Culture Fit war«, sagte Lindsay und verwies damit auf Ivonas Fortschritte auf einem Gebiet, in dem die Forschung sich gern mal von hehren Bestrebungen ablenken lässt. »Sie hatten genug Biss, um die Scheuklappen der Wissenschaft abzunehmen und über die akademische Welt hinauszublicken.«
Den Ankauf der Firma – für rund 30 Millionen Dollar – brachte man bereits 2012 unter Dach und Fach, hielt ihn aber ein ganzes Jahr lang geheim. Das Team von Ivona und die wachsende Zahl von Sprachingenieuren, die Amazon darüber hinaus noch für sein neues Danziger F&E-Zentrum einstellen sollte, waren allein mit der Entwicklung von Dopplers Stimme betraut. Die Leitung des Projekts übernahm Bezos persönlich und kümmerte sich darum bis ins letzte Detail. Was auch bedeutete, dass sich die Danziger seinen üblichen Eigenheiten und Schrullen ausgesetzt sahen.
Zuerst sagte Bezos, er wolle Dutzende eindeutig voneinander zu unterscheidende Stimmen aus dem Gerät hören, jede mit ihrer eigenen Bestimmung beziehungsweise Aufgabe. Als sich das als impraktikabel erwies, überlegte das Team, ob man nicht einer bestimmten Persönlichkeit eine Liste von Eigenschaften – wie etwa Vertrauenswürdigkeit, Empathie und Wärme – zueignen könnte, und kam dann zu dem Schluss, dass man derlei Züge im Allgemeinen mit einer Frauenstimme verband.
Zur Entwicklung einer solchen Stimme und um sicherzugehen, dass ihr auch nicht der Hauch eines regionalen Akzents anhaftete, arbeitete das polnische Team mit GM Voices, einem in Atlanta, Georgia, beheimateten Synchronstudio, das bereits dabei mitgewirkt hatte, die Stimme der Synchronsprecherin Susan Bennett in Apples Assistentin Siri zu verwandeln. Zur Entwicklung der synthetischen Persönlichkeiten gab GM Voices mehreren Synchronsprecherinnen Hunderte von Stunden Text zu lesen, von ganzen Büchern bis hin zu willkürlich ausgewählten Artikeln, eine stupide Prozedur, die sich über Monate hinziehen konnte.
Greg Hart und seine Kollegen verbrachten ihrerseits Monate damit, die von GM Voice besorgten Tonaufnahmen durchzugehen, und legten ihre Topkandidaten dann Bezos vor. Wiederum wählte man die Besten aus und bat um weitere Beispiele, bis es endlich zu einer Entscheidung kam, die Bezos unterschrieb.





























