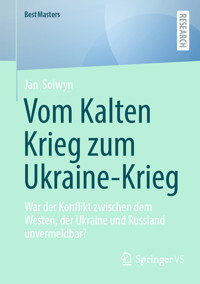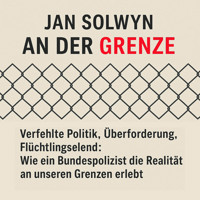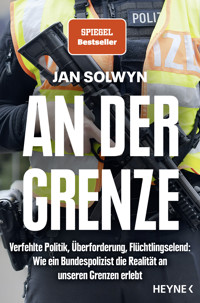
17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der schonungslos ehrliche Erfahrungsbericht aus 15 Jahren Dienst bei der Bundespolizei
Als Beamter der Bundespolizei riskierte er für die Sicherheit der Gesellschaft Gesundheit und Leben, sah sich mit unzähligen Straftätern und zu vielen unlösbaren moralischen Konflikten konfrontiert. Täglich setzte er sich mit den Menschen auseinander, die unerlaubt nach Deutschland einreisten. Kein wirklicher Schutz für Schutzbedürftige, kein funktionierender Umgang mit den illegal Eingereisten, verzerrte Berichterstattung in der Presse und die frappierende Diskrepanz zwischen politischem Anspruch und polizeilicher Realität: Die Folgen von Richtungslosigkeit und gravierenden Fehlern in der Migrations- und Integrationspolitik Deutschlands bestimmten seinen Alltag. Bis es zu viel wurde. Jan Solwyn quittierte nach 15 Jahren desillusioniert von der Politik den Dienst. Jetzt liefert er einen schonungslos ehrlichen Bericht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Als Beamter der Bundespolizei riskierte er für die Sicherheit der Gesellschaft Gesundheit und Leben, sah sich mit unzähligen Straftätern und zu vielen unlösbaren moralischen Konflikten konfrontiert. Täglich setzte er sich mit den Menschen auseinander, die unerlaubt nach Deutschland einreisten. Kein wirklicher Schutz für Schutzbedürftige, kein funktionierender Umgang mit den illegal Eingereisten, eine verzerrte öffentliche Wahrnehmung und die frappierende Diskrepanz zwischen politischem Anspruch und polizeilicher Realität: Die Folgen von Richtungslosigkeit und gravierenden Fehlern in der Migrations- und Integrationspolitik Deutschlands bestimmten seinen Alltag. Bis es zu viel wurde. Jan Solwyn quittierte nach 15 Jahren desillusioniert von der Politik den Dienst. Jetzt liefert er einen schonungslos ehrlichen Bericht.
»Was ich hier schildere, sind die ungefilterten Eindrücke und Erfahrungen, die ich in fast fünfzehn Jahren bei der Bundespolizei gewonnen und gemacht habe, sowie meine ganz persönlichen Schlüsse und Konsequenzen daraus. Die Realität, wie ich sie erlebte, widerspricht den praxisfernen und idealisierten Vorstellungen, die viele Menschen von der Migrations- und Integrationspolitik haben, auf teilweise absurde Weise. Es sind Geschichten voller Grenzerfahrungen und moralischer Dilemmata, die weder den Anspruch auf Objektivität noch auf die Erfüllung wissenschaftlicher Standards erheben.
Es sind einfach wahre Geschichten von Menschen und Ereignissen, die mich geprägt haben, und nur einzelne Fragmente aus eineinhalb Jahrzehnten im Dienst der Bundespolizei. Es sind Momentaufnahmen aus einer viel größeren Geschichte. Wenn ich mit diesem Buch dazu beitragen kann, dass wir uns endlich der Realität an der Grenze stellen, dann hat es seinen Zweck erfüllt.«
Jan Solwyn
JAN SOLWYN
AN DER GRENZE
Verfehlte Politik, Überforderung, Flüchtlingselend: Wie ein Bundespolizist die Realität an unseren Grenzen erlebt
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Originalausgabe 03/2025
Copyright © 2025 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Redaktion: Ulrike Strerath-Bolz
Umschlaggestaltung: wilhelm typo grafisch unter Verwendung eines Fotos von: © angelagarciaphoto
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-33390-4V001
www.heyne.de
Prolog
September 2015, Gleis 11 des Dortmunder Hauptbahnhofs, ca. 14 Uhr. Meine damalige Frau und ich hatten für einige Tage unsere Familien in unserer Heimatstadt in Westfalen besucht und uns dann auf den Rückweg nach Köln gemacht. In etwa 15 Metern Entfernung vernahm ich plötzlich eine laute Stimme: »Lass mich in Ruhe! Ich ruf’ die Polizei!«
Eine brünette Frau, ca. Mitte 30, versuchte, sich durch den Einsatz ihrer Stimme und entsprechender Gesten einen Mann vom Leib zu halten. Er war dunkelhäutig, ich vermutete, dass er aus Ostafrika stammte. Der Bahnsteig war nicht sonderlich voll, es herrschte kein Berufsverkehr. Einige Menschen standen in unmittelbarer Nähe des Geschehens; ein paar sahen zu, die meisten taten so, als würden sie die Auseinandersetzung nicht bemerken. Meine Frau spürte, dass die Szene meine Aufmerksamkeit auf sich zog, und legte ihre Hand auf meine Schulter.
»Können wir bitte einfach nach Hause fahren? Das ist nicht deine Angelegenheit.«
»Du hast ja recht«, seufzte ich, »und ehrlich gesagt, brauch ich nach den vergangenen Wochen auch echt mal ’ne Pause.«
Plötzlich wandte sich der Mann von der Frau ab, machte ein paar ungelenk wirkende Schritte auf einen Mann mittleren Alters zu, der die Szene aus nächster Nähe beobachtet hatte, und stellte sich Nase an Nase vor ihn. Offenbar wechselten sie ein paar Worte, aufgrund der Entfernung konnte ich jedoch nicht verstehen, was sie sagten. Der andere Mann streckte die Arme mit geöffneten Handflächen neben seinen Kopf, drehte sich kopfschüttelnd um und entfernte sich schnellen Schrittes. Während sich die meisten umstehenden Personen von der Szenerie zurückgezogen hatten, war ich instinktiv einige Meter in Richtung des Geschehens gerückt. Ich vernahm noch die Stimme meiner Frau: »Lass uns hier weggehen«, als der Delinquent offenbar bemerkt hatte, dass mein Blick ihn fixierte.
Er wandte sich nun mir zu, wobei ich bemerkte, dass er stark schwankte. Er stand offenbar unter erheblichem Alkoholeinfluss. Er war etwa 1,75 groß, sehr schlank, fast hager, ich schätzte ihn auf ca. 20 Jahre. Nach fast sechs Jahren im Polizeidienst und entsprechend häufigem Kontakt mit Asylbewerbern aus Afrika war ich imstande, Menschen mit einer ziemlich geringen Fehlerquote anhand ihres Aussehens geografisch zu verorten. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit handelte es sich um einen Somali oder einen Eritreer. Im Augenwinkel sah ich, wie die umstehenden Menschen nun alle gebannt in meine Richtung starrten.
Ich bin 1,85 groß und muss in der Rückschau ein wenig nostalgisch feststellen, dass ich im Sommer 2015 auf dem Höhepunkt meiner körperlichen Leistungsfähigkeit war, was man auch durch meine offen getragene schwarze Lederjacke erahnen konnte. Ich sah definitiv nicht aus wie jemand, mit dem man sich zum Spaß anlegen würde. Das war auch mir selbst bewusst, und irgendwie hoffte ich, dass mein Erscheinungsbild ihn davon abhalten würde, mit mir Streit zu suchen.
Demonstrativ blickte ich auf mein Handy und tippte darauf herum in der Hoffnung, dass er einfach weitergehen und mich in Ruhe lassen würde. Doch mein Plan ging nicht auf. Er blieb genau vor mir stehen, und eine schwere Alkoholfahne schlug mir entgegen.
»Was los?«, nuschelte er mir ins Gesicht.
Ich löste meinen Blick vom Handy und schaute ihn mit möglichst neutralem Gesichtsausdruck an.
»Nichts«, antwortete ich. »Haben wir ein Problem?«
»Was Problem?« Er machte eine Kopfbewegung in meine Richtung.
»Ob du ein Problem hast«, fragte ich nun mit deutlich lauterer Stimme.
»Was Problem?« Er kam mir zentimeterweise näher, sodass unsere Nasen sich fast berührten.
Ich rührte mich nicht von der Stelle und blickte ihm in seine geröteten Augen. Meine rechte Hand ließ mein Handy in die Hosentasche gleiten. Er war für meinen Geschmack eindeutig zu weit in meine persönliche Sphäre vorgedrungen, und ich schob ihn mit der linken Hand von mir weg. Er versuchte im Gegenzug, meinen Arm zu greifen, woraufhin ich ihm einen ordentlichen Impuls mit der offenen rechten Hand vor die Brust gab. Ein nicht alkoholisierter Mensch seiner Gewichtsklasse wäre vermutlich einen halben Meter zurückgestoßen worden, aufgrund seines Zustandes fiel er jedoch ziemlich ungeschickt rückwärts zu Boden. Ich sah im Hintergrund unser gesamtes »Publikum« an Bahnreisenden mittlerweile in gebührendem Sicherheitsabstand versammelt. Na klasse, genau das, was ich vermeiden wollte …, dachte ich.
Zwei Handlungsoptionen schossen mir durch den Kopf. Erste Möglichkeit: Ich gebe mich als Polizeibeamter zu erkennen und nehme ihn vorläufig fest. Unsere Bahnfahrt nach Köln wäre damit mindestens für die kommende Stunde gestorben. Zweite Möglichkeit: Ich hoffte, dass der Sturz ihn dazu bewog, wenigstens hier und heute keinen Streit mehr zu suchen. Ich würde mich mit meiner Frau, die die Szene konsterniert aus nächster Nähe beobachtete, schnell zum anderen Ende des Bahnsteigs begeben und hoffen, dass der RE1 pünktlich käme.
Ich entschied mich für Letzteres.
Ein nicht unwesentliches Argument dafür war meine Schulterverletzung. Etwa eine Woche zuvor hatte ich mir eine Tossy-Verletzung im rechten Schultereckgelenk zugezogen, und zudem kämpfte ich mit einer entzündeten Bizepssehne im selben Arm. Meine Schulter schmerzte schon im Ruhezustand, und mein gesamter Arm war in seiner Beweglichkeit eingeschränkt. Schon allein deshalb konnte ich mir eine Festnahme mit Widerstand nicht leisten. Gerade betrunkene und unter Drogeneinfluss stehende Menschen haben zwar meistens eine eingeschränkte Koordination und Reaktion und sind somit leicht zu Boden zu bringen, dafür haben sie aber ein erheblich eingeschränktes Schmerzempfinden und dazu eine erstaunliche rohe Körperkraft.
Der Mann hatte sich mittlerweile wieder aufgerappelt. Ich vermittelte ihm mit Stimme und Gesten, dass er ruhig bleiben solle, und nahm die Hand meiner Frau, um schnell zum anderen Ende des Bahnsteigs zu gehen. Als wir uns gerade in Bewegung setzen wollten, tat er einen Sprung auf mich zu und versuchte, mich mit seinem Kopf auf Brust- oder Bauchhöhe zu treffen. Ich ließ die Hand meiner Frau los und umfasste mit meinem linken Arm seinen Hals, während er versuchte, mich mit ungezielten Faustschlägen zu treffen. Dann riss ich ihn mit beiden Händen mit mir zu Boden, wobei wir unsanft aufschlugen und uns ineinander verkeilten. Gegen seinen erheblichen Widerstand schaffte ich es, ihn auf dem Bauch liegend zu fixieren, zog meinen Dienstausweis aus der Hosentasche, hielt ihn ihm vor die Nase und schrie ihn an: »Polizei! Police!«
Er schrie unbeeindruckt zurück: »Was Problem? Fuck you! Scheiße Polizei!«
Ich richtete ihn im Transportgriff auf und ging so schnell ich konnte mit ihm Richtung Abgang zum Bahnhofstunnel. Dabei kamen wir an einem ca. 45-jährigen Mann vorbei, der lautstark die umstehenden Passanten anschrie: »Hier wird ein Ausländer angegriffen und ihr steht hier nur rum! Rassismus! Warum hilft ihm denn keiner?«
Als hätte ich es nicht geahnt, dass genau so etwas passieren würde! Ich war heilfroh, als ich endlich vom Gleis in den Bahnhofstunnel abtauchte und mir zwei Mitarbeiter der DB-Sicherheit entgegenkamen, denen ich zurief, dass ich Polizeibeamter bin. Sie legten dem Delinquenten Handfesseln an und halfen mir, ihn zur Wache am Haupteingang zu verbringen. Meine Frau kam in einigem Abstand mit unseren Koffern hinterher.
Auf der Wache angekommen, konnte er identifiziert werden. Ich hatte mich nicht getäuscht, es handelte sich um einen nach eigenen Angaben 18-jährigen Eritreer, der im Herbst 2013 mit einem gefälschten französischen Reisepass ins Bundesgebiet eingereist war und im November 2013 einen Asylantrag gestellt hatte. Gemeldet war er in einer Unterkunft für Asylbewerber in Gevelsberg (ca. 35 Kilometer südlich von Dortmund). Seit seiner Einreise war er bereits mehrfach wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten straffällig geworden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,16 Promille. Weiterhin fragten die Kollegen mich sofort, ob ich gekratzt, gebissen oder angespuckt worden sei, da er laut Personaldaten an ansteckenden Krankheiten leide. Glücklicherweise konnte ich das nach einer kurzen Überprüfung meiner Haut an exponierten Stellen verneinen.
Während ich mit dem diensthabenden Gruppenleiter die Formalitäten besprach, hörte ich, wie es in der Gewahrsamszelle nebenan mehrfach zu heftigen körperlichen Auseinandersetzungen zwischen dem Eritreer und den Kollegen kam. Im Bericht konnte ich später lesen, dass er versucht hatte, die Zellentür einzutreten und die herbeieilenden Beamten körperlich anzugreifen. Bereits zu diesem Zeitpunkt, während mein Adrenalinpegel langsam wieder auf Normalniveau sank, merkte ich, dass meine rechte Schulter höllisch zu schmerzen begann. Mir war klar, dass sich die bestehende Verletzung bei der Festnahme verschlimmert hatte.
Mein erster Gedanke, als ich endlich in den Zug nach Köln einstieg, war bezeichnenderweise, dass ich mir große Sorgen machte, ob jemand den Vorfall mit seinem Handy gefilmt hatte. In dem Fall wäre die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass ich der ungewollte Protagonist des Videos »Deutscher in Lederjacke verprügelt afrikanischen Flüchtling am Bahnhof« auf YouTube und Facebook werden würde. Bei dem Gedanken wurde mir schlecht. Zu meinem Glück ist der Fall nie einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden.
Ich habe den Delinquenten seit diesem Tag nie wiedergesehen, weiß jedoch durch das polizeiliche Fahndungssystem INPOL, dass er in den folgenden Jahren regelmäßig in mehreren Deliktsfeldern – u. a. Körperverletzungen unterschiedlichster Art, Betrug, Erschleichen von Leistungen, Diebstahl und Beleidigung – in Erscheinung getreten ist. Er saß regelmäßig kurze Haftstrafen ab. Trotzdem wurde sein Asylantrag im Winter 2016 positiv beschieden.
Am nächsten Tag suchte ich den Polizeiarzt auf, der mich erneut zum CT schickte. Meine Vermutung bestätigte sich: Meine bereits verletzte rechte Schulter war bei dem Vorfall noch weiter in Mitleidenschaft gezogen worden. In der Folge blieb ich über zwei Monate dienstunfähig, bekam regelmäßig Kortisonspritzen und musste zur Physiotherapie. Doch gravierender war, dass meine bevorstehende Verbeamtung auf Lebenszeit dadurch auf dem Spiel stand. Es war nämlich nicht mehr sicher, ob ich die nötige amtsärztliche Untersuchung bestehen würde.
Etwa drei Wochen nach dem Vorfall bekam ich Post von der Staatsanwaltschaft Dortmund. Ich setzte mich auf die Couch und öffnete den Umschlag im Beisein meiner Frau. Das Strafverfahren gegen Tesfamichael A. wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung werde nach § 153 StPO wegen Geringfügigkeit eingestellt.
Ungläubigkeit, Resignation und Wut machten sich in mir breit. Ich ließ den Brief auf den Tisch fallen. »Weißt du was«, sagte ich zu meiner Frau, »eines Tages, eines fernen Tages werde ich ein Buch über all das hier schreiben.«
Heute, neun Jahre später, bin ich kein Polizeibeamter mehr und lebe mit meiner neuen Partnerin in Israel. Ich bin nun selbst Migrant in einem Land mit einem der selektivsten Einwanderungssysteme der Welt. Was ich damals in einer Trotzreaktion auf die zunehmenden Unzulänglichkeiten des deutschen Rechtsstaats und eine beginnende Entfremdung angekündigt habe, ist entgegen aller Widerstände Wirklichkeit geworden: Sie halten dieses Buch in Ihren Händen.
Zu dem Ereignis vom September 2015 gibt es eine jahrelange Vorgeschichte, die ich mit Ihnen teilen möchte. Ich hatte zuvor bereits diverse denkwürdige Situationen ähnlicher Art sowohl im Dienst als auch in meinem Privatleben erlebt. Die Einstellung des Verfahrens gegen den Mann auf dem Bahnhof war in diesem Moment einfach der sprichwörtliche Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Dabei konnte ich damals noch nicht ahnen, was in den darauffolgenden Jahren auf mich zukommen würde. Ich wusste nicht, dass wir am Beginn einer Reihe von Ereignissen standen, die später als »Flüchtlingskrise« in die Geschichtsbücher eingehen sollten. Ich wusste nicht, dass ich genau ein Jahr später in meinen ersten Auslandseinsatz aufbrechen und mit eigenen Augen sehen würde, wo, wie und warum diese Krise entstanden war. Ich wusste nicht, dass ich mehr als acht Jahre später, nach einem fast zweijährigen Auslandseinsatz im Nahen Osten, die Entscheidung fällen würde, meinen Dienst bei der Bundespolizei zu quittieren und in Israel zu bleiben.
Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich für dieses Buch höchstwahrscheinlich viel Zuspruch und Applaus von Menschen bekommen werde, deren politische und gesellschaftliche Ansichten ich in keiner Weise teile. Von Menschen, Organisationen und Parteien mit rechtsradikalem, nationalistischem oder rassistischem Gedankengut distanziere ich mich ausdrücklich und weise jede Vereinnahmung aus diesem Spektrum entschieden von mir.
Ich bin mir genauso bewusst, dass ich für mein Buch viel Kritik und Vorwürfe von Menschen werde hinnehmen müssen, deren politische und gesellschaftliche Ansichten ich ebenso wenig teile. Von Menschen, Organisationen und Parteien, die die Polizei grundsätzlich als Teil eines Repressionsapparates diffamieren oder ihr einen strukturellen Rassismus unterstellen, kann ich weder Zustimmung noch Verständnis erwarten.
Ich weiß, dass ich mich in ein Spannungsfeld begebe, das leider zunehmend von Extremen dominiert wird. Ich habe dieses Buch weder geschrieben, um festgefahrene Weltbilder zu bestätigen oder mich jemandem politisch anzubiedern, noch habe ich dieses Buch geschrieben, um einer bedenklichen politischen Korrektheit gerecht zu werden. Es ist kein Aufruf zu ideologischen Grabenkämpfen, sondern ein Plädoyer für die notwendige Konfrontation mit der Realität mit all ihren Konsequenzen.
Wenn dieses Werk den Anhängern des äußeren rechten Spektrums zu links und den Anhängern des äußeren linken Spektrums zu rechts erscheint, dann ist es genau dort, wo es hingehört.
Was ich hier schildere, sind die ungefilterten Eindrücke und Erfahrungen, die ich in fast 15 Jahren bei der Bundespolizei gewonnen und gemacht habe, sowie meine ganz persönlichen Schlüsse und Konsequenzen daraus. Die Realität, wie ich sie erlebte, widerspricht den praxisfernen und idealisierten Vorstellungen, die viele Menschen von der Migrations- und Integrationspolitik haben, auf teilweise absurde Weise. Es sind Geschichten voller Grenzerfahrungen und moralischer Dilemmata, die weder den Anspruch auf Objektivität noch auf die Erfüllung wissenschaftlicher Standards erheben.
Es sind einfach nur wahre Geschichten von Menschen und Ereignissen, die mich geprägt haben.
1
Im Januar 2011, ich hatte bereits 15 Monate Basisausbildung und theoretische Unterweisungen im Aus- und Fortbildungszentrum und an der Bundespolizeiakademie hinter mir, stand der erste praktische Abschnitt auf einer Dienststelle der Bundespolizei an. Da die erste Verwendung nach Möglichkeit heimatnah erfolgen sollte, kam ich zur Bundespolizeiinspektion Dortmund.
Das erste Mal uniformiert und bewaffnet in der »echten Welt« außerhalb der Hörsäle aufzutreten und als Polizeibeamter wahrgenommen zu werden, versetzte mich in eine gefühlsmäßige Ausnahmesituation, die schwer zu beschreiben ist. Auf meinen Schultern lastete eine mir bisher unbekannte Verantwortung für mich und andere.
Da ich in Westfalen geboren und aufgewachsen war, hatte ich in meiner Erstverwendung in Dortmund einen gewissen Heimvorteil: Ich kannte den Dortmunder Hauptbahnhof seit meiner Kindheit. Die allgemeine Lage im Zuständigkeitsbereich der Inspektion war mir größtenteils aus meiner Jugend bekannt. Der Hauptbahnhof trennte die Innenstadt vom Bezirk Nordstadt, dem größten sozialen Brennpunkt Dortmunds. Die dort grassierende Kriminalität sickerte seit jeher durch die räumliche Nähe in all ihren Facetten (Eigentumsdelikte, Körperverletzungen, Betäubungsmittel) auch ins Umfeld des Hauptbahnhofs ein.
Das war insofern irgendwie auch eine Ironie des Schicksals, da ich selbst eine recht bewegte Jugend gehabt und mich noch wenige Jahre zuvor gemeinsam mit allerlei zweifelhaften Gestalten in der Nordstadt herumgetrieben hatte. Manchmal glaube ich, dass meine Entscheidung, zur Bundespolizei zu gehen, maßgeblich davon beeinflusst wurde. Es war für mich eine persönliche Katharsis.
Januar 2011, Dortmund Hauptbahnhof, Frühdienst, ca. 11:30 Uhr. Die Leitstelle der Bundespolizei wurde über ein verdächtiges Gepäckstück in einem Regionalzug informiert, der abfahrbereit im Hauptbahnhof stand. Über Funk kam das Stichwort »NZG« an unsere Streife, und wir begaben uns zum Gleis.
Vermeintlich herrenlose Koffer, Taschen, Rucksäcke und sonstige Behältnisse werden in der Regel in drei Kategorien eingeteilt. Ein NZG (nicht zuzuordnender Gegenstand) beschreibt dabei jedes herrenlose Behältnis, das sich an einem neuralgischen Punkt befindet und die Klärung der Besitz- und Eigentumsverhältnisse und ggf. Klärung des Inhaltes erfordert und von dem noch kein direktes Bedrohungs- bzw. Gefährdungspotenzial ausgeht. Die zweite Stufe ist der »USBV-Verdacht«, was für »Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung« steht. In diesem Fall begründet die Gesamtsituation den Verdacht, dass von dem entsprechenden Behältnis eine Gefahr für Leib und Leben ausgehen kann, was die sofortige Einleitung polizeilicher Maßnahmen erfordert. Der Begriff USBV der Polizei entspricht der englisch-militärischen Bezeichnung »IED«. Die dritte Stufe ist die gesicherte Erkenntnis, dass es sich bei dem Objekt um eine USBV handelt; sie wird in der Regel durch Entschärfer festgestellt.
Frisch von der Akademie, ging ich den Maßnahmenkatalog für NZG-Lagen in meinem Kopf durch und meinem Streifenführer entsprechend auf die Nerven, während wir zum Gleis hoch eilten. »Räumen wir jetzt den ganzen Zug oder nur den einen Waggon? Müssen wir zusätzliche Kräfte anfordern?«
Mein lebensälterer Kollege raunte mir in feinstem Ruhrpottdeutsch zu: »Ruhig Blut, Jung, ersma’ gucken, wat da Phase is’.« Am Gleis wartete bereits ein Zugbegleiter auf uns, der uns in den Waggon geleitete und auf eine schwarze, verschlossene Sporttasche deutete, die auf der Sitzfläche eines Vierersitzes lag. »Dat is dat Dingen. Hab’ keinen gesehen, dems gehört, die anderen Fahrgäste wissen auch nix. Steht da wohl schon ’ne Weile.«
Ich meldete der Leitstelle, dass wir im Zug waren, und wedelte mit dem Funkgerät in Richtung meines Kollegen. »Sollen wir räumen und absperren?« Er sah mich ein wenig belustigt an, wie er vermutlich jedes Jahr aufs Neue übermotivierte Jungkollegen ansah. »Dat is nix, Jung, da müssen wa jetz’ kein Fass für aufmachen. Wenn wa jetz’ dat große Besteck rausholen, wird dat nix mit’m Feierabend heute Mittach.« Ich zuckte kurz zusammen, als er die Tasche mit dem Stiefel anstupste. »Siehste? Allet töfte.« Er sah meinen irritierten Blick. »Ich weiß auch, dat die euch dat oben in der Kaderschmiede anders beibringen, aber dat is nich’ immer die Realität.« Er öffnete die Tasche, in der sich Laufschuhe und Sportkleidung befanden. »Nehmen wa mit zum Fundbüro dat Dingen, euch ’ne gute Fahrt.« Der Zugbegleiter bedankte sich bei uns, und der Zug fuhr mit geringer Verspätung ab.
In den folgenden Jahren erlebte ich Dutzende Male, dass eine NZG-Lage auf diese oder ähnliche Weise »gelöst« wurde. Und jedes Mal hätte ich den Kollegen dafür den Hals umdrehen können. Viereinhalb Jahre zuvor, am 31. Juli 2006, hatten zwei Libanesen Kofferbomben im Kölner Hauptbahnhof in zwei Regionalzügen platziert, die nur dank fehlerhafter Zündvorrichtungen nicht detoniert waren. Eine der beiden USBV war im RE1 im Dortmunder Hauptbahnhof festgestellt worden. Ein Jahr davor, im Juli 2005, waren bei einem Bombenanschlag einer islamistischen Gruppierung auf die Londoner Metro mehr als 50 Menschen getötet und mehr als 700 verletzt worden. Und noch einmal ein Jahr davor, im März 2004, waren bei einem Bombenanschlag einer nordafrikanischen Al-Qaida-Zelle auf Züge in Madrid fast 200 Menschen getötet und mehr als 2000 verletzt worden.
Insbesondere diese erste Begegnung mit einem NZG in Dortmund ist mir mit einem mulmigen Gefühl im Gedächtnis geblieben. Ich erinnerte mich jedes Mal im Dienst daran, und so geht es mir bis heute. In diesem Moment wurde mir schlagartig bewusst, dass Bombenanschläge mit Toten und Verletzten von nun an ein mögliches Szenario in meinem Leben sein würden. Mein Blick auf vermeintlich herrenlose Gepäckstücke veränderte sich in den folgenden Jahren – bis heute.
Zwei Monate nach meiner ersten Erfahrung mit einem NZG in Deutschland wurden in meiner heutigen Heimat Israel bei einem Bombenanschlag mit einer USBV in einem Reisekoffer an einer Bushaltestelle durch palästinensische Terroristen zwei Menschen getötet und 40 weitere verletzt.
Januar 2011, Dortmund Hauptbahnhof, Nachtdienst, ca. 22:30 Uhr. Wir befanden uns auf Streife im Bahnhofstunnel, als zwei uns aus Richtung Nordausgang entgegenkommende Männer die Aufmerksamkeit meiner beiden Kollegen erregten. Der eine tippte mir auf die Schulter. »Die beiden kontrollieren wa ma’. Hey, KiKo in Ausbildung, lass dir ma’ die Ausweise zeigen!«
Die ironische bis leicht abwertende Bezeichnung als zukünftiger »Kinderkommissar« ignorierte ich und fokussierte die beiden zu kontrollierenden Personen. Menschen, die oft mit der Polizei zu tun haben, merken sofort, wenn sie die Aufmerksamkeit einer Streife auf sich ziehen. Unsere Blicke trafen sich. Sie blieben stehen, begannen in ihrer Muttersprache miteinander zu sprechen, blickten uns zwischendurch an und kicherten. Als wir sie fast erreicht hatten, holten beide eine grünlich-violette Papierkarte aus der Jackentasche, die mich fortan für den Rest meiner Karriere bei der Bundespolizei begleiten sollte. »Guten Abend, die Bundespolizei. Haben Sie Reiseabsichten?«, gab ich die in Lübeck gelernte Standardformel für den Erstkontakt mit zu kontrollierenden Personen an Bahnhöfen und Flughäfen in etwas unsicherem Ton wieder.
Die beiden Männer waren Mitte bis Ende 20, leicht dunklerer Hautton, schwarze Haare, Dreitagebart. Beide trugen trotz der eiskalten Nacht offene Lederjacke.
Sie grinsten mich beide provozierend an. Der eine schnalzte die Zunge. »Nix gut deutsch so.«
»Wollen Sie mit dem Zug fahren? Was machen Sie hier?«
»Ah mach’ so dies das, weißt du.«
»Verstehe. Haben Sie Ausweise für mich?«
»Sicher, Bruder.«
Beide reichten mir ihre Papierkarten. Auf der Vorderseite stand Aussetzung der Abschiebung (Duldung) – Kein Aufenthaltstitel! Der Inhaber ist ausreisepflichtig! Im Grundkurs Ausländerrecht in Lübeck hatten wir bis zu diesem Zeitpunkt schwerpunktmäßig Einreisevoraussetzungen und Straftaten nach dem Aufenthaltsgesetz gelernt. Klar hatte ich von einer Duldung gehört, wusste sie aber in diesem Moment nicht rechtssicher einzuordnen. Ich blickte ein wenig verloren zu meinen Kollegen neben mir, während die beiden Kontrollpersonen sich etwas in ihrer Sprache zuraunten und glucksten.
Sie wurden schroff und lautstark von meinem Kollegen unterbrochen. »Hände aus den Taschen und Schnauze halten, solange der Kollege eure Ausweise kontrolliert!«
Auf die bestimmte Ansprache hin verstummten beide. Er fixierte beide mit festem Blick, während der andere Kollege und ich uns zwei Meter fortbewegten. Ich musterte die Papiere genau.
»Ich glaub, die sind gefälscht …« murmelte ich.
Mein Kollege schien ein wenig belustigt und grinste zurück. »So? Wie kommst’n darauf?«
»Na ja, die sind beide am 1.1. geboren. Das kann ja nicht sein.« Ich tippte auf das Geburtsdatum, das auf der Seite mit persönlichen Merkmalen wie Augenfarbe, Körpergröße etc. stand. Geburtsort: Grosny; Staatsangehörigkeit: Russisch.Die Personalangaben beruhen auf den eigenen Angaben der Inhaberin/des Inhabers. »Außerdem sind die beiden doch nie im Leben jünger als ich, schau dir mal das Geburtsjahr an. Da stimmt doch nix.« Die eingeklebten Fotos aber stimmten zweifelsfrei mit den beiden Personen überein.
Der Kollege zuckte mit den Schultern. »Wat soll ich sagen … So is’ dat halt. Wenne da jetzt keine offensichtlichen Fälschungsmerkmale siehs’, und ich seh’ da keine, dann musse dat so nehmen, wie’s da steht.« Er sah mich ein bisschen mitleidig an. »Ich mein’, die beiden sind abgelehnte Asylbewerber, die dürften eigentlich gar nich’ hier sein. Willkommen in Deutschland.«
Ein wenig irritiert fuhr ich im Protokoll fort. »Ich frag die dann jetzt ab, ja?«
Er nickte.
Die Leitstelle überprüfte die Personen anhand der Daten. »Beide Personen hinreichend bekannt: Unerlaubte Einreise vor ca. anderthalb Jahren, bekannt wegen KV, BTMK, TD.[1] Keine aktuelle Fahndung«, kam es über Funk.
»Verstanden«, erwiderte ich.
Mein Kollege tippte auf den Text unter Nebenbestimmungen. »Aber guck ma’ hier.« Laut Fließtext war der Aufenthalt auf einen anderen Kreis in NRW beschränkt. »Dat is’n Verstoß. Räumliche Beschränkung für beide.«
»Ist das ’ne Straftat?«
»Beim ersten Mal isset ’ne Owi und ab dem zweiten Mal ’ne Straftat.«
Wir durchsuchten beide Personen vor Ort ergebnislos nach verbotenen oder gefährlichen Gegenständen und beendeten die Kontrolle. Da dies für beide Personen der erste Verstoß gegen ihre räumliche Beschränkung war, nahmen wir die Personalien zwecks Fertigung einer Ordnungswidrigkeitenanzeige auf.
Auf dem Weg zur Wache fragte ich meine Kollegen bezüglich der seltsamen Geburtsdaten. Sie erklärten mir, dass es für Asylbewerber (oder wie sie es nannten, »Asyltouristen«) eigentlich nur eine sichere Methode gab, dauerhaft in Deutschland zu bleiben. Und das war, ohne Identitätspapiere einzureisen. Alle Angaben, die fortan gegenüber dem BAMF und allen anderen Behörden gemacht wurden, konnten frei erfunden werden. Insbesondere beim Alter wurde teilweise so sehr gelogen, dass es fast schon lächerlich war. So waren dann auch die »14-Jährigen mit Vollbart« zu erklären, die mein Kollege, sicher mit einer gewissen Übertreibung, kopfschüttelnd erwähnte. Seitens der deutschen Behörden wird, beruhend auf den Angaben der Person, das Alter geschätzt, wobei laut ständiger Rechtsprechung »im Zweifel von einer Minderjährigkeit auszugehen ist«. Als fiktives Geburtsdatum wird dann der 1. Januar festgelegt. Die Vorteile für den Betroffenen liegen auf der Hand: Die staatliche Unterstützung für Minderjährige ist umfangreicher, eine Abschiebung ist nahezu ausgeschlossen, und bei Straftaten kommt das mildere Jugendstrafrecht zur Anwendung.
Der Begriff »Duldung« zog sich durch den Rest meiner polizeilichen Laufbahn und darüber hinaus. Es handelt sich um einen wirklichkeitsverzerrenden Euphemismus; nur allzu oft las und lese ich von »geduldeten Asylbewerbern« in den Medien, was suggeriert, dass sie sich in Deutschland aufhalten dürfen. Das ist aber nicht der Fall. »Duldung«, eigentlich: »Aussetzung der Abschiebung«, bedeutet, dass der Asylantrag des Inhabers abgelehnt wurde und er Deutschland umgehend zu verlassen hat, dies aber nicht tut. Grund dafür sind sogenannte »Abschiebehindernisse« wie z. B. das Fehlen eines Reisepasses oder gesundheitliche Gründe. Er erhält weiterhin staatliche Zuwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Seit dem 1. Januar 2015 endet die räumliche Beschränkung (umgangssprachlich auch Residenzpflicht) für Asylbewerber, auch für abgelehnte Asylbewerber, grundsätzlich nach drei Monaten ununterbrochenem Aufenthalt im Bundesgebiet. Ein wirksames Steuerungselement zur Kontrolle des Aufenthalts von in Deutschland befindlichen Asylbewerbern wurde damit abgeschafft.
Februar 2011, Dortmund Hauptbahnhof, Nachtdienst, ca. 4:45 Uhr morgens. Da der Bahnhof nahezu leer war und die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt lagen, saß der überwiegende Teil unserer Dienstgruppe im Aufenthaltsraum der ordentlich beheizten Wache und versuchte krampfhaft, nicht wegzudösen.
»Borsig 100 von Borsig.«
Der Funk des Gruppenleiters unterbrach die Stille.
»100 hört.«
»Könnt ihr eine Streife zum Bahnhofseingang beim CineStar schicken? DB-Sicherheit hat da wohl ’ne HiLo. Spricht kein Deutsch.«
»Verstanden!«
Wir hatten den Funk mitgehört, und mein Streifenführer deutete mir an, dass wir den Einsatz übernehmen würden. Wir warfen uns eine zusätzliche Kleiderschicht über und machten uns auf den Weg zum ca. 300 Meter entfernten Tunneleingang. »HiLo« oder »HiLoPe« steht für Hilflose Person und kann vieles bedeuten. Nach nunmehr schon einigen Wochen auf der Wache wusste ich, dass die HiLo mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Obdachloser sein würde, der alkoholisiert draußen eingeschlafen war, was bei den Witterungsverhältnissen tödlich sein konnte. In den vergangenen Wochen hatte ich mit meinen Kollegen schon einige Obdachlose von den Straßen rund um den Bahnhof, von den Bahnsteigen und aus dem Bahnhofstunnel gezogen. Einige von ihnen waren besudelt mit dem eigenen Erbrochenen, Kot und Urin gewesen – besonders erpicht auf diesen Einsatz war ich deshalb nicht. Aber Lehrjahre sind nun mal keine Herrenjahre, und meine Kollegen waren froh über jeden KiKo in Ausbildung, der ihnen Aufgaben dieser Art abnahm.
Als wir ankamen, stellte sich die Situation jedoch völlig anders dar als erwartet. Zwei Mitarbeiter der DB-Sicherheit beugten sich, die Hände in die Hüften gestemmt, über eine vollkommen in Schwarz gekleidete Person und versuchten offenbar, mit ihr zu kommunizieren. Es handelte sich um eine Frau vermutlich ostafrikanischer Herkunft. Sie trug ein schwarzes Kopftuch und war in mindestens eine schwarze Decke gehüllt, die sie zitternd an ihren Körper presste, während sie krampfhaft auf den Boden schaute. Ich schätzte sie auf Mitte 20 bis 30.
»Die irrte hier einfach so rum«, erklärte uns der DB-Mann die Situation. »Als wir sie angesprochen haben, hat sie sich hier hingekauert. Der muss rattenkalt sein. Keine Ahnung, wo sie herkommt oder wohin sie will. Spricht jedenfalls kein Deutsch oder will’s nicht sprechen.«
Mein Kollege nickte mit ernster Miene und atmete tief aus. »Deutsch? Bisschen?«, sprach er die Frau an und symbolisierte mit Daumen und Zeigefinger etwas Kleines.
Ich wusste nicht, ob es am Zittern lag oder ob sie gleichzeitig versuchte, den Kopf zu schütteln. Sie gab uns jedenfalls nonverbal zu verstehen, dass sie unserer Sprache nicht mächtig war.
»English?«, warf ich ein.
Ihr Blick traf mich.
»Little bit«, hauchte sie und blickte umgehend wieder auf den Boden.
»Na, besser als nix«, stellte mein Kollege nüchtern fest.
»Come with us to the police station!« Er deutete auf unsere Wache, die in Sichtweite lag.
Sein natürlicher Befehlston hatte keine beruhigende Wirkung auf die Frau, im Gegenteil. Wieder blickte sie mich an. In ihren Augen konnte ich Angst erkennen, gar Panik. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung, wer sie war, aber klar, als Frau in einer eiskalten Nacht an einem menschenleeren Bahnhof von vier fremden Männern umringt zu sein, die in fremder Sprache auf einen einreden, ist unabhängig von allen sonstigen Umständen das Gegenteil von angenehm.
»It’s okay. Let’s go to our station. It’s warm in there. No one will hurt you«, versuchte ich sie mit ein paar einfachen Sätzen zu beruhigen.
Die anderen drei Männer waren alle mehr als 20 Jahre älter als ich, hatten deutlich dichtere Bärte und waren körperlich recht massig. Ich glaube, dass ich als Anfang 20-Jähriger mit Dreitagebart einfach am wenigsten bedrohlich auf sie wirkte. Sie stand auf, und die DB-Männer setzten ihren Rundgang durch den Bahnhof fort.
»Borsig 170/1 mit einer Person zur Wache«, kündigte ich uns über Funk an.
»Verstanden«, plärrte es aus meinem analogen FuG 10a. Die Frau zuckte zusammen.
Auf der Wache angekommen, waren wir froh, im Warmen zu sein. Leider wurde die offensichtliche Angst der Frau jetzt nur noch größer. Neben dem Gruppenleiter kamen noch zwei weitere Kollegen aus dem Aufenthaltsraum in den Vorraum der Wache, sodass sie nun von fünf uniformierten Männern umringt war, die sie alle beäugten.
»Wat habta uns’n da mitgebracht?«, raunte der Gruppenleiter hörbar müde von seinem Schreibtisch.
»DB Sicherheit meinte, die lief da ’n bisschen verloren am Tunnel ’rum. Spricht kein Deutsch, versteht ’n bisschen Englisch. Die hätt’ sich glatt ’n Tod geholt da draußen.«
Ich bemerkte, wie ihr panischer Blick zwischen den beiden Kollegen hin- und hersprang. Ich wandte mich ihr zu und versuchte so ruhig und freundlich zu klingen, wie ich konnte.
»Where are you from?«
Sie zitterte noch immer stark, ob vor Kälte oder aus Angst wusste ich nicht; vermutlich war es beides. »Somalia«, sagte sie mit wackliger Stimme.
Ich weiß bis heute genau, warum mir diese Begegnung so sehr im Gedächtnis geblieben ist. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich einem Menschen gegenübersaß, der Todesangst hatte. Und nicht nur das, sie hatte Todesangst vor mir und meinen Kollegen. Sie wusste nicht, ob diese bewaffneten Männer sie vergewaltigen, ausrauben oder töten würden, so wie es einer unbegleiteten Frau in viel zu vielen Gegenden der Welt geschehen kann.
»It’s okay, you’re safe here«, versuchte ich sie zu beruhigen. Was nicht gelang.
Keiner meiner Kollegen schien den Zustand der armen Frau zu erkennen. Ich versuchte, ihr irgendwie zu vermitteln, dass von uns keine Gefahr ausging, während meine Kollegen kaum ein Wort mit ihr wechselten. Vielleicht überließen sie mir aber auch absichtlich die Gesprächsführung, da auch sie erkannten, dass ich die beste Chance hatte, einen Zugang zu ihr zu bekommen. Wenigstens funkte unser Gruppenleiter geistesgegenwärtig die einzige Kollegin an, die gerade auf Streife an einem anderen Bahnhof war, und beorderte sie zurück zur Wache. Die anderen Kollegen bereiteten den Papierkram vor. Der Frühdienst würde bald übernehmen. Währenddessen versuchte ich weiter, mit der Frau zu kommunizieren.
»Why are you here? Why Germany?«
»The war … in Somalia war.« Ihr Zittern ließ allmählich nach.
»Can you tell me how you got to Dortmund?«
»Sorry, no good understand.«
»How you come here?«, vereinfachte ich mein Englisch so gut es ging, zeigte mit dem Finger zuerst auf sie und malte dann einen großen Kreis in die Luft.
»Truck. Big Truck.«
Es war das erste Mal, dass sie begann, ihre Arme zum Gestikulieren zu verwenden, was ich als gutes Zeichen deutete.
»Borsig 180 steht Wache. Schalten ab«, knarzte die Stimme unserer Kollegin aus dem Funkgerät. Wenige Augenblicke später betrat sie die Wache. Ich wusste nicht genau, ob der Blick auf dem ausgezehrten Gesicht der Somalierin Erstaunen oder ein Anflug von Freude war, endlich eine Frau zu sehen. Eine Frau in der gleichen Uniform, wie wir sie trugen.
»Die ist ganz schön durch den Wind, die Arme«, begrüßte ich meine Kollegin.
»Ja, glaub ich gerne. Ich übernehme ab hier. Ist ja gleich geschafft«, lächelte sie erst mich, dann die Frau freundlich, aber todmüde an. Einige Minuten später trafen die ersten Kollegen vom Frühdienst ein, und die Nachtschicht endete für mich.
Ich habe bis zum heutigen Tag nie wieder einen Menschen getroffen, der so große Angst vor mir hatte, der so offensichtlich damit rechnete, von mir schwer misshandelt oder gar getötet zu werden. Ich konnte und kann nur spekulieren, was ihr in ihrem Leben und auf ihrer Reise widerfahren war. Der Horror des Erlebten war unfassbar tief in die Augen dieser Frau gemeißelt.
Die zwei Monate bei der Bundespolizeiinspektion Dortmund vergingen schnell. Der Großteil meines Dienstalltags bestand aus dem Aufnehmen von Graffiti-Straftaten, dem Feststellen von geringen Mengen BTM, dem Feststellen von Aufenthaltsermittlungen und am Wochenende aus Schlägereien zwischen betrunkenen Partygängern. Des Weiteren beschäftigten uns in fast jeder Schicht Laden- und insbesondere Taschendiebstähle, die zum überwiegenden Teil von organisierten Banden vom Balkan aus der Nordstadt heraus begangen wurden. Seit dem EU-Beitritt Rumäniens und Bulgariens vier Jahre zuvor waren Hunderte oft abfällig als »Armutsmigranten« bezeichnete Menschen vom Balkan in die Nordstadt geströmt, und jedes Jahr wurden es mehr. Einen wachsenden Anteil am organisierten Laden- und Taschendiebstahl hatten damals aber auch Banden aus Nordafrika, die eine hohe Gewaltbereitschaft aufwiesen und den »eingesessenen« Sinti und Roma ihre traditionellen Reviere streitig machten.
Nach der ersten praktischen Erfahrung als Polizist ging es für einige Wochen zur weiteren Ausbildung ins AFZ. Am 2. März erreichte uns dort die Nachricht vom ersten islamistischen Anschlag mit Todesopfern, seit ich bei der Bundespolizei war. Der Kosovo-Albaner Arid U. hatte am Frankfurter Flughafen zwei Angehörige der US Airforce erschossen und zwei weitere schwer verletzt. Er konnte von Beamten der Bundespolizei im Terminal 2 gestellt und überwältigt werden. Der Vorfall gilt seitdem als erster islamistisch motivierter Anschlag mit Todesopfern auf deutschem Boden. Uns wurde klar, dass neben Sprengstoffanschlägen auch Anschläge mit Schusswaffen ein mögliches Szenario waren, mit dem wir uns auseinandersetzen mussten. Flughäfen und Bahnhöfe, auf denen die Bundespolizei präsent ist, stellen immer exponierte Anschlagsziele dar.
Anschließend ging es für uns zum zweiten Teil des Hauptstudiums nach Lübeck. Mehr als die Hälfte des dreijährigen Studiums war bereits vorbei.
Zum Praktikum kam ich in die Einsatzhundertschaft nach Ratzeburg. Der Dienst dort gestaltete sich eher unspektakulär, was daran lag, dass in meiner ersten Woche dort ein Einsatzbefehl an die Abteilung zur Unterstützung der Landespolizei Berlin reinkam. Dass in Berlin durch Linksextremisten und sonstige Randalierer Fahrzeuge in Brand gesteckt wurden, war keine Seltenheit. Allerdings hatte eine Anschlagsserie im August 2011 eine bis dato ungekannte Intensität erreicht, die die Polizei Berlin veranlasste, die Bundespolizei um Unterstützung zu bitten. Vermutlich veranlasste der Umstand, dass im September die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus anstand, die Politik zum Handeln. Dies führte jedoch dazu, dass die mir zugeteilte Hundertschaft in den Einsatz nach Berlin ausrückte, während ein anderer Anwärter und ich in der weitgehend verwaisten Abteilung in Ratzeburg zurückblieben. Anwärter wurden nämlich nicht in mehrwöchige Einsätze zur Unterstützung eines Bundeslandes geschickt.
Wir kamen also in den Tagesdienst, trieben Sport, nutzten die Zeit, um unsere Diplomarbeit vorzubereiten, und schauten Nachrichten auf dem Röhrenfernseher im Aufenthaltsraum, was wir als »Politische Bildung« im Dienstplan eintrugen. Neben der drohenden Staatspleite Griechenlands, dem bald drohenden Untergang des Euros als Währung, den Aus- und Nachwirkungen der Reaktorkatastrophe von Fukushima, dem syrischen Bürgerkrieg und dem Vormarsch der libyschen Rebellen auf Gaddafis letzte Bastion in Tripolis beschäftigte mich persönlich damals eine weitere Meldung.
Nachdem ein 29-jähriges, polizeibekanntes Gangmitglied bei einer Polizeikontrolle im Norden Londons erschossen worden war, kam es in der britischen Hauptstadt zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen, die auf mehrere englische Städte übergriffen. Als die Unruhen nach einer Woche abebbten, waren fünf Todesopfer, mehr als 200 Verletzte und unzählige zerstörte und geplünderte Fahrzeuge und Gebäude zu beklagen. Die Familie des Erschossenen und andere Angehörige der sogenannten »Black Community« unterstellten der Polizei Rassismus, da der Erschossene dunkelhäutig gewesen war, und versammelten sich zu Hunderten vor der Tottenham Police Station, woraus sich die Unruhen entwickelten. Die englische Polizei war vom Tempo der Mobilisierung und den koordinierten Plünderungen und Brandstiftungen, die dem erstmaligen flächendeckenden Einsatz von sozialen Medien (Facebook, Twitter) als Kommunikationsmittel seitens der Randalierer zugeschrieben wurden, vollkommen überrascht worden. Auch hier stellte ich mir damals die Frage, ob so etwas auch bei uns möglich sein würde. (Der Schusswaffeneinsatz wurde 2017 abschließend durch ein Berufungsgericht für rechtmäßig erklärt.)
Zum ersten Mal in meinem Leben begann ich mich ernsthaft mit dem Verhältnis zwischen Polizei und Gesellschaft zu beschäftigen. Insbesondere stellte ich mir damals die Frage, warum das Verhältnis zwischen Polizei und ethnischen oder religiösen Minderheiten offensichtlich in vielen westlichen Gesellschaften ein anderes war als zwischen Polizei und der sogenannten »Mehrheitsgesellschaft«. Den Begriff »Race Riots« kannte ich vage aus dem Geschichtsunterricht und assoziierte ihn eher mit den USA oder Südafrika als mit Europa. Und mir war auch klar: Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wäre es zu keinen Straßenschlachten, Brandstiftungen und Plünderungen gekommen, wenn der Polizeibeamte dunkelhäutig und der Getötete hellhäutig gewesen wäre. Warum war das so? Warum sollte Hautfarbe bzw. Aussehen überhaupt irgendeine Rolle spielen, wenn, wie wir in Lübeck lernten, vor dem Gesetz doch alle gleich sind? Was war meine Einstellung hierzu und wie würde sie sich in den kommenden Jahren entwickeln? Für mich hatte Hautfarbe o. Ä. nie eine Rolle in meinem Leben gespielt, was auch daran lag, dass bis zu diesem Tag mein gesamtes persönliches Umfeld zu über 90 Prozent aus hellhäutigen Mitteleuropäern bestand.
Die vergangenen Jahre und insbesondere meinen praktischen Ausbildungsabschnitt in Dortmund Anfang des Jahres rekapitulierend, stellte ich mit einigem Erstaunen fest, dass der überwiegende Teil aller Straftäter, denen ich in meinem Leben begegnet war, einen nicht-mitteleuropäischen Migrationshintergrund hatten.
In meiner kleinen Heimatstadt war das regelmäßige »Abziehen«[2] einer berüchtigten albanischen Familie vorbehalten. Der Drogenhandel war überwiegend in türkischer Hand, wobei der Hauptumschlagplatz in Dortmund lag. Dort hatten bereits damals Nordafrikaner begonnen, auf den Markt zu drängen, wobei sie oft die Verbindungen zu bestehenden nordafrikanischen Drogenkartellen in den Niederlanden nutzten. Als ich dann einige Jahre später, im Januar/Februar 2011, auf der anderen Seite des Gesetzes stand, bestätigte sich bei den aufgenommenen Straftaten der Eindruck, dass bestimmte Deliktsformen mehrheitlich von Tätern bestimmter ethnischer Zugehörigkeit besetzt waren. Konsumenten, die wir mit geringen Mengen Marihuana oder Haschisch im oder am Bahnhof aufgriffen, waren zu gleichen Teilen Deutsche mit und ohne Migrationshintergrund und Ausländer. Die beiden Dealer, bei deren Festnahme ich in Dortmund beteiligt war, hatten beide arabischen Migrationshintergrund; an die genaue Herkunft erinnere ich mich nicht mehr. Die Ausnahme stellten in meiner persönlichen Erfahrung die wenigen Graffitisprayer dar, die wir festnehmen konnten; sie waren alle Deutsche ohne Migrationshintergrund. Meine Kollegen äußerten sich ähnlich. »Im Prinzip is’ allet, wat hier an BTM getickt wird, fest in Ausländerhand«, hatte mir ein Kollege unverblümt gesagt. »Ganz selten nimmt die LaPo ma’n deutschen Großticker fest, aber dat is’ die Ausnahme. Wenne in dem Business wat erreichen wills’, brauchse ’n Clan mit Kohle und Knarren; ohne geht dat heute nich’ mehr.«
Was mein Kollege gesagt hatte, schien mir angesichts meiner eigenen Erfahrungen und Beobachtungen der vergangenen Jahre plausibel, ohne dass ich die Tragweite damals erfassen konnte. Ohne dass ich den Begriff damals gekannt hätte, bekam ich den ersten Vorgeschmack dessen, was man in der Soziologie als ethnische und religiöse Segregation bezeichnet und was für mich in den darauffolgenden Jahrzehnten das Bild der deutschen Gesellschaft prägen sollte.
Die London Riots am Bildschirm verfolgend, stellte ich mir die Frage, was geschehen würde, wenn ich eines Tages von der Schusswaffe würde Gebrauch machen müssen. Ich versuchte, mich in die Lage der englischen Kollegen der Einheit »Trident« zur Bekämpfung der Gang-Kriminalität Londons zu versetzen, die die Unruhen durch ihren Einsatz ausgelöst hatten. Was war ihre Wahrnehmung von der englischen Gesellschaft? Wie hatte diese sich über die Jahre verändert? Wie fühlte es sich an, in den gefährlichsten Gegenden Londons seinen Dienst zu tun? Wie fühlte es sich an, wenn die Staatsanwaltschaft wegen Totschlags gegen einen ermittelt? Wie fühlte es sich an, wenn auf einmal mehrere Städte wegen deiner Schussabgabe in Flammen stehen?
Ich versuchte, mich auch in die Menschen zu versetzen, die sich an den Protesten und der anschließenden Gewalteskalation beteiligten. Dass Familie und Angehörige des Getöteten eine lückenlose Aufklärung des Einsatzes und seiner Rechtmäßigkeit forderten, war nur selbstverständlich. Dass sich jedoch andere Menschen mit dem Straftäter quasi automatisch solidarisierten und als Reaktion eine wahllose Gewaltorgie gegen Menschen und Material entfesselten, entzog sich meiner Empathie. Wo war der Zusammenhang zwischen dem Polizeieinsatz, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen war, und einer außer Kontrolle geratenen Menschenmenge, die plünderte und mutwillig zerstörte? Wie kam dieser blinde Solidarisierungseffekt zustande? Und wenn die Wut sich gegen die Polizei richtete, warum wurden dann wahllos Menschen angegriffen, Fahrzeuge und Geschäfte geplündert und in Brand gesteckt? Da ich zu keinem Ergebnis kam, gab ich es irgendwann auf, mir den Kopf darüber zu zerbrechen. Die Frage, ob so etwas in Deutschland möglich sein würde, und insbesondere, ob so etwas mir passieren könnte, behielt ich aber seitdem im Hinterkopf.
Einige Tage bevor unser Ausbildungsabschnitt in Ratzeburg offiziell endete, kehrte unsere Hundertschaft aus Berlin zurück und verabschiedete uns. Nach wenigen Tagen Unterbrechung ging es für zwei Monate ins Praktikum nach Aachen.
Ich wurde dem Revier Aachen-Süd am Grenzübergang Lichtenbusch zugewiesen. So gering das Arbeitspensum in Ratzeburg gewesen war, so hoch war es in Aachen. Das Dreiländereck Deutschland-Belgien-Niederlande bietet aus grenzpolizeilicher Perspektive ein hohes Potenzial: unerlaubte Migration aus Belgien und unerlaubte Einfuhr von Betäubungsmitteln aus den Niederlanden. Auch wenn seit der Einführung des Schengen-Systems innerhalb der Europäischen Union 1995 keine Grenzkontrollen zwischen den Mitgliedsstaaten mehr bestehen, so kann jeder Mitgliedsstaat dennoch die grenzbezogene Schleierfahndung aufrechterhalten. Die Bundespolizei ist demnach befugt, in einem Gebiet 30 km landeinwärts verdachtsunabhängige Fahrzeug- und Personenkontrollen durchzuführen. Damit war mein Dienstalltag beschrieben, denn kaum etwas anderes machten wir die kommenden zwei Monate. Während die Kollegen des Reviers Aachen-Nord in Zusammenarbeit mit den Kollegen der Zollfahndung hauptsächlich jede Woche Rauschgift aus dem Verkehr zogen, stellten wir auf den Straßen und die Kollegen vom Revier Aachen Hbf in den grenzüberschreitenden Zügen jede Woche mehrere Personen fest, die sich nach rechtlichem Status nicht in Deutschland aufhalten durften.
September 2012, Aachen-Süd, Spätdienst, ca. 16 Uhr. Mein Streifenführer und ich saßen in unserem etwas in die Jahre gekommenen, aber dennoch zuverlässigen VW