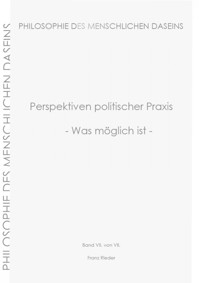Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Philosophie des menschlichen Daseins – 7 Bände Band 2: An die Arbeit behandelt die theoretischen Systeme, die sich mit der menschlichen Arbeit beschäftigt haben. Das sind wenige aus der Philosophie, die man zudem auch nur einigermaßen systematisch nennen kann. Da sind die Theorien der politischen Ökonomie, angefangen bei Platon, dann differenzierter bei Aristoteles bis zu Adam Smith und Karl Marx. Und natürlich die Wissenschaften der Ökonomie, die wir unter den Begriff der Ökonomik versammeln. Thematisch geht es in diesem Band um den Zusammenhang zwischen individuellem Wohlstand und gesellschaftlicher Wohlfahrt in grundlegender Absicht. Dabei spielen Überlegungen zur Wertschöpfung (Produktion) und zu den Märkten hinsichtlich der Entwicklung von Löhnen und Gehältern und deren Auswirkungen auf die Preise (Konsum) eine zentrale Rolle. Dort von den Konsummärkten, wo Angebot und Nachfrage herrschen, blicken wir wieder zurück auf die Einflussfaktoren bei der Herstellung der Güter, auf Eigentum, Geld und Kreditzinsen. Dabei entwickeln wir durch den gesamten Band II eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Ideologien, an deren Basis die des homo oeconomicus steht. Und mit dieser Auseinandersetzung um das Prinzip der unbedingten Nutzenmaximierung auch die Frage, ob man zu einer besseren Theorie und Praxis für und in der Art, wie wir unser Dasein reproduzieren, kommen kann, wenn wir dieses Nutzen- bzw. Gewinnmaximierungsprinzip abschaffen würden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 693
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Philosophie des menschlichen Daseins – Band II von sieben Bänden.
Autor: Franz Rieder
Copyright © 2025 der deutschsprachigen Ausgabe 2025 durch
Franz Rieder, Nievenheimer Str. 17, 40221 Düsseldorf
E-Mail: [email protected]
Herstellung:
epubli - ein Service der neopubli GmbH, Köpenicker Straße 154a,
10997 Berlin
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung:
Vorwort
Einleitung
Kapitel 1: An die Arbeit
Verantwortung
Verantwortung der Wirtschaftswissenschaft
Verantwortung zwischen Wissenschaft und Politik
Verantwortung und Politik
Verantwortung und Politik
Gott beim Würfeln zusehen
Markt- oder Systemversagen?
Neue Bekanntschaften
Neue Freundschaften
Freunde FÜRS Leben
Anschauen – nicht anfassen!
Auf dem Markt der Eitelkeiten
Mit fingerdicker Kosmetik zukleistern
Globalisierung – Ausweg oder Holzweg?
Alte und neue Rezepte…
Aus Oma’s Küche
Pleite durch Arbeit
Arbeit im Saldo minus
Kapitalflucht in den Krisenländern
Alles umsonst?
Danse macabre
In der Falle
Kapitel 2: Das Ideal eines vollständigen Wettbewerbs
Hoch effizient – Keine Wirkung
Der Pareto-Schwindel
Staat und Wirtschaft
Staatliches Krisenmanagement – Distribution
Staatliches Machtmanagement – Allokation
Staatliches Notfall-Management – Stabilisierungsfunktion
Wettbewerbs-Antagonien I.
Wettbewerbs-Antagonien II.
Kapitalkonzentration – Monopolisierung
Konzentration – Konkurrenz
Krisen – Selbsterneuerungen
Von Krisen und Größen
Konzentration – Zyklen
Konzentration – Zyklen: Das japanische Modell
Japans Modell weltweit
Kapitel 3: Ausweg – Fall der Profitrate
Ausweg – nicht in Sicht
Ausweg – visionär
Wettbewerb vs. Konkurrenz
Auf Leben und Tod
Monopol – Ein Straftatbestand
Monopole – Ein Paradigmenwechsel
Das Missverständnis vom Wettbewerb
Wettbewerb – Entdeckung und Disruption
Die Mitte ist nicht mehr Maß
Der König ist tot
Es lebe der König
Angst vor dem Wettbewerb
Mangel vs. Sein
Der Mangel kämpft
Angst – Schweiss – Tränen
Grenzen
Der neue Handelsimperialismus
Kapitel 4: Die unsichtbare Hand
Moderne Feudalherren
Moderne Feudalrechte – Leitzinsen
Des Kaiser’s neue Kleider – Zentralbankzinsen
Seide – Sack und Asche
Das rechte Kleid zum gegebenen Anlass
Patchwork Family
Zuviel zuwenig
Kapitel 5: Eigentum zählt
Der immaterielle Wert des Eigentums
Eigentum und Marktwirtschaft
Eigentum und Volkswirtschaft
Eigentum und Märkte
Eigentum und Wachstum
Schlaflied vom kontinuierlichen Wachstum
Wertpapiere
Geld
Mit Geld durch Dick und Dünn
Durabel – Fungibel
“In the long run we are all dead”
Sparen oder investieren
Asset Rich, Cash Poor!
Kapitalakkumulation
Zins als Einkommen
Zins als Einkommen – Teil II.
Zins als Einkommen – Teil III.
Das Geld ist weg
Geld als Wertform
Kapitel 6: Die Umkehrung der Wertform
Umkehrung der Wertform – bilanziert
Umkehrung der Wertform – General Liability
Umkehrung der Wertform – Beschränkte Haftung
Volkswirtschaftliches Funktionsversagen
Vom Geld zum Kapital
Reich durch Verlust
Wandel der Wertschöpfung
Wachstum in Unordnung
Perpetuum immobile
Good ones don’t come by the score
Attac fractale
Fractale en march
Märchenmärkte
Kapitel 7: Transgressionen des Eigentums
Das Schweigen der Monetaristen
Die Krise der Menge
Der Inflationsritt aus der Krise
Samt Gaul voll ins Hindernis
Das Individualprinzip in der Ökonomie
Seltsame Kampfgenossen
Literaturliste:
Vorwort
Philosophie des menschlichen Daseins
Franz Rieder
Band II.
Band 2: An die Arbeit behandelt die theoretischen Systeme, die sich mit der menschlichen Arbeit beschäftigt haben. Das sind wenige aus der Philosophie, die man zudem auch nur einigermaßen systematisch nennen kann. Da sind die Theorien der politischen Ökonomie, angefangen bei Platon, dann differenzierter bei Aristoteles bis zu Adam Smith und Karl Marx. Und natürlich die Wissenschaften der Ökonomie, die wir unter den Begriff der Ökonomik versammeln. Thematisch geht es in diesem Band um den Zusammenhang zwischen individuellem Wohlstand und gesellschaftlicher Wohlfahrt in grundlegender Absicht. Dabei spielen Überlegungen zur Wertschöpfung (Produktion) und zu den Märkten hinsichtlich der Entwicklung von Löhnen und Gehältern und deren Auswirkungen auf die Preise (Konsum) eine zentrale Rolle. Dort von den Konsummärkten, wo Angebot und Nachfrage herrschen, blicken wir wieder zurück auf die Einflussfaktoren bei der Herstellung der Güter, auf Eigentum, Geld und Kreditzinsen. Dabei entwickeln wir durch den gesamten Band II eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Ideologien, an deren Basis die des Homo oeconomicus steht. Und mit dieser Auseinandersetzung um das Prinzip der unbedingten Nutzenmaximierung auch die Frage, ob man zu einer besseren Theorie und Praxis für und in der Art, wie wir unser Dasein reproduzieren, kommen kann, wenn wir dieses Nutzen- bzw. Gewinnmaximierungsprinzip abschaffen würden.
Band VII: Perspektiven. Dieser Band ist ein Sammelsurium, eine Ansammlung von Möglichkeiten, die in der Zukunft möglicherweise eine Rolle spielen werden und deshalb auch Möglichkeiten mit Perspektiven zu nennen sind. Es gibt viele Möglichkeiten, aber nicht alle haben die Perspektive, eine Rolle, eine entscheidende Bedeutung in unserem Leben in der Zukunft zu spielen, gar unserem Dasein einen anderen, einen neuen Sinn zu verleihen. Ganz gleich, ob unser Dasein durch neue Seinsmöglichkeiten bereichert wird, oder nicht, denn auch die Frage nach dem Wert eines neuen, sinnvollen Lebens kann nicht endgültig beantwortet werden, zumal, wenn Veränderungen mit neuen Perspektiven sich erst noch in der Phase der Entwicklung oder in einer Phase der Transformation von Altem auf Neues hin befinden. Eine praktische Philosophie, die unser Dasein aus neuen Möglichkeiten und neuen Perspektiven betrachtet, bleibt notwendigerweise also vage, was nicht heißt, irrelevant.
Band VI: Veränderung. Dieser Band versucht den komplexen Sachverhalt von Bewahrung und Veränderung aus vielen, möglichst den relevanten Perspektiven nachzuzeichnen in der Absicht, Klarheit zu schaffen. Klarheit darüber, was die wesentlichen Kräfte sind, die einer Bewahrung wie andererseits einer Veränderung entgegenstehen, wobei wir den Sachverhalt, also das, was bewahrt wird oder verändert wird in jeder Perspektive mit betrachten und also erst aus diesem Zusammenhang bestimmen können.
Band V: Digitalisierung. Dieser Band betrachtet den digitalen Wandel in den neuen Feldern der politischen Ökonomie, vor allem auf dem Feld der Geldpolitik. Hieraus ergeben sich Veränderungen auf allen Feldern der Ökonomie, und zwar in globaler Hinsicht. Mit
Einführung von Digitalgeld und der sukzessiven Abschaffung des Bargelds gewinnt die Geldpolitik immense Spielräume, die etwa das fünf- bis sechsfache dessen ausmachen, womit sie bis dato umzugehen in der Lage ist. Geld- und Fiskalpolitik werden so in absehbarer Zukunft kaum noch etwas damit zu tun haben, was wir bislang davon kennengelernt haben. Für die Wirtschaft und die Wissenschaft der Ökonomie hat das weitreichende Konsequenzen. Die Wirtschaft wird sich darauf einstellen müssen, dass sie zunehmend weniger in marktwirtschaftlichen Zusammenhängen operiert. Die Wissenschaft darf sich darauf einstellen, dass damit auch fast alle ökonomischen Kategorien ihre wissenschaftliche Relevanz verlieren. Digitalisierung beschäftigt uns auch im Zusammenhang mit den neuen Kryptowährungen und natürlich auch im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz, beides neue Technologien, die unser Leben mehr verändern, als dies Technik vorher jemals konnte. Sie verändert unsere Art zu arbeiten, unser Freizeitverhalten, unsere Bildung und auch unser Bewusstsein, und nicht zuletzt unseren Umgang miteinander grundlegend. Wie solche grundlegenden Veränderungen in die Welt kommen, darum geht es in diesem Band. Die sozialen, kulturellen und zwischenmenschlichen Auswirkungen der neuen Geldpolitik und der neuen Technologien in Hinblick auf die Lebensgrundlagen und Lebensverhältnisse, in denen das menschliche Dasein sich entfaltet, wird uns in einem Band VI. dann beschäftigen.
Band IV: Zu einer neuen Politischen Ökonomie. Dieser Band beschäftigt sich mit den Modellen der klassischen und neoklassischen Ökonomik, die eine wissenschaftliche Entwicklung beschreiben, deren letzten Kapiteln wir gerade beiwohnen. Hier werden die Schlusskapitel der politischen Ökonomie geschrieben, die mit den Transformationsprozessen innerhalb der Politischen Ökonomie nicht mehr Schritt halten können, weil sie mit den wirklichen Einflüssen, die Politik heute über die Notenbanken auf die Ökonomie ausübt, intellektuell nicht mitkommen.
Band III: Die Transformation der Marktwirtschaft beschäftigt sich mit den Prozessen innerhalb der Ökonomik, die aus der klassischen politischen Ökonomie herausführen in eine Wirtschaftsform, die immer weniger zu tun hat mit einer Marktwirtschaft, sei diese nun eine Liberale Marktwirtschaft, wie in den angelsächsischen Modellen, oder innerhalb von einer Sozialen Marktwirtschaft wie in den europäischen Modellen.
Band 1: Andenken behandelt in knapper Form die Entstehung und Entwicklung wichtiger Themen und Denkmuster, angefangen in der antiken, griechischen Philosophie bis in die Moderne des Abendlandes. Dabei wird eine Neubestimmung abendländischen Denkens aus der Komplementarität von Denken und Sein vorgenommen und damit die bestehenden Bestimmungen aus dem Gegensatz und der Negation bzw. dem Widerspruch zwischen Denken und Sein überwunden. Eine Neubesinnung auf das Thema und die Phänomenologie der Macht als politische Macht will die Inflation soziologischer Machtbestimmungen beenden und den Weg aufzeigen, wie politische Macht als phantasmatische Macht im Dasein des Menschen sich ausgebreitet hat und heute weiter prozediert.
Einleitung
Band II unserer Philosophie des menschlichen Daseins trägt den Titel: An die Arbeit. Nicht unbeabsichtigt ist die doppelte Bedeutung, eine transitive und eine intransitive, die in diesem Titel steckt, geht es doch um die Beschäftigung mit dem wesentlichen Element im Daseinsvollzug, der materiellen Reproduktion des menschlichen Daseins oder einfach geschrieben, der Arbeit im Sinne der Erwerbsarbeit. Wir nehmen darin auf, was wir in der Philosophiegeschichte gefunden haben und das ist wenig. Allein Karl Marx hat systematisch und themenumfassend davon gehandelt. Wenig gibt es dazu von den antiken Griechen, etwas zur Technik bei Heidegger und anderen Technikphilosophen.
Das erklärt auch die transitive Bedeutung des Titels, insofern wir zum Thema Arbeit beitragen möchten. Wir nehmen dabei auf oder zur Kenntnis, was wir in der Philosophiegeschichte zum Thema gefunden haben und das ist wahrlich wenig, lässt man mal das Kapital von Karl Marx beiseite. Ein wenig aus der griechischen Antike, etwas zur Technik von Heidegger und Technikphilosophien. Warum das Thema Arbeit in der Philosophie so wenig Resonanz gefunden hat, ist unerklärlich. Umso mehr wollen wir deshalb dazu beitragen, dies zu ändern und werden notwendigerweise uns mehr mit der Ökonomik als mit der Philosophie dazu zu beschäftigen haben. Und hier beginnen schon die Schwierigkeiten, um deren Klärung man nicht umhinkommt, will man sich darin nicht unversehens und schnell derart verstricken, dass man einen Weg heraus nicht mehr zu finden in der Lage ist. Worum geht es?
Es geht um das Selbstverständnis unserer Beschäftigung mit den materiellen Grundlagen und den Prozessen der Reproduktion unseres Daseins. Dieses Selbstverständnis kann zwei Positionen einnehmen, einmal die Position einer beschreibenden Wissenschaft, einmal die Position einer pragmatischen Wissenschaft. Beide Positionen können sehr unterschiedliche Orientierungen offenbaren, wobei eine am Gemeinwohl, die andere an möglichst exakten, wissenschaftlichen Beschreibungen ausgerichtet ist. Beide Orientierungen, so ergibt sich, schaut man in die Entwicklungsgeschichte beider Positionierungen, nennen sich selbst bzw. werden im wissenschaftlichen Diskurs Ökonomie bzw. Ökonomik genannt, was einigermaßen verwirrt und zeigt, dass eine präzise Abgrenzung entweder zu schwer oder vielleicht auch unmöglich ist.
Schauen wir zurück ins 19. Jahrhundert, dann finden wir als den gebräuchlichsten Begriff für die Wirtschaftswissenschaft, Nationalökonomie oder Volkswirtschaftslehre den der „politischen Ökonomie“, so auch der Titel: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie von Karl Marx, 1857-1858 und einem Anhang für die Jahre 1850-1859. Der Begriff der politischen Ökonomie geht zurück auf drei Begriffe, die die griechische Antike noch getrennt behandelt hat, die „politeia“, also der Staat bez. die gesellschaftliche Ordnung, der „oikos“, das Haus im Sinne einer Haus- bzw. Hofwirtschaft und „nomos“, das Gesetz. Die Zusammenfassung dieser drei antiken Begriffe zu einer politischen Ökonomie blickt auf die materielle Reproduktion des menschlichen Daseins als ein Verhalten, welches sowohl die materielle Reproduktion eines einzelnen Menschen wie sein soziales Umfeld umschreibt, dort im Athener Stadtstaat die Gemeinschaft des Oikos, die Hofgemeinschaft.
Politische Ökonomie war also in Athen wie dann im 19. Jahrhundert die Idee einer am Gemeinwohl orientierten Ökonomie im Sinne einer praktischen Wirtschaft wie auch im Sinne einer praktischen Wissenschaft dieses Wirtschaftens, also eine Wirtschaftswissenschaft bzw. Ökonomik. Die Unterscheidung zwischen Ökonomie und Ökonomik muss daher in dieser Rückschau getroffen werden in der Idee einer Gemeinwohl-Wirtschaft und nicht in der Analyse von verschiedenen, historisch konkreten Konzepten von am Gemeinwohl orientierter Ökonomie und Ökonomik. Die Idee des Gemeinwohls ist also das Diskriminationskriterium zu den Ansätzen, die dann ab dem Ende des 19. Jahrhundert sich Wirtschaftstheorie nennen und die allesamt sich gegenüber ihren Vorgängern als „objektive“, also gerade nicht an der Idee des Gemeinwohls orientierten Wissenschaftsphilosophien positionieren.
Die (wissenschafts-) philosophischen Theorien, angefangen bei Platon und dann über die Ausdifferenzierungen von Aristoteles bis hin zu Adam Smith, dann über Karl Marx, bis zu Friedrich August von Hayek und bis hin zur Idee der Sozialen Marktwirtschaft lassen sich unter der Idee des Gemeinwohls mühelos mit denen in Verbindung bringen, die heute von den Anhängern etwa einer Share Economy, Care Economy, Blue Economy etc. vertreten werden. Und die moderne klassische Ökonomie von Maynard Keynes über die neoklassischen wie auch die monetaristischen Ansätze setzen dagegen keine Idee des wirtschaftlichen Handelns, sondern die Wirtschaft als ein passives, so gegebenes Objekt wie etwa die Natur, der Kosmos usw., also ein naturwissenschaftliches Theorieverständnis, welches mühelos ohne Ideen vorgibt auszukommen, aber in ganz und gar wertfreien, also objektiven bzw. positivistischen Beschreibung jenes Objekts und seiner mathematischen Modellierung seinen Sinn findet.
Nun könnte man schnell zu der Meinung kommen, dann ist doch alles klar und einfach, aber leider ist dem nicht so, dass die einen von einer am Gemeinwohl orientierten Idee, die anderen ideenlos von den vorhandenen, empirischen, also beobachtbaren und mathematisch berechenbaren Tatsachen ausgehen; das wäre zudem auch nicht einmal zu schön, um wahr zu sein. Marx etwa hätte für sich in Anspruch genommen, seine Analyse des Kapitals wäre damit schon zufrieden, wenn dieses im Kapital aggregierte Verhalten und Denken der Idee des Gemeinwohls folgen würde. Dem war ihm nicht genug, Marx wollte die Revolution, also die Abschaffung des Kapitals, hier das Privateigentum des Produktivvermögens. Lassen wir kurz die moderne Ökonomik zu Worte kommen, dann sehen wir, dass deren Vorwurf an die Adresse der politischen Ökonomie deren Unwissenschaftlichkeit adressierte. Sie, die wissenschaftliche Ökonomie, sei als eine naturwissenschaftliche Ökonomik eine viel leistungsfähigere Theorie, weil sie nicht unbewiesenen Meinungen, sondern mit empirischem Wissen arbeitet; meinen, glauben, dafürhalten wie Hegels Phänomenologie des Geistes als Vorformen des Wissens beginnt, so sagte bereits der größte aller Idealisten, taugen nichts für eine aufgeklärte Wissenschaft, also sei die moderne Ökonomik der richtige Weg und das bessere Verfahren der Betrachtung.
Das ist ganz und gar evolutionär gedacht, so als hätte sich die auf naturwissenschaftlichen Modellierungen gründende Wissenschaft insgesamt und speziell die der Ökonomik durchgesetzt, sich als besser und anpassungsfähiger, als effizienter erwiesen. Nun sieht man aber, dass die Ökonomik der praktischen, politischen Ökonomie ihre Vorbehalte der Unwissenschaftlichkeit nicht nur selbst ganz und gar unwissenschaftlich entgegenschleudert, ohne sich mit der Idee des Gemeinwohls darin explizit zu beschäftigen, also ihre Kritik daselbst im Duktus bloßer Meinungen vorträgt. Nein, sie selbst hat spätesten seit Keynes implizit großen Anteil an der politischen Idee des Gemeinwohls, ohne es anfangs aus den o.g. Gründen explizit nicht vorgetragen zu haben. So wurde die Ökonomik contre Coeur zu einer politischen Ökonomie, als sie sich damit beschäftigen musste, wie in Krisenzeiten – heute spricht man auch von Zeiten des Marktversagens – die Politik etwa mit Konjunkturprogrammen der Ökonomie helfend zur Seite springen oder fiskalisch unter die Arme greifen muss, um tiefgreifende Wirtschaftskrisen zu vermeiden bzw. zu beenden. Gleichwohl also mathematische Modelle dem, was in einer Marktwirtschaft passiert, abbildend hinterherspüren, am Ende ist die moderne Ökonomik dann doch eine pseudonaturwissenschaftliche Theorie, die sich mit politischer Ökonomie anreichert, wenn Ökonomie allein nicht mehr ausreicht.
Halten wir bis hierher fest, die politische Ökonomie beginnt mit der Idee einer auf das Gemeinwohl zielenden Wirtschaft und ist so im Grunde und in der Orientierung eine Handlungs- und Sozialwissenschaft in gesellschaftspolitischer Absicht. Das würde heute wohl auch Marx so gerade noch unterschreiben, dass, wenn wirtschaftliches Handeln unter dem Primat einer am Gemeinwohl orientierten Marktwirtschaft stünde und damit auch sich mit den Ideen einer guten und gerechten Wirtschaft beschäftigt, wie Platon bis später Adam Smith diese angedacht hatten, dann wäre auch evolutionstheoretisch wenig dagegen anzuführen, zielten ja die staatspolitischen Ideen eines Sozialismus‘, sogar eines Kommunismus‘ in eben diese Richtung.
Aber einmal mehr klingt die Sache einfacher, als sie ist. Der Weg dorthin ist strittig und zwischen evolutionstheoretischen und revolutionären Ansätzen klafft doch eine gewaltige intellektuelle Lücke, ein theoretischer Hiatus. Denn selbst die an mathematischen Modellen ideologisierten Wissenschaften des Wirtschaftens sind wie die politische Ökonomie von A. Smith nicht schon per se dadurch, dass sie philosophischen Ideen in ihren Theorien Raum verschaffen, schon implizit revolutionär. Wir sehen heute kaum noch eine Ökonomie, die, ob sie als politische oder als rein wissenschaftliche Theorie daherkommt, keine Themen der kritischen Sozialwissenschaften, der Humanwissenschaft und der Philosophie in ihre Theorien hereinnimmt, oder weiterhin schier immun sein will wie bislang, Themen wie Arbeitslosigkeit oder Ökologie lediglich als Folgen von Marktgesetzen zu diskutieren. Eine gute und gerechte Wirtschaft ist eben mehr als das, was als ein positivistisches Verständnis von Marktvorgängen imponieren wollte, was als eine Art vergangener Ökonomik teilweise noch in aktuellen Theorien mitschwingt.
Wir haben unter dem Begriff der gleichzeitigen Ungleichzeitigkeit dieses Nebeneinander von bereits überwundenen und neuen theoretischen Modellen beschrieben, von alten Einstellungen, was z. B. Einstellungen gegenüber Herkunft, Rasse, Religion, Kultur und sexueller Orientierung angehen und zugleich deren aufgeklärten Negationen. Wir sehen heute in den Volkswirtschaftslehren durchaus neben mathematischen Modellen, die die Lehre von den Gesetzen der Haushalte (Ökonomie) mit Themen der Sinnorientierung der Wirtschaft zusammenzubringen versuchen, Themen wie die sozialen Probleme einer Gesellschaft, die Nachhaltigkeit des Wirtschaften mit ökologischer Ausrichtung, die sozialpolitische Bedeutung von Wohlfahrtsystem, wie dies A. Smith in seinem bereits am 09. März 1776 erschienenen Buch: “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” der wissenschaftlichen Nachwelt vererbt hatte. Smith wandte sich damals explizit gegen eine bestimmte Auffassung von Ökonomie, den Merkantilismus, der ja auch eine Form der politischen Ökonomie ausgeprägt hat, der in Zeiten des Absolutismus Wirtschaft verstand als Wirtschaftspolitik, die über die besondere Förderung von Industrie und Außenwirtschaft, durch Zölle, Handelsmonopole und staatlichen Dirigismus das Ziel verfolgte, die politische Finanzkraft und damit die Staatsmacht zu stärken.
Dagegen trat also die Idee des Gemeinwohls an, eine Idee, die in der ewigen Idee der Freiheit des Menschen gründet und in der aufgeklärten politischen Ökonomie ihre Ausprägung im Utilitarismus fand. Hier wurde sie zu der Auffassung, dass, wenn jeder Einzelne den größtmöglichen Nutzen für sich selbst anstrebt, auch die Gemeinschaft den größtmöglichen Nutzen, der erreichbar ist, gewinnt. Die klassische Grundformel des zweckorientierten, teleologischen Nutzen ist zugleich auch eine Wirtschaftsethik, eine Nutzenethik, die stark reduziert besagt, dass wirtschaftliches Handeln genau dann moralisch richtig ist, wenn sie den aggregierten Gesamtnutzen, d.h. die Summe des Wohlergehens aller Betroffenen maximiert. Wir sehen, die Idee der politischen Ökonomie, die Idee des Gemeinwohles ist hier zu einer immanenten Idee des wirtschaftlichen Handelns geworden, insofern sie nicht über das wirtschaftliche Handeln hinausgreift, sondern sie unter der Nützlichkeit, speziell der Befriedigung der Bedürfnisse für jeden Einzelnen postuliert.
Wenn alle zum eigenen Nutzen handeln, ist die größtmögliche, soziale Ausbreitung des Nutzens, das Gemeinwohl erreicht. Aus einer politischen Ökonomie ist so die Ökonomik als Wissenschaft des wirtschaftlichen Nutzens geworden. Aber an der Tatsache, dass diese Transformation schon unter einer pseudo-naturwissenschaftlichen Orientierung stand, hat sich nichts geändert. Denn die Befriedigung der vielen einzelnen Bedürfnisse lässt sich wie ein passives Beobachtungsobjekt behandeln, gleichwohl sich Bedürfnisse ändern können. Sie bleiben messbar, zählbar, totalisierbar mit den Mitteln der Ökonomik. Eine Anzahl von Bedürfnissen, ein Korb voller Waren, die Preise für deren Herstellung und den Konsum sowie der Wert des Geldes, der Währung, alles das erlaubt eine positivistische Beschreibung und eine mathematische Modellierung. Worin liegt dann also die Schwierigkeit mit den verschiedenen Formen der Ökonomie?
Positivistische Beschreibungen und mathematische Modellierung dieser beschriebenen „Sache“ denken alles, was mit Ökonomie zusammenhängt als etwas, was der Wirklichkeit der Wirtschaft entspricht. Sie befinden sich im Seienden der Ökonomie und verlassen auch den Horizont des Seienden dann nicht, wenn sie die Veränderungen evolutionär denken, also aus vergangenen Sachverhalten und gegenwärtigen auf zukünftige schließen. Diese Veränderungen kommen dann aus dem Seienden selbst heraus, sind Entwicklungen, die in der Sache selbst bzw. in den Relationen, die die Sachen in Sachverhalten eingehen, entspringen. Die einfachste Formel dafür ist die Relation von Angebot und Nachfrage, die sich durch Mengen- oder Preisänderungen verändern kann.
Politische Ökonomien gehen von einer Idee aus, etwa der Idee einer gerechten Wirtschaftsordnung und haben den Fokus weniger auf die Beschreibung eines Sachverhaltes gerichtet bzw. diesen als nachgeordneten Faktor im Denken. Auch sie kommen nicht umhin, am Seienden darzulegen, inwieweit eine Wirtschaft der Idee einer gerechten Wirtschaft entspricht oder nicht. Politische Ökonomien beginnen also mit einer Idee bzw. einer Gesamtheit an Vorstellungen, die sie als Sein des Seienden vorstellen und messen bzw. bewerten das Seiende am Grad der Verwirklichung einer Idee. Auch hier blicken politische Ökonomien auf die tatsächlichen Veränderungen in den ökonomischen Sachverhalten, die sie als immanente Prozesse vorstellen, als evolutionäre oder als Entwicklungsprozesse begreifen. Was also vormals ein primär positivistisches Theorieverständnis von Ökonomie war ist nun durch ein mehr pragmatisches Verständnis ersetzt worden, das die Ökonomik als ein Feld der praktischen, durch lebendige Subjekte hervorgebrachte Veränderung mit in Theorie einschließt.
War im 19. Jahrhundert ein an Mathematik und Physik orientiertes, wissenschaftliches Verständnis von Wirtschaft primär, so mischten sich soziale, gesellschaftspolitische und vor allem an der Lösung von drängenden Problemen wie z. b. Wirtschafts- und Sozialkrisen orientierte Themen in die Theoriebildungen und nahmen also auch am Gemeinwohl ausgerichtete Elemente mit in die wissenschaftlichen Ansätze der Ökonomie auf. Ob also eine Theorie über sich hinausweist, über eine Beschreibung des Seienden ist deshalb keine Frage, ob diese eine am Gemeinwohl orientierte Theorie ist oder eine rein deskriptive.Erinnern wir uns zurück an Marx, dann sehen wir, Marx hatte anderes als eine evolutionäre Theorie im Sinn; eine rein deskriptive natürlich auch nicht. Marx sah in der Wirtschaft vor allem der Englands eine politische Ökonomie, die von einem Gegensatz, dem zwischen Kapital und Arbeit angetrieben war und in dessen Folge eine ungerechte Form der Verteilung des produzierten Wohlstands zwischen Kapitalisten und Arbeitern entstanden ist. Die ungerechte Verteilung führt zu einer Klassengesellschaft, die den Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit über die Akkumulation des Kapitals und der Ausbeutung des Faktors Arbeit weiter vertieft und mit der Vertiefung des Spaltung von Kapital und Arbeit wird Ausbeutung zum herrschenden und Reichtum zum alles beherrschenden Prinzip. Alles dies ist politische Ökonomie, gewissenmaßen eine negative Theorie des gesellschaftlichen Reichtums.
Marx sah auch eine Art Entwicklung von den ersten Formen materieller, menschlicher Reproduktion bis hin zum Kapitalismus. Er aber wollte primär eine andere Form der Ökonomie, eine bislang nicht wirkliche, aber mögliche Form. Und die sei nur zu erreichen durch eine Revolution, eine Umkehrung der Herrschaftsverhältnisse in der Ökonomie mithin der Aufhebung der Negation durch Negation. Abschaffung des Privateigentums an den Produktionsmitteln war der herausragende Weg zu Umsetzung mit dem Ziel, eine nicht auf Ausbeutung aufbauende Produktion mit dem Ziel einer klassenlosen Gesellschaft à la longue, die im Sozialismus als Vorform und im Kommunismus als Endform einer herrschaftsfreien Gesellschaft verwirklicht wird.
Wir sehen leicht, dass Marx nicht daran glaubte, ohne eine Revolution allein durch eine evolutionäre Entwicklung den Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit in der Produktion überwinden zu können und auf dieser Grundlage die Entwicklung zu einer klassenlosen, herrschaftsfreien Gesellschaft zu erkennen. Aus dem Seienden, wie es war, etwa in den Frühformen von Absolutismus und Feudalismus, schon gar wie es ist im System der kapitalistischen Produktion und der Gesellschaftsform des Bürgertums existierte, wird nach Marx auch keine wirkliche und erkennbare Entwicklung hin zu einer herrschaftsfreien, auf Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zielende Wirtschafts- und Gesellschaftsform denkbar bzw. durchsetzbar sein, vor allem nicht aus einer inneren Antriebskraft. Die Form einer politischen Ökonomie, deren Verwirklichung Marx im Sinne hat, gab es weder in einer vergangenen noch in der gegenwärtigen Wirklichkeit und ist auch nicht innerhalb einer, aus der Wirklichkeit heraus sich entwickelnden und erkennbaren Form vorstellbar. Die Vorstellung einer herrschaftsfreien Produktion und klassenlosen Gesellschaft ist eine neue Idee, ist ein neues, detailliertes Gesamt an Vorstellungen, ohne Vorbild. Bleiben wir in unserer bisherigen philosophischen Terminologie, dann ist diese Idee das Sein des Nichtseienden und so haben wir auf diesem Weg auch sogleich dieses schwierige Begriffsensemble vom Sein des Nichtseienden bzw. Nichtseins vorgestellt.
Das wird im Verlaufe dieses Bandes, dann mehr noch im nächsten und im letzten Band unserer Philosophie des menschlichen Daseins von einiger Bedeutung sein. Denn zuerst einmal müssen wir ja präzise begrifflich unterscheiden, an welcher Idee sich die unterschiedlichen Ökonomien ausrichten. Wir kennen im Ansatz bereits die Orientierung der politischen Ökonomie, die sich teleologisch orientiert am Gemeinwohl. Wir kennen die Idee der klassischen Ökonomik, die sich am Ideal einer objektiven Wissenschaft ausrichtet und zur Wirtschaft zählt, was sie beobachten, messen und mathematisch modellieren kann. Das mathematische Modell ist dabei keineswegs so sicher, dass es ohne eine Idee, die am Gemeinwohl oder an der sozialen Ausgewogenheit ausgerichtet ist, nicht schwungvoll an der Realität seiner Sachverhalte vorbeitanzen würde. Das geht besonders in der Marginalisierung externer Faktoren in der traditionellen Ökonomie wie etwa Ökologie, das Bedürfnis nach gesunder Ernährung, neuen Formen der Arbeit und der Bereich der transnationalen Geldströme und Kooperationen, um nur ein paar Beispiele zu nennen.
Wer erinnert sich heute noch an Johann Heinrich von Thünen?1 Wohl kaum jemand mehr. Was nicht verwundert aus der sogenannten rechten Szene, aber dass er auch bei der linken vergessen wurde, verwundert doch einigermaßen, war er doch einer der ersten, der den Manchester-Kapitalismus vehement ablehnte, seine Mitarbeiter am erwirtschafteten Gewinn beteiligte und, ohne gleich der sozialistischen Bewegung geistig beizutreten, deren Grundfragen in die Ökonomik trug. Seine Idee: Gewinnbeteiligung der Mitarbeiter und Zusicherung eines Rentenauskommens. Das war damals mehr als ambitioniert und antwortet auf die schreiende Ungerechtigkeit der frühen Industrialisierung gegenüber den Arbeitern, auch der Kinderarbeit, und der Armut, die damals selbst bei Vollbeschäftigung herrschte.
Von Thünen war ein Gutsherr, ein Patriarch und trotzdem seinen Arbeitern gegenüber wohlgesonnen; das gab es selten. So beschäftigte er sich mit Frage nach einem gerechten Lohn, dem Existenzminimum und der regionalen Wirtschaft. Er Kritisierte den Zusammenhang von Angebot und Nachfrage auf deArbeitsmarkt bei der Ermittlung des Lohns und sah sehr klar, dass dabei die Fragen, was einem Arbeiter zustand und was er zum Leben brauchte keine Rolle spielte. Weil von Thünen nicht zu den sogenannten Frühsozialisten gehörte, nahmen Sozialdemokraten und Gewerkschaften seine Analysen nicht zur Kenntnis; im Gegenteil. Sie verstiegen sich sogar zu solch abenteuerlichen Grundannahmen der Arbeitsmarkttheorie, dass Gewinnbeteiligungen einen Anreiz schaffen würden für Arbeiter, sich für höhere Gewinne des Unternehmens einzusetzen und sich durch Mehrarbeit aufzureiben, also in eine Form der Selbstausbeutung geraten. Gewinnbeteiligung mit Selbstausbeutung zu beantworten war an kognitiver Verzerrung kaum noch zu überbieten.
Von Thünen nahm gewissermaßen einmal einen Teil der großen Sozialreformen Otto von Bismarcks vorweg wie er heute auch von einigen jungen Ökonomen als Grundlage eines „Raum-Wirtschaftsmodells“ gelesen wird: Think global act local ist deren neues Credo und zielt auf eine nachhaltige Landwirtschaft zuerst und dann auf dezentrale, lokale resp. zonale Wirtschaftsmodelle.2 Mit von Thünen kam ein Gedanke in die Ökonomik der damaligen Zeit, der zumindest als fortschrittlich in Hinsicht auf die Entwicklung einer Sozialen Marktwirtschaft sich erweisen sollte, ohne die Grundlagen-Analysen für eine nachhaltige Wirtschaft dabei zu kurz kommen zu lassen. Von Thünen war einer der wenigen, die den Tanz um das Goldene Vlies bzw. das Goldene Kalb zu stören in der Lage war. So sehr auch die Ökonomik in ihrer Entwicklung sich als mono-kriterial erwiesen hat, vor allem sanktioniert über die angelsächsischen Kanäle der Volks- und Wirtschaftswissenschaften, so ganz ohne die sozialen Kriterien, die sich mit dem reinen ökonomischen Kriterium notwendigerweise mitentwickeln, kommt sie schlussendlich nicht aus.
Übrigens, so kann, so darf man heute sagen, der Tanz ums Goldene Kalb der Ökonomik ist vielleicht nicht ganz ausgetanzt, aber hat zumindest vom beschwingten in einen gemächlicheren Rhythmus gewechselt. Mit mathematischer Modellierung der Kosten-Nutzen-Rechnung allein lassen sich die Prozesse einer modernen Ökonomie nicht mehr beschreiben. Wir werden auch noch eine dritte Ökonomie kennenlernen, die, weil auch sie eine politische Ökonomie ist, bei der aber ganz zentral der politische Einfluss auf das wirtschaftliche Geschehen im Vordergrund steht, von uns Politische Ökonomie genannt wird, groß geschrieben das politische Element darin.
Kommen wir zurück: Arbeit ist nicht ohne sein relatives Aggregat, das Kapital. Wenn wir also in diesem Band über Arbeit handeln, dann geht das nicht, ohne die Arbeit selbst sowie deren materiellen Bedingungen zu betrachten; Arbeit und Kapital gehören zusammen in der Betrachtung. Ist es so, wie Marx dachte, Arbeit allein ist die wirkliche Produktivkraft? Sie ist es, so Marx, die Werte produziert und indem sie Tauschwerte produziert, produziert sie zugleich auch den Wert, den das Kapital abschöpft zu seinem wachsenden Reichtum, den Mehrwert; ist das wirklich so? Es gibt andere Bestimmungen der Wertschöpfung im Wirtschaftsprozess, bei dem die Technik bzw. die technologische Entwicklung eine entscheidende Rolle spielt, andere, die dem Geld diese Rolle zuschreiben, was stimmt daran wiederum, was nicht? Und wenn Geld eine Rolle spielt, wenn, wie der Volksmund sagt, Geld arbeitet, welche Bedeutung haben dann die Zinsen?
Eines scheint doch allgemein bestätigt, Geld trägt neben anderen Funktionen das Leistungsprinzip. Vor allem über die Entlohnung der Arbeitsleistungen findet das Leistungsprinzip als solches seine Fundierung. Es gilt: wer mehr leistet, bekommt mehr Lohn bzw. Gehalt und schlussendlich auch mehr Rente bzw. Pension. Das Leistungsprinzip, wie wir es kennen, ist ein Individualprinzip, das zudem Verfassungsrang hat. Mit diesem Individualprinzip, dass alle Leistung letztlich nur mir nützt, wenn es meine Leistung ist, die von jemandem gewollt, gesehen und vergütet wird, sind dann zugleich andere Formen von Arbeit wie etwa kooperative und kollektive Formen, Formen nicht individueller Erwerbsarbeit suspendiert? Nicht jeder Mensch arbeitet in Erwerbsverhältnissen, was ist dann mit diesen Menschen, mit deren Leistung? Wer trägt also zum Gemeinwohl bei, stimmt es, dass unsere Sozialsysteme fast ausschließlich über die Arbeitnehmer und Arbeitgeberanteile am Erwerbslohn gesichert werden? Wenn dies zutrifft, dann ist die Entwicklung unserer Sozialsysteme direkt abhängig von den Steigerungen von Löhnen und Gehälter, wenn der Arbeitgeberanteil fix bleibt wie zurzeit.
Wir folgen sehr detailliert dem Thema Zinsen in zweierlei Hinsicht. Einmal interessieren uns die Zinsen in Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung, zum anderen in Hinsicht auf die Vermögen. Wir alle wissen, ein Schloss am Rhein wirft keine Zinsen ab, im Gegenteil. Und so ist es auch mit einem privat genutzten 300 PS Boliden oder den vier Designer-Fahrrädern in der Familie, den Smartphones und TV-Kisten. Wenn Zinsen also gewissermaßen die Arbeitserträge des Geldes sind, wie kommt dann Geld an die Arbeit? Und wenn Geld etwas durch Arbeit verdient, wo, für wen arbeitet es dann? Dass aus Geld Vermögen werden kann, ist bekannt; wirklich? Bis heute gilt im Volksbewusstsein, dass Geld sparen oder Geld nicht ausgeben, ein nettes Wort für Geiz, Vermögen schafft. Dann müssten alle Schotten reich sein. Und alle Sparer. Aber wie wir gerade erkenn müssen, Sparen bringt den Sparern zurzeit wenig, eher verliert man Vermögen durch Sparen. Dies gilt so für den privaten Sparer wie auch für alle anderen, die etwa Bundesanleihen zeichnen. Warum in der Hölle sparen dann die Menschen, warum zeichnen Großanleger und Banken Anleihen, um am Ende für an den Staat geliehenes Geld sogar noch etwas draufzuzahlen? Sind die alle verrückt geworden?
Die Relation Zinsen – Geld und Vermögen ist ein spannendes Kapitel auch in Hinsicht auf die Entwicklung der Sozialsysteme oder wie wir es kurz nach dem Titel des Hauptwerkes von Adam Smith nennen: die gesellschaftliche Wohlfahrt. Weder bei der Betrachtung der Entwicklung der Aggregate Arbeit und Kapital wie auch bei der Betrachtung der Wohlfahrtsentwicklung kommen wir umhin, uns mit den Methoden zu beschäftigen, wie die Ökonomie und die Ökonomik dieses Entwicklungen berechnen, wobei natürlich die Ökonomik im Vordergrund steht, weil sie es ist, die das Primat der wissenschaftlichen Berechenbarkeit von wirtschaftlichen wie auch von sozialwirtschaftlichen Entwicklungen explizit behauptet und vorführt. Schon Marx hat mit dem Begriff vom tendenziellen Fall der Profitrate eine Betrachtung angestrengt, die nachzuweisen versuchte, dass die Ermittlung der makroökonomischen wie auch der sozialökonomischen Veränderungen, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR) genannt, ganz wesentlich mit der Differenz der Produktionsfaktoren zu tun hat. Marx war der Auffassung, die er mit einigen einfachen mathematischen Formeln zu belegen versuchte, dass die Steigerung der Arbeitsproduktivität oder des Outputs per Arbeiter zu einer tendenziell zunehmenden Rate von Kapital zur Arbeit führt, dass also immer mehr Kapital dem Arbeitsprozess oder dem Prozess der Wertschöpfung zugeführt muss, um das gleiche Ergebnis in der Zeit zu erreichen bzw. Wachstum zu erzielen. Wir werden diesem „Fall der Profitrate“ kritisch nachspüren und jene Ausprägungen der Wirtschaftsformen nachzeichnen, für die dies galt oder immer noch gilt.
Wir betrachten also sowohl die Denkmuster der Ökonomik wie die Entwicklungsprozesse der westlichen Industriegesellschaften und blicken auch auf asiatische Modelle, vornehmlich das japanische und chinesische Modell der Wirtschaft. Wirtschaftsmodelle zu analysieren und zu vergleichen, geht natürlich nicht, ohne diese Wirtschaftsmodelle unter einen komplexeren Horizont zu stellen, den jeweiligen Auffassungen von gesellschaftlicher Wohlfahrt durch wirtschaftliche Praxis; wir lassen dabei die politischen und sozialen wie kulturellen Faktoren zwar nicht ganz außen vor, sehen sie aber in diesem und im nächsten Band III noch nicht als Zentralperspektive. Was für uns zentral steht ist die Wertschöpfung und der darin begründete Diskurs über den gesamtgesellschaftlichen Wohlstand und die entsprechende Wohlfahrt einer Nation, die also in der Behauptung gründet, Wohlstand und Wohlfahrt seien direkt und ursächlich Ergebnisse der Ökonomie einer Nation und die in den wissenschaftlichen Modellen der Ökonomik des 20. Jahrhunderts zu beweisen versucht wurde.
In allem, was wir betrachten, liegt wie eingangs gesagt, auch immer die Frage, ob die Veränderungen im Gegenstand der Betrachtung evolutionäre Formen von Veränderungen sind, oder ob Veränderungen neue Formen wirtschaftlichen Handelns ausbilden, wofür wir den Begriff der Transformation einsetzen. Schnell, fast schon inflationär wird heute von Disruptionen gesprochen, was zunächst einmal ‚nur‘ so viel wie Unterbrechung, Störung, Bruch, Unordnung oder Zerstörung bedeutet und wirtschaftsimmanent traditionelle Geschäftsmodelle adressiert. Aber damit ist ja nicht genug, voller Euphorie spricht die kritische Intelligenz nun schon fast seit einem Jahrzehnt von Disruption und sieht darin, um dies hier einmal ganz und gar ideologisch zu formulieren, den Kapitalismus in seinen bekannten Formen hinweggefegt, revolutioniert. Diese vorschnell revolutionären Auffassungen, die sich seit der sog. New Oeconomy Phase Anfang des neuen Jahrtausends bis heute ausgebreitet haben, kranken alle daran, dass sie Revolutionen in der Wirtschaft entdecken, wo sie nicht sind. Anders gesagt, die Kritik am Kapitalismus irrt sich hinsichtlich der revolutionären Kräfte bereits darin, was sie vom Kapitalismus versteht bzw. verstanden wissen will, und das ist so gut wie gar nichts. Die Kritik basiert also nicht auf Wissen, sondern auf Auffassungen, die das hypostasieren, was sie meinen vom Gegenstand verstanden zu haben.
Eine Art der vermeintlichen Revolution der bestehenden Form der Ökonomie verbindet sich mit den Auffassungen zur ökologischen Erneuerung des Kapitalismus. Sie geht davon aus, dass wir Menschen zurzeit dabei sind, durch unser hemmungsloses Gewinnstreben, durch Profitmaximierung vor allem sowohl die Natur wie die Kultur der Menschheit zu zerstören und nur eine ökologische Revolution könnte beide, Natur und Kultur retten. Auch hier sehen wir die gängige Logik, die behauptet, alles hat seine Ursache in der Wirtschaft. Nun kann man aber durchaus denken, dass die Menschheit durch eine ökologische Form der Produktion und Distribution in Form von Kreislaufwirtschaften die Natur zu retten in der Lage ist – jedenfalls ist es scheinbar bis heute noch denkbar – die Kultur dabei aber trotzdem vor die Hunde geht. Was also wäre gewonnen? Zumindest die Einsicht, dass das logisch hinreichende Bindeglied zwischen Natur und Kultur so nicht hält, dass es keine einfache Kausalbeziehung gibt zwischen der Wirtschaft und unseren natürlichen wie kulturellen Entwicklungen. Aber das wäre uns zu wenig. Wir möchten genauer hinschauen und jene dynamischen Elemente finden, die eine Wirtschaft in neue Formen transformieren, im Gegensatz zu bloßen Optimierungsprozessen, die sicherlich auch wichtig und bedeutend sind. Und bevor wir den doch recht großen Mangel an Verständnis wirtschaftlicher Vorgänge nicht besser verstanden haben, wie wollen wir dann Transformation verstehen oder gar revolutionäre Prozesse, Ansatzpunkte einer umfassenden Veränderung und Neuformierung der Wirtschaft benennen können?
In diesem und im nächsten Band der Philosophie des menschlichen Daseins geht es also nicht um Revolution, um eine neue Idee der Reproduktion des menschlichen Daseins in wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Hinsicht, sondern um ein besseres Verständnis von dem, wie wir als westliche Industriegesellschaften gearbeitet haben und heute arbeiten, wie wir diese Formen der Arbeit bis in unsere heutigen Formen von Marktwirtschaften in den USA, in Europa und in Asien transformiert haben, wo Transformation sich von Optimierung unterscheiden und wo Einlassstellen sich finden lassen, für neue Ideen gesellschaftlicher Veränderung. Disruption jedenfalls, so viel sei hier bereits vorausgesagt, trägt keine Umwälzungen, die unsere Wirtschaftssysteme so sehr und im Kern in Frage stellen, dass neue, bessere entstehen können. Einfach allein schon deshalb, weil Disruption ein Prozess ist, bei dem ein bestehendes Geschäftsmodell oder ein gesamter Markt durch eine stark wachsende Innovation abgelöst beziehungsweise „zerschlagen“ wird und weil dieser Prozess also nicht durch eine neue Idee geleitet wird, eine Idee, die das Sein des Nichtseins vorstellt und Hinweise gibt, wie vom Nichtsein zum Sein zu kommen ist. Eine neue Idee, die den Kritiken der Marktwirtschaft Rechnung trägt, muss natürlich zuerst einmal feststellen, ob und inwieweit diese Kritiken berechtigt sind, um sich dann von diesen positiv unterscheiden zu können. Neue Geschäftsmodelle, neue Märkte sind noch nicht ausreichend, um daraus neue Ideen zu entwickeln, die eine gesamte Wirtschaftsordnung verändern soll.
So zeichnen wir nicht nur den Weg nach, den die Marktwirtschaft eingeschlagen hat, sondern prüfen dabei auch, ob auf diesem Weg Abbiegungen in eine andere Richtung sichtbar sind. Seit mittlerweile mehr als fünfzig Jahren ist sich dabei die Kritik - wie eben gesagt - einig, dass das Gewinnstreben beendet werden muss, um einen Ausweg zu finden. Deshalb behandeln wir die Themen Eigentum und Vermögen besonders gründlich und deren Einfluss auf die Wirtschaft und die Wohlfahrt. Damit steht auch in Zusammenhang die Frage nach dem Eigennutzen, seiner Berechtigung und Legitimität, die von den gleichen Kritikern grundlegend verneint wird und am Begriff des Homo oeconomicus exemplarisch als Inbegriff des Nutzenprinzips im Sinne des maximalen Eigennutzens zur Sprache bringen. Aber ist der Homo oeconomicus wirklich dieser garstige Egoist, der in allem, was er denkt und macht und in Interaktion beabsichtig bzw. entscheidet, diesem Prinzip folgt? Das Thema Eigentum in Verbindung mit dem Thema Nutzen beschäftigt uns also von Beginn an explizit oder implizit und mit diesen Themen endet auch dieser zweite Band.
Kapitel 1: An die Arbeit
In den siebziger Jahren wohnten zwei ältere Damen in der Wohnung über mir, sozialer Wohnungsbau, ein Zimmer, kleine Küche mit Sitzbadewanne, Diele mit Kleiderschrank, Bad mit abwaschbarer Ölfarbe gestrichen, die große Ölfarb-Nasen über der ganzen Fläche verteilt, Gasheizung, kleiner Balkon, also schon recht ordentlich ausgestattet und zum Preis von 80,- DM/Monat für insgesamt 18 qm; das waren damals günstige 4,50 DM/qm, aber Stadtmitte Düsseldorf, nur etwa 150 Meter bis zur Oststraße, wo die ersten Cafés sich befanden, dahinter die großen Kaufhäuser und zwischendrin einige Tante Emma Läden.
Freitags ab 15.00h sah man die beiden Damen dann im Nerzimitat das Haus verlassen, um ins Café zu gehen, wo sie dann bei einer Tasse echten Kaffee, manchmal ein Stück Kuchen, zwei bis drei Stunden verbrachten. Sie waren Kriegerwitwen, so nannte man damals solche Frauen aus der Perspektive des Patriarchats, hatten ihre Söhne und die Ehemänner im Krieg an den Hitler-Wahnsinn verloren, aber auch schon ein Großvater war im Ersten Weltkrieg im Feld geblieben und eine Enkelin starb früh an den Masern, als es ganz schlimm kam, 1917/18.
Die beiden Damen sprachen immer vom Krieg und vom Ersten Weltkrieg, so als sei dieser nur ein kleiner Vorläufer des großen, des Krieges eben gewesen. Und das war er ja auch. Jedenfalls für die, die nicht in Ypern oder in den Gräben von Verdun verreckt sind. Für die beiden Nachbarinnen von mir war dieser Weg ins Café viel mehr als ein freitägliches Ritual mit Kaffee und Kuchen, wie es ab dem Ende der sechziger, spätesten ab den siebziger Jahren im Wirtschaftswunderzeitalter üblich wurde. Für die beiden war es Teilhabe, Teilhabe an einem Leben, das sie sich so sehr gewünscht hatten, das nun aber zu einer doch sehr eingeschränkten Wunscherfüllung geworden war. Vor allem, weil die Witwenrente, die es damals gab, zwei Tassen Kaffee oder zwei Café-Besuche die Woche nicht hergab.
Sie klagten nicht, fiel mir auf. Sie sprachen viel über ihre Männer, über die Zeit als der Krieg noch nicht war und von den Träumen, die die Zwanziger Jahre in Berlin, wo sie geheiratet und lange gewohnt und ihre Männer, Söhne und Verwandten gearbeitet haben, bei ihnen hinterlassen hatten. Ausgehen, im Mittelpunkt stehen, jedenfalls sich das vorzustellen, dass alle, nun gut, viele Augen auf sie gerichtet, auf Hut und Pelzmantel, manche ein wenig verrucht mit einer Stola und einem falschen Leberfleck à la Marie Antoinette; ach; wenn der verdammte Krieg, gegen den sie immer gewesen waren, doch nicht dazwischen gekommen wäre …3
Für die politische Ökonomie4 sind diese beiden ehrbaren, respektablen und sozial wertvollen alten Damen kein „Gegenstand“ ihrer Betrachtung. Einzusehen, warum das so ist, fällt schwer, verrichten heute die meisten älteren Damen doch einerseits wichtige Aufgaben bei der Betreuung der Enkel, damit die Eltern, meist Doppelverdiener, ihren Arbeiten nachgehen können. Und auch als Konsumentinnen werden die älteren Damen zunehmend wichtiger und volksökonomisch wertvoller. Hatte man früher gerne als Kernzielgruppe der Volksökonomie die Menschen bis zum Alter von 59 Jahren mit Ach und Krach gezählt, 49 Jahre hatten besser gepasst für die ökonomischen Berechnungsverfahren, so spricht man heute hinter kaum mehr vorgehaltener Hand vom „best ager“5 und versteht darunter eine Zielgruppe von Personen mit einem Lebensalter von über 50 Jahren. Unklar ist und bleibt bei vielen die mit den best ager fast inflationär genannten Begriffe, ob die Zeit der „besten Jahre“ erst mit dem Tod oder bereits weit vorher endet. Wobei es der Ökonomie ja nicht um das Dasein der benannten Menschen geht, sondern um die Frage, wann ein Mensch den Geltungsbereich der ökonomischen Betrachtung verlässt?
Mit zunehmender Lebenserwartung und Gesundheit mancher westlicher Populationen hat sich nicht einfach nur die verfügbare Zeit des einzelnen Menschen als Wertschöpfungskategorie und als Konsumptionskategorie verlängert, was für die Wissenschaft der Ökonomie kein großes Problem darstellt. Aber mit beiden einher geht etwas, was für den ehrbaren Ökonom dem wahren Grauen schon recht nahekommt, der ökonomisch nicht festgestellte Mensch. Nach Nietzsche passt der nicht-festgestellte Mensch einfach in keine Schublade, schon gar nicht in die ökonomische. Aber ist das wirklich ein erwähnenswertes Problem für die Ökonomie? Insofern sie als eine, an den Naturwissenschaften orientierte Einzelwissenschaft verstanden wird, eher kaum. Denn alle solche Einzelwissenschaften abstrahieren fokussiert auf ihren Gegenstand hin und dürfen sich sonnen in der verhältnismäßigen Zutreffentheit und Richtigkeit ihrer Methoden und Aussagen, solange diese nicht widerlegt und jene nicht als unzuverlässig und unsauber im wissenschaftlichen Sinne kritisiert worden sind. Aber als eine Wissenschaft, die sowohl sozial und politisch so enormen Einfluss auf das Dasein des Menschen hat wie die Ökonomik müssen die Grenzen natürlich viel enger gezogen werden. Ökonomie und Ökonomik tragen Verantwortung. Oder etwa nicht?
Ein Wort noch zur Geschichte: Es war im Jahr 2002 der Jurist und spätere Hamburger Bürgermeister und jetzige Bundeskanzler Olaf Scholz, der maßgeblich verantwortlich war für die Umsetzung der berühmt-berüchtigten Harz-IV-Gesetze des damaligen Kanzlers Gerhard Schröder. Damals als Generalsekretär der SPD in Amt führte Scholz den Begriff der „Scheinselbstständigkeit“ ein, typisch für einen Juristen. Was zuvor abhängig Beschäftigte, also Erwerbstätige ohne Angestellte, waren wie etwa Brief- oder Paketzusteller, Fahrer usw. die man in die Selbstständigkeit genötigt hatte aus offensichtlichen Gründen der Wirtschaftlichkeit und Eigenverantwortlichkeit, wurde nun auf die sogenannten Ich-AGs, auf die riesige Summe an Einzelkämpfern, die Aufträge von Firmen übernahmen, übertragen.6
Sie gerieten mit der juristischen Feinsinnerei des schlauen Olaf nun in den Generalverdacht, ihre Selbstständigkeit nur vorzutäuschen und doch faktisch weisungsgebunden zu arbeiten und als Solo-Selbständige von staatlichen Wohltaten zu profitieren, die nur wirklichen Kaufleuten mit Angestellten zugutekamen. Um die unverantwortlich Ungerechtigkeit solcher juristischer Spitzfindigkeiten an der kurz Leine zu belassen wollen wir darauf fokussieren, was hier eigentlich zur Disposition stand und in die Fänge der Sozialdemokraten geriet, das Misstrauen gegen jeder Form der Selbstorganisation der Arbeit. Dieses Misstrauen wurde wieder Grundlage der Politik und alle jene Menschen in Arbeit, die außerhalb der Normalorganisation Werte schufen. Sie wurden als unsolidarisch, als paralegale Nutznießer abgestempelt bis hin ins Verdikt der „Selbstausbeutung“ stigmatisiert. SPD und CDU fanden das richtig.
Selbstständige im Sinne einer Ich-AG und Freiberufler generell sind überwiegend klassische Vertreter einer modernen Wissensgesellschaft und meistens darin Spezialisten, ob Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Programmierer oder Designer, sie alle können Personengesellschaften ohne Angestellte sein, oft aber in weitverzweigten Kooperationen mit wiederum anderen Spezialisten zusammenarbeiten. In der Regel können sie das, was sie arbeiten, besser als ihre Vorgesetzten, weshalb ihr Weg in die Selbständigkeit vorgezeichnet ist; viel zu wenige gehen diesen Weg, auch, weil die politische Situation nicht gerade förderlich ist.
Spezialisten sind Spezialisten der Arbeitsteilung. Sie wissen aus eigener Erfahrung, dass es besser ist, nicht alles selber zu machen; im Gegenteil. Sie sind es gewohnt, in Prozessen der Arbeitsteilung zu denken und für jeden Job oder auch für jeden Arbeitsschritt die fähigsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu engagieren, mit solchen zusammenzuarbeiten. Sie sind somit auch im Management hoch talentiert. Eine Industriegesellschaft wie unsere schafft tagtäglich neue Spezialisten durch ihre arbeitsteiligen Prozesse und braucht zu deren Management nicht mehr den universellen „Führer“, sondern zunehmend mehr die Wissensarbeit. Das sind jene Menschen, die die Fähigkeit haben, von den sich verändernden Prozessen etwas zu verstehen, die genau hinsehen und hinhören können und die in realen und sich entwickelnden Netzwerken denken, planen, organisieren und handeln können.
Aber gerade diese Menschen wurden von der Politik in den letzten Jahrzehnten schlichtweg ignoriert. Ihre Arbeitsmittel, Computer und Algorithmen, moderne Kommunikationstechnologien und virtuelle Projektionen hielten in der BRD Dauerschlaf. Während Olaf Scholz mit der Ausgestaltung und Umsetzung von Harz-IV-Gesetzen den Status Quo einer industriellen Tradition festzurrte, wiesen Menschen wie der US-Soziologe Daniel Bell7 und der niederländische Soziologe Hans Adriaansens8 auf die Anforderungen der „postindustriellen Gesellschaft“ hin. Die Zunahme bei den selbstständigen Berufen, von Expertinnen und Experten, Dienstleistern, Beratern, Fachleuten und Projektleitern veränderten bereits vor vielen Jahren schon die Art, wie wir arbeiten und machten auch eine neue Sichtweise auf unsere Sozialsysteme erforderlich. Denn mit der Arbeit in Netzwerken, mit der Zunahme flexibler Arbeitsformen verändern sich auch notwendigerweise diejenigen Systeme, die die soziale Sicherheit tragen. Bis heute (2022) hat es die Politik nicht geschafft, die Sozialsysteme an die modernen Formen der Arbeit anzupassen. Die alte industrielle Arbeits- und Sozialordnung wird eher restauriert als reformiert – in Band VII werden wir dazu eigene Vorstellungen formulieren.
So stellen wir uns im Folgenden einige wesentliche Fragen im Zusammenhang mit der Arbeit. Welche Folgen hat es, wenn Vorgesetzte von dem, worüber sie handeln, wenig bis keine Ahnung haben, aber alle wichtigen Entscheidungen treffen? Und wo ist die alte Organisation geblieben, dass der, der entscheidet, auch die Verantwortung dafür trägt? Wir kommen auch nicht umhin, uns mit Fragen zu beschäftigen, die die alten Lebensentwürfe betreffen und die in dem kulturellen Narrativ, Erzählung gründen, dass je mehr und größere Freiräume in der Arbeitswelt geschaffen werden, das Leben der Menschen unsicherer werde. Dass die meisten Menschen Lebensentwürfe vorziehen, die nicht den Anforderungen einer vernetzten, einer sogar global vernetzten Welt entsprechen und die auf der Grundlage von Selbstorganisation und autonomen Arbeiten basieren.
Selbstständige, und dabei sind nicht nur die Konzernlenker gemeint, die übrigens gar keine Selbstständigen sind, sondern hoch dotierte Angestellte, werden nach wie vor eher als asozial und egoistisch beschrieben, auch, weil gerade die Freiberufler und Solo-Selbstständigen nicht wie alle anderen Erwerbstätigen in die Sozialsysteme einzahlen. Aber können Selbstständige und Unternehmer überhaupt arbeiten, ohne sozial, ohne in Kooperationen zu denken, ohne sich assoziativ zu bewegen und zu begegnen? Sind sie wirklich diese extremen Individualisten, ohne kollektives Bewusstsein und wenn ja, sind sie das ganz und gar, oder nur in bestimmten Situationen, wiederum zum Gemeinwohl ihrer Unternehmen?
Nur zu einem ersten Eindruck, hier ein paar Zahlen (bezogen auf 2019). Es gibt 4 Mio. Selbstständige in der BRD. Das sind 10% an allen Beschäftigten. Sie arbeiten im Durchschnitt 1906 Stunden im Jahr gegenüber 1383 Stunden bei den Erwerbstätigen, also etwa 50% mehr. Die Zahl der Freiberufler hat sich von 0,7 Mio. im Jahr 2000 auf 1,45 Mio. im Jahr 2020 mehr als verdoppelt. Freelancer verdienen durchschnittlich 5900 Euro im Monat, legen davon 998 Euro für die Altersvorsorge zurück. Der Anteil der Solo-Selbstständigen, die so gerade hinkommen mit ihrem Einkommen liegt bei 17%, bei denen mit Angestellten oder Beschäftigten bei 19%. Der Anteil der Freiberufler an allen Selbstständigen in der BRD liegt bei 34%. Der Umsatz (2019) bei 475 Mrd. Euro. Der Anteil der Freiberufler mit Beschäftigten am BIP liegt bei 11%.
In den letzten 50 Jahren hat sich die Bedeutung der einzelnen Wirtschaftssektoren für die Beschäftigung deutlich verschoben. 1970 arbeiteten 8,4 Prozent aller Erwerbstätigen im Bereich Land-/Forstwirtschaft und Fischerei. 2019 waren es nur noch 1,3 Prozent. Auch beim produzierenden Gewerbe halbierte sich der Anteil an allen Erwerbstätigen zwischen 1970 und 2019 von 46,5 auf 24,1 Prozent. Die Bedeutung des Dienstleistungssektors hat sich hingegen erhöht: Der Anteil der im tertiären Sektor Beschäftigten an allen Erwerbstätigen stieg von 45,1 Prozent 1970 auf 74,5 Prozent 2019.9
Verantwortung
Wir müssen zuerst über Verantwortung sprechen, bevor wir in eine kritische Bewertung der Ökonomie in Bezug auf menschliches Dasein10 übergehen können. Verantwortung11 ist in einem grundsätzlichen Sinne der Begriff, der alle weiteren sozialen und politischen Bestimmungen trägt. Ohne eine Bestimmung von Verantwortung im Kontext von Ökonomie ist auch eine ethische, eine sozial-ökonomische Bestimmung einäugig und unbrauchbar.
Der Horizont des Begriffs der Verantwortung in der Ökonomie und mit diesem gleichzeitig der Rekurs auf die Qualität aller Aussagen zur Ökonomie ist fü0r uns zuerst die tiefste Depression, die die Wirtschaft und ganz besonders die Finanzwirtschaft heute seit den 1930er Jahren durchlebt, was zugleich auch die Wirtschaftswissenschaften bzw. den Diskurs innerhalb der Wirtschaftswissenschaften in einen ökonomischen Mainstream und in eine ökonomische Heterodoxie12 zu spalten begonnen hat. Die Spaltung betrifft hauptsächlich die aktuelle Methodendebatte innerhalb der Wirtschaftswissenschaften, geleitet von der Frage: Warum war die Wirtschaftswissenschaft nahezu unvorbereitet in Bezug auf die sog. Finanzkrise ab 2008? Welche Verantwortung trägt die – immerhin regelmäßig bei der Vergabe der Nobelpreise alljährlich hoch dekorierte – volkswirtschaftswissenschaftlich akademische Profession, besonders aus den USA, und welche Konsequenzen sollten bzw. müssten aus dieser Fehlbeurteilung der Finanzkrise innerhalb der Wirtschaftswissenschaften gezogen werden?
Unsere Perspektive dabei bleibt selbstverständlich überwiegend begrifflicher und nicht wissenschaftlich-institutioneller Natur. So betrachten wir auch den Begriff der Verantwortung aus dem philosophischen Horizont der Ethik und der Bewusstseinsphilosophie. Hier liegt Verantwortung in der Autonomie des handelnden Menschen begründet, dort dessen Auswirkungen auf jene Menschen, die von den Handlungen betroffen sind; so jedenfalls zunächst einmal. Nehmen wir nur einmal den Gedanken, der ja auch allenthalben laut ausgesprochen wurde und wird, dass nämlich das Scheitern der sozialistischen Ökonomie mit ihrer grundsätzlichen Ablehnung von Markt und Privateigentum auf die Ökonomik von Karl Marx zurückgeht und also dieser auch in weitreichender Hinsicht eine Verantwortung, mindestens aber eine Mitverantwortung für dieses Scheitern trägt. Demnach gelte auch, dass die moderne Mainstream Wirtschaftswissenschaft13 mit ihrem, überwiegend durch Privateigentum und Marktwettbewerb organisierten, weltwirtschaftlichen Ansatz für die jüngste weltweite Depression und das Desaster innerhalb der Finanzmarktkrise 2008 verantwortlich gemacht werden kann.
Aber ist das so einfach? Wer trägt denn überhaupt Verantwortung? Konzentrieren wir uns zunächst darauf, wer an Handlungen im Rahmen der Wirtschaft14 beteiligt ist. Die Wirtschaft trägt Verantwortung durch die Akteure und für die Akteure, die das wirtschaftliche Handeln vollziehen und die ebenso bei der Organisation von strukturellen wie institutionellen Bedingungen maßgeblich beteiligt sind, auf deren Grundlage wiederum Personen, Personengruppen oder Institutionen im Hinblick auf die Produktion, den Gebrauch oder die Transaktion von Gütern und Dienstleistungen tätig werden. Prima Vista erscheint die Wirtschaft als die Gesamtheit aller Einrichtungen wie Unternehmen, private und öffentliche Haushalte, die im privatrechtlichen Sinne selbstverantwortliche Eigentümer und Handlungsbevollmächtigte sind, deren Eigenschaft als Träger der Verantwortung qua Autonomie ihrer Handlungen bestimmt sind.
Scheinbar Konsens wurde schnell die Erkenntnis, dass niemand, weder aus der Privatwirtschaft wie etwa Banker und Finanzinvestoren, ebenso wenig Politiker als Regulatoren den zeitlichen Eintritt der neueren Finanzkrise vorherzusagen im Stand war. Ebenso wenig die massive Stärke, mit der die Finanzkrise das weltweite Bankensystem erschütterte, in der Folge auch die Privatinvestitionen in der Wirtschaft bedrohte und auch nicht das enorme systemische Risiko, das letztlich bis heute noch im weltweiten Bankensystem herumgeistert und die Märkte verunsichert. Dies alles wäre weniger bedenklich, wäre damit nicht zugleich auch die Erkenntnis verbunden, dass die Wirtschaftswissenschaft als Disziplin der Analytik und Prognostik hier nicht unausgesprochen ein erschütterndes Eingeständnis ihres Versagens bezüglich der internationalen Finanzmärkte abgegeben hätte. Mit Verwunderung musste man feststellen, dass ihr nicht nur die systemischen Risiken der Banken rückblickend unbekannt waren, sondern dass sie gleich das Feld, auf dem es ums Geld, also ums Ganze des Wirtschaftens geht, gleich ganz von der akademischen Agenda gestrichen hatte. Allenfalls als Randnotiz im Stundenplan der akademischen Reflexion fristeten die Finanzmärkte ein geisterhaftes Dasein; ab 2008 wurde der Spuk dann sichtbar im Tageslicht der zusammenbrechenden Finanzmärkte. Bevor man aber daraus die Frage ableiten kann, ob sich daraus eine Mitverantwortung der Wirtschaftswissenschaftler für die Finanzmarktkrise begründen lässt, wollen wir zunächst das Verhältnis von Verantwortung und Wissenschaft eingehender betrachten.
Verantwortung der Wirtschaftswissenschaft
Nach Lohmann15 wird Verantwortung als Zurechnung einer bestimmten, freiwilligen Handlungsweise zu erfassbaren Folgen für den Handelnden und Dritte unter bestimmten Rahmenbedingungen bestimmt. Und er bestimmt weiter, dass Verantwortung generell die Freiwilligkeit der Art und Weise der Handlungsausführung sowie Wahlmöglichkeiten, Bestimmbarkeit der Folgen und die Akzeptanz gewisser Rahmenbedingungen zur Voraussetzung hat. Verantwortung generell, also so sie nicht eingeschränkt ist durch bestimmte Vereinbarungen und Verträge im wirtschaftlichen Kontext, kann als rechtliche oder moralische Haftung verstanden werden, sofern man auf die Folgen der Handlung schaut. Und mithin verbunden mit jeder Haftung sind materielle oder immaterielle Sanktionen.
Lohmann sieht in der Wirtschaftswissenschaft gewissermaßen ein Derivat dieser Begriffsbestimmung und folgert für die Wissenschaft generell, ganz gleich, um welche Wissenschaft zu welcher Zeit es geht, also auch solche Wissenschaften wie etwa die der Atomphysik und der Genetik, dass nur die moralische Verantwortlichkeit hier auf dem Feld der Wissenschaften greift. Dieser Auffassung zugrunde aber liegt die nach wie vor weit verbreitete, aber längst nicht mehr überall im akademischen Betrieb akzeptiert Auffassung von der Nicht-Rekursivität von Wissenschaft als deren Kernbestimmung. Das meint, dass Wissenschaft zuvörderst für die Schaffung von verwertbaren Erkenntnissen verantwortlich sei, in einigen Fällen auch für die daraus sich ergebenden Handlungsempfehlungen, mehr nicht. Ihre Verantwortung gründet somit auf einer ethisch-moralischen Ebene, nicht auf einer zivil- oder gar strafrechtlichen. Teleologisch gesehen erwächst die wissenschaftliche Verantwortung aus dem wissenschaftlichen „Gewissen“ zu einer abschließenden moralischen Selbstverantwortung.
Die eigentliche Verantwortung tragen andere, nämlich die, die als Nutznießer wissenschaftlicher Erkenntnisse und Empfehlungen fungieren. Sie sind die eigentlich Handelnden, die Wissenschaft als Unternehmer und Unternehmen, Politiker, Verbandsfunktionäre und institutionelle wie andere kollektive Akteure bis hin zu den sog. NGOs bis in zu den Landwirten umsetzen. Fast überflüssig schon in diesem Zusammenhang scheint die Erwähnung, dass diese eigentlich Handelnden nun ihrerseits wiederum nicht selten sich bei Gelegenheit auf die Wissenschaft berufen, um von der Verantwortung ihrer darauf gründenden Handlungen ganz bzw. teilweise freigesprochen zu werden.
Verantwortung in den durch die Wirtschaftswissenschaft bedingten Handlungen ist umso relativer, als – auch nicht unter Aspekten des sog. Matilda- bzw. Matthäus-Effekts16 betrachtet – die externen negativen Folgen weder intendiert noch klar erkennbar oder mit hoher Wahrscheinlichkeit zu befürchten waren. Da aber die Wissenschaftsgemeinde eo ipso dazu neigt, die negativen Folgen ihres Handelns selbst wiederum mit wissenschaftlichen Methoden als Einzel- oder Grenzfälle ihrer Annahmen zu deklarieren, kann weder Fahrlässigkeit noch Intention angenommen werden. Wissenschaftliche Kunstfehler führen selten zu moralischer Verantwortung.
Neben der Ideologisierung der „freien“, nicht-rekursiven Wissenschaft steht die Verantwortung wissenschaftlicher Lehre auch noch unter einem anderen Horizont, den akademischen Rahmenbedingungen. Besonders in der Wirtschaftswissenschaft sind die akademischen Meriten, die die Legitimität der Forschung und Lehre wie die fachwissenschaftliche Reputation gleichermaßen ausbilden, auf deren Basis dann Stellenvergabe und Karriere aufsetzen, ganz maßgeblich von der Einhaltung von akademisch-methodischen und pragmatischen „Spielregeln“ der Wissenschaftsgemeinschaft abhängig. Forschung, Lehre und Beratung bzw. Expertise gehen gerade hier einen fast marktoptimiert zu nennenden Weg. Methodenausbildung, Mitarbeiter-, Doktoranden-Iteration auf die gesetzten Prozesse und Wissenschaftsziele und Drittmitteleinwerbung hin sowie Publikation in ausschließlich fachwissenschaftlich anerkannten Fachmedien spielen hier ebenso eine nicht unwichtige, alltägliche Praxis wie die Fokussierung auf Mittelzuweisen im Rahmen von staatlichen und privaten Exzellenzstrategien, die Erringung einer Listenkompetenz für akademische und/oder Berufungen als Gutachter, Berater oder Business Consultants. Dies alles ist schon in der sog. Formationsphase von Bedeutung wie förderhin im gesamten akademischen Karriereprozess bei der Erreichung leistungsbemessender Verdienstchancen wie auch außerhalb der Science Community in der Erwirkung externer Verdienstchancen. Mainstream innerhalb der akademischen Normalwissenschaft bildet so den methodisch-pragmatischen Horizont wissenschaftlichen Handelns, den der7die einzelne Wissenschaftler/Wissenschaftlerin durch sein Mit-Sein mit verantwortet. Pierre Bourdieu (2005) spricht in diesem Kontext von einem Bestand an ‚kulturellem Kapital’, in das jeder Wissenschaftler sowohl einzahlt als auch davon profitiert. Im Rückgriff auf unser Kapitel zur Macht (Bd. 1/6) geht es u. E. in diesem Kontext nicht um verborgene Mechanismen der Macht. Wir kommen aber gleich auf die Ebene politischer Macht, wie sie im Wissenschaftsbetrieb mehr oder weniger subtil ihre finanzmarktpolitischen Interessen durchsetzt und sich hinter der Wirtschaftswissenschaft geschickt versteckt zu sprechen.
Verantwortung zwischen Wissenschaft und Politik
Die Wissenschaft, hier also Vertreter der sog. Mainstream-Ökonomik, erklären wie übrigens auch der hoch geachtete deutsche Sachverständigenrat17 die Finanzkrise aus dem Jahre 2008 hauptsächlich als Versagen eines Teils des Immobilienmarktes, des sog. Subprime-Segments. Wesentliche Verantwortliche sieht man in beiden Quellen, in den Bankern und Wallstreet-Akteuren, die zum einen hoch riskante Kreditvergaben an niedrig rangierende, meistens private Schuldner vergeben haben, wobei darunter selbst Busfahrer und gerade entlassene Häftlinge waren, teilweise ohne Versicherungskarten. Und zum anderen in den Folgen einer drastischen Verteuerung der kurzfristigen Refinanzierung jener Subprime18 Kreditpakete, die ab 2007 einige Banken von der Illiquidität in die Insolvenz führte. Da die Refinanzierung nach dem Preisverfall auf dem US-Immobilienmarkt durch private Geschäftsbanken zunehmend unsicherer wurde, mussten diese nun ihrerseits hohe Wertberichtigungen in ihren Bankbilanzen vornehmen. Dieser Kapitalverlust schränkte gleichzeitig auch die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung der Kreditvergabe so sehr ein, dass dieser De-Leverage Effekt19 nun umfassend auf den gesamten Bankenbereich der USA und darüber hinaus um sich griff, spätestens sichtbar mit dem Datum des Zusammenbruchs der Lehmann Brothers Investment Bank.
Der Rolling-Stone-Effekt traf sowohl den privaten Immobilienmarkt wie den gesamten Interbanken-Bereich. Die privaten Schuldner konnten ihre Schuldendienste nicht mehr bedienen, da sie ihrerseits, wie üblich in Amerika, selbst wiederum auf ihre Hypotheken weitere Schuldzusagen eingegangen waren und in einen Dominoeffekt privater Insolvenzen gerieten. Der enorme Vertrauensverlust unter den Privatbanken führte zu einem Zustand, der die Interbanken-Kreditvergabe fast gänzlich zum Erliegen brachte und der, ohne sofortiges, massives Eingreifen der US-Fed und anderer, asiatischer wie Europäischer Zentralbanken, wohl zu einem weltweiten Kollaps im internationalen Finanzsystem geführt hätte.
Heute, fast neun Jahre (2016) nach der Lehman-Pleite, erhöht die US-Fed langsam die Kosten für die Refinanzierung der Banken- und Interbanken-Kredite; in Europa ist aufgrund der toxischen Situation besonders der Banken in Italien, Griechenland, Frankreich und Spanien eine Änderung der EZB-Politik noch nicht in Sicht. Die Auswirkungen dieser Finanzkrise, die im Kern vielfältig sind, angefangen von einem enormen Vertrauensverlust von Unternehmen und Privatpersonen gegenüber Banken, einem gewaltigen Vermögensverlust im privaten Sektor, vor allem was Versicherungs- bzw. Sicherungsprodukte, aber auch Anleihen und Aktienpakete betrifft, eine knirschende Kreditklemme aus einmal Risikoaversion bei Banken wie auch gegenüber innovativen Geschäftsmodellen, besonders auf den modernen Technologiemärkten und eine Reihe anderer Auswirkungen haben zu einem jahrelangen Ausfall an Investitions- und Konsumnachfragen geführt. Die Bereitschaft zum Konsum, die heute leicht wieder ansteigt, zeichnet aber keineswegs das Bild einer Erholung auf den Märkten, sondern kann auch als ein toxisches Symptom betrachtet werden, als halb-verzweifelter Konsum-Hype aufgrund der miserablen Zinssituation im Bereich privater Spareinlagen und anderer privater Vermögensmodelle. Wie dem auch sei, die Finanzkrise ist damit spätestens bei den Konsumenten und somit in der alltäglichen Lebensplanung angekommen.
Nicht nur in den USA, aber ganz besonders in Europa stellen wir also fest, dass gigantische Stabilisierungsmaßnahmen der Notenbanken mit immer neuen und größeren „Rettungsschirmen“ die gewünschten Effekte auf den Finanzmärkten und in der Realwirtschaft nicht bzw. kaum signifikant hervorgebracht haben. Betrachten wir dazu noch die nun hinterlassenen, riesigen Verschuldungssummen und -Grade der meisten westlichen Volkswirtschaften, die sich mehr oder weniger schnell auf die „japanische“ Situation zubewegen, dann drängt sich doch die Überlegung auf, ob wir es hier wirklich mit einem separierten Marktgeschehen zu tun haben, zumal gerade die Finanzmärkte, im Gegensatz zur landläufigen und von der Politik ubiquitär unterstützten Meinung, zu den am strengsten regulierten Märkten gehören und nicht von „Heuschrecken“ des Finanzkapitals wie von Wallstreet-Hasardeuren in die Finanzkrise getrieben worden sind.
So sehr auch Politik, Mainstream-Ökonomik und größte Teile der Presselandschaft dieser Erklärung der Finanzkrise bis heute Vorrang geben, steht aber schon seit langen, jedenfalls zeitlich schon länger andauernd als die Finanzkrise selbst, die Auffassung bei heterodoxen Ökonomen im Raum, dass es sich bei der Finanzkrise um eine Äußerung einer tieferen, nämlich systemischen Krise der Marktwirtschaft20 handelt. Dies schließt natürlich nicht aus, dass wir es im Fall der Finanzkrise nicht auch mit einem Versagen auf dem Finanzmarkt zu tun haben. Das Versagen betrifft vor allem eine grandiose Fehleinschätzung der Risiken auf dem Immobiliensektor und seinen angeschlossenen Finanzierungs- und Refinanzierungsinstrumenten, letztlich auf die globalen Prozesse im Interbanken-Handel.
Gleichwohl die internationalen Finanzmärkte