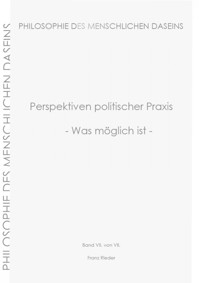Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Band V: Digitalisierung, betrachtet den digitalen Wandel in den neuen Feldern der politischen Ökonomie, vor allem auf dem Feld der Geldpolitik. Hieraus ergeben sich Veränderungen auf allen Feldern der Ökonomie, und zwar in globaler Hinsicht. Mit der Einführung von Digitalgeld und der sukzessiven Abschaffung des Bargelds gewinnt die Geldpolitik immense Spielräume, die etwa das fünf- bis sechsfache dessen ausmachen, womit sie bis dato umzugehen in der Lage ist. Geld- und Fiskalpolitik werden so in absehbarer Zukunft kaum noch etwas damit zu tun haben, was wir bislang davon kennengelernt haben. Für die Wirtschaft und die Wissenschaft der Ökonomie hat das weitreichende Konsequenzen. Die Wirtschaft wird sich darauf einstellen müssen, dass sie zunehmend weniger in marktwirtschaftlichen Zusammenhängen operiert. Die Wissenschaft darf sich darauf einstellen, dass damit auch fast alle ökonomischen Kategorien ihre wissenschaftliche Relevanz verlieren. Digitalisierung beschäftigt uns auch im Zusammenhang mit den neuen Kryptowährungen und natürlich auch im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz, beides neue Technologien, die unser Leben mehr verändern, als dies Technik vorher jemals konnte. Sie verändert unsere Art zu arbeiten, unser Freizeitverhalten, unsere Bildung und auch unser Bewusstsein, und nicht zuletzt unseren Umgang miteinander grundlegend. Wie solche grundlegenden Veränderungen in die Welt kommen, darum geht es in diesem Band. Die sozialen, kulturellen und zwischen-menschlichen Auswirkungen der neuen Geldpolitik und der neuen Technologien in Hinblick auf die Lebensgrundlagen und Lebensverhältnisse, in denen das menschliche Dasein sich entfaltet, wird uns in einem Band VI. dann beschäftigen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1193
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Philosophie des menschlichen Daseins – Band 5 von sieben Bänden.
Erstmals veröffentlicht 2021 im Selbstverlag.
Copyright © 2025 der deutschsprachigen Ausgabe 2025 durch
Franz Rieder, Nievenheimer Str. 17, 40221 Düsseldorf
E-Mail: [email protected]
Herstellung:
epubli - ein Service der neopubli GmbH, Köpenicker Straße 154a,
10997 Berlin
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung:
Vorwort
Band V: Digitalisierung. Dieser Band betrachtet den digitalen Wandel in den neuen Feldern der politischen Ökonomie, vor allem auf dem Feld der Geldpolitik. Hieraus ergeben sich Veränderungen auf allen Feldern der Ökonomie, und zwar in globaler Hinsicht. Mit der Einführung von Digitalgeld und der sukzessiven Abschaffung des Bargelds gewinnt die Geldpolitik immense Spielräume, die etwa das fünf- bis sechsfache dessen ausmachen, womit sie bis dato umzugehen in der Lage ist. Geld- und Fiskalpolitik werden so in absehbarer Zukunft kaum noch etwas damit zu tun haben, was wir bislang davon kennengelernt haben. Für die Wirtschaft und die Wissenschaft der Ökonomie hat das weitreichende Konsequenzen. Die Wirtschaft wird sich darauf einstellen müssen, dass sie zunehmend weniger in marktwirtschaftlichen Zusammenhängen operiert. Die Wissenschaft darf sich darauf einstellen, dass damit auch fast alle ökonomischen Kategorien ihre wissenschaftliche Relevanz verlieren. Digitalisierung beschäftigt uns auch im Zusammenhang mit den neuen Kryptowährungen und natürlich auch im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz, beides neue Technologien, die unser Leben mehr verändern, als dies Technik vorher jemals konnte. Sie verändert unsere Art zu arbeiten, unser Freizeitverhalten, unsere Bildung und auch unser Bewusstsein, und nicht zuletzt unseren Umgang miteinander grundlegend. Wie solche grundlegenden Veränderungen in die Welt kommen, darum geht es in diesem Band. Die sozialen, kulturellen und zwischenmenschlichen Auswirkungen der neuen Geldpolitik und der neuen Technologien in Hinblick auf die Lebensgrundlagen und Lebensverhältnisse, in denen das menschliche Dasein sich entfaltet, wird uns in einem Band VI. dann beschäftigen.
Band IV: Zu einer neuen Politischen Ökonomie. Dieser Band beschäftigt sich mit den Modellen der klassischen und neoklassischen Ökonomik, die eine wissenschaftliche Entwicklung beschreiben, deren letzten Kapiteln wir gerade beiwohnen. Hier werden die Schlusskapitel der politischen Ökonomie geschrieben, die mit den Transformationsprozessen innerhalb der Politischen Ökonomie nicht mehr Schritt halten können, weil sie mit den wirklichen Einflüssen, die Politik heute über die Notenbanken auf die Ökonomie ausübt, intellektuell nicht mitkommen.
Band III: Die Transformation der Marktwirtschaft beschäftigt sich mit den Prozessen innerhalb der Ökonomik, die aus der klassischen politischen Ökonomie herausführen in eine Wirtschaftsform, die immer weniger zu tun hat mit einer Marktwirtschaft, sei diese nun eine Liberale Marktwirtschaft, wie in den angelsächsischen Modellen, oder innerhalb von einer Sozialen Marktwirtschaft wie in den europäischen Modellen.
Band 2: An die Arbeit behandelt die theoretischen Systeme, die sich mit der menschlichen Arbeit beschäftigt haben. Das sind wenige aus der Philosophie, die man zudem auch nur einigermaßen systematisch nennen kann. Da sind die Theorien der politischen Ökonomie, angefangen bei Platon, dann differenzierter bei Aristoteles bis hin zu Adam Smith und Karl Marx. Und natürlich die Wissenschaften der Ökonomie, die wir unter den Begriff der Ökonomik versammeln.
Thematisch geht es in diesem Band um den Zusammenhang zwischen individuellem Wohlstand und gesellschaftlicher Wohlfahrt in grundlegender Absicht. Dabei spielen Überlegungen zur Wertschöpfung (Produktion) und zu den Märkten hinsichtlich der Entwicklung von Löhnen und Gehältern und deren Auswirkungen auf die Preise (Konsum) eine zentrale Rolle. Dort von den Konsummärkten, wo Angebot und Nachfrage herrschen, blicken wir wieder zurück auf die Einflussfaktoren bei der Herstellung der Güter, auf Eigentum, Geld und Kreditzinsen.
Dabei entwickeln wir durch den gesamten Band II eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Ideologien, an deren Basis die des Homo Oeconomicus steht. Und mit dieser Auseinandersetzung um das Prinzip der unbedingten Nutzenmaximierung auch die Frage, ob man zu einer besseren Theorie und Praxis für und in der Art, wie wir unser Dasein reproduzieren, kommen kann, wenn wir dieses Nutzen- bzw. Gewinnmaximierungsprinzip abschaffen würden.
Band 1: Andenken behandelt in knapper Form die Entstehung und Entwicklung wichtiger Themen und Denkmuster, angefangen in der antiken, griechischen Philosophie bis in die Moderne des Abendlandes. Dabei wird eine Neubestimmung abendländischen Denkens aus der Komplementarität von Denken und Sein vorgenommen und damit die bestehenden Bestimmungen aus dem Gegensatz und der Negation bzw. dem Widerspruch zwischen Denken und Sein überwunden. Eine Neubesinnung auf das Thema und die Phänomenologie der Macht als politische Macht will die Inflation soziologischer Machtbestimmungen beenden und den Weg aufzeigen, wie politische Macht als phantasmatische Macht im Dasein des Menschen sich ausgebreitet hat und heute weiter prozediert.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort 3
Inhaltsverzeichnis 5
Einleitung 10
Das Ende der Idee von der Welt als Dorfgemeinschaft 16
Alles nur noch ein Datensatz? 19
Eine Innovation sucht ihren Nutzen 22
Kapitel 1: Money Down 29
Plattform-Anwendungen 30
Die Abschaffung des Bargelds in China 31
Ein Blick Backdoor 33
Money Disclosure 35
Geldvermögen und Schulden in Deutschland 36
Die Digitalisierung privater Vermögenswerte 39
PSD2 – Der Weg ins Open Banking 43
Open Banking 45
Wo kühn Kräfte sich regen, da rat' ich offen zum Krieg… 47
Open Access 54
Open wounds 56
Das neue europäische Finanzmarktmodell 56
Der Fall Libra 58
Menlo Park und die City of London 60
Frankreich zaudert nicht 63
Amerika - the first and the last 65
Digitalgeld und Digital Business 67
Das Perpetuum mobile der Geldpolitik 69
Windmühlen an der Zimmerdecke 71
Die Repo-Märkte; toxisch wie Arsen 72
Encore: Das Social Credit System der VRC 76
2. Kapitel: Neues Zahlungssystem für Europa 78
Die Systemfrage im Zahlungssystem 80
Programmierbar oder nicht – das ist die Frage 81
Distributed Ledger und Blockchain Technologien 84
Die Terminologie der Blockchain Technologie 85
Smart Contracts 91
Smart Contracts in Distributed Ledgers 92
Die Zukunft der Distributed Ledgers 97
Europäische Positionen 100
Exkurs in die Welt der neuen Wettbewerber. 102
World Wide War - Kampf der Systeme. 106
Datenschutz – Schutz der Person vs. Schutz der Daten 108
Der Blick ins Portemonnaie. 109
Das neue Geldsystem 111
Forderungen der Finanz-Partisanen 113
Der E-Euro – eine paneuropäische Idee 118
Was für die Bürger, muss auch für die Regierungen gelten 119
Die traurige Wirklichkeit der paneuropäischen Geldpolitik 119
Experimente mit dem E-Euro 123
Der Zankapfel Bargeld 126
Die wahren Freunde des Bargelds 127
Europa goes Krypto 129
Kapitel 3: Die Dynamik von Konjunkturkrisen 131
Tor auf zur Politischen Ökonomie 136
Die Zugbrücke fällt 138
Zielkonflikte des neuen Geldes 140
Magie der Moderne 145
Knockin‘ on heavens door 147
Haftung und Haftungsrisken 148
Diskrete Haushaltsbücher 152
Memento mori … 158
Carpe diem 162
Das Rätsel der Bilanzen 165
Das gefährliche Rätsel der Vollzuteilung und Mindestreserven 166
Fraktale Handlungssystematik 169
Zwischenstand Zukunft 172
Von Werten und linearen Funktionen 174
Schluss mit der neofeudalen Geldpolitik? 177
Die „soziale“ Differenz 184
„Hitlers Enkel“ 187
Die Digitalisierung der Nationalstaaten 189
Ein Exkurs zum Nachdenken: Tracing App 191
Mehrebenen-Systeme in der Entscheidungsfindung 194
Kooperation und Koexistenz 201
Komplementäre Selbstorganisation 204
PostBüropkratische Agilität 204
Responsives Regieren 207
Das Gespenst der Umverteilung 211
Politische Permeabilität 218
Staatsschulden und Staatskalküle 219
Unbekannte Riesen der Finanzindustrie ... 230
Währungsfragen sind systemrelevant 233
Babbo morto 236
Amoralischer Familismus und Condono tombale. 238
Die Konten der Regierungen 241
Justitia distributiva – Justitia commutativa 244
Bruchstellen gerechter Verteilung 251
Freie Idiotes 256
Kapitel 4: Die Ökonomie der BigTechs 262
Das Neue marktwirtschaftliche Paradox 264
Von einer Liberalen Marktwirtschaft zu einer Liberalen Digitalwirtschaft 268
Old man river 270
Der Dollar und die Kryptowährungen 274
Das „Goldene Kalb“ wird zur Schlachtbank geführt 279
Krypto-Währungen 280
Dollar und Kryptowährungen - Ausblicke 303
Die Rückkehr der Kartelle 309
Kartelle in Plattform-Ökonomien 312
Access to Earth 325
5. Kapitel: Hat Europa hat seine Zukunft bereits hinter sich? 330
Die neueGeldpolitik 332
„The Cuyahoga River runs smoking through my dreams“ 334
Haben die USA von Europa gelernt? 342
Europa auf Holzwegen 344
Datenwirtschaft 346
Allzu öffentliche Geheimnisse 349
Business Power to the People 355
Das Gravitationsgesetz im Onlinehandel 357
Die neue Rolle der EU auf den Anleihemärkten 374
Ein klärender Rückblick in die Aufklärung 376
Mit aufgeklärtem Blick in die Zukunft 383
God said ‚Let Newton BE‘ AND all was light 386
Financial Big Data 393
Von Zahlen und Orten 395
Rekursiv - iterativ 399
Illusionistische Naturwissenschaften 404
Von hier aus: Aus der Welt in den virtuellen Raum. 411
Kap. 6: Künstliche Neuronale Netze (KNN) 416
Von Zahlen zu Graphen 419
Ausflug ins Goldenen Zeitalter der Zahlen 427
Die Zukunft in Zahlen 431
Automatische Handschrifterkennung 434
Fehlertoleranz und Redundanz 441
Trainings-, Kontrolldaten und die Kostenfunktion 443
Vorwärts – Rückwärts – Im Kreis 447
Einsatz in der digitalen Transformation 457
Erkenntnis Non-Disclosure 463
Kohonennetze 471
Ein kurzer Blick hinter die Kulissen der Finanzämter 473
EaaS – Everything as a Service 476
Der neue Wirtschaftsimperialismus 483
Imperiale Träume 487
Exkurs: Ernst mit der Monopolklage? 491
Dezentrale Bewegungen 506
Politische Bewegungen 513
Zettels neuer Traum 522
Die letzten Tage der Wissenschaften 531
Der Dämmerschlaf der bürgerlichen Freiheit 538
Grenzen überwinden – Sehnsuchtsorte der Freiheit 540
Literaturliste: 544
Einleitung
Der Band V. unserer Philosophie des menschlichen Daseins beschäftigt sich mit der Digitalisierung, vornehmlich in Hinblick auf die großen und das Dasein eines jeden Menschen bestimmenden Bereiche. Wenn wir in diesem Zusammenhang den Begriff der Bestimmung wählen, so haben wir damit noch kein Kausalverhältnis und auch keine Zielvorstellung formuliert. Wir sprechen von Einfluss, davon, dass digitale Technologien unser Dasein beeinflussen, nicht in einem notwendigen Sinn, sondern in der Form von einer Veränderung bzw. einer neuen Bedeutung dessen, was wir tun, was wir denken und wie wir uns verhalten.
Bevor wir also von einem neuen Sinn von etwas sprechen, müssen wir zunächst einmal herausfinden, ob das, was sich durch digitale Technologien verändert bzw. einem Bedeutungswandel unterzieht, sinnvoll genutzt werden kann, oder als Unsinn verworfen werden sollte. Dabei ist es ja nicht ganz so einfach, etwas zu verwerfen, was unser Leben tagtäglich durchdringt. Wie gerne hätten damals, als das Girokonto eingeführt wurde, viele, wahrscheinlich die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland diese Veränderung nicht nur abgelehnt, sondern auch verworfen, hätten lieber weiter Bargeldauszahlungen ihrer Löhne erhalten. Aber sie wurden weder befragt, noch gab es eine politische Repräsentation ihres Unwillens.
Und so ist es auch mit der Digitalisierung. Sie dringt in jeden Lebensbereich der Bürgerinnen und Bürger ein, ohne, dass diese eine qualifizierte Entscheidung oder gar eine demokratische Wahl darüber hätten. Dabei ist die Einführung von Kryptowährungen folgenreicher für Bürger und Unternehmen als alles vorher, was im Bereich des Geldes und der Transaktionen stattgefunden hat. Kryptowährungen sind beileibe kein "next big thing", sie zeigen wie so vieles innerhalb der Digitalisierung lediglich die Spitze eines Eisbergs, aber nicht "the whole big thing". Untersuchen wir daher die Kryptowährungen genau, um der Masse an bestimmenden Veränderungen, die gleichsam unter Wasser sich ausbreitet, auf die Spur zu kommen. Das, was bei Kryptowährungen unter Wasser sich ausbreitet und in unser Leben eindringt, hängt also nicht allein zusammen mit den verschiedenen Kryptowährungen, wie wir sie jetzt schon eine ganze Weile lang zur Kenntnis nehmen konnten; viele Menschen haben sie bislang auch einfach nur ignoriert, ignorieren können. Bitcoin, Ethereum etc., die besser Krypto Geld genannt werden sollten, also digitale Zahlungsmittel, die auf kryptografischen Werkzeugen wie Blockchains bzw. Digital Ledger Technologien und digitalen Signaturen basieren, sind vielen von uns bislang kaum oder gar nicht begegnet, gleichwohl etwas mehr als einhundert solcher Formen von Krypto Geld bereits auf unseren Märkten unterwegs sind; wir sollten daher die Zeit nutzen und uns mit Krypto Geld beschäftigen, bevor wir sie benutzen wie die Kreditkarte, ohne genau zu wissen, was sich dahinter verborgen abspielt.
Krypto Geld ist vielfach bereits im Einsatz, heißt aber nicht so und ist daher auch diskret, spielt sich also im Verborgenen ab. Wenige Menschen haben vor zehn Jahren erstmalig mit Bitcoin bezahlt, heute sind es bereits so viele, dass das Bitcoin-Transaktionsvolumen die des Kreditkartenanbieters Visa und des Zahlungsdienstleisters PayPal, beide etabliert und zu den Großen der Branche zählend, inzwischen übertroffen haben. Schauen wir hier im Vorgriff auf Späteres also kurz auf die Bedeutung des Krypto Geldes, dann halten wir fest: Als der Bitcoin vor etwas mehr als zehn Jahren auf den Markt kam, trat er an, das staatliche Geldmonopol zu durchbrechen. Er wurde schnell mit dem Ausdruck: „disruptiv“ belegt und stand für einen neue, positive Bedeutung des Geldsystems, das viele Male vorher, aber besonders durch die Internationale Finanzkrise (Peak um 2008) in eine massive Vertrauenskrise geraten war, vor allem durch die Geldpolitik der Notenbanken. Nach der Lehman-Pleite sah man lange Schlangen von US-Bürgern vor ihren Bankfilialen, um Bargeld abzuheben (Bank Run), dann sah man sie in Großbritannien, dann in Deutschland und schließlich in ganz Europa. Es war nicht leicht, ein Sümmchen vom Konto zusammenzukratzen und unters Kopfkissen zu schaffen. Kanzlerin Merkel und ihr Finanzminister Steinbrück mussten vor die Kamera treten und mit ernster Stimme verkünden: das Geld ist sicher; einem Vertreter der privaten Großbanken oder der Notenbanken hätte niemand mehr vertraut. Die Währungen waren in einer veritablen Vertrauenskrise bei Bürgern und Unternehmen geraten.
Der Initiator des Bitcoins, der unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto auftrat, begründete die Notwendigkeit des Bitcoins so: „Der Zentralbank muss vertraut werden, dass sie die Währung nicht entwertet, doch die Geschichte des Fiat-Geldes ist voll von Verrat an diesem Vertrauen.“ Und überraschenderweise, von vielen aber unbemerkt, stand quasi "unter Wasser" des als neue Spitze des Geldsystems herausragenden Krypto Geldes Bitcoin nun der Markt selbst, resp. die Marktwirtschaft. Der Unterschied von Krypto Geld zu Dollar, Euro, japanischem Jen oder chinesischem Renminbi ist, dass sich das Krypto Geld am Markt bewähren muss, also einen Nutzen besitzen und aus diesem Nutzen für alle Menschen Vertrauen schafft, das nicht durch die pure Wucht einer staatlichen Institution suggeriert werden kann, sondern sich im Alltag als Zahlungsmittel bewährt. Nur dann wird Krypto Geld oder eine Kryptowährung wie etwa ein neuer E-Euro oder E-Dollar Akzeptanz finden, so die Meinung der Experten von Geldsystemen. Bleiben wir beim Krypto Geld, dann heißt Vertrauen auf den Geld- und Zahlungsmärkten auch, dass Akzeptanz nicht von Dauer sein muss, wie auch kein anderes Produkt, keine andere Ware eine notwendige Präsenz auf den Märkten haben muss, sondern so schnell auch wieder vom Markt verschwinden kann, wie sie gekommen ist. Das ist der Vorteil der Marktwirtschaft. Die Anbieter müssen die Bedürfnisse der Kunden befriedigen, sonst verschwinden sie vom Markt. Deshalb ist das Aufkommen der vielen "Kryptowährungen" in Wirklichkeit auch kein disruptiver Vorgang wie oft behauptet wird und steht damit allenfalls in der Perspektive einer veränderten Bedeutung, die die etablierte Währungswelt nicht notwendig aus der Wirklichkeit hinausfegt, sondern beschreibt eine eher evolutionäre Veränderung des Geldsystems.
Aber was machte denn einen neuen Sinn des Geldsystems aus? Sicherlich ganz generell gesagt, muss das Geldsystem als System so verändert werden, dass es einen anderen, einen neuen Sinn bekommt. Nun darf man wissen, dass nirgends geschrieben steht, dass unser Geldsystem das einzig wahre ist und also keiner Erneuerung oder Veränderung ausgesetzt werden darf. So lesen wir im Bundesbankgesetz: „Auf Euro lautende Banknoten sind das einzige unbeschränkte gesetzliche Zahlungsmittel“ (Art. 14, Abs. 1). Eine entsprechende Vorschrift für die Länder der Eurozone wurde in den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union übernommen (Art. 148, Abs. 1). Genau gelesen bedeutet der Artikel 14 aber, dass nicht der Euro an sich das „einzige unbeschränkte gesetzliche Zahlungsmittel“ ist, sondern lediglich die „auf Euro lautenden Banknoten“. Und das ist ein fundamentaler Unterschied, denn die Banknote ist Bargeld und kein Buchgeld bzw. Digitalgeld, wie Buchgeld heute in den überwiegenden Fällen in Form von Konten vorliegt und was wir in einem vorherigen Band unserer Philosophie mit dem Unterschied zwischen "Money Propper" und Money of Account" dargelegt haben (Bd. III, Kap. 3).
Zählen wir unter der Geldmenge1 M3 die gesamte Eurogeldmenge zusammen, dann macht darin das Bargeld etwa 10 Prozent aus, weitere zehn Prozent fallen auf Zentralbankgeld, also Geld der EZB, das als Sichteinlagen der Banken bei den Notenbanken des Eurosystems, den nationalen Notenbanken, anfallen. Was bleibt sind knapp achtzig Prozent von M3 und das ist Buch- oder Giralgeld, welches durch private Banken erzeugt wird, indem Banken durch Kreditvergabe Geld schöpfen, Buchgeld mithin. Dieses neue Geld ist kein Bargeld, ist Money of Account, von Privatbanken erzeugt und insofern es Kreditausweisungen und Buchgeldeinschreibungen sind, ist es auch kein „unbeschränkt gesetzliches Zahlungsmittel“, sondern liegt meist als Sacheinlagen in den Unternehmensbilanzen auf der Habenseite oder sind Verbraucherkredite etc. also Geld, das weder in einem Portemonnaie zu finden ist noch als Sichteinlagen auf privaten Konten. Achtzig Prozent der Eurogeldmenge ist also genaugenommen privates Geld, welches nur zu zehn Prozent als Bargeld oder Sichtguthaben auf Bankkonten zugleich auch unbeschränkt anerkanntes Zahlungsmittel ist, und 10 Prozent ist Zentralbankgeld, das zwar staatlich erzeugt wurde, aber ebenfalls nicht der Definition des „einzigen unbeschränkt gesetzlichen Zahlungsmittels“ entspricht.
Unser bisheriges Geldsystem ist also eine Konstruktion, bei der Privatbanken und Notenbanken eine ganz entscheidende Rolle spielen, die im Zentrum von Krypto Geld und Kryptowährungen angegriffen wird, als bei beiden die Mittlerrolle der Banken zwischen Staat und Privatkunden, zu denen auch die Unternehmen, so sie nicht ganz oder teilweise in Staatsbesitz sich befinden, gehören. Würde Krypto Geld also das staatlich oder in Banken erzeugte Geld ersetzen, wären schlagartig weitere zehn Prozent der Geldmenge M3 auf dem Markt und damit auch als Zahlungsmittel verfügbar; dies diskutiert zurzeit mit Leidenschaft die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel. Das gerade die BIZ darüber diskutiert, das Zentralbankgeld als gesetzliches Zahlungsmittel anzuerkennen ist ein fundamentaler Systemwechsel im europäischen Geldsystem. Wir gehen ausführlich auf diesen Punkt ein und fragen uns, ob ein Bank Run, wenn jeder Bürger ein eigenes Konto bei der EZB oder einer nationalen Zentralbank in der Eurozone hätte, eher un- oder eher wahrscheinlicher würde. Wir stellen uns vor, dass jeder Bürger per Klick auf seinem Smartphone Geld von seinem Bankkonto auf sein Zentralbankkonto transferieren könnte, was wäre dann in Krisenzeiten mit unserem Geldsystem?
Wir erinnern an einen vorherigen Band (Bd. III), wo wir zeigten, dass unsere Geldsystem in der deutschen, dann in der englischen Geschichte nicht aus einer Währung und damit einer staatlichen Legitimation entstanden ist. Die Wechsel der Fugger (Bd. III, Kap.4) erfüllten dies genauso gut wie die Wechsel, die deutsche oder englische Händler ausgegeben haben, wie viel später dies auch US-amerikanische Zigaretten auf den deutschen Nachkriegs-Schwarzmärkten erfüllte, dass also Geld eine Privatsache war und trotzdem als „allgemein anerkanntes Tausch- und Zahlungsmittel“ Gültigkeit besaß; und wir zeichnen nach, wie die Bank of England den Stein ins Rollen brachte und das Vertrauen der Bürger und Kreditgeber verletzte, damit die britische Regierung ihre Kriege finanzieren konnte und dieses Vertrauen auch heute noch verletzt, indem die City of London Flucht- Schwarz- und illegal erworbenes Geld im großen Stil auf die britischen Kronkolonien verteilt.
Geht es um Vertrauen in eine Währung, dann stehen zwei Meinungen mittlerweile völlig unversöhnlich nebeneinander. Die eine Meinung haben wir unter der Überschrift: Modern Money Theory bereits in Band IV kennengelernt, die andere unter Austeritätspolitik oder Schuldenregime. Die eine behauptet die Verschuldung der Staaten sei weitgehend folgenlos für das Vertrauen in ein Währungssystem, die andere bestreitet dies vehement. Wir graben uns durch die Schichten dieser Meinungen, die in den verschiedenen Auffassungen zur Geld- und Fiskalpolitik, allen voran die USA und Deutschland auf der anderen Seite zum Tragen kommen. Geldwertstabilität und Integrität einer Währungszone wie die des Euros spielen in diesem Zusammenhang ein wichtige Rolle, wie auch die ganz grundsätzliche Frage, welche Bedeutung denn die Stabilität einer Währung einmal als hoheitliche Aufgabe, besonders über das amerikanische Federal Reserve System oder über die Europäische Zentralbank hat. Sind die Fed und die EZB überhaupt in ihrer Geldpolitik noch vergleichbar? Und was wird aus der alten hoheitlichen Geldordnung nach der Einführung einer Kryptowährung?
War bislang in den westlichen Industrieländern guter Konsens, die Geldproduktion stets als eine Art Private-Public-Partnership zu organisieren, indem also der Staat die Banken mit dem Geldschöpfungsprivileg ausstattet und die Banken im Gegenzug den Staat über ihre Kreditvergaben finanzieren, so ist dieses System so stark im Schwanken begriffen, dass die Furcht, dass es bei der nächsten weltweiten Finanzkrise einstürzt, nicht ganz unbegründet erscheint. Aus heutiger Sicht, nun nach sieben Monaten Corona-Krise müssen wir erleben, dass große Teile unserer nationalen Wirtschaften und mit ihr unser Geld in einen Krisenmodus geraten sind, aus dem kein vernünftiger Gedanken an die jemalige Rückzahlung der neu aufgenommen Schulden der Staaten der EU oder der USA zu entspringen vermag. Ewigkeitsschulden, Bad Banks, ungeregelte Finanzmärkte haben längst schon einen gewichtigen Teil der hoheitlichen Aufgaben in den Geldsystemen übernommen, aber mit welchen Folgen?
Ach, was waren das noch Zeiten, als Geld dafür genutzt wurde, um den Fährmann zu bezahlen, der einen ins Reich der Toten rüber ruderte, oder als Geld die mühsame Tauschwirtschaft, den Gebrauchsgütertausch ersetzte und man nicht ewig mit einem Dutzend Gänse unterwegs sein musste, um dafür Getreide oder Mehl einzutauschen, um dies dann wiederum nach Hause zu schleppen. Und wie war das genial von den Fuggern, nicht mehr durch die Wälder mit wertvollen Waren im Gepäck zu ziehen und am Ende alles bärtigen Räubern und Banditen herausgeben zu müssen, nur um sein nacktes Leben zu bewahren? Eins muss man den gierigen Herrschern, den eitlen Königinnen und machtbesessenen Königen, den tumben Fürsten und der gesamten adeligen Bande lassen, sie haben schnell erkannt: wer das Geldmonopol besitzt, der hat mehr als nur Geld. Der hat Gewürze auf dem Teller, Brokat an den Wänden, Bildung und vor allem Geld, um Kriege zu finanzieren, die, bei gutem Ausgang, größere Herrschaftsgebiete versprachen und damit noch mehr Geld und Untertanen; auch Sklaven waren begehrt. Leider sprach es sich an den Höfen Europa schnell herum und jeder wollte dasselbe und so entstand ein regelrechter Wettbewerb, ein Tanz ums goldene Vlies. Und während sie tanzten verloren ihre Währungen an Wert und Handwerker und Händler stiegen schnell um auf anderes Geld, auf Geld bzw. Währungen, die mehr Vertrauen genossen; die globalen Finanzmärkte waren geboren und sogar Tulpen aus Amsterdam erreichten damals an der Börse einen Wert, der Gold und Silber um ein Vielfaches übertraf (Bd. III, Kap.6).
Wer heute Geld sagt, meint wissentlich aber nicht zugleich auch die Wertstellung des Geldes auf den internationalen Finanzmärkten. Nun scheinen aber die internationalen Finanzmärkte nur prima Vista freie Märkte wie die der Waren des täglichen Bedarfs oder andere zu sein. In Wahrheit sind die internationalen Finanzmärkte, jedenfalls der geregelte Part derselben, zu einer Art Oligopol gewachsen, in dem die USA mit dem US-Dollar ganz weit an der Spitze stehen und sich deshalb auch Dinge erlauben, die sich kein Staat der Erde, nicht einmal die Volksrepublik China auch nur im Ansatz erlauben könnte. Großbritannien mit seiner City of London und den dazugehörenden Kronkolonien, ein Börsenplatz, der lange Zeit der Wallstreet durchaus Konkurrenz zu machen in der Lage war, die Eurozone, der ostasiatische und der chinesische Finanzmarkt führen zwar untereinander noch einen Wettbewerb, aber ein offener Markt ist dieses Oligopol längst nicht mehr.
Wir blicken zurück auf jene Zeit, als Geld noch aus dem Goldstandard seinen Wert als Währung bekam und auf die Folgen des Abkommen von Bretton Woods (siehe auch Bd. IV, Kap. 6), die unser Leben nachhaltig verändert haben. Damals begann die enge Verzahnung zwischen den USA, GB, und dann der EU, die den Wettbewerb der Währungen mehr oder weniger ausgeschaltet hat, als sich die Welt aufgeteilt hat und als Westen gegenüber dem "Rest der Welt" imponierte. Als mit Bretton Woods das Geld bzw. die Währungen von ihrer Goldbindung gelöst wurden hatte dies zur Folge, dass heute den meisten Menschen nur noch Fiat-Geld2 zur Verfügung steht, das auf dem Vertrauen fußt, dass nun allein die Notenbanken durch ihre zunehmend homogene Geldpolitik schaffen wollten, was auch einige Zeit lang gut gelang, bis der US-Dollar ausscherte und die Fremdverschuldung zunahm und damit das Angewiesen-sein auf einen ständigen Zufluss von fremdem Geld zur Refinanzierung der Schuldenhaushalte und zur Finanzierung notwendiger staatlicher Maßnahmen in der Fiskalpolitik und der Wirtschaftspolitik.
Aber gerade das neue Fiat-Geld kam der Politik entgegen. Ob US-Dollar, Euro, japanischer Yen, chinesischer Renminbi, Britisches Pfund oder Schweizer Franken, sie sind mittlerweile allesamt Fiat-Geld. Will man unser Geldsystem verstehen, selbst bis hin an die Grenze zu einer Kryptowährung, dann muss man das Fiat-Geld verstehen. Es zeichnet sich vor allem durch drei Eigenschaften aus: Es wird von staatlichen Zentralbanken produziert, die das Monopol der Geldproduktion innehaben. Fiat-Geld ist, so kann man sagen, intrinsisch oder vom Gebrauchs- bzw. Materialwertwert her gesehen, anders als etwa Gold und Silber oder andere Edelmetalle, wertlos, es hat lediglich die Form von mit Tinte bedruckten Papierzetteln, resp. aufbereiteten Baumwollstücken, von Münzen mit relativ geringem Metallwert, auf denen eine Zahl aufgedruckt bzw. eingeprägt ist, und Einträgen auf Computerfestplatten resp. elektromagnetischen Speichermedien, dort schon nicht mehr ersichtlich in Form von „Bits and Bytes“. Und die Geldmenge sowohl in Papierform oder elektronischer Form lässt sich im Grunde beliebig vermehren. Fiat-Geld wird im Regelfall durch Bankkreditvergabe (Notenbanken und den Privatbanken als Transferinstitute zum Markt) produziert, durch Kredite, die nicht durch „echte Ersparnis“ oder überhaupt durch eine andere Referenzierung wie etwa das Nationaleinkommen und der Schuldenstand einer Volkswirtschaft oder eben amerikanische Zigaretten etc., gedeckt sind; Fiat-Geld wird also aus dem Nichts, „ex nihilo“ geschaffen.
Mit dem Bitcoin verbunden war der erste ernstzunehmende Versuch, das staatliche Geldmonopol zu durchbrechen und dies erfolgte zu einem Zeitpunkt, als das Vertrauen in das Geldsystem durch die damalige Finanzkrise einmal mehr tief erschüttert worden war, aber die Geschichte des Fiat-Geldes ist voll von Verrat an diesem Vertrauen. Fiat-Geld ist, so darf man heute unumwunden aussagen, notorisch inflationär, wobei wir sehen werden, dass alle volkswirtschaftlichen Parameter zur Berechnung der Inflation offensichtlich nicht hinreichen, sonst würden wir zu Zeit eine Quote von mehr als vier Prozent erleben in Deutschland, sechs Prozent in Europa und irgendwo dazwischen in den USA. Fiat-Geld hat die unangenehme Eigenschaft, die der Ökonomik geradezu Furchen auf die Stirn gräbt, es sorgt für eine ungerechte Verteilung des gesellschaftlichen Wohlstands, also der Verteilung von Vermögen in Relation zu den Lebenshaltungskosten und der finanziellen Daseinsvorsorge der Menschen. Während die Börsen boomen, steigen die Mieten und die Immobilienpreise, oder eher, weil die Börsen boomen? Diese Frage um den Zusammenhang von Kapitalmärkten und Spar- sowie Privatvermögen, also den privaten Vermögenswerten, werden wir eingehend besprechen.
Mit dem Krypto Geld verbunden ist also die Suche nach einem „besseren Geld“, einer echten Alternative zu den offiziellen Fiat-Währungen. Nun muss man solche neuen Währungen aber im Zusammenhang mit ihrer Technologie, der Blockchain-Technologie zusammen betrachten. Ist dann aus dieser Zusammenschau eine Kryptowährung wirklich eine bessere Währung? Das neue Geld sei ein monetärer Quantensprung, stimmt das und wenn ja, ganz oder teilweise, und in welcher Hinsicht oder Funktion kann das neue Geld unser Geldsystem in einem positiven Sinn verändern? Jedenfalls ist unser Geldsystem viel zu wichtig für jeden einzelnen von uns, als es einfach unhinterfragt hinzunehmen, als einfach, ja fast schon fahrlässig leichtgläubig den Fiat-Währungen zu vertrauen.
Das Ende der Idee von der Welt als Dorfgemeinschaft
Das Internet war am Beginn entstanden aus der Idee eines global vernetzten Datenverkehrs und einer frei verfügbaren Datennutzung. Wer immer auch wo auf der Welt die URL in seinen Browser eingab, konnte eine Internetseite erreichen und die dort befindlichen Informationen und Rechenoperationen nutzen, teilweise interaktiv. Eine Beschränkung dieser Idee ging vor allem und zuerst von der alten Sowjetunion, danach von Russland und der VRC aus. Ihre Argumente für die Legitimität dieser Einschränkung waren stets und damals schon die nationale Sicherheit und Souveränität und damit hatte das Internet die Politik erreicht. Es war kein Netz der Wissenschaften, keins der freien, privaten Nutzung mehr. Unter dem Einfluss der Politik wurde aus der libertären Idee eines ungeregelten Datenverkehrs eine politisch geregelte Nutzung. Auch der Westen, die USA und Europa bringen immer mehr Regularien bei der Nutzung des Internets ins Spiel und dies umso mehr als das Internet zu einem Synonym der Digitalwirtschaft geworden ist. Digitale Transformation, also die Umwandlung der Wirtschaft zu einer Digitalwirtschaft, wird wie selbstverständlich angesehen, der Nutzer bzw. die private Nutzung des Internets wurde so schon fast zu einer Nebensache; irreversibel. Und mit jeder neuen Regulierung wird sich der Charakter des Internets als eine staatlich regulierte Verfügungsgewalt über vornehmlich wirtschaftliche Nutzung des Webs weiter verfestigen.
Besonders bei Unternehmen, die das Internet für Geschäftszwecke nutzen, keimt langsam die Einsicht, dass keine Firewall, kein technischer Abschottungsmechanismus ausreicht, um notwendige Sicherheit im Netz zu gewährleisten. An oberster Stelle der sicherheitsrelevanten Faktoren stehen die eigenen Mitarbeiter; darin sind Unternehmen und Geheimdienste sich sehr ähnlich. Heute, da Unternehmen zunehmend vernetzt sind mit 3rd Party Unternehmen und Geschäftsprozesse unternehmensübergreifend digital aufgebaut worden sind, stehen daher, wenig verwunderlich, die Mitarbeiter von Partner-Unternehmen, Servicepartner und Zulieferer auch an zweiter Stelle aller Sicherheitsrisiken. Erst danach kommen laut einer Studie von PwC (PricewaterhouseCoopers) externe Faktoren, angeführt von Hackern und Hackern im Dienst von Konkurrenten oder Staaten. Der Mensch als Sicherheitsfaktor und Sicherheitsrisiko zugleich und nicht nur die Vielzahl an vernetzten Computern, die überwiegend heute noch aufwendig sind in kontinuierlicher Wartung, auch die sogenannten SaaS3 als Teilbereich des Cloud Computing erfordern ein hohes Maß an externen Dienstleistungen bei Software und digitaler Infrastruktur. Abschottung, Software und Infrastruktur zu installieren wie eine Burg, einer von außen schier uneinnehmbaren Festung verkennt, dass der Feind bereits innerhalb der Mauern agiert. Abschottung ist also zweifacher Unsinn, sowohl in Sicherheitsfragen wie in Fragen der Datenintegrität.
Datenintegrität als Ergebnis nationaler Alleingänge zahlte einen zu hohen Preis an Netz-Accessibility. Einzig eine Verbindung von Crypto-Codes und Ledger Technologie sind heute das Maß aller Dinge in Fragen der Datenintegrität und -Sicherheit. Ob aber dabei die Politische Ökonomie und die staatlichen Geheimdienste außen vorgelassen werden können, darf man bezweifeln. Und noch ein Phänomen lässt nachdenklich werden; im Dark Net bilden sich mittlerweile ganze Banden, die wie in der normalen Welt gegeneinander Krieg führen und dabei wenig zimperlich auch vor Mord nicht zurückschrecken. Angriffsziele dieser Banden sind also nicht nur lukrative Hacks von digitalen Kontoverbindungen, von eCommerce-Seiten etc., sondern auch Hackerbanden selbst, die vor allem dadurch auffallen, dass sie beim Hacking zu sorglos vorgehen und die verborgenen Aktivitäten anderer Banden in Gefahr bringen; das ist Bandenkriminalität mit Gang-Strukturen wie die alte „ehrwürdige Gesellschaft“. Nicht selten arbeiten diese Banden im Auftrag von Regierungen bzw. halbstaatlichen Organisationen, wie wir Ähnliches auch bereits im Zusammenhang mit Wahlmanipulationen in den USA (donald t. Wahl) und in Europa kennengelernt haben.
Richtete sich also die Frage der Datensicherheit bislang ganz zentral auf einzelne Individuen als Risikofaktoren, konnotiert mit dem Hacker als subversiven „Netz-Piraten“, so klingt dies heute wie romantische Folklore. Hacker stehen nicht selten in Diensten von Wirtschaft und zunehmend auch von politischen Organisationen (Trolle) und bilden immer mehr Cluster von fast spionage-ähnlichen Strukturen, immer mit dem Ziel, nicht öffentliche Informationen zu stehlen, Kommunikation und Verhaltensweisen zu manipulieren, wirtschaftliche und finanzielle Vorteile zu realisieren. Was heute fast schon ganz vergessen ist, ist die Tatsache, dass das Internet, als es am 6. August 1991 der Informatiker Tim Berners-Lee „erfand“ und die erste Webseite unter info.cern.ch online stellte, eine Gegenerfindung zum militärischen Nutzen darstellte. Das ARPANET, das unter der Leitung des Mathematikers Lawrence G. Roberts entwickelt worden war, wurde eine Ausgrenzung für militärische Zwecke, angesiedelt beim US-Verteidigungsministerium, gegenüber der zivilen Nutzung des Internets für private Zwecke und private Unternehmen wofür das „WWW“ und Tim Berners Lee stehen.
Eigentlich aber spiegelt sich diese Ausgrenzung und die folgende komplementäre Nutzung für Privatpersonen und Unternehmen schon in der Biografie von Lawrence G. Roberts wider. Im Jahr 1973 verließ Roberts die ARPA und gründete das Unternehmen Telenet Communications Corporation, um das Prinzip der Datenübertragung durch Paketvermittlung zu kommerzialisieren. Telenet war das erste Unternehmen, das Werkzeuge für die Paketvermittlung anbot. Roberts war von 1973 bis 1980 CEO der Firma. Von 1983 bis 1993 war er CEO von NetExpress, einer Firma für Asynchronous-Transfer-Mode-Ausrüstung, von 1993 bis 1998 Präsident von ATM Systems. Ab 1999 agierte er als Aufsichtsratsvorsitzender und CTO von Caspian Networks, einem Ausrüster für Breitband-Netzwerktechnik. Anfang 2004 verließ er die Firma, die Ende 2006 den Betrieb einstellte4.
Wie zwei Seelen schlagen seitdem als private und ökonomische Nutzung des Internets in deren Transferprotokollen. Die wirtschaftliche Nutzung mit den gesamten Sicherheitsproblemen, die private Nutzung, die Berner Lee aus der Idee einer religiös unitarischen Weltanschauung formulierte5. In diese Idee passt kein Copyright, kein Patent, kein Trade Mark, keine Abmahnanwälte und Kanzleien, keine Geldeintreiberbanden, kein wirtschaftlicher Konsum. Lee veröffentliche die Bauanleitung eines Netz-Servers und den gesamten Code (HTTP und HTML) unentgeltlich, nicht patentiert zur freien Nutzung durch jeden. Das World Wide Web Consortium (W3C), dem er lange vorsaß, wachte streng darüber, dass nur patentfreie Standards verabschiedet wurden, die stets die Möglichkeit gleichwertig einräumen, das Web zu editieren wie auch zu browsen. Was im Netz stand, stand da zur freien Nutzung, zur Information, zum wissenschaftlichen und zivilen Diskurs, zur öffentlichen Auseinandersetzung oder zur Anregung und Unterhaltung.
Abbildung 1
Die Verbreitung des Internets ist überhaupt nicht vorstellbar, ohne diese offene, fast kostenlose Nutzung. Waren es 1989 noch nicht mehr als eine Handvoll Nutzer, stieg die Zahl 1964 auf eine Million und danach explodierte sie förmlich auf über 4 Milliarden Nutzer heute. Der private Bereich war zweifellos die treibende Kraft bei der Ausbreitung, freie Nutzung von Informationen, Teilen von Informationen, sozialer Austausch und Zusammenarbeit waren dabei die wesentlichen Funktionen, die aus der Idee des Konsumverzichts der 60er Jahre entstanden und radikale Lebensformen bei den sogenannten „Blumenkindern“ an der Westküste der USA und in Europa fanden. Verzicht auf Hierarchien, so weit wie möglich, Kooperation ohne Wettbewerb, so weit wie möglich, Toleranz und Offenheit gegenüber allen Menschen und für die Vielfalt der Kulturen, ein humanistischer Vernunftgebrauch und die moralische Verantwortung von Ingenieuren, also von denen, die eine Technik und eine Technologie erfinden, die sowohl zum Nutzen wie zum Schaden der Menschen sich entwickeln kann – eine Erfahrung aus der Atomphysik, die bekanntlich zur Atombombe geführt hat - , das waren die Vorstellungen einer unitarischen Weltanschauung, die uns heute wie fast schon lächerliche Romantizismen einer längst vergangenen Welt vorkommen, dabei sind diese Vorstellungen im Netz weniger als dreißig Jahre alt.
In der so angedachten zivilen Nutzung des Internets war das Thema Sicherheit so gut wie überflüssig. Was sollte jemand stehlen, was er auch umsonst haben konnte. Die Quellcodes lagen offen, das Internet gehörte nicht mehr dem US-Verteidigungsministerium, die Wirtschaft war ein belächelter Nachzügler in der Nutzung des Netzes. Es gab niemanden, der auf die Idee gekommen wäre, einen Schnappschuss ins Netz zu stellen, um dann Tracking-Software laufen zu lassen, um einen Nutzer des Fotos mit Abmahnungen zu überziehen und ein paar Tausend Euro für ein grottenschlechtes Foto einzuklagen; es gab keine Abmahnvereine, Abmahn-Kanzleien, keine Tracking-Software. Wir sehen hier diesen Graubereich zwischen einer privaten Nutzung und einen aus wirtschaftlichem Interesse. Heute ist die private Nutzung schon fast vergessen. Alles findet unter einem ökonomischen Interesse statt oder steht zumindest in einer solchen Option. Als ein Resümee kann man sagen: die Zivilgesellschaft hat die Chance des privaten Teils des Internets verspielt; wir kommen später auf diesen Aspekt noch einmal eingehender zurück.
Alles nur noch ein Datensatz?
Als Tim Berners Lee die Seitenbeschreibungssprache HTML erfunden und den Quellcode des Internetprotokolls veröffentlicht hatte, sah alles nach einer Informationstechnologie aus, die Informationen und Menschen rund um den Globus miteinander verbindet, „Power to the People“ schien ein Stück wirklicher geworden zu sein. In Verbindung mit dem Personal Computer wurde die digitale Technologie aus ihrer anonymen, militärischen Nutzung in das Dasein des einzelnen Menschen geholt, Unternehmen hatten ihre Datenanonymität noch nicht aufgebaut oder einen Verwertungszusammenhang im Internet entwickelt. Der PC stand geradezu in anarchischer Vereinzelung gegen die strammen Linien der Großrechner in den Rechenzentren der Armee und der langsam aufkommenden Großrechner der Konzerne, einer Armada der Elektronengehirne der Macht und der Wirtschaft, die heute weitgehend bereit ist, wieder zusammen „Krieg zu führen“ gegen Einzelne aus der Zivilgesellschaft, die sich den Verwertungen und konsumtiven Kalkülen verweigern. Vergessen wir das nicht, der PC in Verbindung mit dem Internet war zu Anfang als ein Werkzeug der Zivilgesellschaft gedacht, konstruiert und vernetzt worden und die Idee einer vernetzten Zivilgesellschaft durch den „Computer für jedermann“ - wie dies Apple- Mitbegründer Steve Wozniak einmal nannte - war von den Vorstellungen von mehr Selbstbestimmung und mehr Emanzipation des einzelnen Menschen bestimmt, nicht von der Verwertung der öffentlichen Inhalte.
Es waren bislang mehr die Menschen, die im Netz riesige Mengen an Daten erzeugten, vor allem in den sozialen Medien. Nun werden sie weit übertroffen von vernetzten Maschinen, die uns erlauben, aus maschinenlesbaren Daten sowohl die Wünsche der Menschen wie die Veränderungen auf den Märkten herauszulesen. Big Data ist zu diesem Wort geworden, das uns Veränderungen und Wünsche vorstellbar werden lässt. Der jüngste Datenskandal der Firma Oracle6 belegt einmal mehr, dass es US-Firmen so ziemlich egal ist, ob die Gesetze Datenerhebung und -Analyse einschränken oder nicht; sie machen das einfach. Ein Zufall brachte einmal mehr das ans Licht, was jeder bereits wusste, Firmen hosten Verzeichnisse mit Milliarden von Daten, die u.a. Namen, Anschriften, E-Mail-Adressen und andere personenbeziehbare Daten von Nutzern aus aller Herren Länder, darunter auch sensible Browsing-Verläufe, von Shopping-Touren im Web bis zur Abbestellungen von Newsletter-Abonnements reichen. "Man kann es kaum beschreiben, wie aufschlussreich einige dieser Daten sein können", erklärte Bennett Cyphers von der US-Bürgerrechtsorganisation Electronic Frontier Foundation (EFF).
Fein abgestufte Aufzeichnungen über die Surfgewohnheiten von Menschen im Web könnten Hobbys, politische Vorlieben, Einkommensklassen, den Gesundheitszustand, sexuelle Präferenzen und andere persönliche Details offenbaren. Die Aussagekraft nehme ständig zu, "da wir einen immer größeren Teil unseres Lebens online verbringen". Die Daten kamen von einem Tochterunternehmen von Oracle, das als ein Start-up im Jahr 2014 für etwa 400 Millionen USD gekauft worden war und das mithilfe von Cookies und anderen Tracking-Instrumenten wie ‚Schnüffelpixeln‘ auf Webseiten inklusive Porno-Portalen und in HTML-Mails einen großen einschlägigen Werbeverbund aufgebaut hat. Auf dem zugehörigen Markt für Profiling und personenbezogene Werbung gelten etwa Google mit seinem Netzwerk DoubleClick, Facebook und Amazon als noch größere Datensammelmaschinen.
Googles Tochter BlueKai ist also keineswegs ein Einzelfall. Laut Branchenexperten verfolgt BlueKai rund 1,2 Prozent des gesamten Datenverkehrs im Web und arbeitet mit den Betreibern einiger der größten Homepages und Online-Dienste wie Amazon, ESPN, Forbes, Lévis, MSN.com, Rotten Tomatoes und der New York Times zusammen. Und auch deutsche Internet-Nutzer wurden zahlreich und über längere Zeiträume getrackt, gleichwohl nach deutschen Recht Tracker wie Google Analytics und Cookies selbst in pseudonymisierter Form nur mit ausdrücklicher und informierter Einwilligung der Nutzer erlaubt sind. Und die Verwendung der Daten wird sich wohl auch nicht nur auf die Schaltung und Steuerung von Werbeanzeigen beschränken, wie dies bereits vom Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kelber vor einem Jahr (2019) beklagt wurde. Die von Anwendersystemen abgegriffenen Daten und daraus geformten Profile werden längst nicht nur für Anzeigen verwendet, denn neue Möglichkeiten aus Cloud-Computing, KI und das sogenannte Internet of Things (IoT) lassen die Substanz an Big Data zu einem globalen Wert werden.
Allein mit moderner Audio-Technik kann ein weltweiter Markt im zweistelligen US-Dollar Bereich erschlossen werden.
Datenbanken aus vernetzten, digitalen Quellen sind die Werte der großen amerikanischen und chinesischen Unternehmen, der BigTechs. Sie entwickelten sich selbst aus ihrem Datenreichtum und ihren Fähigkeiten, diesen auf ihre unterschiedlichsten Bedürfnisse hin auszuwerten oder auf die unterschiedlichen Interessen anderer Organisationen, bis hin zu den politischen Institutionen zu analysieren und zu verteilen, zu Oligopolen auf ihren Märkten. Aber nicht nur beschränkt sich ihre Datendominanz auf die eigenen Märkte, im Gegenteil. Kaum ein Markt, sei er auch noch so weit entfernt in der Sache, liegt mittlerweile außerhalb ihres Einfluss-Spektrums.
Wir erkennen, dass Datenerhebung und Datenauswertung zusammen zu einer Informationssymmetrie führen, unter der alles, auch die ungleichsten Sachverhalte und Phänomene zu Datensätzen werden und diese Daten- bzw. Informationssymmetrie zugleich zu einer extrem ungleichen Nutzung und Verteilung der Daten führt, also in eine soziale und politische Informationsasymmetrie.
Gleichwohl der Mensch und die mit ihm verbundenen Wirtschaftsprozesse, seine sozialen, politischen und kulturellen Verhaltensweisen, Beziehungen und Verbindungen defacto im Zentrum des Interesses der GigaTechs stehen, die Erhebungen aus Auswertungen der Daten stehen in keinem Verhältnis zu den wirtschaftlichen, sozialen, politischen und kulturellen Bedürfnissen der Menschen. Herrschaft und Knechtschaft, wir erinnern an einen früheren Band unserer Philosophie (Band I. Kap. 1: Nichts ist…), stehen in eben diesem asymmetrischen Verhältnis zueinander, in keinem dialektischen. Die Herrschaft im System Big Data und seinen IT-Trends ist daher bestimmt als Phänomen der Verteilung und des Zugangs zu Daten, aus dem bereits der neue Verteilungskampf der Digitalwirtschaft sichtbar wird.
Die Beziehung zwischen Big Data und Politik ist offensichtlich. Mehr an Komplementarität geht nicht, wenn nach kalifornischem Recht Oracle eigentlich verpflichtet gewesen wäre, die zuständigen Aufsichtsbehörden unmittelbar nach Bekanntwerden des Datenlecks darüber zu informieren, dies aber der Konzern bis heute versäumt hat. Bereits vor der Übernahme von Blue Kai hätte das amerikanische Wettbewerbsrecht die Monopolbildung in diesem Teil der Digitalwirtschaft unterbinden können, hat dies aber versäumt; vermutlich willentlich. So billigen Unternehmen und Politik die nämlichen Praktiken, die der Struktur und dem Ziel der Kartellbildung folgen und Markt-Oligopole stillschweigend auf Seiten der Politik und lautstark auf Seiten der Unternehmen, der Finanzwirtschaft und Börsen feiern; wir werden sehen, was Europa bzw. Deutschland in dieser Angelegenheit unternimmt, denn bei solchen offensichtlichen Verstößen gegen die DSGVO sieht der Gesetzgeber Bußgelder bis zu 20 Millionen Euro beziehungsweise vier Prozent des Jahresumsatzes eines Unternehmens vor.
Eine Innovation sucht ihren Nutzen
Am Anfang war das Bedürfnis, so könnte man die Geschichte der technischen Innovationen überschreiben, die mit den Federn der Wissenschaften geschrieben wurde. Das Märchen vom: ‚es war einmal ein Bedürfnis‘ ist sehr alt und wie im Märchen tragen die dort erzählten Geschichten ihrem Gehalt nach nicht die Bedeutung, es waren und sind wie immer nicht die Erfahrungen, die Bedürfnisse und deren Geschichten, sondern die sie tragenden Bedeutungen wie T.S. Elliot in einem seiner Gedichte vermerkt: "We had the experience but missed the meaning." Die gewaltige Arbeit, die nicht minder gewaltigen Kosten, die Umstellungen und die damit verbundenen Erfahrungen in Wirtschaft, Politik und menschlicher Arbeit wurden begonnen und werden mit immer weiter steigender Dynamik fortgesetzt, nicht, weil man damit Bedürfnisse befriedigt, weil der Nutzen der Digitalisierung auf der Hand läge, wenn es um politische und wirtschaftliche Überlegungen und Veränderungen geht. Hier hofft man, nach sehr langem Zögern und Zweifeln, außer im militärischen Bereich ihrer Anwendungen, dass sie zu etwas führt – eine Innovation sucht sich ihren Nutzen. Aber fest stand erst mal gar nichts. Der Computer wurde, wie vieles auf der Welt, entwickelt, weil es ging. Computer und Vernetzungen waren gewissermaßen das, was Taleb einen Schwarzen Schwan7 nennt. Ein Ereignis von hoher Seltenheit, aber mit extremen Auswirkungen wie etwa die Entdeckung von Amerika, von Penicillin oder eben die Paketübertragung in der Datentechnologie. Der Zufall also bezeugt, dass wir nicht wissen, gleichwohl es zum Denken selbst gehört, aposteriori bzw. post festum verständliche, wenn möglich, begründete Erklärungen dafür zu finden.
So war der dem IBM-Präsidenten Thomas Watson Sr. apostrophierte Ausspruch: „Ich glaube, dass es auf der Welt einen Bedarf von vielleicht fünf Computern geben wird“ zugleich Programm und unwahr zugleich, denn nicht einmal der CEO des größten Computerkonzerns konnte sich anfangs das vorstellen, was wir heute allenthalben sehen. Was wir ebenso darin erkennen ist, dass – wie man heute so schön und schlecht zugleich sagt – die Narrative der Nützlichkeit wie die der menschlichen Konsumbedürfnisse post festum der Computertechnologie zugeschrieben werden. So werden heute dem vernetzten PC und der Digitalisierung allerlei Fähigkeiten und Wirkweisen zugeschrieben, die dem Kanon der bürgerlichen Aufklärung entnommen sein könnten: eine effizientere Wissensvermittlung und somit eine bessere Bildung der Menschen, die ihn mit seinen Begabungen zu mehr Selbstständigkeit, mehr Autonomie verhelfen kann. Eine größere Chancengleichheit, die die materiellen Unterschiede fast unberücksichtigt lassen kann, weil Lernen mit der didaktischen Effizienz digitaler Lernprogramme jedem Menschen auf gleiche Weise zur Verfügung stehe und die Tendenz zur Wissenssymmetrie fördert; allein die Wirklichkeit sieht doch sehr verschieden davon aus und auch nur die Vorstellung auf das Ziel einer globalen Wissenssymmetrie lässt viele doch zurecht erschaudern.
Weder der Nutzen noch ein aufklärerischer Zweck, gar ein humanistisches Ziel waren am Anfang der Entwicklung diesen Technologien inhärent noch wurden sie darin als solche verfolgt. Was am Anfang im Fokus des Interesses stand waren die Lösung von mathematischen Rechenaufgaben, war der Computer als Werkzeug der Mathematik und Physik. Mathematik belebte seit ihren Anfängen in der vorsokratischen Naturphilosophie die Idee von der Vorhersagbarkeit, die das griechische Denken aus den mathematisch kalkulierbaren Naturvorgängen ableitete. Aber immer dann, wenn Mathematik das Reich der Freiheit betrat, stimmten ihre Berechnungen nicht mehr. Es blieb ihre Domäne, die Erdumlaufbahn eines Satelliten zu berechnen und auch den genauen Zeitpunkt seines Wiedereintritts in die Erdatmosphäre und das genaue Landegebiet. Hätte Mathematik einen Menschen in die Erdumlaufbahn geschickt, sie hätte damit rechnen müssen, dass der plötzlich auf die Idee kommen würde, sich die Sonne aus größerer Nähe doch einmal genauer anzuschauen, er wäre dabei wohl aus der Bahn geraten und abgestürzt, nur nicht dort, wo die Mathematik es berechnet hatte. Seit den Zeiten der alten Naturphilosophie war die Mathematik selten um eine Formel verlegen, ging es um die Vorgänge in der Natur, um deren Gesetzmäßigkeiten, und für komplexe Rechenvorgänge standen ab der Neuzeit ausgeklügelte, mechanische Rechensysteme zur Verfügung; es hätte eines Computers wahrlich nicht gebraucht, schon gar nicht, um Fragestellungen und Probleme, die sich im Zusammenhang mit der menschlichen Existenz aufstellen, zu berechnen. Das wusste Philosophie bereits lange vor Aristoteles, dass das menschliche Dasein allein schon deshalb nicht berechenbar ist, weil vieles darin von ambivalenter Bedeutung ist und stets ein Geschehen in der Zeit ist. Dass wusste schon die Medizin des Hippokrates zu beachten und der war bekanntlich etwa achtzig Jahre vor Aristoteles auf Kos geboren.
Die Vorstellung, dass eine digitale Rechenmaschine geradezu ideal für alles sei, was man rechnen, klassifizieren, sortieren und entscheiden kann, wurde ihr nachgetragen und in dieser Nachträglichkeit gleich mitgegeben wurden uralte Vorstellungen eines universellen Denkens, welches aus der Vorstellung entsprang, dass Denken grenzenlos sei und letztlich alles rechnen, klassifizieren, sortieren und entscheiden kann. Der PC als Universalmaschine war also eine Spätgeburt, um nicht zu sagen, eine späte Fehlgeburt in dieser Hinsicht. Er kann, so man dies will, alle Routinearbeiten des Denkens hoch effizient automatisieren. Er kann alles, was es an Routinearbeiten im Büro gibt und das mit jetzt einsehbarerer Effizienzsteigerung. Er ist schneller in automatisierbaren Prozessen, beschleunigt die Abarbeitung linearer Prozesse. Als dies, angetrieben zu Anfang von Rank Xerox in Palo Alto immer deutlicher wurde, hielten alle Ausschau nach automatisierbaren Vorgängen, um diese sozusagen aus der realen Welt in eine digitale Welt der Simulation zu verlegen und die wurde zu einer riesigen Baustelle, auf der man eigentümlicherweise ganz und gar unzumutbare Erfahrungen duldete, die sich, außer in der Kunst, kaum eine Branche hätte jemals erlauben dürfen. Und wie auf allen Baustellen ging und geht es auch auf der der Digitalisierung extrem rau und sehr laut zu.
Die ersten kommerziellen Rechner überzeugten die Anwender für einfache Büroroutinen wie Lohnbuchhaltung und Lagerverwaltung nicht sofort, erst allmählich. Die Grundlagen für die elektronische Datenverarbeitung waren damit zwar gelegt, aber längst nicht übertragen in die jahrelang bewährte, ruhige Routine endloser Sitzreihen in Großraumbüros. Was mit dem PC an Aggressionen, Flüchen und anderen emotionalen Ausfällen verbunden war, ist heute kaum mehr vorstellbar, was an Aufwand betrieben werden musste schon mit Textverarbeitungsprogrammen und dann mit Tabellenkalkulationen spottet eigentlich jeder Beschreibung. Bereits 1956 trafen sich im Dartmouth College in Hanover, New Hampshire, zahlreiche führende Mathematiker, Informationswissenschaftler, Kybernetiker und Elektroingenieure und verkündeten den Durchbruch in die Künstliche Intelligenz, KI, das ist nun 64 Jahre her. Wie war das noch vor fünf Jahren? Da verkündete man den Durchbruch zur neuen, fahrerlosen Mobilität, die ja auch auf KI aufbaut und das Fahren mit autoähnlichen Gefährten vor allem sicherer machen sollte. Rein statistisch müssten alle bestehenden Testfahrzeuge noch etwa 238 Jahre so weiter testen, um eine mit Menschen hinter dem Lenkrad vergleichbare Unfallstatistik zu erreichen; nur leider finden die Tests nicht auf denselben Straßen statt, daher dürfte es wohl noch erheblich länger dauern, wenn es so weitergeht.
Als IBM die Leistungen von PC und Großrechner in einer Client-Server-Architektur zusammenbrachte, als man also den PC mit einem Zentralrechner verbunden hatte und so von dort Daten abrufen konnte, die mit Hochleistungsrechnern aufbereitet worden waren, dachte man wieder vor einem großen Durchbruch zu stehen und die Kinderkrankheiten der PC-Welt zu den Akten legen zu können. Wie wir wissen, hat IBM diesen Schritt selbst nur mit äußerster Mühe überlebt, war fast Pleite und die große Welt der Business-to-Business Anwendungen war um einen Giganten fast ärmer. Als 1993 der Mosaik-Browser die Verfügbarkeit von Informationen weltweit und für jedermann erlaubte und zugleich die E-Mail die Briefkommunikation digital simulierte und mit Lichtgeschwindigkeit zu kommunizieren ermöglichte wurde klar, die neue Welt vernetzter PCs war keine mehr der nur reinen Simulation, gleichwohl vieles noch so aussah wie in der sogenannten analogen Welt. Raum und Zeit waren nicht mehr das, was sie einmal waren, Grenzbegriffe des Daseins. Gleichzeitigkeit in der Kommunikation über Raum- und Zeitgrenzen hinweg gab es bereits seit Einführung der Telefonie, aber mit der E-Mail gelang eine Form der Kooperation, die es vorher so nicht gab. Text und Bilddateien wurden gleichzeitig verfügbar von einem Ende der Welt zum anderen und die räumliche Nähe kooperierender Menschen wurde zur Kontingenz. Mit der Relativierung von Raum und Zeit in der Informations- und Kommunikationstechnologie eröffnete sich eine neue Idee und ein neues Geschäftsmodell in der Wirtschaft zugleich. Wenn die Wirklichkeit ein Datensatz ist und dieser ohne die Grenzen von Raum und Zeit jederzeit überall verfügbar und ausführbar ist in allen Belangen wirtschaftlicher Abläufe, dann haben wir mit dem Computer die perfekte Universalmaschine gefunden und in seiner Vernetzung zu technischen Plattformen eine neue Ökonomie, die Digitalwirtschaft, die der traditionellen Form der Ökonomie in allen Belangen weit überlegen ist.
Diese Idee trieb die erste Generation der Digitalwirtschaft an, deren Ausdruck auf dem Finanzmarkt: „Wette niemals gegen das Internet“ war. Amazon, Ebay, Google, Apple wurden mit zigtausenden neuer Geschäftsideen zu einer regelrechten Planwagen-Karawane, die, von Aktionären und Risikokapital begleitet an die Börsen in Manhattan und der City of London zogen. In Deutschland dauerte es kaum vier Jahre, in GB und den USA ein wenig länger, da war die Idee geplatzt und ein Großteil der sogenannten Dotcom-Generation, gerade noch zum Millionär im Money of Account (Band II. Kap. 5: Das Geld…) aufgestiegen, wieder Pleite. Es wurde für eine kurze Zeit recht ruhig auf der digitalen Baustelle, aber der eingeleitete Prozess der digitalen Transformation war unumkehrbar geworden. Noch heute plagen die Anwender Betriebssysteme und Anwendungssoftware, aber wer will wirklich auf Desktop-Publishing (DTP) verzichten? Wer will auf das Internet verzichten?
Nach einer ganz kurzen Pause der Ruhe begannen die Unternehmen und die Finanzmärkte wieder in neuem Getöse. Aus den riesigen gekühlten Hallen der Großrechner schallten die Rufe von der Vorhersagbarkeit der Zukunft. Als eine der ersten zivilen Anwendungen erlebte die Welt Berechnungen zur Bevölkerungsentwicklung, deren statistische Prognose auf allen Ebenen mehrfache Korrekturen erfuhr und mittlerweile, auch ohne Covid-19, mehr Korrekturen als einigermaßen gesicherte Statistiken produziert. Aussagen über die zukünftige Präsidentschaft in den USA und anderen entwickelten Industriestaaten mussten signifikante Einflüsse fremder Geheimdienste und halb-ziviler Hacker vor allem in den Sozialen Medien einräumen, sogar Einzelpersonen wie z.B. Rezo, der kurz vor einer Wahl in Deutschland ein Anti-CDU-Video ins Netz gestellt hatte, in dem er satte 45 Minuten die Christdemokraten ordentlich beschimpfte, verhageln den Mathematikern mitsamt ihren digitalen Großhirnen die Show. Aber schlimmer noch stehen die Apologeten von Big Data aus den Naturwissenschaften vor einem Paradox, welches sie selber geschaffen haben.
Die Idee, mit Big Data die Zukunft vorhersagbar werden zu lassen, gelingt längst nicht so elegant wie gedacht, selbst bei linearer Betrachtung. Selbst solche Entwicklungen, die aus der Vergangenheit betrachtet sich in eingerechneter Fehlertoleranz linear in die Zukunft fortschreiben lassen, haben nicht selten fraktalen Charakter auf den zweiten Blick. Legt man einmal etwas Wert auf die Reflektion, was in einem zweiten Blick erscheint, also auf die Frage, ob etwas Verbindendes zwischen den der ersten Betrachtung erscheinenden Phänomene immanent ist und was dies sein könnte, dann wird man schnell erkennen, dass der Begriff der Digitalisierung alle jene Eigenschaften einschließt, die sich auf den zweiten Blick als dynamische Attribute, als charakteristische Eigenschaften oder Wesensmerkmale erschließen lassen, und die der ersten Inaugenscheinnahme der phänomenalen Eigenschaften geradezu diametral gegenläufig sind.
So ist Digitalisierung zuerst verbunden mit dem was wir mit Sortieren, Klassifizieren und Berechnen kategorisiert haben – die meisten Autoren nehmen „entscheiden“ noch in diese Reihenfolge auf. Auf den zweiten Blick aber erkennen wir, das Digitalisierung zugleich, und wir meinen damit tatsächlich eine ganz enge Verbindung von Gleichzeitigkeit und Ungleichzeitigkeit, auch aus der Unberechenbarkeit der Zukunft – und auch des Vorhandenen, also phänomenal Gegenwärtigen – seine Energie, seine Dynamik schöpft. Denn mit Digitalisierung ist von Anfang an verbunden die Fort- wie auch die Neuentwicklung von Techniken, die die lineare Entwicklung der Computertechnologie konterkarieren. Eine anti-kategoriale, also nicht sortier- und berechenbare, nicht systematisier- bzw. klassifizierbare Dynamik finden wir allenthalben inmitten einer praxisorientierten Technik, die die Linearität durchbricht und die Vorhersagbarkeit einschränkt, wenn nicht gar ad absurdum führt. Das ist das Vorhersage-Paradox, dass Zukunft nicht berechenbar ist, da sogar die beste aller denkbaren Berechnungstechniken, auch die, die wir mit den Quantencomputern verbinden, in sich selbst schon fraktal ist und ihre eigene technische Berechenbarkeitsentwicklung unberechenbar sein lässt. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht wahrscheinlich ist, eine als dominant vorgestellte Option unter vielen, also primus inter pares.
Auch wir wollen in diesem Band uns mit der Zukunft beschäftigen, der Zukunft der Digitalisierung in Verbindung mit politischer Macht, Geld und Künstlicher Intelligenz, die uns von heute aus betrachtet die Zukunft vorstellen lassen wollen. Sie wollen dies, was den politischen Willen zur Macht betrifft, als eine helle und strahlende Zukunft mit mehr Wohlstand, sozialer Sicherheit und unangreifbarer Freiheit, weder durch Kriminalität, Gewalt und Terror. Die Finanzmärkte erzählen uns dies schöne Märchen der modernen Geldtheorie, wonach unser Wohlstand auf ewig gesichert ist, weil Schulden Ewigkeitsschulden sind, so sie von Staaten als finanzielle Wohltaten über die Menschen ein wenig und über die Wirtschaft aus vollen Kübeln herabregnen. Die hochverschuldeten Regierungen arbeiten unablässig am Narrativ der Wohlstandentwicklung und die Ökonomik sieht sich nicht selten an deren Seite mit Wachstumsprognosen und staatlichen Konjunkturprogrammen und Konsumhilfen bei Bedarf. Und schlussendlich gründet dies alles in den Finanzmärkten, die historisch, also linear betrachtet, von einem Höchststand der Indizes zum nächsten eilen und Finanzkrisen als Unfälle mit lediglich kleinen Blechschäden äußerlicher Art erscheinen lassen. Der Motor läuft weiter wie geschmiert; ist das so? Und bleibt das so?
Das jedenfalls legen die Hauptakteure des wirtschaftlichen Wachstums nahe, die zugleich auch die Hoffnungsträger innerhalb der Entwicklung zum Besseren sind: die Digitalisierung und mit ihr die neue Finanzwirtschaft und die Digitalwirtschaft. Wir schauen uns diese Entwicklung zum Besseren ein wenig genauer an. Was macht die Digitalisierung der Geld- und Finanzwirtschaft zu einer neuen Finanz- und Geldwirtschaft denn wirklich aus? Welche Transformationsvorgänge betreiben die Entwicklung vom Fiat Geld zum Krypto Geld? Werden wirklich alle Distributionsagenten verschwinden? Welche Bedeutung haben in Zukunft Notenbanken, Geschäftsbanken und Sparkassen noch? Was bleibt von unserem geliebten wie gehassten Fetisch Geld? Wir müssen uns zur Beantwortung unserer Fragen auch und zuerst auf die technologische Seite des neuen Geldes begeben und uns die Blockchain Technologie sowie die Digital Ledger Technologien anschauen. Wir werden sehen, dass bei der Entwicklung von Kryptowährungen der Staat ordentlich mitmischt, weniger als mandatierter Regulator und legitimierte Aufsicht, sondern als der Hauptakteur in Währungsangelegenheiten. Wir werden erkennen, dass sein legitimer Auftrag zur Bekämpfung des Schwarzgeldes längst schon umgeschlagen ist in eine illegitime Anwartschaft des Staates auf das Geld der Bürgerinnen und Bürger, das er dann, wenn Kryptowährungen das Fiat Geld einmal abgelöst haben, leicht als Pfänder für sein ausuferndes Schuldenregime hinterlegen kann und sich so enorme finanzielle Ressourcen über die privaten Portemonnaies erschließt.
Wir verfolgen wie die Privatbanken in Deutschland und Europa nicht kampflos ihre Mittlerrolle in der Geldwirtschaft den neuen FinTechs und Kryptowährungen überlassen wollen und mit welchen Mitteln sie gegensteuern. Kurz ist die Zeitschiene im Rückblick, auf der der Kampf der Großbanken ihre schwierige Geburt einer paneuropäischen Lösung für Echtzeit-Zahlungssysteme bisher ausgetragen worden ist. Europa hat mit solchen digitalen Zahlungssystemen eigene Erfahrungen erst seit dem Jahr 2019 und ein, den US-amerikanischen Systemen Master Card und Visa ebenbürtiges europäisches Zahlungssystem ist noch nicht in Sicht. Aber je kürzer der Rückblick, umso weiter können sich die Vorstellungen von etwas Neuem in die Zukunft ausbreiten; dass wollen wir versuchen. Wie könnte ein paneuropäisches Konzept einer Digitalwährung aussehen? Welche Idee sollte dahinterstehen? Wie kann man verhindern, dass der Staat alle seine Privatbürger in die Haftung für seine hemmungslose Ausgabenpolitik nimmt?
Wer sich mit Digitalisierung beschäftigt und die Digitalisierung der Geldwirtschaft mit ins Kalkül nimmt, kommt nicht umhin, sich auch mit Künstlicher Intelligenz zu beschäftigen. KI ist bereits vielfach in Anwendung, in der Wirtschaft unter dem Stichwort Industrie 4.0, in der Automatisierung, der Robotik, der Logistik, im Transportwesen wie in der Luftfahrt; von den militärischen Anwendungen, den so harmlos bezeichneten „smart weapons“, angefangen bei der precision-guided munition bis hin zu den Killerdrohnen, einmal abgesehen. Aber nicht nur in der Industrie fallen die digitalen Transformationen immer mehr ins Auge, auch in der Wissenschaft der Ökonomie sehen wir sie allmählich die Bühne des Diskurses betreten. Viel haben davon gehört, an den Finanzmärkten rechnen Hochleistungscomputer im Dienste der Gewinnmaximierung rund um die Uhr und beeinflussen nicht nur die Kontostände der Großanleger und Großinvestoren, sondern beeinflussen auch die Entwicklung ganzer Volkswirtschaften, wenn sie sie nicht gar schon mitentscheidend neben der Politischen Ökonomie steuern. KI sitzt mit im Auto und berechnet immer präziser das Wetter wie eine Vielzahl an Daten-Cluster, die wir als Apps und in anderen Formen auf unseren Smartphones im Einsatz haben. Die überwiegende Mehrzahl der Menschen benutzt KI bereits in ihren ersten Anwendungsformen, ohne sich dessen bewusst zu sein; das wollen wir ein wenig verändern in Richtung Kenntnis und Vorstellungen von den Konsequenzen dieser neuen Technologie, die sich selbst in die feinsten Verästelungen unseres Daseins einwebt.
Wir schauen uns also die modernen Berechnungsmethoden der digitalen Technologien etwas genauer an. In unseren diesbezüglichen, kritischen Betrachtungen kommen aber weniger Methoden der Berechenbarkeit zur Anwendung als Vorstellungen zu Begriffen, weniger wollen wir selbst Berechnungen anstellen, als die Ergebnisse der modernen Berechnungen uns in ihrer Bedeutung für unser Dasein vorstellbar machen. Was also auf uns zukommt durch die neuen Technologien und was wir selbst dort hineinbilden an Vorstellungen, Wünschen und Erwartungen, wenn wir moderne digitale Technologien entwickeln, für diese Fragen wollen wir die Grundlagen einer Beantwortung legen, erste schon in diesem, weitere dann im nächsten Band unserer Philosophie des menschlichen Daseins.
Kapitel 1: Money Down
In Band IV. haben wir mit einem düsteren Ausblick auf das Bargeld geschlossen. Und dies war mehr als eine These bzw. Hypothese auf die Zukunft, dass die goldenen Zeiten des Bargeldes gezählt sind. Noch wird in weiten Teilen der westlichen Welt, der einst so erfolgreichen Industrienationen mit Bargeld bezahlt. Und dies nicht nur im Markt des privaten Zahlungsverkehrs. Industrie, Massenproduktion und barer Geldwert schienen unauflöslich miteinander verbunden zu sein, ‚nur bares Geld ist wahres Geld‘ lautete die Universalformel der Wertermittlung, die dann später auch ihre Entsprechung darin fand, dass der Monetarismus den Formelbezug zwischen Menge der Produktion und Geldmenge fand.
Wir haben uns die Geldmengen bereits genauer angesehen und die Relation zwischen Güter-Menge und Geld-Menge widerlegen können. Wir sind dabei auf eine andere Relation gestoßen, eine, die sich disproportional zueinander entwickelt, nämlich die Relation zwischen wirtschaftlichem Wachstum und Schulden-Wachstum. Eigentlich müsste mit dem wirtschaftlichen Wachstum das Schuldenwachstum umgekehrt proportional abnehmen; aber das weltweite Schuldenwachstum erfreut sich munterer Blüte, gleichwohl wirtschaftliches Wachstum weltweit signifikant zunimmt; die aktuelle Corona-Krise einmal außervorgelassen.
Nun wäre es einfach zu behaupten, das weltweite Wirtschaftswachstum beruhe auf Schulden; aber so einfach ist es nicht. Es ist wahr, aber deshalb noch nicht einfach, weder einfach zu verstehen noch einfach zu ändern. Was uns aber an dieser Stelle deutlich mehr interessiert ist, welche Auswirkungen haben die anwachsenden Schulden in der Wirtschaft – und wir fügen ausdrücklich hinzu – bei den Regierungen in der Welt, für die Wirtschaft, die Menschen und letztlich auch für die gesellschaftspolitischen Verhältnisse, in denen sie leben? Schauen wir uns die Entwicklung von Bargeld und Schulden an, dann werden wir schnell feststellen, dass es diese Form der Entwicklung, ohne die Entwicklung der Digitalisierung des Zahlungsverkehrs nicht gäbe und nicht einmal oberflächlich zu verstehen wäre. Also, nun ein Blick nach China, wo diese Entwicklung sich am deutlichsten zeigt.