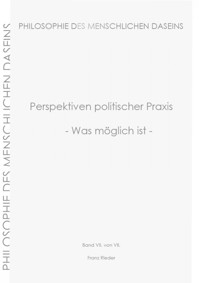
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Band VII: Perspektiven. Dieser Band ist ein Sammelsurium im besten Sinne; eine Ansammlung von Möglichkeiten, die in der Zukunft möglicherweise eine Rolle spielen werden und deshalb auch Möglichkeiten mit Perspektiven zu nennen sind. Es gibt viele Möglichkeiten, aber nicht alle haben die Perspektive, eine Rolle, eine entscheidende Bedeutung in unserem Leben in der Zukunft zu spielen, gar unserem Dasein einen anderen, vielleicht sogar einen neuen Sinn zu verleihen. Ganz gleich, ob unser Dasein durch neue Seinsmöglichkeiten bereichert wird, oder nicht. Denn auch die Frage nach dem Wert eines neuen, sinnvollen Lebens kann nicht endgültig beantwortet werden, zumal, wenn Veränderungen mit neuen Perspektiven sich erst noch in der Phase der Entwicklung oder in einer Phase der Transformation von Altem auf Neues hin befinden. Eine praktische Philosophie, die unser Dasein aus neuen Möglichkeiten und neuen Perspektiven betrachtet, bleibt notwendigerweise also vage, was nicht heißt, irrelevant.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1091
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Philosophie des menschlichen Daseins – Band 7 von sieben Bänden.
Erstmals veröffentlicht 2021 im Selbstverlag.
Copyright © 2025 der deutschsprachigen Ausgabe 2025 durch
Franz Rieder, Nievenheimer Str. 17, 40221 Düsseldorf
E-Mail: [email protected]
Herstellung:
epubli - ein Service der neopubli GmbH, Köpenicker Straße 154a,
10997 Berlin
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung:
Vorwort
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Kapitel 1: Demokratie - Reform
Perspektiven in Urteilen
Kants Vermächtnis
Bestimmende und reflektierende Urteilskraft.
Der naive Realismus der Übereinstimmung
Zur Repräsentation im Recht
Prozesse der Repräsentation
Strukturierte Repräsentation
Ein-Fall des Zweifels
Dem Zweifel eine Orientierung geben
Struktur von Fehlurteilen
KI in der politischen Willensbildung
Muster in politischen Narrativen
Überlegen unüberlegt
Überlegt unterlegen
Der Protest – Thematisch und methodisch
Zum Modus operandi
Politik orientierungslos
Politische Orientierungen
Akutes Regieren
Akut gefährdet
Kapitel 2: Erweiterte Repräsentation
Rentenzeiten
Volksabstimmung
Netzausbau
Politische Praxis
Gesundheitswesen
Sozialer Wohnungsmarkt
Neue Staatsfonds
Renten- bzw- Pensionsfonds
Transgenerative Sparfonds
Ausschüttungsfonds
Transformative Staatsfonds
Reichtum der Kultur
Eine Angelegenheit der Frauen
Kapitel 3: Die Ökonomie der Direkten Demokratie
Direkte Demokratie und Ökonomie
Vom Verschwinden der Märkte
Das Warenhaus im Wohnzimmer
Die Wiederentdeckung der Moral
Die Moral der Sozialkritik
Die Moral der Politischen Ökonomie
Die Moral der Verteilung
Gerechtigkeit ist unmoralisch
Die Moral der Freiheit und Freiwilligkeit
Verschwörungsregime
Von der Krisen-Moral
Zum besseren Leben
Kurzer Rückblick in die Generationen
Offene Fenster – geschlossene Türen
Der Kostenfaktor Bestandswahrung
Bestand und Differenz - Exkurs
Direkte Demokratie: Bestand und Perspektiven
Kapitel 4: Zukunftsthema Schulden
Geld schöpfen aus dem Nichts
Das Trugbild von der Marktwirtschaft
Märkte ohne Marktwirtschaft
Betrug ohne Betrüger
Die Kopula von Geld und Politik
Neofeudale Marktwirtschaft
Private oder öffentliche Schulden
Unsere Zukunft in der Kapitalunion
Rien ne va plus Giralgeld – Faite vos jeux Vollgeld
Neues Geld
Neues Geld – Neues System
Neues Haftungssystem
Gerührt, nicht geschüttelt
ESG – der neue Wandel
Kapitel 5: Ein Wandel im Ganzen
Niemand will hier ein Kapitalist sein.
Das Stakeholder-Prinzip
Risiken begegnen
Vom Kryptogeld…
… zur Kryptowährung
Zu Europas Währungssouveränität
Wenn schon Politik, dann aber richtig
Notenbank im Wandel
Wandel wohin? Deutung und Bedeutung
Wilde Richtungswechsel
Ruderlos auf offener See
Episode oder Ausweg?
Der Weg des KryptoGeldes
Die Identität der Personas
Die Identität eines Unternehmens
Die unsichtbare Arbeit
Das sichtbare und das unsichtbare Universum
Ein Blick ins Relevanz-Set der digital Natives
Komplex versus kompliziert
Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft
Emergenz der Geschichte
Die Pandemie des Geistes
Kapitel 6: Wertewandel
Der moderne Mensch…
… entdeckt das Paradox
… in sich selbst
Techlashing
Selbstwertgefühl
Selbstwertschätzung
Eine Betrachtungsweise
Identität…
…Womit?
Erwartungen und Überzeugungen
Ansprüche…
…an die Gemeinschaft
Die Triebstruktur der Gesellschaft
Antriebsformen der Gesellschaft
Eine Frage des Rechts
Recht und Wahrheit
Die Einheit im Bewusstsein
Bewusstseinswandel
Revision versus Widerstand
Die bestimmende Reflexion
Kapitel 7: Im Wandel
Eine schwierige Bestimmung
Eine widersprüchliche Bestimmung
Die Immunität der Macht
Die Immunität des Patriarchen
Das Ende der Patriarchen
Selbst eingehandelt
Das Recht der Patriarchen - Finale
Kapitel 8: Krieg und Frieden
Kriegsökonomie
Friedensökonomie
Die Rückkehr des Patriarchats nach Europa
Tango der Gleichgesinnten
Handelsvernunft
Post festum – ante festum
Trading en Block
Das Block-Dilemma
Wahrheit und Täuschung
Die neuen „Rollenspiele“
Das neue Ensemble im digitalen Theater
Street oeconomy
Digital Oeconomy
Grundzüge einer neuen Taxonomie der Arbeit
Die Ziele der neuen Taxonomien
Marktwirtschaftliche Taxonomien
Wohlstand für alle
Stahlharte Bedingungen
Fairer Wettbewerb
Wohlstandspakt
Gerechtigkeit ist asymmetrisch
Der Preis des New Work
Struktureller Wohlstandsverlust
Kopfgeldjäger
Armes reiches Land
Nachspielzeit
Kapitel 9: Schluss mit Frieden
Literaturliste
Vorwort
Band VII: Perspektiven. Dieser Band ist ein Sammelsurium, eine Ansammlung von Möglichkeiten, die in der Zukunft möglicherweise eine Rolle spielen werden und deshalb auch Möglichkeiten mit Perspektiven zu nennen sind. Es gibt viele Möglichkeiten, aber nicht alle haben die Perspektive, eine Rolle, eine entscheidende Bedeutung in unserem Leben in der Zukunft zu spielen, gar unserem Dasein einen anderen, einen neuen Sinn zu verleihen. Ganz gleich, ob unser Dasein durch neue Seinsmöglichkeiten bereichert wird, oder nicht. Denn auch die Frage nach dem Wert eines neuen, sinnvollen Lebens kann nicht endgültig beantwortet werden, zumal, wenn Veränderungen mit neuen Perspektiven sich erst noch in der Phase der Entwicklung oder in einer Phase der Transformation von Altem auf Neues hin befinden. Eine praktische Philosophie, die unser Dasein aus neuen Möglichkeiten und neuen Perspektiven betrachtet, bleibt notwendigerweise also vage, was nicht heißt, irrelevant.
Band VI: Veränderung. Dieser Band versucht den komplexen Sachverhalt von Bewahrung und Veränderung aus vielen, möglichst den relevanten Perspektiven nachzuzeichnen in der Absicht, Klarheit zu schaffen. Klarheit darüber, was die wesentlichen Kräfte sind, die einer Bewahrung wie andererseits einer Veränderung entgegenstehen, wobei wir den Sachverhalt, also das, was bewahrt wird oder verändert wird in jeder Perspektive mit betrachten und also erst aus diesem Zusammenhang bestimmen können.
Band V: Digitalisierung. Dieser Band betrachtet den digitalen Wandel in den neuen Feldern der politischen Ökonomie, vor allem auf dem Feld der Geldpolitik. Hieraus ergeben sich Veränderungen auf allen Feldern der Ökonomie, und zwar in globaler Hinsicht. Mit der Einführung von Digitalgeld und der sukzessiven Abschaffung des Bargelds gewinnt die Geldpolitik immense Spielräume, die etwa das fünf- bis sechsfache dessen ausmachen, womit sie bis dato umzugehen in der Lage ist. Geld- und Fiskalpolitik werden so in absehbarer Zukunft kaum noch etwas damit zu tun haben, was wir bislang davon kennengelernt haben. Für die Wirtschaft und die Wissenschaft der Ökonomie hat das weitreichende Konsequenzen. Die Wirtschaft wird sich darauf einstellen müssen, dass sie zunehmend weniger in marktwirtschaftlichen Zusammenhängen operiert. Die Wissenschaft darf sich darauf einstellen, dass damit auch fast alle ökonomischen Kategorien ihre wissenschaftliche Relevanz verlieren. Digitalisierung beschäftigt uns auch im Zusammenhang mit den neuen Kryptowährungen und natürlich auch im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz, beides neue Technologien, die unser Leben mehr verändern, als dies Technik vorher jemals konnte. Sie verändert unsere Art zu arbeiten, unser Freizeitverhalten, unsere Bildung und auch unser Bewusstsein, und nicht zuletzt unseren Umgang miteinander grundlegend. Wie solche grundlegenden Veränderungen in die Welt kommen, darum geht es in diesem Band. Die sozialen, kulturellen und zwischenmenschlichen Auswirkungen der neuen Geldpolitik und der neuen Technologien in Hinblick auf die Lebensgrundlagen und Lebensverhältnisse, in denen das menschliche Dasein sich entfaltet, wird uns in einem Band VI. dann beschäftigen.
Band IV: Zu einer neuen Politischen Ökonomie. Dieser Band beschäftigt sich mit den Modellen der klassischen und neoklassischen Ökonomik, die eine wissenschaftliche Entwicklung beschreiben, deren letzten Kapiteln wir gerade beiwohnen. Hier werden die Schlusskapitel der politischen Ökonomie geschrieben, die mit den Transformationsprozessen innerhalb der Politischen Ökonomie nicht mehr Schritt halten können, weil sie mit den wirklichen Einflüssen, die Politik heute über die Notenbanken auf die Ökonomie ausübt, intellektuell nicht mitkommen.
Band III: Die Transformation der Marktwirtschaft beschäftigt sich mit den Prozessen innerhalb der Ökonomik, die aus der klassischen politischen Ökonomie herausführen in eine Wirtschaftsform, die immer weniger zu tun hat mit einer Marktwirtschaft, sei diese nun eine Liberale Marktwirtschaft, wie in den angelsächsischen Modellen, oder innerhalb von einer Sozialen Marktwirtschaft wie in den europäischen Modellen.
Band 2: An die Arbeit behandelt die theoretischen Systeme, die sich mit der menschlichen Arbeit beschäftigt haben. Das sind wenige aus der Philosophie, die man zudem auch nur einigermaßen systematisch nennen kann. Da sind die Theorien der politischen Ökonomie, angefangen bei Platon, dann differenzierter bei Aristoteles bis hin zu Adam Smith und Karl Marx. Und natürlich die Wissenschaften der Ökonomie, die wir unter den Begriff der Ökonomik versammeln.
Thematisch geht es in diesem Band um den Zusammenhang zwischen individuellem Wohlstand und gesellschaftlicher Wohlfahrt in grundlegender Absicht. Dabei spielen Überlegungen zur Wertschöpfung (Produktion) und zu den Märkten hinsichtlich der Entwicklung von Löhnen und Gehältern und deren Auswirkungen auf die Preise (Konsum) eine zentrale Rolle. Dort von den Konsummärkten, wo Angebot und Nachfrage herrschen, blicken wir wieder zurück auf die Einflussfaktoren bei der Herstellung der Güter, auf Eigentum, Geld und Kreditzinsen.
Dabei entwickeln wir durch den gesamten Band II eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Ideologien, an deren Basis die des Homo Oeconomicus steht. Und mit dieser Auseinandersetzung um das Prinzip der unbedingten Nutzenmaximierung auch die Frage, ob man zu einer besseren Theorie und Praxis für und in der Art, wie wir unser Dasein reproduzieren, kommen kann, wenn wir dieses Nutzen- bzw. Gewinnmaximierungsprinzip abschaffen würden.
Band 1: Andenken behandelt in knapper Form die Entstehung und Entwicklung wichtiger Themen und Denkmuster, angefangen in der antiken, griechischen Philosophie bis in die Moderne des Abendlandes. Dabei wird eine Neubestimmung abendländischen Denkens aus der Komplementarität von Denken und Sein vorgenommen und damit die bestehenden Bestimmungen aus dem Gegensatz und der Negation bzw. dem Widerspruch zwischen Denken und Sein überwunden. Eine Neubesinnung auf das Thema und die Phänomenologie der Macht als politische Macht will die Inflation soziologischer Machtbestimmungen beenden und den Weg aufzeigen, wie politische Macht als phantasmatische Macht im Dasein des Menschen sich ausgebreitet hat und heute weiter prozediert.
Einleitung
Der Band VII. unserer Philosophie des menschlichen Daseins beschäftigt sich mit dem, was möglich ist. Haben wir uns im Band VI. noch damit beschäftigt, was möglich ist und was dem Möglichen so sehr entgegensteht, dass dies nicht zur Entfaltung kommt, so steht nun im Zentrum der Betrachtung das, was möglich ist, selbst, indem es sich aufdrängt, fast schon unausweichlich geworden ist. Natürlich ist mit jeder Veränderung auf eine Möglichkeit hin auch verbunden eine Veränderung der bestehenden Sichtweisen und die betrachten wir natürlich mit. Wenn wir von einer Reform der Demokratie sprechen, dann analysieren wir also nicht nur die Schwachstellen, die wir im System der Repräsentativen Demokratie ausgemacht haben, sondern deren komplementäre Faktoren (Band I. Kap. 1: Der Begriff der Komplementarität1), die Strukturen von Urteilen und Fehlurteilen in kulturellen, politischen und juristischen Hinsichten. Wir beschäftigen uns mit den Folgen der Repräsentativen Demokratie, einmal mit der Frage, ob die demokratischen Verfahren von Wahlen, Abstimmungen, Befragungen und medialer Diskurse noch ihren Zweck erfüllen, dass in politischen Urteilen (Mehrheitsurteilen) sich auch die politische Willensbildung repräsentiert.
Urteil und Wille, stehen sie wirklich in einem relationalen Verhältnis zueinander, oder entwickeln sich beide zueinander wie Paralleluniversen? Dieser Band VII. wurde in Zeiten der Corona-Pandemie geschrieben und wenn es markante Erfahrungen und Erkenntnisse aus dieser Zeit gibt, dann dass politische Urteile und politischer Wille auseinanderstreben, sich so sehr voneinander entfernen können, dass eine nachvollziehbare Beziehung zwischen beiden schwer bis unmöglich ausfällt. Im Verhalten von Politik konnten wir über einen langen Zeitraum kaum logisch nachvollziehbare Entscheidungen und Handlungen erkennen, zu verstehen gab es dabei auch recht wenig, einzig, dass mit anstehenden Wahlen eine politische Zweckrationalität dominierte und alles andere im Stauraum des aktuellen Geschehens ablegte. Der war mit der Zeit zum Platzen vollgestellt und immer noch quellen die politischen Unterlassenschaften vieler Jahre hervor. Deutschland hat keine digitale Nachverfolgung der Inzidenzen, obwohl deutsche Software in einigen afrikanischen Ländern diesbezüglich gute Dienste leistet. Deutschland hat extremen Mangel bei der Beurteilung, was Freiheit ist; eine kulturelle Schande für den Umgang mit der deutschen Aufklärung, mit Kant und Hegel, mit Leibniz, Fichte und Schelling, mit Erasmus von Rotterdam und Luther, um nur einige zu nennen. Immanuel Kants berühmte Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? (Dezember 1784) zeigte doch einen Ausweg aus selbstverschuldeter Unmündigkeit durch die Fähigkeit des Menschen, sich Klarheit über einen Sachverhalt zu verschaffen, aus der dann die Entwicklung einer mündigen Persönlichkeit sich zu entfalten vermag, die das Wagnis, klug oder gar weise zu sein, einzugehen und über die Lebenszeit hinweg zu bestehen vermochte.
‚Sapere aude‘, was ist daraus geworden? Wie sollen Wille und Urteil zusammengehen, wenn das Urteilsvermögen bei jedem Einzelnen aus den Fugen gerät, wenn Urteils- und Willensbildung auf einer Tour der Unvernunft unterwegs sind? Verschwörungstheorien haben Konjunktur, Shitstorm ist das neue Wort für Kommunikation mit Ansichten von Clowns, die es bis zu Regierungschefs bringen; und Fake News suggerieren, es gäbe noch eine Mehrzahl an Informationen mit klarem Sachverhalt. So kommen wir nicht umhin, uns mit Urteilen und mit dem Willen und deren Zusammenhang zu beschäftigen. Was bedingt unsere Urteile, was bedingt unsere politischen Entscheidungen und auch unsere politischen Willensbekundungen? Aber wir bleiben nicht bei den Fragen stehen, sondern versuchen uns in jedem Kapitel dieses Bandes um Lösungsansätze. Wir erarbeiten einen erweiterten Begriff der Repräsentation und dehnen diesen so weit wie es geht aus. Uns reicht es nicht, uns in politischen Urteilen repräsentiert zu wissen, zumal wir immer weiter weg uns entfernen von einem repräsentativen Mehrheitsprinzip. Und weil wir heute über eine ganze Reihe von Möglichkeiten verfügen, die unseren politischen Willen besser und differenzierter repräsentieren können als bislang. Aber nicht nur dem politischen Willen im engeren Sinne wie bei Wahlen und Abstimmungen gilt unser Augenmerk. Auch unsere Wirklichkeit soll hinterfragt werden, was sie repräsentiert. Was repräsentiert unser Rentensystem, was unser Gesundheitswesen, was unser Wohnungsmarkt und können wir in den dortigen Entwicklungen wirklich die Umsetzung der Bedürfnisse der meisten Menschen in unserer Gesellschaft verwirklicht sehen?
Wenn es nun nicht so ist, dass sich unser Dasein entlang unserer Bedürfnisse und Interessen entwickelt, jedenfalls der Bedürfnissen und Interessen der meisten von uns, was bleiben dann für Möglichkeiten? Wir sehen eine Antwort auf diese Frage in Verfahren der Direkten Demokratie und verbinden diese Verfahren mit unseren ökonomischen, sozialen und moralischen Wirklichkeiten. Es mag für viele von uns so scheinen, als lebten wir in einer Welt, die uns ermöglicht, viele Bedürfnisse mehr als noch vor wenigen Jahren zu befriedigen, und nicht nur das, sondern dazu noch auf recht komfortable Art und Weise. Wir shoppen vom Bett aus, kommunizieren mit der Welt und in verschiedenen Gruppen, haben ganze Stadtbibliotheken auf unseren Festplatten oder Zugang zu weltweiten Informationen und Services über Clouds., alles, nur für uns. Wir teilen zwar die Links und Likes, aber ist beine Gruppe oder gar eine Gesellschaft, die Informationen und Wissen untereinander teilt, die ausgiebig kommuniziert und global kooperiert deshalb schon eine soziale, eine solidarische Gesellschaft?
Wir können bestimmte Themen nicht mehr diskret behandeln oder gar weit von uns weisen oder an die nächste Generation übergeben. Beim Thema Umwelt- und Naturschutz, beim Thema Schulden bzw. Staatsverschuldung gelingt die Staffelübergabe nicht mehr, die Jugend läuft nicht mehr mit. Also weichen wir der Frage nicht aus, was wir tun können, ja tun müssen, um selbst bei solchen Themen voranzukommen, ganz beheben, was unsere Generation versaut hat, können wir nicht mehr. Was wir in der Zukunft tun können, was auch möglich ist, ist mehr direktdemokratische Verfahren nutzen, um die Politik zu schnelleren Entscheidungen zu motivieren, dazu machen wir eine Reihe von Vorschlägen, die nicht ideologisch, sondern technischer Art sind. Dazu nutzen wir moderne Technologien zur Vorbereitung parlamentarischer Verfahren. Warum?
Weil die Themen, die unsere Gesellschaft beschäftigen, immer zahlreicher werden und Politik, wie in den letzten beiden Jahrzehnten ganz besonders ernüchternd erfahren werden musste, drängende Themen einfach liegen gelassen, auf die lange Bank geschoben hat, oder wie die Kanzlerin der vertagten Lösungen gerne ausdrückte: wir müssen Zeit kaufen. Die Arbeitsverweigerung der ehemaligen Regierungen, aus welchen Gründen auch immer, aus Gründen anstehender Wahlen oder Rücksichtnahmen diverser Interessengruppen usw. kommen allen, aber vor allen der nächsten Generation unrechtmäßig teuer zu stehen; das hat sogar das oberste Gericht Deutschlands so festgehalten2. Deutschland hat in vielerlei Hinsicht sein Tafelsilber verscherbelt. Die Infrastruktur hat den maroden Grad manches Schwellenlandes erreicht, bei der Versorgung mit 5G im Kommunikationsnetz ist Deutschland bereits zum Entwicklungsland geworden. Energieunabhängigkeit und Transformation von fossilen zu erneuerbaren Energieträgern ist in weite Ferne gerückt, auch wenn nun ambitionierter regiert wird. Was das in Preisen und politischer Gestaltungsfähigkeit bedeutet, sehen wir heute im Februar 2022 in Europa. Seit dem 24.02.2022 ist wieder Krieg auf dem alten Kontinent; davon handelt unser Schlusskapitel dieses Bandes.
Spricht man über das, was möglich ist, sollte es gute Sitte sein, auch einige Gedanken daran zu verschwenden, wie das, was man da für möglich hält, auch finanziert werden könnte oder sollte. Es war uns über alle sieben Bände hinweg ein wichtiges Anliegen, über Geld zu sprechen. Wie wir es verdienen, wofür wir es einsetzen, welchen Einfluss Geld auf unser Dasein hat und wir haben dabei gesehen, so einfach sind solche Themen nicht, schon gar nicht in nonchalanter Art abzufertigen, wie dies in der zeitgenössischen Philosophie und in Teilen der Politik üblich geworden ist. Wir zählen bereitwillig vorhandenes Geld und fragen uns, ob und wie man das Geld besser verwenden könnte. Dabei werden wir feststellen, dass auch die alten Unterscheidungen von Geld und Kapital so richtig nicht mehr sind, schon gar nicht wirklich brauchbar für die neuen Anforderungen, gesellschaftliche und von Menschen gemachte „natürliche“ Probleme zu bewältigen. Auch darin sehen wir eine Form der intellektuellen Arbeitsverweigerung, wie schnell und behende Politik vorangeht mit einem Katalog neu erfundener ethischer Grundsätze, als wäre der gleichzusetzen mit der Bibel moderner Politik; honi soit qui mal y pense!
Themen von Relevanz werden zahlreicher, ihre Lösungen teurer. Da hilft keine Ethik-Kommission, dieses scheinheilige Aperçu politischer Dekadenz, kein Feierabendgespräch oder dessen Kaminvariante, wenn es um die Sozialsysteme einer Gesellschaft geht und um eine Art zu wirtschaften, die am Ende die Spaltung zwischen Arm und Reich in Konfliktbereiche treibt, die keine Gesellschaft sich heute mehr leisten kann. Wir scheuen uns nicht, das Revolution zu nennen, wenn es um eine Um- und Neuorientierung in der Wirtschaft und im bürgerlichen Bewusstsein geht, weg von der Liberalen Doktrin in der Ökonomie und weg vom alles überbordenden Subjektivismus, von der personalen Ich-Identität. Wir stellen also nicht nur Fragen in die Formen der kollektiven Finanzierung der Sozialsysteme, ob diese ihre Funktion noch erfüllen, erfüllen können in der Zukunft. Wir stellen Fragen in die Finanzierungssysteme für den Natur- und Umweltschutz und ob diese privatwirtschaftlichen Ansätze den einzigen Sinn machen müssen, und ob nicht andere Formen der Finanzallokation und -Konstruktion weit mehr Erfolg versprechen und zudem weitere Teil der Solidargemeinschaft und der Zivilgesellschaft einbeziehen können.
Das mag illusionistisch erscheinen, ist es auch. Aber was wären wir, ohne unsere Vorstellungskraft? Wir jedenfalls wollen lieber illusionistisch sein als moralisch, eine Einstellung und Umgangsart zwischen Menschen, die zurzeit enorm zunimmt. Was in der Politik den Dispens des Denkens durch ethische Grundsätze ausmacht, spiegelt sich proportional in der Zunahme moralischer Urteile in der Zivilgesellschaft. Es gibt fast schon eine Faustformel ab, in Krisen schürfen Politik und Bürgerin und Bürger ihr Bewusstsein aus Ethik und Moral. Ist die Welt ja schon komplex genug, dass in Friedens- und Hochkonjunkturzeiten die Antworten auf Fragen, die sich in der Politik, in der Wirtschaft und in der Kultur stellen, sich so viel Zeit lassen, dass die Umstände sich schneller den Fragen entziehen, als diese Antworten zugeführt werden können, so gilt dies mehr noch unter den Tempomachern moderner Krisen. Dann spricht man schnell Unsinn, vom Verfall der Werte, vom traurigen Ende von Sitte und Moral und anderen lausigen Seinsauslegungen, die eine nie gekannte Anzahl an Veröffentlichungen hervorbringt. Die Virologen haben noch nicht ansatzweise die Corona-Pandemie verstanden, gibt es schon Dutzende von Büchern zum Umgang mit der Pandemie, gibt es Demonstrationen allen Ortes und aller geistiger Kolorationen, selbst US-Präsidenten gerieren sich als medizinisches Fachpersonal und antivirale Heilsbringer und schlagen vor, Reinigungsmittel in den Blutkreislauf zu spritzen, denn, was Haushaltsbakterien besiegt, macht wohl auch mit Viren im Körper kurzen Prozess.
Es scheint ein wenig so zu sein, als ob eine immer differenzierter werdende Welt das Bewusstsein der Menschen nicht unbeschadet lässt und dabei die Frage auftaucht, was an der Welt und am Bewusstsein der Menschen überhaupt noch brauchbar zusammengeht? Und der Prozess der Differenzierung nimmt eher Fahrt auf, als dass er sich verlangsamt. Hinzu kommt noch, dass diese Differenzierungen stattfinden in Zeiten großer Transformationen, was die Sache noch zusätzlich erschwert. Das politische System ändert sich, das demokratische Mehrheitsprinzip ist mittlerweile so sehr ausdifferenziert, dass eine Repräsentation des Volkswillens in den politischen Institutionen kaum mehr kenntlich erscheint. Die politische Ökonomie ist zu einer Politischen Ökonomie geworden und kaum mehr ist noch auseinanderzuhalten, was ist noch Marktwirtschaft, was eine moderne Form von Staatswirtschaft, was noch eine Lobby und was nicht bereits eine durch ökonomische Interessen gesteuerte Politik. Märkte verändern sich stark, aber das taten sie auch in der Vergangenheit, nur nicht so rasant schnell. Aber unter dem Einfluss von immer mehr Finanzkapital und zudem von neuen Technologien wie der Blockchain, die weit über das hinausgeht, was bislang noch mit dem Begriff Digitalisierung zusammenging, transformiert sich weit mehr als unser traditionelles Finanzsystem, in dem Banken die zentrale Rolle spielten.
Heute könnten wir auf Banken verzichten und dieser Verzicht konnotierte nicht wie üblich mit Einschränkungen; im Gegenteil. Neue Geldformen, neue Finanzdienstleistungen, neue Währungen ermöglichen auch einen neuen Umgang mit Geld und Kapital. Europa muss keine neofeudale Marktwirtschaft akzeptieren oder einer solchen gar folgen. Eine neosoziale Geldwirtschaft – um bei diesem etwas unglücklichen Ausdruck zu bleiben – eine viel mehr kooperative Kapitalwirtschaft können die Bekämpfung sozialer Ungleichheit zu einer wertschöpfenden Wirtschaftskraft werden lassen; denken wir solchen Ideen einmal nach. Wertschöpfung, nicht Umverteilung muss unsere Orientierung und unser Maßstab sein. Das haben wir in verschiedenen Zusammenhängen betrachtet und, es funktioniert. Besser noch in einer großen Wirtschaftsunion wie der EU, wenn denn dort Politikerinnen und Politiker Entscheidungen träfen, die auf Kenntnisse neuer Möglichkeiten durch die transformatorischen Veränderungen auf den Märkten, den Finanzmärkten wie den Erzeuger- und Konsummärkten, basierten. Wir können uns leider nicht des Gedankens erwehren, dass gerade in Hinblick auf die neuen, digitalen Technologien die Kenntnisse in Europa und in Deutschland besonders gering ausgeprägt waren und nur mühsam der Rückstand aufzuholen ist.
Immerhin, man liest mit Freude, dass Deutschland gerade bei den Digital Ledger Technologien (Band V. Kap.2) eher einen vorderen Platz im internationalen Vergleich einnimmt. In diesem Zusammenhang aber müssen wir auch feststellen, dass die für die Umsetzung solcher neuen Technologien gebotene Rechtssicherheit nicht gegeben ist. Hier werden wir emotional, wenn wir feststellen, dass die Jurisprudenz im Wissen wie in dessen Anwendung bei der Gesetzesausgestaltung hoffnungslos überfordert zu sein scheint. Welche Dimensionen die neuen Technologien in der juristischen Ausgestaltung der gesetzgeberischen Beschlüsse annimmt, scheint deshalb so schwierig zu handhaben zu sein, weil wenig Kenntnis vorhanden ist, wie die neuen Technologien funktionieren. Aber damit eine technologische Transformation gelingen kann, wäre mehr als Unwissen darüber von enormem Vorteil für das ganze Land; mit altem Wissen an neue Möglichkeiten heranzutreten, ist wenig hilfreich. So mag im Grundsatz die DGSVO zwar richtig sein, aber selbst nach dieser langen Zeit ihrer Ausgestaltung ist doch nur ein unpraktikables Machwerk herausgekommen, das zudem den kulturellen Entwicklungsprozess derart monetarisiert, dass wir fürchten, dass kulturelle Prozesse demnächst nur noch von reichen Ideologiekonzernen betrieben werden können.
Was wir nicht brauchen ist ein Mehr an Privatisierung, eine bis ins kleinste Detail privatrechtlich organisierte Kultur. Wir werden sehen, dass so im kulturellen Bereich, vor allem in den öffentlichen Diskursen, in der Wissenschaft, bei den unabhängigen, privaten Medien bzw. der privaten Kommunikation Parallelwelten entstehen wie auf den Finanzmärkten die ungeregelten, grauen Märkte, und wir scheuen uns nicht davor, die Schattenhaushalte der Regierungen hier mit hineinzunehmen. Am Gartentörchen stehen die Anwälte, Richter und Gerichte und bringen ein Schild nach dem anderen an: Betreten verboten, Parken nicht erlaubt, lautes Sprechen nach 22.00h nicht erlaubt, Werbung unerwünscht usw. und im Keller oder Gartenhaus filmen die Nachbarn die Vergewaltigung von Kindern und stellen diese ins Darknet. Und der Rechtsstaat muss tatenlos zusehen oder die Grundrechte seiner Bürgerinnen und Bürger verraten und Staatstrojaner erlaubt werden; well done, Adam. Zu langsam, zu uninformiert, zu uninspiriert. Dazu ineffektiv, teuer und mit den Ressourcen am falschen Ort; das würde allemal ausreichen, um einen Mitarbeiter zu entlassen oder einen ganzen Konzern aufzugeben; den Juristen geht es gut. Damit kein falscher Eindruck entsteht, wir führen nicht das Wort gegen den Rechtsstaat wie wir auch nicht gegen demokratische Institutionen sind, aber mehr als Standesdünkel und Besitzstandswahrung darf man doch auch von denen erwarten, unter deren Talaren sich wieder der Mief von vielen Jahren unterlassener Selbsthygiene ausbreitet.
Es ist schön, vom Wertewandel zu schwadronieren, wenn man in die Sache wenig Zeit und Mühen investieren will oder kann. Es ist leicht zu reden vom Untergang der Demokratien und wenige Worte gegen die zu erheben, die den Untergang der Demokratien betreiben. Wir haben uns bereits wieder an die Straßenaufmärsche, auf Fackelzüge und Versammlungen vor den Häusern von Politikerinnen und Politiker gewöhnt. Und alles dies geschieht unter dem Recht auf freie Meinungsäußerung und ähnlichem juristischen Gequatsche; ein wenig mehr politisches Bewusstsein wäre schon wünschenswert und ein Ausweg ist das nicht, wenn der einzige Weg über den Verfassungsschutz führt. Der Wertewandel heute ist leider kein Wandel mehr in bildungsbürgerlichen Paradigmen, er spielt in der Liga der Mächtigen. Und mit Mächtigen meinen wir jene, denen diese Bestimmung heute zukommt, das sind die neuen Patriarchen in den USA, in der VRC und in Russland. Wohin der sogenannte Wertewandel wirklich führt, sehen wir ja gerade in der Ukraine und in Russland. Und der ewig grinsende Xi steht schon Gewehr bei Fuß mit Blick nach Taiwan. Aber der Aufmarsch hat bereits begonnen. Das Aufmarschgebiet sind Spratly und Paracel, chinesisch „Nansha“ und „Xisha“. Die Paracel-Inseln sind eine Gruppe kleiner Korallenatolle, rund 330 km südöstlich der Insel Hainan im Südchinesischen Meer und werden in Gänze von zwei Nationen als ihr Territorium beansprucht: Volksrepublik China und Vietnam. Spratly und Paracel – die Namen dieser beiden Inselgruppen aber stehen nicht nur für den Konflikt um reiche Fischgründe, sowie große Öl- und Gasreserven. Sie stehen für die Kontrolle einer der bedeutendsten Schifffahrtsrouten der Welt, und damit über die Kontrolle von globalen Handelsbeziehungen von Billionen von US-Dollar, mithin über den Wohlstand vieler Nationen. Ein Drittel des Welthandels wird über das Südchinesische Meer abgewickelt – der Streit berührt also auch Europa ganz erheblich.
Funkspruch eines chinesischen Zerstörers vor den Paracel-Inseln: „Philippinisches Flugzeug, dies ist die letzte Warnung! Entfernen Sie sich, oder Sie tragen Verantwortung für die Konsequenzen.“ Solche Drohungen sind Alltag im Seegebiet zwischen dem Golf von Thailand im Südwesten und dem Golf von Tonking im Nordwesten. Nirgendwo auf der Welt konzentriert sich so viel militärische Feuerkraft: chinesische Kriegsschiffe, amerikanische Flugzeugträger, philippinische Zerstörer, vietnamesische Fregatten, ungezählte Kampfjets – dazu hunderte Fischerboote, die sich ihr Recht auf einen guten Fang ertrotzen wollen.
Abbildung 1: BlankAsia.png: FB derivative work: J. Patrick Fischer, gemeinfrei
Chinas Führung hat nach geltendem Recht „keine rechtliche Grundlage für ihre Gebiets-Ansprüche. Sie hat sich stattdessen entschieden für einen ziemlich dubiosen juristischen Ansatz, um diese Ansprüche zu rechtfertigen“, so Adam Ni vom Thinktank China Policy Center in Canberra. Ein symbolisch wichtiger Schritt war Mitte April die Schaffung von zwei neuen Verwaltungsbezirken im Südchinesischen Meer. Damit wollten die chinesischen Behörden verdeutlichen: Es handelt sich bei den Inseln im Südchinesischen Meer nicht einfach nur um besetzte Inseln, wie die Anrainerstaaten sagen, sondern um chinesisches Kern-Territorium; wer erinnert nun nicht die jüngsten Ereignisse in der Ukraine in allen ihren bisweilen grotesken Narrativen?3
Fast zwei Jahre her, aber stets aktuell, die Narrative der patriarchalen Macht4. Dieser bedingungslose Wille zur Macht, grundlos, unbegrenzt, ein alles umfassender Nihilismus, lässt sich nicht mit Werten bekämpfen. Denn nur er bestimmt, was Wert ist und dabei geht er bis zum äußersten; der nächste kriegerische Konflikt hat also bereits begonnen und wird wohl seinen Anfang im Südchinesischen Meer finden. Und in wessen Kopf er gedeiht, in welchen Köpfen er seine ‚Resonanzräume‘ findet, dürfte auch jedem bekannt sein. Wir kommen also nicht umhin, uns auch in diesem Band mit der Macht zu beschäftigen, nun als ultimative Erscheinungsform im modernen Patriarchat. Denn so fürchterlich es auch ist, man sieht, sie entscheidet über Krieg oder Frieden, sie macht den Krieg und auch den Dritten Weltkrieg bzw. Atomkrieg möglich. Sie ist damit eine sehr konkrete Möglichkeit im Dasein aller Menschen und deshalb gehört sie in diesen Band. Was möglich ist, ist leider nicht immer konnotiert mit einer positiven Möglichkeit und so hat sich die Möglichkeit eines Krieges in Europa in diesen Band gedrängt. Das Kapitel über die neuen Patriarchen in diesem Band war bereits längst abgeschlossen, als die Bomben von Putin auf die Ukraine flogen. Unserer Ausführungen zur Macht ist nichts hinzuzufügen, außer, dass sie in ihrer ultimativen Ratio, dem Krieg, jederzeit sich realisieren kann.
Patriarchale Macht und ihre semantischen Derivate wie Autokratie, Tyrannei, Führerprinzip etc. ist natürlich nie wertegetriebene Politik. Uns muss natürlich sofort interessieren, ob politische Macht in Demokratien diese wertebasierte Entscheidungsfindung trägt, oder eher nicht? Sind Demokratie, Freiheit, Recht und Solidarität wirklich jene Werte-Basen, auf deren Grundlage Politik ihr „Geschäft“ betreibt, oder ist Politik nicht doch zu einem großen Anteil „selbstmotiviert“, also ein an der eigenen Macht bzw. am Machterhalt orientiertes Verhalten?5Politische Karrieren sind nicht selten fast schon strategisch geplante Verhaltensweisen zum Aufbau von Strukturen, die, demokratisch betrachtet, im kleinen wie im entwickelten Stil eher korrupt sind, und ein Netzwerk bilden, welches nach der Übernahme eines politischen Mandats dessen Erhaltung sicherstellt; wir denken in diesem Zusammenhang nicht an Altkanzler Schröer, sondern genereller. Auch die demokratische Macht fürchtet nichts mehr als ihre Abwahl, ihren Sturz durch Parteifreunde, was nicht selten große Ähnlichkeiten mit einem Putsch zeigt. Sich dagegen zu immunisieren ist eines, wenn nicht das probate Mittel. Resilienz heißt heute das schöne neue Wort für ein Verhaltens- und Bewusstseinstraining, welches die Person davor schützen soll, jederzeit und nachhaltig kampfesbereit zu sein, um politische Attacken wie Bakterien und Viren abzuwehren. Immun vor Widerspruch von außen und innerer Selbstkritik kann da schon viel bewirken.
Um bei dem Bild und in der Terminologie zu bleiben: schlimm und gefährlich ist ein Zustand, den man gemeinhin mit Immunsuppression beschreibt. Wenn noch keine Resilienz sich aufgebaut hat, die alten Abwehrkräfte und Medikamente nicht mehr oder nur mäßig Linderung schaffen, dann wird es schwierig, wechseln die Ansichten und Einstellungen sogar zu lange Bewährtem und hektische Nervosität, bisweilen sogar hysterische Zustände erzwingen schnell wechselnde Entscheidungen, wie man heute in Fragen der Energiepolitik, der Mobilität und vor allem beim globalen Handel feststellen muss. Die Transformation zu den Erneuerbaren Energien6 zeigt heute, dass der Wandel weder vernünftig noch in wirtschaftlicher Hinsicht gut vorbereitet und eingeleitet war. Beim Wandel von fossilen auf Erneuerbare Energie im gesamten Bereich der Mobilität fallen Alleingänge, blanke Unvernunft und eine eigenartige Sorglosigkeit auf, die schon verwundert, fragt man nach den vielen beratenden Experten, warum sie sich in so zurückhaltender Vorsicht über Jahre hinweg dieses Thema auf Distanz gehalten haben. Es wird enorm spannend zu sehen, bis wann und wie eine flächendeckende Infrastruktur erzeugter, echter grüner Energie bis an die Fahrzeuge, in die Industrie und in die Haushalte kommt.
Was also tun im globalen Desaster des Klimawandels? Was tun im globalen Handel mit weltbeherrschenden Patriarchaten; was, wenn donald t. wiederkehrt wie Nosferatu allnächtlich? Die Symbole des Grauens sind von den Leinwänden in die Regierungsbänke der Parlamente und Präsidien gezogen und haben dort Platz genommen. Und das Publikum ist Kino und darf noch applaudieren, aber auch das ist verzichtbar. Weder den Klimawandel noch die Globalisierung können wir zurückdrehen. Aber haben wir wirklich alle unsere Möglichkeiten bereits ausgereizt? Wir wissen es nicht, aber was wir wissen ist, dass, wenn nur eine Möglichkeit noch offensteht und alles andere keinen Weg ins Offene weist, dann muss sie ergriffen werden, dann geht buchstäblich kein Weg daran vorbei. Wir sehen noch eine Brücke über tiefes, schnell fließendes Wasser. Sie ist weder die Ponte Vecchia noch die Brooklyn Bride, obwohl wir über die letztere durchaus dorthin gelangen, wo etwas trockenes Ufer noch ist. Die südlich in Manhattan gelegene Wall Street verfügt über genügend Ressourcen, um den Klimawandel weltweit aufzuhalten, jedenfalls, was in menschlichem Ermessen noch liegt. Aber uns geht es nicht nur um Fragen der Finanzierung, uns geht es auch um die Ursachen der großen Probleme der Menschheit, wobei wir hier anmerken möchten, dass ein Nachdenken über solch gewaltige Zusammenhänge nur ein bescheidener Versuch und Beitrag sein kann, im besten Falle.
Eine Ursache ist für uns die Fehlallokation des Kapitals. Zuviel Geld und Wertschöpfung fließt in solche Felder der Arbeit, die Naturschutz nicht als Quelle kollektiven Wohlstands7 bislang entdeckt haben. Und der Prozess der Kapitalakkumulation zum Zwecke privatwirtschaftlichen Reichtums geht nicht in verminderter Fahrt weiter, im Gegenteil. Sagenhafte Reichtümer werden akkumuliert und wir wollen nicht durch Ausführungen zu Umverteilung und Enteignung unser Bestes dazu geben. Wir wollen aufzeigen, dass es Möglichkeiten gibt, sehr viele Möglichkeiten, Kapital in Wertschöpfungen zu „locken“, die dem Gemeinwohl dient, wozu wir auch Natur und Umwelt, also unsere Lebensgrundlagen zählen. So haben wir in Band I. begonnen, so enden wir den Band VII. mit einem neuen Versuch, Wohlstand für alle zu denken, aber nicht auf einer vergessenen, theoretisch übersehenen Grundlage, die der menschlichen Existenz. Unsere natürlichen Grundlagen zu bewahren, erfordert aber nicht nur ein neues Umweltbewusstsein. Das wäre aus einem Grund schon nicht genug, wenn die Spanne zwischen Armut und Reichtum weiter auseinander ginge.
Nicht missverstehen; Armut und Reichtum sind nicht die Ursachen von Umweltzerstörung, auch nicht die Folgen eines Bewusstseins, welches sich an der Ausbeutung von Natur und Mensch erfreut; das wäre zu einfach. Aber selbst, wenn es so wäre, ein solches Bewusstsein zu ändern fiele wohl nach wie vor schwer nach all den vielen fehlgeschlagenen Versuchen in den vielen vergangenen Jahren. Nehmen wir zum Beispiel einen SUV8. Da gibt es große, teure, aber auch preiswertere. Alle aber verbrauchen eineinhalb Parkbuchten in unseren engen Innenstädten, die leider keine Erweiterung von Parkbuchten erlauben, zumal mit jedem SUV zusätzlich rein rechnerisch die Anzahl der Parkbuchten verdoppelt werden müsste. Ein SUV belastet somit das Gemeinwohl, wenn wir das auch als Parkmöglichkeit verstehen, um einhundert Prozent. Das möchten wir zum Faktor Arbeit hinzuzählen, also als eine neue Taxonomie der Arbeit und indirekt damit auch als Taxonomie des Kapitals anregen. Die Taxonomie des Gemeinwohls beinhaltet somit Faktoren wie Umwelt, Energieverbrauch, Parkraumverbrauch usw. Nehmen wir ein anderes Beispiel, die Kreuzfahrtschiffe. An manchen Tagen ankerten vier bis fünf der Riesen in der Lagune von Venedig, bliesen das Gift ihrer Schlote und jedes ein paar Tausend Besucher tagtäglich in die Stadt und beim An- und Ablegen vom Pier wurde Venedigs Untergrund derart belastet, dass die Stadt zu versinken drohte; was daran ist Gemeinwohl? Richtig. Venedig muss erhalten bleiben. Hier hilft nur eine neue Taxonomie von Arbeit und Kapital, die den Kreuzschiffahrtsbau zwar nicht verbietet – etwas verbieten wollen wir nicht - aber jede Kabine so teuer macht, dass nur noch Scheichs sich eine leisten können, die auch für nur eine Nacht in der siebenhundert Quadratmeter großen Suite im Burj al Arab vierzehntausend USD hinblättern; Venedig wäre gerettet. Natürlich wollen wir keine Luxussteuer, der Sinn der neuen Taxonomie soll sich in einer Gemeinwohlabgabe ergeben, die auf den Verkaufspreis eines SUV aufgeschlagen wird, der eine bestimmte Breite z. B. übersteigt; andere Parameter sind denkbar. Wir wollen und können weder ins Detail hineinrechnen noch in alle rechtlichen Details hineinschauen, denn es geht uns ums Prinzip. Das Gemeinwohl-Prinzip soll das Leistungsprinzip nicht ersetzen, es soll zu diesem hinzutreten immer dort, wo es betroffen ist.
Kommen wir zur Verwendung der Gemeinwohl-Abgabe. Ihr Nutzen ist am größten, wenn sie dazu dient, die Spreizung zwischen Arm und Reich zu vermindern. Deshalb ist darauf zu achten, dass die Abgabe nicht den Weg einer Steuer nimmt, sondern – unser Vorschlag - in einen staatlich kontrollierten, privatwirtschaftlich agierenden Fonds fließt, um darüber zu Kapital aus Wertschöpfung zu werden. Dann haben wir keine Umverteilung, sondern Kapital aus Wertschöpfung, an dem Menschen mit geringem Einkommen oder die aus staatlichen Zuwendungen leben, beteiligt werden. Nehmen wir zum Beispiel die Energiewende. Claudia Kemfert beziffert den finanziellen Aufwand für die deutsche Energieunabhängigkeit von fossilen Brennstoffen auf etwa 500 Mrd. Euro, verteilt auf zehn Jahre, also auf 50 Mrd. p.a. Mögen die Wirtschaftsexperten weiter redlich streiten über Kosten und Einsparungen, für uns liegt hier ein Marktpotenzial mit enormer Wertschöpfung und darin soll auch unser Gemeinwohl gedeihen. Deutschland hat kein Erdöl wie Norwegen und kann deshalb auch keinen Staatsfonds aus Erdöleinnahmen finanzieren, der allein im Jahr 2021 einen dreistelligen Milliarden-Gewinn einfahren konnte. Dabei profitierte der Pensionsfonds zusätzlich von den Kursgewinnen am Aktienmarkt9. Deutschland könnte aber mühelos durch Gemeinwohl-Abgaben und privaten Anlagen sowie der Öffnung gegenüber institutionellen Anlegern ein Fonds-Volumen vergleichbar mit dem des norwegischen Staatsfonds aufbringen, wobei es uns aber mehr um das Geschäftsmodell als solches geht.
Dieses Geschäftsmodell sähe große Ähnlichkeiten mit den Norwegern – wir dürfen uns auch bei diesen Ausführungen an die sogenannte Deutschland AG10 erinnern - , die seit vielen Jahren ihre Einkünfte an den internationalen Finanzmärkten investieren. Über diese Investitionen hält der Fonds aus Norwegen mittlerweile Beteiligungen an knapp 9100 Unternehmen weltweit, ist also hinreichend diversifiziert und wir sähen diese Diversifizierung überwiegend in Umweltprojekten. Was die Norweger machen kann auch als eine Blaupause für einen deutschen Staatsfond werden, nämlich zudem in nicht börsennotierte Immobilien und Infrastruktur für Erneuerbare Energien zu investieren, ist doch die energetische Transformation anders kaum zu schaffen und für den privaten Immobilienmarkt stehen ebenfalls neue Geschäftsmodelle aus, die die steigenden Mieten von den geringverdienenden Menschen in unserer Gesellschaft weitgehend fernhalten können. War der norwegische Fonds eine Erfindung der 1990er Jahre, um die umfangreichen Leistungen des Sozialstaats zu finanzieren und sich vor Schwankungen an den Rohstoffmärkten zu schützen, so mutet es ein wenig seltsam an, dass Deutschland, immerhin die Erfinderin der Sozialen Marktwirtschaft, auf diese Finanzierungsideen nicht selbst gekommen ist. Mag sein, dass dies mit daran lag, dass in Deutschland der Weg über die Finanzmärkte seit den Fuggern im Mittelalter mit extrem negativen Konnotationen versehen ist und bis heute ist „Heuschrecke“ noch eine der netteren Bezeichnungen für Finanzmarkt-Tätigkeiten. Mag sein, dass seit dem Kapital von Marx dem Kapital schlechthin jede Form der Beteiligung und Entwicklung von Gemeinwohl abschlägig attestiert wird, wobei dann allerding völlig unklar bleibt, warum selbst die allermeisten Deutschen der Idee der Sozialen Marktwirtschaft positiv gegenüberstehen, ja sogar ein wenig stolz sind darauf, zu deren Erfindern zu gehören; vielleicht tragen unsere Darlegungen ja auch ein wenig zur De-Ideologisierung bei.
Als wir den Titel des 8. Kapitels verfasst hatten, waren wir noch ein paar Wochen vom Krieg entfernt. Umso wichtiger und bedenkenswerter halten wir die darin vorgestellten Gedanken und Ideen, die wir an einer Stelle sogar als „revolutionär“ kategorisiert haben; das sind natürlich keine revolutionären Ideen im klassischen Sinne. In der Zukunft den Blick vermehrt auch in wirtschaftlichen Angelegenheiten vom Gemeinwohl her zu definieren, dürfte aber notwendig werden und die Marktwirtschaft ist auch jederzeit in der Lage, aus einem komplementären Verhältnis von Gemeinwohl und Privatwohl ihre Erfolgsaussichten zu lesen. Wir müssen natürlich die Betrachtung eines „Sowohl-als-auch“ oder „Entweder-oder“ verlassen und Gemeinwohl und Privatwohl gleichwertig in den Blick nehmen, wo immer dies auch geht. Aber es geht nicht immer gleichwertig. Dann ist für das Gemeinwohl zu entscheiden. Alles, was sich Natur- und Umweltschutz nennt, muss diese Entscheidung treffen und den Menschen vermitteln. Die Grundlagen der Existenz aller Menschen sind nicht verhandelbar oder abwägbar, das haben wir zu lange gemacht mit dem Ergebnis, wie es heute sich uns zeigt. Der Verbrauch der natürlichen Ressourcen und vor allem die Entsorgung verbrauchter Ressourcen wieder in der Natur hat lange funktioniert durch die Selbstheilungskräfte der Natur und unsere grobe Sinnlichkeit, die wenig vom Dreck gesehen, gerochen und geschmeckt hat, zumal wir den ja etwas weiter entfernt von unseren Nasen, Augen und Ohren verbracht haben; nun ja, alles geht einmal zu Ende.
So sollte das Schlusskapitel auch ein großes Finale aller Themen der letzten sechs Bände werden, aber da kam dann der Krieg dazwischen und hat dieses Kapitel aus der Aktualität der Ereignisse gedrängt. Was alle heute sagen, der Krieg markiere eine Zeitenwende, ist unseres Erachtens schon die nächste Stufe des „unglücklichen Bewusstseins“, der wir uns nicht so ohne weiteres anschließen werden. Es wendet sich nichts, es vollendet sich, was lange Zeit schon währte. Und es verschärft sich sogar, was lange währt, die Rückkehr der Patriarchen. Wie kann es sein, dass im 21. Jahrhundert und nach den großen, verheerenden Kriegen des letzten Jahrhunderts ein einzelner, kleiner Mann, ohne Haare auf dem Kopf, mit Schweinsaugen – die teilt er mit donald t. – etwas steif in den Hüften wie die meisten Juristen, ganz allein über Krieg und Frieden, über die Existenz und den Untergang der Menschheit entscheidet? Und die nächsten stehen schon vor den Toren oder haben ihre schmutzigen Finger bereits an den roten Knöpfen der Macht. Das nächste Kapitel, welches es unbedingt zu schreiben gilt, heißt: wie verhindern die Menschen die Rückkehr der Patriarchen? Es wird nicht reichen, mit Trump, Putin, Xi oder den klerikalen Fanatikern im Iran usw. Handel zu treiben und wie der damalige deutsche Kanzler in die Formel schrieb, auf „Wandel durch Handel“ zu hoffen11. Wir haben Handel getrieben mit Russland bis über die Grenze der energetischen Abhängigkeit, und was hat es geholfen? Wir treiben noch viel mehr Handel mit dem Chinesen, welchem Wandel sehen wir entgegen? Die Formel mag schön sein, der Wandel weniger. Bislang ist das Ergebnis der Formel dies: nach dem Handel kommen die Sanktionen, der Handel mit Waren, Gütern und heute Finanzdienstleistungen wird eingestellt. Hätte man dies nicht präventiv vorher besser überlegt und geregelt?
Was bringt es, die Demokratien ins Feld zu schicken? Das hat nicht funktioniert in Korea, nicht in Vietnam, nicht im Irak und in Afghanistan? Und sind nicht die USA eine lupenreine Demokratie und hat diese diesen Irren aus Queens, NYC, verhindert? Immerhin, wie es scheint muss auch dieser Patriarch bevor er die alleinige Verfügungsgewalt über den roten Knopf erreicht, die Checks and Balance, die wichtigsten demokratischen Institutionen und den öffentlichen Diskurs unter seine Herrschaft bringen. Aber was ein einzelner, alter weißer Mann in nur fünf Jahren diesbezüglich geschafft hat, ist beachtlich. Auch zu ihrer Abschaffung bleibt der Demokratie nicht viel Zeit unter unglücklichen Umständen. Unser unglückliches Bewusstsein ist wohl dann doch nicht ein, durch Irrtum, Entfremdung, Unwissen und an sich selbst entzweites, ein mit sich selbst unversöhntes Bewusstsein. Und wenn es ein der Wahrheit entfremdetes Bewusstsein ist, dann stimmt noch das, was Hegel darüber sagte. Der Mensch birgt nun mal nicht alles, woran er glaubt und wovon und worin erlebt, in sich, schon gar nicht klar und bestimmt, wie Descartes das dachte. Er hat seinen Lebensinhalt ganz wesentlich außer seiner selbst und dort ist auch ein Teil der Wahrheit, aus der der Mensch lebt, aus der er leben kann oder nicht; das zeigt der Krieg. Und der von Pudn (amerikanische Sprechweise) vom Zaun gebrochene Krieg kann auch in Zukunft von keinem Bewusstsein versöhnt werden, es irgendwie glücklich machen, nicht einmal durch Drogen.
Das Selbstverständnis wird von jedem Krieg zerrissen, entzweit. Es bleibt ein unglückliches Bewusstsein, das in Stücke zerbrochen auf dem Boden liegt und sich einmal mehr fraktal im eigenen Spiegelbild begegnet. Pudns Krieg ist kein Lebensirrtum, keine verkannte Wahrheit in der Phänomenologie des Geistes; es ist die erkannte Wahrheit im Unglück des ukrainischen Volkes, das auch nicht unter der innerweltlichen Sinnlosigkeit, sondern unter Bomben, Hunger, Durst, Verletzung, Trennung und Angst leidet und dessen Leiden das Unglück konkret sein lässt, für viele bis zum bitteren Ende; der Krieg sorgt sich nicht, weder um etwas noch als etwas. Pudns Krieg macht mehr als alles andere deutlich, dass die Wahrheit doch ein Abstraktum ist, solange sie in der totalen Usurpation patriarchaler Herrschaft gefangen existiert.
Zu Dionys dem Tyrannen, schlich Damon den Dolch im Gewande, Ihn schlugen die Häscher in Bande. "Was wolltest du mit dem Dolche, sprich!" Entgegnet ihm finster der Wüterich. Die Stadt vom Tyrannen befreien!"12
Es gibt heute keine Versöhnung mehr mit Tyrannen, was bliebe wäre ein altes probates Mittel, der Tyrannenmord, die Tat, die in die Geschichte eingeht und von der dann in tausend Jahren vielleicht die Kinder in lateinischen Unterrichtsstunden lesen lernen. Schillers Gedicht aber endet anders, wie man weiß. Zwischen Macht und Mensch steht die Demokratie als „Dritte im Bunde“. Auch sie vermag das Unglück aus dem Bewusstsein nicht zu vertreiben, versöhnen mit der Macht soll sie sich nicht.
Kapitel 1: Demokratie - Reform
Vor dem Krieg. 04.08.2021
Die Demokratie ist in der gesamten westlichen Welt in einer veritablen Krise. Ihre Ursprünge in der griechischen Antike reichen nicht aus zu einer Um- und Neubesinnung, sind nicht mehr deren Referenzpunkte. Es bringt wenig, sich heute immer wieder auf Platon und Aristoteles zu berufen, um von dort her der Krise demokratischer Systeme zu begegnen. Macht auf Zeit und Kontrolle der Macht durch das „Demos“, das Volk, sind als ideale Vorstellungen einer Grundlage gesellschaftlichen Ordnung realisiert. An demokratischen Wahlen als solchen gibt es wenig zu kritisieren, allenfalls die Einschränkung des Wahlrechts auf volljährige Deutsche. Aber warum ist dann auch in Deutschland die Demokratie in einem so miserablen Zustand, dass immer weniger Menschen sich damit identifizieren können? Woran man das erkennt? An dem Erscheinen von rechtsradikalen Parteien in ganz Europa, auch in Deutschland erkennen wir nur die äußere Seite der Demokratiekrise wie auch im Auftreten von sogenannten „Bürgerbewegungen“, die aber so wenig mit einer Bürgerbewegung gemein haben, wie man sich kaum vorstellen kann. Denn „Pegida“ und deren lokale Ableger, die „Querdenker“, die nun ihrerseits so wenig mit Denken gemein haben wie nur vorstellbar ist, sind auch nur äußere Zeichen und deren innere Beziehungen zu rechtsradikalen und verschwörungstheoretischen Meinungs-Konglomeraten bezeugen allenfalls eine vorhandene, dumpfe Wut, eine unverhohlene Aggressivität gegen Politik, Parteien, Politikerinnen und Politiker, Presse und Wissenschaften, die bereits zu körperlichen Angriffen geführt haben. Opfer solcher Aggressionen sind zudem einmal mehr auch Anhänger des jüdischen Glaubens, Frauen, Homosexuelle, Diverse etc. wie generell fast jede, von der ihren abweichende Meinungen in den öffentlichen wie den privaten Medien. Die sozialen Medien sind zu einer Shitstorm-Schleuder und zu Verbreitungskanälen apokrypher Meinungen und unerträglichen politischen Vorstellungen geworden, Hate-Speech trägt nicht selten Morddrohungen, Mobbing und Diskriminierungen und Bildbearbeitungsprogramme, die die Fakes bis in die Montage falscher Identitäten auf jedem Smartphone unterwegs ermöglichen, tragen ihr Übriges dazu bei.
Aber auch die bürgerliche Gesellschaft zeigt starke Züge einer Abwendung von demokratischen Prinzipien. Kaum ein staatliches Projekt im Energiesektor oder im Bereich der Infrastrukturmaßnahmen findet die Zustimmung der Bürger. Die erstaunliche Solidarität der Bürger mit den Geschädigten der jüngsten Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz hat mit einer Zustimmung zur Klimapolitik der Regierung wenig zu tun und der Versuch, sie politisch zu vereinnahmen ist auf breiter Linie gescheitert. Weder Grüne, SPD noch CDU konnten hier Punkte bei Meinungsumfragen sammeln; im Gegenteil. Seit vielen Jahren bröckeln die Zustimmungswerte auf breiter politischer Front, die Parteienlandschaft hat sich dramatisch dahingehend verändert, dass eine politische Differenzierung kaum noch möglich ist und das Vertrauen gegenüber den politischen Repräsentanten deutlich geschwunden ist. Die in 2021 zur Wahl stehenden Kanzlerkandidatin und -Kandidaten haben Beliebtheitswerte, die so niedrig sind, dass alle eigentlich ihre Kandidatur unmittelbar nach deren ersten Feststellungen hätten zurückziehen müssen. Nicht besser sieht es bei den Parteien aus, die eine Volatilität in den Umfragen aufweisen wie Hoch-Risiko-Aktien an den Börsen. Beide, Parteien und Kandidatinnen und Kandidaten hier wie die Wählerinnen und Wähler dort stehen in einem extrem entfremdeten Verhältnis zueinander, um einen traditionellen, aber bewährten Begriff zu bemühen. Diese Entfremdung also ist wechselseitig, wobei auch hier eine Asymmetrie sich zeigt: die Politik kürt ihre Kandidaten nach reinen partei-internen Kriterien und wie geschehen in teils abenteuerlich aufwendigen, bürgerfernen Verfahren, die Wählerinnen und Wähler wissen weder, was solche Verfahren zu ihrer Aufklärung und zur Information über die programmatische Zukunft der Parteien beitragen.
Piketty13 hat die Entfremdung zwischen Politik und Bürger eingehend untersucht und beschrieben. Historisch haben sich die Parteien-Lager in den letzten dreißig Jahren weitgehend aufgelöst und repräsentieren so auch nicht mehr einstige politische Übereinstimmungen. Die Zustimmung zur CDU war weitgehend verbunden mit der Übereinstimmung zu einer Politik, die die wirtschaftlichen Interessen mit einem christlichen Wertekanon und dem Primat der Familie als gesellschaftlicher Basiseinheit sozialer Interaktion verband. Die SPD repräsentierte die Arbeiterinteressen und in Teilen auch die von Angestellten, die von Rentnerinnen und Rentner wie die FDP den Mittelstand und die Repräsentanz liberaler Werte, mithin weitgehender Privatisierung und Liberalisierung privater Lebensentwürfe, zumindest das Recht darauf, verkörperte. Die Beurteilung der politischen Unterschiede gelang leicht, die reflektierende Urteilskraft (siehe hier: Kants Vermächtnis) stand vor keinen großen Herausforderungen, also gelang auch die politische Entscheidung bei der Stimmabgabe alle vier Jahre eher reibungslos. Lagerwahlkämpfe waren an der Tagesordnung, heftige Debatten über die Perspektiven des deutschen Staates, seien diese im Feld der Ökonomie, der Innen- und der Außenpolitik sowie der Rechtspolitik formuliert, trugen erkennbare parteipolitische Konturen. Diese politischen Lager, denen ein bestimmter, ideologischer Diskurs entsprach, hatten zudem nach Piketty eine lange, eine teils Jahrhunderte lange Tradition, dem wir mit Abstrichen zustimmen können14. Er sieht eine Entwicklung, deren unterschiedliche Ausprägungen sich grundsätzlich über Fragen des „politischen Regimes und der Eigentumsverhältnisse“ erhellen. Wir gehen aber davon aus, dass rechtliche resp. verfassungsrechtliche Bestimmungen im Sinne Kants bestimmender Urteilskraft die notwendigen Bedingen erhellen, auf deren Grundlage gesellschaftliche Entwicklungen in modernen Gesellschaften stattfinden.
Deshalb untersuchen wir primär Prozesse der bestimmenden und der reflektierenden Urteilskraft, jene, weil sie die notwendigen Voraussetzungen beinhalten, in dessen Rahmen Entwicklungen stattfinden können, diese, weil sie eben jene komplexen Prozesses betrachten, die mit aller Fehlerhaftigkeit der politischen Meinungsbildung und Urteilsfindung zu Wahlentscheidungen führen, die dann wiederum maßgeblich in parlamentarischen Prozessen der Gesetzgebung werden können. Ist also die bestimmende Urteilskraft vorausschauend eine Orientierung an einem bestehenden Ordnungsrahmen einer Gesellschaft orientiert, diesen bestätigend oder ganz oder teilweise infrage stellend, so bildet die reflektierende Urteilskraft jene hinreichenden Bedingungen für politische Präferenzen aus der Sicht der Bürger, aus denen ein Mandat und daraus wiederum eine politische Perspektive im demokratischen Prozess werden können. Bürger-Präferenzen können von Minderheitsmeinungen getragen werden, von Interessengruppen wie auch von vielen anderen Diskursen mit z. B. wissenschaftlichen, kulturellen, ökonomischen wie sozialen Kernthemen. Das Wesentliche in einem demokratischen Entscheidungsfindungsprozess ist, ob und wie weit solche politischen Themen im politischen Diskurs repräsentiert sind. Und diesbezüglich sieht es nicht gut aus.
Würde man in einem Verfahren von kontinuierlichen Befragungen der Bürger-Präferenzen diese überhaupt repräsentativ ermitteln, wäre die weite Entfremdung zwischen Bürgern und Politik wohl auf erschreckende Art belegt, gleichsam dokumentiert. Da, wo dies geschieht jedenfalls, finden wir erhebliche Diskrepanzen zwischen politischem und Bürger-Willen. Was für uns von Bedeutung in diesem Zusammenhang ist, werden wir in den nächsten Abschnitten herausarbeiten. Und vorab schon sei vermerkt, dass es dabei nicht nur um eine philosophische Betrachtung geht, sondern auch darum, ob und wie Diskrepanzen zwischen Bürger und Politik auf verfahrenstechnischen Wegen begegnet werden kann. Verfahrenstechnik verstehen wir als ein technisch basiertes Verfahren der Ermittlung des politischen Willens von Parteien, von Organisationen und Institutionen, die am politischen Willensbildungsprozess beteiligt sind, sowie den Bürgerwillen. Es geht darüber hinaus auch um den Abgleich zwischen Bürgerwillen und Partei-Willen, hier dokumentiert in Parteiprogrammen und Koalitionsvereinbarungen im Kern. Alle anderen Auszeichnungen des politischen Willen einer Regierung bleiben fürs Erste einmal zurückgestellt. Den Bürgerwillen ermitteln Befragungen, wie dies bereits kontinuierlich geschieht mit dem Unterschied, dass diese kontinuierlich und thematisch differenziert Eingang in solche Bürgerbefragungen finden sollen.
Das Ziel solcher Aufzeichnungen und repräsentativen Auswertungen bzw. Auszählungen von Fragestellungen und Themen zur politischen Meinungsbildung ist, eine Öffentlichkeit hierzu herzustellen, die erlaubt die Kenntnisnahme wie die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Strömungen im politischen Urteilsfindungsprozess; der Zweck ist eine signifikante Verbesserung und Steigerung direkter demokratischer Einflussnahmen durch die Bürgerinnen und Bürger. Direkte Demokratie ist nicht ganz der richtige Terminus für das politische Beteiligungssystem, das uns vorschwebt. Es ist mehr ein halbdirektes System, sagen wir ein komplementäres System, in welchem direktdemokratische Verfahren15 und repräsentative, sprich plebiszitäre Verfahren bestehen. Diese bestehen aus Volksabstimmungen und Volksversammlungen, aus Volksbefragungen und Volksinitiativen, die unter dem Terminus Volksbegehren existieren. Sie bilden den Prozess der reflektierten Urteilsfindung ab, die Letztentscheidung aber verbleibt bei politischen Institutionen. Daneben bestehen direktdemokratische Verfahren, bestehend aus Volksbefragungen mit Volksentscheiden bzw. Bürgerentscheidungen, also direkten Einflüssen auf die Gesamtheit der politischen Entscheidungen in Teilbereichen bzw. thematischen Grenzen. Hierzu gehören auch die aus dem Schweizer Modell bekannten Referenden und Volksinitiativen. Uns schwebt somit ein System aus repräsentativen und direktdemokratischen Elementen vor. Hinzufügen möchten wir auch ein Element der parlamentarischen Kontrolle bei bestimmten direktdemokratischen Entscheidungen, also ein Verfahren, welches die Letztentscheidung bei bestimmten Bürger- bzw. Volksentscheidungen an das Parlament delegiert. Solche Delegationen betreffen Entscheidungen, die Auswirkungen auf das Grundgesetz, die Außen- und die Fiskalpolitik haben.
Grundgedanke dieser komplementären politischen Demokratieform ist es, das alleinige Mehrheitsprinzip der repräsentativen Demokratie gegen eine wesentlich höhere Beteiligung von Minderheiten am Entscheidungsprozess einzuschränken. Die Bedeutung dieser Einschränkung ist also in der Sache eine Erweiterung der politischen Urteilsfindung und eine des Prinzips der Repräsentation von Minderheiten auf dem Weg zu möglichen Mehrheiten. Das soll das politische Mandat zu mehr politischen Austausch und zu mehr Beschäftigung mit dem Wählerwillen führen, mehr alternative Ansichten berücksichtigen, mehr Information der gesamten Wählerschaft und der Stimmungen in der Gesamtpopulation. Dazu sollten auch Nicht-Wählerinnen und Nicht-Wähler repräsentiert werden durch Befragungen, die fakultativ durchgeführt und parlamentarisch berücksichtig werden. Schauen wir nun ein wenig ins Detail.
Perspektiven in Urteilen
Wie schnell sagt man: Es fehlt eine Perspektive! Immer dann, wenn man auf eine Veränderung hinweist, etwa auf eine neue Gesetzgebung zur Eindämmung des Pandemie-Geschehens, auf unternehmerische Maßnahmen zur Konsolidierung, auf fiskalische Maßnahmen oder deren Surrogate in der Geldpolitik, stets werden mit dem Hinweis, es fehle an einer Perspektive, diese Maßnahmen in Frage gestellt; mehr noch, sie werden grundlegend in Frage gestellt. Das gilt auch für das Privatleben.
Wir haben den Band VI. unserer Philosophie des menschlichen Daseins mit einem kurzen Blick auf die Neuerungen im Bereich der digital unterstützten Rechtsprechung beendet. Also greifen wir hier diesen Gedanken wieder auf und beginnen im Bereich des Rechts erneut uns die Frage zu stellen: was ist eigentlich eine Perspektive? Eine Perspektive im Recht ist verbindlich, während andere Perspektiven im menschlichen Dasein durchaus vorhanden, aber nicht zugleich auch verbindlich, eben unverbindlich sind. Nun haben wir an sehr vielen Stellen stets die gedankliche Erfahrung gemacht, dass Kategorien oder auch Eigenschaften, Sachverhalte oder Argumente, die scheinbar aufeinander bezogen sind, nicht selten substanziell nichts miteinander zu tun haben. Dafür haben wir den Begriff des A-Privativums bemüht (Band I. u. Band VI.). Er bezeichnet also keine Verneinung im Sinne eines „Un- im logischen Sinne, sondern eine Verneinung oder Negation im absoluten Sinne.
Unverbindlich ist also in Wahrheit keine Negation von verbindlich, weder im Sinne einer Einschränkung von ‚nur wenig‘ oder ‚kaum verbindlich‘, noch ein Gegensatz im logischen Sinne. Wenn wir verbindlich und unverbindlich in Relation zueinander bringen, dann handelt es sich wie stets bei uns bei solchen Sachverhalten scheinbar relationaler Begriffe oder Termini um ein komplementäres Verhältnis. Ein Angebot, welches Ihnen ein Autohaus macht, ist so lange unverbindlich, solange, bis es nicht in Schriftform und unterschrieben Ihnen vorliegt; dann ist es verbindlich. Nicht in Schriftform vorliegend, ist also ein z. B. mündlich unterbreitetes Angebot – wie man so schön sagt – Null und nichtig. Das meint, von der Schriftform her betrachtet, ist es diese mündliche Form „nichtend“. Wir können also formulieren: Eine Negation kann auch die Bedeutung einer „Nichtung“ haben und so ist es auch in den allermeisten Rechtsfällen, bis auf die wenigen Ausnahmen, die mündliche Aussagen im Geschäftsleben wie im Privatleben einnehmen können, wenn eine kaufmännische Zusage als eine verbindliche oder vor-verbindliche Aussage juristisch bedeutsam ist wie auch bei einer privaten Zusage dies juristisch beigemessen werden kann, wenn man etwa sagt: gerne passe ich die paar Minuten auf Ihr Kind auf, bis Sie zurück sind; Sie sollten sich dann an Ihre Zusage halten, das ist besser, als vor Gericht erscheinen zu müssen. Eine verbindliche Aussage oder Zusage ist somit ein einklagbarer Sachverhalt, ein Versprechen, eine Zusage, ein Angebot etc., dem ein Recht zugrunde liegt. Als Aussage allein betrachtet ist ein Prädikat ein Zuspruch, also etwas, was etwas anderem zugesprochen wird16. Und dies ist das Umfeld, in dem wir uns im Folgenden bewegen wollen, wenn wir uns mit neuen oder veränderten Perspektiven beschäftigen. Perspektiven ganz allgemein gesprochen sind also Veränderungen, die auf eine zukünftige Vorstellung oder Position der Orientierung verweisen. Sind Veränderungen je schon über die zeitlichen Dimensionen der Vergangenheit und der Gegenwart hinaus und weisen so auf etwas, was möglich ist in der Zukunft hin, so wird unter dem Begriff der Perspektive diese bzw. generell alle Möglichkeiten mit einem Prädikat des Zukünftigen belegt. So aber, dass nicht allein die Möglichkeiten im Blickfeld des Denkens und Handelns erscheinen, sondern bestimmte Möglichkeiten, die zudem mit der Qualität einer prädikativen Aussage belegt sind. Solche Aussagen wie etwa: ‚wir wollen, dass dies in Zukunft möglich sein soll‘ beinhalten im Kern also nicht nur eine Möglichkeit in der Zukunft, sondern auch ein abschlägiges Urteil bereits über andere Möglichkeiten in der Zukunft (siehe Band VI, Kap. 1).
So spricht eine prädikative Aussage, was in Zukunft möglich ist oder sein soll, auch zugleich ein Urteil und mit diesem Urteil eine Entscheidung aus, und deshalb sprechen wir fortan über prädikative Urteile anstelle von prädikativen Aussagen; der Einfachheit halber sprechen wir über Urteile und unterscheiden diese von dem Begriff der Urteilskraft, wie wir ihn von Kant her kennen. Das ist wichtig zu unterscheiden, weil wir einerseits nicht in die ermüdende akademische Diskussion über ästhetische versus empirische Aussagen hineingeraten wollen, noch in eine fundamental-ontologische Streiterei über einen generellen oder speziellen Sinn von Urteilen überhaupt. Urteile, zumal wenn sie sich auf etwas Zukünftiges beziehen, haben in der Tat die Empirie noch nicht an ihrer Seite, wie auch? Gleichwohl sind sie nicht freischwebend, weder in der Motivation Einzelner noch im politischen Willen einer Mehrheit, weil ihre Zukunft bereits begonnen hat. Manchmal spontan, manchmal aus uralten Gründen tauchen Aussagen über neue Perspektiven auf und sind längst mehr geworden als bloße Meinungen und Haltungen, als allgemein daher gesprochener Kokolores oder als rein akademisch-wissenschaftliche Aussagen. Wenn wir heute über den Klimawandel sprechen, dann ist das nicht mehr dasselbe wie noch vor sechzig Jahren, als dies schon im „Club of Rome“ diskutiert wurde, noch berührt es damalige „Verschwörungstheorien“ – damals kamen die aus der „Ecke der Linken“ und hingen an der Vorstellung, dass das internationale Finanzkapital in seiner Gier nicht nur die Erwerbstätigen, sondern auch die materiellen Ressourcen, mithin die Erde im globalen Stile ausbeutet.
Sprechen wir über Perspektiven im Sinne von Urteilen und Entscheidungen, dann sind diese zwar empirisch begründet, was aber nicht gleichzeitig heißt, dass sie deshalb auch schon richtig oder wahr sind. Sie sind als Aussage oder Urteil bzw. Entscheidung, ob individuell oder kollektiv, ob spontan oder geschichtlich selbst auch als eine Verschwörungstheorie begründet, was nichts anderes heißt, als argumentativ formuliert, gleichwohl können also Perspektiven wie auch immer formuliert, der größte Unsinn sein; die Welt war ja auch einmal eine Scheibe und das wurde an höchster Stelle so ausgesagt und geglaubt. Und dass diese Perspektive verbindlichen, also Urteilscharakter hatte, mag man daran erkennen, dass einige Häretiker und Kritiker dieser Glaubensperspektive dafür ihr Leben lassen mussten. Auch wissenschaftlich begründeten Urteilen und Entscheidungen waren ein ähnliches Schicksal beschieden und sind es heute noch, denken wir an die Millionen Opfer, die neben Glaubens- auch politischen Systemen zum Opfer fielen und fallen.
In diesen Zusammenhängen verbietet es sich, von Indifferenz, von Gleichgültigkeit zu sprechen. Urteile in politischen Zusammenhängen sind bei weitem keine beliebigen Meinungsäußerungen, weder in Diktaturen, noch in demokratischen Systemen. Wie gehen wir also mit Urteilen um, wenn sie von einem Einzelnen oder einer Gruppe, gar einer Mehrheit wie in Demokratien geäußert werden? Urteile haben im politischen wie auch im praktischen Kontext einen anderen ontologischen Status als etwa Ansichten, Meinungen, Vermutungen, Behauptungen usw. Nehmen wir den klassischen Fall einer Rechtsprechung. Vor Gericht werden fraglos Urteile auf der Grundlage bestehender Gesetze gefällt. Wenn die Richterin bzw. der Richter „Im Namen des Volkes“ verkündet, jemand hat sich einer Straftat schuldig gemacht, dann ist dies zwar im engeren Sinne das Urteil, aber nicht die ganze Aussage. Denn schuldig gesprochen zu werden, bedeutet noch nicht viel bzw. nichts, folgt dem Richterspruch nicht das Strafmaß. Und das Strafmaß sagt aus, dass und für wie lange dem Schuldigen Rechte abgesprochen werden. Das ist gewissermaßen ein negativer Zuspruch, dass nämlich eine ganze Reihe von rechtmäßigen Möglichkeiten des Daseinsvollzugs für eine Zeit ausgesetzt sind. Und hier beginnt das Dilemma, nicht im Richterspruch an solchen. Folgte kein Strafmaß auf den Spruch, eine Straftat begangen zu haben, etwa Mord, dann bliebe der Spruch ein Spruch ohne Konsequenzen. Im Strafmaß, deshalb ist ein Urteil erst ein Urteil, betrifft es doch eine höchst-richterliche Entscheidung über den weiteren Daseinsvollzug eines Menschen. Hier und nicht im Urteilsspruch, wird das Dilemma der Justitia als modernes System der Strafzumessung deutlich; wird hier am Gericht z. B. ein Strafmaß von zehn Jahren verhängt, kommt es nicht selten vor, dass anderen Ortes lebenslänglich nebst Sicherungsverwahrung zu Buche schlägt.17
Das meint das Gerechtigkeitsproblem, dass im Justizzusammenhang nicht die Urteile, sondern die Zumessungen der Strafmaße sehr unterschiedlich ausfallen können. Natürlich kommt dem entgegen, dass Menschen, die über ausreichend Finanzmittel und Beziehungen verfügen, auch so zu für sich oder Angehörige und Freunde günstigeren Strafen kommen können; am meisten Vorteile verzeichnen dabei Firmen und politische Einflussträger. Aber das ist gleichsam das uneigentliche Problem, wenn wir von Problemen sprechen wollen. Wir müssen dies tun, das wird uns im gesamten Band VII. immer wieder in den unterschiedlichsten Zusammenhängen und Sachverhalten beschäftigen, und was das eigentliche, das wahre Problem darstellt. Hier betrifft es das Gerechtigkeitsproblem insofern, als es uns vor die Frage stellt: wie können Einzelurteile zu verbindlichen, also allgemein gültigen Strafzumessungen finden? Es ist ja nicht gerecht für den Einzelnen und für eine Gesellschaft sozial wie politisch gefährlich, wenn Ungerechtigkeit, also eine Ungleichheit vor dem Gesetz über einen längeren Zeitraum besteht. Gleichheit, wie wir an verschiedenen Stellen ausgeführt haben, womit nicht Solidarität, sondern allein die Gleichheit vor dem Gesetz gemeint ist, war eine der drei großen kulturellen Errungenschaften der europäischen Aufklärung und eine der konstitutiven Sinnfälligkeiten der Französischen Revolution.
Kants Vermächtnis
Also kommen wir an dieser Stelle nicht umhin, uns einmal mehr mit Kant zu beschäftigen, denn hier finden wir den Kontext, der das Problem der Gerechtigkeit bestimmt.18





























