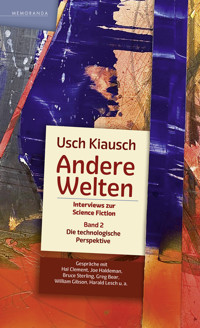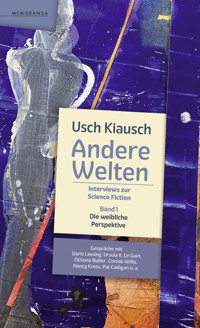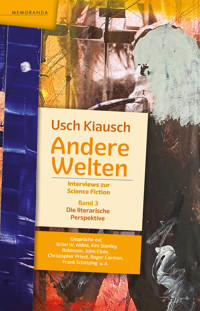
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Memoranda Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Memoranda
- Sprache: Deutsch
Usch Kiausch lernte in ihrer langen Karriere als Journalistin, Autorin und Übersetzerin viele bedeutende Schriftstellerinnen und Schriftsteller sowie Kolleginnen und Kollegen kennen und führte zahllose Interviews, die meisten davon auf den Jahreskonferenzen der »International Association for the Fantastic in the Arts« in Fort Lauderdale/Florida. Der abschließende Band der drei Bände umfassenden Reihe präsentiert unter anderem den Essay »Utopia und Post-Utopia«, zwölf Interviews sowie eine Erzählung von Usch Kiausch. Interviews in Band 3 mit: Frank Schätzing, Brian W. Aldiss, Philip José Farmer, Stephen R. Donaldson, Roger Corman, Michael Bishop, Robert Holdstock, Peter Straub, John Clute, David Hartwell und Christopher Priest.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Impressum
Usch Kiausch
ANDERE WELTEN – Interviews zur Science Fiction
Band 3: Die literarische Perspektive
© 2024 by Usch Kiausch (Texte)
© 2024 by Wolfgang Glass [www.wolfgang-glass.de] (Titelbild)
Mit freundlicher Genehmigung der Autorin
© dieser Ausgabe 2024 by Memoranda Verlag
Alle Rechte vorbehalten
Redaktion: Hardy Kettlitz
Korrektur: Michelle Giffels
Gestaltung: s.BENeš [http://benswerk.com]
Memoranda Verlag
Hardy Kettlitz
Ilsenhof 12 | 12053 Berlin
Kontakt: [email protected]
www.memoranda.eu
www.facebook.com/MemorandaVerlag
ISBN: 978-3-948616-98-4 (Buchausgabe)
ISBN: 978-3-948616-99-1 (E-Book)
Inhalt
Inhalt
Impressum
Inhalt
Utopia und Post-Utopia
Von Gehirnen und Agenten, Träumen und Realitäten
Nachruf auf Josef Nesvadba
Stephen King – Facetten des Horrors
Peter F. Hamilton – ein Porträt
INTERVIEWS
Ein Abend mit Brian W. Aldiss und Philip José Farmer
Ein Gespräch mit Brian W. Aldiss
Ein Gespräch mit Stephen R. Donaldson
Ein Gespräch mit Roger Corman
Ein Gespräch mit Michael Bishop
Ein Gespräch mit Robert Holdstock
Ein Gespräch mit Peter Straub
Ein Gespräch mit Brian W. Aldiss (1999)
Ein Gespräch mit John Clute
Ein Gespräch mit David G. Hartwell
Ein Gespräch mit Christopher Priest
Ein Gespräch mit Frank Schätzing
ERZÄHLUNG
Die Haraschta
Quellen
Bücher bei MEMORANDA
Utopia und Post-Utopia
Science Fiction als Sozialgeschichte
Science Fiction – das ist Aldous Huxleys Schöne neue Welt und Ursula K. Le Guins Planet der Habenichtse, das ist Jane Fondas kulleräugige Barbarella und Sigourney Weavers tapfere, Aliens bekämpfende Ripley, das ist die martialische Serie BATTLETECH und Doris Lessings mystischer Zyklus SHIKASTA, das ist Zeitreise vor und zurück und der Salto Mortale durch Alternativgeschichte oder Paralleluniversen, das ist Kalter Krieg und feministische Ökotopie, Technikeuphorie und Post-Doomsday-Didaktik.
Science Fiction – das sind dekadenübergreifende Traditionslinien und kurzlebige Modeströmungen, die – wie der Cyberpunk der 1980er- und 1990er-Jahre – heute schon wieder die Vergangenheit der Zukunft bilden, weil der Mainstream der materiellen und virtuellen Wirklichkeit sie eingeholt und aufgenommen hat.
Für manche Kritiker ist Science Fiction längst kein literarisches Genre mehr, sondern eine gigantische Industrie: Science Fiction ist alles, was sich unter diesem Etikett vermarkten lässt. Für andere, etwa Brian W. Aldiss in Der Milliarden-Jahre-Traum, seiner kritischen Geschichte der SF, bleibt Science Fiction »die Suche nach einer Definition von Menschheit und ihrem Status im Universum, die unserem fortgeschrittenen, aber recht konfusen Wissen standhält«.
Wenn ich Science Fiction hier als Sozialgeschichte behandle, konzentriere ich mich auf vier schlichte Fragen:
Wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir von Science Fiction reden?Mit welchen realen und fiktionalen Entwicklungen haben wir es dabei zu tun?Wo bleiben bei all dem die Frauen?Und leben wir heute in Post-Utopia?Es dreht sich hier vor allem um Themen und Traditionen der deutschen und der marktbeherrschenden angloamerikanischen Science Fiction, da ein globaler Streifzug durch diese Literatur Bände füllen würde.
Wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir über Science Fiction reden?
Was unterscheidet Science Fiction von anderen Literaturgattungen, die häufig in der Super-Kategorie nicht-realistisch oder phantastisch zusammengefasst werden? (Und zwar deshalb, weil sie nicht das wiedergeben, was gemeinhin als Realität unterstellt wird, so fiktiv das wiederum sein mag.)
Ich will versuchen, dieses Gebiet zumindest einzukreisen. Dazu ein paar Thesen zu den diversen Literaturen, die uns aus der uns bekannten Welt katapultieren. Der Unterschied liegt in den Welten, in die sie uns hineinkatapultieren.
Der Magische Realismus entführt uns in Welten, deren Regeln sich gegenüber unserer eigenen ein ganz klein wenig geändert haben. Eine solche Welt ist in sich geschlossen und stimmig, aber von den handelnden Personen nicht zu durchschauen. Kafkas Josef K. kann ihre Schlösser im wahrsten Sinne des Wortes nicht knacken.
Phantastische Romane – etwa die Haruki Murakamis oder auch die meisten Horror-Romane Stephen Kings – handeln zumeist vom Verrücken der Realitäten, von Brüchen im Welt- und Zeitgefüge, die bei den handelnden Personen Zögern, Zweifel und Irritationen auslösen. Über die gewohnte Matrix unserer Welt scheint sich eine zweite zu legen, die nach und nach alles durchdringt.
Postmoderne Romane dagegen – etwa die von Arturo Pérez-Reverte – nutzen unterschiedliche Erzählmodi, um unseren Realitätssinn zu erschüttern. Sie spielen mit literarischen Genres wie Krimi oder SF, verweben Elemente des Realismus mit Mythen und Märchen oder der Bildzeitung, unterbrechen den Handlungsfaden schamlos, damit sich der Autor mit seinen Hauptfiguren streiten kann und so weiter. Das heißt: Sie entführen uns in die Welt reiner oder auch schmutziger Texte, hier ist nichts mehr Realität, hier ist ALLES TEXT.
Dagegen macht sich Tolkiens Herr der Ringe geradezu konservativ brav aus: Das, was wir gemeinhin als Fantasy bezeichnen, trennt die fiktionale Welt meist vollständig von der uns bekannten ab, ohne dass diese Loslösung thematisiert wird. Sie wird bei Leserin und Leser schlichtweg vorausgesetzt. Mit der ersten Seite des Romans treten wir in diese zweite vorgestellte Welt ein, in der die Naturgesetze aufgehoben sind, Bäume und Tiere sich mitunter (leider) wie Menschen verhalten und der Kampf zwischen Gut und Böse jenseits jeder Zeitrechnung tobt.
Und jetzt kommen wir endlich zum Punkt: Auch die Science Fiction – jedenfalls die früherer Dekaden – schafft Welten, die unter, über oder neben unserer eigenen angesiedelt sind und ihren eigenen Regeln gehorchen. Allerdings sind das andere Regeln als in der Welt der Fantasy. In meist realistischem Erzählmodus geht es der Science Fiction – jedenfalls der interessanten – um Projektionen, manchmal auch Visionen, die unsere Wirklichkeit erhellen oder transzendieren.
Science Fiction als »visionärer Realismus« – ich klaue hier einen Ausdruck des britischen Schriftstellers Christopher Priest – ist jedoch keine prognostische Literatur, sondern allenfalls eines vieler Fenster zur Zukunft. In meinem Verständnis von Science Fiction folge ich der pragmatischen Definition der »International Association for the Fantastic in the Arts«, deren Mitglied ich lange Zeit war. Danach kann Science Fiction höchstens Folgendes leisten: Sie isoliert und extrapoliert reale Tendenzen unserer Gegenwart, verfolgt sie weiter nach dem Motto »Was wäre, wenn«. Sie trifft Aussagen über vorherrschende Tendenzen der Gegenwart, ist dem Anspruch nach nicht hellseherisch, sondern sagt etwas über den Diskurs unserer Gegenwart aus.
Die Besonderheit von Science Fiction liegt zudem darin, dass ihre Stoffe und Handlungen (längst nicht immer, aber häufig) gegenwärtigen Annahmen und Erkenntnissen der Wissenschaft zumindest nicht widersprechen. Und dass sie diese Annahmen und Erkenntnisse – im Unterschied zur Nabelschau vieler Befindlichkeitsromane – auch ausdrücklich thematisiert.
Längst haben sich die Grenzen zwischen phantastischen Romanen, sogenannten realistischen Mainstream-Romanen, postmodernen Romanen und Science-Fiction-Romanen verwischt und verschwinden zunehmend. Das liegt nicht an der Politik der Verlage – sie vollziehen diese Entwicklung nur nach –, sondern an der chaotischen Wirklichkeit, die unsere eigene Erfahrung immer mehr auf einzelne Fragmente reduziert. Wenn die Wirklichkeit, wie der SF-Kritiker John Clute sagt, immer mehr zu einer Reihe von Optionen wird, wird das »Genre-Hopping« oder »literarische Crossover« zwangsläufig zum Normalfall. Auch die SF-Autorinnen und -Autoren haben inzwischen größtenteils mit der linearen Erzählweise eines Romans des 19. Jahrhunderts gebrochen.
Mit welchen realen und fiktionalen Entwicklungen haben wir es in der Science Fiction zu tun?
In Abgrenzung zu manchen Kritikerinnen und Kritikern, die Utopien und Science Fiction in einen Topf werfen – folglich schon Platos Republik und Campanellas Sonnenstaat als Vorläufer der Science Fiction in Anspruch nehmen –, stimme ich mit dem 2017 verstorbenen englischen Autor Brian W. Aldiss überein, wenn er den eigentlichen Beginn der Science Fiction mit der Erschütterung feudaler Verhältnisse, den Nachwehen der französischen Revolution, dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und – vor allem – der Verunsicherung bestehender Verhältnisse durch die Industrielle Revolution in Verbindung bringt: Als Krisenliteratur thematisierte und thematisiert Science Fiction Ängste einer Gesellschaft im Wandel.
1818 schreibt Mary Shelley (1797–1851) mit Frankenstein or the Modern Prometheus den ersten Roman, in dessen Mittelpunkt Triumph und Niederlage des wissenschaftlichen Fortschritts stehen. Eine moderne Variation des Faust-Themas: Frankenstein, der Forscher, der Wissen, Macht und Selbsterfüllung sucht, muss erkennen, dass Wissen menschliche Gemeinschaft sogar zerstören kann. Gleichzeitig beinhaltet Frankenstein auch die Kritik an Gesellschaft und familiärer Gemeinschaft selbst: Erst durch die Ausgrenzung seitens der Menschen wird Frankensteins humanoide Schöpfung zum Monster.
Es gibt viele Deutungen von Mary Shelleys Frankenstein, darunter auch diverse psychoanalytische, in denen, aufgrund von Shelleys Biografie, die Schöpfung des Frankenstein‘schen Monsters als Trauma des ungewollten Kindes oder als Bewältigung des Todestraumas interpretiert wird. Mit Frankenstein gelingt es Shelley, tiefgreifende persönliche und gesellschaftliche Ängste in Metaphern zu fassen – eine Eigenart, die Science Fiction über Dekaden gegenüber mikrokosmischen Szenarien anderer literarischer Gattungen auszeichnen wird.
In Stichworten sollen hier nur ein paar Tendenzen der frühen Science Fiction und deren Autoren erwähnt werden. Zum Beispiel Jules Verne (1828–1905), der – fasziniert von geografischen Entdeckungsreisen und dem damaligen Stand der naturwissenschaftlichen Forschung – 1864 die literarische Reise zum Mittelpunkt der Erde antritt, sich 1879 20 000 Meilen unter das Meer begibt und später die Reise zum Mond schildert. Sein Anspruch ist weniger der eines Romanciers als der eines Enzyklopädisten, der das astronomische, geografische und biologische Wissen seiner Zeit mit der Entdeckung und Eroberung von Neuland koppelt – ganz wie es dem Zeitalter des klassischen Kolonialismus entspricht.
Herbert George Wells (1868–1946), Autor von 120 Büchern, darunter Die Zeitmaschine (1895) oder Der Krieg der Welten (1897), thematisiert in seinen Romanen – wir brauchen nur an die Elois und Morlocks zu denken – sehr wohl die Klassenspaltung der heimischen Gesellschaft und die Kolonialisierungspolitik des British Empire. Nicht zuletzt beschreibt er im Roman Der Krieg der Welten »how it feels to be colonized«. Dass ausgerechnet die Marsianer am irdischen Horizont auftauchen, ist kein Zufall: Ende des 19. Jahrhunderts führen die Forschungen des Italieners Schiaparelli, seine Oberflächenkartierung des Mars und die Entdeckung ominöser »Mars-Kanäle« zu einem Boom spekulativer Mars-Literatur.
Auch der deutsche Mathematiker und Physiker Kurd Laßwitz (1848–1910) bewegt sich literarisch Auf zwei Planeten, Erstveröffentlichung 1897, und fördert mit liberalem Humanismus die friedliche Koexistenz zwischen Marsianern und Menschen.
Damit unterscheidet er sich wohltuend von anderen Autoren aus Deutschland, beispielsweise vom Ingenieur Hans Dominik (1872–1945), der das Genie deutscher Erfinder fortwährend zur Bewahrung deutscher Vorherrschaft einsetzt und gegen den Ansturm feindseliger Mächte verteidigen muss. Er ist aber keineswegs ein Einzelfall: In »Zukunftskriegsromanen«, beispielsweise Michael Wagebalds Europa in Flammen (Berlin 1908) beweist die Deutsche Luftwaffe ihre technische Überlegenheit durch Vernichtung der nicht so flugtüchtigen Feinde. Groschenhefte voller Zeppeline und fremder Teufel werden so populär, dass die Kirchen um die Seelen ihrer jugendlichen Schäfchen fürchten und Kampagnen gegen die sogenannte Schmutz- und Schundliteratur einleiten.
Aber es gibt auch andere Stimmen in dieser Zeit, etwa die des Schriftstellers und Künstlers Paul Scheerbart (1863–1915), der – beispielsweise in seinem Asteroiden-Roman Lesabendio und anderen sogenannten kosmischen Phantasien – von einer mystischen Welt ohne Nationen, Militär und Kriege träumt.
Während die frühe europäische Tradition der Science Fiction häufig zivilisationskritische oder sozial-utopische Elemente enthält, hat die amerikanische Science Fiction ganz andere Wurzeln: Die Ursprünge liegen hier in der »Boys Literature« – Abenteuergeschichten für Jungs, bestimmt von einfachen Erzählstrukturen, veröffentlicht in billigen Magazinen für wenig zahlungskräftige Käuferschichten.
1926 erscheint zum ersten Mal das Magazin AMAZING STORIES, herausgegeben von Hugo Gernsback (1894–1967). Er ist ein Technik-Freak, der eigentlich Radios bastelt und vertreibt. Sein Interesse als Autor und Herausgeber liegt vorrangig in technischen Vorhersagen, weniger in den gesellschaftlichen Auswirkungen von Technologien. Bekanntermaßen schreibt man Gernsback auch die ursprüngliche Begriffskonstruktion »Scientifiction« zu, aus der sich später der leichter zu sprechende Begriff der »Science Fiction« entwickelte.
Gernsback, dessen naive Technikeuphorie William Gibson später auch in der Erzählung »Das Gernsback-Kontinuum« verewigt hat, vertritt eine Richtung der Science Fiction, die auf dem Hintergrund amerikanischer Verhältnisse gesehen werden muss. Eine schnelle industrielle Entwicklung, die Vertreibung und Unterdrückung der Ureinwohner und die »new frontiers« mit jeder Menge Platz für die neuen Kolonialisten haben die Ideologie »Alle Macht dem Tüchtigen« begünstigt: Der tüchtige protestantische Weiße männlichen Geschlechts behauptet sich im Existenzkampf und nimmt alsbald die Eroberung, Besiedlung und Ausbeutung fremder Regionen in Angriff, erhält und verteidigt die persönliche Unabhängigkeit im Kampf Mann gegen Mann und greift – wie im Western High Noon – wenn’s denn sein soll – auch zur Knarre, um das Gute zu erhalten.
Dieses Konglomerat aus Sozialdarwinismus, Sendungsbewusstsein, Technikeuphorie und Fortschrittsgläubigkeit schlägt sich auch im sogenannten »Goldenen Zeitalter« der amerikanischen Science Fiction nieder, das man etwa vom Ende der 1930er-Jahre bis nach Ende des Zweiten Weltkriegs datieren kann. E. E. ›Doc‹ Smith (1890–1965) entwickelt Visionen der Super-Science und der Super-Helden, die den Weltraum erobern und dabei Räuber und Gendarm spielen. Später lässt Robert A. Heinlein seine Starship Troopers fremde Territorien und insektenartige Aliens niederwalzen und feiert den Triumph von Macht und Militär.
Allerdings bleibt der Sieg der »Starship Troopers« kein Sieg auf Dauer, sondern muss im Frost des »Kalten Krieges« immer wieder neu ausgefochten werden. Der erste sowjetische Sputnik im Weltraum löst 1957 eine wahre Flut von Bedrohungsszenarien in Film und Literatur aus, in denen das, was über die amerikanische Welt hereinbricht, ebenso »alien« ist wie Chruschtschows Schuhklopferei vor der UNO. Spinnen, Mutationen und Monster bevölkern amerikanische Kleinstädte und belagern die Vorgärten – das ist die eine Seite. Die andere Seite ist der Ausschuss für gänzlich un-amerikanische Aktivitäten, Senator McCarthy, die Kommunistenhatz und Repression, wie sie etwa Ray Bradbury in Fahrenheit 451 (1953) mit Gedankenpolizei und Bücherverbrennungen thematisiert hat.
Die 1960er-Jahre katapultieren uns dann vom »Outer Space« in den »Inner Space« – vom Weltraum zurück in irdische Gefilde: Laser-Entwicklung, bemannte Raumfahrt, Herztransplantionen, Armstrongs erster Schritt auf dem Mond, Drogen, Beatles, Stones, Mothers of Invention, Mini-Mode, Swinging London, Anti-Autoritarismus und außerparlamentarische Opposition, weltweite Proteste gegen den Vietnam-Krieg: In Welt und Köpfen gerät einiges in Bewegung. Durch die »New Wave« in der Science Fiction weht J. G. Ballards Wind from Nowhere, in London übernimmt Michael Moorcock das Magazin NEW WORLDS, führt Szenarien irdischer Dekadenz vor und versichert sich der Mitarbeit von Brian W. Aldiss. Aldiss schreibt in dieser Zeit seinen drogeninspirierten Innenwelt-Roman, den er Barfuß im Kopf betitelt. Die Dinge sind nicht, was sie scheinen, sagt auch Philip K. Dick und jongliert mit elektrischen Schafen, Realitätsbrüchen und Alternativwelten. Die Zeit ist – nicht nur bei Dick – aus den Fugen.
Die 1970er-Jahre bescheren uns die weitere Desillusionierung von Allmachts- und Technikträumen, die USA knabbert auch literarisch am Trauma des Vietnamkriegs. In der Science Fiction tritt etwa der Vietnam-Veteran Joe Haldeman, seinerzeit wegen »Tapferkeit vor dem Feind« mit dem »Purple Heart«-Orden ausgezeichnet, mit seiner Vietnam-Reminiszenz The Forever War (1975; dt. Der ewige Krieg) hervor.
Und wo bleiben in all diesen Gefechten die Frauen?
Dass die Frauen bisher kaum vorgekommen sind, ist kein Zufall: Bis in die 1960er-Jahre des 20. Jahrhunderts ist die offiziell registrierte und rezensierte Science Fiction weitgehend ein »Boys Club«, in dem die Jungs unter sich bleiben oder auch bleiben wollen. Die Handlungsträger sind in der Realität wie in der Fiktion in der Regel Männer. Wenn Frauen in den Romanen vorkommen, dann meistens als sanfte Zierde, treue Hüterinnen von Kindern, Küche und Kirche, platinblonde Opfer und rabenschwarze Vamps, manchmal auch als grässlich humorlose Wissenschaftlerinnen. Diese stereotypen, oft auch sexistischen Frauenbilder sind insbesondere für eine literarische Gattung, die sich dem Wandel verschrieben hat, ein ziemliches Paradoxon. Dabei hat es sie durchaus gegeben, die Frauen, die vor und nach Mary Shelley ihre gesellschaftlichen Visionen zu Papier gebracht haben, oft unter männlichem Pseudonym.
Mit dem Wiederaufleben oder Neubeginn der Frauenbewegung in den 1970er-Jahren werden die Frauen auch in der männlichen Domäne Science Fiction sichtbar und hörbar aktiv. Es sind die Frauen, die das einleiten, was man als Paradigmenwechsel in der Science Fiction bezeichnen kann. An die Stelle von Technik-Faszination treten die Fragen: Wohin führen uns neue Technologien? Welchen sozialen Wandel werden sie bewirken? Welche Art von Sexualität, familiärer und sozialer Organisation wird das mit sich bringen? Und nicht zuletzt: Wie werden wir mit dem Unterschied zwischen Arm und Reich umgehen? Wie werden wir mit der Erde und den natürlichen Ressourcen umgehen? Kurz gesagt tritt an die Stelle technik-verliebter Szenarien ein Boom sozio-ökologischer Utopien.
An erster Stelle ist hier Ursula K. Le Guin mit ihrem bahnbrechenden Roman The Left Hand of Darkness (dt. Winterplanet bzw. Die linke Hand der Dunkelheit) zu nennen – ihrer eigenen Aussage nach ein Gedankenexperiment der Androgynität: Was passiert mit einer Gesellschaft, in der die Trennung zwischen den Geschlechtern aufgehoben ist? 1988 schreibt sie in einem Nachtrag dazu: »Wenn Männer und Frauen in ihren sozialen Rollen völlig gleichgestellt wären, ebenso in rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht, im Grad der Freiheit, Verantwortlichkeit und im Selbstwertgefühl, dann sähe diese Gesellschaft völlig anders aus.«
Ähnliche Gedankenexperimente mit der Beseitigung, Veränderung oder Umkehrung von Geschlechterrollen liegen in dieser Zeit sozusagen in der Luft. Die spätere Nobelpreisträgerin Doris Lessing widmet einen ganzen Band (Die Ehen zwischen den Zonen Drei, Vier und Fünf) ihres Roman-Zyklus CANOPUS IN ARGOS: ARCHIVE der Frage, wie Yin und Yang, weibliches und männliches Prinzip, so zusammenzubringen sind, dass eine höhere Stufe der menschlichen und gesellschaftlichen Entwicklung erreicht werden kann.
Marge Piercy schafft 1979 mit ihrem Roman Frau am Abgrund der Zeit die Vision eines Gemeinwesens, das basisdemokratisch, anti-zentralistisch und nach ökologischen Prinzipien organisiert ist. Spezifische Geschlechterrollen sind darin aufgehoben. Sind diese Ansätze heute überholt?
Leben wir in Post-Utopia?
Die ökotopische Strömung in der Science Fiction versiegt in den 1990er-Jahren mehr und mehr. Die Ereignisse in Osteuropa, die Auflösung der Sowjetunion, der Fall der Berliner Mauer, die deutsch-deutsche Vereinigung lösen zunächst einen ganz anderen Diskurs aus – den über das angebliche »Ende der Geschichte«.
Der Science-Fiction-Autor Kim Stanley Robinson sagt kurz vor der Jahrtausendwende in einem Interview: »Mit dem Zerfall alter Denkmodelle des Kalten Krieges ging diese lächerliche Diskussion einher, in der behauptet wurde, wir hätten das Ende aller Geschichte erreicht. Dabei handelte es sich ganz und gar nicht um das Ende der Geschichte, sondern lediglich um die Grenzen unserer Vorstellungskraft.« Alle waren völlig befangen von den geistigen und politischen Modellen der Nachkriegszeit und darin stecken geblieben. Und als die nicht mehr zutrafen, musste zwangsläufig die Frage kommen: »Was sollen wir als Nächstes machen?«
Mit einem dreiteiligen Epos unternimmt Robinson selbst den Versuch, Zeitgeschichte zu extrapolieren, indem er sie zum Mars exportiert. »Kann es sein«, fragt er, »dass diese sogenannten sanften Revolutionen zum Erfolg führen? Und falls ja: Was passiert danach? Gibt es Rückschläge? Und warum?«
Auch Brian W. Aldiss und der Physiker Roger Penrose gehen 1999 in dem Roman Weißer Mars – eine Utopie des 21. Jahrhunderts der Frage nach, wie die Menschheit den »Aufbruch zur Vernunft« bewerkstelligen kann – bei ihnen ist es eine Revolution des Denkens, die alle Sektoren der Mars-Gesellschaft durchdringt und dann auch den Planeten Erde infiziert.
Octavia Butler schafft mit der Parabel vom Sämann (1999), deren Schauplatz in einer USA der nahen Zukunft angesiedelt ist, eine Vision ökologischer Katastrophen und sozialen Zerfalls. Allerdings setzt sie diesem Szenario eine Hoffnungsträgerin entgegen: die junge schwarze Lauren Olamina, die eine Bewegung des sozialen Aufbruchs schafft.
Kim Stanley Robinson, Brian W. Aldiss, Roger Penrose, Octavia Butler, Ursula K. Le Guin – sie alle haben bei aller Verschiedenheit der Ansätze eines gemeinsam: Sie setzen auf die materielle Kraft menschlicher Vorstellung. »Die Art und Weise, wie wir unser Zusammenleben organisieren«, sagt Robinson in dem erwähnten Interview, »ist ein genauso wesentlicher Aspekt unseres Lebens wie der biologische.«
»Die neue Organisation menschlichen Wissens«, sagt der Physiker und SF-Autor Karlheinz Steinmüller im September 2000 während der Wetzlarer Phantastik-Tage, »ermöglicht eine Vernetzung von Ideen und Konzepten. Denn es sind nicht nur die ›harten Fakten‹ der Wirtschaft, die unsere Wirklichkeit prägen, sondern auch unsere Vorstellungen und Projekte.«
Seitdem sind mehr als zwei Jahrzehnte vergangen.
In Anbetracht der rasanten wirtschaftlichen Globalisierung mit all ihren Folgen, der ständig gewachsenen weltweiten Kluft zwischen Arm und Reich, der Kriege und Krisen und ökologischen Katastrophen in so vielen Ländern, der Flüchtlingsströme, des Erstarkens des Terrorismus, des Rassismus und Nationalismus und fundamental-religiöser Strömungen ist es dringender denn je, sich ins Gedächtnis zu rufen, dass – jenseits der ›harten Fakten‹ – auch andere Weltmodelle vorstellbar und projektierbar sind. Weder sind die gesellschaftlichen und politischen Fragen, die den Utopien und Dystopien der 1970er- und 1980er-Jahre zugrunde lagen, in irgendeiner Weise gelöst, noch ist das Ausmaß neuer Fragen auch nur abzusehen. All das sind Fragen, die über die Art des Lebens und des Todes auf diesem Planeten und über Leben und Tod des Planeten selbst entscheiden werden. Um es in der Sprache der Werbung auszudrücken: Gedankenexperimente waren noch nie so wichtig wie heute. Eine andere Welt muss vorstellbar sein, ehe sie machbar wird.
Als Literatur des Wandels kann Science Fiction soziale Veränderungen erspüren und thematisieren, Szenarien künftiger Entwicklungen entwerfen. »Diese Szenarien«, sagt Kim Stanley Robinson, »sind wie Gedankenexperimente in der Physik. Wenn man Science Fiction so versteht, dann ist diese Literatur mehr als nur billige Unterhaltung. Sie wird tatsächlich zu einem Instrument des Denkens, und für dieses Denken spielt die Utopie eine ganz wesentliche Rolle.«
Ich ziehe den Begriff des Gedankenexperiments dem der Utopie vor, weil derjenige der »Utopie« allzu leicht Vorstellungen eines geschlossenen, hierarchischen, zentralistischen, eindimensionalen Systems heraufbeschwört. Für ein solches in sich geschlossenes Systemdenken ist uns die Welt mit all ihren Brüchen, Spaltungen und Verwerfungen bereits allzu nahe auf den Leib gerückt. Auch das Selbstverständnis der Science Fiction ist derzeit einem radikalen Wandel unterworfen und keineswegs eindeutig.
»Das nimmt kein Ende, was eine lebende Welt von dir fordert«, schrieb die weise SF-Autorin Octavia Butler in ihrem fiktiven Traktat Erdensaat: Die Bücher der Lebenden.
Von Gehirnen und Agenten, Träumen und Realitäten
Ein kurzer Streifzug
Emily Dickinson, Dichterin (1830–1886)
hat das seltsame Verhältnis zwischen dem kleinen Inneren unseres Gehirns und seiner riesigen Projektionsfläche in einem Gedicht thematisiert:
The Brain — is wider than the Sky —
For — put them side by side —
The one the other will contain
With ease — and You — beside —
The Brain is deeper than the sea —
For — hold them — Blue to Blue —
The one the other will absorb —
As Sponges — Buckets — do —
Zhuang Zi, Philosoph (gest. 275 v. Chr.)
ist einer der Väter des Taoismus. Hier seine viel zitierte Schmetterlingsparabel zur Frage unserer Realitätswahrnehmung: Zhuang Zi träumte, er sei ein Schmetterling. In glücklicher Selbstzufriedenheit gaukelte und flatterte er umher und tat einfach das, was ihm gefiel. Und er wusste nicht, dass er Zhuang Zi war. Plötzlich erwachte er aus dem Traum, und schau – da war er wieder er selbst: echt und unverkennbar Zhuang Zi. Aber dann wurde er sehr nachdenklich. Er wusste mit einem Male nicht mehr, ob er nun Zhuang Zi war, der eben träumte, ein Schmetterling zu sein, oder ob er vielleicht ein Schmetterling war, der träumte, Zhuang Zi zu sein.
Brian W. Aldiss, Science-Fiction-Autor (1925–2017)
schrieb viele Jahrhunderte später zur Realitätswahrnehmung: »Wenn Sie wie ein Mensch denken und fühlen, wenn Sie angerührt sein können vom Anblick einer Landschaft, wenn Ihr Geist und Ihr Körper auf den Moment der Dämmerung reagiert, an dem es weder Tag noch Nacht zu sein scheint – dann könnten Sie immer noch eine Maschine sein, so programmiert, dass Sie denken, Sie seien ein Mensch.«
Marvin Minsky, Erforscher künstlicher Intelligenz (1927–2016)
sah das Gehirn als »Agenten-Gemeinschaft«. Seine Kernthese zum menschlichen Gehirn: Unintelligente, einfache Bausteine, sogenannte Agenten, können durch Interaktionen Komplexität aufbauen. Er beschreibt, wie verschiedene Interaktionen, die einer spezifischen Problemlösung zugeordnet sind, als Kollektiv aufgefasst werden können (»Society of the Mind«). Diese Theorie betrachtet die menschliche Psyche und jedes andere natürlich entstandene kognitive System als eine große Anzahl einzelner simpler Prozesse.
Raymond Kurzweil, Informatiker und Futurist (geb. 1948)
meinte zum echten und simulierten Bewusstsein: »Wenn man unter simulierter Intelligenz eine Kopie aller wichtigen Prozesse versteht, die im menschlichen Gehirn stattfinden (…), dann gibt es keinen Unterschied zwischen echter und simulierter Intelligenz. (…) Doch an welchem Punkt halten wir diese Prozesse für bewusst? Hat ein Wesen Bewusstsein, wenn es ein individuelles Erleben hat?«
Klaus Mainzer, Wissenschaftsphilosoph (geb. 1947)
sagte zur menschlichen Evolution: »Auch die menschliche Gesellschaft lässt sich als ein vernetzter Superorganismus verstehen. Mit seinen technischen Computer- und Informationssystemen wird er die Fähigkeiten des einzelnen Individuums in vielen Bereichen überflügeln und eine neue kollektive Intelligenz entwickeln. Internet und World Wide Web sind nur der Einstieg in die digitale Evolution digitaler Netzwelten. Mit deren wachsender Komplexität werden virtuelle Agenten für das Netzmanagement ebenso unverzichtbar sein wie mikrobielle Organismen für die Lebensfähigkeit des menschlichen Körpers.«
Nachruf auf Josef Nesvadba
* 19. Juni 1926 † 26. April 2005
»Auch eine wohlwollende Utopie ist nicht menschlich und führt zu Verbrechen«, heißt es am Ende seines stark autobiografisch gefärbten Romans Geheimbericht aus Prag, entstanden 1967–69, der dort ungekürzt erst 1991 erscheinen konnte (deutsch 1994). Das Scheitern der Utopie zieht sich als roter Faden durch das ganze Werk Josef Nesvadbas, der sich bereits während des Zweiten Weltkrieges intensiv mit marxistischer Literatur und Philosophie auseinandersetzte. Deren Gesellschaftsanalysen und utopische Elemente faszinierten ihn bis zum Lebensende, doch er blieb stets ein Skeptiker und scharfer Kritiker realsozialistischer Verhältnisse in Osteuropa. Seine frühen Geschichten verstand er selbst als kontinuierliche Polemik gegen die restriktive Umsetzung ideologischer Ziele, mit denen er durchaus sympathisierte. »Die Pirateninsel«, eine seiner ersten Geschichten, ist ein gutes Beispiel dafür: Die Piraten wollen eine Insel im Pazifik retten, weil sie wissen, dass andere Freibeuter diese Insel irgendwann in ihre Gewalt bringen wollen. Doch die Inselbewohner wollen sich nicht retten lassen, also löschen die wohlgesinnten Piraten die ganze Insel aus.
Ein zweites, damit verbundenes Thema ist bei Nesvadba die immer wiederkehrende Frage nach der Realitätswahrnehmung. In der Erzählung »Einsteins Gehirn« (1960) heißt es dazu:
»Gewiss, die technischen Wissensgebiete haben seit Ende des 19. Jahrhunderts die Welt verändert, sie haben alle übrigen Fächer in den Schatten gestellt, sie haben es möglich gemacht, dass sich die Menschen nur wirklich wichtigen Aufgaben widmen, wie wir das alle sehr gut wissen. Die Grundprobleme aber hat man nicht gelöst. Die Menschen fragen sich bis zum heutigen Tag, wie und warum sie eigentlich leben; bis heute wissen wir nichts über den Beginn des Weltalls, bis heute können wir die vierte Dimension, die Einstein ausspekuliert hat, nicht einmal begreifen. (…) Die Physik beginnt, eine Hilfswissenschaft zu werden, immer deutlicher zeigt sich ihre Abhängigkeit von der Philosophie, ungefähr so, wie das Anfertigen von gehäkelten Spitzen von der Grafik abhängig ist.«
Während eines Interviews, das ich 1999 anlässlich der European Science Fiction Convention »Trinity« in Dortmund mit Josef Nesvadba führen konnte, bemerkt er dazu: »Irgendwie geht es bei mir immer um die Tragik der Erkenntnis. Es geht um das Ende der Rationalität. Einfacher gesagt, um die Geschichte eines Mannes, der sich für klug hält und durch die Realität ernüchtert oder irregeführt wird.«
Von Anfang seiner Schriftstellerkarriere an spielt er in seinen Geschichten mit der Verfremdung von Realitäten, verwebt die klassischen Sujets von Science-Fiction- und Horror-Literatur zu Grotesken und Satiren, die in der Tradition osteuropäischer Phantastik stehen. Und in der Tradition von Swift, Wells und Huxley, die er bereits in der Schulzeit gelesen hat. Bald wird er zum erfolgreichsten tschechischen Autor dieser literarischen Richtung und in einem Atemzug mit Karel Čapek genannt. Dabei ist das Schreiben sein Zweitberuf: An der Karlsuniversität hat er Medizin und Philosophie studiert und sich auf Psychiatrie spezialisiert; von 1956 an arbeitet er als Psychotherapeut an der Prager Universitätsklinik. Noch 1999 praktiziert er regelmäßig als privater Gruppentherapeut.
Die ersten literarischen Versuche macht er als Übersetzer englischer Lyrik. In den folgenden Jahrzehnten schreibt er Schauspiele, Drehbücher, Kurzgeschichten und Romane, die in der ČSSR sehr hohe Auflagen erreichen und größtenteils auch in der UdSSR, Polen, Österreich, den USA und Deutschland veröffentlicht werden (darunter Einsteins Gehirn, Heyne 1975; Wie Kapitän Nemo starb, Das Neue Berlin 1978; Die absolute Maschine, Artia 1966; Vor Eltern sei gewarnt, S. Fischer 1975; Kapitän Nemos letztes Abenteuer, Neues Leben 1983; Vampir Ltd., Suhrkamp 1983 und 1998). Einige seiner Erzählungen dienten als Vorlagen für Kino- oder Fernsehfilme.
Stets hat Nesvadba literarisches Schubladendenken verabscheut und sich selbst als Crossover-Autor gesehen. Was er in den letzten Lebensjahrzehnten befürchtete, war eine »McDonaldisierung«, wie er es nannte, der Science Fiction: »Das Problem liegt darin, dass die Leute immer neue Planeten, neue Aliens, neue Abenteuer haben wollen, die aber gleichzeitig immer haargenau dieselben sein sollen. Sie wollen nichts anderes. Und das kastriert die ganze Bewegung. Ich habe mal jemanden sagen hören: So öde ist sonst nur noch die Pornografie. (…) Aber man kann natürlich auch versuchen, die alten Formen zu benutzen und sie irgendwie anders zu füllen. Für mich besteht die Inspiration beim Schreiben darin, dass ich etwas Neues entdeckt habe, sonst macht mir das Schreiben keinen Spaß. Die zwei Dinge, die mich mein ganzes Leben lang interessiert haben, waren Erkenntnis und Sex, und beides hängt natürlich auch zusammen. Man will Neues erfahren und entdecken.«
Tatsächlich hat Nesvadba in späten Jahren auch erotische Geschichten geschrieben, zumeist unter dem Pseudonym Joseph Nevada. 1991 veröffentlichte ALIEN CONTACT seine Erzählung »Erosome«. Weniger bekannt ist, dass er auch unmittelbar politische Texte schrieb. 1965 brachte die FAZ eine ganze Serie seiner kritischen Reflexionen über den Vietnam-Krieg.
Einige seiner bissigen Werke konnten nur stark zensiert oder im Ausland erscheinen. (Nesvadba war ein Sprachentalent und schrieb auch auf Deutsch und Englisch.) Stets hatte er eine Gruppe junger Autoren um sich, die er auch in politisch harten Zeiten förderte und unterstützte. Noch in den letzten Lebensjahren nahm er sich der Manuskripte von Nachwuchsschriftstellern an.
Seine Rolle als Mentor und kritischer Autor brachte ihm nicht nur Freundschaften, sondern auch Feindschaften ein. Nach dem Prager Frühling geriet er ins Visier der Parteispitze und musste in Österreich Exil suchen, kehrte aber später nach Prag zurück. Sein Roman Geheimbericht aus Prag durfte 1968 nicht mehr erscheinen und wurde 1978 zum harmlosen Krimi heruntergestutzt. Als die Originalfassung 1991 erschien, fand sie als »Schlüsselroman« einer ganzen politischen Epoche bei der tschechischen Leserschaft große Resonanz.
Dagegen fand Nesvadba für seine Satiren und Grotesken im In- und Ausland kaum noch ein Publikum, da ihr Referenzrahmen sich überholt hatte, wie er selbst festgestellt hat: »Die Leute haben eigentlich genug von Allegorien, sie sind ihrer müde. Meine Geschichten sind ja oft weniger Parabeln als Diagnosen gewesen. Aber heute ist eine komplette Freiheit der Formulierungen gegeben. Und um interessant zu sein oder sich durchzusetzen, müsste die Form wahrscheinlich noch viel schärfer sein. Das heißt: auch brutaler. Ich glaube, man müsste eher ein Tabu durchbrechen, aber kein sexuelles, denn das ist genehmigt.«
Noch kurz vor der Jahrtausendwende hatte Nesvadba ein großes utopisches Projekt für das 21. Jahrhundert im Kopf, das er gern in Angriff genommen hätte. »Ich frage mich oft, was nach dieser großen politischen Wende passieren wird. Kommt es zu einer Zersplitterung, zu einer Trennung zwischen der Aristokratie der Wissenden und der Masse der Ausgebeuteten? Oder kommt es zu einer Wiederkehr all dieser Ideen, die wir heute totsagen? Das heißt: Kommt die Aufklärung zurück? Kommt irgendwann in der nahen Zukunft wieder einmal ein Jahr 1848? Und woher? Und wie? Das kann niemand sagen. Die Menschen in Osteuropa sind an gewisse Dinge gewöhnt, die sie in dieser neuen Welt nicht finden. Und ich glaube, da gibt es ein reifes Feld für neue Ideen, für Ideen, die die alten sozialistischen Ideale in viel humanerer Weise realisieren könnten. (…) Weil ich so alt bin und bald sterben werde, mache ich mir über die Zukunft eher amüsierte Gedanken und denke: Na ja, ich werde ja nicht mehr dabei sein. Aber dennoch fühle ich mich nicht wohl bei dem Gedanken. Eigentlich erlebe ich die Katastrophe seit meiner Jugend. Das 20. Jahrhundert ist eine sich ewig wiederholende Katastrophe. Aber das 21. Jahrhundert könnte durch eine neue Utopie gerettet werden. Thomas Morus’ Utopia ist zwar schlecht geschrieben, aber die Idee ist sehr interessant. Sie entspricht vielleicht gerade der Religiosität des Menschen – dieser anderen Kategorie von Werten.«
Zu diesem utopischen Entwurf ist es nicht mehr gekommen. Als letztes Buch Nesvadbas erschien 2002 der Roman Die Hölle Beneš (eine deutsche Übersetzung liegt meines Wissens nicht vor), den er selbst als »Alternativgeschichte, ein Buch über den Nationalismus und seine Scheußlichkeiten« charakterisierte. Im Mittelpunkt steht dabei die zweite Ära Beneš in der ČSSR, die Zeit von 1945 bis 1948.
Zuletzt arbeitete Nesvadba trotz großer gesundheitlicher Probleme an seinen Memoiren »rund um Sex und Kommunismus«, die vor allem die 1950er- und 1960er-Jahre behandeln sollten. Er konnte sie nicht mehr vollenden.
Stephen King – Facetten des Horrors
Pleased to meet you – hope you guess my name
Die Memorial Bridge zwischen Portsmouth, New Hampshire, und Kittery, Maine, verbindet den nördlichsten Bundesstaat Neuenglands mit dem Rest der Vereinigten Staaten. Im Sommer rollen die Wagen der Urlauber mit New Yorker Nummernschildern Tag und Nacht gen Norden. Die Brücke markiert zugleich die Grenze zwischen den Landschaften. Auf die sanften Hügel und Landstädte New Hampshires folgen kleine vergessene Dörfer an der rauen Küste und gleich jenseits der Interstate 95 die dichten Wälder.
Maine
»Während anderswo wuchernde Städte das Land verzehren, fällt der Großteil des Staates langsam, aber sicher an die Wälder zurück. Die Bilder von Winslow Homer, John Martin und Andrew Wyeth fangen das am besten ein: Sie geben dem Verlust des Zeitsinns Gestalt, der auch das Land durchdringt«, heißt es im Tourbook Maine der American Automobile Association. In Maine ist Stephen King, »brand name« moderner Horrorliteratur, geboren und aufgewachsen. Maine, das Hinterland, hat ihn nie losgelassen, und seiner Hassliebe hat er nachgegeben, als er in Bangor sein viktorianisches Herrenhaus erwarb. Bangor – Protoyp der fiktiven Kleinstadt Derry, von der er in seinem Roman It, (dt. Es), 2017 von Andrés Muschietti erneut verfilmt, erzählt: »Die Geschichte einer Stadt hat Ähnlichkeit mit einem großen alten Herrensitz – viele Säle und kleine Zimmerchen und Waschküchen und Türmchen und Kellergewölbe und ein, zwei Geheimgänge. Sie werden sie finden, wenn Sie danach suchen.«
So, wie William Faulkner das Fluidum des amerikanischen Südens verewigte, hat King in seinen Romanen und Geschichten den Mythos Maine geschaffen und die Tradition des neuenglischen Regionalismus in der Horrorliteratur fortgeführt. Maine, eine Landschaft voller Puppenhäuser, deren Putz Einsamkeit, Hass und Tod kaschiert. Maine, der Mikrokosmos einer Welt, in der Kindheitsängste wahr werden: »Der Wind berührt dich an einer Stelle, die tiefer liegt als das Mark deiner Knochen.« (Salem’s Lot, 1975; dt. Brennen muss Salem). Kleinkariert wie die Holzfällerhemden sind die von King beschriebenen Lebensmuster in den abgeschiedenen Dörfern und Städtchen, nostalgisch in ihrer Übersichtlichkeit, abwehrend dem Neuen und Fremden gegenüber. Kings Horror ist mitten in der Enge des Zusammenlebens und in der Tristesse der von Schnellimbissen, Auto-Kinos, Supermärkten und Tankstellen gesäumten öden Straßen angesiedelt – in dem, was man die Organisation des Lebens nennen könnte.
Ordnung versus Chaos
Ist jede Horrorgeschichte zwangsläufig konservativ, weil sie erst auf der Folie der sogenannten Normalität wirken kann (die am Ende meistens mehr oder weniger wiederhergestellt wird)? Wenn die Ordnung selbst schon der eigentliche Horror ist, wie häufig in Kings von Egoismus, Korruption und Machtgier bedrohten Gemeinwesen, dann ist ihr Gegenpol das Chaos, die Anarchie. Insofern ist Kings Roman The Stand, 1978; dt. Das letzte Gefecht, zweite vollständige Fassung 1990) durch und durch subversiv. Die instrumentelle Vernunft, die sich in der nordamerikanischen Gesellschaft mehr und mehr als aggressive Profit- und Machtgier Bahn gebrochen hat, hat in diesem Roman den nahezu vollständigen sozialen Zusammenbruch bewirkt. »Am Ende der Vernunft«, lässt King einen seiner Protagonisten sagen, »steht das Massengrab … Es war früher Mode, alles auf die ›Technologie‹ zu schieben, aber die ›Technologie‹ ist nur der Stamm des Baumes und berührt nicht die Wurzeln.«
Die wenigen Überlebenden einer Seuchenkatastrophe, ausgelöst durch militärische Versuche der biologischen Kriegsführung, sammeln sich an zwei Polen des zerstörten Kontinents. Die einen um den »letzten Magier rationaler Denkweise«, der alsbald eine technologisch hoch ausgerüstete Diktatur re-organisiert, die anderen um Abigail, Inkarnation von Güte, Liebe und Mitmenschlichkeit. Das »letzte Gefecht« wird zwischen diesen Polen ausgetragen. Die ›gute‹ demokratische Gesellschaftsorganisation siegt schließlich, aber der Wurm verordneter Konformität nagt bereits an dieser Konstruktion.
Explizit politisch ist auch Kings Roman Under the Dome (2009; dt. Die Arena