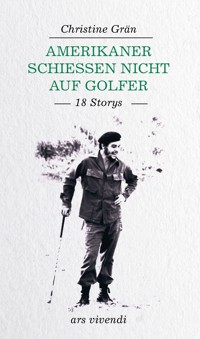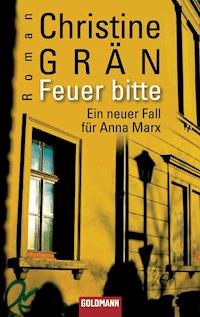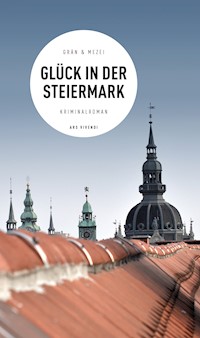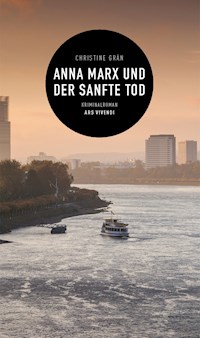
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ars vivendi Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Zu ihrem 64. Geburtstag hat Anna Marx nur zwei Flaschen Rotwein eingeladen. Es gibt keinen Grund zum Feiern: Ihre beste Freundin ist tot, die Detektei läuft nicht, sie selbst ist so gut wie pleite, und obendrein wurde ihr die Wohnung gekündigt. Dann meldet sich eine Stimme aus der Vergangenheit: ihre Ex-Kollegin Gaby Lehmann bittet Anna, den plötzlichen Tod ihrer Mutter in einem Bonner Seniorenheim aufzuklären. Mitten im Karneval zieht Anna in die Villa ihrer früheren Kollegin und schleust sich schließlich in das Seniorenheim ein. Bald stößt sie auf ein dunkles Familiengeheimnis – und auf weitere mysteriöse Todesfälle im Umfeld des Heims.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 354
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christine Grän
Anna Marx
und der sanfte Tod
Kriminalroman
ars vivendi
Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Originalausgabe (Erste Auflage April 2021)
© 2021 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG, Bauhof 1, 90556 Cadolzburg
Alle Rechte vorbehalten
www.arsvivendi.com
Lektorat: Dr. Felicitas Igel
Umschlaggestaltung: FYYF
Motivauswahl: ars vivendi
Coverfoto: mauritius images / Walter Bibikow
Datenkonvertierung eBook: ars vivendi verlag
eISBN 978-3-7472-0287-6
Inhalt
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Die Autorin
Prolog
Liebe Marion,
die Stunden, in denen ich Dir schreibe, sind mir die liebsten. Weil ich dann zur Ruhe komme. Mich ganz auf Dich konzentriere. Wahrhaftig sein kann. Die Lügen, die einem die Gesellschaft abverlangt, finde ich wirklich anstrengend. Zu Dir, zu Dir allein kann ich vollkommen aufrichtig sein. Muss nicht Interesse heucheln, Aufmerksamkeit, Zustimmung oder gar Zuneigung.
Die Menschen wollen geliebt, ergo belogen werden. Ich mag die Menschen nicht, im besten Fall sind sie mir gleichgültig. Diese naive Gier nach dem Glück, dem sie nachjagen bis ins hohe Alter, ja bis zum Tode. Wie kleine Kinder werden sie zuletzt, verkommene Wesen und auch noch grässlich anzusehen. Habe ich schon erwähnt, dass mich vor Greisen ekelt? Schönheit ist ein Geschenk mit beschränkter Haftung. Man muss sich schon sehr lieben, um sich ein Leben lang auszuhalten. Ich weiß, Du nennst mich zynisch. Doch ist es nicht der geglückte Versuch, die Welt zu sehen, wie sie nun einmal ist?
Das habe ich irgendwo gelesen: »Nur weil du paranoid bist, bedeutet das nicht, dass sie dich NICHT verfolgen.«
Natürlich bist Du nicht paranoid, meine Liebe. Aber ich fühle, dass Du in Gefahr bist. Es sind nur Blicke, Gesten, keine Worte. Böse Schwingungen. Pfeile, unsichtbar abgeschossen. Schwerelose Messer, die in der Luft tänzeln …
Auf meine Gefühle habe ich mich immer verlassen können. MEINE. Nicht die der anderen. Wer auf die baut, ist hoffnungslos verloren. DU MUSST AUF DICH AUFPASSEN! Der Unterwürfigkeit misstrauen, auch der Freundlichkeit. Eben all den Lügen, auf die Du ja kein Monopol hast.
Dreh Dich um, wenn Du im Dunkeln gehst. Bleib weg von offenen Fenstern. Meide die Heuchler und Schmeichler und alle, die vorgeben, Deine Gesellschaft zu suchen. Ich mache mir ernste Sorgen um Dein Wohl. Und kann nicht mehr tun, als Dich zu warnen.
Darf ich den Dichter zitieren, unseren geliebten Rilke:
»Der Tod ist groß.
Wir sind die Seinen
lachenden Munds.
Wenn wir uns mitten im Leben meinen,
wagt er zu weinen
mitten in uns.«
Denk an diese Worte! Ich umarme Dich.
1
Sie hat nur zwei Rotweinflaschen zu ihrem Geburtstag eingeladen.
Nie rückwärtsgehen. Wenn das eine Art Lebensmotto ist, haben ihm die Jahre zugesetzt. Die Taten und Untaten und Untätigkeiten. Anna Marx ist vierundsechzig Jahre alt. Wie in dem Beatles-Song, den sie wieder und wieder spielt. When I’m Sixty-Four … unmelodisches Schniefen als Untermalung, aber da ist sie schon ganz schön betrunken.
Gibt es Schlimmeres, als einen vierundsechzigsten Geburtstag nur mit Alkohol zu verbringen? Gut, sie könnte tot sein, doch die Orgie des Selbstmitleids lässt weiterführende Gedanken nicht zu. Anna sitzt vor einer Flasche Rotwein, die leer ist, der Aschenbecher dagegen voll. Selber schuld, sie hätte Nachbarn einladen können und gute Bekannte. Paul, den Kleinspurcasanova, mit dem sie eine Weile Sex hatte. Inzwischen reden sie nur noch darüber. Weißt du noch?
Ja, Anna weiß noch, dass er sie mit Sybille betrogen hat, ihrer besten Freundin. Aber Sybille war so, die reizende Schlampe schlief mit jedem, den sie auch nur annähernd sympathisch fand – und Moral kam in diesem Kontext einfach nicht vor. Anna hat ihr tatsächlich schnell verziehen und lediglich Paul aus ihrem Intimleben verbannt. Der letzte Ritter, der sich auf Anna Marx gestürzt hatte wie in eine Schlacht, die er nur verlieren konnte. Seither ist er auf schlampige Weise gealtert, er lässt sich gehen.
Sybille ist tot. Brustkrebs. Eins, zwei, drei – jede vierte trifft’s. Sybille ging zu spät zum Arzt, brach die Chemo ab, trank und lachte und liebte, solange sie konnte … und starb an einem grauen Sonntag im Januar. Im Hospiz. Anna war kurz aus dem Zimmer gegangen, um eine Zigarette zu rauchen. Typisch Sybille, genau diesen Augenblick für ihren letzten Atemzug zu wählen, sie war ein Miststück bis zuletzt. Und Anna weint um sie an ihrem vierundsechzigsten Geburtstag, weil sie niemanden mehr hat, den sie lieben und hassen kann. Weil sie allein ist. Uralt. Und außerordentlich pleite.
Ihr Detektivbüro läuft schlecht, Ehefrauen lassen ihre Männer nicht mehr bespitzeln, sondern gehen gleich zum Anwalt. Eltern wollen ihre Kinder nicht mehr suchen, die sind halt dann weg. Keiner will mehr irgendwas genau wissen oder jemanden dafür bezahlen, dass er unangenehme Wahrheiten ans Licht bringt.
Auf der Lauer zu liegen, um herauszufinden, welcher Hund ständig vor das Tor einer Villa am Wannsee scheißt – das war wirklich der allerletzte Auftrag! Den Anna angenommen hat, um die Miete zu bezahlen. Und jetzt hat ihr die Firma, der das Haus gehört, in dem sie seit gefühlten Ewigkeiten wohnt, gekündigt. Der alte Kasten soll abgerissen werden, so wie die beiden Häuser daneben, um einem Einkaufszentrum Platz zu machen. Weil Berlin nichts so dringend braucht wie einen weiteren Konsumtempel.
Marx ist tot, und Anna ist mit dieser Stadt nie richtig warm geworden. Damals, als sie von Bonn nach Berlin zog, war da immerhin noch der Trost des billigen Wohnens und der schäbigen Trinkanstalten mit ihren schrägen Figuren. Das grandiose Gefühl eines Anfangs in einer alten, verkommenen Stadt, die sich bereit machte, jung und hip und zu guter Letzt teuer zu werden. Kein Journalismus mehr, Anna wollte sich als Detektivin selbstständig machen. Der Verlag hatte ihr eine Abfindung bezahlt, die sie als Startkapital nutzte. Anna war davon überzeugt gewesen, es in Berlin zu schaffen. Gnadenlos optimistisch, eine ihrer besseren Eigenschaften, inzwischen ein wenig ramponiert – wie die Hülle auch.
Nach einem guten Jahrzehnt des Verdrängens nistet sich das bittere Gefühl des Scheiterns ein. Ja, es gab ein paar schöne und lukrative Aufträge, aber viel zu wenige. Es gab Männer, die Anna liebte, jedoch nie für lange. Die meisten Amouren blieben oberflächlich. Doch es gab auch wunderbare Stunden der Heiterkeit mit den verlorenen Seelen in Sybilles Kneipe. Jetzt ein fernöstliches Nagelstudio, warum arbeiten da nur Asiatinnen? Eine der vielen ungelösten Fragen in Annas Leben. Der Tante-Emma-Laden, in dem man auch nachts Zigaretten kaufen konnte, ist einem veganen Teehaus gewichen, wer braucht denn so was? Die schäbigen alten Wohnungen sterben für unerschwingliche Luxusbehausungen. Alles fließt … aber in die falsche Richtung, denkt Anna.
Tränen schon wieder. Sie hasst ihre Ausflüge ins Selbstmitleid, so wie sie ihre Raucherei hasst. Die achtzig Kilo, die sich üppig um ein Meter achtzig verteilen. Anna Marx, die lieber in den Kühlschrank sieht als in den Spiegel, ist eine ewig hungrige Seele geblieben. Ja doch, frau sollte sich lieben, genau so, wie sie innen und außen beschaffen ist. Unzulänglichkeiten akzeptieren und in Stärken umwandeln. Ihr Fett umarmen und ihre Falten zärtlich streicheln. Vierundsechzig ist das neue sechsundvierzig! Mit Photoshop und plastischer Chirurgie, mit sportlicher Disziplin und Diäten. Nichts davon stand je auf Annas Speise- und Lebensplan.
Joggen: insgesamt drei Mal. Pilates: fünf Einheiten. Yoga: zwei Stunden. Fitnessstudio: ein Jahr bezahlt, vier Wochen durchgehalten. Die Quersumme aller Bemühungen ergibt am Ende eine fette Null. Darüber könnte sie lachen, nur nicht an diesem Scheißgeburtstag, dem ersten seit Langem, den sie nicht in Sybilles Kneipe feiert. Ihrem zweiten Zuhause. Der Mensch, der ihr am nächsten war, mit dem sie über alles reden und streiten und lachen konnte. Anna kommt es so vor, als habe man ihr etwas Wesentliches herausgeschnitten. Mit Sybille begraben. Zur Urnenbestattung kamen alle Stammgäste des Mondscheintarif, so hieß die Kneipe, und sie feierten zusammen ein letztes rauschendes Fest, das der Wirtin gefallen hätte. Anna betrank sich, als gäbe es kein Morgen, und der Kater war so übel, dass er beinah den Schmerz verdrängte. Nun hat sie alle Phasen der Trauer durchlaufen, durchtrunken, durchraucht – und immer noch tut es weh, wenn sie an die Freundin denkt. Nichts altert so schnell wie das Glück, aber das weiß man ja immer erst, wenn es zu spät ist.
Das Haus, in dem Anna lebt, ist hellhörig, die Zwischendecken sind nicht isoliert. Fjodor, der über ihr wohnt, übt Tonleitern. Russischer Opernsänger ohne Engagement, Bariton, schwul wie nix und eine Seele von Mensch, wenn er nüchtern ist. Ex-Stammgast im Mondscheintarif. Seit die Kneipe geschlossen ist und Fjodor einen Afghanen aufgenommen hat, sehen sie sich nicht mehr so oft. Im Treppenhaus gelegentlich. Die Umarmung. Wangenküsse. Wie geht es dir? Gut – und dir? Ganz wunderbar. Wir müssen uns unbedingt mal sehen!
Er hat ihr versprochen, nur einmal am Tag eine halbe Stunde lang Tonleitern zu üben, Arien schmettert er zu jeder Tages- und Nachtzeit. Wenn es ihr zu viel wird, klopft sie mit dem Besen an die Decke, das hilft manchmal. Oder sie geht spazieren in den kleinen Park, der unlängst von Junkies und Dealern gesäubert wurde, um Müttern mit Kleinkindern Platz zu machen. Die Drogenleute werden zurückkommen, das weiß jeder, und dann wird es wieder Bürgerbegehren geben und Anhörungen und endlose Diskussionen … und vielleicht rückt dann abermals die Polizei an, und das alte Spiel beginnt von Neuem. Berlin, wie es leibt und lebt. Man könnte darüber lachen.
Zurzeit haben Mütter und plärrende Zwerge die Oberhand. Kinderwagen werden wie Panzer eingesetzt, wehe, du weichst nicht rechtzeitig aus. Panzer mit Babygeschrei, und im veganen Teeladen sitzen die Mamis und stillen stolz. Sie könnte jetzt Oma sein, denkt Anna, wenn sie jemals den Kinderwunsch gehabt hätte. Aber nein, es waren immer die richtigen Männer zur falschen Zeit und vice versa. Es gab guten und schlechten Sex, glückliche Tage und miese Abgänge. Einmal hat sie sich sogar in einen Mörder verliebt, die geniale Detektivin. Natürlich nur so lange, bis sie es wusste. Sybille fand das wahnsinnig witzig. Sie nannte Anna eine Komikerin, die gegen ein tragisches Drehbuch anspielt.
Seit sie den alten Jaguar verkauft hat, geht Anna viel zu Fuß. Schon weil sie die U-Bahn nicht mag, die in Berlin streckenweise verdammt verlottert ist. Auch nachts ist sie lieber per pedes unterwegs. Einmal ist sie bisher überfallen worden, das Geld war weg, aber bis auf einen unsanften Stoß ist nichts weiter passiert. Sie war so überrascht, dass sie gar nicht auf die Idee kam, sich zu wehren. Oder zu schreien. Detektive im Fernsehen agieren irgendwie anders. Doch das Schnappmesser, das sie sich illegal besorgt hat, ist so tief versunken in ihrer Handtasche, dass sie es ohnehin nie rechtzeitig finden würde. Sie weiß ja, wie lange sie braucht, um ihren Hausschlüssel zu finden. Und wieder eine Waffe beantragen? In Berlin? Das würde Monate dauern, wenn nicht Jahre. Bis dahin könnte sie längst tot sein.
I donʼt need sex, life fucks me every day.
Der Satz des Jahres, den sie auf die weiße Wand der Küche gesprüht hat. Anna verabscheut Sinnsprüche, Lebensweisheiten, all die Anmutungen, die durchs Internet geistern wie Brei auf Stelzen. Diesen aber nicht! Jeden Morgen, wenn sie auf die Wand schaut, weiß sie zumindest, woran sie ist. Manchmal bringt sie der Satz zum Lachen.
Sie checkt auf dem Laptop die Facebook-Glückwünsche. Viele sind es nicht. Anna ist mehr ein Social-Media-Gespenst, nutzt den Account gelegentlich nur, um Leute ausfindig zu machen. Sie stellt grundsätzlich nie Privates ins Netz. Wen soll das interessieren? Schon das Profil: Anna Marx, Privatdetektivin, Berlin. Auf dem Foto schaut sie ernst, beinahe grimmig. Das Bild soll Leute nicht dazu bringen, sie zu mögen, sondern sie zu engagieren. Aber das eben ist das Problem: Es gibt zu viele Detektive in Berlin, und die großen Büros sahnen fast alles ab. Frauen engagieren außerdem lieber Männer, und Männer tun das sowieso, weil die meisten den Frauen wenig zutrauen außerhalb der Küche und der vier Bettpfosten.
Der Hund, den Anna nach zwei Tagen Observierung der Villa als Täter entlarvte, ist ein Dackel, und seine Besitzerin eine alte, fast blinde Frau. Anna hat den Dackel in flagranti fotografiert, die Identität der Hundehalterin ermittelt und ihren Bericht bei der Villenbesitzerin abgeliefert. Das war ein leichter Job. Aber irgendwie beschissen. Außerdem sehen Hunde immer so blöd aus, wenn sie ihr Geschäft verrichten. Als ob es ihnen peinlich wäre.
Von dem Dackelhonorar hat sie eine Flasche Château Latour für knapp hundert Euro gekauft, für ihren Geburtstag. Der Wein ist jetzt alle, welche Verschwendung, wenn man doch auch vom billigen Roten betrunken wird. Die Stampfkartoffeln mit Kaviar und Sauerrahm sind ebenfalls perdu. Der Kaviar mit verflossenem Ablaufdatum war ein Geburtstagsgeschenk von Fjodor, er handelt mit Schmuggelware, solange er von keiner Opernbühne entdeckt wird. Und jetzt hört er auf zu üben, stattdessen hört sie über ihrem Schlafzimmer das Bett knarzen. Amir, der Afghane, ist ein attraktiver Mann, dessen Asylantrag nach sieben Jahren abgelehnt wurde, weshalb er untertauchte, was in Berlin leichter sein mag als anderswo. Die beiden sind glücklich miteinander, das freut Anna, von den Geräuschen abgesehen. Sie zündet sich eine Zigarette an und überlegt, ob sie den Chianti öffnen soll, den ihr die Nachbarn zur Rechten mit angehängter Glückwunschkarte vor die Tür gestellt hatten. Zu feige, um zu läuten und ihr zum Vierundsechzigsten zu gratulieren?
Auf dem Küchentisch, der auch als Schreibtisch dient, liegt neben dem Laptop das Kündigungsschreiben des Hauseigentümers. Sie hat drei Monate Zeit, sich eine neue Wohnung zu suchen. Maklerhonorar, Umzugskosten, Kaution … Wie soll sie all das bezahlen? Anna verflucht die Kapitalistenschweine, die Berlin aufkaufen und die kleinen Leute vor die Tür setzen. Als ob die Sozis im Senat was dagegen tun würden! Wut ist besser als Selbstmitleid, nur hilft sie ihr auch nicht an diesem schwarzen Tag. Nichts hilft, außer die Chianti-Flasche zu köpfen. Sie wird so lange trinken, bis sie tot ist, denkt Anna. Auf der Küchenkommode steht noch eine Flasche Wodka. Ein Geschenk des Hausmeisters, der wird auch arbeitslos, wenn sie die Bude abreißen. Otto ist so berlinerisch, dass er beinah wie eine Karikatur wirkt. Er kann alles reparieren, aber es hält nur für eine gewisse Zeit. Das ewige Provisorium, damit verkörpert er Berlin perfekt. Das alte Berlin. Baustellen sind nicht sexy. Anna mag die Stadt nicht mehr, am liebsten würde sie weggehen.
Als ihr Handy klingelt, will sie gerade eine Zigarette anzünden. Anna schaut auf das Display und erkennt die Nummer nicht, wohl aber die Vorwahl: 0228. Bonn. Wegdrücken ist ihr erster Instinkt, doch dann ist sie zu neugierig. »Marx«, sagt sie streng. Nur für den Fall, dass einer was verkaufen will.
Eine muntere Stimme: »Anna? Hier ist Gaby. Gabriele Lehmann. Erst einmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!«
Eine Stimme aus der Bonner Zeit, und in ihrer trunkenen Einsamkeit freut sich Anna sogar darüber. Gaby war eine Kollegin in der Redaktion des Stadtanzeigers. Sie volontierte, als Anna längst »Klatschtante« war, und ließ sich von ihr journalistische Tipps geben. Eine Weile waren sie oberflächlich befreundet, bis die Kollegin ihren Millionär kennenlernte. Die schöne Gaby, die noch dazu ein Herz aus Gold hatte, musste einfach ihren Prinzen finden. Alle Frauen in der Redaktion waren neidisch und gratulierten mit spitzer Zunge. Zur Hochzeit war Anna noch eingeladen, und danach zweimal in die Villa in Bad Godesberg. Doch allmählich schlief die Freundschaft ein, was auch mit Gabys Millionärsmann zu tun hatte, der nach Annas Meinung ein richtig blöder Arsch war.
»Anna …?«
»Sorry, aber dein Anruf kam so unerwartet. Außerdem hab ich zu viel getrunken. All die Leute, die vorbeikamen und mit mir anstoßen wollten …«
»Verstehe. Also geht es dir gut in Berlin?«
»Bestens«, sagt Anna und merkt selbst, dass sie nicht überzeugend klingt.
Gabys Stimme bleibt unverändert heiter. »Das freut mich für dich, Anna. Anderseits … Ach, ich fall gleich mit der Tür ins Haus: Ich fände es toll, wenn du mal nach Bonn kommst. Für länger. Ich hätte nämlich einen Auftrag für dich. Und eine Wohnung. In der Villa. Mit separatem Eingang natürlich: zwei Zimmer, Küche, Bad, Balkon im ausgebauten Dachgeschoss. Voll möbliert. Mietfrei.«
Jetzt zündet Anna ihre Zigarette an. Denkt an Jakob Lehmann mit seiner Arroganz gegenüber allen Leuten, die ihm nicht wichtig schienen. »Nett von dir, aber danke. Wie hast du mich überhaupt gefunden?«
»Na, über Google. Dein Detektivbüro. Es wäre ein sehr lukrativer Auftrag. Oder brauchst du kein Geld?«
Was für eine blöde Frage. »Doch, natürlich. Aber ich möchte nicht für deinen Mann arbeiten. Weil er – in aller Höflichkeit formuliert – nicht grad mein Typ ist.«
Das leise Lachen am anderen Ende der Leitung überrascht Anna dann doch.
»Du hast dich nicht verändert. Aber wenn es dich beruhigt: Er konnte dich auch nicht leiden, nannte dich immer ›die rothaarige Schlampe‹.«
»Na, siehst du«, sagt Anna, von Gabys Offenheit verblüfft. »Aber nett, dass du fragst. Und mir gratuliert hast …«
Anna will das Gespräch beenden, doch Gaby ruft dazwischen: »Warte, hör mir doch erst mal zu. Jakob ist voriges Jahr gestorben. Ich bin Witwe und wohne seither allein in der Villa, weil meine Mutter im Seniorenheim ist – war. Sie ist dort Ende Dezember ebenfalls …« Gaby redet schnell weiter. »Der Tod meiner Mutter hat mir echt den Rest gegeben. Ich hätte sie nicht ins Heim lassen sollen. Aber sie wollte es unbedingt – und ich dachte, sie hätte es besser dort.«
Weshalb erzählt sie mir das alles? Anna hält den Hörer ein Stück weg und nimmt einen Schluck von dem Rotwein, der nicht halb so gut schmeckt wie sein Vorgänger. Alkohol immerhin. Sie setzt das Glas ab. Auf dem Holztisch sind viele Rotweinflecken, zwei Zigarettenlöcher, ein paar Wachsreste, unsachgemäß behandelt (die Idee, mit dem Bügeleisen drüberzugehen, war nicht die beste). Der Tisch passt aber zu Anna. Sie sucht nach angemessenen Worten: »Das tut mir sehr leid, Gaby. Jakob war ja noch nicht so alt. Woran ist er denn gestorben?«
»Herzversagen.«
»Du Ärmste …« Beileidsbekundungen waren ihr schon immer ein Gräuel. »Aber ich versteh nicht, was für ein Auftrag das sein soll? Und warum ich?«
Gabys weiche, ein wenig hohe Stimme klingt jetzt härter: »Natürlich gibt es auch in Bonn Detektive. Aber ich dachte sofort an dich, Anna. Dass du vielleicht Lust hast, die alte Heimat wiederzusehen. Die Stadt hat sich verändert, seit du weg bist … Also: Du kannst in der Villa mietfrei wohnen, solange du willst – und ich biete dir ein Tageshonorar von hundert Euro. Dafür, dass du den Tod meiner Mutter aufklärst.«
Mietfreies Wohnen klingt zauberhaft. Hundert pro Tag plus Spesen, denkt Anna, wären auch nicht schlecht. Andererseits: Geld und Freundschaft sind keine gute Kombination. Waren sie überhaupt Freunde? Oder bloß Kolleginnen? Anna wischt eine Tränenspur von der Wange. Scheißselbstmitleid. Sie fühlt sich nicht mehr so betrunken. »Wieso? Denkst du, dass mit ihrem Tod was nicht stimmt?«
Gaby seufzt: »Mutter war sechsundsiebzig. Okay, geistig hatte sie ein bisschen abgebaut, aber körperlich war sie verdammt fit für ihr Alter. Sie hat noch Yoga gemacht und viel im Garten gearbeitet. Die offizielle Diagnose war Herzversagen. Sie lag tot in ihrem Apartment, als man sie fand. Für eine Reanimation war es zu spät. Sagten sie. Ich war zu der Zeit auf den Malediven und bin sofort zurückgeflogen, als Lisbeth mich anrief. Als ich ankam, hatte meine emsige Schwester schon alles fürs Begräbnis geregelt.«
Anna erinnert sich vage an Gabys Schwester Lisbeth – nur wenig älter, nicht so hübsch, sehr selbstbewusst, die beiden schienen sich nicht sonderlich zu mögen. »Alte Menschen sterben, Gaby. Wie kommst du auf diesen Verdacht?«
Kurze Stille. »Weil … es hat innerhalb von zwei Monaten zwei Todesfälle im Heim gegeben. Mama war die Dritte. Und die teure Uhr, die ich meiner Mutter zu ihrem letzten Geburtstag geschenkt habe, war auch weg. Ich hätte sie nicht dort einziehen lassen sollen, Anna. In der Villa wäre genug Platz gewesen – auch für eine Pflegerin. Es war falsch, und ich habe ein schlechtes Gewissen. Vielleicht bilde ich mir deshalb ein, dass mit ihrem Tod was nicht stimmt. Aber wenn du dich umhören würdest, das kann ja nicht schaden. Und Geld spielt wirklich keine Rolle …«
Der Satz ist gemein. Anna nimmt noch einen Schluck und beschließt, dass dies der letzte war. An diesem Abend. »Deine Trauer ist verständlich, noch dazu nach dem Tod deines Mannes. Trotzdem, für eine Form der Trauerverarbeitung kommt mir das wie ein echt teurer Spaß vor. Entschuldige die Formulierung. Wie denkt Lisbeth darüber?«
Gabys Stimme klingt bei manchen Sätzen wie das Geräusch von Kreide auf einer Schiefertafel. »Meine Schwester denkt, dass ich verrückt bin und mehr Geld habe, als mir guttut. Sie hat sich immer schon für was Besseres gehalten, nur weil sie einen Professor geheiratet hat. Hilf mir, Anna … um der alten Zeiten willen. Bitte!«
Der erste Schritt zurück: »Kann ich darüber nachdenken?«
2
Wenn sie nach so vielen Jahren beim Anblick der jeweils anderen erschrecken, lassen sie es sich nicht anmerken.
»Anna Marx, wie sie leibt und lebt«, sagt Gaby lachend und versucht, ihr den schweren Rollkoffer abzunehmen. Anna will ihn nicht hergeben und überlässt ihr den kleineren. »Die Jahre sind spurlos an dir vorübergegangen«, sagt sie und meint es halbwegs ehrlich. Gabriele ist zehn Jahre jünger als sie und wirkt jünger als vierundfünfzig. Reichtum konserviert besser, denkt Anna ketzerisch, und dass Gabys Haare im alterstypischen Bob ein bisschen zu blond und Jeans und Lederjacke zu glänzend sind. Gaby war immer sehr schlank, jetzt wirkt sie dürr. Annas Betrachtungsweise, aber natürlich wandert sie auf diesem Gebiet über ein seelisches Minenfeld. Und die ganze Zeit lächelt Anna mit ihrem breiten Mund, dieses Bonner Abenteuer muss einfach gutgehen, denn einen Weg zurück gibt es kaum. Sie lächelt, während sie neben Gaby herläuft und versucht, nicht so viel größer und breiter auszusehen. Annas Koffer eiert mit quietschendem Protest nur noch auf drei Rollen. Passt gut zur Marx. Irgendwie.
Die beiden Frauen steuern dem Ausgang zu, der Köln/Bonner Flughafen ist übersichtlich, und Anna, die in den letzten zwei Jahren aus Berlin nicht weiter raus als bis zum Wannsee gekommen ist, staunt über den Mangel an Chaos. Wären da nicht Maskierte überall, Touristen auf dem Weg von oder nach Bonn und Köln, zu den Hochburgen des rheinischen Karnevals. Im Gedränge drückt ihr ein Clown einen Luftballon in die Hand, auf dem das Motto dieser Saison steht: Jötterfunke överall – Ludwig, Bonn un Karneval. Das große Jubiläumsjahr in Bonn, das im Anschluss an den Karneval seinen Lauf nehmen soll. Zweihundertfünfzig Jahre Beethoven. Dreihundert Veranstaltungen sind geplant, den Meister zu ehren.
Es ist Faschingsdienstag. Helau und alaaf. Grenzenloser Frohsinn, von Alkohol beflügelt. Denn morgen ist alles vorbei. Anna schwankt zwischen Grauen, Nostalgie und Hoffnung auf ein baldiges Ende und hinkt wie immer ihren Erwartungen hinterher. Sie erinnert sich, dass Gaby eine Karnevalistin der ersten Stunde war. »Du bist ja gar nicht kostümiert«, sagt sie, und Gaby lacht: »Ich wollte dich nicht gleich zu Anfang erschrecken. Aber gestern war ich natürlich beim Umzug dabei, und heute Abend muss ich noch zu einer Karnevalsparty. Du kannst gern mitkommen, es ist allerdings Kostümzwang.«
Annas Seitenblick ist mörderisch: »Nur über meine Leiche … aber ich finde es lustig, dass du immer noch auf dem Trip bist. Ich hab einfach nie Zugang dazu gefunden.«
Gaby weicht einem betrunkenen Beethoven aus. »Ich glaube, man muss hier geboren sein. Dir fehlt das Karnevals-Gen, da kann man nichts machen. Ich find es herrlich, ein paar Tage lang zu feiern, die ganze Stadt ist eine riesige Fete.«
In Berlin kaum vorstellbar. Anna fragt sich, warum sie nicht einen Tag später geflogen ist, dann wäre der Spuk vorbei gewesen. Nur noch Kamelle auf den Straßen, leere Flaschen, Konfetti, Alkoholleichen, Zigarettenkippen, benutzte Kondome. Bis die Stadtreinigung anrückt. »Als was wirst du heute Abend gehen?«
Sie nähern sich dem Ausgang und lassen die reisenden Karnevalisten hinter sich. Gaby schiebt den Handkoffer, Anna den großen, schweren.
»Als Eleonore von Breuning. Sie war Beethovens Klavierschülerin und vielleicht auch mehr. Ich habe mir Kostüm und Perücke extra nach dem Bild von ihr anfertigen lassen. Das Fest steht unter dem Motto ›Roll over Ludwig‹.«
»Wie putzig«, sagt Anna und erklärt, dass es in Berlin viel kälter war, dafür gebe es dort keine Maskierten. Ihr fällt ein, dass Gaby früher ein Tanzmariechen war. Einmal sogar eine Bonna, die Karnevalsprinzessin Bonns. War sie dafür nicht mit einem der Offiziellen ins Bett gegangen? Böse Gerüchte. Anna fällt ein bitterer Zug um Gabys Lippen auf. Feine, senkrechte Falten links und rechts. Dann sind sie am Parkplatz, und Gaby öffnet per Fernbedienung die Türen eines silberfarbenen Porsche Cayenne. Er hat den gleichen Ton wie ihre Lederjacke, die mit blauem Pelz gefüttert ist. Anna trägt ihren grünen Parka mit schwarzem Plüschfell, er ist alt und wärmt, und sie mag ihn sehr. Es bringt nichts, sich an Gaby zu messen, damals nicht und heute schon gar nicht. Sie hievt ihren Koffer ins Auto, dann steigt sie ein. Viel Platz für Annas lange Beine. Die waren immer schon das Beste an ihr.
Eine Zigarette wär jetzt schön, aber sie wagt nicht zu fragen. »Nettes Auto, ich habe meins vor drei Jahren verkauft. Hat sich nicht mehr gelohnt mitten in der Stadt, und ständig hat irgendein Mistkerl was in den Lack geritzt. Der letzte Streich war ›nice car‹, quer über die Motorhaube geschrieben. Ich habe es nicht als Kompliment aufgefasst.«
Gaby fährt auf den Zubringer zur Autobahn. »Oh mein Gott – war das noch der alte Jaguar?«
Sentimental Journey: »Ja, Fat Cat –ich hab ihn über zwanzig Jahre lang gefahren. Oder geschoben. Oft verflucht. Immer geliebt. Bis die Vernunft siegte – und ich hab auch noch einen Liebhaberpreis dafür bekommen. Wenn ich jetzt ein Auto brauche, miete ich mir eins. Alles ist billiger als Fat Cat.«
Gaby lacht. »Mein Mann fuhr einen Volvo, stell dir vor. Autos waren Jakob vollkommen egal. Ich habe mir den Cayenne erst nach seinem Tod gekauft, vorher hatte ich einen kleinen Peugeot.«
»Das tut mir leid«, sagt Anna und meint natürlich den Witwenstand. »Es war eine so schöne Hochzeit.«
»Das immerhin«, sagt Gaby, und Anna denkt, da kommt noch was. Sie hat immer schon geglaubt, dass Gaby mehr aus ökonomischen denn aus romantischen Gründen geheiratet hat. Jakob war um einiges älter, und seine Arroganz fand Anna abstoßend. Geld kann man nicht umarmen. Obwohl Anna einen Sack voll Geld inzwischen geradezu innig herzen könnte.
Gaby fädelt ein und tritt aufs Gas. Sie fährt schnell und konzentriert, und Anna mustert sie von der Seite. Erbarmungsloses Seitenlicht: Gaby ist immer noch attraktiv, doch langsam kommt sie in das Alter, in dem »für immer jung« zur Chimäre wird. Die Augen sehen nach einem Lifting aus, die Stirn nach Botox, und die Lippenpartie nach Hyaluronsäure. In Würde altern ist so ein bombastischer Satz, den die meisten Frauen milde belächeln. Anna, wenn sie je zu viel Geld gehabt hätte, wäre vielleicht auch in Versuchung gekommen: als Erstes die Hängebrüste, danach eine Bauchstraffung … mit dem Gesicht steht sie inzwischen nicht mehr auf Kriegsfuß. Es ist würdelos gealtert, basta.
»Hast du denn inzwischen einen … Neuen?«
Gaby lächelt, ein schneller Seitenblick. »Nein, nicht wirklich. Und du?«
Anna holt tief Luft. »Seit zwei Jahren lebe ich in Keuschheit. Oder so ähnlich. Es gibt keine guten Männer mehr in meinem Alter. Oder wenn, dann verstecken sie sich irgendwo vor mir.«
Ihr Lachen erinnert Anna an früher. Gaby war immer schon eine rheinische Frohnatur. Sie war so verdammt hübsch damals mit ihren blonden Locken und den blauen Augen, kein Wunder, dass sie sich einen Millionär geangelt hatte. Im Vergleich zu ihr erschien Anna nahezu schwermütig, schwergewichtig sowieso, und vermutlich basierte ihre damalige Freundschaft darauf, dass sich Gegensätze anziehen.
Als Gaby dem Schild »Bonn-Süd« folgend von der Autobahn abbiegt, fühlt Anna einen Anflug von Panik. Was hat sie sich dabei gedacht, in Berlin alles aufzugeben, nur weil Gaby um Hilfe bat beziehungsweise Hilfe anbot? Anna hat eine Woche lang über den Vorschlag nachgedacht, das Für und Wider abgewogen, konnte sich aber nicht entscheiden und warf schließlich eine Münze. Kopf oder Zahl? Das Schicksal in Form einer Zahl entschied, Berlin den Rücken zu kehren. Anna kündigte ihre Wohnung, aus der sie ohnehin rausgeflogen wäre, und verteilte ihre Möbel an Nachbarn und Amirs Freunde. Ein paar Sachen kamen auf den Sperrmüll, sechs Kisten mit Büchern, Platten und Bildern, Wäsche und Kleidung hat sie nach Bonn geschickt. Ein Abschiedsfest in der leeren Wohnung mit Bier und Buletten, das hatte sie nach dem einsamen Geburtstag verdient. Fjodor sang Schmachtfetzen, ein Freund spielte auf der Gitarre, Amir hatte »Schwarzen Afghanen« mitgebracht, und Joints machten die Runde. Bekannte aus dem »Club erfolgloser polnischer Frauen« kamen um Mitternacht mit einem Riesentopf Bigosch, da waren alle schon bekifft oder betrunken und in jedem Fall hungrig. Am Schluss, so gegen fünf Uhr morgens, weinten alle, während Fjodor schmetterte: »Wir wollen niemals auseinandergehn.« Anna schlief auf der Luftmatratze ein, die Nachbarn ihr geborgt hatten. Stellte den Wecker auf neun, räumte zwei Stunden lang die Partyreste auf, putzte sehr oberflächlich, duschte und nahm dann ein Taxi zum Flughafen.
»Rauchst du noch?«, fragt Gaby.
»Ab und zu«, lügt Anna.
»Ich wäre dir dankbar, wenn du nur auf der Terrasse oder im Garten rauchst. Oder auf dem Balkon. Geht das?«
»Aber natürlich.« Es fängt nicht gut an, denkt Anna. Obwohl sie ohnehin vorhat, mit dem Rauchen aufzuhören.
Gaby wirft ihr einen forschenden Seitenblick zu: »Die Wohnung ist sehr hübsch eingerichtet, überwiegend Jugendstil, gemixt mit ein paar modernen Klassikern. Jakob war mehr so der Typ skandinavische Möbel, viel Naturholz und kein Schnickschnack. Nach seinem Tod hab ich angefangen, Zimmer um Zimmer neu zu gestalten. Ich hätte Innenarchitektin werden sollen – ich glaube, das hätte mir Spaß gemacht.«
»Du warst eine gute Journalistin.« Darauf war Anna damals neidisch gewesen. Dass sie die Klatschtante vom Dienst war – und Gaby die Gerichtsreporterin.
»Danke, aber du glaubst nicht, wie langweilig die meisten Prozesse sind. Da sitzt du stundenlang drin, um danach einen Zweispalter zu schreiben. Nein, damit habe ich abgeschlossen. Und du?«
Bevor Anna antworten kann, biegt Gaby ab und hält vor einem Holztor, das sich per Fernbedienung zurückzieht. Sie fahren über einen Kiesweg zur weißen Villa, die Anna nicht so groß in Erinnerung hat. Gaby parkt das Auto direkt vor der Eingangstür, und eine ältere Asiatin kommt über die Treppe und nimmt ihren Koffer, obwohl Anna protestiert. Die Frau geht ihr gerade mal bis zur Schulter und soll ihr Gepäck schleppen?
»Lass sie, sonst ist Salita beleidigt. Außerdem ist sie viel stärker, als sie aussieht.«
Gaby nimmt Annas freie Hand: »Willkommen in deinem neuen Zuhause. Ich bin sehr froh, dass du da bist, Anna!«
Die Panik ist verebbt. Vorübergehend. Anna holt tief Luft und schreitet über die Schwelle ihres neuen, noblen Zuhauses. Hofft, dass das Gefühl der Fremdheit sich legen wird. Alles ist so durchgestylt und ordentlich, sie durchqueren die Eingangshalle, und Salita geht voraus über die Treppen in den zweiten Stock. Wie war das mit dem getrennten Eingang?
Gaby: »Es gibt einen separaten Zugang vom Garten aus, du musst halt einmal ums Haus herumgehen. Ich hoffe, das macht dir nichts aus.«
Salita öffnet die Tür, und Anna fühlt sich nach dem ersten Rundblick zu einem Kompliment genötigt. »So edel habe ich ja noch nie gewohnt. Hast du ne Hausratversicherung?«
»Klar.« Gaby macht die Tür zu dem großen Balkon auf. »Im Sommer ist es ganz wunderbar, und du hast den vollkommenen Rheinblick.« An dem ich oft spazieren war, denkt Anna, früher, denn sie mochte den trägen Fluss und die Promenade mit den Touristen und Joggern und Liebespaaren. Sie mochte Bonn, weil es klein und überschaubar war, der Gegenentwurf zu jeder Metropole und von le Carré einmal so oder ähnlich definiert: Entweder es regnet – oder die Bahnschranken sind zu.
Ihr Wohnzimmer ist groß mit integrierter Küche. Altneuer Möbelmix, an den Wänden hängen Bilder mit Jugendstilmotiven. Originale? Anna wagt nicht zu fragen. Auch das Schlafzimmer ist weitläufig, und im Badezimmer haben Dusche und eine frei stehende Wanne Platz, das gefällt Anna sehr, und auch, dass die Toilette separat ist. Sie lobt Gabys guten Geschmack und sehnt sich zurück nach Berlin.
Salita hat den Koffer vor dem Schrank deponiert. Asiatisches Pokerface. Sie fragt, ob sie für Anna auspacken soll?
»Danke, das mach ich selbst«, sagt Anna schnell. Peinlicher Inhalt: der feuerrote Kunstpenis. Ein Abschiedsgeschenk von Fjodor, und sie hat das Ding tatsächlich mit nach Bonn genommen. Konnte es schließlich nicht zurücklassen.
Gaby schließt die Balkontür. »Ich schlage vor, du packst aus und erfrischst dich – und dann öffnen wir zur Feier des Tages eine Flasche Champagner. Salita hat eine Kleinigkeit gekocht, du hast heute sicher keine Lust auszugehen. Ich muss so um acht weg und brauche etwa eine Stunde, um mich als Beethovens Geliebte herzurichten.«
Anna lächelt. Sie sehnt sich nach einer Zigarette. Und nach ihrem alten Zuhause. Die chaotische Wohnung, in der ihr niemand das Rauchen verboten hat. In der sie sich geborgen fühlte. »Fein, ich komm dann gleich runter, wenn ich ausgepackt habe.«
Salita wirft ihr zum Abschied einen Blick zu, den Anna nicht deuten kann. Hätte sie ihr Trinkgeld geben sollen? Das kann sie immer noch tun, aber im Prinzip will sie mit Gabys dienstbaren Geistern so wenig wie möglich zu tun haben. Anna kann selber putzen und kochen, auch wenn sie Ersteres nicht gern tut. Und jetzt steht sie draußen und raucht, nachdem sie vergebens einen Aschenbecher gesucht hat. In sämtlichen Küchenschränken und Schubladen, und dort ist wirklich alles zu finden, was die gute Hausfrau so braucht. Sie hat das Gefühl, hier überhaupt nicht reinzupassen. Was, wenn sie betrunken die blattgoldverzierte Art-déco-Vase zerdeppert? Oder Rotwein auf das weiße Ledersofa schüttet?
Anna hatte in Berlin nicht halb so viele Küchenutensilien, obwohl sie in den letzten Jahren eine gewisse Lust am Kochen entwickelt hat. Sie findet es entspannend, am Herd zu stehen und etwas zu schaffen, das Genuss bereitet. Anna tippt auf Alterserscheinung, denn in jüngeren Jahren fand sie Kochen langweilig. Sie drückt ihre Zigarette an der Untertasse aus. Verdammte Kälte, sie hat den Winter nie gemocht, jedenfalls nicht seit ihrer Kindheit. Zurück in die Wohnung, die überheizt ist. Anna findet keinen Schalter, mit dem sie die Temperatur regulieren könnte, und lässt deshalb die Balkontür offen. Dann packt sie ihren Koffer aus, überwiegend warme Kleidung, ein paar Kosmetika, Schuhe, Unterwäsche, zwei Bücher. Sie widersteht dem Impuls, alles in den Schrank zu werfen. Es geht auch anders, dauert aber länger. Inzwischen ist sie hungrig und durstig. Und neugierig, was Gaby über ihre Mutter erzählt. Nach der Dackelaffäre wäre ein Mord ja nicht mal so übel.
Anna wäscht sich die Hände und das Gesicht, bürstet die Haare und dreht sie zu einem Knoten im Nacken. Ein wenig Lippenstift – voilà, besser gehtʼs nicht. Und wenn, wäre es zu zeitaufwendig.
Auf der Kommode im weitläufigen Entree stehen Fotos in Silberrahmen. Gaby als Baby, Teenager und Braut, als Karnevalsprinzessin, Tennisspielerin und Bikinischönheit, zwei Bilder mit ihrer Mutter, die Ähnlichkeit ist groß. Jakob ist außer auf dem Hochzeitsfoto nirgendwo zu sehen. Anna könnte sich vorstellen, dass er seine Schwiegermutter genauso arrogant ignorierte, wie er es mit Gabys Freundinnen tat.
Sie verschließt die Tür ihrer neuen Wohnung. Die steile Treppe, denkt sie, war für eine alte Frau sicher nicht ideal gewesen. Anna hat Gabys Mutter im Rheinischen Hof kennengelernt, als Gaby dort ihren Geburtstag feierte. Und ein Jahr später begegneten sie sich wieder bei der Hochzeit, ein relativ bescheidenes Ereignis mit Catering in der Villa und einem DJ, der Musik aus den 80er-Jahren auflegte. Danach ging es für das Brautpaar nicht in die Südsee, sondern nach Venedig. Jakob lebte trotz seines Geldes ziemlich bescheiden. An diesen Satz kann sich Anna erinnern. Sie ordnet ihn Gabys Mutter zu.
Anna war zu Hochzeiten immer nur eingeladen, nie die Hauptperson. Eine erstaunliche Auswahl an Männern, die nicht heiratswillig waren oder bereits gebunden. Retrospektiv ein großer Haufen vergeudeter Gefühle. Andererseits waren es aber auch die glücklichsten Zeiten, jene der Verliebtheit – und die traurigsten die Phasen der Trennung. Hätte sie irgendeinen von ihnen heiraten wollen? Philipp vielleicht, aber der war es bereits und nicht willens, sein Leben für Anna Marx auf den Kopf zu stellen. Bonner Erinnerungen. Fängt man mit vierundsechzig Jahren an, rückwärts zu leben?
Als Anna im Esszimmer auftaucht, füllt Gaby zwei Champagnergläser und hebt ihres: »Herzlich willkommen in Bonn. Auf uns – und alles, was wir lieben.«
Anna trinkt auf sich. Sie mag Schampus überhaupt nicht, doch Gaby stand immer schon drauf. Nun hat sie ihr Champagner-Leben, denkt Anna, diesmal ganz ohne Neid. Sie muss aufpassen und dieses Gefühl unter Verschluss halten. Gaby hat viel mehr Geld als sie, das ist alles. Darüber hinaus ist sie auch allein, hat keine Kinder, ihre Eltern sind tot, und mit der Schwester ist sie nie gut ausgekommen. Freunde? Vermutlich nicht so viele. Wozu hat sie sich einen so großen Tisch angeschafft, wenn sie Single ist? Das Art-déco-Monster bietet Platz für mindestens zwölf, und man muss dankbar sein, dass nicht an beiden Enden gedeckt wurde wie manchmal in Filmen, wo sich die Protagonisten über den Tisch hinweg anschweigen.
»Gelegentlich gebe ich Dinnerpartys.« Gaby stellt ihr Glas auf einen Untersetzer, und Anna tut es ihr nach. Das muss sie sich auch abgewöhnen, Gläser und Teller direkt auf den Tisch zu knallen. Aber wer gibt denn heute noch Dinnerpartys außer Botschafter und Societydeppen?
Aus der Küche kommt Salita mit verschiedenen Schüsseln, die sie auf den Tisch verteilt. Gesenkte Augen, devot wirkt sie auf Anna dennoch nicht. Sie und Gaby schauen schweigend zu, wie Deckel gelüftet und Vorlegebestecke daneben platziert werden. Die Servietten sind weiß und so gestärkt, dass sie bei Berührung rascheln. Salita trägt eine Schürze mit Rüschen. Dinnermusik plätschert aus unsichtbaren Lautsprechern. Anna fühlt sich wie im falschen Film.
Eine einladende Geste der Hausherrin: »Es gibt Hähnchenbrust mit verschiedenen Gemüsen und Reis. Nimm dir einfach, was du magst.«
Anna lächelt Salita an, doch wieder keine Erwiderung. »Ich glaube, sie mag mich nicht«, sagt sie, nachdem sie raus ist.
»Bitte nimm dir, bevor es kalt wird. Salita wird es nie lernen, Speisen heiß aufzutragen, das ist so eine philippinische Eigenart. Und mach dir keine Gedanken: Sie ist eine harte Nuss, ich musste mir ihre Zuneigung nach Jakobs Tod auch erst mit einer kräftigen Lohnerhöhung erkaufen.«
»Lebt sie hier im Haus?«
»Ja, im Souterrain. Gott sei Dank hat sie hier keine Familie, nur entfernte Cousinen und so. Ich möchte ja keinen philippinischen Clan unterhalten.«
Anna bedient sich aus den Schüsseln und häuft sich deutlich mehr auf den Teller als Gaby, die lieber vor der Party essen wollte. »Ich hasse dieses Fingerfood im Stehen. Glas, Teller, Handtasche … Man muss immer irgendwie jonglieren.«
Das Essen schmeckt ziemlich fade, wie Anna findet. Gedünstetes Gemüse, und das Hähnchen ist auch zu wenig gewürzt. Anna verzichtet auf einen Nachschlag: »Ich muss auf meine Figur achten. Du weißt ja, was für einen beschissenen Grundumsatz alte Frauen haben.«
Gaby lächelt ganz kurz. »Ach Anna, du bist einfach köstlich. Ich fühle mich überhaupt nicht alt. Du etwa?«
»Manchmal schon. Wenn ich in den Spiegel schaue. Oder wenn es hier und dort zwickt. Wenn ich an einer Gruppe Bauarbeiter vorbeigehe – und keiner pfeift mir nach wie früher. Ja, dann fühle ich mich alt. Und fast schon überflüssig.«
Gaby hatte ein klares Nein erwartet und denkt nicht zum ersten Mal, dass Anna durchaus charmanter und verlogener sein könnte. Aber das war nie ihr Stil. »Ach was, du siehst doch noch blendend aus.«
»Kuh oder Ziege«, sagt Anna, »man muss sich entscheiden.«
Gaby spießt mit großer Sorgfalt zwei Erbsen auf ihre Gabel und sagt mit unbestimmtem Lächeln: »Du warst immer schon eine Kuh.«
Ein überraschendes Statement. Anna kann jetzt nicht anders: »Und du eine Ziege.«
Sekundenlang ist nur das Ticken der Wanduhr zu hören, dann lösen sie die Spannung mit einem synchronen Lachen, leicht hysterisch. Schließlich steht Anna auf und entschuldigt sich, weil sie draußen rauchen will. Das braucht sie jetzt dringend.
»Du solltest wirklich mit diesem Laster aufhören«, ruft Gaby ihr nach. Sie hat recht und nervt trotzdem, Anna lächelt nur und geht auf die Terrasse. In der Dämmerung sind die Bäume im Garten lediglich als dunkle Schatten wahrnehmbar. Was für ein Luxus, so einen Riesengarten für sich allein zu haben! Vermutlich gibt es einen Gärtner, denkt Anna, und dass Gaby aus kapitalistischer Sicht alles richtig gemacht hat. Und sie selbst fast alles falsch. Dafür, dass sie ihr Leben lang gearbeitet hat, wird sie mit sechsundsechzigeinhalb Jahren unsanft in die Altersarmut gleiten, sofern sie nicht dazuverdient. Tausendzweihundert Euro Rente monatlich sind nicht die Welt. Ersparnisse von zwölftausend Euro auch nicht. Sonstige irdische Besitztümer hat Anna nicht aufzuweisen. Weshalb Gabys Honorarangebot höchst willkommen ist. Obwohl … mal sehen, ob sie es aushalten wird, sich ständig als Gast und arme Freundin zu fühlen. Anna hasst jegliches Gefühl von Abhängigkeit, weshalb sie ein schwieriges Kind und eine katastrophale Jugendliche war, dem abwesenden Vater und der überanwesenden Mutter in hilfloser Zu- und Abneigung verbunden. Sie sind beide tot, es gibt nichts mehr zu bedauern, doch die Trauer über den Verlust ist seltsam hartnäckig. Überfällt sie oft, wenn sie im Dunkeln irgendwo draußen steht und raucht. Es war so eine undefinierte Kindheit. Keine Grausamkeiten, aber auch wenig schöne Erinnerungen. Mit fünfzehn fing sie an zu rauchen, um irgendwo dazuzugehören. Anna löscht die Zigarette am Boden aus und nimmt sie mit in die Küche. Mülleimer. So entstehen Brände. Sie muss einen Aschenbecher besorgen, sonst wird sie noch Gabys Bude abfackeln.
Die Gastgeberin hat in der Zwischenzeit das Geschirr abgetragen und in die Spüle eingeräumt. So ordentlich. In Annas Berliner Welt wurde über dreckigen Tellern weiter getrunken, geraucht, diskutiert. Das war am nächsten Morgen dann immer eine Schweinerei, aber …
Die Gläser sind wieder gefüllt. Zumindest trinkt sie, denkt Anna. »Tut mir leid, ich hätte dir gerne geholfen.«
»De nada, Salita nimmt mir ohnehin fast alles ab. Ich habe nichts zu tun, und das kann verdammt langweilig sein, Anna.«
Wenn Leute auf hohem Niveau jammern, fühlt Anna sich herausgefordert: »Dann tu halt was. Studiere Architektur – oder Philosophie. Tue Gutes! Engagier dich in der Flüchtlingshilfe. Reise um die Welt …«
»Mach ich doch, aber … meine Mutter fehlt mir. Dabei mochten wir uns gar nicht. Nur mit Jakob verstand sie sich ganz prima. Wirklich, die zwei waren ein Herz und eine Seele. Man hätte fast eifersüchtig werden können.«
Den Satz findet Anna seltsam, doch sie übergeht ihn. »Ich verstehe nur nicht, warum sie kurz nach Jakobs Tod ausgezogen ist?«
Gaby holt tief Luft und sieht an Anna vorbei auf das Bild eines stilisierten Embryos. Ein Geschenk von Jakob, ein böses. »Ich hab es auch nicht verstanden, glaub mir. Wir brauchten einander doch, gerade damals, aber … meine Mutter konnte so unfassbar stur sein, wahrscheinlich wollte sie mich für einen Streit kurz nach Jakobs Tod bestrafen. Alte Leute können so verdammt kindisch sein! Und jetzt denke ich, dass sie wahrscheinlich noch am Leben wäre, wenn sie nicht ins Paradies gezogen wäre.«
Paradies? Anna fragt sich, wie jemand auf die schräge Idee kommen kann, ein Altersheim