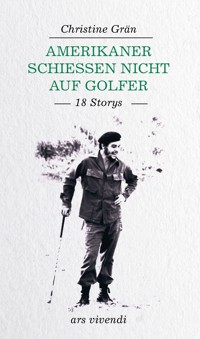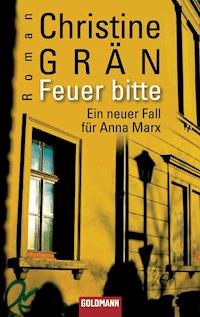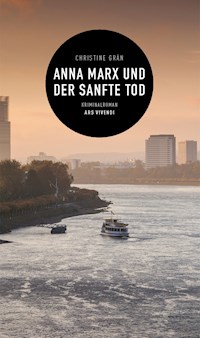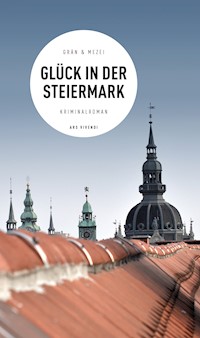4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Ein spektakulärer Strafprozeß um eine Vergewaltigung. Ein mitreißender Roman über die Suche nach der Wahrheit. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 430
Ähnliche
Christine Grän
Die kleine Schwester der Wahrheit
Roman
FISCHER E-Books
Inhalt
The first thing we do, let's kill all the lawyers.
William Shakespeare, King Henry VI.
I. Kapitel
Die Männer tun alle dasselbe. Sie liegen oben, wir liegen unten. Das ist der ganze Unterschied …
Kirsten Bergmann fragte sich, warum ihr in dieser Situation ausgerechnet die Josephine Mutzenbacher einfiel. Idiotisch, denn schließlich war sie keine Wiener Hure, sondern eine anständige Frau. Eine Frau in einem Gerichtssaal. Noch war sie eine anständige Frau, aber das würde sich vielleicht ändern. Schließlich saß sie in einem Raum voller Männer, und einige davon waren Feinde.
Es war ein häßlicher Raum, die Nummer 130 des Kölner Landgerichtes. Sie hatte sich Gerichtssäle anders vorgestellt: würdiger, nicht so nüchtern und schäbig. Die Bänke und Stühle waren von ergreifender Schlichtheit.
Keine Gardinen, nichts, woran sich das Auge festhalten konnte. Der einzige Wandschmuck war ein Kreuz, das hinter dem Richter hing. Gott war überall; auch um neun Uhr morgens in einem Kölner Gerichtssaal mit der Nummer 130.
Oben thronten die Richter, optisch nur eine Stufe höher als das Volk, aber es war keine Frage der Optik. Wie schwarze Krähen sehen sie aus, dachte Kirsten: Staatsanwalt, zwei Schöffen ohne Robe, drei Richter, darunter eine Frau.
Eine Richterin, stellte sie, ein wenig beruhigt, fest. Sie war noch sehr jung, sah höchstens aus wie dreißig. Ernst schaute sie drein, so als ob sie mit der Robe eine gewisse Traurigkeit übergestreift hätte. Sie war nicht hübsch. Die Augen standen zu eng beieinander, und die braunen Haare waren strähnig und schlecht geschnitten. Der dunkelrote Lippenstift war zu grell und betonte die Blässe ihres Gesichts.
Kirsten Bergmann wies sich innerlich zurecht. Es war doch egal, wie die Frau aussah. Nach diesen Kriterien beurteilte sie Männer schließlich auch nicht. Diese verflixte Automatik, vor der man nirgendwo sicher war.
Sie mußte sich förmlich zwingen, nach links zu schauen, dorthin, wo die beiden Angeklagten und deren Verteidiger saßen. Niemand erwiderte ihren Blick. Bernhard starrte aus dem Fenster. Schlecht sah er aus, fand sie, alt und müde. Sein bleiches Gesicht drückte keinerlei Regung aus. Er saß da, so als ob ihn das, was in diesem Saal passierte, überhaupt nichts anginge.
Henner Krug sprach leise mit seinem Anwalt. Obwohl es still war im Saal, konnte sie nichts hören. Die Zuschauerbänke waren noch leer an diesem frühen Morgen, und sie hoffte inbrünstig, daß es so bleiben würde. Aber nein, dieser Fall würde nicht ohne Öffentlichkeit über die Bühne gehen. Journalisten waren keine Frühaufsteher, das wußte sie aus eigener Erfahrung. Es würden sicher noch Leute kommen, um sich an Schmutz und Schmerz zu weiden. Schließlich war das hier ein Theater mit Freikarten. Niemand wußte am Anfang, ob es zur Tragödie oder Komödie würde. Das Ende war offen. Die Schauspieler setzten sich aus Laien und Profis zusammen, die Hauptrollen waren klar verteilt. Man mußte sich nur an den Gesetzestext halten und den Rest improvisieren. Sie selbst spielte eine wichtige Nebenrolle. Aber einen Oscar würde sie dafür nicht bekommen.
Dr. Oliver Timm liebte Vergewaltigungen nicht. Diese schon überhaupt nicht. Und es paßte ihm nicht, daß die Betroffene als Nebenklägerin auftrat. Wenigstens war Kollege Kant, der sie vertrat, ein vernünftiger Mann. Hoffentlich würde er ihr raten, während der Einlassung der Angeklagten den Saal zu verlassen. Aber aus eigener Erfahrung wußte Timm, daß es gewisse Berufsgruppen gab, die sich von ihren Anwälten herzlich wenig sagen ließen, weil sie im Wahn der Halbbildung meinten, selbst alles besser zu wissen. Dazu zählten vornehmlich Lehrer, Ärzte, Journalisten. Aber vielleicht gehörte Kirsten Bergmann zu den wenigen einsichtigen Ausnahmen. Es blieb abzuwarten.
Timm zupfte an seiner weißen Krawatte, die er zu eng geknüpft hatte. Der Saal war überheizt, und ihm war heiß unter der schwarzen Kaschmirrobe. Er hätte Grimmes Verteidigung nicht übernehmen sollen. Aber dessen Rechtsanwalt hatte sich einem Strafprozeß nicht gewachsen gefühlt und ihn förmlich bekniet. Diese diffusen Vergewaltigungen waren ihm wirklich ein Greuel. Keine Klarheit und schon gar nicht Wahrheit. Die einzig akzeptablen Fälle waren die klassischen Vergewaltigungen: Mann überfällt fremde Frau im Park. Damit konnte man arbeiten, denn da waren die Fronten klar. Aber dieser Fall Bergmann lag genau in jener Grauzone, die von Lügen, Halbwahrheiten und ewigen Zweifeln begrenzt war. Ein Marathon der Wahrheitsfindung, bei dem vermutlich alle Beteiligten in irgendeiner Form auf der Strecke blieben. Dr. Grimme mit großer Wahrscheinlichkeit, da seine Startchancen am schlechtesten waren.
»Du bist der einzige, der ihn rauspauken kann. Du mußt seine Verteidigung einfach übernehmen.« Der Kollege neigte zu Übertreibungen. Doch Timm war, in aller Bescheidenheit, einer der besten Strafverteidiger in Köln. Wenn er sich selbst für den allerbesten hielt, ging er damit nicht hausieren. Seine Honorarforderungen waren deutlich genug. Und bei Dr. Grimme hatte er besonders hoch gegriffen, in der vagen Hoffnung, daß dieser bei fünftausend pro Prozeßtag passen würde. Aber der Arzt hatte nicht mit der Wimper gezuckt und den vereinbarten Honorarvorschuß von 50000 Mark überwiesen. Ein eisernes Prinzip des Strafverteidigers, vor Prozeßbeginn zu kassieren.
Eine teure Nacht, dachte Timm. Die Frage, ob die Frau das wert war, erübrigte sich natürlich, Kirsten Bergmann, sechsunddreißig Jahre, wie er aus den Akten wußte, hatte ein wenig von Romy Schneider, obwohl sie blond war. Gutes Gesicht, mit großen, grauen Augen und sinnlichem Mund. Sie war dezent geschminkt und trug die langen Haare zu einem Knoten geschlungen. Mit Kennerblick hatte er gesehen, daß das schwarze Kostüm teuer war und – daß sie schöne Beine hatte. Die Jacke mit den breiten Schultern ließ weiteren anatomischen Betrachtungen keinen Spielraum. Aber alles in allem: eine schöne Frau in den besten Jahren, wenn auch in den letzten besten Jahren. Aber verdammt, nicht einmal Miß Universum wäre es wert, dafür so viel zu bezahlen. Kirsten Bergmann würde nicht darum herumkommen, ein paar unangenehme Fragen zu beantworten. Keine Schonzeit für Rehe!
Der Vorsitzende Richter am Landgericht, Johannes Mayer, war irritiert. Erstens hatte ihm der Anwalt der Nebenklägerin im Flur gesagt, daß diese während der Einlassungen der Angeklagten den Saal nicht verlassen würde. Das war zwar zulässig, wertete aber ihre nachfolgende Aussage zwangsläufig ab.
Zweitens hatte seine Frau vergessen, den Wecker zu stellen, und er war überhastet und ohne Frühstück aus dem Haus geeilt. Seine Frau wurde nicht nur immer häßlicher, sondern auch immer nachlässiger. Eine unerquickliche Kombination. Kein Mann würde je auf die Idee kommen, Frau Mayer zu vergewaltigen! Außerdem war Dr. Oliver Timm im Saal. Bei diesem Verteidiger gingen bei ihm und noch einer Reihe anderer Richterkollegen die roten Warnlampen an. Mit Timm einen Prozeß zu führen war wie Autofahren auf Glatteis. Ein prozessualer Ausrutscher, und schon legte der Kerl Revision ein. Timm war in Köln als wandelnde Strafprozeßordnung gefürchtet, dafür, daß er alle Tricks kannte und sie schamlos anwandte. Nein, ein gemütlicher Prozeß würde das nicht werden.
Aber was ihm schon einmal passiert war – die Aufhebung seines Urteils durch den Bundesgerichtshof aufgrund eines läppischen Formfehlers –, das würde ihm kein zweites Mal zustoßen. Dem war Gott vor, seine Routine und der Beisitzende Richter Martin Boll. Zum Glück hatte ihm der Geschäftsverteilungsplan diesen Richter zur Seite gesetzt. Martin Boll war von keinerlei Brillanz gesegnet. Aber pingelig war er. Dem würde es als erstem auffallen, wenn Timm versuchte, sein berühmtes Revisionsballett zu tanzen.
Die kleine Kampen war vielleicht auch nicht schlecht: Eine frischgebackene Richterin hatte die Paragraphen noch ins Hirn gebrannt. Sie sah zwar aus wie eine graue Maus, aber dafür würde sie aller Voraussicht nach wenig Widerworte geben und sich der Meinung des Vorsitzenden anschließen. Mayer dachte mit Grauen an jene freche Richterin, die ihm während seines letzten Prozesses andauernd widersprochen hatte, weil sie eine rechthaberische Emanze war und an Profilneurose litt. Er war nahe daran gewesen, sich auf sie zu stürzen. Jaja, sein Temperament. Er würde es zügeln müssen, wenn Timm im Saal war. Wer sich aufregt, macht leicht Fehler. Johannes Mayer dachte mit Genugtuung daran, daß er ein As im Ärmel hatte, von dem der kluge Herr Verteidiger nichts wußte.
Nach der routinemäßigen Feststellung der Personalien der Angeklagten, die Mayer mit jener Milde heruntersurrte, für die er berüchtigt war, weil er sie nach dem Prinzip von Zuckerbrot und Peitsche einsetzte, verlas der Staatsanwalt den Anklagesatz aus der Anklageschrift. Henrik Raven las laut und betont, denn er haßte es, wenn im Gerichtssaal genuschelt wurde. Es war ein kurzer Anklagesatz: Der Arzt Dr. Bernhard Grimme und der Journalist Henner Krug waren angeklagt, in der Nacht vom 2. auf den 3. August die Journalistin Kirsten Bergmann mit Gewalt und durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben zum außerehelichen Beischlaf genötigt zu haben …
Kirsten Bergmann hatte nur die ersten beiden Sätze bewußt wahrgenommen. Was für eine Sprache, diese Sprache der Gesetzbücher. So, wie dieser Staatsanwalt dies vortrug, klang es ganz und gar nicht wie ihre Geschichte. Ob Bernhard und Henner Krug sich in diesem Anklagesatz wiederfanden? Bernhard sah immer noch unbeteiligt aus. Er hatte sie nicht ein einziges Mal direkt angesehen, und sie war ihm dankbar dafür. Aber sie spürte Krugs Blicke und konnte seine Wut geradezu schmecken, fühlen, riechen. Sie wünschte sich, diese Wut erwidern zu können, so wie damals. Es war wenigstens ein Gefühl gewesen. Aber nichts davon war an diesem Tag, dem ersten Prozeßtag, noch übrig. Nichts von dem Schmerz und der Wut, nicht einmal der Wunsch nach Rache war ihr geblieben. Nichts als Leere, Ekel. Auch Ekel vor sich selbst.
Die Nacht vom 2. auf den 3. August war fast ein halbes Jahr alt. Und nun saß sie in diesem häßlichen Saal, und fremde Leute maßten sich an, über diese Nacht ein Urteil zu sprechen. Es kam ihr auf einmal lächerlich vor, obszön, denn ihrer aller Gefühle und Taten würden in diesem Saal seziert werden. Und sie selbst hatte die Maschinerie in Gang gesetzt, die nicht mehr aufzuhaltenden Mühlen des Gesetzes. Die alles zermalmten und den zähen Brei fein säuberlich mit Paragraphen umzäunten, bis alle Wirklichkeit unter ihnen begraben war.
Kirsten strich sich eine blonde Haarsträhne aus dem Gesicht, die sich aus dem Knoten gelöst hatte. Dezent, hatte ihr Rechtsanwalt gesagt, solle sie aussehen. Wie eine anständige Frau eben und nicht wie ein Flittchen, das Männer zur Vergewaltigung einlädt. Und weil sie die Angst des kleinen Mädchens vor Polizisten, Ärzten und Rechtsanwälten noch immer nicht abgelegt hatte, saß sie nun da wie die fromme Helene und schämte sich – nicht vor dem unlieben Gott, sondern vor sich selbst.
Furchteinflößende Männer in schwarzen Roben: Es war das erste Mal, daß sie mit dem Gesetz in dieser Form in Berührung kam. Wie für die meisten Leute war der Vollzug der Staatsgewalt für sie immer etwas »für die anderen« gewesen. Ein gesetzestreuer Bürger, mehr oder weniger, kam damit nicht in Berührung. Wie naiv sie gewesen war.
Der Vorsitzende Richter trug ein Goldkettchen. Das hatte sie gesehen, als sie draußen auf der Bank saß und er noch keine Robe getragen hatte. Obwohl sie Männer mit Schmuck nicht leiden konnte, hatte dieser Anblick sie irgendwie beruhigt. Auch nur ein Mann … wahrscheinlich ein eitler, denn für fünfzig, die er bestimmt war, sah er überaus gepflegt aus. Typ graue Schläfen, aber nicht unsympathisch. Mein Gott, wie abhängig sie sich von Äußerlichkeiten machte. Schließlich war es nicht sie, die auf der Anklagebank saß. Doch die Schuld, ihre und die der anderen, würgte sie wie ein imaginäres Halsband. Aber es war zu spät. Im Leben gab es keine Generalproben. Jeder Akt mußte sofort stehen.
Sie griff sich unwillkürlich an den Hals, und Dr. Kant sah sie fragend von der Seite an. »Ist Ihnen nicht gut, meine Liebe?« Es war nur ein Flüstern.
»Doch, doch …« Bildete sie sich nur ein, daß dieser Rechtsanwalt, dieser Timm, sie höhnisch angrinste? Es war so still im Saal, nachdem der Staatsanwalt die Anklage verlesen hatte. Der Vorsitzende raschelte mit den Akten. Bernhard starrte immer noch aus dem Fenster. Diese verdammte Abgeklärtheit, die sie schon immer an ihm gehaßt hatte! Man sprach mit ihm, und er war ganz woanders. Alles, was ihn langweilte, ignorierte er. Als ob man das ganze Leben ignorieren könnte, verflucht. Es war so still im Saal.
»Bevor ich die Angeklagten frage, ob sie sich zur Sache einlassen wollen, möchte ich ein paar persönliche Worte sagen.« Richter Mayer blickte beschwörend von einem zum anderen. Seine Stimme klang sehr versöhnlich, und er lächelte. »Ich meine, meine Damen und Herren, wir sind doch alle hier erwachsene Menschen, ich möchte sagen, humanistisch geprägt, und wir könnten in gemeinsamem Bemühen diesen delikaten Fall mit, ich will mal sagen, mit gutem Geschmack und einer gewissen Zurückhaltung handhaben. Aus Erfahrung weiß ich, daß die öffentliche Behandlung intimer Bereiche von allen Beteiligten ein gewisses Maß an Selbstüberwindung fordert. Ich meine damit natürlich besonders die Nebenklägerin, Frau Bergmann.«
Ich weiß genau, worauf du mit deinen salbungsvollen Worten hinaus willst. Oliver Timm starrte den Richter mit leicht hochgezogenen Mundwinkeln an. Opferschutzgesetz: Du möchtest, daß wir die Dame hier, die meinen Klienten immerhin für ein paar Jahre hinter Gitter bringen kann, mit Samthandschuhen anfassen. Porno-Mayer, wie er in Kollegenkreisen hieß, ließ seinen ersten Warnschuß los. Aber so leicht war er nicht zu erschrecken. Sein Kollege Laubenthal, Krugs Verteidiger, schien dagegen beeindruckt. Er saß mit leicht geöffnetem Mund da und sah nicht besonders intelligent aus. Aber diese Eigenschaft hatte man Laubenthal noch nie nachgesagt.
Herr Dr. Laubenthal, dachte Timm, ist ein Mitstreiter, den ich mir freiwillig nicht ausgesucht hätte. Ein kleiner Ferkelstecher mit großer Klappe. Einer von denen, die Justizbeamte schmieren, damit diese den Knastbrüdern den entsprechenden Anwalt andienen. Das ein oder andere Essen mit dem Lokalreporter, der ihn dann namentlich erwähnte. Laubenthal übernahm vorwiegend Pflichtverteidigungen, und ob dieser Form des Broterwerbs mußte er zwangsläufig dem einen oder anderen Richter in den Allerwertesten kriechen. Weil ja auch Richter den Anwälten Pflichtverteidigungen antrugen. Und kein Richter ist so masochistisch, sich einen renitenten Anwalt freiwillig auszusuchen.
Er fragte sich, wie dieser Krug an Laubenthal gekommen war. Vermutlich dessen gute Beziehungen zur Presse! Nun, Herr Krug würde sich noch wundern.
Rechtsanwalt Timm sandte ein kurzes Stoßgebet zu dem Kreuz hinter dem Vorsitzenden. Er hatte keine Ahnung, was der Mitangeklagte aussagen würde. Es wäre ein Segen, wenn Krug zuerst an die Reihe käme. Dann könnte Grimme seine Aussage immer noch modifizieren. Aber andersherum …? Timm hatte dieses Gefühl, das ihn manchmal, aber nicht oft, trog, daß sein Klient die Wahrheit sagte. Im großen und ganzen die Wahrheit, aber mit einigen Aussparungen, die seiner Geschichte den fatalen Hauch der Unglaubwürdigkeit gaben. Er war kein Idiot, dieser Dr. Grimme, gewiß nicht. Er wußte, worum es ging, nämlich um die nächsten paar Jahre seines Lebens, um seine Approbation, seine Existenz. Aber vorausgesetzt, das, was Grimme ihm erzählt hatte, entsprach der Wahrheit: Warum dann diese Erinnerungslücken?
Er hatte gute Lust, seinem Klienten zu raten, sich überhaupt nicht einzulassen. Aber Grimme wollte aussagen. Sie hatten diese Aussage ein paarmal abgeklopft. Sie war nicht unstimmig. Sie wäre glaubhaft – wenn es die Lücken nicht gäbe. Wenn es die Aussagen der anderen nicht gäbe …
Timm war in diesen ersten Prozeßtag mit einem Gefühl der Unsicherheit gegangen. Irgend etwas stank – aber noch konnte er nicht identifizieren, was. Bei Gott, wenn Grimme aus Rücksichtnahme auf die Nebenklägerin etwas zurückhielt, würde er ihm das während des Prozesses noch aus der Nase ziehen. Nichts gegen die Pappritz in diesen Zeiten des Verfalls guter Manieren. Aber alles zu seiner Zeit. Nicht in diesem Saal und nicht bei »Porno-Mayer«. Der hatte in seinen ersten persönlichen Bemerkungen schon kundgetan, auf wessen Seite er stand.
»Wir beginnen mit der Einlassung des Angeklagten Grimme.« Der Vorsitzende blickte nicht auf, sondern blätterte in den Akten. Er suchte das Polizeiprotokoll, in dem Grimmes erste Aussage vermerkt war: Wenn ein Mensch zweimal dasselbe erzählte, und das in einem Abstand von über sieben Monaten, gab es seiner Erfahrung nach immer Widersprüchlichkeiten.
Der läßt den Doktor absichtlich weg, dachte Timm. Die Demütigung des Angeklagten, ein probates Mittel. Und wie nicht anders zu erwarten, mußte sein Mandant zuerst aussagen.
»Will sich Ihr Mandant einlassen, Herr Rechtsanwalt?« Ein Blick des Vorsitzenden über den Goldrand seiner Brille.
Timm, der sonst von sanfter Stimme war, konnte schneidende Schärfe hineinlegen, wenn er vor Gericht war. »Jawohl, Herr Vorsitzender, Herr Dr. Grimme ist befeit, sich zur Sache einzulassen.«
Der Vorsitzende lehnte sich in seinem Stuhl zurück. »Ja, fangen Sie an, Herr Dr. Grimme. Wir warten. Und bitte – aber das hat Ihnen Ihr Verteidiger sicher schon gesagt – bemühen Sie sich, nach bestem Wissen und Gewissen alles zu erzählen, was in dieser Nacht geschehen ist. Lassen Sie nichts aus, was Ihnen wichtig erscheint, und fügen Sie nichts hinzu, das nicht der Wahrheit entspricht …«
Natürlich. Grimme mußte sich zwingen, die Richter anzusehen. »Ich fange wohl am besten mit meinen Personalien an. Ich bin in Berlin geboren, am 30. Januar 1938. Mein Vater besaß einen Fachverlag für medizinische Literatur in Berlin. Meine Mutter starb bei der Geburt. Aber ich hatte eine ziemlich glückliche Kindheit und Jugend, soweit ich mich erinnern kann. Ich begann, in Berlin Medizin zu studieren, nach dem Abitur. 1960 verkaufte mein Vater den Verlag, und wir zogen nach Hamburg, wo ich weiterstudierte. Um es kurz zu machen: In Hamburg habe ich 1965 promoviert. Das war das Jahr, in dem mein Vater starb.«
»Waren Sie der einzige Sohn und Erbe?« Mayer versuchte sich vorzustellen, wie hoch das Erbe gewesen war.
»Ja. Ich verkaufte unser Haus und zog nach Bonn, um mich dort als Arzt niederzulassen.«
»Warum sind Sie umgezogen?« Mayer konnte sich nicht vorstellen, wie ein Mensch freiwillig nach Bonn ziehen konnte. Köln, das war noch etwas anderes.
Grimme zuckte die Achseln. »Ich weiß nicht. Ich habe damals eine Frau in Bonn gekannt, und Hamburg gefiel mir nicht mehr.«
Die erste Halbwahrheit. Der Vorsitzende legte Zweifel in seine Miene. »Na gut, wollen wir das so stehenlassen. Ich nehme an, diese Frau spielt keine Rolle in Ihrem Leben mehr. Wie ich aus den Akten ersehe, haben Sie in der Beethovenstraße Ihre Praxis eröffnet, die Sie bis heute führen.«
»Ja, Herr Vorsitzender. Ich habe das Haus gekauft und mir im zweiten Stock eine Wohnung eingerichtet. Die Praxis läuft sehr gut.«
Wahrscheinlich, weil du einer der Ärzte bist, die die Krankenkassen übervorteilen. Von den Brüdern haben wir reichlich, dachte Mayer, der im Rahmen seiner beruflichen Erfahrung ein gewisses Vorurteil gegen den Ärztestand pflegte.
»Sie sollen so eine Art Prominentenarzt sein, Herr Dr. Grimme?«
Grimme nickte. »Wenn Sie das so ausdrücken wollen, Herr Vorsitzender.«
Wenn hier einer Ironie pflegt, dann bin ich das. Mayer legte eine Spur Schärfe in seine Stimme. »Sie sind nicht verheiratet. Wie kommt das bei einem gutsituierten Mann in den besten Jahren? Kann es sein, daß Sie Probleme mit Frauen haben, sexuelle Probleme vielleicht?«
»Wir könnten hier etwa 30 Damen benennen, die Herrn Dr. Grimme das attestieren würden, was man gemeinhin als sexuelle Normalität bezeichnet, Herr Vorsitzender. Aber diese Zeuginnen würden den Prozeß doch sehr in die Länge ziehen.« Timm grinste.
Johannes Mayer bemühte sich um ein Lächeln. Die Drohung, den Prozeß durch neue Zeugen in die Länge zu ziehen, war ihm nicht neu. »Geschenkt, Herr Rechtsanwalt. Was ich fragen wollte, Herr Dr. Grimme, ist, ob es einen bestimmten Grund für Ihr Single-Dasein gibt. Ich meine, es ist ja kein Verbrechen, Junggeselle zu sein. Nach den Ausführungen Ihres Rechtsanwaltes könnte ich es mir sogar sehr schön vorstellen …«
Zuckerbrot und Peitsche: Bernhard Grimme entzog sich diesem Scherz. »Ich habe einfach noch nicht die richtige Frau getroffen, nehme ich an. Bei Frau Bergmann, die ich seit eineinhalb Jahren kenne, hatte ich das zunächst gedacht. Aber wir haben doch Streit bekommen und uns, ich glaube, das war Anfang Juni, getrennt.«
»Wie kam es zu dem Streit?«
Immer, wenn Porno-Mayer besonders interessiert ist, schiebt er die Brille die griechisch-römische Nase hoch. Timm mußte sich das merken. Jetzt wurde es kritisch.
»Frau Bergmann hat sich von mir getrennt, Herr Vorsitzender. Das ist alles, was ich dazu sagen möchte.«
Mayer fragte ganz sanft: »Aber Herr Dr. Grimme, der Grund für dieses Zerwürfnis könnte sehr wichtig für uns sein. Haben Sie sich das auch gut überlegt und mit Ihrem Verteidiger besprochen?«
Grimme nickte. Er sah Timm nicht an. »Ja, das habe ich. Es ist etwas sehr Persönliches und steht in keinem Zusammenhang mit der mir vorgeworfenen Tat.«
»Den Zusammenhang herzustellen, müssen Sie schon dem Gericht überlassen, Herr Grimme.« Mayer spürte, wie die kleine Richterin neben ihm ob seines scharfen Tonfalls zusammenzuckte. »Na gut, gehen wir weiter. Sie haben Frau Bergmann seit dem Tag des Zerwürfnisses nicht mehr gesehen, stimmt das? Gut, dann kommen wir zu der Nacht des 2. August. Da haben Sie Frau Bergmann offenbar wiedergetroffen.«
Um ein Haar, dachte Grimme, wäre ich nicht zu dieser blöden Party gegangen, und dieses Haar hat mich schon viel gekostet. »Wir haben uns an diesem Abend ganz zufällig getroffen. Ich war zu einer Party bei Johannes Max eingeladen, dem Kölner Galeristen. Es waren bestimmt 100 Leute da. Die übliche Gartenfete. Es gab Champagner, Wein, ein Büfett und eine exotische Band, und die Leute standen herum und klatschten. Ich habe mich ziemlich gelangweilt und deshalb recht viel getrunken. Eine Flasche Champagner bestimmt. Ja, und so gegen elf, als ich eigentlich gehen wollte, sah ich Kirsten, pardon – Frau Bergmann. Sie stand unter dem Kirschbaum, und neben ihr war dieser Henner Krug.«
»Den Sie bis zu diesem Abend nicht gekannt haben?«
Leider nicht, dachte Grimme. »Nein, Herr Vorsitzender. Ich habe ihn wohl vom Sehen gekannt. Man trifft auf den Kölner Partys ja immer wieder dieselben Leute. Ich bin auf die beiden zugegangen, es wäre lächerlich gewesen, Frau Bergmann zu ignorieren. Sie hat mir ihren Begleiter vorgestellt, als Kollegen. Sie war kühl am Anfang, aber nicht direkt abweisend. Wir sprachen über Belangloses, eine Ausstellung von Max, und Kirsten erzählte von ihrer letzten Reise nach China. Sie ging dann für eine Weile weg, und ich blieb mit Krug stehen, und wir redeten, ich weiß nicht mehr worüber, belangloses Zeug. Sie kam zurück und hatte eine Flasche Champagner in der Hand. Wenn ich mich richtig erinnere, war sie plötzlich anders, irgendwie fröhlicher und aufgekratzter, nicht mehr so distanziert wie vorher. Wir tranken diese Flasche Champagner zu dritt leer. Ich fürchte, wir waren dann alle drei schon ein wenig beschwipst. Diese Nacht war sehr warm und schön, regte zum Trinken an. Vielleicht hatte ich auch die Hoffnung, daß wir uns wieder versöhnen würden.«
Der Vorsitzende sah zu Professor Leitz hin, dem Alkoholsachverständigen. Der schrieb mit, hatte aber offenbar keine Fragen.
»Wollten Sie sich denn mit Frau Bergmann wieder versöhnen?«
Bernhard Grimme versuchte, diese Frage wahrheitsgemäß zu beantworten. Hatte er wirklich geglaubt, daß eine Versöhnung möglich war? Er schaute zur Seite und traf ihre Augen. Darin stand nichts, woran er sich festhalten konnte. »Ich glaube schon, ich wollte zumindest ihr Freund bleiben.«
»Eine trügerische Hoffnung, wie sich später herausstellte.« Die Häme war nicht so böse gemeint, wie sie klang. »Wer von Ihnen ist auf die Idee gekommen, die Party gemeinsam zu verlassen?«
Bernhard Grimme schloß für einen Moment die Augen. Die Wahrheit, nichts als die Wahrheit – aber diese Nacht war doch nicht mehr als eine Anhäufung winziger Tatsachen, überzogen mit einem Netz aus Erinnerungen, Gefühlen und Selbsttäuschungen.
»Ich glaube, es war Herr Krug, der diesen Vorschlag machte.«
Mayers Stimme war sanft: »Sie wissen also nicht mehr, wer diesen Vorschlag machte? Versuchen Sie doch, sich zu erinnern. Es kann wichtig sein.«
Grimme sah seinen Anwalt hilflos an. Er zuckte die Achseln.
»Mein Mandant hat nach bestem Wissen und Gewissen geantwortet, Herr Vorsitzender. Im übrigen hielte ich es für zweckdienlicher, ihn ausreden zu lassen und die anfallenden Fragen erst hinterher zu stellen. So wird es üblicherweise bei Einlassungen von Angeklagten gehandhabt, und so verlangt es das Gesetz!«
»Sie brauchen mich hier nicht über die Strafprozeßordnung zu belehren, Herr Rechtsanwalt.« Mayer spürte, wie sich in seinem Magen ein Klumpen Wut formte, den er unbedingt kontrollieren mußte. Man hatte ihn vor dieser Timm-Taktik gewarnt. Wenn der sah, daß er auf aussichtslosem Posten kämpfte, versuchte er, das Gericht um jeden Preis zu provozieren, bis er es an einen Punkt brachte, an dem ihm ein Formfehler unterlief. Ein Formfehler genügte für eine Revisionsrüge und im schlimmsten Fall für eine Aufhebung des Urteils. Die meisten Rechtsanwälte verstanden zuwenig vom Revisionsrecht, um die Strafprozeßordnung auf solche Formfehler auszureizen. Aber Timm war ein anderer Fall. Er verständigte sich mit Richter Boll mit einem kurzen Blick. »Gut, Herr Dr. Grimme. Fahren Sie fort. Wir werden uns bemühen, Ihren Erinnerungsfluß nicht mehr zu unterbrechen.«
Er war ihm auf kindische Weise dankbar dafür. Bernhard Grimme, der das Gefühl der Unterlegenheit seit Jahren nicht mehr gekannt hatte, bemühte sich, seine Unsicherheit in den Griff zu bekommen. Das waren Profis, so wie er auf seinem Gebiet. Halbgötter in Schwarz, Leute, die nichts als ihren Job machten. Es gab keinen Grund für dieses Gefühl der Angst und Unterlegenheit. Und doch fühlte er so, hatte er schon begonnen, sich wie ein Verbrecher zu fühlen.
»Ja. Ich meine, es war Herr Krug, der als erster die Idee hatte, wir sollten woanders hingehen. Der Vorschlag, zu ›Elsa‹ zu gehen, stammte von ihm. Ich kannte das Lokal nicht und Frau Bergmann meines Wissens auch nicht. Herr Krug war wohl schon öfter dagewesen, es schien zumindest so, weil er mit der Besitzerin recht vertraut war. Wir sind also, das muß zwischen Mitternacht und ein Uhr gewesen sein – genauer kann ich es nicht bestimmen –, zu ›Elsa‹ gegangen. Wir waren alle drei nicht mehr nüchtern genug, um Auto zu fahren, und so gingen wir zu Fuß, es war nicht weit, etwa eine Viertelstunde.«
»›Elsa‹ ist, auf gut deutsch gesagt, ein Puff.« Der Vorsitzende lächelte entschuldigend für seinen Einwurf.
Der Staatsanwalt, der den Vorsitzenden nicht leiden konnte, fragte sich, ob der sein Wissen aus erster Hand bezog. Timm verkniff sich jede Bemerkung.
Grimme, der die Schöffin fixierte, was diese sichtlich irritierte, nickte. »Ja, so ist es. Die haben zwar eine normale Bar, aber wohl Separées irgendwo. Es war nicht viel los in dieser Nacht. Die Besitzerin, Elsa, war da und noch drei Mädchen. Sie alle schienen Herrn Krug zu kennen, und sie waren sehr freundlich, obwohl es – angesichts der Begleitung von Frau Bergmann – offensichtlich war, daß wir nichts anderes im Sinn hatten, als an der Bar einen Absacker zu trinken. Wir bestellten eine Flasche Champagner und dann noch eine und gaben auch jedem der Mädchen ein Glas aus. Außerdem war nur noch ein Gast da. Es war sehr lustig, wir haben getrunken und gelacht, und die Atmosphäre war entspannt. Frau Bergmann war sehr fröhlich und charmant. Wir gingen miteinander um wie zwei vertraute Bekannte, und ich war unglaublich erleichtert, daß unsere Trennung keine bitteren Spuren hinterlassen hatte. So glaubte ich zumindest. Ich erinnere mich, daß ich in dieser obskuren Bar beinahe so etwas wie glücklich war.«
Es gab ihr einen Stich, als er das sagte. Es klang so verdammt aufrichtig. Aber Kirsten Bergmann erinnerte sich, daß Bernhard auch verdammt gut lügen konnte. Sie hörte ihm so konzentriert zu, wie sie es tat, wenn sie jemanden interviewte.
Grimmes Stimme war rauh: »Von jetzt an werde ich vielleicht etwas ungenau in den Zeitangaben, weil ich wirklich schon zuviel getrunken hatte. Wir müssen so zwischen ein und zwei Stunden bei ›Elsa‹ gewesen sein. Dann habe ich gesagt, ich könne nichts mehr trinken, und habe die Rechnung bezahlt. Es waren 420 Mark. Elsa machte noch den Vorschlag, daß ich eines ihrer Mädchen mitnehmen sollte, aber ich habe abgelehnt. Ich hatte keine Lust, und Krug hatte kein Geld, oder ich weiß nicht … Wir sind dann raus aus dem Lokal, und – ich weiß nicht, ob Sie dieses Gefühl kennen – wir hatten eigentlich schon alle drei genug, aber wir wollten nicht aufhören. So sind wir noch in eine Diskothek nebenan gegangen, aber das Publikum war so furchtbar, daß wir gleich wieder raus sind. Frau Bergmann machte schließlich den Vorschlag, daß wir bei ihr noch einen Kaffee trinken sollten. Ihre Wohnung liegt praktisch in der Innenstadt, unten am Rhein. Wir sind also zu Fuß in ihre Wohnung. Als wir da ankamen, muß es gegen drei gewesen sein, vielleicht etwas früher. Frau Bergmann ging in die Küche, um Kaffee zu kochen, und ich saß im Wohnzimmer mit Krug. Wir tranken Cognac und Cola. Es dauerte lange, das Kaffeekochen, meine ich. Und ich war auf einmal furchtbar müde. Vielleicht ein paar Minuten, nachdem Frau Bergmann zurück war, bin ich mit einer Entschuldigung ins Schlafzimmer gegangen, das kannte ich ja, und dort habe ich mich angezogen auf das Bett gelegt. Ich bin sofort eingeschlafen. Und ich muß geschlafen haben wie ein Stein. Denn als ich aufwachte, am nächsten Morgen, kurz vor sieben, war niemand in der Wohnung. Kirsten, Frau Bergmann, war weg und auch Henner Krug.«
Wie er sie haßte, diese Lügenmärchen, die er sich seit 20 Jahren anhören mußte. Bei allem Verständnis dafür, daß Menschen, die auf der Anklagebank saßen, sich verzweifelt verteidigten – manches beleidigte seine Intelligenz und ließ ihn zornig werden. Der Vorsitzende trommelte mit dem Kugelschreiber auf den Akten, ein Geräusch, als ob mit einer Maschinenpistole in Watteballen geschossen würde.
»Ich war natürlich verkatert, habe mich gefragt, was passiert war. Aber dann dachte ich mir, daß Herr Krug nach dem Kaffee weggegangen war und Frau Bergmann vielleicht einen frühen Termin hatte und mich nicht wecken wollte. Es war etwas unordentlich im Wohnzimmer, und ich habe zumindest die Tassen und Gläser weggeräumt. Erst wollte ich Kirsten eine Nachricht schreiben, habe mich aber dann entschlossen, sie später anzurufen, um mich für das Nachtasyl zu bedanken. Im Grunde habe ich sogar gehofft, daß wir uns nach diesem schönen Abend wieder versöhnen würden. Aber ich habe sie dann in den nächsten Tagen nicht erreicht. Erst als die Polizei in die Praxis kam, hörte ich von den ungeheuerlichen Vorwürfen. Das ist die Wahrheit. Ich habe geschlafen. Das bin ich bereit zu beschwören.«
»Wer schläft, der sündigt nicht.« Diese Bemerkung hatte Mayer sich beim besten Willen nicht verkneifen können.
Der Staatsanwalt zog die Mundwinkel herab und warf einen forschenden Blick auf Grimmes Verteidiger. Oliver Timm, der sah, daß Grimme einem Zusammenbruch nah war, drückte ihn sanft auf den Stuhl zurück. Von Mensch zu Mensch hätte er dem Mayer jetzt gesagt, daß es geschmacklos und unwürdig war, Bonmots auf Kosten von Angeklagten zu machen. Aber die Robe schaffte andere Spielregeln.
»Ich beantrage eine Pause von einer halben Stunde, Herr Vorsitzender. Mein Mandant hat seiner Einlassung zunächst nichts hinzuzufügen, und wie Sie sehen können, geht es ihm nicht gut. Im übrigen böte mir diese Pause Zeit, einen Befangenheitsantrag zu formulieren.«
Die Miniaturbombe war geräuschlos eingeschlagen.
II. Kapitel
Der Kuß am Morgen war eines der geliebten Rituale ihrer Kindheit. Kirsten konnte sich nicht erinnern, daß ihre Mutter dieses Ritual jemals versäumt hätte, nur in den seltenen Fällen, wenn sie verreist oder krank war. Aber Magdalena Bergmann war eine altmodische Frau mit einer beinahe besessenen Verbundenheit an Haus und Familie. Es schien, als hielte sie an alten Werten fest, so als ob diese sie vor den Unbillen der Zeit schützen könnten. Magdalena Bergmann sprach nie vom Krieg, von Krankheit oder Tod. Alles, was häßlich war, wurde verdrängt in diesem schönen Haus an der Alster, in Hamburgs Nobelviertel.
Es war zumindest ungewöhnlich im Haushalt eines Arztes, aber das fiel Kirsten erst viel später auf. Ihr Vater sprach zu Hause nicht über seine Arbeit. Wurde jemand in der Familie krank, was selten genug vorkam, sagte er »Papperlapapp«. Man wurde nicht krank bei den Bergmanns, nicht in der Zeit, als sie in dem schönen Haus an der Alster wohnten und die Mahlzeiten von einem Dienstmädchen serviert wurden und die Tischgespräche sich um Haus und Garten drehten, um Literatur, Kunst und Musik. Kirstens Kinderkrankheiten wurden mit einer für das Kind enttäuschenden Nonchalance gehandhabt. Beinahe verstohlen stellte der Vater die Medizin auf den Nachttisch, und ihre Mutter, die sie hingebungsvoll betreute, tat dennoch so, als ob die »Unpäßlichkeit« ein lästiges Insekt wäre, das sich durch bloßes Öffnen eines Fensters aus dem Weg schaffen ließ. Für ein zwölfjähriges Kind war das ziemlich frustrierend. Kirsten fühlte, daß man sie um jene raren Waffen beraubte, die ein Kind in der Welt der Erwachsenen hat.
Es war eine glückliche, ein behütete Kindheit. Kirsten liebte ihre Mutter, wie man als Kind den lieben Gott liebt: gefühlsbetont, ohne Fragen und Zweifel und in dem sicheren Wissen, daß der Gegenstand der Liebe immer für einen da war.
Magdalena Bergmann war eine schöne Frau von der zeitlosen Art, die keiner Mode unterworfen ist: groß, schlank, mit fast weißer Haut, mit seltsam blauen Augen und rotblonden Haaren, die natürlich lang waren und immer hochgesteckt, immer in der gleichen Weise, so als ob Magdalena auf einer Wolke schlafe und sich nie zu frisieren brauchte. Es war so beruhigend, diese ewige Wiederholung. So beruhigend wie die stets sanfte, leise Stimme ihrer Mutter, die hellen Seidenblusen und dunklen Röcke, die Perlenkette, die sie ständig trug. Diamanten, sagte Magdalena Bergmann, seien vulgär, etwas für Neureiche. Sie hatte sehr ausgeprägte, oft merkwürdige Ansichten, und wenn diese von ihrer Umgebung als hoffnungslos altmodisch empfunden wurden, so schien sie das nicht zu stören. Sie sagte alles nur einmal, und wenn ihr widersprochen wurde, lächelte sie nur und argumentierte nicht.
Kirsten hatte ihre Eltern niemals streiten hören. Später erklärte sie sich das mit dem geradezu besessenen Harmoniebedürfnis ihrer Mutter. Als sie zehn Jahre alt war, wurde ein Dienstmädchen entlassen, nur weil seine Stimme für Magdalena unerträglich laut war. Alles Laute war vulgär. Tischgespräche über Politik waren vulgär, über Geld, Sexuelles sowieso, moderne Kunst, große Partys, berufstätige Frauen, Männer mit Siegelringen … Die Liste war lang. Magdalena Bergmann vertrat ihre Ansichten leise, aber bestimmt, und sie ignorierte sowohl das nachsichtige Lächeln ihres Mannes wie auch gelegentlichen Widerspruch ihrer Freunde und Bekannten.
Es waren oft Gäste im Haus, eingeladen nach einem Ritual, das Kirsten nie ganz verstanden hatte. Der Bekanntenkreis ihrer Eltern war groß, aber eine Freundin, eine intime Freundin, hatte ihre Mutter nicht gehabt.
Magdalena wurde von vielen der männlichen Bekannten verehrt oder bewundert, aber mehr so, als sei sie ein seltenes Tier oder eine Pflanze, die man beschützen mußte, die nicht zum Anfassen da war. »Magdalena ist ein wandelnder Anachronismus« hörte sie die Schwester ihres Vaters einmal sagen, und als sie ihre Mutter nach diesem Wort fragte, lächelte diese, ohne es zu erklären.
Es gab vieles, das sie nicht verstand, ohne daß es sie damals sehr gestört hätte. Es kam ihr manchmal vor, als lebte sie in einem verwunschenen Märchenschloß, zusammen mit einer guten Fee und einem Schloßherrn, der noch distanzierter und unerreichbarer war. Axel Bergmann störte ihre Kreise nicht. Wenn er nach Hause kam, zog er sich in sein Arbeitszimmer zurück, um später zum Abendessen zu erscheinen und mit sanfter Stimme über die unwesentlichen Dinge des Lebens mit seiner Frau oder seiner Tochter zu plaudern. Er fragte Kirsten nach ihren Noten, aber nie nach ihren Nöten. Hatte sie welche?
Später, viel später, als sie versuchte, mit ihrem Vater zu sprechen, mußte sie feststellen, daß das Schweigen, das Aussparen aller Häßlichkeiten, wie ihre Mutter das in ihrem Haus gefordert hatte, zu seinem zweiten Ich geworden war. Das, was sein Leben zerstört hatte, nannte er das »schreckliche Ereignis«, als wollte er mit Worten Eis über einen glühenden Vulkan legen.
Damals, in dem schönen Haus an der Alster, liebte sie ihren Vater mit der gedämpften Erwartung zurückgewiesener Zuneigung. Er war nie böse zu ihr, nicht einmal, als sie ihm einen Frosch unter den Tellerwärmer gelegt hatte. Nie würde Kirsten das angewiderte Gesicht ihrer Mutter vergessen, als ihr Vater am Sonntagabend den silbernen Tellerwärmer hob – das geheimnisvolle Lüften dieser Dinger hatte die Achtjährige schon seit langem gereizt – und statt des erwarteten Bratens ein Frosch zum Vorschein kam, der verängstigt quer über den Tisch hüpfte. Es war wirklich komisch, das dumme Gesicht ihres Vaters, aber die Miene ihrer Mutter hatte ihr Gelächter verstummen lassen. Sie wurde aus dem Zimmer geschickt und durfte zur Strafe ein Vierteljahr lang nicht mit am Tisch essen.
Nein, es hatte nie Prügel gegeben, so sehr sie sich auch manchmal danach gesehnt hatte. Wahrscheinlich, weil Magdalena Bergmann Prügel als vulgär empfand.
Scheiße, Arschloch, Drecksau: In ihrem Zimmer und draußen im Garten wiederholte Kirsten die köstlichen Worte, die sie in der Schule gelernt hatte, immer und immer wieder. Sie zerflossen ihr auf der Zunge und tönten wie silberne Glocken in ihren Ohren. Aber nie hatte sie gewagt, mit einem dieser Worte in das Glashaus der Harmonie einzudringen. Später, als alles »Häßliche« erlaubt war, hatten sie ihren besonderen Reiz verloren.
Das Lächeln Magdalenas zu zerstören galt als Todsünde. Es bereitete Kirsten Höllenqualen, ihrer Mutter »Kummer zu bereiten« und dies in deren Gesicht manifestiert zu sehen. Es war eben Liebe, diese gnadenlose Abhängigkeit, wie sie in den Beziehungen zwischen Kindern und Erwachsenen besteht. Das Lächeln ihres Vaters war nicht so wichtig, jedenfalls nicht bis zu dem Tag, als eintrat, was später als »schreckliches Ereignis« in die Familienchronik einging.
Kirsten hatte keine Großeltern mehr, sie waren im Krieg umgekommen, mehr wollte Magdalena nicht dazu sagen. Aber es gab eine Reihe von Tanten und Onkeln und Cousins und Cousinen, die sporadisch auftauchten und keine bleibenden Spuren hinterließen. Die Familie besaß Geld, aber natürlich wurde nicht darüber gesprochen. Es gab das schöne Haus und den Mercedes ihres Vaters, die Mutter lehnte Autofahren ab. Sie hatten ein Dienstmädchen und eine Köchin und einen alten, lahmen Gärtner, der so häßlich war, daß er vom Haus und seinen Bewohnern möglichst ferngehalten wurde. Irgendwo war die große Privatpraxis des Vaters, die Kirsten nie gesehen hatte und – wie sie argwöhnte – ihre Mutter auch nicht. Es gab feste Zeiten für Mahlzeiten und Einladungen und Hausmusik und Schonbezüge über den schweren Ledersesseln. Es gab Magdalenas Kuß jeden Morgen und beim Schlafengehen ihr liebevolles Lächeln. Oder den Entzug dieses Lächelns, wenn Kirsten einen ihrer zahllosen Streiche verbrochen hatte, zu deren schlimmsten zählte, daß sie das Gebiß der Köchin versteckt hatte. Später begriff Kirsten, daß ihre Streiche nichts weiter als ein Aufbegehren gegen die Harmonie dieses Hauses waren.
Dr. Axel Bergmann träumte oft davon, mit zwei Frauen zu schlafen, mit seiner eigenen und einer schönen, lasziven Unbekannten. Ein irrwitziger Traum, wie er sich selbst eingestand, denn der Gedanke, daß Magdalena seine erotischen Phantasien teilen würde, war beinahe gotteslästerlich. Seine Frau, selbstgewählte Gefährtin vieler Tage und Nächte, war von unvergleichlich steriler Erotik. Magdalena und Sex: das war Dunkelheit, Geflüster, Ritual. Nie sprach sie darüber, was sie dabei empfand. Sie schrie nicht, und sie stöhnte nicht, sondern seufzte höchstens, in dieser zarten Lautstärke, die ihr zu eigen war. Sie war ihm ein Rätsel, seine Frau, in ihrer Anspruchslosigkeit an das Leben und in ihrer sturen Phantasielosigkeit. Magdalena kam ihm manchmal vor wie eine Blume aus Stahl. Und er liebte sie. Er liebte sie ohne die Hoffnung, daß er sie je verstehen, ihr wirklich nahekommen würde.
Sie war seine erste Frau, und er hatte sie in dreizehn Ehejahren nie betrogen. Nur in Gedanken, in Gedanken schon. Nicht, daß es ihm an Chancen gefehlt hätte. Er war mit seinen vierzig Jahren ein gutaussehender, erfolgreicher Mann. Nicht brillant, aber klug genug, sich damit zu begnügen, daß er kein Intellektueller war. Ein Naturwissenschaftler eben, ein guter Arzt, und kein Schöngeist. Literatur, Musik und Malerei interessierten ihn allenfalls oberflächlich. Eigentlich hatte er keine Interessen, von seiner Familie und seiner Praxis abgesehen. Axel liebte die Betulichkeit seines Seins, die wohltemperierte Atmosphäre seines Hauses, die wunderbare Langeweile der Abende und Nächte mit Magdalena. Es gab keine Überraschungen, nichts Unvorhersehbares und nichts Unkalkulierbares. Es war so beruhigend, das Leben im Griff zu haben. O ja, er war glücklich. Er dachte nicht daran, die valiumwattige Glocke, die er über sein Leben gestülpt hatte, mit der Unwägbarkeit etwa eines Seitensprunges zu vertauschen. Mit einer seiner Patientinnen etwa, den Damen um die Vierzig, die ihn anhimmelten und ihm mehr oder weniger unverhohlen Avancen machten.
Er sah wirklich gut aus: groß, schlank, mit grauen Augen und grauen Schläfen. Sein Mund war für einen Mann schon beinahe zu sinnlich. Abgesehen von den erotischen Träumen und sexuellen Phantasien war Axel Bergmann ein Mann ohne Exzesse. Er trank gerne Wein, aber nie zuviel davon. Er rauchte eine Zigarre nach dem Abendessen und ließ in allem, was er tat, jene Vorsicht walten, die gemeinhin als »vernünftiger Lebenswandel« bezeichnet wird.
Seine Phantasie war unbegrenzt. Seine Phantasie versetzte Berge und brachte sein Blut in Wallung. In seiner Phantasie war er Abenteurer und Casanova, Spekulant und Hochstapler, ein sadistischer Teufel und von allen gefürchtet. Manchmal machten sie ihm beinahe angst, diese Träume, die ihn in seinem Arbeitszimmer überfielen oder in der Stille seines Betts. Es waren fast immer erotische Träume, und fast immer spielte Magdalena eine Haupt- oder Nebenrolle. Aber niemals hätte er gewagt, seiner Frau auch nur eine Silbe davon zu verraten. Magdalena, die keines häßlichen Gedankens fähig war, würde seinen Träumen mit Abscheu und Verachtung begegnen. Sex, aus der Dunkelheit des Schlafzimmers geholt, war für sie häßlich und degoûtant. Wenn man es schon tun mußte, sprach man nicht darüber. Magdalena hatte sich ja auch standhaft geweigert, ihn an Kirstens Geburt teilnehmen zu lassen. Magdalena verschloß Toilettentüren. Magdalena war wie ein schönes Bild, das man angreifen, aber nicht besitzen durfte. Sie war perfekt. Und er betete diese Perfektion an, weil sie ihn seine eigene Unzulänglichkeit besser ertragen ließ.
Kirsten war ganz anders als ihre Mutter. Nicht äußerlich, sie würde einmal genauso schön werden, wie Magdalena heute war: groß, blond, mit diesen faszinierenden Schlafzimmeraugen, den hohen Backenknochen und dem arroganten Mund. Aber Kirsten war anders als ihre Mutter, weil sie maßlos war: maßlos in ihren Ansprüchen an das Leben. Kirsten wollte immer alles haben, und das sofort. Wie ihr Großvater, sein Vater, der Gott sei Dank tot war. Axel Bergmann hatte seinen Vater gehaßt, solange er denken konnte. Der Alte war ein Säufer und Betrüger, ein Schmarotzer ohne Sinn für Anstand und Moral. Wenn der Alte eine gute Eigenschaft besessen hatte, dann seinen Sinn für Humor – der allerdings immer auf Kosten anderer ging. Kirsten war auch so: Ihre Streiche gingen immer auf irgend jemandes Kosten. Sie log, und das oft ohne Not. Sie konnte von strahlendem Charme sein oder unerträglich verstockt, ein Wechselbad an Gefühlen, die sie hemmungslos nach außen trug. Er liebte seine Tochter, natürlich liebte er sie. Aber es tat ihm weh, wie wenig sie Magdalena ähnelte, und er hoffte zutiefst, daß sich das Gute und Sanfte ihrer Mutter doch noch bei ihr entwickeln würde. Es war schön, daß Magdalena kein zweites Kind wollte. Er wollte ihre Liebe nicht mit noch einem Menschen teilen. Das wäre mehr gewesen, als er hätte ertragen können.
»Du siehst aus, als ob du Kopfschmerzen hättest, mein Lieber. Soll ich dir die Schläfen massieren?«
Sie war so perfekt organisiert … Für den Abend erwarteten sie sechs Gäste, und Magdalena hatte trotzdem Zeit, sich nur ihm zu widmen. Axel Bergmann sah sie liebevoll an.
»Danke, Liebling, es ist wirklich nicht nötig. Ich hatte einen ziemlich harten Tag, das ist alles. Gib mir ein paar Minuten, und ich bin wieder fit. Wie war dein Tag?«
Magdalena streichelte ihm kurz über das Haar und setzte sich ihm gegenüber auf die Couch. »Alles bestens. Das Dienstmädchen stellt sich an, weil sie Überstunden machen muß, und die Köchin, die ich engagiert habe, scheint über zuviel Kraft zu verfügen. Sie wütet in der Küche wie ein Elefant im Porzellanladen, buchstäblich. Sie hat mir einen Teller vom guten Service zerschlagen. Kirsten hat in Latein eine Fünf nach Hause gebracht und behauptet, das läge nur daran, daß der Lehrer in sie verliebt wäre und ihr, weil sie ihn verschmäht, schlechte Zensuren gibt. Die Rache des enttäuschten Liebhabers, verstehst du? Deine Tochter ist unmöglich. Außerdem werde ich für sie einen Nachhilfelehrer besorgen müssen.«
Sie sagte immer »deine Tochter«, und manchmal störte ihn das. »Ein perfekter Tag also. Wann kommen die Gäste?«
Magdalena sah ihn erstaunt an. »In eineinhalb Stunden, mein Lieber, das weißt du doch. Ich habe deinen Dunkelblauen rausgelegt und die Krawatte mit den Silberstreifen. Wenn du möchtest, gehe ich jetzt und lasse dein Bad ein.«
Er nickte und sah ihr nach, wie sie die Treppe hinunterging, so als trüge sie ein unsichtbares Buch auf dem Kopf. Magdalena bewegte sich mit unnachahmlicher Grazie. Im Bad würde er Zeit zum Träumen haben …
Magdalena liebte Einladungen, solange sie im kleinen und überschaubaren Rahmen blieben. Wenn sie Gäste im Haus hatte, dann erlebte sie das schöne Gefühl, ihr Heim mit den Augen der anderen zu sehen. Und sie sah nur Schönes und Edles. Sie spürte eine geradezu physische Nähe zu den Dingen, zu jedem Möbelstück und jeder Vase, und sie bewunderte sich selbst mit den Augen der anderen für das, was sie aus diesem Haus gemacht hatte.
Natürlich würde sie der Köchin den Teller nicht von ihrem Lohn abziehen, so, wie sie es ihr angedroht hatte. Die arme Person hatte fast geheult vor Schreck, während Kirsten feixend daneben stand. Man war schließlich sozial. Blieben noch 23 Teller, und die reichten für ihre bescheidenen Einladungen durchaus.
Es war Zeit, sich umzuziehen. Magdalena überzeugte sich mit einem letzten Blick, daß alles in ihrem Haus perfekt war. Sie hörte Axel, der in der Badewanne einen Marsch pfiff, furchtbar falsch. Gott sei Dank hatte sie ihr eigenes Badezimmer. Nicht wegen seiner Pfeiferei. Das Bad war ein Intimbereich, den sie mit niemandem teilen mochte, auch nicht mit ihrem Mann. Während sie duschte, überlegte sie, welches Kleid sie anziehen sollte. Magdalena war nicht eitel, jedenfalls nicht im herkömmlichen Sinn. Ihre Garderobe war ihrem Bedürfnis nach Harmonie und Ästhetik angepaßt. Sie bevorzugte Grau- und Brauntöne, klassische Designs aus edlem Material. Das hellgraue Seidenkleid war angemessen. Sie stieg aus der Dusche und frottierte sich gründlich ab. Nichts war schlimmer als eine Gastgeberin, die besser gekleidet war als ihre Gäste. Es war ihr einmal passiert, und sie hatte einen Abend lang gelitten wie ein verstoßenes Kind. Es waren die kleinen Dinge im Leben, die zählten. Den meisten Menschen fehlte der Sensor dafür.
»Weißt du, daß ich nicht einmal genau weiß, wer heute abend kommt?«
Axel kam in ihr Schlafzimmer, während sie sich die Haare zu einem Knoten hochsteckte. Er wußte, daß sie es nicht mochte, sozusagen unfertig ertappt zu werden. Was er nicht wußte, war, daß ihr seine »Zerstreute-Professor-Imitation« unglaublich auf die Nerven ging. Magdalena antwortete erst, nachdem sie sich die letzte Nadel ins Haar gesteckt hatte.
»Du weißt es wohl. Dein Kollege Schmidt mit Frau, die von Grüns und unsere Nachbarn, denen wir eine Gegeneinladung schuldig sind. Außerdem habe ich deine Cousine Imke eingeladen. Sie bringt einen Studienkollegen mit. Ein bißchen frisches Blut kann nicht schaden. Die von Grüns sollten wir langsam von der Liste streichen. Er wird senil, und sie trinkt zuviel. Das letzte Mal war sie so betrunken, daß sie sich beim Hinausgehen von unserem Mädchen verabschiedet hat.«
»Wenn ich mit so einem alten Knacker verheiratet wäre, würde ich auch trinken.«
Magdalena legte ihre Rubinohrringe an. »Sie ist eine Frau ohne Disziplin, das ist alles. Wo ist Kirsten?«
Axel Bergmann betrachtete seine Frau durch den Spiegel. Sie war wirklich schön. Manchmal fragte er sich, womit er diese Frau verdient hatte. »Unsere Tochter hockt in der Küche und befragt die Köchin nach deren Lebenslauf. Sie ist unglaublich neugierig. Ich habe noch kein Kind gesehen, das sich so für Erwachsene interessiert.«
»Und was für Erwachsene, mein Lieber! Dienstmädchen, Köchinnen, Briefträger … Sie kommt langsam in das Alter, in dem schlechtes Benehmen nicht mehr entschuldbar ist. Ich werde ein ernstes Wort mit ihr reden müssen. Hast du ihr gesagt, daß sie aufbleiben kann, bis die Gäste kommen?«
»Ja, habe ich. Du siehst übrigens bezaubernd aus, Magdalena.«
»O danke.« Sie stand auf und ging auf Zehenspitzen zu ihrem Schuhschrank, in dem die vernünftigen und die feinen Schuhe säuberlich getrennt waren. Axel sagte ihr jeden Abend, daß sie wunderschön aussah. Das hatte diesem Kompliment allen Zauber genommen. Außerdem paßte das Wort nicht zu ihr. Sie war auf eine kühle Art sicher schön zu nennen, aber nicht von der Art, die Männer sofort faszinierte. Sie war nicht hübsch und gewiß nicht sexy. Das war sie als junges Mädchen nicht gewesen, und das wollte sie auch nie sein, weil sie das Zur-Schau-Tragen einer Wesensart als vulgär empfand.
»Ich sehe noch einmal unten nach dem Rechten.« Sie schüttelte den Kopf, ganz sanft. »Danke, Axel, ich brauche keine Hilfe. Ruhe dich noch aus, bis die Gäste kommen.«
Kirsten stand in der Diele, als sie kamen. Sie war satt bis zum Erbrechen, hätte sich aber den Einzug der Geladenen um keinen Preis entgehen lassen. Die Köchin hatte sie mit Resten gefüttert, und weil diese soviel dabei erzählte, hatte sie sich gedankenlos vollgestopft, bis ihr schlecht wurde.
Die Schmidts kamen als erste, wie immer: Er war klein und dick, aber charmant und geistreich, wie Mutter sagte. Kirsten mochte ihn trotzdem nicht, empfand seine unhanseatische Herzlichkeit als die eines tückischen Schweins. Frau Schmidt, die Kirsten wie immer an den großen Busen drückte, stank penetrant nach Parfum. Während Kirsten sich losmachte, versuchte sie, sich vorzustellen, wie Herr und Frau Schwein gemeinsam ins Bett stiegen. Es mußte ein großes, ein stabiles Bett sein, und wahrscheinlich grunzten sie nachts. Bah …
Die von Grüns waren so uralt, daß sie für die ihre Phantasie nicht mehr strapazierte. Die starben ohnehin bald, und dann würde Mutter sich für ihre Essen neue Adelige suchen müssen. Sie gab ihnen artig die Hand und spähte aufgeregt nach dem einzigen Gast, den sie nicht kannte. Seinen Namen wußte sie nicht, nur, daß er ein Freund von Imke war. Kirsten brauchte wieder Menschen-Nahrung für ihre Geschichten, für ihre Abenteuer mit Prinzen und Hexen und Jungfrauen und alten, bösen Zauberern. Sie brauchte einen Prinzen.
Und es war typisch, daß Magdalena sie gerade dann in die Küche schickte, als Imke mit ihrem Freund klingelte. Irgendeine dumme Frage an die Köchin, es war einfach nicht fair. Und ins Wohnzimmer und Eßzimmer durfte sie nicht, wenn Gäste da waren. Diese verdammten Gebote und Verbote, die nur dazu da waren, Kinder zu quälen! Kirsten spähte durchs Schlüsselloch oder – versteckt – durch die Tür, wenn das Dienstmädchen sie öffnete.
Er saß mit dem Rücken zur Tür. Kirsten sah nur, daß er breite Schultern hatte und schwarze, lockige Haare, die sich über einem weißen Hemdkragen kräuselten. Er hatte längere Haare, als sie es je bei einem anderen Gast ihrer Eltern gesehen hatte. Es war einfach nicht fair, daß er sich nie umdrehte. Der Prinz saß zwischen Imke und ihrer Mutter.
»Mädchen, wenn du nicht von der Tür weggehst, flieg ich mit dem Tablett über dich, und dann gute Nacht …«
Kirsten steckte ihr die Zunge raus. Das war genau das, was sie sich wünschte. Dann würde es einen Riesenkrach geben und Scherben und jede Menge Hummersuppe auf dem Teppich, und die Erwachsenen würden nicht mehr so selbstzufrieden dasitzen, sondern sich umdrehen und entsetzt dreingucken und …
Sie erwägte kurz, der Elfie ein Bein zu stellen, verwarf den Gedanken aber wieder. Kurze Freude, langes Leiden: Elfie würde vermutlich entlassen, was nicht das Schlimmste war. Magdalena würde eine Weile nicht mit ihr sprechen, so wie damals nach der Geschichte mit dem Frosch. Magdalenas Schweigen aber war viel schlimmer als Prügel oder Hausarrest, weil es unerbittlich und anklagend war und tagelang andauerte. Dann mußte man zu Kreuze kriechen, erklären, entschuldigen …
Er drehte sich nicht um. Kirsten beschloß, sich nach oben zu verziehen, bevor ihre Mutter auf die Idee kam, draußen nach dem Rechten zu sehen. Kirstens Bettzeit war neun Uhr abends, und man erwartete von ihr, daß sie sich an die Spielregeln hielt und ihrer Mutter keinen Grund gab, die Stimme zu heben. Das Gemeine war, daß die Spielregeln ausschließlich von Erwachsenen aufgestellt wurden. Und was wußten die schon vom Spielen …