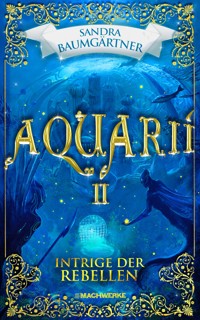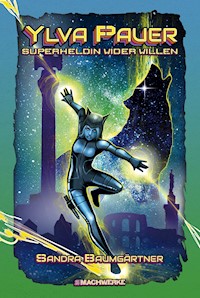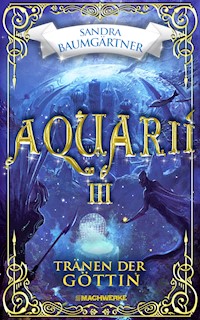
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Machwerke Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Mellis Hoffnung, Verbündete im Kampf um Marahií zu finden, schwindet. Selbst Benjamin bricht nach ihrem gemeinsamen Besuch im Königreich den Kontakt zu ihr ab. Ihr bleibt nur noch eine Möglichkeit: Sie muss mit den Rebellen verhandeln, um sie von ihrem zerstörerischen Vorhaben abzubringen. Doch wie nähert man sich dem Feind, ohne in Gefahr zu geraten? Welche Pläne verfolgt ihr Bruder? Und bringt der Ahári tatsächlich Läuterung, wie es ihr in der Schlucht der Erinnerung vorhergesagt wurde? Oder deutet Melli die Worte der Göttin völlig falsch?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Herstellung&Satz:
MACHWERKE Verlag
C/O Block Services
Stuttgarter Straße 106
70736 Fellbach
© Covergestaltung: FANTASIO und Designomicon
Lektorat/Korrektorat: Lektorat Bobrowski
ISBN 978-3-947361-20-5
www.machwerke-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten.
Sämtliche Inhalte, Fotos und Grafiken dieses Machwerkes sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen ohne vorherige Genehmigung weder ganz noch auszugsweise kopiert, verändert, vervielfältigt oder veröffentlicht werden.
*
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.
*
Die im Text genannten Personen und fantastischen Wesen, egal ob lebendig, tot oder untot, sind allesamt frei erfunden. Dies gilt auch für Zeitungsartikel, Mails und Nachrichten jeglicher Art. Sie wurden nie geschrieben oder veröffentlicht und entspringen alleine der Fantasie einer kreativen Autorin.
*
Wenn Ihnen diese Lektüre gefallen hat, dann erzählen Sie es weiter, schreiben Sie eine Rezension darüber und empfehlen Sie sie Ihren Freunden und Bekannten. So fördern Sie nicht bloß diesen Verlag und die Autorin, sondern auch eine fantastische Lesewelt.
Danke.
~ Für Günter ~
Prolog
Eldeboroó schwamm seinen Soldaten ungeduldig entgegen. „Habt ihr sie gefunden?“
„Nein, Kommandant“, antwortete der Vormann. „Wir haben alles abgesucht. Wir waren sogar am Rand des Meeres, aber auch dort fanden wir Eure Tochter nicht.“
Der Rebellenführer hieb seinen Speer frustriert in den Boden. „Das kann nicht sein!“, rief er. „Habt ihr wenigstens die Königskinder zu fassen bekommen?“
„Zumindest zwei von ihnen.“ Der Soldat wirkte erleichtert, weil er einen Erfolg vermelden konnte. „Wir haben Prinzessin Solameliaá und die Prinzen Koholeélo und Maraáro im Palast gefangen genommen. Der Pacha-Aár Tachimaál entkam uns hingegen und nahm Eure Tochter als Geisel mit.“
Eldeboroó knurrte und schloss für einen Moment die Augen. „Wie verlief der Rest des Planes?“
„Wir haben gehandelt wie befohlen. Wir sind unbemerkt in den Königspalast vorgedrungen, haben die drei Kinder gefesselt und an Land gebracht. Glücklicherweise kam der Pacha-Aár seinen Geschwistern nicht zu Hilfe. Wir stießen erst später auf ihn …“
Das Zögern des Soldaten ließ Eldeboroó misstrauisch werden. „Und?“
„Es gab Komplikationen.“ Der Krieger senkte den Blick und vermied es, ihn direkt anzusehen.
„Rede!“, befahl er ihm.
„Wir brachten die Prinzessin und Prinz Koholeélo an Land, doch wir verloren Maraáro.“
„Ihr habt ihn verloren? Erkläre dich!“
Der Kopf des Soldaten sank tiefer. „Der Pacha-Aár griff uns aus dem Hinterhalt an. Wir drängten ihn ab und führten unseren Plan weiter aus. Turuhuú, der den kleinen Prinzen trug, kam uns jedoch kaum hinterher.“
„Weiter.“
„Ich hielt ihn zur Eile an und trug den Transport des Königsjungen einem anderen auf, da Turuhuú beim Kampf mit dem Pacha-Aár verletzt worden war. Doch er versicherte mir, es sei nur ein Kratzer. Turuhuú war ein zuverlässiger Soldat. Es gab keinen Grund, nicht auf ihn zu vertrauen. Also sind wir weitergeschwommen und haben die beiden betäubten Kinder am Strand ausgesetzt. Das war schwierig, denn die Sonne brannte unerbittlich. Wir alle haben Verbrennungen davongetragen, doch letztlich waren wir erfolgreich. Turuhuú war hingegen noch nicht mit dem Königsjungen eingetroffen. Wir suchten unseren Kameraden und fanden ihn tot mit einem Speer im Hals unweit von dem Platz entfernt, an dem der Kampf mit dem Pacha-Aár stattgefunden hatte. Von Tachimaál und Maraáro fehlte jede Spur.“
Eldeboroó schäumte vor Wut. Er packte den Soldaten an den Schultern. „Mein Befehl lautete, alle Königskinder an Land auszusetzen. Und jetzt erzählst du mir, dass ihr nur zwei fortgeschafft habt?“
„Der kleine Maraáro wirkte mehr tot als lebendig“, verteidigte sich der Mann. „Die Dosis des Betäubungsmittels war hoch. Das Kind wird die Entführung vermutlich ohnehin nicht überleben.“
„Aber Tachimaál!“ Eldeboroó sah ihn wütend an. „Ihr wart zu viert, er hingegen war allein. Und dennoch bezwang er euch.“
„Er ist ein einflussreicher Pacha-Aár, und er hatte eure Tochter als Geisel. Wir mussten vorsichtig agieren. Vielleicht … wenn wir ihn mithilfe von Stellanah auf unserer Seite …“
„Schweig! Kein Wort mehr darüber.“ Eldeboroó war es leid. Wieso sich seine Tochter ausgerechnet in diesen überheblichen Königssohn verliebt hatte, wo es unter den Rebellen genügend fähige Soldaten gab, war ihm ein Rätsel. Er hatte Stellanah deutlich zu verstehen gegeben, dass eine Beziehung zu Tachimaál nicht infrage kam. Der hinterlistige Pacha-Aár würde sie nur benutzen, um die Pläne der Rebellen auszuspionieren. Diesem Täuschungsmanöver hatte Eldeboroó rigoros einen Riegel vorgeschoben und Stellanah jeglichen Umgang mit Tachimaál verboten. Einmal hatte sie ihm daraufhin noch entwischen können, dann hatte er sie unter Arrest gestellt. Seither hatte sie kein Wort mehr mit ihm gesprochen. Und nun war sie ihm erneut entkommen. Ob sie ausgerissen oder entführt worden war? Wenigstens waren seine Söhne im Arcani geblieben und warteten auf seine Rückkehr.
Eldeboroó baute sich vor dem Soldaten auf. „Ihr habt hoffentlich einen Hinweis, wo sich meine Tochter jetzt aufhält?“
Der Vormann sackte in sich zusammen. „Nein, aber …“
Er versetze dem Krieger einen harten Stoß und katapultierte ihn zurück in die Reihen seiner Mannschaft. „Ihr Nichtsnutze! Wozu habe ich Soldaten, wenn sie nicht fähig sind, meine Befehle korrekt auszuführen?“, schrie er die Truppe an.
Ein bislang stummer Soldat murmelte etwas und ignorierte das Zischen und den wütenden Blick seines Befehlshabers.
Eldeboroó fuhr herum. „Sprich lauter, Mann. Was verschweigst du mir?“
„Eure Tochter Stellanah möchte nicht gefunden werden.“
Sein wütendes Knurren ließ den Soldaten zusammenfahren. „Hieß es vorhin nicht, Tachimaál habe sie entführt?“
„Nein, Kommandant. Der Vormann hat gelogen. Stellanah ist dem Pacha-Aár freiwillig gefolgt.“
Völlig außer sich riss Eldeboroó seinen Speer aus dem Sand. Mit einem geschmeidigen Wurf traf er den Vormann, der tödlich verletzt zur Seite kippte und mit starrem Blick zu Boden sank. Eldeboroó achtete nicht weiter auf ihn. „Ich will die ganze Geschichte hören“, verlangte er von dem Soldaten. „Rede! Und wage nicht, zu lügen.“
Sein Gegenüber nickte eingeschüchtert. „Wir trafen Stellanah im Palast an. Ich weiß nicht, was sie dort zu suchen hatte oder wie sie ins Königreich gelangt war. Vermutlich hat sie der Pacha-Aár zu sich geholt. Wir versuchten, sie einzufangen, doch Tachimaál kam uns dazwischen. Beim Kampf wurde Turuhuú zwar schwer verletzt, aber wir konnten auf keinen Mann verzichten. Der Vormann war der Meinung, wir würden Stellanah und den Pacha-Aár leicht wiederfinden, wenn wir erst die drei Kinder weggeschafft hätten. Also konzentrierten wir uns zunächst darauf.“
Eldeboroó sah seine Soldaten wutentbrannt an. Warum hatte er sich nicht gleich selbst um diese Angelegenheit gekümmert? Er hätte seine Tochter energischer vor diesem Scharlatan Tachimaál warnen sollen. Ihr drohen, statt sie zu ermahnen. Von einer verliebten Frau konnte man keine Vernunft erwarten. Doch es war müßig, darüber nachzudenken. Es galt, zu handeln. „Schwimmt zurück zum Lager. Sammelt alle verfügbaren Kräfte und macht euch auf die Suche nach Stellanah und Tachimaál. Findet zudem heraus, wo Maraáro ist. Ob tot oder lebendig, es muss Hinweise auf seinen Verbleib geben. Er kann sich nicht aufgelöst haben.“
„Wie Ihr befehlt.“ Der Soldat schloss zu seinen Kollegen auf und schwamm mit ihnen davon. Keiner scherte sich um den toten Kommandanten.
Eldeboroó sah der Mannschaft verbittert nach und bemerkte erst jetzt, dass drei der ursprünglich entsandten Krieger fehlten. Bei jeder Konfrontation mit den Königstreuen verringerte sich die Anzahl seiner Gefolgschaft. Wenn die Verluste so weitergingen, blieben am Ende nur eine Handvoll übrig, die mit ihm kämpften. Wenigstens standen ihm seine Söhne Pahaluú und Korohuú zur Seite. Sie waren zwar keine erfahrenen Pacha-Aárs, doch sie waren loyal. Sie unterstützten sein Vorhaben, den alten König zu stürzen, die Aquarií aus der Isolation zu befreien und ihr Leben in neue Bahnen zu lenken. Die Landwesen waren weder bedrohlich noch nutzlos und hatten Technologien, von denen sie profitieren konnten. Wenn seine Pläne aufgingen, würde er bald Kooperationen mit den Menschen eingehen und sich neue Lebensräume sichern. Mithilfe von Partnern an Land konnten sie auf Sangua-Ahár verzichten. Eldeboroó war die Entbehrungen hier im Schwarzwasser leid, doch das behielt er für sich. Eine Rückkehr ins Königreich, zum Glauben und zur Großen Mutter glich einer Kapitulation, und diese Niederlage würde er niemals hinnehmen. Reneveel um Reneveel hatte er seine Getreuen eingeschworen und sie von seinem Vorhaben überzeugt. Und nun standen sie kurz vor dem alles entscheidenden Schritt. Der erste Kontakt zu den Landwesen war geknüpft. Zwei Soldaten und einige Menschen hatten ihr Leben dafür gegeben. Dennoch sah Eldeboroó einer zukünftigen Zusammenarbeit positiv entgegen. Eine profitable Partnerschaft gründete immer auf Opfern und Krieg. Der Boden war bereitet. Jetzt galt es, die anfänglichen Differenzen zu vergessen und auf das gemeinsame Ziel zu fokussieren. Nur so war der Fortbestand der Aquarií garantiert. Eine Tatsache, die der alte Aqua-Lohií weder begreifen noch gutheißen würde.
Als Eldeboroó in seinem Arcani ankam, konnte er Pahaluú und Korohuú nicht finden. Er hatte seinen Söhnen aufgetragen, hierzubleiben, bis er wieder zurückkäme, doch die Höhle war leer. Eldeboroó verharrte inmitten der Schlafstätte, die sie seit ihrer Abkehr von Marahií bezogen hatten. Ein Arcani bot Schutz vor Gronuluúhs und anderen Gefahren der tiefen See, dennoch musste hier etwas vorgefallen sein. Die umhertreibenden Mucuófetzen waren Indiz dafür. Normalerweise wurden die Schlafhüllen nach Gebrauch zu einem Gallertball zusammengeknüllt und an kleinere Fische verfüttert. Eldeboroó fing eines der noch klebrigen Stücke auf und drehte es zu einer Kugel. Wo trieben sich seine Söhne herum?
Ein paar Felsbrocken lagen im Sand, die frisch abgebrochenen Kanten leuchteten hell. Das Wasser im Arcani war trüb, der Boden aufgewühlt. Also hatte es wieder einmal Streit gegeben. Eldeboroó hob ein Korallenbruchstück auf. Seegras hatte sich in den verzweigten Armen verfangen und hing wie ein Wimpel daran. Er wollte es schon fallen lassen, da erst bemerkte er, was er in der Hand hielt. In dem zerrissenen Grasband war eine seltene Muschel verflochten. Er warf die Koralle beiseite und betrachtete das rare Stück genauer. Seine Tochter besaß keinen Schmuck. Und Rebellen dekorierten sich nicht. Solchen Tand trugen die Mitglieder der königlichen Familie. Es waren deren Insignien, mit denen sie ihre Macht und ihren Reichtum zur Schau stellten. Eldeboroó riss das Band in zwei Teile, die Muschel sprang aus ihrer Verbindung und fiel ihm in die Hand. Auf der Innenseite der Schale hatte jemand eine feine Zeichnung eingraviert.
Er schwamm hinaus ins Helle, um die Gravur zu begutachten. Das Band war weniger versiert gebunden, als es im Dunkeln ausgesehen hatte. Vielmehr wirkte es wie die stümperhafte Kopie wertvollen Schmucks. Die Gravur im Muschelinneren war ebenfalls unsauber ausgeführt. Das sprach gegen einen Gegenstand aus dem Königspalast. Im Licht erkannte Eldeboroó sein Familiensiegel, das mit zittrigen Schnörkeln mit dem Königssiegel verbunden worden war. Die Zeichnung eines naiven Kindes, das Werk einer Träumerin, die in ihrer Verblendung von der Verbindung zweier verfeindeter Stämme träumt. Hatte Stellanah dieses Band als Zeichen ihrer Liebe zu Tachimaál gefertigt, um es ihm zu schenken? In Eldeboroó flammte heißer Zorn auf. Stellanahs Mutter war von Königstreuen ermordet worden. Er hatte ihr zugesichert, immer auf seine Ziehtochter aufzupassen. Jetzt verließ ihn endgültig die Geduld mit ihr. Sie hatte ihm zu viel abgefordert, hatte seine Anweisungen zu oft hinterfragt und noch öfter ignoriert. Stellanahs Verfehlungen zeugten nicht von Stärke, sondern waren vielmehr Ausdruck ihrer Schwäche. Und nun hatten sich auch noch seine Söhne fangen lassen.
„Diese Brut ist so unfähig, wie ihre Mutter es war“, zischte er. „Sie sind die Aufmerksamkeit nicht wert, die ich ihnen schenkte.“ Er schwamm hinaus, schüttelte die Fäuste und schrie in die dunkle Weite: „Stelle deine Forderung, du blasierter Königssohn. Ich werde nicht darauf eingehen.“
Sollte der Pacha-Aár seine Kinder ruhig töten, niemals wieder würde Eldeboroó sich Aqua-Lohií Tiraboroó unterwerfen.
Chaos
Melli stieg aus dem Beiboot, mit dem Tamati sie vom Katamaran zum Strand gefahren hatte. Sie nahm ihren Rucksack entgegen und bedankte sich. „Ich melde mich, sobald ich etwas herausfinde“, sagte sie. „Hoffentlich bekomme ich Benjamin dazu, mit mir zu reden. Wenn er sich weigert, bleibt uns nur noch die Möglichkeit, es bei Cassia zu versuchen.“
„Das wird schon“, meinte Tamati und lächelte aufmunternd. Die Ruhe und Zuversicht, die er vermittelte, beruhigten sie ein wenig. „Ich bin mir sicher, er wird froh sein, offen mit jemandem über seine Erlebnisse reden zu können.“
Natürlich hatte Tamati recht. Niemand würde Benjamin glauben, dass er neben seiner menschlichen Gestalt eine weitere einnehmen konnte. Eine zweite Identität als Meermensch klang für Außenstehende mindestens unglaubwürdig, im schlimmsten Fall nach einer Geistesstörung. Dennoch bezweifelte sie, dass Benjamin sie anhören und sich ihr öffnen würde. Er hatte beim letzten Mal deutlich zu verstehen gegeben, dass er nichts mit seinem Aquariídasein und erst recht nicht mit den Problemen zwischen dem Königreich Marahií und den Rebellen zu tun haben wollte. Lag das daran, dass er der Sohn des Rebellenführers war? Schämte er sich für Eldeboroó, der im Begriff war, das Königreich zu verraten und die Existenz aller Aquarií aufs Spiel zu setzen? Die Organisation Aquacon, die Melli schon vor ihrer Ankunft in Australien beschattet hatte, wartete nur darauf, Marahií zu lokalisieren und Zugang zum wertvollen Erz der Aquarií zu erlangen. Möglicherweise war Eldeboroó ja ihr Mittelsmann. Konnte Benjamin das überhaupt wissen?
„Wenn Benjamin sich weigert, kommst du wieder zurück.“ Tamatis Worte rissen sie aus ihren Überlegungen. „Dann rufen wir Cassia an. Der hat ja bereits signalisiert, dass er mit uns reden will.“
„Vermutlich wäre es mit ihm einfacher, ins Gespräch zu kommen“, sagte Melli. „Immerhin hat er dir seine Handynummer gegeben. Und er war so begeistert von Marahií. Ich wüsste nur zu gerne, was er mit Vater besprochen hat.“
Cassias Faszination für die Wunder im Königreich stimmte Melli optimistisch. Ihre Kontakte zu Benjamin und Cassia waren von großem Wert. Sie legte viel Hoffnung in die beiden, denn sie stellten eine wichtige Verbindung zu den Rebellen her, deren Handeln zweifelsohne das Schicksal der Aquarií beeinflussen würde. Mit ihrer Hilfe konnte sie die Rebellen hoffentlich von ihrem Vorhaben abbringen. Melli würde alles daransetzen, ihr Volk zu retten.
„Andererseits war er sehr einsilbig, als ich ihn bei unserer Rückkehr an Land darauf ansprach.“ Tamati manövrierte das Dinghy, weil es zu weit ins seichte Wasser geraten war.
„Fahr zurück, bevor du hier strandest.“ Sie lachte. „Ich gehe jetzt erst mal in die Oyster Shack. Ich muss ja auch noch meine Sachen aus dem Zimmer holen. Ich melde mich danach.“
„Ist gut. Ich besuche in der Zwischenzeit Frank und norde ihn ein. Er kennt hier alles und jeden. Wenn jemand nach dir Ausschau halten oder Fragen stellen sollte, werden es ihm seine zahlreichen Kumpels berichten. Beeilen solltest du dich trotzdem. Momentan ist Palmer Senior zwar noch außer Gefecht, aber dieser andere Typ, der mit ihm am Strand war, ist ebenfalls unterwegs.“ Er betrachtete Melli und grinste. „Wobei man dich mit hochgesteckten Haaren, Basecap und im Mitarbeitershirt vom Kite-Surf-Camp kaum erkennt. Fehlt nur noch die Sonnenbrille.“
Melli hatte sich die Brille griffbereit in den Ausschnitt gesteckt und setzte sie auf. „Besser?“
Tamati blinzelte verwirrt. „Hey-ho! Wer sind Sie denn? Kennen wir uns?“, neckte er. „Perfekt. Also dann, viel Erfolg und pass auf dich auf. Meine Braut und ich werden auf deine Rückkehr warten.“ Sein Grinsen entlockte ihr ein Lächeln.
„Gut zu wissen“, sagte sie und zwang sich, den Blick von ihm abzuwenden.
Wenn er bloß nicht mein Aquarií-Bruder wäre.
Wie oft hatte sie sich das in den letzten Stunden schon gewünscht?
Sie steuerte auf die Oyster Shack zu, doch beim Betreten der Rezeption schwand ihre Zuversicht. Auf dem Tresen standen die Prospektaufsteller wild durcheinander. Die bunten Zettel lagen zwischen vertrockneten Eukalyptusblättern auf dem Fußboden. Der Arbeitstisch quoll von Unterlagen über, auf dem Regal dahinter reihte sich eine dreckige Kaffeetasse an die andere, flankiert von leeren Coladosen und Softdrinkflaschen. Doch das war nichts im Vergleich zu Heather. Melli erkannte die Frau kaum wieder. Sie hatte dunkle Ringe unter den Augen. Ihr T-Shirt war verschwitzt, die Haare waren fettig und zu einem unordentlichen Zopf verknotet.
Als sie Melli eintreten sah, änderte sich ihr Gesichtsausdruck schlagartig. „Tauchst du auch endlich auf?“, fauchte sie.
Heather mochte sie aus unerfindlichen Gründen nicht, aber dass sie jetzt derart angefahren wurde, fand Melli unfair. „Guten Morgen“, grüßte sie extrafreundlich. „Sorry, ich habe die Nacht auswärts verbracht. Ist das ein Problem? Ich wollte ohnehin heute …“
„Wir haben hier ganz andere Probleme.“ Heather schob einen Stapel Papiere zusammen, stopfte sie in eine Schublade und ging dabei so ruppig vor, dass einige Seiten zerknitterten.
„Das tut mir leid“, sagte Melli. „Gab es wieder Schwierigkeiten mit den Handwerkern? Benjamin hat mir erzählt, dass sie nicht sauber gearbeitet haben und ihr sehr viel Ärger mit ihnen hattet.“
Heather sah sie an, als verstünde sie kein Wort. Sie wirkte müde und abgekämpft.
„Wo ist er eigentlich?“ Melli wurde immer mulmiger zumute. „Ich muss ihn dringend sprechen.“
Heathers Augen füllten sich mit Tränen. Sie schniefte und klatschte sich plötzlich die Hände vors Gesicht.
Melli überwand ihre Vorbehalte, umrundete den Tresen und nahm Heather in die Arme. Sie waren keine Freundinnen, aber hier war eine Frau, die dringend Trost brauchte. „Was ist denn los?“, fragte sie mitfühlend. „Kann ich irgendetwas für dich tun?“
Sie wurde wirsch zurückgestoßen und stolperte rückwärts gegen das Regal. Eine Tasse kam ins Wanken, fiel und polterte zum Glück unbeschadet unter den Tresen. Heather verpasste dem Porzellan einen zusätzlichen Tritt, es zerbarst an der Frontplatte.
„Geh weg!“ Sie zeigte mit dem Finger auf Melli. „Deinetwegen liegt Benjy doch im Krankenhaus. Ich muss hier alles allein regeln. Seitdem du hier aufgetaucht bist, läuft alles schief. Ist dir eigentlich klar, was du angerichtet hast? Für dich ging es nur um ein kostenloses Zimmer, und Benjy ist zu gut, um das zu kapieren. Ich sag dir jetzt mal was, du Schnorrerin: Benjy ist ein toller Mensch. Ihn konntest du mit deinem Kleinmädchengehabe vielleicht beeindrucken, mich aber nicht. Ich habe dich gleich durchschaut. Benjy hat was Besseres verdient. Also verschwinde, bevor du alles nur noch schlimmer machst.“
„Moment mal, was?“ Melli überging Heathers Schimpftirade. „Benjamin ist im Krankenhaus? Hatte er einen Unfall?“ Melli überlief es eiskalt. „Was ist passiert?“
Heather ließ sie warten. Sie schniefte mehrmals und putzte sich ausgiebig die Nase. Dann sah sie trotzig auf. „Sag du es mir“, forderte sie. „Ihr seid doch zusammen zum Mauritius Beach gefahren und habt euch nach dem Festival in die Scheune verzogen.“
Aus den Anschuldigungen wurde Melli nicht schlau. „Ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Wir sind gemeinsam zum Strand und ab da dann getrennte Wege gegangen.“ Den Streit verschwieg sie. Dass seine Stimmung umgeschlagen war und seine schlechte Laune Melli veranlasst hatte, das Twilight-Festival allein zu erkunden, spielte keine Rolle. Oder doch?
„Nette Ausrede. Wirst du das so auch vor der Polizei aussagen?“
Diese Provokation ließ Melli nach Luft schnappen. „Heather, jetzt sag mir endlich, was passiert ist! Wieso ist Benjamin im Krankenhaus? Und wieso muss ich vor der Polizei aussagen?“
Nachdem Heather ein weiteres Mal geräuschvoll die Nase geputzt hatte, stand sie auf. „Er ist im Krankenhaus, weil er gestern Nacht versucht hat, sich umzubringen. Er hat überlebt. Abgesehen von Würgemalen am Hals und ein paar Schürfwunden, ist er okay. Der Arzt sagte, dass er Glück im Unglück hatte. Benjy sieht das womöglich anders.“
Melli krallte sich am Tresen fest, um nicht zusammenzubrechen. „Aber wieso? Wieso hat er das getan?“
„Woher soll ich das denn wissen? Ich habe keine Ahnung, wieso er sein Leben plötzlich so scheiße findet, dass er es beenden will.“
„Wo ist er jetzt?“
Ich muss unbedingt mit ihm reden! Ist unser Ausflug nach Marahií daran schuld? Oder hat die seltsame Gestalt, die gestern aus dem Meer an den Strand kam, etwas damit zu tun?
„Sag mir lieber, was da zwischen euch läuft. Hast du ihm einen Korb gegeben? War er frustriert, weil du ihn abserviert hast?“
Melli holte tief Luft. Sie musste sich konzentrieren, um nicht ausfallend zu werden. Ihr die Schuld an Benjamins Suizidversuch in die Schuhe zu schieben war unverschämt. Oder hing das alles doch mit ihr zusammen? „Es läuft nichts zwischen Benjamin und mir.“
Heather baute sich vor ihr auf. „Erzähl das dem Officer. Nur dass du es weißt: Ich habe es der Polizei gestern zu Protokoll gegeben. Die Cops haben in der Shack alle befragt, nachdem Benjy ins Krankenhaus gebracht worden war. Die Befragung war angeblich reine Routine, wie üblich bei versuchtem Suizid, aber das nehme ich denen nicht ab. Da steckt mehr dahinter.“
Das glaube ich allerdings auch. Mist!
„Ich muss zu ihm. In welches Krankenhaus haben sie ihn gebracht?“
„Lass ihn in Ruhe“, zischte Heather. Die roten Flecken auf ihren Wangen kamen nicht nur vom Heulen. „Jeder hat gemerkt, dass Benjy ganz neben der Spur war, seitdem er dich in Perth aufgegabelt hat. Wir haben doch alle gesehen, wie du ihm den Kopf verdreht hast. Er hat es nicht verdient, dass du ihn so eiskalt abservierst. Benjy ist ein empfindsamer Mann, sensibler als er sich nach außen gibt.“
„Ich habe ihn nicht …“
„Dass du dich überhaupt in die Shack zurücktraust, du Bitch. Weißt du, was ich denke? Dass du ihn so fertiggemacht hast, dass er sich nach eurer letzten Nacht in der Scheune aufgehängt hat und …“
„Stopp!“ Melli haute auf den Tresen. „Erstens: Es lief nichts zwischen Benjamin und mir, und ich habe ihn auch nie abgewiesen. Zweitens: Ich bin gestern nach dem Festival nicht mit ihm zurückgekommen, sondern auf das Boot eines Freundes gegangen. Ich war seit gestern Nachmittag nicht mehr hier.“
Heathers Gesicht wurde krebsrot. „Lügnerin!“, schrie sie. „Ich glaube dir kein Wort. Ich habe gleich geahnt, dass das mit Benjy und dir mies ausgehen wird.“
Melli schloss die Augen und atmete ein paar Mal bewusst ein und aus. Sie ignorierte die Wut, die mit Heathers erfundenen Vorwürfen aufgekommen war, und konzentrierte sich auf Wichtigeres. „Wo finde ich ihn jetzt?“
„Im Connelly Hospital. Aber du kannst es dir sparen, hinzufahren. Sie lassen dich ohnehin nicht zu ihm durch. Und selbst wenn, wird er bestimmt … hoffentlich nicht mit dir reden wollen. Nach allem, was du ihm angetan hast.“
Melli ging, drehte sich in der Tür jedoch erneut zu Heather um. „Eins noch: Wie kommst du eigentlich darauf, dass ich die Nacht mit Benjamin verbracht habe?“
Statt zu antworten, nahm Heather etwas aus dem Regal und knallte es auf den Tresen. „Deshalb.“
Melli seufzte. Natürlich, ihr Rucksack. Tamati hatte ja gesagt, dass Benjamin ihn mitgenommen hatte.
„Der lag neben Benjy in der Scheune. Der gehört dir, oder?“
„Ja, tut er.“ Melli griff danach, doch Heather schlug mit der Hand darauf. „Was lief da zwischen euch beiden?“, fragte sie und schniefte. Ihre Stimmung hatte sich merkbar verändert.
Sie ist eifersüchtig. Vermutlich verdächtigt sie mich deshalb.
Die ganze Situation war verfahren, und nur Benjamin konnte Antworten liefern.
„Bitte glaub mir, Benjamin und ich sind bloß Freunde. Ich wäre hier nie eingezogen, aber seine Mutter hat uns praktisch dazu genötigt.“
Heather schnaubte und verschränkte die Arme vor dem Körper. Ihr Blick fiel auf Mellis Anhänger, den Ningyo-Opal, und verweilte dort. Automatisch griff Melli an den Stein und drehte ihn zwischen den Fingern. Die Berührung gab ihr Kraft. „Falls es dich beruhigt: Ich habe einen festen Freund. Und mit dem habe ich die Nacht verbracht.“
Heather setzte sich zurück auf ihren Stuhl und ließ Kopf und Schultern hängen. „Und dein Rucksack? Wie kam der in die Scheune?“
„Ich habe ihn am Strand verloren.“ Das war nicht einmal gelogen. „Benjamin muss ihn gefunden und mitgenommen haben.“
Heather legte wieder die Hände vors Gesicht und seufzte. „Tut mir leid. Wegen dem ‚Bitch‘ und überhaupt. Ich bin total durcheinander wegen der ganzen Sache. Ich dachte nur … Ich wusste ja nicht, dass du einen Freund hast. Benjy hat sich in letzter Zeit so komisch benommen. Klar, wir hatten jede Menge Stress wegen der Umbaumaßnahmen. Aber deshalb bringt man sich doch nicht gleich um. Warum hat er dermaßen überreagiert? Ich verstehe es einfach nicht! Ich mache mir echt Sorgen um ihn. Es muss etwas Schlimmes vorgefallen sein. So was macht man doch nicht ohne Grund. Ich zerbrech mir schon die ganze Zeit den Schädel darüber, was das sein könnte. Verdammt, ich fühle mich so hilflos. Ich dachte immer, er würde mir vertrauen, wir wären gute Freunde. Er wusste doch, dass er mit mir über alles reden kann. Ich hätte niemals gedacht, dass Benjy irgendwann mal Selbstmord begehen könnte. Er ist immer so lebenslustig. So feinfühlig, liebenswürdig, ein toller Kumpel und Boss eben. Ich will ihn doch nicht verlieren.“
„Das will keiner von uns.“ Heathers Schluchzen rührte Melli. Trug sie eine Teilschuld an Benjamins Verzweiflungstat? Sie hätte nach ihrer Reise ins Königreich bei ihm bleiben und hartnäckig nachfragen sollen, statt sich auf Tamatis Katamaran zu flüchten. Glücklicherweise hatte Benjamin überlebt, und dieses Mal würde sie sich nicht von ihm abweisen lassen. Sie würde so lange fragen, bis er ihr Antworten lieferte.
Ein lautes Klopfen an der Tür ließ sie beide herumfahren. Ein junger Mann, den Melli schon öfter in der Oyster Shack gesehen hatte, trat ein.
„Hey, Heather.“ Er stockte, als er seine verheulte Kollegin sah.
Melli nutzte sein Kommen, um sich zu verabschieden. „Ich muss leider gehen. Kannst du dich bitte um sie kümmern? Sie hat mir eben das von Benjamin erzählt. Ich will so schnell wie möglich zu ihm.“
„Klar“, antwortete der Mann. Er trat hinter den Tresen und schloss seine Kollegin in die Arme. „Geh ruhig“, forderte er Melli auf. „Das wird schon wieder.“
„Danke.“
Melli verließ die Rezeption mit gemischten Gefühlen. Einiges, was Heather ihr an den Kopf geworfen hatte, war Blödsinn. Aber war möglicherweise etwas daran, dass Benjamin sie mochte? Die widersprüchlichen Signale, die er ausgesendet hatte, reichten von verhaltener Sympathie zu offener Abneigung. Was sich Heather da zusammengereimt hatte, basierte alleine auf ihrer Eifersucht. Benjamin war niemals in Melli verliebt. Spätestens in Marahií waren seine Gefühle für sie in Hass umgeschlagen. Dass er etwas für sie empfand, war ausgeschlossen. Oder etwa nicht?
Fügung
Die Bushaltestelle lag direkt an der Straße vor der Oyster Shack. Während Melli auf den nächsten Bus wartete, rief sie Tamati an. Sie berichtete ihm, was passiert war, und versprach, sich gleich nach dem Krankenbesuch zu melden.
Ein Auto fuhr vom Backpacker-Parkplatz und steuerte auf den Kreisverkehr zu. Der Fahrer setzte den Blinker und bog auf die Hauptstraße ein. Als er auf Mellis Höhe war, ruckte der Kopf der Beifahrerin plötzlich herum. Sie wirkte aufgeregt und gestikulierte hektisch. Dann war das Auto an Melli vorbei. Schnell zog sie die Kappe tiefer. Wer waren die beiden? War ihre Tarnung aufgeflogen? Ein paar Meter weiter kam der Wagen zum Stehen. Das Getriebe knirschte laut, als der Fahrer den Rückwärtsgang einlegte, zurückfuhr und vor Melli abbremste. Die Autoscheibe glitt herunter.
Weglaufen wäre jetzt kindisch. Solange sie im Auto bleiben, kann ja nichts passieren.
„Entschuldige bitte, bist du Melanie Braun?“, rief der Fahrer ihr zu.
Melli erkannte den rothaarigen Mann, der annähernd so alt war wie sie, nicht am Aussehen, sondern vielmehr an seiner Stimme. „Cassia?“
Auf seinem Gesicht erschien ein Lachen. „Oder Korohuú, je nachdem.“
Seine Beifahrerin winkte ihr zu. „Hi, Melanie!“ Ihre Haare waren so hellblond wie Mellis.
„Was für eine Überraschung, dich hier zu sehen, Melanie“, meinte Cassia. „Ich hätte dich in diesen Klamotten fast nicht erkannt. Was machst du hier?“ Seine Frage klang beiläufig.
Beide warteten lächelnd auf eine Antwort, doch Melli schwieg. Ihr schien diese Zufallsbegegnung wenig zufällig.
Cassia sah seine Begleiterin mit hochgezogenen Augenbrauen an. „Wir wohnen hier in der Oyster Shack und wollen in die Stadt, um ein paar Besorgungen zu machen. Ein bisschen Wein, Brot und Krams. Und zur Pharmacy, um Medikamente für meinen Dad zu kaufen. Wir haben ihn vorerst in unserem Zimmer zwischengelagert. Ein Flug nach Hause wäre gestern nicht mehr infrage gekommen“, meinte er. „Können wir dich irgendwohin mitnehmen?“
Es war eine günstige Gelegenheit, sich mit ihm über die Geschehnisse in Marahií zu unterhalten. Andererseits saß da seine Beifahrerin mit im Auto. Das machte es schwierig, offen zu reden.
Aber wer nicht wagt … Vielleicht ergibt sich ja ein günstiger Augenblick zum Vier-Augen-Gespräch. Ich wüsste zu gerne, was Cassia im Thronsaal mit Vater besprochen hat. Und außerdem hält ihn seine Bekannte hoffentlich von dummen Ideen ab.
Sie musste ihre Skepsis ihm gegenüber ja nicht ablegen. Sie würde weiterhin wachsam bleiben.
„Komm schon, spar dir das Busgeld und die Fahrt in der rollenden Sauna. Wir haben eine Klimaanlage hier drin.“ Er deutete auf seine Beifahrerin. „Das ist übrigens Sasha, meine Freundin und bessere Hälfte.“
„Na, noch nicht ganz die Hälfte. Aber die bessere auf jeden Fall. Hi, Melanie.“ Sasha hob die Hand. Sie starrte Melli einen Augenblick zu lange an.
Irgendwo habe ich sie schon mal gesehen. Bloß wo?
Die Frau war ihr nicht unsympathisch, die eingehende Musterung war ihr jedoch unangenehm.
„Na, was ist? Schwitzkasten oder Kühlschrank?“, feixte Cassia.
Melli gab sich einen Ruck. „Kühlschrank“, sagte sie und stieg ein.
Nachdem sie auf der Rückbank Platz genommen und sich angeschnallt hatte, fuhr Cassia los. Während er sich über die Hitze beschwerte, tippte sie schnell eine SMS für Tamati. Dann steckte sie das Handy wieder ein und sah nach vorn.
„Achtung!“, rief sie zeitgleich mit Sasha.
Lautes Hupen ertönte, Cassia riss gerade noch rechtzeitig das Lenkrad herum. Der Wagen steuerte nach links und verfehlte den entgegenkommenden Kleinlaster nur um Zentimeter. „Shit, ich war zu weit rechts.“
Melli war auf der Rückbank in den Gurt gepresst worden. Sie richtete sich wieder auf. Ihr zitterten die Knie.
Sasha hingegen lachte. „Sorry, Melanie. Cass ist übernächtigt. Wir sind gestern kaum zum Schlafen gekommen.“
„Nicht, was du jetzt denkst“, sagte Cassia sofort. „Wir haben bloß kein Auge zutun können wegen allem. Du weißt schon …“ Als er Melli über den Rückspiegel ansah, grinste er. „Hey, kein Grund zur Sorge. Sash ist auf unserer Seite. Sie weiß sogar mehr über die Aquarií als ich.“
Melli schluckte. „Sie kennt die Aquarií?“
„Kennen wäre übertrieben, aber ich weiß vieles über sie“, antwortete Sasha und drehte sich zu ihr herum. „Aber über den angeblichen Aquaman neben mir weiß ich nichts.“
„Noch nicht, Sash! Noch nicht. Irgendwann klappt es, und dann wirst du den Mund vor Staunen nicht mehr zukriegen.“ Das Straßenschild wies nach rechts zum Stadtzentrum. Cassia setzte den Blinker. „Ich habe ihr gestern alles erzählt. Von meiner Verwandlung, dem Ausflug nach Marahií, von der unglaublichen Vielfalt da unten, von den Aquarií und den Rebellen. Ich habe ihr von allem erzählt. Schließlich ist sie Meeresbiologin und liebt den Ozean. Und hoffentlich auch mich.“
Melli schwieg und wartete gespannt auf Sashas Reaktion.
„Natürlich, du Depp. Auch wenn ich nicht alles glaube, was du mir erzählt hast.“ An Melli adressiert fuhr sie fort: „Den Beweis, dass er sich tatsächlich in einen Aquarií verwandeln kann, ist er mir gestern nämlich schuldig geblieben. Ich habe über meine Arbeit bei der SeaLiFed von den NimuAs, also von den Aquarií, erfahren. Wir haben sogar ein Exemplar im Labor.“ Sie hatte sich jetzt ganz im Sitz umgedreht.
„Was? Ihr haltet einen Aquarií im Labor gefangen?“
Furchtbar! Ein Aquarií, der in einem Aquarium eingesperrt dahinvegetiert und möglicherweise gequält wird. Das ist widerlich. Was kommt demnächst? Stecken sie uns ins Seaworld?
„Nein, nein. Keine Sorge“, meinte Sasha. „Es war ein Kadaver, der an den Strand angespült worden war. Die SeaLiFed hat ihn in einem speziellen Tank konserviert und erforscht daran die Spezies. Immerhin ist sie uns bis vor Kurzem unbekannt gewesen.“
„Ihr nehmt dort die Leiche auseinander?“ Melli bekam Gänsehaut.
Eigentlich klar, dass sie die Leiche untersucht. So einen Fund kann man als Wissenschaftlerin ja nicht ignorieren.
„Wie gesagt, das Exemplar war schon tot. Es war trotzdem eine Sensation. Wir wissen bisher nur sehr wenig von den NimuAs. Da ist so ein Fund ein echter Glücksgriff. Um die Spezies besser schützen zu können, müssen wir ihre Funktion innerhalb des Ökosystems kennenlernen. Verstehen, wie und wo sie leben, solche Details eben. Die SeaLiFed geht bei ihren Untersuchungen sehr behutsam vor. Mart achtet immer darauf, dass die Würde des weiblichen Exemplars gewahrt bleibt. Er hat ihm sogar einen Namen gegeben.“
Wieso lasst ihr sie nicht einfach in Ruhe?
Sie wusste selbst, was für ein kindischer Wunsch das war. Menschen suchten immer nach Erklärungen. Und um an Antworten zu gelangen, warfen sie sämtliche Skrupel über Bord, nebst Verstand und Respekt, und wenn es notwendig war, sogar das eigene Leben. Alles nur dem Zweck geopfert, den Sinn der Existenz zu ergründen.
Eine Aquarií im Aquarium, Leichenfledderei, NimuAs … so viele neue Informationen in so kurzer Zeit.
Melli versuchte, die Neuigkeiten einzuordnen, doch es kam ständig mehr hinzu.
„Mart, das ist Professor Martin Hennings, der Leiter der SeaLiFed in Cairns“, erklärte Cassia.
Cairns! Na klar. Dort habe ich Sasha gesehen. Ich habe mich also nicht geirrt, als ich das Wort Aquarií gehört habe. Das war sie!
„Sorry, klar. Ich hätte mich verständlicher ausdrücken sollen.“ Sasha lächelte entschuldigend.
„Hennings taufte die tote Aquarií-Dame Madison“, redete Cassia währenddessen weiter. „Sie ist wirklich sehr beeindruckend. Ich durfte sie auch schon bewundern. Allerdings ist sie kein Vergleich zu dir, Melanie. Madison hat keine Salimaárs, wie du sie trägst.“
Jetzt lächelte Sasha nicht mehr. „Weißt du, ich habe echt Probleme, das zu glauben. Er fabuliert, oder?“, fragte sie Melli.
Jetzt ist wohl der Moment der Wahrheit gekommen. Sie weiß ja, dass es die Aquarií gibt. Und Cassia weiß, dass wir uns verwandeln können. Also was bringt es, zu lügen? Er hat ihr ja ohnehin schon alles verraten.
„Nein“, antwortete sie. „Er lügt nicht. Er ist Mensch und Aquarií. So wie ich.“
Sasha sah sie lange an. „Und warum hat er sich dann nicht in einen NimuA verwandelt? Das hätte er doch müssen, wenn er ins Meer geht und nass wird, oder?“ Als Melli den Kopf schüttelte, seufzte sie. „Okay, ich war zu naiv. Ich dachte, es läuft wie bei der H2O-Serie, wo die Mädels sich in Meerjungfrauen verwandeln, sobald sie mit Wasser in Berührung kommen.“
„Hey“, schimpfte Cassia. „Wenn, dann sind wir beide naiv. Ich dachte ja auch, dass es funktioniert. Schließlich klappte es beim ersten Mal so. Ich fiel mit allen anderen ins Wasser, und plötzlich war ich ein Meermann.“
„Aber als du es mir beweisen wolltest, klappte es nicht. Es hat mich gleich misstrauisch gemacht, dass es wie in einer Kinderserie funktionieren soll. Kannst du uns verraten, wie es abläuft, Melanie? Wir verwandelst du dich zu einer Aquarií?“
Bin ich jetzt auf dem Labortisch, oder wie? Werden sie gleich zur SeaLiFed fahren und mich in einen Tank stecken, um dann ausgiebige Untersuchungen an mir vorzunehmen?
„Es ist Magie. Keine Ahnung, wie ich es anders erklären soll.“ Melli drehte unbewusst an ihrem Anhänger. Als Sasha es bemerkte, ließ sie den Stein sofort los.
„Was ist das da um deinen Hals? Dieser hübsch schimmernde Stein?“
Wieder log sie. „Das ist ein Mondstein. Ein Glücksbringer, den mir meine Eltern bei meiner Abreise geschenkt haben.“
„Dad scheint ganz scharf darauf zu sein“, meinte Cassia. „Wenn ich ihm sage, dass es bloß ein Mondstein ist, flippt er aus.“
„Dein Vater ist Chef der Aquacon, oder?“, fragte sie. „Wieso will er meinen Anhänger haben? Er kann sich doch bestimmt eine ganze Tonne Mondsteine leisten.“
Cassia lachte. „Klar kann er das. Aber er denkt, dein Juwel wäre aus Neridium.“
„Neridium?“ Melli griff erneut an den Stein.
„Ein Erz, dessen Vorkommen er bei den Aquarií vermutet. Er ist der Meinung, du könntest ihn mit dem Anhänger zu einem riesigen Neridiumvorkommen führen. Die Aquacon will dieses Erz unbedingt bergen und für die Energiegewinnung an Land nutzen. Und die SeaLiFed, für die Sash und ich arbeiten, will genau das verhindern.“
„Du arbeitest also nicht für deinen Vater und die Aquacon, sondern für deren Konkurrenz? Was sagt dein Vater dazu, dass du bei der SeaLiFed arbeitest?“ Es gelang ihr nicht, sich Frederic Palmer als toleranten, liebevollen Vater vorzustellen. Aber womöglich lag sie mit ihrer Einschätzung falsch?
Cassia nahm sich Zeit, ehe er ihre Frage beantwortete. „Nein, Dad war kein bisschen begeistert, als ich ihm von meinem Wechsel zur SeaLiFed berichtet habe. Er flippte ziemlich aus. Aber was er davon hält, ist mir egal, und das habe ich ihm auch klipp und klar zu verstehen gegeben. Ich will nicht, dass die Aquarií ausgebeutet werden. Sie müssen geschützt werden. Das will ich jetzt noch mehr als jemals zuvor. Aus den uns bekannten Gründen.“
Das klang ein bisschen wie auswendig gelernt. Sie hatte ihn in Marahií gesehen. Da hatte er wesentlich enthusiastischer gewirkt.
„Das will ich auch“, meinte sie. „Ich will, dass mein Volk in Frieden gelassen wird und nicht in Tanks landet. Und wenn uns die Aquacon das Sangua-Ahár wegnimmt, verlieren wir unsere Lebensgrundlage.“
Sasha musterte sie wieder mit diesem seltsamen Blick. „Sangua-Ahár?“
Melli hatte ohnehin schon zu viel verraten. Hoffentlich war diese Frau vertrauenswürdig.
Cassia kam ihrer Antwort zuvor. „Sangua-Ahár ist bloß eine poetische Umschreibung fürs Neridium“, erklärte er Sasha. „Die NimuAs haben viele solcher blumigen Umschreibungen. Für sie ist das Zeug heilig. Sie horten es in einer Grotte und beten es an. Die DAMERA hat es erforscht, und erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass es ein hochgradig wirksamer Omikron-Strahler ist, der die sauberste Energie ever liefern könnte. Vater träumt schon von seinem neuen Konzern, Neridium Energie.“
Melli gefiel nicht, wie er ihr Volk und ihre Lebensweise beschrieb. Nur, weil die Aquarií die Natur achteten und ihr Wertschätzung entgegenbrachten, waren sie noch lange keine naiven Wilden. Es gab keinen Grund zu glauben, Menschen seien Aquariís überlegen, nur weil sie wissenschaftliche Begriffe benutzten und sich nicht ihrer Umwelt unterwarfen. Wer die nachhaltigere Überlebensstrategie hatte, stand für Melli außer Zweifel.
„Für uns Aquarií ist das Neridium nicht bloß ein Energielieferant.“ Sie betonte bewusst das „uns“. Sollten die beiden von ihr denken, was sie wollten. Sie schämte sich nicht für ihren Glauben an die Große Mutter. „Es ist auch im spirituellen Sinn wichtig. Übersetzt heißt Sangua-Ahár das Blut der Göttin. In unserer Überlieferung spendete die Große Mutter Aqua-Ahár ihren Kindern einst ihr Blut, um ihnen immerwährendes Licht und Leben zu ermöglichen. Das mag in den Ohren einer Wissenschaftlerin oder eines Wissenschaftlers vielleicht kitschig klingen, aber es erklärt letzten Endes ein bekanntes Phänomen. Die Energie, also die Magie des Sangua-Ahárs wirkt in Marahií und somit für alle Lebewesen und Pflanzen. Und egal, wie man es nennt – ob Sangua-Ahár, Neridium oder Blut der Göttin – am Ende würde der Verlust für die Aquarií immer das Gleiche bedeuten: Marahií und alles Leben dort würden sterben. Du weißt das, Cassia. Schließlich hast du Marahií gesehen. Und du hast mit dem König gesprochen. Worüber habt ihr euch eigentlich unterhalten?“
Ihre leidenschaftliche Rede hatte die beiden zum Schweigen gebracht. Leider blieb Cassia ihr die Antwort schuldig.
Okay, das sagt ja auch einiges.
„Entschuldige bitte, wenn ich jetzt so brachial vom Thema ablenke“, sagte Cassia nach einer Weile. „Wo willst du überhaupt hin?“ Er ließ den Wagen vor einer großen Kreuzung ausrollen und stoppte an der roten Ampel.
Dann schauen wir doch mal, wie er darauf reagiert. „Zum Connelly Hospital. Ich will Benjamin besuchen.“
Cassia wirbelte herum. „Was? Wieso sagst du das erst jetzt? Wieso ist er im Krankenhaus?“ Seine Überraschung wirkte authentisch.
„Schau nach vorn, Cass“, rügte Sasha. „Es wird grün.“
Hinter ihnen ertönte ein Hupen. Cassia gab Gas.
„Man hat ihn heute Morgen in einer Scheune gefunden. Angeblich hat er versucht, sich umzubringen, aber er hat zum Glück überlebt. Er wurde ins Connelly Hospital gebracht.“ Melli beobachtete ihn genau. Seine Hände krampften sich nervös ums Lenkrad.
„Scheiße!“ Sein Fluch fasste die Situation perfekt zusammen. Er sah zu seiner Freundin. „Wir müssen mitgehen, Sash. Ich muss wissen, was passiert ist. Und warum er das, verdammt noch mal, gemacht hat.“
So wie es aussieht, warst wenigstens du nicht daran beteiligt.
„Ist das eine gute Idee?“, fragte Sasha. „Wir haben andere Pläne, schon vergessen?“
„Die müssen warten.“
„Ach so? Können sie das plötzlich? Mart erwartet aber unseren Bericht, das weißt du genau.“ Sie sah ihn auf eine seltsame Weise an. „Du kennst diesen Benjamin doch gar nicht.“
„Natürlich kenne ich ihn“, widersprach Cassia hitzig. „Pahaluú ist mein Bruder! Nein, Sash. Mart muss warten. Das hier ist jetzt wichtiger.“
„Aha, dein Bruder also.“ Sasha zuckte mit den Schultern. „Okay, wie du meinst. Dann macht ihr mal. Ich halte mich raus. Und um ehrlich zu sein: Langsam verliere ich den Überblick, was dir wichtig ist und was nicht.“
Momentaufnahme
Womöglich wurde ein vertrauliches Gespräch mit Benjamin durch Cassias Anwesenheit schwieriger, aber nachdem Melli voreilig geplappert hatte, musste sie seine Begleitung zwangsläufig akzeptieren.
Selbst schuld!
Kurz bevor sie den Krankenhausparkplatz erreichten, schickte Melli Tamati eine SMS, um ihn auf den neusten Stand zu bringen. Ein paar Sekunden später kam seine Antwort:
Vielleicht eine gute Gelegenheit, auch mit Cassia ins Gespräch zu kommen? Aber kann man seiner Freundin trauen?
Melli tippte die Antwort:
Ja, vielleicht. Und was sie betrifft: Ich hoffe es. Bin mir aber nicht so sicher.
Sie steckte ihr Handy zurück in die Tasche.
Cassia schaltete den Motor aus. „Wir sind da. Wartest du hier, Sash? Wenn wir zu dritt reingehen, wimmeln sie uns bestimmt gleich wieder ab.“
„Okay“, sagte seine Freundin sofort. „Ich telefoniere derweilen mit Mart.“
Der konspirative Blickwechsel der beiden gefiel Melli nicht. Ihr mulmiges Gefühl wuchs.
„Dann los.“ Cassia stieg aus und Melli folgte ihm.
Zu ihrem Erstaunen gab man ihnen an der Pforte bereitwillig Auskunft, und sie wurden in den zweiten Stock geschickt. Melli klopfte leise und öffnete dann die Zimmertür. Benjamin saß aufrecht auf seinem Bett, sah fern und drehte nicht einmal den Kopf, als sie eintraten.
„Hallo, Benjamin“, grüßte Melli und blieb unschlüssig stehen.
„Hey, Pahaluú.“ Cassia war weniger zurückhaltend. „Was machst du denn für krasse Sachen?“ Seine forsche Begrüßung würde Benjamin ganz sicher nicht zum Reden animieren, aber immerhin provozierte sie seine Aufmerksamkeit.
„Was wollt ihr hier?“, blaffte Benjamin. „Lasst mich in Ruhe.“
„Wir wollten nur nach dir schauen und hören, wie es dir geht“, meinte Melli.
Verständlich, dass er sauer ist. Hoffentlich begreift er, dass ich ihm helfen will.
„Wie soll es mir schon gehen? Nach allem.“
„Stimmt. Mann, ja“, sagte Cassia. „Da ist echt viel passiert. Ist auch für mich schwer zu verdauen. Aber musstest du gleich …? Ich meine, echt jetzt? Selbstmord?“ Cassia machte eine ausschweifende Handbewegung. „Du wolltest an Land dein Leben leben und nie wieder zurückkommen, erinnerst du dich? Und dann das? Es zwingt dich ja keiner, zurückzugehen.“
Benjamin starrte erst ihn, dann Melli böse an. „Ihr denkt, wir können das, was Teil von uns ist, ignorieren und so tun, als wäre nie etwas passiert? Dann seid ihr Träumer. Es wird nie wieder so sein wie vorher. Ich werde nicht so weiterleben können wie zuvor. Dafür werden sie schon sorgen.“
Melli wurde hellhörig. „Wen meinst du mit ‚sie‘?“
Benjamin lachte kehlig. „Alle. Die Königstreuen, die Rebellen, ihre Helfershelfer hier an Land. Ihr beiden auch. Und ich. Unser altes Leben existiert nicht mehr. Es endete in dem Moment, in dem wir uns in jemand anderen verwandelt haben.“
Melli blieb misstrauisch. „Das hört sich für mich so an, als würde dich jemand bedrohen.“
Doch Benjamin ignorierte sie. „Lasst mich endlich in Ruhe. Geht wieder nach Hause. Hier gibt es nichts mehr zu sehen oder zu hören.“ Er wendete sich dem Fernseher zu.
„Weiß Dawn eigentlich schon davon?“, fragte Melli, in der Hoffnung, ihn mit dem Themenwechsel gesprächig zu halten.
Benjamins Kopf ruckte herum. Seine Augen verengten sich. „Du wirst sie nicht anrufen! Wenn ich rauskriege, dass du ihr auch nur ein Wort davon erzählst, dann reiße ich dir die Zunge raus, kapiert?“
Melli zuckte zurück. „Verstanden. Ich werde deiner Mum nichts sagen.“ Sie hätte ihm dieses aggressive Verhalten niemals zugetraut, doch sie konnte es nachvollziehen und nahm es ihm nicht übel.
„Du solltest deiner Mum aber schon Bescheid geben, dass du im Krankenhaus liegst, Bro.“ Cassia legte ihm eine Hand auf die Schulter.
Benjamin wischte sie unwirsch weg. „Nimm die Finger runter und erspar mir das dämliche ‚Bro‘. Wir sind keine Brüder.“
Ein leises Klopfen an der Tür unterbrach sie. Eine Krankenschwester trat ein und grüßte freundlich. „Darf ich Sie bitten, das Zimmer zu verlassen? Gleich ist Visite.“
„Die beiden wollten ohnehin gerade gehen“, sagte Benjamin.
Die Krankenschwester nickte. „Aber verabschieden können Sie sich schon noch. Der Arzt ist erst im Zimmer nebenan“, meinte sie und ging.
Melli wollte es ein letztes Mal versuchen. „Benjamin, bitte. Wen hast du vorhin gemeint? Wer wird dafür sorgen, dass du nicht mehr so wie früher weiterleben kannst?“
„Das sagte ich doch bereits: alle! Sie werden ihre Pläne stur weiterverfolgen, um ihre Ziele zu erreichen. Die Königstreuen setzen sich dafür ein, dass alles beim Alten bleibt. Die Rebellen dafür, dass sich alles ändert. Pro oder Kontra. Dazwischen gibt es nichts. Und wer sich für etwas anderes entscheidet oder ihnen in die Quere kommt, wird beseitigt.“
„König Tiraboroó würde niemals verlangen, dass du zurückkehrst oder Partei ergreifst“, behauptete Melli. „Und dein Vater Eldeboroó kann dich genauso wenig dazu zwingen.“
„Dein Bruder aber schon.“
„Tachimaál?“ Melli glaubte, sich verhört zu haben.
Er funkelte sie böse an. Seine offene Feindseligkeit tat weh.
In diesem Moment klopfte es erneut, und ein Arzt trat mit einem Gefolge aus Assistenten und Krankenschwestern herein. „Darf ich Sie jetzt bitten, das Zimmer zu verlassen und draußen im Gang zu warten?“, fragte er.
„Natürlich.“ Cassia wollte Mellis Arm ergreifen, doch Benjamin war schneller.
„Melli! Pass auf dich auf. Vertraue niemandem! Vor allem nicht Tachimaál.“
Sein abrupter Stimmungswechsel war genauso verwirrend wie seine Warnung. „Jetzt verschwindet endlich!“, herrschte er sie an. „Und kommt nie wieder.“
Sie verließen schweigend das Krankenhaus und steuerten auf den Parkplatz zu. Cassias Freundin stand neben dem Auto und telefonierte. Sie sah auf, wendete sich unvermittelt ab und beendete hektisch das Telefongespräch. „Und?“ Sasha küsste Cassia flüchtig. „Wie gehts dem Kranken?“
„Um es mit der Floskel zu sagen: Den Umständen entsprechend gut. Zumindest lebt er und hatte so viel Energie, uns aus dem Zimmer zu werfen.“ Er öffnete die Fahrertür. „Mann, der war auf hundertachtzig. Und besonders freundlich war er zu dir auch nicht, Melanie. Ich dachte, ihr seid Freunde. Und dann diese Androhung, dir die Zunge rauszureißen. Puh.“
„Mal ehrlich, was habt ihr erwartet?“ Sasha zog die Beifahrertür auf. „Dass er nur darauf gewartet hat, euch zu sehen, und sich jetzt an eurer Schulter ausheulen will? In so einer Angelegenheit macht man das bestenfalls bei seinen engen Freunden, nicht aber bei Fremden. Vermutlich würde er nicht mal seiner Mutter beichten, was los war.“
„Ich dachte, weil wir doch … Ach, vergiss es.“ Cassia winkte ab.
„Grüße übrigens von Mart. Er freut sich schon auf die Neuigkeiten.“ Beide sahen zu Melli herüber, die unschlüssig vor dem Auto stand.
„Steig ein, Melanie“, meinte Cassia und nickte auffordernd zum Wagen. „Fahren wir zurück zur Oyster Shack. Dort können wir uns in den Schatten setzen und über alte Zeiten quatschen.“
„Super Idee“, meinte Sasha und grinste. „Ich steuer die Kaltgetränke und Kekse bei.“
„Wolltet ihr nicht etwas in der Stadt erledigen?“, fragte Melli. Sie würde sich nicht noch einmal zu ihnen ins Auto setzen. „Danke, aber ich nehme den Bus. Wenn ich schon mal hier bin, gehe ich gleich zur Post. Ein paar Souvenirs brauche ich auch noch. Wir können uns ja später zusammensetzen.“
„Dann kommen wir einfach mit in die Stadt. Oder was meinst du, Cass? Ich liebe es, im Urlaub unnützes Zeug zu kaufen.“
Sashas Vorschlag bestätigte Mellis Vorbehalte. „Lieb gemeint“, wiegelte sie ab. „Aber ich gehe lieber allein.“ Hoffentlich würden sie es dabei belassen.
„Wie du meinst. Aber wir sehen uns später, okay?“, fragte Cassia.
„Cass …?“
„Sagen wir um acht?“ Er ignorierte Sashas Einwurf. „Bis dahin haben wir meinen Dad in den Flieger gesetzt und Proviant für ein Barbecue aufgetrieben.“
„In Ordnung“, antwortete Melli. „Um acht dann.“
Sie sah dem Auto hinterher. Melli hatte immer mehr das Gefühl, dass die beiden nicht mit offenen Karten spielten. Wenn Cassia über „alte Zeiten quatschen“ wollte, dann nur im Beisein von Tamati. Melli konnte es an keiner konkreten Sache festmachen, warum sie Cassia und vor allem Sasha nicht traute, aber von jetzt an würde sie vorsichtiger sein. Sie brauchte nicht auch noch die SeaLiFed als Gegner. Wer sagte denn, dass diese Organisation ehrlicher war als die Aquacon? Nach außen hin präsentierten sich schließlich alle anständig.
Melli war weder nach Shopping noch nach Stadttrubel zumute. Sie suchte nach Hinweisschildern, die den Weg zum Strand wiesen, und informierte Tamati über ihre Rückkehr. Er versprach, ihr mit dem Dinghy entgegenzufahren und sie aufzusammeln. Als sie sein kleines Beiboot endlich auf den Wellen entdeckte, winkte sie. Sie zog ihre Sandalen aus und stelzte ihm im seichten Wasser entgegen.
„Hey-ho, Cuty“, grüßte Tamati und reichte ihr die Hand, um ihr beim Einsteigen zu helfen.
Melli war froh, wieder bei ihm zu sein. In seiner Nähe fühlte sie sich sicher.
„Du siehst nicht glücklich aus.“ Er hing unentschlossen am Motor. Dann stand er auf. Seine Bewegung brachte das Dinghy zum Schaukeln. Melli musste sich an der Reling festhalten, Tamati hingegen lief in völligem Gleichgewicht zu ihr, nahm neben ihr Platz und schloss sie in die Arme. „Was ist los? Bist du traurig wegen Benjamin?“
„Klar. Und wegen Cassia. Und überhaupt.“ Die Ernüchterung saß tief. Vermutlich hatte sie zu viel Hoffnung in ein Gespräch mit Benjamin – und Cassia – gesetzt. „Benjamin wollte nicht mit mir reden. Und ich glaube, er hätte sich auch dann geweigert, wenn ich allein gekommen wäre, so abweisend, wie er war. Und bei Cassia und seiner Freundin Sasha habe ich das blöde Gefühl, dass sie etwas vorhaben. Sasha ist zwar höflich und nett, verhält sich aber merkwürdig. Sie taxiert mich immer, als würde sie auf etwas warten.“
„Klingt ein bisschen übertrieben, findest du nicht?“ Tamati kraulte ihr den Nacken, was Melli angenehm, zugleich aber unangebracht fand.
„Ja, schon. Trotzdem wollte ich lieber nicht mehr mit ihnen zurück zur Oyster Shack fahren. Stell dir vor, Cassia und seine Freundin wohnen ausgerechnet in Benjamins Motel! Das ist doch kein Zufall, oder? Ich kann ihnen also nicht aus dem Weg gehen. Ich muss zumindest noch einmal in die Shack, um meine Sachen aus dem Zimmer zu holen.“
„Das kriegen wir schon irgendwie hin“, meinte Tamati, drückte sie ein letztes Mal und balancierte zurück zum Motor. „Jetzt bringe ich dich erst einmal in Sicherheit. Hast du Hunger?“
Melli hatte ein üppiges Frühstück ausfallen lassen, um möglichst schnell zu Benjamin zu kommen. „Und wie!“, antwortete sie.
„Gut. Ich habe nämlich einen leckeren Fang gemacht. Der kommt jetzt auf den Grill. Und in der Zwischenzeit können wir einen Salat zubereiten.“
„Ich verrate dir etwas“, meinte sie. „Ich esse gelegentlich auch Fisch. Aber sag es keinem. Offiziell bin ich Vegetarierin.“
„Aye.“ Er blinzelte ihr zu und die Fältchen tanzten um seine Augen. „Ich verrate es niemandem. Vielleicht fällt es dir einfacher, entgegen deiner ethischen Überzeugung Fisch zu essen, wenn ich dir verrate, dass ich ihn gar nicht geangelt habe, sondern er mir praktisch freiwillig vor die Füße gesprungen ist? Im Ernst, du musst nicht mitessen, bist aber herzlich dazu eingeladen. So frisch bekommt man einen Red Snapper selten auf den Teller.“
Den Mittag verbrachten sie an Bord der Coral Sea Bride. Sie schnorchelten ein wenig im Meer und entspannten dann an Deck in der Sonne. Am späten Nachmittag ging Tamati an Land, um Getränke und frische Lebensmittel einzukaufen und in der Oyster Shack Mellis Sachen zu holen. Er plante eine Stunde ein, die Melli allein an Bord bleiben wollte.
Als Tamati ins Dinghy stieg und davonfuhr, rief sie bei Heather in der Rezeption an und gab Bescheid, dass ein Freund vorbeikommen und ihren Backpack mitnehmen würde.
„Wie geht es Benjy?“, fragte die Rezeptionistin. „Geht es ihm besser?“
„Soweit ich es einschätzen kann, ja“, antwortete sie. „Er sah ein bisschen mitgenommen aus, aber ansonsten schien er okay.“
Aber was seine Gefühlswelt angeht, bezweifel ich, dass da alles okay ist.
„Ich werde heute Abend mal bei ihm vorbeischauen“, meinte Heather. „Um acht Uhr schließe ich das Büro. Sollen mich die Leute eben auf dem Handy anrufen, wenn was ist. Die nerven ohnehin schon den ganzen Tag. Vorhin kam jemand rein, der wollte allen Ernstes wissen, ob ich Antibiotika dahätte. Sein Dad hätte sich eine Grippe eingefangen. Ist ja nicht so, als wäre es verboten, ohne Anfrage weitere Leute im Zimmer einzuquartieren. Und überhaupt, was denken die sich? Wir sind weder eine Apotheke noch ein Krankenhaus. Ich habe denen klipp und deutlich gesagt, dass sie ihren Alten sofort woanders einquartieren sollen. In einem anderen Motel oder gleich beim Bestatter. Mir doch egal! Für eine schmarotzende Bazillenschleuder ist in der Oyster Shack kein Platz. Und für Gäste, die ihr Zimmer illegalerweise untervermieten auch nicht. Echt, die haben sie doch nicht mehr alle. Für so jemanden verschwende ich meine Zeit, oder was? Nein, also ab acht, vielleicht schon um sieben, bin ich hier raus. Benjy geht vor.“
Heather hatte offensichtlich Redebedarf. Doch bevor sie weitersprechen konnte, unterbrach Melli den nächsten Wortschwall. „Er freut sich bestimmt, dich zu sehen. Aber wunder dich nicht, wenn er etwas komisch ist.“
Doch Heather ignorierte sie. „Hat er gesagt, ob er irgendwas braucht? Handy, Klamotten, Zahnbürste? Er hat ja gar nichts dabei.“
„Keine Ahnung“, antwortete Melli. „Ruf ihn doch vorher einfach mal an. Ich habe ein Telefon auf dem Tisch neben seinem Bett stehen sehen. An der Pforte stellen sie dich bestimmt gerne zu ihm durch. Die sind da sehr freundlich. Er liegt übrigens im zweiten Stock, Zimmer 230.“
„Okay. Ich muss weiterarbeiten“, sagte Heather und legte einfach auf.
Da Melli immer noch genügend Zeit hatte, tippte sie eine Nachricht für Emma. Eine Rückmeldung erwartete sie nicht. Ihre beste Freundin hatte einen Job und oft Nachtschicht. Und die fing um sechs Uhr abends an. Statt also auf Emmas Antwort zu warten, rief Melli bei ihren Eltern an. Suza meldete sich nach dem dritten Klingeln. Melli schwankte zwischen Freude und Unzufriedenheit, wie immer, wenn sie die Stimme ihrer Mutter hörte. Einerseits freute sie sich, mit Zuhause zu telefonieren, denn hier gab es Menschen, die sie liebte und auf die sie vertrauen konnte. Andererseits hingen die bisherigen Geschehnisse und die daraus resultierenden Fragen wie eine drohende Gewitterwolke zwischen ihnen. Allem voran die Ungewissheit, ob ihre Adoptiveltern Suza und Henry etwas von den Aquarií wussten, und wenn ja, warum sie ihr nie von der wirklichen Bedeutung des Ningyo-Opals und den Meermenschen erzählt hatten. Sie hätte Suza fragen können, aber sie direkt darauf anzusprechen war übers Telefon schwierig. Das alles vergiftete die ehemals innige Beziehung zu ihren Eltern.
Dennoch war das Telefonat herzlich, wenn auch belanglos, und es verlangte Melli jede Menge Disziplin ab. Sie konnte Suza weder von ihrem Ausflug nach Marahií noch von Benjamins Suizidversuch erzählen. Suza hätte sofort ihre Freundin Dawn in Perth anrufen und trösten wollen. Das hätte jedoch weitere Probleme provoziert. So sehr Melli sich verpflichtet fühlte, Dawn Bescheid zu geben, so wichtig war es ihr, die überanstrengte Freundschaft zu Benjamin nicht durch einen weiteren Vertrauensbruch zu belasten. Er hatte ihr verboten, Dawn zu informieren, und daran würde sie sich halten. So blieb ihr nichts anderes übrig, als ihrer Mutter wie üblich Unverfängliches zu berichten und vom Twilight-Festival und den Ausflügen ans Ningaloo Reef vorzuschwärmen.
„Und wo bist du gerade, Blenny?“, fragte Suza.
Melli hatte keine Lust auf weitere Lügengeschichten. „Momentan bin ich auf einem Katamaran und genieße das Meer und die Sonne.“ Sie musste ja nicht verraten, dass sie hier sogar wohnte.
„Oh, das klingt wundervoll. Warst du auch schon im Wasser, schnorcheln? Ach, das würde ich so gerne mal wieder.“
„Ja, heute Morgen. Ich habe dieses Mal sogar eine Meeresschildkröte gesehen.“
„Wie schön. Du, ich muss dir etwas verraten: Ich bearbeite deinen Dad schon seit deiner Abreise, dass wir doch auch nach Australien fliegen könnten. Er schiebt immer Timmi vor. Der würde in der Vorschule zu viel verpassen. Und andere angeblich wichtige Gründe, die gegen diese Reise sprechen würden. Dabei wäre doch gerade jetzt die richtige Zeit dafür. Und ich habe Dawn schon so lange nicht mehr gesehen. Du kannst ehrlich sein, Blenny! Wie fändest du es, wenn wir kämen? Wäre es dir peinlich, oder würdest du dich darüber freuen? Natürlich müsstest du nicht mit uns fahren. Du könntest weiterhin an die Orte, die du sehen möchtest, und bräuchtest auf uns keine Rücksicht zu nehmen. Aber vielleicht könnten wir eine kleine Strecke zusammen zurücklegen oder uns irgendwo treffen? Zum Beispiel in Darwin oder im Süden, in Melbourne. Sag, wie fändest du das?“
Mellis Herz klopfte. Wenn ihre Eltern hier auftauchen würden, gäbe es definitiv einiges zu klären. Auf der anderen Seite ergab sich damit endlich die Möglichkeit, ihre Eltern von Angesicht zu Angesicht nach ihrer Vergangenheit und den wahren Gründen ihrer Adoption oder nach den Aquarií zu fragen. Oder würde deren Anwesenheit alles nur noch komplizierter machen? Sie überlegte und antwortete schließlich: „Das wäre toll. Und natürlich könnten wir uns treffen. Wir müssen dann nur mal sehen, in welcher Ecke von Australien ich mich bei eurer Ankunft gerade befinde.