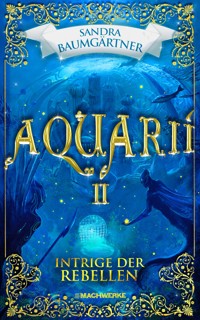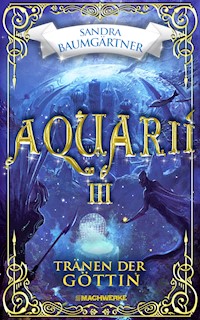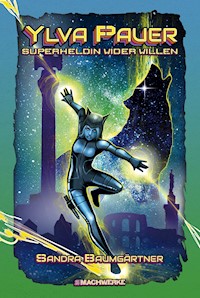3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Langsam und unaufhaltsam wie der Strom flüssigen Lavas breitete sich der dunkelrote Teppich zu meinen Füßen aus. Voller Verlangen beobachtete ich das Schauspiel, spürte die Wärme und die Energie. Der betörende Duft vernebelte mir die Sinne. Das jahrzehntelange Hadern hatte endlich ein Ende. Einen letzten Blick noch warf ich auf die grotesk verbogenen Kadaver und zog dann als unbarmherziger Todesengel meiner Bestimmung entgegen. Die die düstere Wahrheit über Seraphims Vergangenheit liegt tief unter einem maroden Bahnhof im Ruwertal verborgen. Getrieben vom Wunsch, endlich alles über ihre Erschaffung zu erfahren, suchen Seraphim und Leander nach den alten Aufzeichnungen von Ludwig tom Brook und begeben sich damit in ein riskantes Abenteuer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Seraphim: VERITAS OBSCURA
Band 3 der Seraphim:Vampirsaga
Sandra Baumgärtner
2. Auflage, 2017
© 2017, Sandra Baumgärtner
(1. Auflage im Verlag Kleine Schritte, 2014)
Herstellung&Satz: MACHWERKE Verlag, Trier
Covergestaltung: FANTASIO www.fantasio.info
ISBN 978-3-947361-02-1
Alle Rechte vorbehalten.
Sämtliche Inhalte, Fotos und Grafiken dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen ohne vorherige Genehmigung weder ganz noch auszugsweise kopiert, verändert, vervielfältigt oder
veröffentlicht werden.
MACHWERKE Verlag, Trier
www.machwerke-verlag.de
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.
Die im Text genannten Personen, egal ob lebendig, tot oder untot, sind allesamt frei erfunden. Dies gilt auch für Zeitungsartikel, Mails und Nachrichten jeglicher Art. Sie wurden nie geschrieben oder veröffentlicht und entsprangen alleine der Fantasie einer kreativen Autorin. Einzig zur Existenz zweier Trierer Vampire kann die Autorin aus nachvollziehbaren Gründen keinerlei Auskunft geben.
1. Essen
Die verlockende Kombination aus Moschus und Geranium weckte Erinnerungen. Irgendwer musste sich die Hände mit einer parfümierten Seife gewaschen haben. Dieses Bouquet gab es bei Menschen äußerst selten, und noch seltener hielt der Duftspender auch das olfaktorisch gegebene Versprechen und beinhaltete derart köstliches Blut. Es war exklusiv und rar. Ich war bislang nur einmal in diesen Genuss gekommen und leckte mir nun unwillkürlich die Lippen. Wie lange war das her? Eine halbe Ewigkeit. Viel zu lange. Ich lächelte den Mann in Jeans und Skijacke an. Ein Augenaufschlag genügte. Er kam einen Schritt in meine Richtung und musterte mich. »Luzie?« Mit dem Mittelfinger drückte er seine Brille zurecht.
»Ja«, nickte ich und fuhr mir durch die roten Locken. »Kennst du mich denn nicht mehr?«
»Du hast dich verändert«, sagte er entschuldigend.
Ich setzte alles auf eine Karte. »Du dich aber auch. Warst du früher nicht ein bisschen fülliger?«
Seine Mundwinkel gingen nach oben.
»Du siehst gut aus«, ließ ich ihn wissen.
»Danke«, murmelte er verlegen. »Aber sag mal, was machst du hier in Worms? Studierst du nicht mehr in Australien?«
»Habe ich aufgegeben. Zuviel Sonne«, winkte ich ab. »Ich wohne jetzt in Mannheim.«
Das freute ihn. »Ah, schön. Dann sieht man sich ja vielleicht wieder öfter?« Seine Wangen wurden rot. »Ich meine ... ich wollte nicht ...«
»Schon gut«, sagte ich und legte ihm beruhigend die Hand auf den Arm. »Ich weiß, wie du’s meinst.« Ich setzte wieder mein Unschuldslächeln auf. »Hast du vielleicht Lust, mit runter an den Rhein zu gehen?«
»Äh.« Unschlüssig blickte er zuerst auf mich, dann auf die Turmuhr des Domes. Kurz vor elf Uhr nachts.
»So spät alleine spazieren zu gehen, traue ich mich nicht«, fuhr ich fort. »Ich war lange nicht mehr dort. Wir könnten doch was essen gehen und reden.«
»Na gut«, gab er nach und nickte. »Was zum Essen könnte ich auch gebrauchen.«
Ich hakte mich ungefragt bei ihm unter.
»Mein Auto steht drüben am Ludwigsplatz«, informierte er mich.
»Prima«, stimmte ich ihm zu und ließ mich willig führen. Wie ich dieses Katz und Maus Spiel liebte. Und dieses Aroma ließ mich ganz schwach werden.
»Stinke ich?«, fragte er verwirrt und prüfte selbst mit einem kurzen Sniff in Richtung Achselhöhle das vermeintliche Versagen seines Deos. Ich hatte meine Nase wohl zu nah an ihn herangedrückt.
»Kein bisschen. Eher das Gegenteil.« Ich zwang mich, nicht zu euphorisch zu klingen. »Was hast du für ein Waschmittel? Riecht gut.«
»Keine Ahnung. Ich hole meine Klamotten nur aus dem Schrank.«
Hotel Mama, dachte ich amüsiert. Wahrscheinlich wurden seine Hemden auch noch ordentlich gebügelt und gestärkt.
»Erzähl mal, wie war es in Australien?«, fragte er und gab mir so die Möglichkeit, die nächsten zehn Minuten damit zu überbrücken, von einem Kontinent zu erzählen, auf den ich selbst in tausend Jahren keinen Fuß setzen würde.
»Außerdem war es mir dort viel zu heiß«, beschwerte ich mich, als wir endlich am Ludwigsplatz angekommen waren.
»Der da. Der blaue Toyota.« Er schloss eine alte, verbeulte Karre auf. Drinnen stank es nach Brathähnchen und Zitrone. Trotzdem stieg ich ein. Sein köstlicher Blutgeruch würde den Gestank gleich überlagern.
Der Motor brauchte zwei Anläufe, ehe er in Gang kam. »Alt, aber bezahlt«, lachte er. Ich hatte immer noch keine Ahnung, wie der Typ hieß. Wieder einmal schob er sich die Brille zurecht. Ob ich sie ihm nachher abnehmen sollte? Ohne würde er wesentlich besser aussehen. Das Auge isst schließlich mit.
»Ich habe zwar noch ein anderes, aber das ist zurzeit unterwegs.«
Mit der Schuhspitze schubste ich im Fußraum eine zerknüllte Tüte zur Seite. Ich erkannte noch das aufgedruckte Bild eines knusprig-braunen Hühnchens, das mit dämlichem Grinsen den gegrillten Flügel schwang und Guten Appetit! wünschte.
»Sorry, ist von gestern«, sagte er. »Ich kam nicht dazu aufzuräumen.«
Während der Fahrt zum Rheinufer sprachen wir nicht. Ich studierte heimlich das Interieur des Wagens: Eine Christopherus-Medaille klebte auf dem Armaturenbrett und ein abgewetzter Kleinkindschuh baumelte am Spiegel. In der Beifahrertür steckte ein Zettel. »Für Papa Patrik«, stand in Kinderhandschrift darauf. In der Mittelkonsole lagen eine Reihe Münzen und jede Menge Krümel. Auf die Rückbank war ein Kindersitz montiert.
Als wir an einem großen Festplatz vorbeifuhren, hatte ich genug gesehen. »Jetzt erzähl du aber mal, Patrik«, forderte ich ihn auf. »Ich glaube, die Sonne in Downunder hat mir das Hirn verbraten. Ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern, was du so treibst?«
Er bog auf einen kleinen Parkplatz ein und schaltete den Motor aus. »Immer noch dieselbe Scheiße«, antwortete er. »Ich arbeite in der Softwareabteilung von Procotgent und kümmere mich um die PCs und den ganzen Kram.«
Ich grinste und sog ein letztes Mal sein wunderbares Aroma ein. In der kalten Nachtluft würde es mir nicht mehr so konzentriert in die Nase ziehen. Wir stiegen aus und er steuerte prompt auf eine Kneipe zu. Gerade kamen drei Typen heraus und gafften uns an.
»Lass uns bitte erst ein paar Schritte laufen, ja?«, bat ich. »Ich habe den ganzen Tag im Zug gesessen. Bestimmt habe ich schon einen platten Hintern.«
Ich lachte und drehte mich ein wenig zur Seite. Er wagte einen schnellen Blick auf meinen knappen Rock, der mehr einem breiten Gürtel glich, und wurde rot. Die Typen hinter uns lachten anzüglich, verdufteten aber glücklicherweise.
»Und sonst?«, fragte ich, zog ihn nach links vom Wirtshaus weg und hakte mich wieder bei ihm ein. »Was macht die Familie?«
»Nicht viel«, klagte er. »Bin geschieden. Mia ist nur ab und an mal bei mir. Angelina will es so.«
»Aber der Job macht dir schon noch Spaß, oder?«
Ich schien seinen wunden Punkt gefunden zu haben, denn nun begann eine Litanei über den Stress, den er hatte, über die miesen Kollegen, die ihm fürchterlich auf die Nerven gingen, und schlussendlich über seine Mutter.
»So ein Schwachsinn!« Er hatte sich in Rage geredet und schwitzte. Ich konnte kaum noch an mich halten. »Als ob eine Hochzeit unsere Beziehung gerettet hätte. Nur wegen einem Kind zu heiraten ist doch bescheuert!« Moschus stieg mir so heftig in die Nase, dass ich die Augen schloss und mich blind von ihm führen ließ. Ich hörte ihm kaum mehr zu.
»Sollen wir uns setzen?«, fragte er plötzlich. Die asphaltierte Promenade war in einen Schotterweg übergegangen. »Da vorne ist eine Bank.«
»Jaja«, antwortete ich abwesend. Die Aussicht auf ein kleines bisschen Blut ließ mich zittern. Nur ein klitzekleines Bisschen.
Er führte mich zu der Bank. Wir setzten uns und ich rückte nah an ihn heran.
»Ahhh«, tat ich erleichtert. »Herrlich ruhig hier nach all dem Trubel.«
Der Rhein floss schwer wie schwarze Lava an uns vorbei. Auf der anderen Flussseite blinkten vereinzelt Lichter.
»Da drüben ist der Zeltplatz. Weißt du noch, in der 11ten?«, erinnerte er sich.
»Hm.« Keine Ahnung was, aber ich bestätigte es ihm. Er schien zufrieden.
»Das waren Zeiten.« Er blickte sehnsüchtig zum anderen Ufer hinüber. Ich legte meinen Kopf an seine Schulter und seufzte tief.
»Fast so wie früher«, murmelte ich leise. Es dauerte ein paar Sekunden, ehe sich sein Arm um meine Schultern legte. Ich drehte meinen Kopf nur ein wenig hoch und sah direkt in seine grässliche Brille. Liebevoll stupste ich sie ihm auf die Nase hinauf und lächelte. Mein Finger verweilte ein wenig zu lange auf seiner Nasenspitze und berührte kurz seine Lippen, bevor ich die Hand zurückzog. Er zögerte. Ich half ein wenig nach. Sein Kuss war heiß und weich.
»Mensch, Luzie, bist du kalt«, wisperte er benommen, ließ es sich aber nicht nehmen, mich ein zweites Mal zu küssen. Seine nasse Zunge wagte sich tatsächlich an meine Zähne heran. Ich biss nur einmal kurz zu.
»Scheiße!«, fluchte er laut, zuckte zurück und hielt eine Hand an den Mund.
»Nein«, berichtigte ich ihn und lächelte glücklich. »Geranium, Moschus und eine Spur Bergamotte. Dein Blut hält tatsächlich, was dein Geruch verspricht.«
2. Appetit
»Erde an Seraphim. Erde an Seraphim.« Leanders dunkle Stimme katapultierte mich in die Realität zurück. Etwas benommen blickte ich mich um. Zusammen mit René und Aniko saß ich auf dem Sofa im Wohnzimmer. Alle grinsten mich an. Verflixt. Was war gerade das Thema? Essen? Ja, darüber hatten wir geredet. Über eine Möglichkeit, neue Blutspender zu finden.
»Die Idee kam uns, als wir im Urlaub waren«, sagte Aniko und überging galant meine gedankliche Abwesenheit. »Es ist wichtig, rechtzeitig Vorsorge zu treffen.«
»Wir hatten bei deinem Einzug die Konditionen für unseren bestehenden Vertrag neu ausgehandelt«, erklärte mir Leander. »Aber es erschien uns sinnvoll, einen weiteren, wichtigen Aspekt zu bedenken.«
»Ein neuer Vertragspunkt?«, erkundigte ich mich. »Davon hattest du mir nichts erzählt.«
»Nichts Gravierendes. Im Großen und Ganzen blieb ja alles wie gehabt. Ich werde René und Aniko eines Tages zu Unseresgleichen machen. Im Gegenzug stellen sie uns bis dahin ihr Blut zur Verfügung.«
»Schon klar.« So viel wusste ich bereits. »Aber was ist neu?«
Aniko sprach anstelle von Leander weiter: »Zusätzlich haben wir uns verpflichtet, für Ersatz zu sorgen. Für Notzeiten, sozusagen.«
»Ich verstehe«, nickte ich. Eine Vorsorge für den Fall, dass einer unserer beiden Blutspender ausfiele. Wir redeten hier nicht von einer kurzen Durststrecke, sondern von einem Totalausfall.
»Eine gute Idee, den Nachschub sicherzustellen, oder?«, grinste Leander. Ich konnte seinen Enthusiasmus nicht teilen, fühlte mich überrumpelt. Ein wenig kratzte es an meinem Ego, das Leander mir nicht zutraute, meine eigene Nahrung zu suchen. Gut, ich konnte es nicht wirklich. Aber wenn ich musste, dann vielleicht doch.
»Und was heißt das genau? Wollt ihr wildfremde Menschen auf der Straße ansprechen, ob sie eventuell Interesse daran hätten, Blutspender bei einem Vampir zu werden?«
»Selbstverständlich nicht, Seraphim«, entrüstete sich Aniko sofort. »Wir suchen nicht auf der Straße. So plump würden wir niemals vorgehen. Wir dachten ans Internet.«
Er rückte einige der vielen Blätter auf dem Tisch zurecht, um sie uns zu zeigen.
»Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, wie wir Leute vollkommen neutral für unsere Sache begeistern könnten. Dazu brauchen wir eine Präsentation im Netz, eine eigene Homepage«, sagte er. »Wir hatten eine Reihe von Ideen, doch letztlich kristallisierten sich diese drei Ansätze hier heraus.«
Auf dem ersten Blatt waren etliche kleine Bildchen aufgeklebt. Ein wirres Durcheinander an roten und schwarzen Linien machte die Darstellung äußerst unübersichtlich. Ich sah keinerlei Sinn in der Kritzelei, ganz im Gegensatz zu Aniko, der munter weitererklärte: »Allgemein müssen wir später die Seite natürlich mit einem Forum, einem Instant-Messenger und einem Chat ausstatten. Da haben die User die Möglichkeit, sich gegenseitig auszutauschen. So würde man im Vorfeld und ganz nebenbei ihren Charakter erkennen. Sozusagen die erste Auslese.«
»Aha.« Ich verstand nur Bahnhof.
»Sehr gut, Aniko«, lobte Leander. »Das gibt uns die Gelegenheit, selbst mit den Usern in Kontakt zu treten.«
Überrascht blickte ich zu ihm auf. Machte er Scherze? Wollte er allen Ernstes mit den Interessenten kommunizieren?.
»Gute Idee«, bestätigte Aniko und notierte sich etwas auf einen kleinen Notizblock.
Leander widmete sich einem weiteren, ebenso verwirrenden Blatt. »Und eure zweite Idee?«
Aniko hätte seine ausführlichen Erklärungen genauso gut auf Chinesisch machen können – ich verstand nur Bruchteile dessen, was er so enthusiastisch vortrug, so sehr ich auch versuchte, mich darauf zu konzentrieren. Mich plagte indessen ein ganz anderes Problem: Hunger. Ich tat mein Bestes, teilnahmsvoll auszusehen, studierte die Zeichnung auf dem Tisch und sah doch nichts.
Was wäre eigentlich in meinem Traum passiert, wenn aus dem unschuldigen Spiel mit Patrik Ernst geworden wäre? Wenn ich, statt mich zu entschuldigen, das Ganze weitergetrieben hätte? So, wie es vermutlich jeder normale Vampir getan hätte.
Wieder glaubte ich, das himmlische Aroma auf meiner Zunge zu schmecken. Ich verfluchte mich, weil ich unfähig war, einen Menschen zu töten. Das unterschied mich von den anderen Blutsaugern und machte mich zu einem abnormen Vampir, zu einem Krüppel. Nie hatte ich es geschafft, eine Jagd bis zum Ende durchzuziehen. Ich war auch nie dazu gezwungen gewesen. Meine Nahrung war mir bis vor Kurzem von meinem Erschaffer Ludwig tom Brook tot und wehrlos auf dem Silbertablett präsentiert worden. Seit ich bei Leander wohnte, kam ich in den Genuss von René und Aniko, unseren freiwilligen Blutspendern. Die beiden bedeuteten unbezahlbaren Luxus, den ich nur zu gerne in Anspruch nahm.
Lange war ich davon ausgegangen, dass mein Unvermögen ein Teil meiner Natur sei, der mich bis in alle Ewigkeit ausmachen würde. Doch in letzter Zeit verspürte ich immer öfter den Wunsch nach einer normalen Jagd, und der Gedanke ans Töten bereitete mir weniger Unbehagen. Ich träumte sogar davon, ein Opfer zu verfolgen und zu erlegen. Das Katz und Maus Spiel war die Ouvertüre, der blutige Zugriff der letzte Akt. Er schien plötzlich so einfach. Zumindest in meiner Fantasie.
Ich war sicher, heute würde ich Patrik zurückhalten, wenn er sich vorschnell verabschieden wollte. Ich sah die Szene genau vor mir:
»Du bleibst!« Ich packe ihn am Arm. »Ich sagte dir doch, ich habe Hunger!«
Er wird weiß im Gesicht, als er meine Fangzähne sieht.
»Ich muss jetzt wirklich gehen, Luzie«, versucht er abzuwiegeln. »Angelina wartet auf mich.«
»Ihr seid geschieden, schon vergessen?«
»Ja, äh, Mama wartet.« Er macht einen Schritt rückwärts, stolpert und droht hinzufallen. Ich fange ihn mühelos ab, bevor er auf den Boden knallt. Erschrocken japst er nach Luft und will losschreien, doch ich halte ihm den Mund zu.
»Schhh«, mache ich. »Es geht ganz schnell. Und es tut nicht weh.«
Patrik reißt ungläubig die Augen auf, die Brille hängt ihm schief auf der Nase. Ich achte nicht weiter darauf, ich will nur eines: Blut. Sein Kopf dreht sich fast von alleine zur Seite. Es gibt ein komisches Knirschen, dann hängt Patrik schlaff in meinem Arm. Egal, ich ruckele ihn in die richtige Position, damit der Hals freiliegt, fixiere eine gute Stelle in unmittelbarer Nähe zur Halsschlagader und beiße zu. Warm pulsiert das Blut in meinen Mund, füllt meinen Rachen wie heiße Glut. Ein unglaublicher Genuss! Ist er es nicht wert, zu töten? Ich bin eine Blutjägerin. Und ich bin ...
Diesmal riss mich das Klingeln an der Haustür aus meiner Träumerei.
»Ich gehe«, erbot sich Aniko sofort und erhob sich.
»Nicht nötig«, hielt ich ihn zurück und erntete überraschte Blicke. Es war nicht meine Aufgabe, die Haustür zu öffnen. Einfacher und unauffälliger war es, wenn sich unsere menschlichen Angestellten mit der Abfertigung von Postboten, Vertretern und anderen Menschen beschäftigten. Doch heute war ich froh über eine kleine Ablenkung.
»Macht ruhig ohne mich weiter«, schlug ich vor. »Leander kann mir später alles berichten.«
»Wir werden auf dich warten«, sagte dieser sogleich.
»Nein, lass mal. Nicht nötig. Macht weiter. Bin gleich wieder da.«
Ich huschte schnell aus dem Wohnzimmer hinaus, um einen Widerspruch zu vermeiden. Dennoch wusste ich Leanders missbilligenden Blick in meinem Rücken.
Vor der Eingangstür stand ein stämmiger Mann. Ich hatte ihn schon einmal auf dem Nachbargrundstück gesehen.
»Guten Abend.« Ich lächelte ihn freundlich an.
»Ähm.« Der Nachbar schien überrascht, mich zu sehen. Sein Blick wanderte an mir hinunter und wieder hinauf, verweilte eine Spur zu lange an meinem Ausschnitt, um anständig zu sein. Demonstrativ zupfte ich das Shirt zurecht.
»Wie kann ich Ihnen helfen?« Der Typ war mir zuwider, abgesehen von seiner Ausdünstung.
»Tja, äh«, stammelte er und kam einen Schritt näher. »Martin Korn. Ich bin Ihr Nachbar.«
Sein Blutgeruch kam mir mit seiner Hand entgegen. Ich zögerte, reichte ihm der Höflichkeit halber ebenfalls die Hand.
»Uuui«, staunte er prompt. »Ihre Hand ist ja eiskalt.«
Ich verschränkte die Arme vor meinem Ausschnitt. »Was gibt es?«, fragte ich ungehalten.
Er trat nervös von einem Fuß auf den anderen. »Mein Sohn Jonas ist heute Mittag auf Ihre Grundstücksmauer geklettert.«
»Das ist doch nichts Schlimmes.«
»Naja, er ist da hoch, weil er ein paar Fotos von Ihnen machen wollte.« Der Kerl begann zu schwitzen.
Kiefer mit einer Note Sandelholz. Fast so gut wie René, ging es mir durch den Kopf. Ich spürte meinen Hunger sehr deutlich.
»Aha«, sagte ich laut.
»Dabei hat er die Digitalkamera fallen gelassen. Deshalb wollte ich in Ihrem Garten danach suchen.« Er bemerkte meinen kritischen Blick. »Müssen Sie nicht machen«, versicherte er schnell.
»Schon gut, ich gehe. Warten Sie kurz hier.« Ich wollte die Tür schließen, doch er hielt dagegen. So viel Ehrgeiz hätte ich ihm nicht zugetraut.
»Soll ich nicht besser mitkommen?«, lechzte er und schielte neugierig ins Hausinnere.
»Nein, nein«, widersprach ich verärgert. »Ich gehe allein.«
Wieder drückte ich die Tür zu. Diesmal stellte er einen Fuß in den Spalt. Missmutig starrte ich auf den schwarzen Turnschuh. Ob ich die Tür einfach zuschlagen und seinen Fuß abhacken sollte? Eine nicht gerade feine, aber durchaus verdiente Art, mit aufdringlichen Nachbarn umzugehen. Als ich aufschaute, griente der Typ selbstgefällig. Ging es ihm überhaupt um die Digitalkamera? Oder schob er nur seinen Sohn vor, um bei uns schnüffeln zu können? Womöglich hatte er sogar selbst Fotos von uns machen wollen? Überhaupt: Heimlich Nachbarn fotografieren, was sollte das denn?
»Ich komme mit«, insistierte er frech, und versuchte die Tür aufzustoßen. Ich hielt mühelos dagegen. Ein kindisches Spiel, dennoch blieb mir nichts anderes übrig, als es um des lieben Friedens willen mitzuspielen.
»Sie warten gefälligst hier«, kommandierte ich. »Und ziehen Sie Ihren Fuß aus der Tür, bevor ich ihn abhacke.« Ich musste mich schwer zurücknehmen, was mir nicht leicht fiel. Die Amputation würde sicherlich eine ordentliche Sauerei verursachen. Bestimmt würde unsere Putzhilfe Tina eine Flasche Chlorreiniger benötigen, um die Blutflecken aus den Fugen zu entfernen. Aber vielleicht, wenn ich mich rechtzeitig bücken und den Beinstumpf erreichen würde, bevor das Blut auslief?
»Es schadet nicht, wenn ich suchen helfe!« Er wurde dreist und schob nun auch noch eine Schulter durch den Spalt, um die Tür weiter aufzudrücken. Eine Woge Sandelholzduft wehte herein.
Jetzt wurde es knifflig. Ich musste ihn schnellstmöglich und dennoch höflich abweisen. Es war nicht ratsam, Schwierigkeiten mit den Nachbarn zu provozieren, so gerne ich ihm auch wehgetan hätte.
»Wenn ich könnte, wie ich wollte«, fluchte ich.
»Auf welcher Seite stehst du eigentlich, Seraphim?«, schimpfte direkt hinter mir die kratzige Stimme meines verstorbenen Erschaffers Ludwig tom Brook.
»Was?« Ich schreckte herum, absolut sicher, dass Ludwig mit missbilligend erhobenem Zeigefinger, zusammengekniffenen Lippen und zu Schlitzen verengten Augen hinter mir stand.
»Ich fragte: Ist alles in Ordnung, Seraphim?«, erkundigte sich Aniko, der gerade aus dem Wohnzimmer in die Eingangshalle kam.
Ich brauchte ein paar Sekunden, ehe ich mich im Griff hatte.
»Ja ..., nein ...«, stammelte ich. »Unser Nachbar fragt nach seiner Digitalkamera, die sein Sohn in unserem Garten verloren haben soll.«
Ich trat einen Schritt zur Seite und ließ die Tür los, die Korn unfreundlich aufstieß. Sie prallte mit einem Knall gegen die Wand.
»Guten Abend, Herr Korn«, begrüßte ihn Aniko bemerkenswert freundlich und hielt die zitternde Tür fest. »Schön, Sie zu sehen.« Sein Gleichmut und die Beherrschung ob des rüden Verhaltens unseres Nachbarn waren bewundernswert. »Wie geht es Ihrer Frau? Hat sie sich von dem Sturz erholt?«
»Der Gips kommt Ende der Woche ab«, antwortete der Nachbar knapp. Er war über Anikos Erscheinen alles andere als erfreut. Nun blockierte ihm noch jemand den Weg und die Sicht ins Haus. »Die Schienen bleiben weiter drin. So lange kann sie nicht arbeiten.«
Aniko nickte mitfühlend und meinte beiläufig zu mir: »Gehen Sie nur zurück, Seraphim. Ich kümmere mich darum.«
Ich lächelte ihm dankbar zu und warf dem Ekel vor der Tür ein knappes »Tschüss« zu, bevor ich ging.
Hinter mir hörte ich den Nachbarn lamentieren: »Die scheiß Hausarbeit bleibt jetzt an mir hängen.«
»Glücklicherweise ist nicht mehr passiert«, tröstete Aniko. »Ein Sturz die Treppe hinab ins Erdgeschoss kann auch anders enden.«
»Jaja, schon gut. Ich kann das ewige Geseiere nicht mehr hören.«
»Ich mache Ihnen einen Vorschlag, Herr Korn.«
Ich sah, dass Aniko dem Nachbarn den Arm an die Schulter gelegt hatte und ihn hinausführte. »Gehen Sie schon mal rüber. Ich suche derweil Ihre Kamera und bringe sie Ihnen. Ihre Frau wird sich bestimmt über einen kleinen Besuch freuen, oder?«
Korn stöhnte genervt. Seine Chance, einen genaueren Blick ins Hausinnere zu werfen, war dahin. »Soll ich nicht doch ...«, versuchte er es ein letztes Mal. Aniko schnitt ihm das Wort ab.
»Nein, Herr Korn. Im Haus und im Garten laufen bereits die Vorbereitungen für unser alljährliches Walpurgisfest.« Ich musste grinsen. Fast glaubte ich ihm diese Lüge selbst. »Sie werden verstehen, dass es mir nicht möglich ist, Sie hineinzubitten. Ein anderes Mal vielleicht.«
Wieder seufzte Korn vernehmlich. »Na gut«, gab er endlich auf. »Ist eine Canon. Die Kamera muss irgendwo an der südlichen Grundstücksmauer liegen.«
»Gut, Herr Korn. Bis gleich!«
Aniko schlug die Tür ungewöhnlich hart ins Schloss.
»Der Schnüffler war wieder da!«, schimpfte er, als er ins Wohnzimmer trat. René stöhnte demonstrativ.
»Na, meine Holde?«, lächelte Leander, »alles heil überstanden?« Über meine Schulter hinweg wandte er sich an Aniko: »Was wollte unser schlagfertiger Nachbar?«
Er fragte aus Rücksicht auf René, der im Gegensatz zu ihm die Unterhaltung an der Eingangstür nicht hatte mitverfolgen können.
»Angeblich hat sein Sohn eine Digitalkamera in unserem Garten verloren, als er uns heute Mittag fotografieren wollte«, berichtete ich. »Korn wollte sie suchen gehen.«
»Suchen!«, rief Aniko verächtlich. »Der wollte schnüffeln. Korn wartet doch nur auf eine Gelegenheit, ins Haus und in den Garten zu kommen. Es würde mich nicht wundern, wenn der Spanner selbst Fotos geschossen hat und ihm dabei die Kamera runtergefallen ist.«
Ich nickte. »Glaube ich auch«, merkte ich an. »Du scheinst Korn nicht sonderlich zu mögen.«
»Ist das ein Wunder? Er stinkt, als käme er gerade aus einem Schweinestall. Es heißt nicht umsonst: Ich kann ihn nicht riechen. Mir dreht sein Gestank den Magen um.«
Das überraschte mich. Der Kerl hatte für mich durchaus sauber und appetitanregend gerochen.
»Der duscht anscheinend nur selten«, schaltete sich René ein und fügte leise hinzu. »Und uns beschimpft er als schwules Pack.« Es schien ihm peinlich, doch Aniko nickte ihm bestätigend zu.
»Ich werde mit ihm reden«, entrüstete sich Leander. »So etwas dulde ich nicht!«
»Nein, bloß nicht!«, wiegelte Aniko ab. »Solche Typen lässt man am besten in Ruhe. Je weniger wir ihn beachten, desto ruhiger bleibt er hoffentlich.«
»Ich kann ihm ja mal einen Besuch abstatten«, schlug ich vor und erntete einen entgeisterten Blick von Leander. »Was denn?« Ich grinste frech zurück. »Ich fand, er roch lecker.«
Leander beäugte mich kritisch. »Ist alles in Ordnung mit dir?«
»Klar«, versicherte ich. »Ich bin nur ein klein bisschen hungrig. Abgesehen davon geht es mir blendend. Ich dachte mir, wenn Aniko keine Kamera findet und Korn sich als Lügner herausstellt, sollte man ihn zur Rede stellen.« Ich fand die Idee gar nicht mal so übel.
Leander nahm mich offensichtlich beim Wort. »Du wirst doch nicht ...«, begann er argwöhnisch.
»Quatsch gemacht.« Ich lachte mich über seinen Gesichtsausdruck halb kringelig und dachte insgeheim über die Möglichkeit nach. »Natürlich werde ich nicht. Aber das wäre schon was.«
»Wo wir gerade dabei sind: Ich habe Hunger«, erklärte Leander und forderte unsere Blutspender auf: »Unsere letzte Mahlzeit liegt bereits etwas länger zurück. Wenn ich euch also bitten dürfte?«
Sofort setzte sich Aniko zu René aufs Sofa. Gleichzeitig rollten sich beide die Ärmel ihrer Shirts nach oben und warteten geduldig.
Ich winkte Leander zum Sofa. »Alter vor Schönheit«, feixte ich und staunte nicht schlecht, als er – statt wie üblich zu widersprechen – gleich neben Aniko aufs Sofa glitt. Er nahm das dargebotene Handgelenk auf, drehte es in Position und biss vorsichtig hinein. Ein leises Reißen war alles, was man hörte, als sich seine Fangzähne durch die zarte Haut bohrten. Aniko selbst gab keinen Mucks von sich und schloss die Augen.
Ich schaute den beiden zu. Das Verlangen nach Nahrung plagte mich, und der Duftcocktail aus Anikos Blutgeruch und Renés Ausdünstung ließ mir sozusagen das Wasser im Mund zusammenlaufen.
»Iss endlich etwas«, drängte Leander zwischen zwei Schlucken.
Ich nahm also Renés hingehaltenen Arm und biss ruppiger als sonst ins Handgelenk. Mein Spender stöhnte kurz auf. Sein warmes Blut schoß mir in den Mund. Viel zu lange, so schien es mir, hatte ich diese Mahlzeit hinausgezögert. Kein Wunder, dass ich Halluzinationen hatte.
Ich sollte die Pausen dazwischen nicht zu groß werden lassen, dachte ich. Anikos Vorschlag, nach neuen Blutspendern zu suchen, überzeugte mich plötzlich doch sehr.
Nach kurzer Zeit beendete ich meine Mahlzeit, wischte Renés Handgelenk behutsam sauber und dankte ihm für seine Gabe. Er lächelte matt.
»Wir sind soweit fertig«, befand Leander, der ebenfalls seine Mahlzeit beendet hatte. »Was die Internetsache betrifft, würde ich sagen, ihr arbeitet die Ideen aus und erstellt probehalber eine Website. Lasst euch ruhig Zeit. Es hat ja keine Eile.« Er verabschiedete die beiden. Aniko sammelte die Unterlagen vom Tisch ein, packte sie in den Ordner und verließ zusammen mit René das Wohnzimmer. Wir waren alleine.
3. Gelegenheiten
Ich starrte gedankenverloren in die lodernden Flammen des Kaminfeuers, während Leander Musik auflegte. Wenn mich nicht alles täuschte, kannte ich den Komponisten, den er ausgesucht hatte. Ich war mir sicher genug, um ausnahmsweise einen Tipp zu wagen. »Mozart«, behauptete ich.
Sein verdutztes Gesicht ließ mich selbstzufrieden nicken.
Ha, freute ich mich diebisch. Auch eine flügellahme Fledermaus fängt manchmal einen Nachtfalter.
»Ich bin ehrlich überrascht. Du wirst von Mal zu Mal besser, Cara. Wenn du so weitermachst, wird aus dir eine Expertin für klassische Musik.« Zärtlich strich er mir übers Haar. »Es ist die Ouvertüre zu einer großartigen, bewegenden Oper.«
Er erwartete offensichtlich einen Kommentar von mir, doch ich hatte keine Ahnung, um welche Oper es sich handelte. Mit erhobenen Händen bat ich um Nachsicht.
Leander schmunzelte. »So viel also zur Expertin. Was wir gerade hören ist die Entführung aus dem Serail.«
»Wie passend«, kicherte ich. »Vielleicht sollte ich sie zu meiner Auftrittsmusik machen.«
»Wie meinen?« Seine Augenbrauen hoben sich. Die schwarzen Haare fielen ihm ins Gesicht und zeichneten die Konturen seiner Wangen nach. Der Feuerschein spiegelte sich in seinen Augen, die nach dem gerade eben getrunkenen Blut die Farbe makelloser Auberginen hatten. Ich verlor bei diesem Anblick den Faden und erinnerte mich erst nach einer Minute, dass er eine Antwort von mir erwartete. Und Leander wartete geduldig.
»Naja, immerhin hast du mich ja auch entführt«, schmachtete ich ihn schließlich an. »Aus dem Serail, sozusagen.«
Jetzt lachte er, kleine Fältchen bildeten sich um seine Augen. Er rückte näher und zog mich an sich. »Wenn du es so sehen möchtest, gerne. Ich frage mich jedoch ...« Seine Lippen kitzelten an meinem Ohr. »... ob du mich eher als den Edelmann Bassa Selim oder als Erretter Belmonte siehst.« Er wusste nur zu genau, dass ich ihm darauf nicht antworten konnte.
»Vielleicht mache ich dich einfach zum Kerkermeister«, sagte ich diplomatisch. »Schließlich hat ja jedes vernünftige Serail einen Kerker, oder?«
»So, hat es das?«, brummte er in mein Ohr. »Nun, dein Palast besitzt keine Folterkammer. Aber ein Wort von dir genügt, und ich würde dir sofort eine im Untergeschoss einbauen lassen.«
»Ich werde darüber nachdenken«, gab ich mich huldvoll. Zu meinem Leidwesen rückte er plötzlich von mir ab.
»Wo wir gerade von Folter und Qualen reden ... was plagt dich eigentlich in letzter Zeit?« Er stoppte mich sofort, als ich widersprechen wollte: »Du bist und bleibst eine miserable Lügnerin, Cara. Also versuche es gar nicht erst.«
Ich versteckte mich hinter einem Sofakissen und schwieg.
»Was ist los?«, beharrte er und wollte das Kissen zur Seite schieben.
»Nichts. Gar nichts.«
Ich wusste, er würde nicht locker lassen.
»Das Gegenteil ist der Fall. Ist es unsere Praecantara? Möchtest du sie aufschieben?«
Ich ließ entsetzt das Kissen fallen. »Nein«, beteuerte ich wie aus der Pistole geschossen. »Nein, das ist es nicht.«
»Was dann?«
Ich seufzte. Konnte ich denn gar nichts vor ihm verbergen?
»Ich weiß auch nicht«, gestand ich leise. »Ich hatte plötzlich große Lust, es diesem Fiesling Korn heimzuzahlen. Er roch recht appetitanregend. Es reizte mich irgendwie, ihn ...« Ich bereute meine spontanen Worte augenblicklich und schwieg.
»Ich verstehe dich, Cara«, beruhigte mich Leander. »Solche Gefühle müssen dir nicht peinlich sein.«
»Es ist mir nicht peinlich«, widersprach ich. »Es ist nur ... es ist ...«
Er wartete stumm ab, bis ich die passenden Worte gefunden hatte.
»Es ist ungewohnt«, war das Einzige, das mir als Erklärung einfiel. Von der Halluzination wollte ich vorerst nicht reden.
»Aha«, antwortete Leander vielsagend. »Und?«
»Nichts und«, behauptete ich. »Es ist ungewohnt. Das ist alles.«
»Aha.«
Er machte mich wütend damit.
»Was soll das heißen? Entschuldige mal. Ich kenne dieses Gefühl überhaupt nicht. Es reizte mich noch nie so stark, meine Kraft auszuspielen und wirklich zu jagen. Nicht nur den Hunger stillen, sondern richtig Jagen, verstehst du? Ich rede von einem Angriff. Jemandem an den Hals springen, zubeißen, aussaugen. Woher soll ich all das kennen, wo ich doch ein Krüppel bin.« Meine Ehrlichkeit kam einem Offenbarungseid gleich. Leander lächelte nachsichtig.
»Erstens: Du bist kein Krüppel.«
»Ich bin sehr wohl ...«
»Zweitens«, übertönte er mich mühelos, »ist dieses Gefühl für Jäger wie uns vollkommen normal.«
»Ich bin aber kein ...«
»Und drittens: Appetit holen kannst du dir gerne und ohne Reue draußen. Bitte ohne gleich deine Opfer zu morden. Gegessen wird jedoch zu Hause. So heißt es bei den Sterblichen, nur meinen die etwas gänzlich anderes.« Er lachte amüsiert. »Viel passender ist es für uns, findest du nicht? Entspann dich. Alles wird gut«, flüsterte er mit dunkler Stimme. Augenblicklich stellten sich meine Nackenhärchen auf. Er küsste mich zärtlich auf den Mund. »Gut möglich, dass verschollene Instinkte in dir erwachen, die bislang von tom Brooks Medikamenten unterdrückt wurden.«
Ich sah meinen Erschaffer Ludwig tom Brook vor mir: Ein kleiner, gedrungener Mann, die Haare in einer Art zurückgestrichen, wie es längst aus der Mode gekommen war, das Gesicht faltig, die Mundwinkel in stetiger Missbilligung nach unten gezogen. So sehr ich mich anstrengte, ich konnte mir meinen Kreator beim besten Willen nicht lächelnd in Erinnerung rufen. Er war immer ein verschwiegener, abschätzender Skeptiker gewesen.
»Wir werden es nie mehr erfahren«, seufzte ich. »Und ich muss es ausbaden.«
Leander betrachtete mich nachdenklich. »Wieso redest du nicht mal mit deinem Freund Raoul?«
Ich schüttelte sofort den Kopf.
»Wieso nicht?«, hakte er nach. »Schließlich hat er ebenfalls mit tom Brook gearbeitet. Vielleicht hat auch er Nachwirkungen?«
Wieder schüttelte ich den Kopf. »Glaube ich nicht. Das hätte er mir längst erzählt.«
Leander hob eine Augenbraue. »So wie du ihm von deinem Problem erzählt hast?«
Tatsächlich hatte ich Raoul nie von meinem Unvermögen erzählt. Selbst zu Zeiten, als wir gemeinsam in Trier bei Ludwig gelebt hatten, hatte ich mein Geheimnis für mich bewahrt. Dennoch ignorierte ich Leanders Spitzfindigkeit. »Andererseits«, lenkte ich schnell ein, »ist er der einzige Beteiligte, der übrig geblieben ist. Simon ist tot und Ludwig ist von den Seelenwägern gerichtet worden.«
Leander streichelte mir über die Wange und lächelte aufmunternd.
»Rede mit Raoul. Du musst ihm ja nicht beichten, was du ihm all die Jahre verschwiegen hast. Frage ihn einfach bei Gelegenheit, wie er sich fühlt, seitdem er nicht mehr Ludwigs Medikamente nimmt.«
»Mach ich.«
»Versprich es mir.« Er ließ nicht locker.
»Versprochen«, bestätigte ich halbherzig.
Eine Zeit lang saßen wir beisammen, blickten in das knisternde Feuer und genossen die Ruhe und Zweisamkeit. Bis vor Kurzem waren Leanders Schwester Dana und mein Freund Raoul de la Cueva bei uns in Marburg zu Besuch gewesen.
Natürlich hatten wir ihnen von unseren Absichten berichtet, eine Praecantara einzugehen. Sie hatten sich sehr für uns gefreut. Als wir sie dann gebeten hatten, unsere Accredore, unsere Trauzeugen, zu werden, war Dana vollkommen aus dem Häuschen gewesen. Erst vor ein paar Tagen hatte sie angerufen und mich auf ihre besondere Art fast genötigt, die Praecantara in ihrem neu erworbenen und fast fertig renovierten Domizil bei Trier zu zelebrieren. Die Vorstellung, in dem malerischen Schloss Grünwald mitten im idyllischen Ruwertal den Bund zu besiegeln, hatte zugegebenermaßen etwas Romantisches. Und nachdem auch Leander keine Einsprüche erhob, sagte ich Dana zu.
Er hatte es nie offen gesagt, doch ich wusste, Leander freute sich insgeheim darüber, dass seine Schwester zusammen mit meinem Freund Raoul das Anwesen gekauft hatte. Es war der einstige Wohnsitz der Kayrans und nun nach langer Zeit endlich wieder in Familienbesitz.
Ob es dem Gut jedoch zuträglich war, blieb abzuwarten. Dana hatte große Pläne mit dem alten Gebäude und dem angrenzenden Weingut. Es war nachvollziehbar, dass sie nicht den ganzen sonnigen Tag in dunklen Kellerräumen verbringen wollten. Daher wurden die alten Fenster gegen neue ausgetauscht, die keine UV-Strahlen durchlassen. Das war nur der Anfang. Dana wollte mehr. Sie ließ den Innenraum komplett neu gestalten.
Mehrmals hatte sie Leander nach geeigneten Handwerkern gefragt. Dem schien alles egal, solange die Maßnahmen ihm nur seine Schwester vom Hals hielten. »Der Umbau hält meine umtriebige Schwester wenigstens auf Trab«, hatte Leander gespottet. »Immerhin macht sie so keine Schwierigkeiten. Die Handwerker tun mir allerdings ausgesprochen leid. Mit Dana ist sicherlich nicht zu spaßen.«
Trotz aller Widrigkeiten kam der Umbau auf Schloss Grünwald gut voran, und unserer Praecantara am neunten Mai sollte nichts im Wege stehen. Wir hatten dieses Datum gewählt, weil sich an diesem Tag unser Kennenlernen jährte. Es war der bedeutendste Wendepunkt meines Vampirlebens gewesen: Weil wir uns begegnet waren, konnte ich mich aus meinen Fesseln befreien – dabei hatte ich zwar eine Menge verloren, letztlich aber unendlich viel mehr gewonnen.
»Einen Pfennig für deine Gedanken«, schmunzelte Leander nach einer Weile.
»Ich dachte, du könntest sie lesen?«, frotzelte ich. Er zuckte nur mit den Schultern.
»Du wirst alt. Pfennige gibt es schon ewig nicht mehr. – Ich dachte gerade an unsere Feier. Ich habe nichts zum Anziehen«, gestand ich.
»Du könntest nackt gehen«, schlug er vor und blinzelte mir zu.
»Davon träumst du nachts«, fuhr ich auf.
Leander lachte. »Sogar tagsüber.« Er musterte mich abschätzend. »Bist du enttäuscht, wenn ich dir sage, dass die Garderobe dafür längst feststeht?«
»Was? Ich darf mir nicht mal mein Hochzeitskleid aussuchen?«, maulte ich. »Ich glaube, jetzt geht es los! Hast du jemals eine Frau kennengelernt, die es mochte, wie eine Barbiepuppe angezogen zu werden?«
»Barbiepuppe?«, schmunzelte er und blickte erneut an mir herunter. »Kommt nur in etwa hin.«
»Nur in etwa?«, beschwerte ich mich und knuffte ihn in die Seite. »Werde nicht frech! Mach nicht so einen Buhei um die Klamotten. Sag mir lieber, was du dir ausgedacht hast.«
Abwehrend hob Leander die Hände, nur um mich gleich wieder in seine Arme zu schließen. Sein Gesicht war meinem ganz nah.
»Erstens: Ich mache grundsätzlich keinen Buhei um Klamotten. Das tun im Allgemeinen die Frauen. Zweitens: Was die Kleiderauswahl bezüglich unserer Praecantara betrifft – ich bin von Natur aus konservativ. Als Antragsteller nehme ich mir daher die Freiheit, unsere Hochzeitsgarderobe zu bestimmen.«
»Und was, wenn ...«, wollte ich einwenden.
»Es wird dir wie angegossen passen«, schnitt er mir das Wort ab. »Drittens: Nein, ich kenne keine Frau, die es mag, wie eine Barbiepuppe angezogen zu werden. Allerdings sind meine Erfahrungen diesbezüglich eher dürftig.«
»Darf ich endlich mal was sagen?«, fragte ich verschnupft, kaum dass er den Satz beendet hatte.
»Gleich. Viertens: Du bist weitaus attraktiver als diese spindeldürre Plastikpuppe, ganz egal, wie du angezogen bist! Deine Garderobe wird dir gefallen. Verlass dich auf meinen guten Geschmack. So«, er neigte den Kopf in einer gnädigen Geste, »nun darfst du.«
Liebevoll schaute er mich an und meine Einwände schmolzen dahin.
»Danke«, wisperte ich und küsste ihn.
»Ich dachte, du wolltest reden. Ich höre deine Stimme sehr gerne, aber das hier gefällt mir besser.« Mit Kussmund und geschlossenen Augen hielt er mir sein Gesicht hin. Seine Mundwinkel zuckten verdächtig und ließen mich sogleich argwöhnisch fragen: »Gibt es etwas, was ich wissen müsste?«
»Nichts.«
»Nichts?«, wiederholte ich ungläubig und rückte von ihm ab.
»Jep. Nichts.«
Ich verschränkte die Arme vor der Brust und schmollte beleidigt. Dann würde ich eben Dana fragen, ob sie etwas darüber wusste.
»Für den Fall, dass du meine klamottensüchtige Schwester zu Rate ziehen möchtest«, schien Leander meine Absicht zu erraten, »tu das ruhig.« Ein schelmisches Grinsen stahl sich in sein Gesicht. »Alles, was sie dir erzählen wird, ist gelogen. Unsere Feier, meine Regeln! Aber eines kann ich dir versprechen: Diesmal gibt es kein Rosenmassaker.