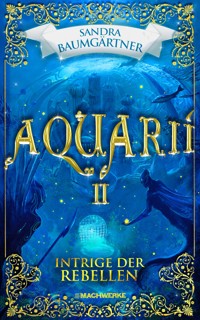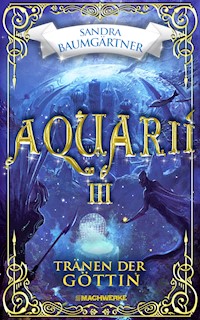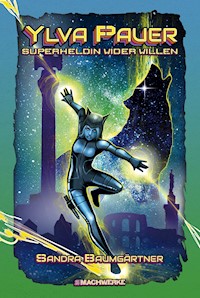1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Wir schreiben das Jahr 1908: Eine junge, wagemutige Frau folgt in einem Park der Spur eines mysteriösen Phantoms, das die Stadt seit geraumer Zeit in Schrecken versetzt. Dabei gelangt sie in die tödlichen Fänge eines Vampirs und erwacht als Vampirin Seraphim aus ihrem Todesschlaf. Als ihr Erschaffer sie bittet, ein von ihm entwickeltes Mittel zu testen, das Vampire gegen Sonnenlicht unempfindlich macht, ist Seraphim zunächst begeistert. Sie kann nicht nur die Freuden der Nacht, sondern auch die des Tages in vollen Zügen genießen – carpe diem, carpe noctem. 100 Jahre später trifft Seraphim auf den charismatischen Vampir Leander Kayran. Er klärt sie über die wahren Hintergründe ihrer damaligen Verwandlung und die dunklen Geheimnisse ihres Kreators Ludwig auf. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn sollten Leanders Informationen stimmen, so wäre sowohl Seraphim als auch Ihresgleichen in größter Gefahr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Seraphim:CARPE NOCTEM
Band 1 der Seraphim:Vampirsaga
Sandra Baumgärtner
2. Auflage, 2017
© 2017, Sandra Baumgärtner
(1. Auflage im Verlag Kleine Schritte, 2011)
Herstellung&Satz: MACHWERKE Verlag, Trier
Covergestaltung: FANTASIO www.fantasio.info
ISBN 978-3-947361-00-7
Alle Rechte vorbehalten.
Sämtliche Inhalte, Fotos und Grafiken dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen ohne vorherige Genehmigung weder ganz noch auszugsweise kopiert, verändert, vervielfältigt oder
veröffentlicht werden.
MACHWERKE Verlag, Trier
www.machwerke-verlag.de
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.
Die im Text genannten Personen, egal ob lebendig, tot oder untot, sind allesamt frei erfunden. Dies gilt auch für Zeitungsartikel, Mails und Nachrichten jeglicher Art. Sie wurden nie geschrieben oder veröffentlicht und entsprangen alleine der Fantasie einer kreativen Autorin. Einzig zur Existenz zweier Trierer Vampire kann die Autorin aus nachvollziehbaren Gründen keinerlei Auskunft geben.
Belächle nicht die Taten vergangener Tage.
Nutze sie für deine Zukunft.
Seraphim
Trier im Juli 1908
1. Das Phantom von Nells Park
Ängstlich drehte sich der Wanderer nach seinem Verfolger um und starrte ihn an.
»Was wollen Sie? Wieso jagen Sie mir hinterher?«, rief er. Die vergebliche Flucht hatte ihn völlig außer Atem gebracht. Zum wiederholten Mal blickte er sich um, doch noch immer war niemand anderes zu sehen. Hie und da hörte er Laubrascheln, sonst war es im Wald still. Totenstill.
»Was wollen Sie?«, fragte er erneut und hob eine Hand, um sich den Schweiß aus den Augen zu wischen. In einem Wimpernschlag hatte der Verfolger den Abstand zwischen ihnen überwunden und die erhobene Hand des Wanderers ergriffen.
»Nur ruhig«, sprach ihn der Fremde mit einer dunklen, überraschend einnehmenden Stimme an, und augenblicklich fühlte sich der Wanderer ein wenig wohler. Der Fremde indes strich mit eiskalten Fingern prüfend über dessen Handgelenk, ganz vertieft in die Betrachtung der Adern, die sich blau und prall gefüllt unter der weichen, warmen Haut abzeichneten.
»Sie haben nichts zu befürchten«, fuhr der Fremde fort, »ich möchte nicht viel von Ihnen.«
»Was ...?«, stotterte der Wanderer verwirrt. Ihm schwindelte plötzlich und sein Kopf fühlte sich an, als hätte er ein Glas Wein zu viel getrunken. Er musste sich anstrengen, um die Worte des Fremden überhaupt noch zu verstehen.
»Es wird nicht wehtun. Haben Sie Vertrauen. Und Sie werden sich hinterher an nichts mehr erinnern können. So ist es für Sie sicherer und für mich auch.«
Der Fremde lachte leise. Es war ein freundliches, angenehmes Lachen, und fast hoben sich auch die Mundwinkel des Wanderers zu einem Lächeln, als plötzlich seine Hand mit einem kräftigen Ruck an die kalten Lippen des Fremden gerissen wurde und sich spitze Zähne in sein Fleisch bohrten. Ein entsetzter Schrei verhallte ungehört im Wald.
Nur wenige Momente später befand sich der Jäger erneut auf der Pirsch. Er wusste, wo er das nächste Opfer seiner Begierde finden würde. Mit katzengleichen Bewegungen huschte er unbemerkt an Häuserzeilen entlang und zwischen Bäumen und Büschen hindurch, stets darauf bedacht, nicht entdeckt zu werden. Er verlangsamte seine leichten Schritte erst, als er den Nordeingang von Nells Park erreichte.
Vier junge Frauen saßen auf einer Decke am Seeufer. Gerade hielten sie sich die Bäuche vor Lachen.
»Ich sagte zu Mutter, dass ich es nicht war, die das Feuer ausgehen ließ, sondern der Hans. Dass er ins Feuer gepinkelt hat, hab ich ihr freilich nicht erzählt. Sonst hätte Vater ihm eine ordentliche Tracht Prügel verpasst«, erklärte die kräftige Frau grinsend.
Erneut lachten die anderen drei laut auf.
»Und was dann, Luise?«, fragte die zierliche Rothaarige. »Hat er sich wenigstens eine Backpfeife eingefangen?«
»Nein, Resa. Hans wurde wie immer nicht bestraft. Mutter schickte stattdessen mich für den Rest des Tages auf mein Zimmer. Und ich musste am nächsten Tag den Hausputz erledigen.«
Allmählich kamen die jungen Frauen zur Ruhe. Die ersten Amseln stimmten ihr Abendlied an und nun bemerkten die vier, dass es sehr spät geworden war.
Sie hätten schon längst zu Hause sein müssen. Aber der Tag war herrlich gewesen und sie hatten sich prächtig amüsiert. Keine hatte sich oder den anderen die gute Laune verderben und das Treffen auflösen wollen.
»Lasst uns besser aufbrechen, bevor wir wieder Ärger bekommen«, meinte Resa zu ihren Freundinnen.
»Ja«, seufzte das Mädchen neben ihr. »Vater wird auch so schon böse auf mich sein. Ich war heute an der Reihe, das Abendbrot zu richten.«
Müde vom Tag standen die vier langsam auf und packten Decke, Kissen und Brotreste in die Taschen.
Ihr fröhliches Picknick war vom anderen Seeufer aus die ganze Zeit über beobachtet worden. Der Jäger hatte sich dort unter dem gewaltigen Blätterdach einer großen Kastanie verborgen gehalten und unentwegt über den See gestarrt. Neugierig hatte er ihren Gesprächen gelauscht und dabei die rothaarige, junge Frau kein einziges Mal aus den Augen gelassen. Mit einer flüchtigen Bewegung strich er sich eine dunkle Haarsträhne zurück, die aus der Kapuze seines langen, schwarzen Umhangs herausragte und machte sich nun, da die Freundinnen aufbrachen, bereit, der Gruppe auf ihrem Heimweg zu folgen.
An einem Wegkreuz angekommen, verabschiedeten sich die Frauen von Resa, die eine andere Richtung einschlagen musste, und verabredeten sich für den nächsten Tag.
»Bringst du diesmal das Essen mit, Resa?«, fragte die kleine Brünette.
»Ja, mache ich gerne, Marie«, sagte Resa. »Großmutter backt immer ordentlich Brot für alle. Da bleibt sicher auch etwas für uns übrig. Bis morgen dann, und schlaft gut.«
Sie winkte ihren Freundinnen noch einmal zu, drehte sich um und marschierte zügig in die dunkle Gasse hinein, die zu ihrem Haus führte. Die Freundinnen blickten ihr noch kurz nach, bevor sie ihren Heimweg fortsetzten. Keine von ihnen bemerkte den Mann im schwarzen Umhang, der Resa wie ein Schatten folgte.
Es dauerte nicht lange, da verbreitete sich das Gerücht, der Park sei verhext. Mütter verboten ihren Kindern, dort zu spielen, Erwachsene mieden ihn und verlegten Ausflüge und Spaziergänge ans nahe gelegene Moselufer. Der Park mit seinen wunderschönen Alleen aus Kastanien und Platanen wirkte wie ausgestorben. Nur noch die Enten bevölkerten jetzt die Wiesen rund um den See. Doch die vier Mädchen ließen sich davon nicht beirren und trafen sich, wenn es die Zeit zuließ, an ihrem Plätzchen am Seeufer. So auch an einem schönen Sommertag einige Wochen später. Gerade nahm Resa einen frisch gebackenen Laib Brot aus ihrem Korb, brach zwei Stücke davon ab und reichte sie ihren beiden Freundinnen Luise und Olga, die sie gleich mit großem Appetit aßen.
»Was meint ihr, sollen wir beim nächsten Mal Marie fragen, ob sie wieder mit uns kommt? Ich vermisse sie. Sie fehlt!«, fragte Resa die anderen.
»Ich weiß nicht, sie ist immer noch ziemlich ängstlich, wenn es darum geht, durch den Park zu spazieren. Selbst bei Tage hat sie Angst.«
Missmutig schüttelte Olga ihren Kopf.
»Ich verstehe sie ja. Das Phantom hat ihr bestimmt einen Heidenschrecken eingejagt«, gab Luise zu bedenken.
»Aber bislang ist es doch immer nur in der Abenddämmerung oder nachts erschienen. Und wir sind in letzter Zeit nie nach sechs Uhr nach Hause gegangen. Und noch lange bevor die Sonne am anderen Moselufer untergeht. Da kann uns nichts passieren«, meinte Resa selbstsicher.
»Vater würde es mir trotzdem übel nehmen, wenn er es wüsste«, lachte Olga, und ihre Freundinnen stimmten mit ein. Ihr lautes Gelächter schreckte drei Enten auf, die ärgerlich schnatternd über den See flüchteten.
»Wir werden sie beim nächsten Ausflug einfach wieder fragen, ob sie mitkommen möchte. Sie kann doch nicht bis zum Jüngsten Tag zu Hause versauern.« So schnell wollte Resa nicht aufgeben. »Und wenn ich sie persönlich herziehen muss ...«
Wieder blinzelten sich die Freundinnen verschwörerisch grinsend zu.
»Du kannst sie ja mit einem Stück Kuchen locken, das schlägt sie bestimmt nicht aus«, bemerkte Luise.
»Du aber auch nicht, Luise!«, feixte Olga und blies die Backen auf.
»Hör auf, Olga, das ist nicht nett«, verteidigte Resa ihre Freundin, die traurig zur Seite schaute.
»Luise ist schon in Ordnung, so wie sie ist. Luise?«
Luise hörte ihren beiden Freundinnen nicht zu. Gebannt starrte sie auf das andere Seeufer.
»Da drüben ...«, war alles, was ihr über die Lippen kam.
Resa und Olga folgten ihrem Blick und schrien leise auf. Im Schatten der großen Kastanie stand ein Mann. Er sah geradewegs zu ihnen herüber. Er verzog keine Miene und grüßte nicht.
»Könnt ihr erkennen, wer es ist?«, fragte Resa.
»Bist du noch ganz bei Trost, Resa? Das ist bestimmt das Phantom!«
Luise zitterte jetzt am ganzen Leib. »Lasst uns sofort hier weg! Ich hab Angst.«
Ohne weitere Worte zu verlieren, rafften die Freundinnen ihre Sachen zusammen und rannten, so schnell sie konnten, aus dem Park auf die Straße hinaus.
»Es kann nicht das Phantom gewesen sein«, meinte Resa, die sich schnell wieder beruhigt hatte. »Das Phantom kommt nur im Dunkeln und wir haben gerade erst fünf Uhr nachmittags.«
»Das ist mir gleich. Ich will nur heim«, sagte Luise trotzig.
»Genau. So schnell geh ich nicht mehr in den Park. Für unser nächstes Treffen müssen wir uns ein anderes Plätzchen aussuchen«, stimmte Olga mit ein.
»Wie ihr wollt, ihr Hasenfüße!«
Sie waren am Wegkreuz angekommen.
»Sollen wir mit bis zu deinem Haus kommen, Resa?«, fragte Luise.
»Nein, lasst nur. Es ist ohnehin nur ein kurzes Stück. Das bin ich schneller gegangen, als du Phantom sagen kannst«, lachte Resa.
»Sag nicht so was, Resa. Ich hab immer noch Angst.« Olga drehte sich schon um und winkte ihrer Freundin zu. »Bis morgen dann.«
»Ja, bis morgen, ihr zwei Gänse.«
Resa lachte noch immer, winkte den beiden zum Abschied zu und wartete, bis sie an der nächsten Biegung außer Sichtweite gerieten.
Phantom, nimm dich in Acht!, dachte sie. Wollen doch mal sehen, wer du bist. Mir machst du keine Angst.
Sie wartete kurz, dann drehte sie sich um und marschierte zurück in den Park. Der Park sah verlassen aus und es herrschte Totenstille. Die Enten waren nicht wieder zurückgekehrt und die vielen Singvögel, die gegen Abend ihre Lieder in den alten Bäumen anstimmten, waren noch nicht zu hören. Resa schlenderte am Seeufer entlang und ließ die gegenüberliegende Seite nicht aus den Augen. Niemand war dort zu sehen und auch der seltsame Mann war verschwunden. Nur die Zweige der großen Kastanien, durch deren Blätterdach die untergehende Sonne ein bewegtes Mosaik aus Licht und Schatten zauberte, schaukelten leicht im lauen Wind.
Solche Hasenfüße, dachte Resa. An so einem herrlichen Tag nach Hause zu laufen, als wäre tatsächlich ein Geist hinter ihnen her. Das ist die reinste Verschwendung!
Sie breitete ihre Decke in der Nähe der Bäume aus und nahm darauf Platz. Anders als von der Stelle aus, an der sie sich immer mit den anderen Mädchen traf, hatte sie von hier aus einen Blick auf einen weniger besuchten, verwilderten Teil des Parks. Dort standen die Ruinen eines alten Guts, das vor langer Zeit ein reicher Trierer Bürger hatte erbauen lassen, ein Herrenhaus, umgeben von Ställen. An der Südfront des ehemals stattlichen Hauptgebäudes waren die Überreste eines großen Glasvorbaus zu erkennen, dessen Scheiben nun alle zerschlagen auf dem Boden verstreut lagen.
Dieses Gebäude ist mir noch nie aufgefallen. Ob es dort etwas zu entdecken gibt?, ging es Resa durch den Kopf. Sie zögerte. Und wenn das Phantom darin spukt?
Kurz schaute sie sich im Park um, konnte aber niemand anderen sehen.
Ist mir gleich. Ich bin bestimmt nicht die Erste, die sich dort umschaut, dachte Resa.
Sie stand auf und ging um den See herum zum Haus. Vor der morschen Tür blieb sie kurz stehen, wuchtete sie dann beherzt auf und trat ins dunkle Innere. Es dauerte eine Weile, bis sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Die schräg einfallenden Sonnenstrahlen gaben nur wenig Licht. Staubwolken wallten durch den großen Raum, es roch muffig und nach feuchtem Holz. Resa ging einige Schritte weiter und gelangte in eine große Halle mit einer geschwungenen Treppe, die ins obere Geschoss führte. Sie wollte gerade eben einen Fuß auf die erste Stufe setzen, als sie hinter sich Stimmen hörte.
»Das ist sie also?«, fragte eine kratzige Männerstimme.
»Ja, das ist sie!«, antwortete eine dunklere, samtige Stimme.
Selbst wenn sie es gewollt hätte, Resa konnte sich nicht bewegen. Wie gebannt stand sie da und lauschte den Stimmen. Ohnehin wagte sie es nicht, sich umzudrehen. Vielleicht würden diese Leute sie übersehen, wenn sie sich nicht regte?
»Sehr gut. Bestens geeignet!« Die kratzige Stimme klang aufgeregt.
»Was meinst du damit? Für was geeignet?«, fragte die dunkle Stimme verärgert zurück.
»Für meine Zwecke«, war die knappe Antwort.
Eine eiskalte Hand strich Resas Haar von den Schultern und bog ihren Kopf mühelos zur Seite, eine andere hielt ihre Schulter mit eisernem Griff umschlossen.
»Nein!«, schrie die dunkle Stimme. »Ludwig, nein!«
Wovon die dunkle Stimme auch abraten wollte, es war zu spät. Resa spürte kalte Lippen, die ihren Hals berührten, und einen kurzen Schmerz, dann wurde alles schwarz um sie herum.
Das Erste, was ich spürte, waren unglaubliche Schmerzen. Unerträglich, erbarmungslos und übermächtig. Außerhalb meines geschundenen Körpers schien nichts mehr zu existieren. Keine Form, kein Licht, keine Stimmen, keine Zeit, kein Sein. Ich wollte, dass es aufhörte. Ich wollte sterben. Vielleicht tat ich es ja auch gerade? Dann hätte dieses Elend bald ein Ende. Das war meine einzige Hoffnung in dieser unendlich großen, schwarzen Leere.
Ich wusste nicht, wie lange ich so dahinvegetierte. Doch fast unmerklich veränderte sich etwas. Die Qualen ließen allmählich nach. Sie kamen und gingen wie Wellen im Meer, erst sturmgepeitschte Wogen, die dann allmählich zu einer leichten Kräuselung abebbten, bis sie schließlich völlig verschwunden waren. Ich hätte aufgeatmet. Doch ich konnte nicht mehr atmen. Ich hätte versucht, den Ort zu verlassen, der mich gefangen hielt. Doch ich konnte mich weder bewegen noch etwas sehen.
»Wird sie es schaffen?«, fragte eine dunkle Stimme besorgt.
»Ich denke schon. Sie ist sehr stark. Sie wird uns ein gutes Stück weiterbringen«, sagte eine andere.
»Ich möchte nicht, dass du mit ihr arbeitest«, flehte die dunkle Stimme jetzt. »Lass sie. Lass sie mir! Wir werden fortgehen. Ich verspreche dir, wir werden uns auf ewig von dir fernhalten und schweigen. Ich bitte dich, Ludwig!«
»Du weißt, das ist unmöglich. Sie gehört nun zu mir! Du hast deine Gelegenheit vertan und warst dir von Anfang an über das Wagnis im Klaren. Sei folgsam und ihr geschieht nichts. Wenn nicht ...« Die kratzige Stimme redete nicht weiter.
»Aber sie hatte keine Wahl! Selbst jetzt lässt du ihr keine Wahl. Ist dir deine Forschung so viel wert?«, fragte die dunkle Stimme verärgert.
»Du solltest dir bewusst sein, mit wem du redest. Stellst du allen Ernstes meine Arbeit infrage? Wegen ihr?«, erklang es jetzt böse.
Etwas raschelte. Ein Mantel, der über einen Steinboden schleifte? Dann Stille. Kein Laut drang mehr an meine Ohren, und ich verlor mich erneut im Nichts. Manchmal schien es mir, als würde ich auftauchen und jemand würde mir mit eiskalter Hand über die Stirn fahren, mir die Haare aus dem Gesicht streichen. Ich wollte aufwachen, die Hand fassen und um Antworten bitten. Aber immer noch war es mir unmöglich, auch nur einen Finger zu rühren.
Werde ich jemals wieder zu mir kommen?, fragte ich mich abermals.
Wo war ich? War dies das Ende des irdischen Lebens? Wo waren die Engel? Der Himmel?
»Resa«, flüsterte mir plötzlich eine gefühlvolle Stimme aus dem Nichts zu. Ich konnte es klar und deutlich neben mir hören.
Ein Engel, dachte ich erleichtert. Er nimmt mich mit. Er wird mich erlösen. Endlich, es hatte ein Ende.
»Resa«, raunte es wieder. »Resa, mach die Augen auf!«
Wie konnte ich mich einer solch himmlischen Stimme widersetzen? Zu meiner größten Erleichterung konnte ich tatsächlich die Lider heben und blickte in die gütigen Augen eines Engels. Goldene Locken umrahmten sein Antlitz wie ein Heiligenschein. Seine ebenmäßigen Gesichtszüge waren makellos und ein sanftes Lächeln umspielte seine weichen Lippen.
»Bist du ein Engel?«, wisperte ich tonlos.
»Ja, Resa, ich bin ein Engel.« Das Lächeln wich nicht von seinen Lippen. Er schaute mich zärtlich an. »Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass es Zeit für dich ist aufzustehen. Du musst gehen!«
»Aber wie? Ich kann mich nicht bewegen. Und außerdem gibt es hier nichts, wohin ich gehen könnte.«
»Das ist wahr, Resa. Alles, was du bis jetzt gekannt hast, gibt es für dich nicht mehr. Resa lebt nicht mehr!«
Es war also wahr: Ich war tot und mein Leben auf Erden zu Ende. »Aber ich spüre mich noch«, sagte ich etwas verwirrt. »Wie kann ich dann tot sein?«
Der Engel schaute mich verständnisvoll an. »Resa ist tot. Doch du bist Seraphim. Eine andere Welt steht dir nun offen. Sie wartet auf dich. Geh, Seraphim! Alles wird gut werden!«, sagte er, doch seine Lippen bewegten sich nicht.
»Aber ich kann nicht. Hier ist nichts«, wimmerte ich.
Die Gestalt des Engels veränderte sich plötzlich, sie wurde immer blasser, löste sich auf. Fast war sie schon verschwunden.
»Warte!«, rief ich voller Angst. »So warte doch!«
Der Engel blickte mich noch ein letztes Mal traurig an. Sein wunderschönes Gesicht mit den großen Augen rührte mich zu Tränen.
»Werde ich dich wiedersehen?«, fragte ich ihn leise.
Er lächelte liebevoll. »Wenn die Zeit kommt, werden wir uns wiedersehen, Seraphim.«
Dann war er verschwunden. Zuerst glaubte ich, nichts an mir hätte sich geändert. Doch dann bemerkte ich, dass meine Augen wieder richtig funktionierten. Ich konnte einzelne Umrisse erkennen. Und dann, endlich, meine nähere Umgebung. Ich schien in einer Art Keller oder Höhle auf einem Steinpodest zu liegen. Die Wände rundherum waren aus massivem Sandstein. Ich vernahm von draußen Wasserrauschen, Stimmen von Menschen, ab und an eine Kirchenglocke und das Rascheln von Blättern in den Bäumen. Ich hörte, wie der Wind durch die Mauerfugen pfiff und ganz in der Nähe die Ratten über den Boden huschten. Das Fiepen der Tiere und das Scharren ihrer bekrallten Füße taten mir in den Ohren weh. Ich versuchte, mich aufzurichten, und wurde dabei fast vom Podest herunterkatapultiert. Ich spürte meinen Körper wieder, aber meine Arme schienen viel zu stark für diese federleichte Gestalt, die sie nur vom Podest hatten anheben wollen. Ich schoss durch die Luft, Beine voraus, auf den Boden zu und landete reflexartig auf allen Vieren, zusammengekauert wie eine Katze. Was war nur los? Das war nicht mehr mein Körper, wie ich ihn kannte, das war nicht mehr ich. Was war passiert? Und wo war ich? Ich vernahm ein neues Geräusch in der hinteren Ecke des Raumes und drehte mich blitzschnell um. Ein kleiner Mann in einem braunen Gehrock kam langsam auf mich zu.
»Seraphim, fürchte dich nicht. Alles ist gut. Es ist vorbei«, sagte er mitfühlend und lächelte freundlich.
»Wer sind Sie? Wie komme ich hierher?«
»Ich beantworte dir gleich alle deine Fragen. Doch zuerst ist es wichtig, dass du diese Arznei nimmst. Sie hilft dir, die Nachwehen deiner Verwandlung zu ertragen.« Er hielt mir seine ausgestreckte Hand hin, die genauso weiß war wie die Tablette, die darauf lag.
»Was meinen Sie?«, entgegnete ich verwirrt und starrte auf seine Hand. »Sie glauben doch nicht, dass ich das da nehme?«, fragte ich ihn ärgerlich. Meine Stimme klang schrill und sie schepperte selbst mir in den Ohren. Das Quietschen der Ratten wurde immer unerträglicher und ich hielt mir unwillkürlich die Ohren zu.
»Wenn du nichts dagegen unternimmst, werden die Schmerzen wieder schlimmer. Also tu besser, was ich dir sage«, riet er mir. »Glaub mir, es ist zu deinem Wohl. Ich weiß, wovon ich spreche. Vertrau mir!« Erneut bot er mir die Tablette an.
Oben fingen die Kirchenglocken an zu läuten und jeder Schlag des Klöppels schien direkt auf mein Trommelfell zu hämmern. Was für eine Wahl hatte ich schon? Ich wusste nicht, wo ich war, wer ich war, noch was aus mir werden sollte. Und der Mann hatte recht, die Schmerzen kamen zurück. Stärker diesmal. Die Vorstellung, wieder in das Nichts zu fallen, war mehr, als ich ertragen konnte. Also nahm ich ihm die Tablette aus der Hand, steckte sie in den Mund und schluckte sie hinunter. Die Schmerzen verschwanden im Nu.
2. Alte und neue Familie
Der kleine, hagere Mann mit der kratzigen Stimme und der schneeweißen Haut hielt sein Wort. Er stellte sich als Ludwig tom Brook vor und beantwortete mir all meine Fragen. Er kannte die Ursache für die immensen Schmerzen, die ich durchlebt hatte und gegen deren Nachwirkungen er mir von nun an regelmäßig seine Arznei verabreichen würde. Und er erklärte mir, weshalb mein Körper sich verändert hatte und meine Sinne geschärft waren. Seine Worte waren so fantastisch, dass ich sie zunächst nicht glauben konnte. Er behauptete allen Ernstes, mich zum Vampir gemacht zu haben.
»Aber das sind doch Märchen! Vampire gibt es nicht!«, widersprach ich und schüttelte ungläubig den Kopf. Tom Brook lachte nur.
»Ganz genau! Vampire gibt es nicht. Und das, Seraphim, ist die erste Lektion, die du lernen musst«, erklärte er gewichtig und hob wie ein Schullehrer den Zeigefinger. »Niemals darfst du dich in der Öffentlichkeit als das ausgeben, was du bist. Wir Vampire haben in der Gesellschaft der Menschen nichts verloren. Und das hat seine guten Gründe. Die Sterblichen glauben nur an solche Dinge, die sie auch sehen und begreifen können. Solange wir für sie unsichtbar sind und sie uns nicht wahrnehmen, sind wir vor ihnen sicher. Wie du sagtest: Vampire gibt es nicht. Aber es gibt uns doch! Die Menschen leugnen unsere Existenz schlichtweg, haben uns an den Rand ihres Bewusstseins verdrängt. Und dort müssen wir bleiben, Seraphim! Nur hier haben wir die Möglichkeit, unbehelligt und für alle Ewigkeit unserer Wege zu ziehen.« Verbissen fügte tom Brook an: »Denn das ist unser Los: eine unsterbliche, unendliche Existenz.«
Ich betrachtete meinen neuen Körper zum ersten Mal genauer. Ich hatte mich verändert. Dazu brauchte es noch nicht einmal einen Blick auf meine schneeweiße Haut. Ich spürte, wie die Muskeln stetig arbeiteten in einem Körper, der sich unglaublich kraftvoll anfühlte und von außen doch so grazil und schwach wirkte. Ich spürte die Energie, die mich wie eine heiße Flüssigkeit erfüllte und wusste genau, ich war schneller, gewandter und stärker als jeder Mensch. Und ich war unsterblich.
»Warum bin ich jetzt ein Vampir? Und wieso kann ich mich nicht daran erinnern, wie es dazu kam?«, fragte ich neugierig. Hatte es überhaupt ein Leben vor diesem gegeben? Ich konnte mich nur dunkel und bruchstückhaft erinnern.
»Die Umstände deiner Verwandlung waren etwas ungewöhnlich«, antwortete tom Brook ernst, »und ich hatte zunächst große Zweifel daran, ob deine Rettung gelingen würde. Doch nachdem ich alle Widrigkeiten beseitigt hatte, habe ich dies letztlich geschafft.«
Allzu genau konnte ich mich an die Schmerzen erinnern und an die große, schwarze Leere, in der ich gefangen war. Das alles war nun glücklicherweise Vergangenheit. Ich war vor dem Tod gerettet worden und existierte – nicht mehr als Mensch, aber dennoch als Seraphim.
Als Vampir, dachte ich und versuchte, das Unfassbare zu verstehen. Und das habe ich allein diesem seltsamen Mann hier zu verdanken.
»Danke«, murmelte ich verlegen.
Tom Brook schüttelte den Kopf. »Ich habe dich lediglich kreiert. Ich habe dich zu dem gemacht, was du bist. Aber um als Vampir überleben zu können, gibt es für dich noch Vieles zu lernen. Ich will dir ein Lehrer sein und dich in Zukunft als Mentor und Berater leiten. Und ich will dir helfen, den Weg in dein neues Dasein zu finden.« Er blickte mich eindringlich an und fuhr mit Nachdruck fort: »Vorausgesetzt, du bist in absehbarer Zeit bereit, mich bei meiner Arbeit zu unterstützen.« Er machte eine Pause und begann, auf und ab zu gehen. »Du musst wissen«, erklärte tom Brook mir dann stolz, »dass ich seit geraumer Zeit an einem Medikament forsche. Diese Entwicklung steht noch am Anfang, doch ich bin mir sicher, dass wir bald die ersten Erfolge verzeichnen können, wenn du mich dabei unterstützt. Wenn nicht ...« Er blieb stehen und machte wieder eine bedeutungsschwere Pause. »Wenn nicht, werden wir ab sofort getrennte Wege gehen, denn ich habe keine Zeit zu verschwenden.«
»Worum dreht sich Ihre Forschung?«, wagte ich zu fragen. Doch tom Brook schüttelte missbilligend den Kopf und antwortete: »Das, Seraphim, kann ich dir erst sagen, wenn die Zeit dafür reif ist.« Die Bestimmtheit seiner Worte machte mir klar, dass ich keine weiteren Fragen stellen sollte. Je mehr ich darüber nachdachte, in welcher Lage ich mich befand, desto klarer wurde mir, dass ich ohnehin keine andere Wahl hatte, als sein Angebot anzunehmen.
Ich betrachtete Ludwig tom Brook, der mir mein neues Leben geschenkt hatte. Dank ihm wusste ich nun, was ich war. Doch was dies für mich bedeutete oder was aus mir werden sollte, wusste ich noch nicht. Dafür benötigte ich seine Hilfe, ebenso wie er für seine Arbeit offenbar die meine. Was auch immer auf mich zukommen würde, alles war besser, als wieder in die Nichtexistenz zurück zu müssen, in der ich schier verzweifelt war. Und so gab ich diesem kleinen, unscheinbaren Mann mein Versprechen, ihm fortan nützlich zu sein, wenn er mich umgekehrt in die geheime Welt eines Vampirs einweihen würde. Wir besiegelten unser gegenseitiges Versprechen mit einem nachdrücklichen Handschlag. Ein Handschlag, der mein Schicksal mehr beeinflussen sollte als ein Pakt mit dem Teufel persönlich.
Ludwig tom Brooks Behausung lag am Rande von Trier in der Nähe des Palastgartens. Im abgeschlossenen Gewölbekeller eines alten, leer stehenden Hauses hatte er sich sein Laboratorium und eine kleine Wohnung eingerichtet, in der er mir Unterkunft gewährte. Obwohl Ludwig sich mir gegenüber großzügig verhielt, blieb er ein unzugänglicher Mann, der nur das Nötigste mit mir sprach und sich über seine Person ausschwieg. Und das sollte sich auch in den kommenden Jahren nicht ändern. Trotzdem wurde Ludwig schon bald mein leuchtendes Vorbild. Ich begab mich vertrauensvoll in seine Obhut und ließ mich von ihm unterweisen. Schritt für Schritt weihte mich mein Mentor in die Lebensweise eines Vampirs ein.
Meine erste Lektion hatte ich bereits erhalten: Vampire mussten für die Menschen unsichtbar bleiben. Das fiel mir leicht, doch es gab andere Dinge, die ich nur widerwillig annahm und die mir mein Leben als Vampir schwer machten.
Als ich schon kurze Zeit nach meiner Verwandlung spürte, dass die Kraft in mir langsam nachließ, schließlich zu einem dünnen Rinnsal versickerte und ich immer schwächer und langsamer wurde, wandte ich mich mit dieser Sorge an Ludwig. Er erklärte mir, dass ich von nun an nicht mehr wie gewohnt essen und trinken müsse. Die Nahrung der Menschen sei für meinen Körper nicht mehr verwertbar. Ich benötige jetzt einen anderen Stoff – das mit Lebensenergie erfüllte, warme Blut eines Menschen. Es sei an der Zeit, auf die Suche danach zu gehen, fuhr er fort. Dies wäre meine zweite Lektion, die ich zu lernen hätte. Er schärfte mir ein, immer nur nach Opfern Ausschau zu halten, die aus dem Alltag verschwinden konnten, ohne dass es jemandem auffiel. Menschen, die in der Gegend unbekannt waren, Alleinreisende, die sich die Stadt anschauen wollten, Bettler oder Rechtsbrecher. Ludwig beobachtete unser erstes Opfer eine geraume Weile, um sicherzugehen, dass es tatsächlich ein Fremder war. Als der Reisende eines Nachts den Fehler beging, einen Spaziergang entlang der Mosel zu unternehmen, hielt Ludwig den Zeitpunkt für geeignet. Er fiel den ahnungslosen Mann von hinten an, biss ihm, ohne zu zögern, in die Kehle und forderte seinen Tribut. Ludwig schien nicht den geringsten Gefallen an der Art unserer Ernährung zu haben und wirkte abgeklärt und fast gelangweilt, als er den leblosen Körper auf den Boden sinken ließ und mir andeutete, mich ebenfalls gütlich daran zu tun. Ich sträubte mich zunächst davor, mich diesem Menschen zu nähern, ihn zu berühren. Doch was blieb mir anderes übrig? Ich würde mich in Zukunft von Blut ernähren müssen. Und so folgte ich mit einiger Überwindung Ludwigs Anweisung, kniete mich neben den bewusstlosen Mann auf den Boden und nahm schnell und ohne darüber nachzudenken sein noch warmes Blut und damit sein dahinschwindendes Leben in mir auf. Das pulsierende Mahl, das mir unfreiwillig gespendet worden war, bereitete mir keinen besonderen Genuss. Aber ich fühlte die belebende Energie, die mich plötzlich wieder durchströmte, und ich trat zurück und schickte dem Leichnam einen Dank hinterher, als er in den schwarzen Fluten der Mosel verschwand.
Genauso wie Tiere für ihre Jungen die Beute erlegen, begab sich Ludwig von da an einmal in der Woche für uns beide auf die Suche nach Nahrung. Immer war er es, der die Wehrlosen für uns niederstreckte, sich seinen Teil nahm und mir meist einen üppigen Rest ließ. War es die widerwärtige Pirsch an die Person, deren Lebenssaft ich rauben musste? Oder der Akt des Zubeißens, der erste Kontakt mit der warmen, oft genug vor Dreck speckigen und stinkenden Haut? Ich verspürte nicht ein einziges Mal den Wunsch, einmal selbst jagen zu gehen. Nur zu gerne ließ ich Ludwig den Vortritt und machte mir darüber nicht allzu viele Gedanken. Und da Ludwig ebenfalls damit zufrieden schien, wurde es mir bald zur Gewohnheit.
Etwas, das selbst über Jahrzehnte hinaus nicht zur Selbstverständlichkeit werden sollte, war das Leben im Dunkeln, zu dem Vampire verdammt waren. Unsere papierdünne Haut bot keinerlei Schutz vor den für uns tödlichen Strahlen der Sonne, und so mussten wir uns selbst bei wolkenverhangenem Himmel wie die anderen Kreaturen der Nacht in finsteren Gewölben verkriechen und darauf warten, dass die Sonne unterging. Erst dann konnten wir uns gefahrlos nach draußen begeben. Anfangs wollte ich nicht begreifen, warum ich nicht auch die Tage genießen konnte. Ich erinnerte mich verschwommen an frühere Ausflüge zur Mosel oder in Parks, die ich als Mensch so geliebt hatte. Warum sollte ich nicht auch als Vampir in den Genuss dieser Annehmlichkeiten kommen?
Die schmerzliche Antwort sollte ich am eigenen Leib zu spüren bekommen, als ich an einem herrlichen Tag Ludwigs eindringliche Warnungen in den Wind schlug und trotzig in den gleißenden Sonnenschein trat. Kaum trafen die Strahlen auf meine bleiche Haut, spürte ich sie wie Millionen spitzer Nadeln meinen Körper durchbohren. Ich brannte! Und nicht nur der Teil meiner Haut, der dem Licht schutzlos ausgesetzt gewesen war, brannte wie Feuer, sondern mein ganzer Körper reagierte darauf. Ich litt Höllenqualen. Geläutert zog ich mich danach in unser schützendes Heim zurück, verbrachte lange Zeit mit heftigen Schmerzen in Ludwigs dunklem, wohltuenden Keller und schwor, nie wieder gegen meine Natur zu handeln. Ich hatte meine dritte Lektion gelernt und mied fortan den Tag.
Es war die Schwierigste aller Lektionen, die ich nur deshalb ertragen konnte, weil Ludwig mich kurz nach jenem Fehltritt endlich in seine Arbeit einweihte. Diese war nicht nur für mich ein Hoffnungsschimmer, mein Licht am Ende einer langen, dunklen Nacht. Denn Ludwig untersuchte seit Jahren, wie es Vampiren in der Zukunft möglich sein könnte, auch am Tage aktiv zu sein, ohne Schaden zu nehmen. Mit einem Medikament, das er Calorsin nannte, wollte er die Empfindlichkeit unserer Haut herabsetzen und einen Schutzschild schaffen, der verhinderte, dass die Sonnenstrahlen uns verbrannten. Wenn das Mittel tatsächlich wirken würde, erklärte Ludwig stolz, wären wir nicht mehr dem Diktat der Tages- und Nachtzeiten unterworfen, wir hätten die Freiheit, uns unter freiem Himmel zu bewegen, wann immer wir dieses wollten. Das würde unser Leben revolutionieren. Bislang hatte er nur die Vorstudien daran machen können, weil es ihm an passenden Probanden mangelte. Doch in mich, so versicherte er mir, lege er große Erwartungen. Mit meiner Hilfe würde er das Calorsin weiterentwickeln können und vielleicht sein Ziel erreichen.
Ich war gerührt und überzeugt, Ludwig bei seiner bahnbrechenden Idee unterstützen zu können. Ich glaubte ihm und teilte seine Hoffnungen nur zu gern. Ludwig dämpfte meinen Optimismus jedoch und machte keinen Hehl daraus, dass es für mich nicht einfach und ungefährlich werden würde. Er warnte vor unvermeidbaren Rückschlägen und vor zu viel Euphorie, da diese die Enttäuschungen über einen Misserfolg nur vergrößern würden. Nichtsdestotrotz war ich augenblicklich von seiner Idee begeistert und bat ihn, sofort mit den ersten Versuchen zu beginnen. Ich konnte es kaum erwarten, der Dunkelheit zu entkommen, so sehr war ich ihr mittlerweile überdrüssig geworden.
In jener Nacht, als mich Ludwig endlich in seine Forschung mit einbezog, wagte ich es noch einmal, ihn etwas genauer darüber auszufragen. Doch seine Antwort war mehr als deutlich und wies mir unmissverständlich die mir zugedachte Rolle zu.
»Nein, Seraphim!«, sagte er hart. »Du solltest ein für alle Mal einsehen, dass ich nicht bereit bin, meine Arbeit offenzulegen. Es handelt sich dabei um eine wissenschaftliche Theorie, die ich im Laufe vieler Jahrzehnte unter großen Mühen aufgestellt habe. Sie ist mein Werk. Deine Aufgabe als Probandin ist es, die Gültigkeit meiner Theorie in der Praxis zu beweisen. Das ist zugegebenermaßen nicht ganz ungefährlich, aber absolut notwendig, um Calorsin zum Erfolg zu führen. Du hast dich dazu bereit erklärt. Nun kümmere du dich um deine Pflichten, so wie ich mich um meine kümmere.«
Damit schien das Thema für ihn erledigt und ich wagte danach nicht mehr, ihn weiter damit zu behelligen. Lieber genoss ich die Aussicht auf eine Zukunft in Freiheit. Es dauerte jedoch etliche Jahre, bis Ludwigs Medikament endlich die richtige Zusammensetzung hatte. Ganz wie er es prophezeit hatte, mussten wir zu Anfang einige Fehlschläge verkraften. Während ich mich dann im dunklen Keller regenerierte, arbeitete Ludwig wie besessen an einer Verbesserung des Wirkstoffs. Es war für mich eine Zeit voller Schmerzen, Finsternis und Einsamkeit. Dennoch versuchte ich, den Dingen etwas Gutes abzugewinnen, gaben mir diese Pausen doch genügend Gelegenheit, über mein vergangenes Leben als Mensch und mein neues Leben als Vampir nachzudenken.
Ich wusste, dass ich irgendwann einmal eine Familie gehabt hatte. Nach all den Jahren war davon auszugehen, dass meine Anverwandten nicht mehr lebten, daher bat ich Ludwig um Erlaubnis, wenigstens nach ihrem Grab suchen zu dürfen. Er willigte mürrisch ein und begleitete mich eines Nachts zum Hauptfriedhof, wo er mir tatsächlich die Stelle zeigte, an der meine Eltern beerdigt lagen. Neugierig betrachtete ich die kleine, schattige Ruhestätte mit dem grauen Gedenkstein, der zur Hälfte mit Moos überwachsen war. Ich kratzte ein wenig davon ab und fand einen dritten Namen über dem meines Vaters: »Resa« stand da, geboren am 19. Januar 1884, gestorben 1908. Kein genaues Datum, nur das Jahr. Sie hatten mich nie gefunden, hatten nie von ihrer Tochter richtig Abschied nehmen und in ihrer Trauer nur das Jahr meines Verschwindens eingravieren können. Ich ließ es zunächst dabei bewenden und tat Ludwig gegenüber so, als wäre die Angelegenheit damit für mich abgeschlossen. Ich schlich mich jedoch später viele Male heimlich an diesen Ort zurück. Wie ein weidwundes Tier lag ich am Grabesrand und bat meine Eltern um Vergebung für die Schmerzen, die mein Verschwinden ihnen bereitet haben musste. Im Laufe der Zeit verwilderte das kleine Blumenbeet zusehends, der Gedenkstein verwitterte und zerbröckelte, bis irgendwann das Grab ganz aufgelöst und eingeebnet wurde. Bald darauf stand ein neuer, sauberer Stein mit goldpolierten Lettern auf der frisch angelegten Stätte und wünschte einem Unbekannten die verdiente, friedvolle Ruhe.
Auch dem bescheidenen, schmucklosen Grab einer Marie Theisen stattete ich einige Besuche ab. Es lag in der Nähe der Mosel und ich war eines Nachts durch Zufall darauf gestoßen. Warum ich dort verweilte, konnte ich mir selbst nicht genau erklären. Es schien, als wolle die Tote mir aus der Ewigkeit heraus etwas sagen, doch hörte ich nie etwas anderes als die Nachtvögel und das Rascheln der Tiere im Gebüsch. Marie Theisen war mit fünfundzwanzig Jahren im selben Jahr wie ich gestorben, und aus mir unerfindlichem Grund empfand ich tiefe Trauer darüber, dass sie nicht ein langes, glückliches Leben hatte führen können. Wie zuvor das Grab meiner Eltern wurde ihres irgendwann aufgelöst.
Das war das Los der Unsterblichkeit: Menschen kamen und gingen für immer. Vampire jedoch blieben. Wenn ich Ludwig und mich als so etwas wie Vater und Tochter betrachtete, erweiterte eines Tages erst ein Bruder, später ein zweiter unsere kleine Familie. Ich werde die Nacht nie vergessen, in der Ludwig um ein Gespräch bat. Es war nicht so, dass wir wenig Gelegenheit zum Reden hatten. Wir verbrachten viel Zeit miteinander in seinem Gewölbekeller, auch wenn ich mir manchmal den einen oder anderen Ausflug abtrotzte. Aber die Art und Weise, wie mein Mentor in jener Nacht um eine Unterredung in seinem privaten Wohnraum bat, war mehr als ungewöhnlich für ihn, der sonst eine so strenge und abweisende Art an den Tag legte. Fast benahm er sich, als ginge er zur Beichte und erwarte von mir Absolution. Als ich mich zur verabredeten Zeit zu Ludwig begab, wirbelten meine Gedanken durcheinander und ich war gespannt, aber auch ein wenig argwöhnisch. Ich konnte mir sein seltsames Verhalten nicht erklären. Und als er unruhig zwischen dem Bücherregal und mir hin- und herlief, konnte ich seine ungewöhnliche Rastlosigkeit nicht länger ertragen und fragte frei heraus: »Was ist los, Ludwig? Du bist doch sonst nicht so förmlich, wenn wir etwas zu bereden haben.«
Nach einer Weile schaute er zu mir herüber und hielt meinen Blick fest. »Es ist nicht einfach, damit anzufangen, Seraphim«, begann er zögerlich. »Ich möchte nichts falsch machen. Und schon gar nicht möchte ich, dass du mich missverstehst!«
»Erzähle mir bitte, was dir auf dem Herzen liegt.« Allmählich bekam ich etwas Angst und glaubte zu ahnen, in welche Richtung dieses Gespräch gehen würde. Hatte er meine kleinen Geheimnisse entdeckt? War ich vielleicht zu unvorsichtig gewesen? War er hinter meine unerlaubten Ausflüge und Spielereien gekommen?
Neben meinen gelegentlichen Streifzügen durch die Stadt frönte ich einer weiteren, unerlaubten Leidenschaft. Ich spielte allzu gerne Katz und Maus und genoss es, wenn ein Mann von mir und meinem makellosen Körper beeindruckt war. Wenn er mich umschwirrte wie eine Motte die Laterne in einer dunklen Nacht. Es reizte mich, seinem erfolglosen Hofieren und Schmeicheln scheinbar nachzugeben. Ich wusste, ich gewann nichts und riskierte alles, wenn ich in Versuchung geriet. Und doch gönnte ich mir dieses Spielchen zuweilen aus reinem Spaß – und um herauszufinden, wie weit ich gehen konnte, ohne meine wahre Identität preiszugeben.