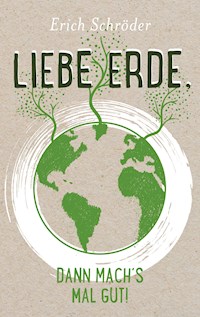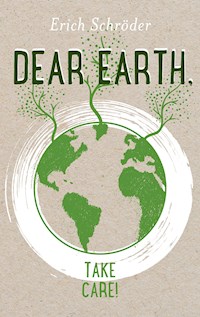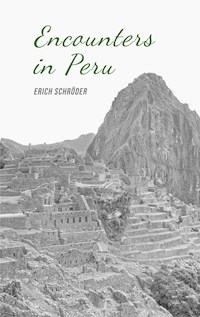Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wie fühlt es sich an, vor 20 jungen und neugierigen Medizinstudenten und Studenten zu stehen, um ihnen etwas aus der eigenen Lebenserfahrung für ihren Arztberuf mitzugeben? Dr. med. Erich Schröder, Ingenieur, Arzt, Journalist und Lebenskünstler wollte es genau wissen. Und das Experiment wurde zu einer richtigen Erfolgsgeschichte! Zwar hatten die jungen Studierenden meist ganz andere Erwartungen an ein Seminar mit dem Titel „Grundzüge ärztlichen Denkens und Handelns“. Aber nach einer ersten Überraschungsphase konnten sie von den vielen kleinen und großen, erfreulichen und schmerzhaften Erlebnissen, Anekdoten und Erfahrungen aus dem Leben eines Arztes in seiner Hausarztpraxis und anderen ärztlichen Tätigkeiten kaum mehr genug bekommen. Ihnen eröffnete sich eine menschliche und meist heitere Seite des Arztberufes neben der wissenschaftlichen Medizin. Statt einer Vorlesung gab es viele Geschichten, aber auch Gedanken über das heute schwieriger gewordene ökonomische und rechtliche Umfeld der ärztlichen Tätigkeit. Der Autor und Dozent aus Leidenschaft führt diese Eindrücke in einer Erzählung zusammen, die nicht zuletzt dem Respekt vor großen ärztlichen Vorbildern gewidmet ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 123
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALTSVERZEICHNIS
WER MIT GENUSS MEDIZIN STUDIEREN WILL GEHT NACH BERLIN
ANKUNFT IN BERLIN MIT EINEM AUFTRAG
GET TOGETHER – DIE EIGENE LEBENSGESCHICHTE ALS EISBRECHER
DAS GESUNDHEITSSYSTEM – OFT GEHT´S UMS GELD
ARZT UND RECHT – EINE SCHWIERIGE BEZIEHUNG
ARZT, ETHIK UND GESELLSCHAFT – SPANNUNGSFELDER IN EINEM SPANNENDEN BERUF
KOMMUNIKATION – BASIS UND RISIKO DES ARZTBERUFS
BESUCHE UND EXKURSIONEN – AUS DER UNI IN DIE ZENTREN DES GESUNDHEITSWESENS
ÄRZTLICHES SELBSTVERSTÄNDNIS – WAS HEIßT „ARZT SEIN“?
EPILOG – DAS GEHEIMNIS DER BANK
Wer mit Genuss Medizin studieren will geht nach Berlin
Die Charité in Berlin ist wohl eines der berühmtesten Krankenhäuser der Welt mit einer bedeutenden Historie und einer immer noch sehr respektablen Gegenwart. Gegründet 1710 als Pesthaus, entwickelte sich die Charité zu einer angesehenen Lehr- und Forschungsstätte der Medizin, die zahlreiche berühmte Forscher und große Ärzte hervorgebracht hat. Robert Koch, Rudolf Virchow und Christoph Wilhelm Hufeland sind nur drei Namen von vielen, die die Geschichte der Charité mit geschrieben haben. Heute ist die Charité mit etwa 3.200 Betten, 13.000 Mitarbeitern und 7.000 Studenten das größte Universitätsklinikum Europas.
Die beeindruckende Historie ist auch noch jetzt beim Betreten des Charité-Geländes in Berlin-Mitte allgegenwärtig: Denkmäler und Gedenktafeln weisen auf die großen Gelehrten hin, Straßennamen im separaten Gelände der „alten Charité“ sind nach ihnen benannt.
Auch der Anblick mancher ehrwürdiger, kaum renovierter Gebäude vermittelt einen Eindruck der jahrhundertealten Tradition. Kein Medizinstudent kann sich wohl diesem Fluidum entziehen. Aber warum auch? Hier wurde Großes entdeckt und geleistet – sicher zwei Gründe, warum die Atmosphäre der alten Stätten und Memorabilien so inspirierend ist, um durch eigene Leistungen selbst etwas zum Fortschritt der Medizin beizutragen. Kann es eine bessere Lehrstätte für die vielen jungen Menschen geben, die in Deutschland Medizin lernen wollen?
Daneben ist es natürlich auch die Stadt, die die jungen Leute anzieht. Berlin besticht mit einer bunten Vielfalt an Menschen und Kulturen, einer turbulenten Historie und einer pulsierenden Gegenwart samt ständiger Veränderung. Es ist eine Stadt, die an keinem Tag langweilig wird. „Arm – aber sexy“, wie es ein Regierender Bürgermeister einmal beschrieben hat. Jederzeit ist irgendwo Partyzeit, denn das Angebot der unzähligen Bars, Restaurants und Kneipen erscheint wahrhaft unbegrenzt. Die Stadt verwöhnt Alt und Jung mit Musik aller Richtungen, Theater und Straßenkunst im Überfluss. Und nicht zuletzt ist Berlin auch eine grüne Stadt mit viel Wasser und einem Umland aus schöner Natur. Welcher Abiturient, der sich gerade von zu Hause abnabelt, möchte nicht hier sein Studium beginnen?
Aber was treibt einen alten Rheinländer nach Berlin, und wie fühlt er sich dort? Auch Köln und Düsseldorf, meine Heimat, sind sehr schöne Städte mit einer jeweils sehr lebendigen Szene – und das nicht nur zum Karneval. Und verglichen mit dem Rhein ist die Spree, ebenso wie die Havel, allenfalls ein Rinnsal. Ich kenne Berlin noch aus der Zeit der geteilten Stadt und war auch damals oft dort. Regelmäßig, also fast jede Woche bin ich aber erst seit meiner Tätigkeit als Journalist etwa ab 2007 in der Hauptstadt. Berlin hat mich immer fasziniert, auch wenn die bedrohliche politische Situation die Begeisterung damals überschattet hat. Seit dem Tag der Einheit überzeugt mich diese Stadt noch mehr und ich bin sehr gerne in Berlin. Und wenn mich doch einmal eine „rheinische Sentimentalität“ überkommt – direkt am Spreeufer gibt es eine fast kölsche Kneipe, die StäV, was so viel heißt wie „Ständige Vertretung des Rheinlands in Berlin“. Dort gibt es leckeres Kölsch und rheinische Gerichte – und den Blick auf den Fluss, der nach dem zweiten Kölsch schon gar nicht mehr so klein erscheint. Und sieht die Brücke am Bahnhof Friedrichstraße nicht aus wie die Hohenzollernbrücke in Köln? Na ja, beim dritten Glas ein wenig.
Ich habe hier von Abiturienten und Studenten gesprochen, und im weiteren Verlauf wird viel von Ärzten die Rede sein. Bitte glauben Sie mir, dass ich Abiturientinnen, Studentinnen und Ärztinnen mindestens genauso schätze wie ihre männlichen Kollegen und weit davon entfernt bin, diese in irgendeiner Weise diskriminieren zu wollen. Bitte gestatten sie einem schon etwas älteren Autor diese altmodische Eigenart.
Doch nun machen wir weiter mit den spannenderen Dingen. Wie ist es, als Arzt in dieser interessanten und hochehrwürdigen Universität vor Studenten zu stehen und über das aufregende Leben in der ärztlichen Praxis zu erzählen? Wie war dabei das „erste Mal“? Nun denn, los geht’s, auf nach Berlin!
Ankunft in Berlin mit einem Auftrag
Mein erster Kurstag an der Charité begann in diesem Semester erst um 16 Uhr und zum Glück hat das Flugzeug mich rechtzeitig in Berlin abgesetzt – ich musste ja aus Düsseldorf dorthin und nahm die „Luftbrücke“. Das Flugzeug ist – frühzeitig gebucht – nicht nur das schnellste, sondern auch das preisgünstigste Verkehrsmittel auf dieser Strecke. Wie die meisten treuen Lufthansa-Flieger bin ich allerdings nicht gut darauf zu sprechen, dass man uns Düsseldorfer kurzerhand von der Lufthansa abgekoppelt und mit der Billigfluglinie Germanwings bestraft hat. Wir sind hier alle der Auffassung, dass wir das nicht verdient haben.
Der TXL-Bus vom Flughafen Tegel (TXL) nach Berlin-Mitte ist oft unpünktlich und meist auch sehr voll, aber er fährt in kurzen Abständen und ist eine selten günstige Anbindung einer Großstadt an einen Flughafen. Bis zum Karlplatz, wo bereits das vom Bildhauer Fritz Klimsch 1910 geschaffene Denkmal von Robert Virchow auf die nahegelegene Charité hinweist, fährt der TXL gut 20 Minuten und von dort sind es noch vielleicht 5 Minuten Fußweg auf der Luisenstraße bis zu den wichtigsten Gebäuden der Charité, die links und rechts entlang der Straße liegen. Vorbei geht es am Haus Nr. 57, wo Robert Koch im damaligen Kaiserlichen Gesundheitsamt tätig war, eine Gedenktafel erinnert heute daran. Schließlich passiert man auf der rechten Seite das erst 1982 erbaute 21-Etagen-Bettenhaus, ein markantes Gebäude in der Berliner Stadtsilhouette. Danach endet die Luisenstraße auf dem Robert-Koch-Platz mit dem Denkmal des berühmten Arztes und dem anschließenden Platz vor dem neuen Tor. Das Robert-Koch-Denkmal wurde 1916 von Louis Tuaillon in Carrera-Marmor gestaltet.
Aber bevor ich mich wieder einmal auf ein weiteres Semester in den Hörsaal im Robert-Koch-Haus wagte, wollte ich in der Nähe der Charité noch etwas essen. So begab ich mich zum chinesischen Schnellimbiss in der Luisenstraße, wo es ein leckeres Entengericht gibt, wie ich schon einmal ausgetestet habe. Zwar weiß ich als Arzt gesundes Essen zu schätzen, andererseits bin ich auch Journalist über gesundheitspolitische Themen und muss daher oft die schnelle Küche nehmen, wenn ich rechtzeitig am „Ort des Geschehens“ zu sein. Und heute habe ich wieder einmal das Glück und die Ehre, junge Mediziner in dem Haus unterrichten zu dürfen, in dem schon Robert Koch gewirkt hat. Um ihnen vom „Abenteuer Arztleben“ zu erzählen, reise ich eigens aus meiner Heimatstadt hierher.
Ein ehrwürdiges Haus mit Schweißgeruch
Die Ehre, in einem historisch so bedeutsamen Gebäude unterrichten zu dürfen, hat natürlich auch ihren Preis. Der erste Eindruck erweckt das Gefühl, dass hier in Gedenken an Robert Koch kein Handwerker mehr den Meißel an den Putz gelegt hat. Das mag übertrieben klingen, aber wer moderne Konferenzräume gewohnt ist, der wird sich ein Jahrhundert zurückversetzt fühlen. Mein Kurs war immer auf 20 Teilnehmer limitiert und fand in einem kleinen Seminarraum statt, wo man eng zusammenrücken musste, wenn 20 Personen Platz finden sollten. Alte Zweifach-Holzfenster mit kleinen Scheiben in Richtung der viel befahrenen Luisenstraße sorgten – sofern geschlossen – immerhin für passablen Schallschutz. Eine Klimaanlage kannte Robert Koch natürlich noch nicht, und auch nachträglich befand man eine solche Einrichtung offenbar als inkompatibel mit dem Gesicht der historischen Stätte. Jedenfalls hat man hier regelmäßig die Wahl zwischen Autolärm bei geöffneten und Schweißgeruch bei geschlossenen Fenstern, was manche Zwangslüftungspause erforderlich macht.
Ärzte und Ökonomen – wer managet wen?
Doch wie kam ich überhaupt dazu, in diesem Gebäude über das aufregende Leben als Arzt plaudern zu dürfen? Nun, offenbar befand man, dass man sich in unserer turbulenten Zeit mit über hundert medizinischen Nebenzweigen wieder aufs Wesentliche konzentrieren sollte, weshalb an der Universität der Lehrbereich „Grundzüge des ärztlichen Denkens und Handelns“ entstand. Ich durfte dort über die „Medizinische Versorgung in Zeiten knapper Kassen“ reden. Das Thema hört sich nach einem betriebswirtschaftlichen Sparkurs an und den gibt es auch in der Tat. Dafür gibt es inzwischen eine zunehmende Anzahl von medizinischen Kalkulationsakrobaten, die sich irgendwo zwischen Ökonomie, Management und Politik bewegen. Inzwischen haben wir zwar einen erheblichen Mangel an Ärzten und Krankenschwestern, dafür aber eine wahre Schwemme von diesen neuen Gesundheitswissenschaftlern, die sich scheinbar alle vorgenommen haben, unser Gesundheitswesen von Grund auf neu zu organisieren. Die eigentlich wichtigste Beziehung im Gesundheitssystem, nämlich die zwischen Patient und Arzt, gerät dabei leicht in den Hintergrund. Der Patient wird dann zum Kunden in einem Dienstleistungsbetrieb, was mich bei einem Vortrag dazu verleitet hat, ein altes Indianerzitat wie folgt abzuwandeln:
„Erst wenn alle Patienten Kunden sind, wenn alle Ärzte durch Manager ersetzt sind, wenn jedes Wort nach Kosten und Nutzen bewertet und jeder Furz evidenzbasiert geblasen wird, dann werden die Menschen merken, dass Gesundheitsmanagement nicht gesund, sondern krank macht.“
Natürlich ist das etwas polemisch, aber es fand spontanen Beifall und löste eine Diskussion aus. Und lesen wir nicht immer wieder Klagen von Patienten, Krankenschwestern und Ärzten über schlimme Zustände in Kliniken, wo massiv an Personal gespart wird? Pflegemängel und Behandlungsfehler sind oft die Folge, wenn eine Klinik allzu streng nach wirtschaftlichen Kriterien geführt wird. Auch der Deutsche Ethikrat hat sich bereits in einem ausführlichen Gutachten mit diesem Problem auseinandergesetzt. Dabei teile ich durchaus die Auffassung, dass der extrem komplexe Moloch des deutschen Gesundheitswesens geradezu nach mehr Management schreit. Ob dies allerdings von frischgebackenen Bachelors gestaltet werden sollte, die – meist jung und gesund – das komplexe Beziehungsgeflecht um Krankheit und Medizin bestenfalls vom Hörensagen kennen, wage ich doch sehr zu bezweifeln. Ein intelligenter Rat sollte natürlich immer willkommen sein, allerdings wollen diese Manager und Ökonomen auch gut bezahlt werden, was die Kosten des Systems erst einmal steigen lässt.
Der Arzt und die Gesundheitsmanagerin – gute Freundschaft geht trotzdem!
An dieser Stelle möchte ich eine gute Freundin erwähnen, nennen wir sie Jana. Als Jana mich das erste Mal anrief, war sie noch Ökonomiestudentin und brauchte für eine Seminararbeit Informationen über die ökonomischen Strukturen im Gesundheitswesen. Ich lud sie zu einem meiner Vorträge ein, wo Arzneimittelverordnungen und ihre Kosten im Fokus der Diskussion standen. Sie saß mit mir auf dem Podium und staunte über den Eifer der Ärzte in der Diskussion. Dabei lernte sie ihr ziemlich fremde Argumente kennen: Nie hätte sie vorher gedacht, dass ein Arzt für die Kosten seiner Verordnungen, an denen er selbst nichts verdient, von den Krankenkassen in Regress genommen werden kann. Aber schon bald mischte sie sich in die Diskussion mit ein. Es war der Beginn einer Freundschaft, in der ich anfangs die Rolle eines Mentors einnahm, aber recht bald holte sie mächtig auf. Ich verfolgte mit Freude ihr Diplom, die Promotion und später auch die Habilitation. Zwischendurch lernte und forschte Jana in den USA weiter, im „Homeland of Managed Care“. Als Junior Professor in den USA erhielt sie bald auch den Ruf einer deutschen Hochschule, um dort als Professorin zu forschen und lehren. Und wir diskutieren weiter – und wie! Ihre Managementlehre und mein eher konservatives ärztliches Berufsbild sind oft wie Feuer und Wasser, was unsere regelmäßigen Treffen und Diskussionen nie langweilig werden lässt und unsere Freundschaft weiter vertieft. Besonders intensiv verläuft unsere Diskussion immer bei den Themen Entscheidungsspielraum des Arztes und ärztliche Honorare. Regelmäßig wehre ich mich dann dagegen, die ärztliche Entscheidungsfreiheit einem kaufmännisch orientierten Manager oder Geschäftsführer unterzuordnen oder das ärztliche Honorar an einen wie auch immer definiertes Behandlungsergebnis zu knüpfen. Was in einer Autowerkstatt vielleicht ganz gut funktioniert lässt sich eben nach meiner Auffassung nicht auf die ärztliche Tätigkeit übertragen. Es würde an der Vielfalt der menschlichen Individualität scheitern, jeder Patient ist anders und jeder Fall ist anders.
An einem warmen Sommerabend saßen wir in Köln in einem Bistro auf der Straße und redeten. Als Jana einmal kurz verschwand, sprach mich ein älterer Herr, ein bekannter Rundfunkjournalist, vom Nebentisch aus an: „Was sind Sie beide für ein tolles Paar! Sie reden hier schon eine Stunde miteinander und haben noch nicht einmal auf Ihr Smartphone geschaut.“ In der Tat, auf die Idee, während dieses Gesprächs mit dem Smartphone zu spielen, wären wir nicht gekommen. Zum Glück hat es auch nicht geklingelt. Etwas enttäuscht erfuhr der Herr von mir, dass wir zwar gern miteinander reden, aber kein Paar sind. Geschmeichelt fühlte ich mich aber schon, denn Jana ist 30 Jahre jünger als ich. Was ich mit dieser Anekdote sagen will: Diese neuen Gesundheitsökonomen und Ärztealter Schule wie ich können durchaus gute Freunde sein und sich gegenseitig bereichern.
„Knappe Kassen“ – ein gut gepflegtes Totschlagargument
Aber zurück zum Thema „Medizinische Versorgung in Zeiten knapper Kassen“. Beim ersten Nachdenken über das Thema wurde mir schnell klar, dass ein rein ökonomisches Räsonieren über die Auswirkungen der „knappen Kassen“ zu kurz gesprungen wäre. Tatsächlich hat die permanente Diskussion um knappe Ressourcen in der Medizin weit mehr verändert als ein paar Einsparungen im Medizinbetrieb. Nicht, dass die Ressourcen in Deutschland jemals wirklich knapp waren, aber der Druck der jahrelangen Diskussion sorgte für weitreichende Verhaltensänderungen bei Ärzten bis hin zu Änderungen im ärztlichen Selbstverständnis. Ganz im Sinne der Krankenkassen begannen viele Ärzte, mit ihren Patienten über Kosten zu diskutieren und ihnen aus Angst vor Regressforderungen teure Therapien vorzuenthalten. Immer mehr Ärzte mutierten aus solcher Not vom Mediziner zum Manager. Letztlich wurde der Druck der Kassen zu Kostensenkungen bei ärztlichen Verordnungen auch rechtlich untermauert und hatte für den Arzt weitreichende Konsequenzen. Gleichzeitig sind die Erwartungen der Gesellschaft an Ärzte hoch – und nehmen eher noch zu. Auch der ethische Anspruch des Arztes an sich selbst steht einer billigeren und möglicherweise minderwertigen Versorgung seiner Patienten entgegen. Doch nicht zuletzt macht die Kommunikation den Deal. Dem systematischen und kontinuierlichen Wehklagen über knappes Geld vonseiten der gesetzlichen Krankenkassen, das regelmäßig die Titelseiten der Presse erreichte, hatten Politik und Ärzteschaft lange Zeit nicht viel entgegenzusetzen. Ich beschloss also, mein Seminarthema weit auszulegen und neben der Ökonomie auch die Bereiche Recht, Ethik, Gesellschaft und Kommunikation anzusprechen, denn diese Bereiche greifen so ineinander, dass sie sich kaum isoliert betrachten lassen. Die Verbindung würde auch dem Rahmenthema „Grundzüge des ärztlichen Denkens und Handelns“ eher gerecht.
Das „1. Mal“: Lampenfieber und Glücksgefühle
Auch wenn ich in meinem Berufsleben schon einige Hundert Vorträge vor Ärzten und Pharmamanagern gehalten hatte – das erste Mal im Hörsaal vor einer lebhaften Studentengruppe war dann doch ganz anders als das übliche Auditorium. Unsicherheit und Selbstzweifel kamen auf, die ich mir natürlich nicht anmerken lassen wollte. Wie werde ich ankommen? Werden die jungen Leute sich für meine Botschaften interessieren? Also tief durchatmen – und nichts wie rein!