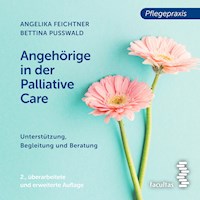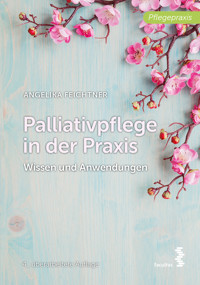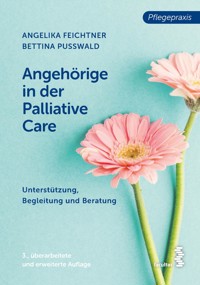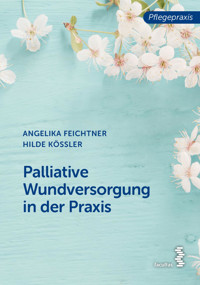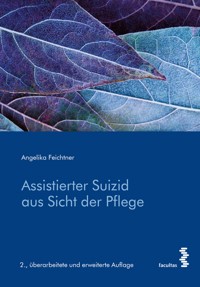
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Facultas
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der assistierte Suizid und die Pflege Seit 2022 ist die Beihilfe zum Suizid auch in Österreich legal. Der assistierte Suizid stellt nicht nur eine rechtliche, ethische und medizinische Herausforderung dar, sondern auch eine pflegerische. In allen Ländern, in denen Suizidassistenz legali-siert wurde, sind Pflegende in unterschiedlicher Weise in assistierte Suizide involviert. In diesem Buch wird der assistierte Suizid aus Sicht der Pflege beleuchtet, es werden die Hintergründe der Suizidassistenz und auch praktische Erfahrungen beschrieben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Angelika Feichtner
Assistierter Suizid aus Sicht der Pflege
Angelika Feichtner, MSc
Diplom in Palliative Care der International School of Cancer Care in Oxford, langjährige Pflege- und Lehrpraxis im Bereich von Palliative Care und Hospizarbeit.
Eine geschlechtergerechte Schreibweise wird in diesem Buch vorwiegend durch die Verwendung der Schreibung mit Stern * realisiert. Ist eine korrekte, alle Endungen berücksichtigende Schreibung auf diese Weise nicht möglich oder erfordert sie Ergänzungen, die den Lesefluss hemmen, so wird – stellvertretend für alle Geschlechter – die weibliche Form gewählt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Alle Angaben in diesem Buch erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr, eine Haftung der Autorin oder des Verlages ist ausgeschlossen.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und der Verbreitung sowie der Übersetzung, sind vorbehalten.
2. Auflage 2024
Copyright © 2022 Facultas Verlags- und Buchhandels AG
facultas Verlag, 1050 Wien, Österreich
Umschlagbild: © itthinksky, Close-up of frosty leaves, istockphoto.com
Lektorat: Laura Hödl
Satz: Florian Spielauer, Wien
Druck und Bindung: Facultas Verlags- und Buchhandels AG
Printed in Austria
ISBN 978-3-7089-2483-0
E-ISBN 978-3-99111-868-8
Inhalt
1 Assistierter Suizid aus Sicht der Pflege
1.1 Gesellschaftliche Entwicklung
1.2 Definitionen und Begriffe
1.3 Entwicklung in Österreich
1.3.1 ASCIRS
1.4 Prinzipielle Überlegungen
1.4.1 Selbstbestimmung und Autonomie
1.4.2 Die Frage der Würde
1.4.3 Freier Wille und Entscheidungsfähigkeit
1.4.4 Der Einfluss des Bindungsverhaltens
1.5 Phänomenologie der Sterbe- und Suizidwünsche
1.5.1 Hintergründe des Wunsches nach assistiertem Suizid
1.5.2 Die Mitteilung von Sterbe- und Suizidwünschen
1.5.3 Praktische Empfehlungen für Gespräche über Sterbe- und Suizidwünsche
1.6 Suizidalität
1.6.1 Daran denken, danach fragen, darüber sprechen
1.6.2 Weniger Suizide durch Legalisierung des assistierten Suizids?
1.7 Präventiver Suizid
1.7.1 Die Angst vor einem „beschämenden“ Tod
1.8 Die Verantwortung der Medien
2 Praxis des assistierten Suizids
2.1 Was beinhaltet Hilfe beim assistierten Suizid?
2.1.1 Die Sterbeverfügung
2.1.2 Suizidmittel und Begleitmedikation
2.1.3 Applikationsformen des Suizidmittels
2.1.4 International verwendete Mittel für den assistierten Suizid
2.1.5 Kritische Ereignisse und Probleme – Erfahrungen aus ASCIRS
2.2 Assistierter Suizid – Das Erleben der Angehörigen
2.2.1 Ein guter Tod?
2.2.2 Sterben nach Plan
2.2.3 Trauer nach einem assistierten Suizid
2.3 Auswirkungen des assistierten Suizids auf die professionelle Pflege
2.3.1 Das ethisch-moralische Dilemma
2.3.2 Die Bedeutung der eigenen Position
2.3.3 Leiden
3 Beispiele internationaler Praxis der Suizidassistenz
3.1 Assistierter Suizid und MAID in Kanada
3.1.1 Voraussetzungen für die Zulassung zu MAID
3.1.2 Durchführung von MAID
3.1.3 Kontrolle und Verhinderung von Missbrauch
3.2 Assistierter Suizid und Tötung auf Verlangen in den Niederlanden
3.2.1 Voraussetzungen für Zulassung zu assistiertem Suizid und Tötung auf Verlangen in den Niederlanden
3.2.2 Tötung von Neugeborenen und Säuglingen
3.2.3 Assistierter Suizid und Tötung auf Verlangen bei Demenz
3.2.4 Assistierter Suizid und Tötung auf Verlangen aufgrund von Leiden am Leben
3.2.5 „Lastwillpill“ als Lösung?
3.2.6 Das Expertisezentrum Euthanasie
3.2.7 Die Praxis
3.3 Assistierter Suizid in der Schweiz
3.3.1 Aufgaben der Ärzt*innen und Pflegepersonen beim assistierten Suizid
3.3.2 Durchführung des assistierten Suizides
3.3.3 Transparenz und Kontrolle
3.3.4 Der Altersfreitod
4 Assistierter Suizid und Ökonomie
5 Mögliche künftige Entwicklungen
5.1 Assistierter Suizid bei Demenz
5.2 Assistierter Suizid bei Strafgefangenen
5.3 Organ- und Gewebetransplantation nach assistiertem Suizid
5.4 Überlegungen zum „guten“ Sterben
6 Alternativen zum assistierten Suizid
6.1 Therapiebegrenzung
6.2 Palliative Sedierung als Alternative zur Suizidassistenz?
6.3 Freiwilliger Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit
6.3.1 Der FVNF – keine Alternative für alle Suizidwilligen
6.4 Palliative Care und assistierter Suizid – ein Widerspruch?
7 Perspektiven
Literatur
Verwendete Abkürzungen
1 Assistierter Suizid aus Sicht der Pflege
1.1 Gesellschaftliche Entwicklung
In den letzten 20 Jahren zeigte sich ein deutlicher Wandel in der gesellschaftlichen Einstellung zum Tod, insbesondere, was die Zeit des Sterbens betrifft. Während dem Sterbeprozess in der Pflege zunehmend mehr Aufmerksamkeit zukommt, besteht in der Gesellschaft allgemein die Haltung, dass diese Phase des Lebens am besten nicht bewusst erlebt oder sogar abgekürzt werden sollte. Das Wissen um die Bedeutung dieser letzten Lebenszeit scheint verloren gegangen zu sein.
Hinzu kommen eine zunehmende Liberalisierung und die Ausweitung der individuellen Rechte, die Forderung nach mehr Selbstbestimmung und Autonomie bis hin zur Entscheidung, wann und wo der Tod eintritt. Die Vorstellungen eines „guten“ Todes haben sich verändert. Es gilt nicht länger der Wunsch nach einer guten Sterbestunde, für viele Menschen im westlichen Kulturkreis ist ein guter Tod heute ein selbstbestimmter Tod. Für moderne Menschen scheint das „Geschehen-Lassen“ im Sinne des Sich-Einlassens auf das, was im Sterben geschieht, keine Option zu sein. Die unterschiedlichen Vorstellungen von einem erstrebenswerten Sterben sind jedoch ebenso zu respektieren wie die individuellen Vorstellungen von einem guten Leben. Die Bedingungen des Lebens und auch des Sterbens sind eng mit den Konzepten von Würde verbunden. Es bestehen unterschiedliche Haltungen zu dem, was als würdig oder unwürdig wahrgenommen wird.
Mit der Phrase vom „würdigen“, weil selbstbestimmten Sterben wird jedoch impliziert, dass ein Sterben aufgrund einer schweren Erkrankung, verbunden mit Pflegebedürftigkeit und Angewiesenheit, an sich schon eine Verletzung der individuellen Würde darstellt. Das weist auch darauf hin, dass Würde in unserer Gesellschaft eng an Selbstständigkeit, Leistungsfähigkeit und Autonomie geknüpft ist.
Angewiesenheit auf die Unterstützung anderer ist jedoch ein Wesensmerkmal des Menschen. Besonders am Beginn und am Ende unseres Lebens sind wir auf die Hilfe und Fürsorge anderer angewiesen, aber auch in Zeiten einer Erkrankung und in Krisen. Diese dem Menschsein immanente Angewiesenheit als Würdeverlust zu werten, ist nur schwer nachzuvollziehen. Denn implizit würde damit allen pflegebedürftigen und schwerkranken Menschen die Würde abgesprochen werden.
Auf gesellschaftlicher Ebene ist die Debatte über den assistierten Suizid im Spiegel dieses derzeit herrschenden Würdekonzeptes des gesunden, selbstständigen und unabhängigen Menschen zu sehen. Wenn Kranksein und Pflegebedürftigkeit mit dem Verlust der Würde gleichgesetzt werden, ist das eine gefährliche Entwicklung und eine Absage an die gesellschaftliche Solidarität. In Anlehnung an Simone de Beauvoir (2008) lässt sich feststellen, dass eine Gesellschaft durch die Art, wie sie sich gegenüber ihren Kranken, Alten und Schwachen verhält, unmissverständlich die Wahrheit über ihre Grundsätze und Ziele enthüllt.
Solidarität als Grundprinzip einer Gesellschaft äußert sich in gegenseitiger Hilfe und dem Eintreten füreinander. In einer humanen Gesellschaft dürfen Kranke, Schwache, Alte und Hilfebedürftige nicht aus diesem Grundprinzip ausgeschlossen werden. Menschenwürde steht auch für die Forderung nach Achtung und Wertschätzung unabhängig von der gesundheitlichen Verfassung eines Menschen und auch unabhängig von persönlichen Leistungen.
Würde stellt daher einen normativen Anspruch dar und sie gilt unbedingt, auch in Situationen der Bedürftigkeit. Wenn die Angewiesenheit schwerkranker Menschen als würdelos dargestellt wird, wird ihnen zugleich vermittelt, dass der Wert ihres Lebens in Frage gestellt wird.
In den Debatten um den assistierten Suizid geht es also immer auch um Würde, ohne dass dabei näher definiert wird, worauf sich die Würde bei einer Selbsttötung begründet. Das Schlagwort vom würdevollen, weil selbstbestimmten Sterben ist gleichsam zum Slogan der Befürworter*innen der Suizidbeihilfe geworden.
Es wird vermittelt, dass die Entscheidung zu einem assistierten Suizid auf rationalen Überlegungen beruht. Dabei bleibt meist unberücksichtigt, dass jedem Sterbe- und Suizidwunsch tiefe Ängste zugrunde liegen. Es ist vor allem die Angst vor Kontrollverlust, davor, auf die Unterstützung anderer angewiesen zu sein und auch die Angst vor möglichem künftigem Leid. Die Entscheidung für einen assistierten Suizid ist daher kaum eine rationale Entscheidung, sondern immer auch von Ängsten geprägt.
Diesen Ängsten und Befürchtungen kann mit dem Angebot von Palliative Care wirksam begegnet werden. Und die Erfahrungen in der Praxis zeigen, dass der Wunsch nach Suizidassistenz selten stabil ist, sich nach verbesserter Symptomlinderung und umfassender palliativer Betreuung sehr oft auflöst und die Patient*innen sich wieder dem verbleibenden Leben zuwenden können. Ein Suizidwunsch bedeutet meist auch nicht, dass die Patient*innen sich den Tod wünschen, sondern dass sie an Grenzen des Ertragbaren gekommen sind und unter den momentanen oder befürchteten, künftigen Bedingungen nicht mehr leben wollen oder nicht mehr leben können. Bei der Betrachtung des assistierten Suizids besteht also ein Spannungsverhältnis zwischen dem Bedürfnis nach Linderung körperlicher und seelischer Leiden sowie der Wahrung der Würde einerseits und der Tatsache, dass der (assistierte) Suizid eine Flucht aus schwierigen und beunruhigenden inneren und unbewussten Konflikten darstellt andererseits (Briggs et al., 2022).
Die mit der Legalisierung der Suizidassistenz veränderten rechtlichen, sozialen und ethischen Rahmenbedingungen haben beträchtliche gesellschaftliche Implikationen und sie wirken sich auch auf die Arbeit der Gesundheitsberufe aus. Sie sind einerseits gefordert, sich mit ihren persönlichen Einstellungen, Überzeugungen und Werten hinsichtlich einer möglichen Suizidassistenz auseinanderzusetzen, andererseits aber auch damit, den Patient*innen mit anderen Vorstellungen von einem erstrebenswerten Leben und Sterben mit Achtung und Respekt zu begegnen.
Auch wenn Pflegepersonen aufgrund ihrer berufsethischen und eigenen moralischen Haltung den Wunsch von Patient*innen nach Suizidassistenz nicht unterstützen können, gilt doch die ethische Verpflichtung, das Leid des/der Patient*in mit Suizidwunsch bestmöglich zu lindern und mitmenschlichen Beistand zu bieten. Wenn Patient*innen einen Wunsch nach assistiertem Suizid anvertrauen, berührt dies immer auch eigene Ängste vor dem Tod, vor Angewiesenheit und vor Verlusten. Bernstein (2001) sieht darin ausgeprägte Übertragungs- und Gegenübertragungsgefühle und er konstatiert, dass „die Quelle der Schwierigkeiten, die wir haben, wenn wir anderen erlauben, aus eigenem Entschluss zu sterben, in der Tatsache liegt, dass wir nicht wollen, dass sie sterben, weil ihr Ableben Auswirkungen auf uns haben wird“ (Bernstein, 2001, S. 246).
Wenn Menschen ihr Leben vorzeitig beenden wollen, berührt und verstört das nicht nur die ihnen Nahestehenden, sondern auch die professionell Betreuenden, denn die Entscheidung zu einem assistierten Suizid wird immer aus einer inneren Notlage heraus getroffen. Die häufige Argumentation, dass der Entschluss zu einem assistierten Suizid aufgrund einer bilanzierenden, rationalen Überlegung getroffen wird, ist ein theoretisches Konstrukt. Die Entscheidung für einen assistierten Suizid wird meist vor dem Hintergrund von unerträglich gewordenen Leidenssituationen oder von Ängsten vor möglichem künftigem Leid getroffen.
Mit dem Wissen, dass eine umfassende Palliativbetreuung viele der Nöte schwerkranker Menschen mit einem Wunsch nach Suizidassistenz zufriedenstellend lindern kann, ist es nicht hinnehmbar, dass diese Art der Versorgung nur relativ wenigen Menschen zur Verfügung steht.
Wird nicht nur der Bedarf terminal erkrankter Menschen an palliativer Versorgung, sondern auch der Palliative-Care-Bedarf alter und demenzkranker Personen berücksichtigt, haben derzeit etwa 10 % der Patient*innen in Österreich Zugang zu Palliative Care. Nach Übereinkünften der Vereinten Nationen, der European Association for Palliative Care, der International Association for Palliative Care, der Worldwide Palliative Care Alliance und Human Rights Watch ist der Zugang zur Palliativversorgung als ein Menschenrecht zu betrachten (Rosa et al., 2021). Es mutet daher geradezu zynisch an, dass es derzeit in unserem Land vielerorts leichter ist, eine Zulassung zum assistierten Suizid zu erhalten, als eine angemessene palliative Betreuung. Es wäre daher nicht nur wünschenswert, sondern auch sinnvoll gewesen, den seit Jahrzehnten vonseiten der Politik versprochenen Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung in Österreich noch vor der Legalisierung der Suizidassistenz umzusetzen.
1.2 Definitionen und Begriffe
In der Auseinandersetzung mit den Fragen um Suizidassistenz und Tötung auf Verlangen ist es wichtig, dass die verwendeten Begriffe unmissverständlich und klar sind. Der häufig verwendete Begriff „Sterbehilfe“ ist euphemistisch, zweideutig und missverständlich. Kommen dann noch Differenzierungen wie „aktiv“ und „passiv“ hinzu, führt das unweigerlich zu Unklarheiten. Daher sollte dieser Begriff grundsätzlich vermieden werden, stattdessen sollten die eindeutigeren Begriffe „assistierter Suizid“ bzw. „Suizidassistenz“ oder „Tötung auf Verlangen“ verwendet werden (Bioethikkommission, 2015).
Der früher gebräuchliche Begriff „Sterbehilfe“ sollte nicht mehr verwendet werden, da er missverständlich, unpräzise und missbrauchsanfällig ist. Handelt es sich um „Hilfe beim Sterben“, um „Hilfe im Sterben“ oder doch um „Hilfe zum Sterben“? (Halmich & Klein, 2023)
International ist der Terminus „Euthanasie“ gebräuchlich, wobei dabei oft nicht zwischen Beihilfe zum Suizid und Tötung auf Verlangen unterschieden wird. Im deutschsprachigen Raum ist der Begriff „Euthanasie“ historisch belastet, daher wird stattdessen von Tötung auf Verlangen gesprochen. In den Beneluxstaaten wird mitunter auch zwischen „freiwilliger“ und „nicht-freiwilliger Euthanasie“ unterschieden (Mroz et al., 2020). Nach österreichischer Rechtsprechung würde die Verabreichung von tödlichen Medikamenten ohne ausdrücklichen Wunsch der Patient*innen dem Straftatbestand der Tötung entsprechen.
Assistierter Suizid (AS) bzw. Beihilfe zum Suizid ist eine Handlung, die mit der Absicht erfolgt, einer Person auf deren freiwilliges und überlegtes Verlangen hin die eigenständige Selbsttötung zu ermöglichen. Dies geschieht, indem eine tödliche Dosis eines Präparates zur Selbstverabreichung bereitgestellt wird. In Abgrenzung zur Tötung auf Verlangen kommt es hier darauf an, dass die suizidwillige Person den Akt des Suizids selbst ausführt.
Tötung auf Verlangen ist eine Handlung, die mit der Absicht erfolgt, eine Person auf deren freiwilliges und angemessenes Verlangen hin zu töten, indem eine entsprechende Medikation verabreicht wird (Radbruch et al., 2016).
International wird zwischen assistiertem Suizid und Tötung auf Verlangen mitunter kaum unterschieden, oft werden Sammelbegriffe wie „Euthanasie“, „Voluntary Assisted Dying“ (VAD), „Medical Assistance in Dying“ (MAID) oder „Euthanasia and Assisted Suicide“ (EAS) für beide Formen lebensbeendigender Maßnahmen synonym verwendet.
Therapieziel-Änderung bzw. Sterben zulassen ist ein legaler und oft auch gebotener Therapieverzicht bei aussichtsloser Prognose bzw. die Beendigung aussichtsloser Maßnahmen. Die Therapieziel-Änderung bedeutet, dass der Fokus nicht mehr auf einer Lebensverlängerung, sondern primär auf dem Wohlbefinden des/der Kranken liegt. Es wird dafür auch der Begriff „Sterben zulassen“ verwendet (Bioethikkommission, 2015, S. 23).
Sterbewunsch ist eine Äußerung, dass die Person sich einen baldigen Tod wünscht. Dabei ist zwischen einem vorübergehenden, situativ ausgelösten Wunsch zu sterben und einem dauerhaften, anhaltenden Sterbewunsch zu unterscheiden. Ein Sterbewunsch bedeutet nicht zwingend, das Sterben beschleunigen zu wollen und er ist auch nicht dem Wunsch nach Beihilfe zum Suizid gleichzusetzen. Es ist daher zwischen einem allgemeinen Wunsch zu sterben, dem Wunsch, der Tod möge eher kommen, dem Wunsch, das eigene Sterben zu beschleunigen, und der (vielleicht präventiven) Anfrage um Suizidassistenz zu unterscheiden.
Suizid ist ein Begriff lateinischer Herkunft, er setzt sich aus sui (ihrer/seiner selbst) und caedere (töten) zusammen. Selbsttötung oder Suizid im rechtlichen Sinn ist, wenn jemand vorsätzlich und freiwillig den Tod an sich selbst unmittelbar verursacht (Birklbauer, 2019). Es handelt sich dabei also um die beabsichtigte Beendigung des eigenen Lebens.
Euphemismen
In internationalen Diskussionen, insbesondere mit Kolleg*innen aus den USA und Kanada, stößt der Begriff des assistierten Suizids meist auf Unverständnis und Widerstand. In jenen Staaten, in denen assistierter Suizid und Tötung auf Verlangen schon länger praktiziert werden, besteht ein deutliches Bemühen um euphemistische Begriffe: von „Death with Dignity“ über „Medical Assistance in Dying“ und „Completed Life“ bis hin zu „Freitod“ und „Selbstbestimmtes Sterben“.
Euphemismen werden meist dann eingesetzt, wenn unangenehme oder problematische Tatsachen abgemildert oder auch verschleiert dargestellt werden sollen. Gerade bei ethisch schwierigen Sachverhalten kann eine klare Sprache wichtig sein, deshalb wird in diesem Buch auf euphemistische Umschreibungen verzichtet und der Begriff „Assistierter Suizid“ (AS) beibehalten.
1.3 Entwicklung in Österreich
Anders als zum Beispiel in den Niederlanden, wo die Strafbarkeit der Suizidassistenz erst nach einem breiten, öffentlichen, über 30 Jahre andauernden Diskussionsprozess aufgehoben wurde, gab es in Österreich kaum einen öffentlichen Diskurs. Erst durch die Abhaltung einer parlamentarischen Enquete zum Thema „Sterben in Würde“ im Jahr 2014 wurden die Fragen zur Suizidassistenz erstmals in strukturierter Form von Expert*innen und Betroffenen diskutiert und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Die Bioethikkommission des Bundeskanzleramtes veröffentlichte im Jahr 2015 unter dem Titel „Sterben in Würde“ eine Stellungnahme mit Empfehlungen zur Begleitung und Betreuung von Menschen am Lebensende und den damit verbundenen Fragestellungen. Diese Stellungnahme enthielt unter anderem auch die Empfehlung, eine eventuelle ärztliche Hilfeleistung beim Suizid in bestimmten Fällen zu entkriminalisieren (Bioethikkommission, 2015).
Bis 2022 galt § 78 „Wer einen anderen dazu verleitet, sich selbst zu töten, oder ihm dazu Hilfe leistet, ist mit einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis 5 Jahren zu bestrafen“. Nach einer von vier Privatpersonen eingebrachten Klage entschied der Verfassungsgerichtshof am 11.12.2020, dass das „ausnahmslose Verbot“ der Hilfestellung beim Suizid ab 1.1.2022 aufgehoben werde und der Passus „oder ihm dazu Hilfe leistet“ ersatzlos gestrichen wird. Dadurch ergab sich die Notwendigkeit einer Neuregelung durch den Gesetzgeber. Zugleich wurde im Regierungsprogramm 2020–24 (ÖVP, Grüne) das Ziel formuliert, Hospiz- und Palliativversorgung auszubauen und auch in die Regelfinanzierung zu überführen. Auch soll die Palliativversorgung bei der Entwicklung einer künftigen Pflegeversicherung berücksichtigt werden.
Im April 2021 wurde vom Justizministerium ein viertägiges „Dialogforum Sterbehilfe“ abgehalten. Ziel des Dialogforums war es nicht, Empfehlungen für eine Neuregelung des § 78 StGb hervorzubringen, sondern Expert*innen anzuhören, um auf dieser Grundlage weitere Schritte in Umsetzung des VfGH-Erkenntnisses zu setzen.
Im Juni 2021 präsentierte das Markt- und Meinungsforschungsinstitut FOCUS Austria eine wissenschaftlich fundierte Studie zur „Sterbehilfe”. Diese repräsentative und differenzierte Abfrage zu den verschiedenen Formen von „Sterbehilfe“ wurde durchgeführt, ohne den Fokus auf das Urteil des VfGH zu legen. Im Unterschied zu anderen, früheren Befragungen wurde in dieser Studie zwischen bereits legalen Formen, wie z. B. dem Beenden lebenserhaltender Maßnahmen, der Gabe von Medikamenten auch mit dem Risiko der Lebensverkürzung etc., und assistiertem Suizid sowie Tötung auf Verlangen klar differenziert.
Die Ergebnisse dieser Studie unterscheiden sich daher von anderen bisher durchgeführten Befragungen. So gaben lediglich 11 % der Befragten an, sich „sehr gut“ über Sterbehilfe informiert zu fühlen. Nur 35 % waren der Meinung, dass Beihilfe zum Suizid in Österreich erlaubt sein sollte, eine Legalisierung von Tötung auf Verlangen wurde von 31 % der Befragten befürwortet. Ein bemerkenswertes Detail dieser Studie ist, dass 73 % der Befragten erwarten, dass es trotz einer gesetzlichen Regelung des assistierten Suizids zu Missbrauch kommen wird (FOCUS Austria, 2021).
Der öffentliche Diskurs zum assistierten Suizid war auch nach dem Erkenntnis des VfGh im Dezember 2020 vergleichsweise gering, was zum Teil auch an dem vorherrschenden Thema der Covid-Pandemie lag. In der medialen Auseinandersetzung mit dem Thema zeigte sich wiederholt, dass die Begriffe aktive und „passive Sterbehilfe“ sowie „Tötung auf Verlangen“ und „assistierter Suizid“ oft synonym oder missverständlich interpretiert werden. Das muss als Hinweis auf einen eklatanten Mangel an Information betrachtet werden.
Am 23.10.2021 wurde ein erster Ministerialentwurf für eine Neuregelung vorgelegt. Dieser Gesetzesentwurf enthielt ein Verfahren zur Errichtung einer Sterbeverfügung, die die Suizidhilfe rechtssicher und missbrauchsgeschützt regulieren sollte. Damit verbunden waren auch erforderliche Änderungen im Strafgesetzbuch zu den Grenzen der legalen Suizidhilfe. Während der äußerst kurzen Begutachtungsfrist von nur 3 Wochen wurden zahlreiche Stellungnahmen eingereicht. Sie führten jedoch nur zu geringfügigen Anpassungen der Finalversion der Gesetzesänderung, die nach dem parlamentarischen Verfahren wie geplant am 1.1.2022 in Kraft trat.
Seit Anfang 2022 ist das ausnahmslose Verbot der Hilfestellung beim Suizid in Österreich aufgehoben und unter bestimmten Voraussetzungen besteht seitdem die Möglichkeit, bei Notar*innen oder bei einer Patientenanwaltschaft eine sogenannte Sterbeverfügung zu errichten, in der eine sterbewillige Person ihren dauerhaften, freien und selbstbestimmten Entschluss festhält, ihr Leben vorzeitig zu beenden.
Das Verbot der Tötung auf Verlangen (§ 77 Strafgesetzbuch) bleibt in Österreich weiterhin aufrecht. Der Verfassungsgerichtshof begründet das damit, dass die Erwägungen zur Legalisierung der Suizidassistenz nicht auf das Verbot der Tötung auf Verlangen übertragen werden können, da es zwischen den beiden lebensbeenden Interventionen wesentliche Unterschiede gibt. Beim assistierten Suizid ist es immer die sterbewillige Person, die den letzten Schritt zur Herbeiführung des Todes setzt. Bei der Tötung auf Verlangen hingegen wird dieser letzte Schritt von der helfenden Person vollzogen (Khakzadeh, 2022).
Allerdings stellten Proponenten der Österreichischen Gesellschaft für ein humanes Lebensende (ÖGHL) im Juni 2023, wieder mit Unterstützung durch den Schweizer Verein Dignitas, einen zweiten Individualantrag an den Verfassungsgerichtshof, um das Sterbeverfügungsgesetz durch das Höchstgericht erneut überprüfen zu lassen. Ziel dieses weiteren Antrages ist, die Hürden zur Errichtung einer Sterbeverfügung zu senken und letztlich auch die Legalisierung der Tötung auf Verlangen zu erreichen.
Rechtlich, medizinisch und ethisch besteht ein gravierender Unterschied zwischen der Tötung einer anderen Person auf deren Verlangen und ihrer Unterstützung bei der freiverantwortlichen Selbsttötung. Bei der Tötung auf Verlangen stirbt eine sterbewillige Person durch die Tat einer anderen Person, während bei der Beihilfe zum Suizid die Tatherrschaft (Handlungskontrolle) bei der sterbewilligen Person bleibt.
Die Hilfeleistung beschränkt sich auf die physische Unterstützung der sterbewilligen Person bei der Durchführung lebensbeendender Maßnahmen, z. B. bei der Beschaffung des Suizidmittels. Die ärztliche Aufklärung oder die Mitwirkung an der Errichtung einer Sterbeverfügung stellt jedoch keine Hilfeleistung zum assistierten Suizid dar.
Der VfGH betont in seinen Erläuterungen mehrfach den Aspekt der freien Selbstbestimmung. Der Entscheidung zum assistierten Suizid müsse ein „aufgeklärter und informierter Willensentschluss“ zugrunde liegen. Da die freie Selbstbestimmung jedoch durch soziale und ökonomische Umstände beeinflusst wird, habe „der Gesetzgeber Maßnahmen zur Verhinderung von Missbrauch vorzusehen, damit die betroffene Person ihre Entscheidung zur Selbsttötung nicht unter dem Einfluss Dritter fasst“ (Parlament Österreich, 2021).
Es kann jedoch keine Verpflichtung zur Hilfeleistung beim Suizid geben, hält der VfGH fest. Die Beihilfe zum Suizid kann nur durch eine Person erfolgen, die dazu bereit ist. Da also keine Verpflichtung zur Hilfeleistung zum Suizid besteht, kann es auch keinen Anspruch auf Beihilfe zum Suizid geben. Laut § 2 des StVfG darf keine natürliche oder juristische Person wegen einer Hilfeleistung (§ 3 Z 4), einer ärztlichen Aufklärung, wegen der Mitwirkung an der Errichtung einer Sterbeverfügung oder wegen der Weigerung, eine Hilfeleistung zu erbringen, eine ärztliche Aufklärung durchzuführen oder an der Errichtung einer Sterbeverfügung mitzuwirken, in welcher Art auch immer benachteiligt werden.
Die verpflichtende Anwesenheit professioneller Betreuungspersonen wie Pflegepersonen und/oder Ärzt*innen ist nicht vorgesehen. Assistierende Personen sind durch das StVfG geschützt, da es Freiwilligkeit und Schutz vor Benachteiligung für diese Personengruppe vorsieht.
Von Seiten des Bundesministeriums besteht die Vorgabe, dass alle errichteten Sterbeverfügungen im Sterbeverfügungsregister erfasst werden sollen. Zweck dieser elektronischen Datenerfassung ist die Verhinderung von Missbrauch bei der Abgabe des Präparats, die Schaffung von Nachforschungsmöglichkeiten für die Strafverfolgungsbehörden und die Erfassung der Sterbeverfügungen für wissenschaftliche Analysen über die Inanspruchnahme von Suizidassistenz (Friesenecker et al., 2023, S. 144). (Näheres zur Sterbeverfügung siehe Kapitel „Die Sterbeverfügung“, S. 69)
1.3.1 ASCIRS
Das österreichische Sterbeverfügungsgesetz ist 2022 in Kraft getreten, ohne Vorbereitung der betreffenden Berufsgruppen und ohne begleitendes Monitoring der praktischen Erfahrungen mit dem assistierten Suizid. Daher wurde von der Österreichischen Palliativgesellschaft (OPG) die Online-Plattform ASCIRS1 errichtet: www.ascirs.at
Abb. 1: ASCIRS-Plattform
Dieses Berichts- und Lernsystem trägt dazu bei, mehr über die Praxis der Suizidbeihilfe in Österreich zu erfahren und aus den Beobachtungen und Erfahrungen der Beteiligten zu lernen. Die mitgeteilten Erfahrungen können zur Entwicklung unterstützender Leitlinien und damit auch zur Verbesserung der Situation beitragen.
Auf ASCIRS können alle assistierten Suizide berichtet werden, nicht nur jene, bei denen es zu Komplikationen gekommen ist. Alle Berichte sind wertvoll und wichtig.
Die Berichte erfolgen anonym. Nur, wenn der Wunsch nach einer Rückmeldung von einer Fachperson aus dem ASCIRS-Team besteht, wird um Angabe einer E-Mail-Adresse ersucht – die natürlich strikt vertraulich behandelt wird.
Die bisher eingereichten Berichte betreffen überwiegend Patient*innen mit Tumorerkrankungen, mit neurologischen oder pulmonalen Erkrankungen im Alter von 30 bis 97 Jahren. Besonders aufschlussreich sind die in den Berichten angegebenen Hintergründe der Wünsche nach Suizidassistenz. Nach den bisherigen Erkenntnissen sind es vor allem unzureichend gelinderte Symptome und existenzielle Leiderfahrungen, die dazu führen, dass Patient*innen sich für einen assistierten Suizid entscheiden.
1.4 Prinzipielle Überlegungen
In den Diskussionen rund um den assistierten Suizid geht es immer auch um das Recht auf Selbstbestimmung, um Willensfreiheit und Würde. Und mitunter entsteht der Eindruck, dass diese Schlagworte wenig reflektiert eingesetzt werden, um für das „Recht“ auf Suizidassistenz zu argumentieren. Abgesehen davon, dass kein rechtlicher Anspruch auf Beihilfe zum Suizid besteht, da niemand zur Hilfeleistung verpflichtet werden kann, ist die Definition von Begriffen wie „Selbstbestimmung“, „Willensfreiheit“ und „Würde“ eine Voraussetzung für eine konstruktive Diskussion.
1.4.1 Selbstbestimmung und Autonomie
Das Recht der Patient*innen auf Selbstbestimmung hat einen hohen Stellenwert in Medizin und Pflege, insbesondere in der Palliative Care. Dabei stehen Fürsorge und Selbstbestimmung keineswegs im Widerspruch, vielmehr dreht sich das Bemühen der Betreuenden oft um eine fürsorgliche Ermöglichung der Selbstbestimmung.
Im täglichen Sprachgebrauch vermischen sich Begriffe wie Autonomie und Selbstbestimmung, deshalb erscheint zunächst eine Begriffsklärung wichtig. Die beiden Begriffe „Selbstbestimmung“ und „Autonomie“ werden oft synonym verwendet, bedeuten letztlich aber Unterschiedliches. Während im Englischen „autonomy“ so viel wie Selbstbestimmung meint, bedeutet „Autonomie“ im deutschen Sprachraum eher Unabhängigkeit oder Selbstgesetzlichkeit. Wörtlich übersetzt bedeutet der Begriff demnach, eigene Gesetze zu haben und nach ihnen zu leben, was auch eine gewisse Unabhängigkeit von anderen beinhaltet. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass eine uneingeschränkte Autonomie eine Utopie darstellt, denn Menschen leben immer in sozialen Bezügen.
Die Diskussion über die Beihilfe zum Suizid wird im Wesentlichen von zwei gegensätzlichen Positionen bestimmt, die von jeweils unterschiedlichen Haltungen zur Selbstbestimmung geprägt sind. In einer der Argumentationslinien gilt das Recht auf Selbstbestimmung als das entscheidende Kriterium für die moralische Akzeptanz der Selbsttötung und der Hilfe beim assistierten Suizid. In der anderen Position wird argumentiert, dass die Fähigkeit zur Selbstbestimmung durch intensives Leiderleben beeinträchtigt sein kann und dass die Patient*innen daher zuerst in einen Zustand versetzt werden müssen, der es ihnen ermöglicht, selbstbestimmt zu entscheiden.
Bei der Überbetonung der Selbstbestimmung und der Logik der Wahl (Mol, 2008) in den Diskussionen um den assistierten Suizid, wird nicht bedacht, dass leidende Menschen oft gar nicht in der Lage sind, prospektiv selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen. Dazu braucht es vor allem Fürsorge, Unterstützung und Beziehungen.
„Die Entfaltung der Autonomiekompetenz ist auf Fürsorge angewiesen, ist – so gesehen – abhängig von ihr. Fürsorge wiederum zielt auf die Unterstützung von Selbstbestimmung im Hinblick auf Leben, das bis zuletzt Momente des Glücks kennen kann“ (Walser, 2010, S. 41).
Aber zweifellos ist die Selbstbestimmung in unserer zunehmend individualisierten Gesellschaft zu einem zentralen Wert geworden. Und nach verbreiteter Ansicht ist der Anspruch auf Selbstbestimmung mit einer bestehenden Hilfe- und Pflegebedürftigkeit nicht vereinbar. Selbstbestimmung scheint an Unabhängigkeit gebunden zu sein, wobei außer Acht gelassen wird, dass wir Menschen immer mehr oder weniger auf andere angewiesen sind.
Die Forderung nach Autonomie im Sinne persönlicher, individueller Selbstbestimmung über das eigene Leben kann als Ausdruck einer verzweifelten Angst angesichts der Realität einer ganz anderen, genau gegenteiligen Erfahrung interpretiert werden: der Erfahrung von Schwäche, Verletzlichkeit und einer daraus resultierenden Angewiesenheit auf andere, die in unserer westlichen Gesellschaft mit Abhängigkeit und negativ konnotiert ist. Das Autonomie-Argument dient rhetorisch dazu, dieses Schreckgespenst der Abhängigkeit zu vertreiben (Walser in: Reitinger et al., 2010). Es scheint darum zu gehen, möglichst lange von der Unterstützung und Fürsorge anderer unabhängig zu sein. Ist diese Unabhängigkeit real bedroht, kann für manche Menschen auch die Beendigung des Lebens als einziger Ausweg erscheinen.
Die utopische Vorstellung uneingeschränkter Selbstbestimmung und Unabhängigkeit erweist sich aber nicht erst bei einer Erkrankung und am Ende des Lebens als brüchig. Eine absolute Selbstbestimmung gibt es grundsätzlich nicht. Selbstbestimmung ist vielmehr als ein relationales Konzept zu betrachten, in dem die Abhängigkeit des Menschen von seiner Natur, von seiner gesellschaftlichen Einbindung und seinen sozialen Bezügen Berücksichtigung findet. Selbstbestimmung steht daher immer auch in einem Beziehungskontext. Die Verbindung individueller Selbstbestimmung mit gleichzeitiger Angewiesenheit auf andere drückt sich im Begriff der „relationalen Autonomie“ aus.
Bei der aktuellen Überbetonung der Autonomie bzw. Selbstbestimmung im Zusammenhang mit dem assistierten Suizid ist bemerkenswert, dass zwar der Wunsch nach Selbstbestimmung die Grundlage für einen assistierten Suizid ist, für die Umsetzung jedoch die Unterstützung anderer in Anspruch genommen wird. Noch deutlicher als beim assistierten Suizid wird dies bei der Tötung auf Verlangen, wo die Durchführung gänzlich an andere delegiert wird.
Eine weitere bemerkenswerte Tatsache ist, dass bestehende Möglichkeiten zur Ausübung des Rechts auf Selbstbestimmung, wie etwa das Erstellen einer Patientenverfügung oder einer Vorsorgevollmacht, die Therapiebegrenzung oder auch der Freiwillige Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit nur relativ wenig genutzt werden.
Unbestritten sind Selbstbestimmung und Autonomie wichtige Werte in unserer Gesellschaft. In der Zeit des Sterbens sind diesen Werten aber naturgemäß Grenzen gesetzt. Bei Pflegebedürftigkeit und Angewiesenheit beziehen sich diese Werte auf andere Inhalte. Im Vordergrund stehen dann die an den individuellen Bedürfnissen und Wünschen der Patient*innen ausgerichtete Betreuung und eine achtsame, fachgerechte, würdebewahrende und menschlich liebevolle Pflege.
Wird das Argument der Selbstbestimmung im Zusammenhang mit dem assistierten Suizid zum Postulat, wird die Tragik übersehen, die jeder Selbsttötung zugrunde liegt. Der assistierte Suizid wäre damit nicht mehr die Folge unerträglichen Leidens, sondern Ausdruck persönlicher Autonomie, oder gar eine „emanzipatorische Selbsttechnik“ (Macho, 2018, S. 8) und eine „Option im Repertoire der Sterbeoptionen“, wie Wils (2021) schreibt.
Verfechter*innen des Rechts auf Suizidassistenz argumentieren oft, dass Menschen generell das Recht haben sollten, nicht nur über ihr eigenes Leben, sondern auch über den Zeitpunkt ihres Todes zu entscheiden, insbesondere dann, wenn sie Leiderfahrungen ausgesetzt sind. Vertreter*innen einer kritischen Haltung zum assistierten Suizid weisen darauf hin, dass die Entscheidung, das Leben zu beenden, unter dem Einfluss von großen körperlichen und psychischen Belastungen, sozialem Druck oder anderen beeinträchtigenden Faktoren getroffen werden könnte. Damit wäre eine solche Entscheidung nicht wirklich frei getroffen.
Letztendlich ist die Beurteilung der „Freiheit“ einer Entscheidung zum assistierten Suizid eine komplexe Angelegenheit, die von vielen Faktoren abhängt.
Die bisherigen Erkenntnisse aus den ASCIRS-Berichten widerlegen den Mythos vom „selbstbestimmten“ frei gewählten Sterben. Die Berichte zeugen von psycho-existenziellem Leid, von unzureichend gelinderten körperlichen Symptomen und von tiefer Verzweiflung. Unter diesen Voraussetzungen von einer selbststimmten und „freien“ Entscheidung zu sprechen, muss als metaphorische Leistung betrachtet werden.
1.4.2 Die Frage der Würde
„Sterben in Würde“ gilt inzwischen geradezu als Chiffre, in der Palliative Care ebenso wie auch im Zusammenhang mit dem assistierten Suizid. Je nach Kontext wird dieser Ausdruck unterschiedlich verstanden, er steht jedoch immer in enger Verbindung mit Selbstbestimmung, Selbstwert und Selbstachtung (Street & Kissane, 2001, S. 94). In Palliative Care und Hospizarbeit stehen eine würdebewahrende Pflege und Betreuung und die bestmögliche Erhaltung der individuellen Lebensqualität der Patient*innen im Zentrum des Bemühens. Verfechter*innen des Rechts auf assistierten Suizid verhandeln die Thematik der Lebensqualität unter dem Begriff der Würde (Streeck, 2020, S. 263). Das Lebensende, so die Darstellung sämtlicher internationaler „Right-to-die“-Organisationen, gefährdet die Würde einer Person. Nach diesem Denkmodell können Menschen durch den Verlust der Selbstständigkeit, durch Einschränkungen körperlicher und geistiger Art, durch Angewiesenheit und Pflegebedürftigkeit in eine als unwürdig empfundene Situation geraten. Aber wie Martha Nussbaum (2010, S. 224) schreibt, sind wir Menschen zeitgebundene Wesen mit Bedürfnissen, die ihr Leben als Säuglinge beginnen und bis zu ihrem Lebensende häufig noch andere Formen der Angewiesenheit erleben. Und wer würde die Angewiesenheit eines Neugeborenen als unwürdig bezeichnen?
Die Selbstverständlichkeit, mit der wir der Abhängigkeit eines Säuglings begegnen und ihm jede erdenkliche Fürsorge und Pflege bieten, steht allen Kranken und Pflegebedürftigen zu. Für Menschen am Lebensende gilt dies in besonderer Weise. Sie sind ähnlich verletzlich und schutzbedürftig wie Neugeborene und es besteht eine gesellschaftliche Verpflichtung, ihnen die Fürsorge zu bieten, die sie brauchen.
Walser schreibt über die Abhängigkeit kurz vor dem Tod, dass alle Menschen am Ende ihres Lebens von anderen Menschen abhängig sind und nicht über das eigene Sterben verfügen können. Auch im Laufe des Lebens bestehen über lange Strecken Abhängigkeiten von anderen Menschen oder Netzwerken. Sie erläutert, dass der Ruf nach Autonomie im Sinne persönlicher und individueller Selbstbestimmung über das eigene Leben (Walser, 2010, S. 33) eigentlich eine Angst vor der Erfahrung von Schwäche, Verletzlichkeit und mit einer damit verbundenen Angewiesenheit auf andere darstelle. Diese Angewiesenheit, mit der naturgegebenen Abhängigkeit von anderen, ist in der westlichen Gesellschaft negativ behaftet. Angewiesen-Sein auf andere gehört zweifellos zum Menschsein, hilfsbedürftig zu sein steht also keineswegs im Widerspruch zur Würde des Menschen. Zeitweise der Zuwendung und Fürsorge anderer zu bedürfen gehört vielmehr untrennbar zum Wesen des Menschseins.
Nicht selten ist es aber die Angst vor einem (vermeintlichen) künftigen Verlust der Würde, die dazu führt, dass sich Patient*innen für einen assistierten Suizid entscheiden. Patient*innen, die sich in ihrer Würde verletzt wahrnehmen, äußern nicht nur deutlich häufiger einen Sterbewunsch, es besteht auch ein erkennbarer Zusammenhang zwischen verletzter Würde, Depression und Hoffnungslosigkeit (Chochinov et al., 2002). Würde, Selbstbestimmung und Autonomie können jedoch nur in Beziehungen zu anderen Menschen erfahren werden und letztlich sind es diese Beziehungen, die Würde erhalten, stärken und stützen.
„Ich denke ein wichtiger Teil meiner Würde ist, dass ihr mir vermittelt, dass ich immer noch einen Wert als Mensch habe“ (Aussage eines Patienten).
Studien belegen, dass die Wahrnehmung, eine Last für andere zu sein, ein häufiger Grund für den Wunsch nach einer vorzeitigen Beendigung des Lebens ist (Wiebe et al., 2018). Sich als Belastung für das soziale Umfeld wahrzunehmen, wird oft als beschämend und würdeverletzend empfunden. Zugleich ist dieses Phänomen mit dem allgemeinen gesellschaftlichen Würdeverständnis verbunden. Und vielfach herrscht die Fehlannahme, dass Würde durch Leistung zu erlangen ist. Ein eindrückliches Beispiel dafür belegen Interviews (Pleschberger, 2005), in denen alte Menschen die Ansicht vertreten, dass man Würde durch das erfahre, was man im Leben geleistet habe, bzw. durch das, was die alten Menschen noch immer leisten – so etwa noch immer rüstig und vital zu sein. Und vor allem, das sei besonders wichtig, den Jungen, der Gesellschaft, dem Staat, den Kindern auf keinen Fall zur Last zu fallen. In Wahrheit steht die Würde eines Menschen jedoch für die Forderung nach Achtung und Anerkennung, unabhängig von Gesundheit und Krankheit und selbstverständlich auch unabhängig von persönlichen Leistungen oder gesellschaftlichem „Nutzen“ eines Menschen.
Zunehmend gilt aber nicht nur, dass Pflegebedürftigkeit und Angewiesenheit als Würdeverlust wahrgenommen werden, sondern auch, dass zu einem selbstbestimmten Leben auch ein selbstbestimmtes Sterben zu einem selbstgewählten Zeitpunkt gehört.
So wirbt zum Beispiel eine Schweizer Suizidhilfeorganisation in ihrer Informationsbroschüre dafür, dem Verein rechtzeitig beizutreten, da sonst ein „Schicksal“ drohe, wie es einem 75-jährigen schwerkranken Patienten widerfuhr. Er habe „zu spät an EXIT gedacht“, weshalb er starb, bevor ein/e Sterbebegleiter*in eintraf (Exit, 2022, 25).
Ausgehend davon, dass in der gegenwärtigen pluralistischen Gesellschaft nicht eine gemeinsame Moral, sondern verschiedene Moralen bestehen, ist anzuerkennen, dass Menschen unterschiedliche Vorstellungen von einem gelingenden Leben und einem erstrebenswerten Sterben haben. Die jedoch meist unreflektierte Verwendung von Begriffen wie „menschenwürdiges“ oder „unwürdiges“ Sterben ist äußerst kritisch zu betrachten und es stellt sich die Frage, was als „unwürdiges“ Sterben gilt. Kann Angewiesenheit, Pflegebedürftigkeit oder Kranksein tatsächlich als unwürdig bewertet werden?
Die Forderung nach einem würdigen Sterben kann aber auch als gesellschaftlicher Auftrag an Pflege und Medizin und als Plädoyer für die Verfügbarkeit von Palliative Care und Hospizbetreuung verstanden werden. Ein menschenwürdiges, der Würde eines Menschen entsprechendes Sterben ist ein Sterben, das frei von vermeidbaren Ängsten und Leiden für die Patient*innen und ihre Angehörigen ist, das den Wünschen der Patient*innen und Angehörigen entspricht und in angemessener Weise mit klinischen, kulturellen und ethischen Standards übereinstimmt (Institute of Medicine, Committee on Care at the End of Life, 1997).
Dem Prozess des Sterbens wird vielfach keine besondere Bedeutung mehr beigemessen, es gilt vielmehr, dieses Geschehen möglichst abzukürzen oder es zumindest nicht bewusst erleben zu müssen. Das unbewusste Sterben, bevorzugt im Schlaf, gilt heute als erstrebenswertes Lebensende. Aber auch ein abruptes Ende durch Selbsttötung bzw. durch Beihilfe zur Selbsttötung ist nur scheinbar Ausdruck radikaler Selbstbestimmtheit, es geht dabei vor allem darum, dem Prozess des Sterbens mit seinen Begleiterscheinungen zuvorzukommen. Beim assistierten Suizid ist es vorrangig das Ziel, den Prozess des Sterbens nicht bewusst zu erleben. Die Vorstellung eines plötzlich eintretenden Todes scheint erträglicher, als sich diesem Geschehen zu stellen.
Im Zusammenhang mit dem assistierten Suizid werden die Schlagworte „Selbstbestimmung“ und „Autonomie“ oft auch mit dem Begriff der Würde verknüpft. Abgesehen davon, dass Würde keineswegs vom Ausmaß der Fähigkeit zur Selbstbestimmung abhängt, würde die Gleichsetzung von Selbstbestimmung, Autonomie und Würde jenen Menschen ihre Würde absprechen, die krankheitsbedingt auf die Fürsorge anderer angewiesen sind. Ein abstrakter Autonomiebegriff nimmt die besondere Hilfs- und Schutzbedürftigkeit von Schwerkranken und Sterbenden nicht wahr. Es ist philosophisch wie auch theologisch betrachtet problematisch, die Würde des Menschen an ein abstraktes Autonomiekonzept zu binden, das Individualität mit Autarkie und völliger Unabhängigkeit verwechselt und umgekehrt jede Form der Abhängigkeit, der Hilfsbedürftigkeit und Angewiesenheit auf andere als narzisstische Kränkung erlebt. Ein solches Autonomieverständnis aber führt dazu, Leiden und Schwäche als menschenunwürdig zu betrachten und nur ein abstrakt selbstbestimmtes Sterben als menschenwürdig zu akzeptieren (Körtner, 2021).
Empathische Pflegefachpersonen würden es wohl niemals als „entwürdigend“ wahrnehmen, wenn schwer kranke Menschen auf Pflege und Hilfe angewiesen sind. Mit ihrer fachlichen Kompetenz und meist auch mit viel Einfühlungsvermögen bemühen sie sich in ihrer täglichen Arbeit darum, das Selbstwertgefühl und die Selbstachtung der ihnen anvertrauten Patient*innen zu wahren und zu stärken. Das geschieht unter anderem dadurch, dass sie stellvertretend für ihre Patient*innen Tätigkeiten übernehmen und Fähigkeiten kompensieren, die den Kranken derzeit nicht mehr zur Verfügung stehen. Es besteht eine humane Verpflichtung, die Würde hilfsbedürftiger Menschen zu schützen und ihnen Wertschätzung entgegenzubringen. Würde ergibt sich nicht durch Leistung. Das Angewiesensein auf die Fürsorge anderer verletzt die Würde eines Menschen nicht, vorausgesetzt, diese Fürsorge erfolgt mit Respekt und Achtung. Menschliche Würde besteht unabhängig von Autonomie und der Fähigkeit, sich selbst zu versorgen.
1.4.3 Freier Wille und Entscheidungsfähigkeit
Eine wesentliche Voraussetzung für die Errichtung einer Sterbeverfügung sind die nachweisliche freie Entscheidung zum assistierten Suizid und die Entscheidungsfähigkeit der suizidwilligen Person.
Laut Definition in § 24 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches gilt als entscheidungsfähig „wer die Bedeutung und die Folgen seines Handelns im jeweiligen Zusammenhang verstehen, seinen Willen danach bestimmen und sich entsprechend verhalten kann. Dies wird im Zweifel bei Volljährigen vermutet“ (ABGB, 2021).
Gesunden und volljährigen Personen werden diese Kompetenzen also grundsätzlich zugesprochen. Liegt jedoch eine psychische oder geistige Beeinträchtigung, vorübergehend oder dauerhaft vor, kann der freie Wille wie auch die Entscheidungsfähigkeit beeinträchtigt sein. Daher ist zur Errichtung einer Sterbeverfügung eine Bestätigung der Entscheidungsfähigkeit der sterbewilligen Person eine der wichtigsten Voraussetzungen. Für einen freien und selbstbestimmt gefassten Entschluss ist aber auch die umfassende Information über den Verlauf der Erkrankung erforderlich, wie auch über Behandlungsoptionen, Konsequenzen und mögliche Alternativen. Im Sterbeverfügungsgesetz wird daher eine Aufklärung und Beratung durch zwei voneinander unabhängigen Ärzt*innen gefordert.
Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sich Sterbe- und Suizidwünsche weniger aufgrund von körperlichen Leiden, sondern viel häufiger aufgrund von psychosozialen Belastungen entwickeln, könnte die freie Willensbildung beeinflusst sein. Menschliche Entscheidungen werden im Allgemeinen von einer Vielzahl externer Faktoren beeinflusst. So können zum Beispiel Meinungen und Werthaltungen von Angehörigen, der behandelnden Ärzt*innen und Pflegepersonen, aber auch Medien, sozioökonomische Faktoren und der Zeitgeist wesentliche Einflussfaktoren darstellen. Auch kann bei alten Patient*innen, bei Pflegebedürftigen und bei psychisch Kranken die existenzielle Abhängigkeit von der Umgebung in einem solchen Ausmaß bestehen, dass sich hinter einem geäußerten Suizidwunsch ein fremdbestimmtes Verlangen verbergen kann (Vollmann, 2008).
Es ist auch zu bedenken, dass eine schwere Erkrankung und die damit verbundenen Leiderfahrungen zu einer wesentlichen Veränderung eines Menschen führen können. Das gängige Modell der Autonomie und Selbstbestimmung berücksichtigt nicht den massiven physiologischen Einfluss des Leiderlebens auf die Motivation und auf die kognitiven Fähigkeiten der Patient*innen. Häufig sind schwer erkrankte Menschen kaum in der Lage, autonom zu entscheiden, denn die Hirnregionen für kognitive Entscheidungen sind durch signifikant erhöhte Mengen von Stresshormonen (Cortisol) blockiert. Ältere, instinktiv gesteuerte Hirnbereiche übernehmen die Führung. Gehirngebiete, die für Planung und Motivation zuständig sind, werden nicht mehr aktiviert. Zugleich ist das Gehirngebiet für angstbezogene Emotionen (Amygdala) hochgradig erregt. Aufgrund der starken Emotionen und Ängste können Entscheidungen oft nicht rational durchdacht werden, sie sind vielmehr angstgeprägt, inflexibel und auf das bedrohlich Negative fixiert (Reed et al., 2013).
Nicht zu unterschätzen ist auch die Tatsache, dass sich schwerkranke Patient*innen häufig als Belastung für ihre Angehörigen wahrnehmen. So gaben z. B. in Oregon laut Jahresbericht 2020 mehr als 53 % der Personen, die Suizidbeihilfe in Anspruch nahmen, als Grund für den Suizidwunsch an, sich als Belastung für andere wahrzunehmen (Public Health Division, Center for Health Statistics, 2021).
Das Empfinden, eine Last für andere, für die Angehörigen oder auch für die professionell Betreuenden darzustellen, ist nicht nur mit einem beträchtlich reduzierten Selbstwertgefühl, sondern oft auch mit Schuldgefühlen, depressiven Symptomen und Ängsten verbunden. Ob in diesem Fall tatsächlich von einem völlig „freien“ Willen zum assistierten Suizid ausgegangen werden kann, ist fraglich. Zumindest ist die Willensbildung durch altruistische Motive beeinflusst, denn die Entscheidung zum assistierten Suizid erfolgt nicht unabhängig von zwischenmenschlichen Bezügen. Der Wunsch, sich zu töten, entspringt nicht einfach der inneren Persönlichkeit, er muss auch als Reaktion, als Widerspiegelung jener Signale gesehen werden, die der Mensch von der Gesellschaft erhält (Maio, 2016, S. 56).
Eine Beihilfe zum Suizid setzt voraus, dass die helfende Person sich in gewisser Weise mit der sterbewilligen Person identifiziert, dass sie die Unerträglichkeit des Leidens nachvollziehen kann und auch das Leben so als nicht mehr lebenswert erachtet. Eine Suizidbeihilfe könnte nicht ohne diese Wertung aufseiten der Helfer*innen ausgeübt werden (Küchenhoff & Teising, 2022).