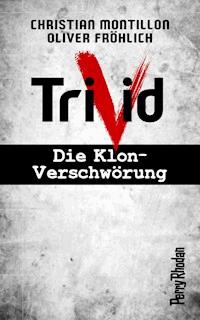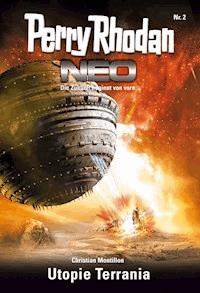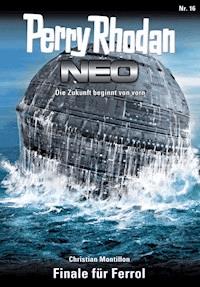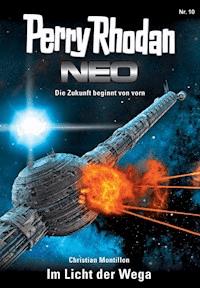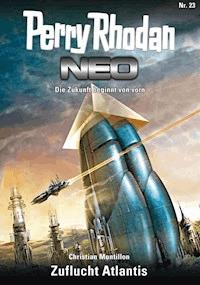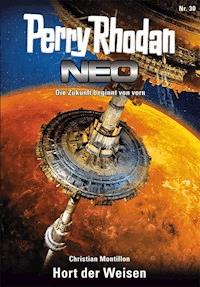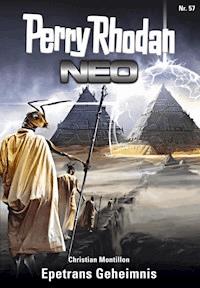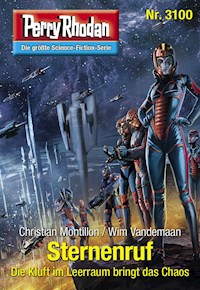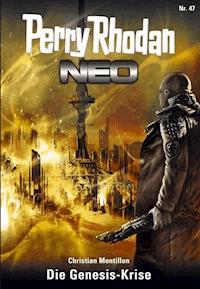Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Perry Rhodan digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: ATLAN X Tamaran
- Sprache: Deutsch
In der Mitte des sechsten Jahrhunderts vor Beginn der christlichen Zeitrechnung ist es wieder einmal soweit: Der Arkonide muss eingreifen, um das sagenhafte Helle Volk aus der Sklaverei zu befreien und es zu einem durch eine Prophezeiung geweissagten mythischen Inselreich zu führen. Aber der Auszug aus Ägypten ist erst der Anfang. Als Weißer Krieger muss Atlan, Seite an Seite mit Nitetis, die als "Goldene" das Volk regieren soll, seine Schutzbefohlenen zum Meer geleiten. Doch ein geheimnisvoller Mörder macht ihm das Leben schwer ... Folgende Romane sind Teil der Tamaran-Trilogie: 1. "Die Prophezeiung von Saïs" von Hans Kneifel 2. "Sternenfall der Goldenen" von Christian Montillon 3. "Das Urteil des Drachenbaumes" von Marc A. Herren und Dennis Mathiak
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zweiter Band der Tamaran-Trilogie
Sternenfall der Goldenen
von Christian Montillon
PrologWer zündet die Sterne an?
Und das helle Volk wird den Weg zu den versprochenen Sieben Königreichen finden, wenn die Sonne im Westen aufgeht. Dorthin müssen der Weiße Krieger und die Goldene es führen, denn nur an diesem Ort ist es geschützt vor den Feinden, die es seiner Bestimmung entziehen wollen.
So lauten die Worte, die mich in die Wüste führten. Zumindest ungefähr. Ich weiß, dass es angebracht wäre, größere Sorgfalt im Umgang mit alten Überlieferungen walten zu lassen, vor allem, wenn es sich um Prophezeiungen handelt. Ich müsste jedes Wort auf die Waagschale legen, über alle scheinbar noch so unbedeutenden Details sinnieren, nach verborgenen Zwischentönen und alternativen Interpretationsmöglichkeiten suchen.
Ich müsste.
Aber mir ist die Lust daran vergangen, denn es kommt mir so vor, als sei das alles nur Unfug. Wie soll die Sonne im Westen aufgehen? Und das ist nur eine von vielen Fragen, die ich mir stelle, wenn ich auf das Heer von Menschen blicke, für das ich die Verantwortung übernommen habe. Noch viel wichtiger ist der nagende Zweifel, wer mir überhaupt die Befugnis verleiht, mich um sie zu kümmern? Brauchen sie mich? Oder maße ich mir etwas an? Mische ich mich in Dinge ein, die mich nichts angehen?
Als ob es das erste Mal wäre …, lästert der Logiksektor.
Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich kann nicht widersprechen. Und doch – wenn ich Nitetis ansehe, glaube ich, dass es Vorherbestimmung ist, die mich an ihre Seite und zu dem Hellen Volk geführt hat.
Aber all diese Überlegungen und alles theoretische Reflektieren verlieren den Sinn, wenn ich in diese weit aufgerissenen Augen schaue, in die Wüstensand geweht wurde. Wir haben die Leiche gefunden, kaum dass der Tag angebrochen ist. Unter den Nägeln schimmert die Haut blau. Zwischen den eingefallenen Lippen blitzen weiße Zähne im Licht der gleißenden Sonne, die heiß auf der Haut brennt. Ein seltsam grünlicher Speichelfaden ist über dem Kinn angetrocknet. Die Haltung des Toten erinnert an die eines Ungeborenen im Mutterleib. Von den Unterschenkel abwärts verschwinden die Beine im Wüstensand, sind vollständig davon bedeckt.
»Chemira«, sagt Orsat. »Es ist Chemira.« Seine Stimme klingt erstickt.
Ich habe den dunkelhaarigen Mann am Abend zuvor noch gesehen, wie er sich einer Frau aus dem Hellen Volk näherte und mit ihr sprach. Die kleine Szene ist mir in Erinnerung geblieben, weil …
Weil die Frau eine echte Schönheit war, kommt der unvermeidliche Kommentar des Extrasinns, und du dich fragtest, was ein hässlicher Kerl wie Chemira mit ihr zu schaffen haben könnte.
Ich sehe keinen Sinn darin, mich zu rechtfertigen. Schließlich stellte ich mir damit eine berechtigte Frage, ob der Logiksektor das versteht oder nicht. Diskutieren werde ich ein anderes Mal. Nicht im Angesicht dieser mit Sand überzogenen Augen.
Orsat bückt sich und zieht an der Leiche, ehe ich es verhindern kann. Wahrscheinlich will er nur die Unterschenkel vom Sand befreien; dass er dabei mögliche Spuren beseitigt, scheint ihn nicht zu kümmern. Er denkt nicht wie ich – kein Wunder, denn er ist nicht in der Spurensuche geschult. Er stammt aus einer anderen Zeit, einer anderen Existenz. Ja, er gehört nicht einmal zum selben Volk wie ich, genau wie alle anderen rund um mich – Menschen vom Planeten Erde oder in meiner Sprache Larsaf III. Ich bin ein Arkonide, gestrandet schon vor langer Zeit auf ihrer Welt, wenn sie davon auch nichts ahnen. Niemand von ihnen könnte auf die Idee kommen, dass es Leben außerhalb ihrer Welt gibt. Sie sind naiv und unwissend, haben keine Ahnung von dem Kosmos, der sie umgibt.
Fast beneide ich sie. Es wäre schön, eine Existenz wie sie zu führen. Einfach und ohne dass sie …
Neben mir schreit jemand entsetzt auf.
Mir dreht sich der Magen um.
Die Unterschenkel stecken keineswegs so tief im Sand, wie ich zunächst glaubte. Stattdessen enden sie eine Handspanne unterhalb der Knie in blutigen Stümpfen. Rote Sandklumpen bröckeln jetzt herab. Einer kullert über den Boden und zerbricht. Ein Käfer wuselt hervor, dessen Chitinpanzer schwarz glänzt. Das Tier vergräbt sich.
Orsat lässt den Toten fallen und wankt mit vor Schreck geweiteten Augen einen Schritt zurück. Seine Hand fährt zum Mund; er würgt. Der Tote kippt zur Seite. Etwas Grünes schwappt aus seinem Mund.
Jemand stößt mich an – eine Frau aus dem Hellen Volk. Genauer gesagt, die Frau, die ich am Abend zuvor schon sah. Ihre Unterlippe bebt. »Er stand gestern plötzlich vor mir.« Die Stimme klingt kehlig und rau. Tränen sammeln sich im Augenwinkel. Das Blau der Iriden gleicht einem tiefen Bergsee. »Ich habe nie vorher mit ihm gesprochen, aber er kannte meinen Namen. Aniagua, sagte er, Aniagua, entschuldige, ich weiß, du …«
»Aniagua, entschuldige, ich weiß, du kennst mich nicht.« Chemira fühlte sich, als müsse er sterben. Und das lag gewiss nicht an der Hitze, die wie in einem letzten Aufbäumen für diesen Tag noch zuzunehmen schien. Die Eiseskälte der Nacht stand bevor. »Ich muss dir sagen etwas … etwas Wichtiges.« Das durfte doch nicht wahr sein! Dümmer hätte er es wirklich nicht anfangen können. Was sollte sie von ihm denken, wenn er nicht einmal einen Satz korrekt aussprechen konnte? Ich muss dir sagen etwas. Er schämte sich, doch es ließ sich nicht mehr ändern. Wahrscheinlich hatte sich nie zuvor ein Mann so töricht verhalten, der sich einer Frau nähern wollte.
Ganz in der Nähe schnatterten Mastgänse in ihren Käfigen. Der ganze Tross hatte sich vor wenigen Minuten niedergelassen. Ein langer Tag lag hinter ihnen; ein Gewaltmarsch durch glühende Hitze und ein scheinbar endloses Wüstengebiet. So weit das Auge reichte, gab es – vom Lager selbst abgesehen – nichts außer dem ewigen, gleichförmigen Sand. Überall rundum baute man Zelte auf, lud die Traglasten der Esel ab, zündete Feuer an. Ein hohes, schrilles Schnattern brach abrupt ab: Der letzte Schrei einer Gans, die bald über offenen Flammen braten würde. Bei dem Gedanken grummelte es in seinem Magen.
Am Horizont küsste der gleißend orangerote Sonnenball die Erde. Die Luft davor waberte. Leichter Wind trieb Sandkörner vor sich her. Chemira kaute nervös auf seiner Unterlippe; etwas knirschte zwischen den Zähnen. Seine Knie zitterten ein wenig. Hoffentlich bemerkte Aniagua es nicht. Sie drehte sich um.
Eine Göttin.
Von ihren Augen träumte er schon, seit er ein Kind gewesen war. Wieso nur hatte er sich ausgerechnet in diesem Augenblick an sie gewandt? Warum nur hatte er nicht seinen Mund gehalten wie all die Winter und Sommer zuvor? Weshalb hatte er die Herrlichste der Canarii angesprochen? Schließlich war er das glatte Gegenteil von ihr. In dieser Hinsicht gab er sich keinen Illusionen hin: Seine Zähne waren nicht eben, seine Haut unrein, die Arme und Beine dünn wie die Zweige verkrüppelter Büsche. So war es eben. Aber damit konnte er leben.
Aber nun würde Aniagua ihn auslachen, und das schmerzte mehr, als der Außenseiter unter dem Hellen Volk zu sein. Das zeigte sich schon an seinen braunen Haaren. Von Kindestagen an hatten ihn alle verspottet: Und so etwas will ein Canarii sein? Der gehört eher dem Dunklen Volk an, wie der aussieht.
Aniagua kaute und schluckte, wischte sich über die Lippen und konnte doch nicht verhindern, dass ein klebriger Krümel zwischen Oberlippe und Nase hängen blieb. Er glänzte wie süßer Goldhonig; aller Wahrscheinlichkeit nach war es auch welcher, denn sie hatte in der Goldhonig-Gewinnung an den Steilen Hügeln gearbeitet. Als treue Diener hatten sie von Aferafers Leute einen kleinen Teil des Abbaus für den Eigengebrauch erhalten. Sicher hatte sie einiges davon mit auf die Reise ins Unbekannte genommen.
Auch das gehörte seit kurzem der Vergangenheit an, seit dieser Exodus begonnen hatte, der das gesamte Volk zu den Sieben Inseln führen sollte, zum fernen Königreich, von dem Chemira nicht einmal glaubte, dass es existierte. Aber wer hörte schon auf ihn? Jedenfalls würde in der Wüste bald niemand mehr Goldhonig essen können. Und von Sand war noch nie jemand satt geworden.
Sicher, sie hatten es nicht leicht gehabt im Talkessel, eingepfercht in Höhlen als Sklaven, die nur wegen ihrer hellen Locken von Interesse waren. Aber es war ein Leben gewesen, ohne Ungewissheit, mit Nahrung und Unterkunft – wenn auch rechtlos.
Er wandte sich ab. So konnte sie wenigstens nicht sehen, wie ihm die Röte ins Gesicht stieg. »Entschuldige.« Er ging einige Schritte, bis sie sagte: »Warte.« Er blieb stehen, atmete tief durch und drehte sich zu ihr um.
Der Honigbrösel hing immer noch unter ihrer Nase. Es tat gut, sich darauf zu konzentrieren. Sie war nur eine Frau mit einem Krümel im Gesicht, nicht mehr; ein mürber Brösel, der sicherlich von getrocknetem Gebäck stammte. »Was musst du mir mitteilen?«, fragte sie.
»Ich … also ich muss … wieso glaubst du, ich wolle dir … oder ich …«
Sie lächelte; die Sonne ging an diesem Tag zum zweiten Mal auf. »Weil du es gesagt hast.«
Er nickte. Natürlich. Nun war auch klar, warum er sich wie ein Trottel verhielt – weil er einer war. »Weißt du, wer ich bin?«
»Ich habe dich schon gesehen, aber nein, tut mir leid. Ich glaube nicht, dass wir jemals miteinander gesprochen haben.«
Sicher nicht, dachte er. »Das weiß ich nicht genau. Ich heiße Chemira. Mein Vater ist Muldir, der Seildreher – du kennst ihn sicher. Unsere Familien haben nicht weit voneinander entfernt gewohnt …« Er brach ab und tippte sich unwillkürlich an die Oberlippe. Kaum geschehen, würde er sich am liebsten den Finger abhacken. Sie bemerkte seine unbedarfte Geste jedoch nicht. Welch ein Glück. Sonst hätte sie sich wohl endgültig von ihm abgewandt.
»Natürlich«, sagte sie. »Du bist der Junge mit den …« Sie brach ab.
»Der Junge mit den …?«, fragte er.
»Entschuldige. Der mit den dunklen Haaren. So haben die anderen Kinder …« Sie blinzelte kurz, sah dann verlegen zu Boden. »So haben wir dich immer bezeichnet.«
Seine Unruhe wuchs. Sie konnte sich an ihn erinnern. Was sollte er nur sagen? Sie ist nur eine Frau mit einem Krümel im Gesicht. »Kein Grund, sich zu schämen«, brachte er heraus und wusste selbst nicht, ob er sich oder sie meinte.
Er war nicht unglücklich, als sich in diesem Moment eine Ablenkung bot. Der Fremde kam auf sie zu – Atlantos von Alashia, der Händler, oder was genau er sein mochte. Chemira war überzeugt, dass mit ihm etwas nicht stimmte. Ohne ihn hätten die Canarii niemals ihre Heimat verlassen, um die sagenhaften Sieben Inseln zu finden. Ohne ihn könnte er immer noch zusehen, wie Aniagua auf dem Weg zu den Steilen Hügel ihre Höhle verließ.
Dieser Atlantos trug die Schuld an allem, genau wie Nitetis, das verlorene und zurückgekehrte Kind seines Volkes, das in der Fremde zur Ziehtochter des von Legenden umrankten Pharaonenkönigs geworden war! Er war eine beeindruckende Gestalt, mit schulterlangen weißen Haaren, markanten Gesichtszügen und einem muskulösen Körperbau. All das, was Chemira nicht war.
Der Fremde ging vorüber, scheinbar ohne sie wahrzunehmen. Er war ins Gespräch vertieft, ausgerechnet mit Nitetis. Chemira schaute sie nur kurz an – eine hochgewachsene junge Frau mit strahlenden Augen, dunkelblau wie der Himmel über der Wüste, in den wenigen erleichternden Momenten des Tages, wenn sich die Abendkühle herabsenkte und noch nicht die Eiseskälte der Nacht brachte. Eine schlanke, biegsame Gestalt, deren sonnengebräunte Haut goldfarben schimmerte. Sah man so aus, wenn man an diesem legendären Hof der Pharaonen lebte, dem »Großen Haus«?
Nachdenklich blickte Chemira den beiden nach. Schon seit dem Aufbruch der Canarii aus ihrem Felsental vor zehn Tagen beobachtete er sie, und oft schien es, als wären sie einander feindlich gesinnt, die ägyptische Katze und der erfahrene Meereskapitän. Zu anderen Zeiten wirkten sie wie zwei Verliebte, die ein Spiel miteinander trieben und ihre gegenseitige Zuneigung nur unzureichend verbargen. Viele raunten, diese heimgekehrte Tochter ihres Volkes sei die Schönste aller Canarii, und allein deshalb sei es ein Zeichen, dass sie aus dem Exil zurückgekehrt war. Darüber konnte Chemira nur müde lächeln. Es mochte sein, dass Nitetis die Goldene aus dieser alten Prophezeiung war – was ging es ihn an? Doch die Schönste stand direkt vor ihm.
»Gibt es noch etwas Wichtiges?«, fragte Aniagua, die Göttin. »Wenn nicht, lass uns …«
»Nein, nein«, haspelte er.
»Dann lass uns morgen weitersprechen. Es wartet jemand auf mich.« Sie verzog das Gesicht, als müsse sie niesen, fuhr mit der Hand an die Nase und fand den Krümel, den sie achtlos beiseite wischte. »Einverstanden?«
»Selbstverständlich.« Er wusste, dass er in dieser Nacht keinen Schlaf finden würde.
Sie wandte sich ab. Das Kleid umschmeichelte ihre Hüften. Die Beine lagen frei, Wüstensand hatte sich in einer Falte des Stoffes versammelt und rieselte zu Boden. Chemira entfernte sich vom Lagerplatz. Er wollte allein sein mit sich und seinen Erinnerungen an die jüngsten Geschehnisse. Er fühlte sich großartig. Ein Pferd wieherte in der Nähe; er entdeckte es als Silhouette vor dem letzten glühenden Wabern, das von der versinkenden Sonne noch geblieben war. Scharrte es mit den Hufen? Ihm war es gleich. Seine Gedanken weilten in anderen Sphären.
»Bleib hier!«, rief jemand. »Die Nacht wird …«
»Schon gut!« Chemira drehte sich nicht einmal um. »Ich bin bald zurück. Ich … ich brauche etwas Ruhe.« Er ging weiter. Seine Sandalen gruben sich in den Sand. Der letzte Glutstreifen verschwand am Horizont. Nicht mehr lange, und es würde empfindlich kalt werden. Obwohl er bereits fröstelte und nicht den wärmenden Wollumhang trug, suchte er nicht das Lager auf. Dort wartete nur die übliche Hektik des Abends, all das Gerede, wahrscheinlich eine der ach so ergötzlichen Predigten von Atlantos oder Nitetis, die sich aufspielten, als wären sie die berufenen Lehrer des Hellen Volkes.
Als er müde wurde und seine Beine zu schmerzen begannen, setzte er sich. Der Sand war noch heiß; er ließ ihn zwischen den Fingern hindurchrieseln. Vollkommene Stille umgab ihn. Der Himmel verdüsterte sich zu einem schwarzen Leichentuch. Interessehalber sah er über die Schulter zurück; dort prasselten als kleine Lichtpunkte etliche Lagerfeuer. Er vermeinte, das grölende Gelächter einiger Männer zu hören. Chemira stützte die Ellenbogen auf die Knie, massierte mit den Fingerspitzen seine Schläfen. Ein Schauer rann ihm über den Rücken. War es die Kälte oder der Gedanke an Aniagua?
»Nur eine Frau mit einem Krümel unter der Nase«, flüsterte er und lachte. Es war verrückt, aber was machte es schon? Schließlich war er ganz allein an diesem Ort und weit genug vom Lager entfernt, als dass ihn jemand hätte …
Das Geräusch hörte er viel zu spät. Etwas zischte durch die Luft.
Schmerz explodierte in seinem Kopf, gefolgt von einem Knacken. Alles drehte sich. Und Schwärze überflutete ihn.
»Wer zündet die Sterne an?«
Chemira vernahm die Worte wie aus weiter Ferne. Die Stimme klang vertraut. Er kannte sie schon lange.
Er öffnete die Augen. Es war fast genauso dunkel wie vorher. Im Sternenlicht glänzte etwas vor ihm. Worum genau es sich handelte, konnte er nicht erkennen.
Er versuchte den Kopf zu bewegen, doch der Schmerz war unerträglich. Eine glühende Zange schien sich in seinen Nacken zu pressen.
»Du bist wach«, sagte die Stimme.
Etwas berührte seinen Mund, drückte sich zwischen die Zähne, zog die Kiefer auseinander. Flüssigkeit schwappte auf seine Zunge. Er musste würgen, wollte sie ausspucken, doch man hielt ihm den Mund zu. Knochige Finger schoben sich über die Nase, pressten sie zu. Ihm blieb ihm nichts anderes übrig, als zu schlucken. Bitter rann es seine Kehle hinab.
Chemira drehte den Kopf zur Seite. Es schmerzte so sehr, dass Sterne vor seinen Augen blitzten.
Sterne?
Ein Gedanke flammte in ihm auf: Wer zündet die Sterne an?
Der brutale Griff lockerte sich. »Dunkel ist die Nacht«, sagte sein Peiniger. Chemira sah ihn nur als Schattenriss. Lediglich die Augen waren als matt glänzende, trübe Perlen zu erahnen.
Er kannte diese Stimme, aber er konnte ihr keinen Namen zuordnen. Wo hatte er sie nur schon gehört? »Was hast du mir …«
»Sei still!«
Erneut blitzte etwas im Sternenlicht. Diesmal glaubte er, es zu erkennen. Es war eine Art gezackte Klinge, ein scharfer Gegenstand. Er hatte gehört, dass die Ägypter über Metallsägen verfügten – war dies eine? Während er sich in Krämpfen krümmte und vor Agonie sterben wollte, packte sein Peiniger Chemiras Beine und zog sie in eine ausgestreckte Position.
Ihm fehlte die Kraft, sich zu wehren. Was ging hier vor? Seine Gedanken glichen trübem Gewässer. Der … die Säge hob sich, und Chemira glaubte, ein gequältes Ächzen zu hören, ehe sie durch die Luft pfiff.
Er hörte ein Bersten und Knacken, mehrfach, wiederholt, mahlende Bewegungen, und während der Schmerz alles hinwegspülte, begriff er, dass der andere ihm die Beine abgetrennt hatte.
Das trübe Wasser seiner Gedanken wandelte sich in einen reißenden, gurgelnden Fluss, der in die Tiefe der Dunkelheit und des Todes strömte. Er schrie, bis sich die knochige Hand auf seinen zuckenden Mund legte.
»Psst«, sagte die Stimme. »Es ist ja bald vorbei.«
Doch das stimmte nicht. Es dauerte noch lange, bis sich endlich Dunkelheit über Chemiras Bewusstsein senkte, eine schiere Ewigkeit, während sein Verstand einen Anker suchte, die irrsinnigen Schmerzen zu übertünchen. So kam es, dass eine seltsame Frage ihn über die letzte Schwelle in der Tiefe begleitete:
»Wer zündet die Sterne an?«
Ich sehe die Leiche und kann es doch kaum glauben. Wer hat diesen Mann verstümmelt und ihn dazu gebracht, grünen Speichel auszuspucken? Und vor allem – warum? Es gab keine Anzeichen eines Überfalls. Weder die Späher noch die Wächter haben am Abend zuvor oder in der Nacht etwas Verdächtiges in der Umgebung bemerkt. Auch mein Robotfalke nicht, der stets über dem Lager kreist, das wir vor wenigen Stunden aufgeschlagen haben, als wir noch nicht ahnten, dass es einen Mörder unter uns gibt.
Wieso?, frage ich mich. Weshalb müssen immer alle nur denkbaren Schwierigkeiten auftreten?
Der Zug durch die Wüste mit diesem unerfahrenen, verweichlichten Volk wäre auch so problematisch genug gewesen. Es hätte ohnehin meine gesamte Kraft gekostet, das Helle Volk an sein Ziel zu führen, zu den Sieben Inseln, die ihm – wenn man den Worten der alten Prophezeiung von Saïs Glauben schenken wollte – als Königreich vorherbestimmt waren. Konnte uns da nicht wenigstens ein brutaler Mörder erspart bleiben?
Offenbar nicht.
Wenn das alles ist, was du zu sagen hast, schelte ich den Logiksektor, schweig lieber!
Diesem Rat folgt er. Immerhin; es hätte anders kommen und sich zu einer ausschweifenden inneren Diskussion entwickeln können.
Ein weiterer Schwall Blut quillt aus den Beinstümpfen. Doch das ist es nicht, was die Männer rundum zurückweichen lässt. Sofort sehne ich mich danach, es »nur« mit einem Mörder zu tun zu haben … denn dieses neue Blut ist grün.
Teil 1
1.Die Botschaft der grünen Leiche
Am zehnten Tag der Odyssee des Hellen Volkes und zu Beginn der Reise
Die feingliedrigen, fast an zarte Mädchenhände erinnernden Finger nestelten an einer Schriftrolle. Zweifellos plante Orsat nicht, sie zu öffnen und zu lesen; viel eher bot sie ihm Halt. Etwas Vertrautes. Er wirkte nervös, der Blick der schwarzen Augen huschte fahrig umher und ruhte nur selten auf mir.
»Sag, Orsat«, fragte ich, »hast du jemals zuvor von Leichen gehört, aus denen grünes Blut rinnt?«
Der Schriftgelehrte lächelte schmallippig. »Ein Wunder.« Die Worte krochen so langsam und leise über seine Lippen, dass ich sie kaum verstehen konnte. »Oder ein Fluch? Hat eine Kreatur aus dem Totenfluss von ihm Besitz ergriffen, ehe er starb?« Er saß am Boden, auf einem ebenso ausgefransten wie vom häufigen Gebrauch abgewetzten roten Tuch. Sein Hinterkopf berührte den Stoff der Zeltwand.
»Das erscheint mir nicht sehr wahrscheinlich«, sagte ich vorsichtig, um nicht rigoros zu betonen, dass ich es für absoluten Unsinn hielt. Orsat war ein Kind seiner Zeit, ein Schriftgelehrter, fest im Glauben an allerlei mythologische Wesen verwurzelt; ich hatte gelernt, ihn auf seine Art zu respektieren. »Ich meine etwas anderes – im Zusammenhang der Prophezeiungen von Saïs ist nie die Rede davon?«
»Niemals«, sagte er, ohne auch nur eine Sekunde nachzudenken. »Ich studiere sie seit Jahren, wie du weißt. Sie fasziniert mich seit jeher. Plötzlich tauchst du auf, ein weißhaariger Fremder, der die Erfüllung der alten Worte in sich trägt … und wie wenig Zeit ist vergangen, bis wir mit der Karawane der Canarii aufgebrochen sind? Die Ereignisse überschlagen sich. Dies sind interessante Zeiten, in denen wir leben. Ein Wendepunkt in der Geschichte nicht nur des Hellen Volkes, wie mir scheint.«
Ständig schweift er ab, meldete sich der Logiksektor zu Wort. Er ist unruhig. Der Fund der Leiche irritiert ihn.
Wer wäre davon nicht … irritiert?, gab ich zurück. »Du glaubst, der Mord steht damit im Zusammenhang?«
»Wenn eine neue Zeit anbricht, gab es schon immer Wehen. Unruhen.« Orsat verlagerte seine Position, streckte den Rücken. Mit einem schleifenden Geräusch strichen die Haare über den Zeltstoff. »Eine neue Epoche löst eine alte nicht ohne Schmerzen ab. Kriege, Opferungen … die Liste ist lang. Das Denken und Fühlen ganzer Völker wird auf die Probe gestellt, vom Glauben ganz abgesehen. Gerade das Letzte sorgte schon oft genug für Schlachten und Tod.«
Ich war erstaunt über derart große Einsicht. Die Historie meiner eigenen Heimatwelt Arkon hatte mich exakt dasselbe gelehrt. »Und wie passt die Leiche deiner Meinung nach in diesen Zusammenhang? Warum musste Chemira sterben?«
Sein Gesicht verzog sich, als spiegelte sich der Schrecken dieses Morgens noch einmal darin. Orsats Hände bewegten sich unruhig. »Diese Frage kann ich dir nicht beantworten. Aber eines glaube ich zu wissen.«
»Und das wäre?«
Er zögerte kurz, erhob sich und griff nach einem Krug, gefüllt mit schalem, viel zu warmem Wein. Als ich in sein Zelt eingetreten war, hatte er mir ebenfalls davon angeboten.
»Es wird nicht bei dieser einen Leiche bleiben«, sagte er.
Eine treffliche Schlussfolgerung, der auch der Extrasinn nicht widersprach. »Kannst du noch einmal die Schriften durcharbeiten, die im Zusammenhang mit der Prophezeiung stehen?«
»Ich kenne sie alle, Atlantos. Nur wegen dieser Weissagung kam ich nach Men-nefer an den Hof des Pharaos, als ich die Gerüchte über seine Ziehtochter hörte. Man sprach von ihrem Haar, das wie Gold in der Sonne glänzte, von Nitetis, in deren Augen man das Meer glitzern sah, von ihrer märchenhaften Schönheit, die alles andere überstrahlte. Ich ahnte sofort, dass sie die Goldene sein musste, nein, mehr, ich wusste es! Endlich hatte ich die Frau gefunden, der in der Prophezeiung eine Schlüsselrolle zukommt, genau wie dem Weißen Krieger aus der Fremde …« Er zögerte kurz. »Wie dir. Also sag du mir nicht, dass es im Umfeld dieser Schriften Worte über grün blutende Leichen geben könnte.«
Ich streckte ihm die flache Handfläche entgegen und verneigte mich leicht. »Ich will deine Weisheit nicht anzweifeln, Orsat. Der Pharao selbst nahm dich auf – wer bin ich, dass ich diesem Urteil widersprechen sollte? Aber auch ich verfüge über bescheidene Kenntnisse im Umgang mit Texten, Geschichten und der Historie im Allgemeinen. Ich weiß, dass sich neue Blickwinkel ergeben, wenn man neue Tatsachen erkennt. Wenn man eine andere Position einnimmt, können alte Schriften plötzlich völlig neu zu sprechen beginnen. Und der Fund der Leiche ist so etwas. Stimmst du mir zu?«
Er bestätigte missmutig. Vielleicht hatten meine Worte ihn nur an Dinge erinnert, die er nicht wahrhaben wollte, weil ihm die bisherige Deutung der Prophezeiung vertraut war und Sicherheit bot; ein Geländer, an dem er sich festhalten konnte und das auch in diesen von ihm so genannten unruhigen Zeiten Stabilität bot.
»Alte, dunkle Worte erscheinen in einem anderen Licht als zuvor«, fuhr ich fort. »Vielleicht ist nicht direkt von grünem Blut die Rede, sondern von einem Fluss in dieser Farbe oder …«
»Ich habe verstanden.« Orsat leerte seinen Krug und stellte ihn achtlos ab; er kippte um und vergoss die letzten Tropfen in den Sand des Bodens. »Ich werde deiner Bitte Folge leisten.«
»Ich danke dir.« Entschlossen trank ich ebenfalls, was einige Überwindung kostete. Der Wein schmeckte fad und warm, besaß eine fast brackige Nuance. Natürlich ließ ich mir nichts anmerken, um der Höflichkeit Genüge zu tun. Immerhin war Flüssigkeit als solche inzwischen knapp, ihr Wert stieg, je länger wir unterwegs waren; und Orsat hatte mir von seinem Vorrat freiwillig und großzügig angeboten. Ob er es nur getan hatte, weil er meinen Worten vertraute, dass wir noch an diesem Tag den Rand einer Oase mit einer ausreichend großen Wasserstelle erreichen würden?
Der Schriftgelehrte öffnete eine kleine, hölzerne Lade, die er seit unserem Aufbruch hütete wie seinen kostbarsten Schatz. Der Deckel war mit feinen Schnitzereien verziert, die allerlei mythologische Gestalten und Götter der Hellenen und Rômet zeigte – eine eigenartige Vermischung der beiden Kulturen, aber wohl immer häufiger geworden in den jüngsten Jahren. Ich sah noch, wie er eine weitere Rolle aus dickem Pergament hervorzog, dann verließ ich das Zelt.
Die Sonneneinstrahlung ließ meine Augen tränen. Ich befand mich schon seit einer halben Ewigkeit auf Larsaf III, lebte so lange unter den Menschen dieses Planeten, dass ich mich bei Gelegenheiten wie diesen fragte, ob ich mich langsam aber sicher zu einem der ihren entwickelte. Normalerweise weinte ein Arkonide nicht, wenn er eine übermäßig helle Umgebung betrat. War das nicht eher eine Eigenart der Bewohner dieser Welt, eine Folge minderwertiger Physiologie und Biologie?
Soll ich dir wirklich eine exakte Definition deiner körperlichen Reaktionen nennen?, lästerte der Extrasinn. Dein Leib ist weder mutiert, noch leidet er unter Anpassungssymptomen dieser Art. Arkonidische Augen tränen, wenn innere Erregung Besitz ergreift von …
Ich weiß, unterbrach ich. Manchmal stelle ich philosophische Überlegungen an, die mit Logik nicht unbedingt zu erklären sind. Das sind Momente, in denen du …
Philosophie? Aber er ließ er mich nun den Gedanken nicht zu Ende bringen. Bist du dir sicher? Oder versinkst du in Jammerei? Haderst du wieder einmal mit deinem Schicksal, das dich von deinen Artgenossen getrennt und zu einem Gestrandeten gemacht hat? Kümmere dich lieber um die Leiche! Ein Mörder ist unter uns – keine gute Voraussetzung, vor allem nicht, weil wir noch heute die Oase erreichen werden, an der du die Menge des Hellen Volkes in drei Gruppen aufteilen musst. Welchem Teil schickst du den Killer mit? Wissentlich oder unwissentlich, was momentan um einiges wahrscheinlicher erscheint?
Das war eine Frage, über die ich lieber nicht nachdenken wollte. Oder anders gesagt: Mir blieben nur wenige Stunden, den Mörder ausfindig zu machen.
»Du weinst, Atlantos?«
Ihre Stimme klang amüsiert. Die weißblonden Haare strahlten im grellen Licht der Sonne, ja, ihre Haut schien von innen heraus zu leuchten. Einen passenderen Beinamen als die Goldene hätte man kaum für sie finden können.
Ich zeigte ein feinsinniges Lächeln. »Allein wegen deiner Schönheit, Nitetis. Weil ich dich so lange nicht mehr gesehen habe.«
Ihre Haltung war perfekt, den Kopf hielt sie aufrecht, das Kinn vielleicht eine Spur zu hoch. Die in der Mitte gescheitelten Haare umschmeichelten die Wangen, bogen sich zum Hals hin ein und wurden zwischen Nacken und Schulterblättern von einem roten Band fixiert. Vereinzelte Strähnen waren unter der ständigen Einstrahlung der Wüstensonne noch heller geworden, fast arkonidisch weiß. »In diesem Fall«, sagte Nitetis, »brauchst du ab sofort nicht mehr traurig zu sein.«
»Wofür ich dir Dank schulde.«
Sie kam näher. Ich tat es ihr gleich und legte ihr die Hand auf die Schulter. Sie rümpfte die spitze Nase. »Was …«
»Sand«, unterbrach ich und strich etliche Körner vom Stoff ihres Kleides, ehe ich die Hand zurückzog. »Du hast geruht?«
»Nicht, dass dich das etwas anginge.« Nitetis lächelte, doch es erschien mir eher spöttisch als freundlich. In ihrem linken Auge war das Weiß gerötet, offenbar waren auch dort einige Sandkörner am Werk gewesen. »Aber nein, Atlantos, ich lag nicht. Wenn sich Sand auf meinen Schultern abgelagert hat, dann nur aus dem Grund, weil ich die Fundstelle der Leiche untersucht habe.«
»Du hast dir die Hände selbst schmutzig gemacht?«
»Ich habe schon lange festgestellt, dass du neidisch auf mich bist, weil mir am Hof meines Ziehvaters Ah’mes eine Menge Diener zur Verfügung standen.«
»Von Neid würde ich keinesfalls …«
»Aber«, fuhr sie ungerührt fort, »ich bin durchaus in der Lage, Dinge selbst zu erledigen.« Sie lächelte keck. »Ich benötige nicht für alles eine helfende Hand.«
Basierend auf langjähriger Beobachtung dieses Volkes kann ich konstatieren, dass sie Interesse an dir zeigt, analysierte der Logiksektor mit der üblichen kühlen Distanziertheit.
Um diese Feststellung zu treffen, benötigte ich ihn nicht; mit den Frauen dieses Planeten und ihrem Verhalten gegenüber Männern im Allgemeinen und mir im Speziellen hatte ich hinlängliche Erfahrungen gesammelt. Interesse an uns, meinst du wohl, dachte ich und es gelang mir damit zum ersten Mal seit langem, den Extrasinn sprachlos zurückzulassen. Es fragte sich nur, wie ausgeprägt Nitetis’ Neugierde war und ob sie nicht eher dem Spieltrieb glich, mit dem sich eine Katze einer Maus widmete.
Unvermittelt wechselte sie das Thema. »Wir sind seit zehn Tagen unterwegs, Atlantos. Wann immer ich mit den Canarii spreche, äußern sie, dass es ihnen so vorkommt, als läge der Alltag in ihrem Gebirgstal Jahre zurück … als sei er Teil eines anderen Lebens. Sie wollen zum einen das Ziel erreichen, sehnen sich nach den sagenhaften Sieben Königreichen. Aber sie haben auch Angst. Über den Gebirgspass hast du uns in diese Wüstenei geführt. Sie fürchten, vor Hitze und Entkräftung zu sterben, ehe wir wieder freundlichere Gegenden zu Gesicht bekommen.«
»Eine völlig unbegründete Angst. Ich kenne diesen Weg. Die Karten, die mir vorliegen und die ich auch den zehn Weisen ausgehändigt habe, sind hinlänglich genau.« Noch genauer war allerdings die Auskunft meines Robotfalken Horus gewesen, den ich als Boten ausgeschickt hatte, um das Land zu überfliegen. »Noch heute werden wir …«
»Ich weiß. Du hast es oft genug angekündigt. Nach wenigen Stunden Fußmarsch erreichen wir eine Oase. Der Späher, den ich vorausgeschickt habe, bestätigt das.«
»Du hast einen Späher …« Sie wollte mich erneut unterbrechen, doch ich hob die Hand und sah sie ärgerlich an, was sie verstummen ließ. »… einen Späher ausgesandt, ohne mir etwas davon zu sagen?«
»Bin ich dir etwa Rechenschaft schuldig? Bist du unser König?«
Mühsam unterdrückte ich aufwallenden Ärger. Sich mit ihr zu streiten, brachte nichts. Mehr denn je waren die rund tausend Menschen des Hellen Volkes darauf angewiesen, dass wir sie führten. Eine Aufgabe, die wir kaum erledigen konnten, wenn wir uneins blieben. Wir mussten zusammenarbeiten, und offenbar legte es Nitetis darauf an, mir zu beweisen, dass sie dazu in der Lage war. Sie war mehr als die verwöhnte, vom Palastleben verweichlichte Pharaonentochter. Das wusste ich, und doch war ich ihr auf vielen Gebieten weit voraus.
Lichtjahre weit, hörte ich die altbekannte Stimme in mir.
Das wird sie wohl kaum verstehen können, konterte ich. Von kosmischen Entfernungen ahnte sie ebenso wenig etwas wie irgendjemand sonst auf diesem Planeten, von mir abgesehen.
»Ich bin nicht euer König«, sagte ich lahm. »Und deiner schon gar nicht. Aber ich dachte, du würdest mir vertrauen. Wolltest du zu Orsat?«
Sie verneinte. »Zu dir. Ich wusste, dass du sein Zelt aufgesucht hast. Ich musste nicht lange warten, um dich abzufangen.«
»Ich fühle mich geehrt.«
Das Braun ihrer Haut war merklich dunkler geworden, seit wir nach dem Gebirge das Wüstengebiet erreicht hatten. Bei einigen aus dem Hellen Volk bildeten sich bereits im Gesicht und an den Händen – an den ungeschützten Hautzonen – Blasen und Rötungen; in seltenen Fällen kam es bis zum Sonnenstich, einschließlich eines nächtlichen Schüttelfrosts und krampfartigen Erbrechens. Niemand jedoch war bislang ernsthaft erkrankt, gerade die Alten, Säuglinge und Kleinkinder ertrugen die Strapazen erstaunlich gut. Die Wüste war kein sonderlich angenehmer Ort, vor allem für solche, die den Aufenthalt in ihr nicht gewohnt waren.
»Also, was kann ich für dich tun?«, fragte ich.
»Nicht hier.« Nitetis machte eine umfassende Handbewegung: Zu viele Leute rundum.
Ich nickte beiläufig, und gemeinsam schritten wir los. Das Zelt des Schriftgelehrten lag ohnehin am Rand des Lagers, das wir für die Nacht aufgeschlagen hatten. Ohne den Leichenfund wären wir schon unterwegs; so verzögerte sich alles. Einige hoben inzwischen für den toten Chemira ein Grab aus. Das Helle Volk pflegte ein althergebrachtes Totenritual, um die Verstorbenen in die jenseitige Welt zu begleiten. Sie waren mühsam darauf bedacht, die eigene Kultur zu bewahren und sich nicht völlig an die jeweilige Umgebung anzupassen.
Bald umgaben uns die Stille und die mörderische Hitze der Wüste abseits der Schatten, die auf Pflöcke gespannte Stoffbahnen boten. Vom Lager her war kaum ein Laut zu hören; alle schienen erschöpft und von dem grausigen Leichenfund wie gelähmt zu sein. Auf meiner Kopfhaut bildeten sich Schweißtropfen, die über Nacken und Stirn rannen. Gerade als ich Nitetis’ Gesicht musterte, tropfte es aus ihren Schläfenfransen. Sie wischte beiläufig darüber.
Ein einzelner Felsen ragte etwa hüfthoch aus dem gelben Sand; ständiger trockener Wind und zahllose Sandstürme hatten ihn glatt geschmirgelt. Eine handspannengroße, graubraune Echse kauerte regungslos darauf. Meine Begleiterin verscheuchte das Tier, indem sie es anstupste. Blitzartig setzte es sich in Bewegung und sprang in den Sand. Als es davonhuschte, zeichnete der Schwanz eine wellenförmige Spur.
Nitetis ließ sich auf dem Stein nieder, in der Haltung einer Königin, den Rücken perfekt aufgerichtet, die geschwungenen Lippen leicht gespitzt. Sie wirkte kühl und unnahbar – genau das, was sie so anziehend und unwiderstehlich machte. Am Hof des Pharaos hatte sie zurückgezogen gelebt; nur wenige waren ihr begegnet. Ich konnte gut nachvollziehen, dass die Gerüchte über ihre geradezu märchenhafte Schönheit sich überall im Land verbreitet hatten. Ihr Ruf war ihr im ganzen Gebiet der Rômet und darüber hinaus vorausgeeilt, bis in das Reich der Pârsa gar, was letztlich auch einer der Gründe gewesen war, dass mein treuer robotischer Diener und Begleiter Rico mich nach einer langen Tiefschlafphase in der Unterwasserkuppel geweckt hatte.
Eine Sekunde überlegte ich, ob ich mich neben sie setzen sollte – mit ein wenig Körperkontakt bot der Felsen genug Platz –, entschied mich aber dagegen. Stattdessen blieb ich stehen und bot ihrem Gesicht somit Schatten. »Du hast also den Fundort der Leiche untersucht.«
»Und dort nichts gefunden außer rot verklumptem Sand, der bestialisch stank. Nach Blut und …« Sie verzog das Gesicht. »Du kannst es dir vorstellen. Als ich einen der Klumpen zerbrach, wimmelten Maden daraus hervor. In der Hitze des Morgens scheinen sie schneller zu wachsen, als die Opfergaben im Tempel verschwinden können.«
»Eine interessante Redensart«, sagte ich.
»Es soll Priester geben, die sich nicht nur für das Wohl der Götter interessieren, sondern auch für das eigene«, meinte Nitetis. »Aber das tut nichts zur Sache. Eigentlich wollte ich auf Folgendes hinaus … Chemira hat sehr viel Blut verloren, und das meiste davon war rot. Erst als Orsat die Leiche bewegte und neue Flüssigkeit austrat, kam das grüne Blut zutage. Wie erklärst du dir das? Du bist weit herumgekommen als Kapitän auf hoher See. Du musst viel erlebt und gesehen haben.«
»Ich habe keine Erklärung«, gab ich zu. Natürlich hatte ich lange nachgedacht; aller Wahrscheinlichkeit lag ein biologischer Prozess vor – ein Gift, das die Blutkörperchen verändert und möglicherweise eine umfassende Mutation ausgelöst hatte. War eine besondere Chemikalie zum Einsatz gekommen, ein Pflanzenextrakt oder etwas Vergleichbares? Wenn ja, wer verfügte über die notwendigen Kenntnisse? Und weshalb machte sich jemand diese Mühe? Wieso genügte es dem Täter nicht, Chemira »nur« zu töten? Ich hoffte, dass die genaue Analyse einer Gewebeprobe Aufschluss darüber gab. Noch war es mir allerdings nicht gelungen, eine solche Probe zu entnehmen. Im Sand versickertes Blut erschien mir nicht sicher genug, denn es war zweifellos verunreinigt. Hinzu kam, dass zahllose Canarii die Leiche seit dem Auffinden umringten; ihr Todes- und Begräbnisritus verlangte es, sie keine Sekunde mehr aus den Augen zu lassen. Aber die Zeit würde kommen …
Nitetis strich nachdenklich mit der Rechten über den Felsen. »Ich glaube nicht an einen Zufall.«
»Inwiefern Zufall?«
»Dass der Mord ausgerechnet geschah, kurz bevor wir uns in drei Gruppen trennen werden. Nur noch heute konnten alle meines Volkes davon erfahren.«
Der letzte Zeitpunkt, um umfassend Angst zu säen, dachte ich. »Also steckt in der Leiche eine Botschaft für das Helle Volk?« Eine interessante Überlegung, die einen neuen Denkansatz bot.
Schrill kratzten Nitetis’ Fingernägel über das Gestein; sie hob die Hand und blickte nachdenklich darauf. Der Nagel am Daumen war gerissen. »Alle wissen, dass du planst, das Volk in drei Gruppen aufzuteilen. Sie haben es hier oder dort gehört, ohne dass jemand Genaueres darüber sagen kann.«
»Ich werde in der Oase alles erklären.«
»Darauf kommt es mir nicht an. Viele sind unsicher und blicken besorgt in die Zukunft. Sie haben alles Vertraute verloren. Sie verhalten sich wie verängstigte Schafe, die nach einem Hirten suchen.«
»Das erscheint mir kaum als ein ausreichender Grund, einen Mord zu begehen«, sagte ich. »Orsat sprach davon, dass wir uns in einer Zeitenwende für das Helle Volk befinden und solche Augenblicke immer mit gewissen … Wehen einhergehen.«
»Wehen?« Sie lachte. »Das ist kaum ein Thema, über das Männer wie ihr beide viel zu sagen hättet. Oder wie viele Kinder habt ihr schon geboren?«
Auch ich konnte mir ein Grinsen nicht verkneifen. »Soweit mir bekannt ist, genauso viele wie du.«
Für einen Augenblick schaute sie ins Leere, und ich fragte mich, ob ich einen Finger in eine offene Wunde gelegt hatte. Schon wollte ich mich entschuldigen, als sie fortfuhr. »Der Mord ist ein Zeichen, da bin ich sicher. Eine Botschaft. Nur was sie bedeutet, kann ich dir noch nicht sagen. Aber ich habe mich an etwas erinnert, das so offensichtlich ist, dass wir es bisher nicht wahrgenommen haben.«
Ich wartete ab, aber als sie zu lange schwieg, sah ich sie auffordernd an. Sie brauchte wohl Ermunterung, um mir mitzuteilen, was ihr auf dem Herzen lag.
»Setz dich, denn meine Erzählung wird einige Zeit in Anspruch nehmen«, forderte sie mich auf, rückte jedoch nicht zur Seite. Also ließ ich mich auf dem Sand nieder. Die Hitze durchdrang den Stoff meiner Kleider.
»Die Canarii verließen gerade das Tal ihrer Gefangenschaft«, sagte sie. »Ich beobachtete alles von einem kleinen Felsenabsatz aus und entdeckte deinen Begleiter.«
»Riancoros?« Mein Roboter Rico trat als ein Angehöriger der Volksgruppe der Pakaftiu auf, der Bewohner von Keftiu oder Kreta – eine Gestalt, die man nicht so leicht vergaß, wenn man sie einmal sah. Ich selbst gab ebenfalls vor, mütterlicherseits ein Rôme aus dem Lande Ägypten zu sein, dessen Vater ein reicher Handelsherr auf Keftiu gewesen war. Deshalb war ich beiden Völkern zugeneigt, was mich geradezu als schiffsreisenden Händler prädestiniert hatte, der später das Kriegshandwerk ergriffen hatte.
Sie nickte. »Er stand bei Orsat, in der Nähe der Gruppe, die sich um Beranuya gebildet hatte. Sie waren die Ersten, die aus dem Tal zogen, und ich gesellte mich zu ihnen …«
Zehn Tage zuvor
Riancoros überragte den Schriftgelehrten Orsat, obwohl auch dieser ein großer Mann war. Beide sahen Nitetis entgegen, als diese sich mit weit ausholenden Schritten näherte. Sie stieg vom westlichen Durchlass des Tales herab, in dem die Canarii lange Jahre als Arbeitssklaven für König Aferafer hatten Frondienst leisten müssen. Eine dunkle Ära für das Helle Volk, die nun der Vergangenheit angehörte.
Der weiße Krieger Atlantos war gekommen … und sie, die Goldene. Zwei Figuren einer überlieferten Prophezeiung, die dem Volk sieben ferne Königreiche verhieß. Ein Herrschaftsbereich, der allerdings eine lange, entbehrungsreiche Odyssee weit entfernt lag; und diese Reise nahm in diesen Augenblicken ihren zaghaften Anfang.
»Wie viele gehören eurer ersten Gruppe an?«, fragte Nitetis.
Orsat schwieg, als müsse er überlegen, ob er ihr antworten sollte. Rico jedoch antwortete, ohne zu zögern. »Einundfünfzig Personen. Wir beide und Beranuya eingeschlossen, der als Führer dient, bis wir uns alle jenseits des Bergpasses versammeln und den Weg in die Wüste antreten.«
Sie standen auf einem Abhang, etwa zwei Mannslängen oberhalb des Hauptwegs, auf dem Mensch und Tier dahinzogen. Beranuya ging an der Spitze der kleinen Schar, die vom Kleinkind bis zum Greis reichte. Nitetis konnte die gesamte Gruppe überblicken, in deren Mitte vier beladene Pferde dahintrotteten. Das Fell glänzte stumpf, doch die Mähnen waren schmutzig. Ein Esel zog einen zweirädrigen Karren, auf dem sich Körbe, Tongeschirr und hölzerne Gefäße stapelten. Die Canarii trieben Schafe, Ziegen und Schweine mit sich. In Käfigen flatterten gemästete Vögel. Dutzende prall gefüllter Ziegenbälge enthielten sauberes Wasser, auf dem Karren und in den Traglasten schaukelten Krüge voll Wein. Dazu kamen Ballen frisch gemähten Grases, Säcke voll Korn und an diesem Tag geerntetes Gemüse und Obst.
Von den Türmen starrten Aferafers Soldaten auf die kleine Karawane, der bald weitere folgen sollten. Ihnen blieb nichts übrig als zuzusehen, wie die einstigen Sklaven als Freie davonzogen. Ihr bequemes Herrenmenschen-Leben rann ihnen sozusagen deutlich sichtbar zwischen den Fingern hindurch.
»Sie werden etwa drei Tage bis zum Pass brauchen«, sagte Riancoros. »Eine Menge wird unterwegs zerbrechen, anderes haben sie vergessen – aber weder wir noch Atlantos konnten sich um jeden Einzelnen kümmern, seine Habseligkeiten mustern und sein Gepäck überprüfen. Ganz davon abgesehen, dass viele uns diese Einsicht wohl verweigert hätten. Du, Nitetis, weißt, wie schlecht sie vorbereitet sind für einen derart weiten Weg. Du bist die Goldene, ihre verheißene Königin oder gar Göttin. Sie benötigen deine Unterstützung jetzt schon, und mit jedem kommenden Tag mehr.«
»Noch wirken sie nicht so, als könnten sie in große Schwierigkeiten geraten.«
»Noch«, versetzte Orsat. Er klang traurig und begeistert zugleich. »Es ist kaum zu glauben, dass es diese Menschen sind, die mit dir gemeinsam die Prophezeiung erfüllen werden, die mich mein ganzes Leben lang fasziniert hat. Dass meine müden Augen sie noch sehen dürfen, ist das größte Glück, das mir je widerfahren ist. Dass ausgerechnet ich dies miterleben darf …«
Von Wort zu Wort sprach er leiser, bis Nitetis das Gemurmel schließlich nicht mehr verstehen konnte. »Sie gehen langsam«, sagte sie. »Sollten wir sie nicht zur Eile antreiben?«
Riancoros nahm einen Stein in die Hand und drehte ihn zwischen den Fingern. »Es wäre überflüssig. Sie werden nie sonderlich schnell sein, erst recht nicht, solange alle tausend gemeinsam unterwegs sind. Später müssen wir die Gruppen trennen, um sie kurz vor dem Ziel wieder zu vereinen. Bis dahin sollen sie sich langsam bewegen, um ihre Kräfte zu schonen. Wir dürfen die Alten und Kranken oder auch die von der Arbeit Ausgezehrten nicht überfordern, und es gibt nun einmal nicht genug Pferde und Karren, um sie alle zu transportieren.«
Der Schriftgelehrte stellte sich neben Nitetis. »Stell sie dir in der Wüste vor. Es wird Opfer geben. Verletzungen, Blasen, Hitzeschocks. Sie werden Durst und Hunger leiden, trotz all der Vorräte, die sie jetzt mit sich führen.«
Über ihnen stieß ein Raubvogel einen krächzenden Schrei aus. Nitetis hatte Falken wie ihn in den zurückliegenden Tagen oft gesehen. Einmal war ein erstaunlich großes Tier sogar bedrohlich nahe gekommen, so dass ihr ein Schauer des Unbehagens über den Rücken gelaufen war. Sonnenstrahlen hatten sich auf dem gebogenen Schnabel gebrochen und ihn aufblitzen lassen. »Das ist mir klar. Was glaubt ihr, womit ich die letzte Nacht verbracht habe?«
»Mit meinem Begleiter Atlantos«, sagte Riancoros. Ein süffisanter Unterton lag in seiner Stimme. »Soweit mir bekannt ist, habt ihr …«
»Wir haben geredet!« Sie fragte sich, ob sich in dem seltsam starren Gesicht ihres Gegenübers tatsächlich ein amüsiertes Lächeln zeigte. Seine Mimik wirkte, als habe er nicht die volle Kontrolle darüber; offenbar ein Leiden, das die Muskulatur oder auch die Nervenbahnen beeinträchtigte. »Wir planten den Auszug des Hellen Volkes.«
»Ich weiß«, versicherte der hochgewachsene Pakafti. »Ich kenne Atlantos gut. Hin und wieder kommt es mir so vor, als hätten wir die Zeit vieler Menschenleben miteinander verbracht.« Dabei neigte er leicht den Kopf und blickte der Goldenen genau ins Gesicht. »Zu welchem Ergebnis seid ihr gekommen?«
»Dass wir uns bald aufteilen, ist dir bekannt. Schiffe warten auf einige von uns, in einem weit entfernten Hafen.« Nitetis hörte das Weinen eines Babys aus der Menschenmenge, die unter ihnen hinweg zog. »Verschiedene Gruppen werden unterschiedliche Wege wählen. Zu Fuß, mit Pferden, über Land und Meer, durch Gebirge und Wüsten … es ist nicht einfach zu erklären.« Die letzten Worte sprach sie in herablassendem Tonfall.
»Ich bin durchaus in der Lage, komplexe Gedankengänge zu verstehen.«
Sie nickte. »Atlantos und ich habe lange über den … göttlichen Beistand gesprochen, der vorweg ziehen wird, als Wegbereiter. Die Götter weisen uns persönlich den Weg.« Sie deutete nach unten, wo Guayaram aus der befestigten Stadt trat, der junge Canarii, der den neu geschaffenen Altar der Zwillingsgötter Xatta und Attax als Priester betreute. Er würde bald die Spitze des Zuges bilden und jeweils als Erster die fremden Landstriche betreten, direkt vor den irdischen Behausungen seiner Götter.
Die Götter weisen uns persönlich den Weg …
Ein Gedanke, der sie beunruhigte, denn für das Helle Volk waren nicht nur Xatta und Attax diese Götter, sondern vor allem auch sie selbst. Die Goldene, die Auserwählte der Prophezeiung, die mythische Gottkönigin, vorherbestimmt, um in den fernen Sieben Königreichen zu herrschen. Nitetis jedoch war die Vorstellung völlig fremd, als Göttin verehrt zu werden. Sie wusste, dass sie Mensch war und immer bleiben würde; etwas, dass das Volk – ihr Volk – anders beurteilte. Es gab Zeiten, in denen es ihr schmeichelte; dann wieder fürchtete sie sich davor, der damit einhergehenden Verantwortung nicht gewachsen zu sein.
Guayaram schritt selbstbewusst voran, den Blick erhoben. Träger schleppten dicht hinter ihm den Zwillingsaltar. Ein junger Mann, über den Nitetis kaum etwas wusste; er zählte etwa fünfunddreißig Sommer, war kräftig, und die mehrfach gebrochene und schief zusammengewachsene Nase sprach von einem nicht gerade zurückhaltenden Leben. Atlantos jedoch hielt große Stücke auf ihn und hatte sich einige Male überzeugt geäußert, dass er der Richtige für diese Aufgabe sei.
Nitetis musste dem Weißen Krieger also Vertrauen schenken – wieder einmal. Bislang hatte es sich nicht als Fehler erwiesen, dennoch gefiel es ihr nicht, bis zu einem gewissen Maß von ihm abhängig zu sein. Seit sie den Pharaonenhof und seine starren Regeln verlassen hatte, fühlte sie sich von Tag zu Tag freier. Wenn sie über die Menschmenge blickte, kam es ihr vor, als sei tatsächlich sie diejenige, auf die alle immer gewartet hatten …
Guayaram blieb stehen und beobachtete den Auszug des Hellen Volkes, genau wie Nitetis, Riancoros und Orsat nur wenige Schritte entfernt von ihm. Eine Familie nach der anderen verließ ihr altes Leben, kam aus den Höhlen und schloss sich samt ihrer Habe und einigen Kleintieren dem Tross an. Krieger aus den Reihen der Rômet, die Atlantos und die Goldene begleitet und letztlich die Sklaverei des Hellen Volkes unter König Aferafer beendet hatten, gesellten sich zu ihnen. Dies diente, wie Nitetis wusste, weniger ihrem Schutz als vielmehr als Zeichen, dass sie den Canarii beistanden – sie blieben ab sofort nicht mehr auf sich allein gestellt.
Nacheinander verließen die einzelnen Gruppen das Gebiet zwischen den Türmen und damit sowohl ihre alte Heimat und als auch ihr Dasein als Sklaven. Sie waren frei, und es würde sich zeigen, was sie mit dieser Freiheit in Zukunft anfingen. Sie mussten eine neue Art zu denken lernen. Ohne Anleitung, das glaubte Nitetis ebenso wie Atlantos, konnten sie nicht überleben; es bestand die Gefahr, dass sie schon auf dem Weg untergingen; dass sie verhungerten, verdursteten, vor Erschöpfung zusammenbrachen.
Alle zogen nach Westen, in die Richtung, die der Weiße Krieger ihnen dank seiner Landkarten gewiesen hatte. Dies waren Zeichnungen, die den zweiten Teil der alten Prophezeiung bildeten, die er erst vor wenigen Tagen dem verblüfften Orsat und den zehn greisen Weisen vorgelegt hatte.
Eine erste Gruppe junger, ungestümer Canarii war bereits vor drei Nächten losgezogen und hatte geschworen, jenseits des Passes ihr Lager aufzuschlagen und auf die anderen zu warten. Mit dem Überschwang der Jugend waren sie nicht zu bremsen gewesen – vor allem der Weiße Krieger hatte darauf bestanden, sie ziehen zu lassen.
Während die Spitze des Zuges bereits hinter einer kleinen Staubwolke verschwand, die die unablässig marschierenden Füße und trampelnden Hufe aufwirbelten, tauchte endlich auch der Zwillingsaltar selbst jenseits der Stadtmauern auf. Sofort eilte Guayaram zu ihm. Den Trägern nickte er nur kurz zu, ehe er sich versicherte, dass das kunstvolle Gebilde unversehrt geblieben war und seiner großen Bedeutung gemäß behandelt wurde. In Körben an den Tragflächen lagerten Opfergaben. Aus der Ferne konnte Nitetis nichts Genaues erkennen. Am Vortag allerdings hatte sie Obst gesehen, über dem Tausende von kleinen Mücken schwirrten, Brot und Fleisch, das zu lange der Sonne ausgesetzt gewesen war und in dem es bereits vor Maden wimmelte.
Der Zwillingsaltar blitzte grün im Morgenlicht.
Nitetis hielt in ihrer Erzählung inne, hob die Hände und legte die Fingerspitzen vor ihrem Gesicht zusammen. Beide Daumen schob sie unter das Kinn, die Zeigefinger berührten die Nase. »Ich habe ausschweifend erzählt, Atlantos, um dir zu zeigen, dass es etwas völlig Normales ist, derart in unser gewöhnliches Umfeld eingebunden, dass wir nicht in der Lage waren, es wahrzunehmen. Jeden Tag begegnet es uns, ständig sehen wir es.«
Ich war erstaunt, denn nicht einmal mein Logiksektor hatte diese Verbindung bislang gezogen. Auch in diesem Moment hielt er sich zurück; weder bestätigte noch widersprach er dem, was Nitetis aufgezeigt hatte. Sogar eine bissige gedankliche Anmerkung verkniff er sich, wahrscheinlich, weil die Logik in diesem Fall an ihre Grenzen gestoßen war.
»Es kann sich um einen Zufall handeln«, sagte ich vorsichtig.
Nitetis ließ die Hände sinken. Sie beugte sich im Sitzen vor, näher zu mir. Das Kleid verrutschte über ihren Brüsten, der Halsausschnitt gab wohl mehr von ihrer makellos braun-goldenen Haut frei, als ihr bewusst war. »Die Götter führen uns. Das ist von solch entscheidender Bedeutung für das Denken des Volkes, dass man die Wichtigkeit dieses Zwillingsaltars nicht überschätzen kann. Du selbst hast dafür gesorgt, dass Guayaram ihn errichtete, weil die Canarii das Tal sonst nicht verlassen hätten! Ein Altar, den alle an jedem Tag sehen, und der nicht zufällig grün gefärbt ist! Plötzlich wird jemand in unserer Mitte unter mysteriösen Umständen ermordet und verstümmelt aufgefunden. Aus seinem Mund läuft grüner Speichel – und das Blut, das aus seinen Beinstümpfen fließt, ist ebenfalls grün.« Sie erhob sich, strich den Stoff wieder glatt; eine kleine bronzene Brosche zierte den Brustausschnitt ihres Kleides. »Du kannst es beurteilen, wie du willst. Ich glaube nicht an einen Zufall.«
»Wenn es sich um ein Zeichen handelt«, sagte ich, »warum ist es bislang niemandem aufgefallen? Welcher Sinn kann einer Botschaft innewohnen, die keiner versteht?«
Ihre Hand fuhr an die Spitzen ihrer Haare und rieb darüber. »Eine gute Frage, über die ich ebenfalls schon lange nachgedacht habe. Ich kann darauf nur mit einer Vermutung antworten. Noch ist niemand in der Lage, diese Nachricht zu verstehen. Doch es wird sich ändern.«
»Noch«, wiederholte ich murmelnd. »Und es ändert sich, wenn was geschieht?«
Die Goldene blickte ernst. »Wenn die nächste Leiche gefunden wird.«
»Du erwartest weitere Tote?«, fragte ich.
Zweifelst du etwa daran, alter Narr?, ätzte der Logiksektor, der sich in den letzten Minuten erstaunlich ruhig verhalten hatte.
»Zweifelst du etwa daran?«, wiederholte Nitetis genau die Worte, als habe sie die gedankliche Botschaft gehört. Nur die spöttische Anrede ließ sie natürlich weg.
»Es ist zu erwarten«, sagte ich vorsichtig. »Aber etwas anderes. Der Altar ist grün, zumindest in weiten Teilen. Eine Tatsache, die nicht zu leugnen ist. Guayaram hat ihn allerdings erst vor wenigen Tagen errichtet. Bevor ich es vorschlug, wusste niemand, dass ein Altar gebaut werden wird. Der Mörder kann also deswegen nicht von langer Hand vorbereitet haben, das Blut seiner Opfer auf welchem Weg auch immer grün einzufärben.«
»War denn eine ausführliche Vorbereitungszeit notwendig?«, fragte Nitetis.
»Wer wäre überhaupt dazu fähig? Wie sollte es dem Täter gelungen sein?«
»Mit Giften und Pflanzenmitteln. Am Hof meines Ziehvaters hab ich die erstaunlichsten Dinge gesehen. Die Priester vermochten vieles, indem sie die richtigen Sude und Essenzen zu einem genau bestimmten Zeitpunkt einsetzten.« Sie lächelte. »Für die meisten Rômet war schon das ein Zauber, was mit Hexerei nicht das Geringste zu tun hatte.«
»Aber alles konntest du dir auch nicht erklären?«
»Dem kann ich nicht widersprechen. Denn die Wahrheit der Zauberei liegt auf der Hand: Es gibt Dinge, die wir nicht verstehen.«