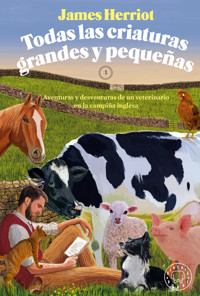7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Wunderbare Hundegeschichten – vom berühmtesten Tierarzt der Welt Ob Mrs. Pumphreys kleiner Liebling allzugern Sahnetorte und Kalbssülze frisst, der Doktor selber das Hundefutter verspeist oder in einer pechschwarzen Nacht ein frischoperierter und leider auch pechschwarzer Patient verschwindet – die Hundegeschichten des berühmten Tierarztes sind eine herrliche Lektüre für alle Tierfreunde. «Geschichten voller Herzlichkeit, voller Witz und Nachdenklichkeit – eine wunderschöne entspannende Lektüre.» (NDR)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 350
Ähnliche
James Herriot
Auf den Hund gekommen
Zehn tierische Geschichten
Über dieses Buch
Wunderbare Hundegeschichten – vom berühmtesten Tierarzt der Welt
Ob Mrs. Pumphreys kleiner Liebling allzugern Sahnetorte und Kalbssülze frisst, der Doktor selber das Hundefutter verspeist oder in einer pechschwarzen Nacht ein frischoperierter und leider auch pechschwarzer Patient verschwindet – die Hundegeschichten des berühmten Tierarztes sind eine herrliche Lektüre für alle Tierfreunde.
«Geschichten voller Herzlichkeit, voller Witz und Nachdenklichkeit – eine wunderschöne entspannende Lektüre.» NDR
Vita
Unter dem Pseudonym James Herriot verfasste der 1916 geborene britische Tierarzt James Wight unzählige warmherzige Tierarztgeschichten. Er wuchs in Schottland auf, studierte in Glasgow Tiermedizin und erhielt eine Assistentenstelle in den Nord Yorkshire Dales. Sein Sohn übernahm später die väterliche Praxis, während seine Tochter Ärztin wurde. James Herriot starb am 23. Februar 1995 in Thirsk/Nordengland.
Impressum
Aus der Originalausgabe «Dog Stories», erschienen 1986 bei Michael Joseph, London
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg,
Copyright © 1974, 1976, 1979, 1982, 1995 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«Dog Stories» Copyright © 1970, 1972, 1973, 1974, 1976, 1977, 1981 by James Herriot
Auswahl «Dog Stories» Copyright © 1986 by James Herriot (siehe Quellenverzeichnis)
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Covergestaltung any.way, Lesley Holmes, Susanne Müller, Wiebke Jakobs
Coverabbildung Mike Watson Images/Corbis
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-644-00975-2
www.rowohlt.de
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Meinem jüngsten Enkelkind, Katrina, in Liebe
Tricki Woo, der Pekinese
Als der Herbst in den Winter überging und auf den hohen Berggipfeln die ersten Schneestreifen erschienen, entdeckte ich, was für Beschwerlichkeiten eine Praxis in den Dales mit sich brachte. Man mußte stundenlang mit eiskalten Füßen und in schneidendem Wind fahren, um zu den hoch gelegenen Höfen zu gelangen. Dazu das ständige Sichauskleiden in zugigen Ställen, das Waschen in kaltem Wasser, mit Scheuerseife und oft einem Stück Sack als Handtuch. Ich merkte jetzt erst so richtig, was es heißt, aufgesprungene Hände zu haben. Wenn viel zu tun war, wurden meine Hände nie richtig trocken, und die kleinen roten Risse zogen sich fast bis zu den Ellenbogen hinauf.
In solchen Zeiten war es ein Segen, wenn man zu einem Kleintier gerufen wurde, für eine Weile der rauhen, harten Routinearbeit entrinnen und sich statt dessen in einem warmen Wohnzimmer auf halten konnte. Und von all den gemütlichen Wohnzimmernwar keines so verlockend wie der Salon von Mrs. Pumphrey.
Mrs. Pumphrey war eine ältliche Witwe. Ihr verstorbener Mann, ein Biermagnat, dessen Brauereien und Pubs über ganz Yorkshire verstreut waren, hatte ihr außer einem beachtlichen Vermögen auch ein wunderschönes Haus am Stadtrand von Darrowby hinterlassen. Hier lebte sie mit einer großen Anzahl von Bediensteten, einem Gärtner, einem Chauffeur und Tricki Woo. Tricki Woo war ein Pekinese und der Augapfel seiner Herrin.
Als ich jetzt vor dem prächtigen Portal stand, sah ich in Gedanken bereits den tiefen Sessel dicht neben den züngelnden Flammen des Kamins, die Schale mit den Cocktailplätzchen, die Flasche mit dem ausgezeichneten Sherry. Wegen des Sherrys richtete ich es immer so ein, daß ich eine halbe Stunde vor dem Lunch erschien.
Ein Mädchen öffnete mir die Tür, begrüßte mich mit strahlendem Lächeln und führte mich in den Salon, der vollgestopft war mit teuren Möbeln, herumliegenden Illustrierten und den neuesten Romanen. Mrs. Pumphrey, die in einem hochlehnigen Sessel am Kamin saß, legte ihr Buch mit einem Schrei des Entzückens aus der Hand. «Tricki! Tricki! Onkel Herriot ist da.» Ich war vor kurzem zum Onkel avanciert und hatte, da ich die Vorteile einer solchen Verwandtschaft erkannte, keine Einwände erhoben.
Tricki hüpfte wie stets von seinem Kissen, sprang auf die Sofalehne und legte seine Vorderpfoten auf meine Schulter. Dann leckte er mein Gesicht gründlich ab, bevor er sich erschöpft zurückzog. Er war immer schnell erschöpft, denn er bekam etwa zweimal soviel Futter, wie ein Hund seiner Größe benötigte. Außerdem war es das falsche Futter.
«Oh, Mr. Herriot», sagte Mrs. Pumphrey und blickte besorgt auf ihren Liebling, «ich bin so froh, daß Sie gekommen sind, bei Tricki bockt es wieder einmal.»
Mit diesem Ausdruck, der in keinem Lehrbuch zu finden ist, beschrieb sie die durch Trickis eingeklemmte Afterdrüsen hervorgerufenen Symptome. Wenn die Drüsen sich füllten, zeigte er sein Unbehagen, indem er sich plötzlich mitten im Laufen hinsetzte, und dann stürzte seine Herrin in großer Aufregung zum Telefon. «Mr. Herriot, bitte, kommen Sie, bei Tricki bockt es schon wieder!»
Ich hob den kleinen Hund auf einen Tisch und drückte einen Wattebausch auf den Anus, um die Drüsen zu entleeren.
Ich begriff nicht, weshalb der Pekinese sich immer so freute, wenn er mich sah. Ein Hund, der einen Mann gern hatte, obgleich dieser Mann ihm bei jeder Begegnung schmerzhaft das Gesäß quetschte, ein solcher Hund mußte ein unglaublich nachsichtiges und gutmütiges Wesen sein. Tricki zeigte niemals irgendwelche Ressentiments; er war ein wirklich liebes Tierchen, das vor Intelligenz sprühte, und ich empfand echte Zuneigung für ihn. Es war ein Vergnügen, sein Leibarzt zu sein.
Als die Prozedur vorbei war, hob ich meinen Patienten vom Tisch herunter. Dabei fiel mir auf, daß Tricki schwerer geworden war und dicke Fleischpolster auf den Rippen hatte. «Hören Sie, Mrs. Pumphrey, ich glaube, Sie überfüttern ihn wieder. Habe ich Ihnen nicht gesagt, daß Sie ihm keine Süßigkeiten geben dürfen und daß er mehr Proteine braucht?»
«Ja, ja, Mr. Herriot, aber was soll ich tun?» jammerte Mrs. Pumphrey. «Er mag nun mal kein Hühnerfleisch.»
Es war hoffnungslos. Ich ließ mich von dem Mädchen zu dem palastartigen Badezimmer führen, wo ich immer ein rituelles Händewaschen vollzog. Es war ein ungeheuer großer Raum mit einem voll bestückten Frisiertisch und Reihen von Glasborden, beladen mit Toilettenartikeln. Neben der teuren Toilettenseife war mein privates Gästehandtuch zurechtgelegt.
Dann kehrte ich in den Salon zurück, mein Sherryglas wurde gefüllt, und ich setzte mich an den Kamin, um Mrs. Pumphrey zu lauschen. Eine Unterhaltung konnte man es nicht nennen, denn sie allein besorgte das Reden, aber ich fand immer, daß es sich lohnte.
Mrs. Pumphrey war liebenswert, spendete großzügig für wohltätige Zwecke und half jedem, der in Not war. Sie besaß Intelligenz, Witz und sehr viel Charme. Aber wie die meisten Leute hatte sie einen schwachen Punkt, und bei ihr war es Tricki Woo. Die Geschichten, die sie über ihren Liebling erzählte, waren zumeist im Reich der Phantasie angesiedelt, und so wartete ich gespannt auf die nächste Fortsetzung.
«Stellen Sie sich vor, Mr. Herriot, Tricki hat jetzt einen Brieffreund! Ist das nicht aufregend? Ja, er hat an den Chefredakteur der Welt des Hundes geschrieben und eine Spende beigelegt. In dem Brief erzählte er, daß er von chinesischen Kaisern abstamme, aber trotzdem beschlossen habe, Verbindung zu gewöhnlichen Hunden aufzunehmen. Er bat, der Zeitungsmann möge unter den Hunden, die er kenne, einen Brieffreund für ihn aussuchen – zum gegenseitigen Gedankenaustausch, wissen Sie. Zu diesem Zweck, schrieb Tricki, werde er sich den Namen Mr. Utterbunkum zulegen. Und denken Sie nur, er bekam einen ganz reizenden Brief von dem Chefredakteur. Dieser Herr meinte, er werde ihn gern mit Bonzo Fotheringham bekannt machen, einem einsamen Dalmatiner, der bestimmt entzückt wäre, Briefe mit einem neuen Freund in Yorkshire zu wechseln.»
Ich trank ein Schlückchen Sherry. Tricki schnarchte auf meinem Schoß.
«Aber ich bin so enttäuscht über die neue Gartenlaube», fuhr Mrs. Pumphrey fort.
«Sie wissen, ich ließ sie speziell für Tricki aufstellen, damit wir an warmen Nachmittagen zusammen im Freien sitzen könnten. Es ist ein so hübsches rustikales Häuschen, aber er kann es einfach nicht ausstehen. Er hat einen Abscheu davor und weigert sich entschieden, hineinzugehen. Sie sollten seine angewiderte Miene sehen, wenn er es nur von weitem erblickt. Und wissen Sie, wie er es gestern genannt hat? Oh, ich wage es Ihnen kaum zu erzählen.» Sie schaute sich im Zimmer um, bevor sie hinter der vorgehaltenen Hand flüsterte: «Er nannte es Scheißbaracke! »
Das Mädchen fachte das Feuer von neuem an und füllte nochmals mein Glas. Der Wind schleuderte eine Handvoll Graupeln gegen das Fenster. Ich wartete auf weitere Neuigkeiten.
«Und habe ich Ihnen schon erzählt, Mr. Herriot, daß Tricki gestern wieder gewonnen hat? Wissen Sie, ich bin sicher, daß er die Rennberichte liest, denn er weiß immer, welches Pferd am besten in Form ist. Also gestern riet er mir, beim Drei-Uhr-Rennen in Redcar auf Canny Lad zu setzen, und wie üblich gewann dieses Pferd. Tricki setzte einen Shilling auf Sieg und Platz, und das brachte ihm neun Schilling ein.»
Diese Wetten wurden immer im Namen von Tricki Woo abgeschlossen, und ich dachte voller Mitgefühl an die örtlichen Buchmacher. Im Laufe des Jahres eine Shillingflut an einen Hund zu verlieren, das mußte für diese Männer höchst unerfreulich sein.
«Letzte Woche ist etwas Schreckliches passiert», sprach Mrs. Pumphrey weiter. «Ich dachte schon, ich würde Sie rufen müssen. Der arme kleine Tricki – er schnappte völlig über. Es war entsetzlich, ich war ganz außer mir. Der Gärtner warf Ringe für Tricki – Sie wissen ja, er macht das jeden Tag eine halbe Stunde lang.»
Ich hatte dieses Schauspiel mehrere Male miterlebt. Hodgkin, ein mißmutiger alter Mann, der aussah, als hasse er alle Hunde und speziell Tricki, mußte jeden Tag auf dem Rasen kleine Gummiringe werfen, die Tricki dann holte und zurückbrachte.
Mrs. Pumphrey fuhr fort: «Also Tricki machte sein Ringspiel, er liebt es doch so sehr. Aber plötzlich schnappte er über. Er vergaß seine Ringe, fing an, im Kreis zu rennen, und dabei bellte und kläffte er so merkwürdig. Und auf einmal fiel er um. Wie ein Toter lag er da. Wissen Sie, Mr. Herriot, ich dachte wirklich, er wäre tot, weil er sich überhaupt nicht rührte. Und was mich am meisten verletzte – Hodgkin lachte darüber. Er ist seit vierundzwanzig Jahren bei mir, und ich habe ihn niemals auch nur lächeln sehen, aber beim Anblick dieser reglosen kleinen Gestalt brach er in ein seltsames schrilles Kichern aus. Es war grauenhaft. Ich wollte gerade zum Telefon laufen, als Tricki aufstand und davonging – er wirkte völlig normal.»
Hysterie, dachte ich, verursacht durch falsche Ernährung und übermäßige Erregung Ich stellte mein Glas hin und blickte Mrs. Pumphrey streng an. «Sehen Sie, deswegen warne ich Sie ja dauernd, Tricki zu überfüttern. Wenn Sie ihn weiterhin mit all diesem ungesunden Zeug vollstopfen, ruinieren Sie seine Gesundheit. Was er braucht, das ist eine vernünftige Hundediät – ein- oder höchstens zweimal am Tag eine kleine Mahlzeit. Nur Fleisch und Schwarzbrot oder Zwieback. Und nichts zwischendurch.»
Mrs. Pumphrey sank förmlich in sich zusammen, ein Bild tiefsten Schuldbewußtseins. «Ach, bitte, sprechen Sie nicht so streng mit mir. Ich versuche ja, ihm die richtigen Dinge zu geben, es ist nur so schwierig. Wenn er um seine kleinen Leckerbissen bettelt, kann ich einfach nicht nein sagen.» Sie betupfte ihre Augen mit einem Taschentuch.
Aber ich war unnachgiebig. «Gut, Mrs. Pumphrey, es liegt bei Ihnen, aber glauben Sie mir, wenn Sie so weitermachen, wird Tricki immer häufiger solche Anfälle erleiden.»
Ich verließ den gemütlichen Hafen nur ungern. Auf dem Kiesweg blieb ich stehen, um mich nach Mrs. Pumphrey umzublicken, die mir nachwinkte. Tricki hockte wie immer hinter der Fensterscheibe, und sein Gesicht mit der breiten Schnauze war offensichtlich zu einem herzlichen Lachen verzogen.
Auf der Heimfahrt dachte ich darüber nach, wie vorteilhaft es doch war, Trickis Onkel zu sein. Wenn er ans Meer fuhr, schickte er mir Kisten mit frischgeräucherten Bücklingen, und wenn die Tomaten in seinem Gewächshaus reiften, bekam ich jede Woche ein oder zwei Pfund. Regelmäßig traf Tabak in Blechdosen ein, dem manchmal ein Foto mit einer liebevollen Widmung beilag. Für diese Gaben bedankte ich mich telefonisch, und Mrs. Pumphrey sagte stets ziemlich kühl, nicht sie, sondern Tricki habe mir das geschickt und ihm gebühre daher der Dank.
Als zu Weihnachten der große Präsentkorb eintraf, wurde mir plötzlich klar, daß ich mir einen schweren taktischen Fehler hatte zuschulden kommen lassen. Ich setzte mich sofort hin, um Tricki einen Brief zu schreiben. Ohne Siegfrieds sardonisches Lächeln zu beachten, dankte ich meinem Hundeneffen für die Weihnachtsgeschenke und für all seine Großzügigkeit in der Vergangenheit. Ich äußerte die Hoffnung, daß die Feiertagskost seinem empfindlichen Magen gut bekommen sei, und empfahl ihm für den Fall von Beschwerden, das schwarze Pulver einzunehmen, das ihm sein Onkel immer verschreibe. Ein vages Gefühl beruflicher Scham ertrank in Visionen von Lachs, Bücklingen, Tomaten und Geschenkkörben. Ich adressierte das Dankschreiben an Master Tricki Pumphrey, Barlby Grange, und warf es fast ohne Gewissensbisse in den Briefkasten.
Bei meinem nächsten Besuch nahm mich Mrs. Pumphrey beiseite. «Mr. Herriot», flüsterte sie, «Tricki war ganz entzückt von Ihrem bezaubernden Brief, und er wird ihn immer aufbewahren. Nur etwas hat ihn sehr verstimmt – Sie adressierten den Brief an Master Tricki, und das ist doch eine Anrede für kleine Jungen. Er besteht auf Mister. Zuerst war er furchtbar beleidigt, aber als er sah, daß der Brief von Ihnen war, kehrte seine gute Laune zurück. Ich weiß gar nicht, woher er diese kleinen Eigenheiten hat. Vielleicht liegt es daran, daß er ein Einzelhund ist – ich glaube, ein Einzelhund entwickelt mehr Eigenheiten als einer, der viele Geschwister hat.»
Als ich Skeldale House betrat, hatte ich das Gefühl, in eine kältere Welt zurückzukehren. Auf dem Gang lief mir Siegfried in die Arme. «Ach, wen haben wir denn da? Ist das nicht der liebe Onkel Herriot? Und was haben Sie heute gemacht, Onkelchen? Sich in Barlby Grange abgemüht, vermute ich. Armer Junge, Sie müssen ja völlig fertig sein. Glauben Sie wirklich, daß es sich lohnt, bis zum Umfallen für einen neuen Geschenkkorb zu schuften?»
Tristans Nachtwache
Ich ließ die chirurgische Nadel auf das Tablett fallen und trat zurück, um die fertige Arbeit zu begutachten. «Also ohne mich loben zu wollen, es sieht recht hübsch aus.»
Tristan stand über den bewußtlosen Hund gebeugt und untersuchte den sauberen Schnitt mit der Reihe regelmäßiger Stiche. «Tatsächlich sehr hübsch, mein Junge. Ich selbst hätte es nicht besser machen können.»
Der große schwarze Neufundländer lag regungslos auf dem Tisch, die Zunge herausgestreckt, die Augen blicklos und glasig. Man hatte ihn mit einer häßlichen Geschwulst über den Rippen zu uns gebracht, und ich hatte entschieden, daß es ein harmloses Lipom sei, gutartig und sehr geeignet für einen operativen Eingriff. Und diese Diagnose hatte sich bestätigt. Ich hatte die Geschwulst mühelos herausschälen können, sie war rund, intakt und glatt. Keine Blutung, und es war auch nicht zu befürchten, daß sich ein neues Lipom bildete.
Die häßliche Schwellung war durch diese saubere Naht ersetzt worden, die in einigen Wochen nicht mehr zu sehen sein würde. Ich war froh und zufrieden.
«Am besten behalten wir ihn hier, bis er zu sich kommt», sagte ich. «Fassen Sie mal mit an, Tristan, wir wollen ihn auf die Dekken legen.» Wir betteten den Hund vor einem elektrischen Ofen, und dann brach ich zu meiner morgendlichen Runde auf.
Beim Lunch hörten wir den seltsamen Laut zum erstenmal. Es war ein Mittelding zwischen Stöhnen und Heulen, fing ganz leise an, steigerte sich zu gellender Höhe und glitt dann die Tonleiter wieder hinab.
Siegfried sah erschrocken von seiner Suppe auf. «Um Gottes willen, was ist das?»
«Muß der Hund sein, den ich heute morgen operiert habe», antwortete ich. «Die Wirkung der Barbiturate läßt nach, und er kommt langsam zu sich. Ich denke, das Geheul wird bald auf hören.»
Siegfried sah mich zweifelnd an. «Na, hoffentlich. Mir langt’s. Klingt ja schauerlich.»
Wir gingen hinüber und sahen nach dem Hund. Der Puls war kräftig, die Atmung tief und regelmäßig, die Schleimhäute hatten eine gute Farbe. Das Tier lag noch immer regungslos ausgestreckt, und das einzige Anzeichen des zurückkehrenden Bewußtseins war das Heulen, das sich alle zehn Sekunden wiederholte.
«Ja, er ist völlig in Ordnung», sagte Siegfried. «Aber was für ein gräßliches Geräusch! Kommt bloß hier raus.»
Die Mahlzeit wurde hastig und schweigend beendet, man hörte nur das Jammern im Hintergrund. Siegfried hatte kaum den letzten Bissen hinuntergeschlungen, da war er schon auf den Beinen. «Ich muß abschwirren. Habe ’ne Menge zu tun heute nachmittag. Tristan, das beste ist wohl, wenn du den Hund ins Wohnzimmer bringst und vor den Kamin legst. Auf diese Weise kannst du ihn im Auge behalten.»
Tristan starrte seinen Bruder entgeistert an. «Du meinst, ich soll mir den ganzen Nachmittag dieses Geheul anhören?»
«Ja, genau das meine ich. Wir können ihn in diesem Zustand nicht nach Hause schikken, und ich möchte nicht, daß ihm etwas passiert. Er braucht Pflege und Beaufsichtigung.»
«Soll ich vielleicht seine Pfote halten oder ihn im Kinderwagen um den Marktplatz herumschieben?»
«Verschone mich mit deinen Unverschämtheiten. Du bleibst bei dem Hund, und damit basta !»
Tristan und ich zogen das schwere Tier auf den Decken den Korridor entlang; dann mußte ich zu meiner nachmittäglichen Runde aufbrechen. An der Tür blieb ich stehen und blickte zurück auf das große schwarze Tier neben dem Feuer und auf Tristan, der unglücklich in einem Sessel hockte. Das Geheul war fürchterlich. Ich schloß hastig die Tür.
Es war dunkel, als ich zurückkam, und das alte Haus ragte schwarz und schweigend in den kalten Himmel. Schweigend – das heißt mit Ausnahme des Geheuls, das gespenstisch in der menschenleeren Straße widerhallte.
Ich sah auf meine Uhr. Es war sechs, also hatte Tristan diese Tortur vier Stunden über sich ergehen lassen. Ich eilte die Stufen hinauf und durch den Korridor. Als ich die Wohnzimmertür öffnete, stand Tristan mit dem Rücken zu mir an dem französischen Fenster und blickte in den dunklen Garten hinaus. Er hatte die Hände tief in die Taschen gesteckt, und aus seinen Ohren hingen Wattebüschel.
«Na, wie sieht’s aus?» fragte ich.
Da keine Antwort kam, ging ich zu ihm und berührte ihn an der Schulter. Die Wirkung war ungeheuerlich. Er sprang in die Luft und fuhr herum. Sein Gesicht war aschfahl, und er zitterte heftig. «Mein Gott, Jim, Sie hätten mich beinahe getötet. Ich kann durch diese Ohrpfropfen nichts hören – bis auf den Hund natürlich.»
Ich kniete mich hin und untersuchte den Neufundländer. Sein Zustand war ausgezeichnet, aber außer einem schwachen Augenreflex deutete nichts auf eine Wiederkehr des Bewußtseins hin. Das durchdringende Heulen ertönte nach wie vor in regelmäßigen Abständen.
«Er braucht aber entsetzlich lange, um zu sich zu kommen», sagte ich. «War er den ganzen Nachmittag so?»
«Ja, genau so. Verschwenden Sie bloß kein Mitleid an diesen jaulenden Teufel – er weiß ja nichts davon. Aber sehen Sie mich an! Ich bin nach all den Stunden völlig mit den Nerven herunter. Noch ein bißchen länger, und Sie müssen auch mir eine Spritze geben.» Er fuhr sich mit zitternder Hand durch das Haar, und in seiner rechten Wange zuckte unaufhörlich ein Muskel.
Ich nahm ihn am Arm. «Essen Sie erst mal was, dann werden Sie sich gleich besser fühlen.» Er folgte mir widerstandslos ins Eßzimmer.
Während der Mahlzeit war Siegfried in ausgezeichneter Stimmung. Er lachte, scherzte und führte das große Wort, ohne das schrille Geheul im Nebenzimmer zu beachten. Um so heftiger zerrte es zweifellos an Tristans Nerven.
Als wir das Zimmer verließen, legte mir Siegfried die Hand auf die Schulter. «Vergessen Sie nicht die Versammlung heute abend in Brawton, James. Der alte Reeves spricht über Schafskrankheiten – er macht so was immer sehr gut. Schade, daß du nicht mitkommen kannst, Tristan, aber ich fürchte, du mußt bei dem Hund bleiben, bis er zu sich kommt.»
Tristan zuckte zusammen, als hätte ihn jemand geschlagen. «O nein, bitte nicht! Das verdammte Biest treibt mich zum Wahnsinn!»
«Leider geht es nicht anders. James oder ich hätten dich heute abend ablösen können, aber wir müssen nun mal zu dieser Versammlung. Es würde einen schlechten Eindruck machen, wenn wir nicht kämen.»
Tristan wankte ins Wohnzimmer zurück, und ich zog meinen Mantel an. Auf der Straße blieb ich einen Augenblick stehen und lauschte. Der Hund heulte immer noch.
Die Versammlung war ein Erfolg. Sie fand in einem Luxushotel statt, und wie meistens war das anschließende gesellige Beisammensein der Tierärzte das Beste vom Abend. Es war ungemein beruhigend, von den Problemen und Fehlern der Kollegen zu hören – besonders von den Fehlern.
Gegen elf Uhr brachen wir auf. Ich dachte schuldbewußt daran, daß ich Tristan und seine Nachtwache in den letzten paar Stunden völlig vergessen hatte. Aber gewiß hatte er an diesem Abend keine Schwierigkeiten gehabt. Der Hund war sicherlich ruhiger geworden. Doch als ich in Darrowby aus dem Auto sprang, erstarrte ich, denn aus dem Haus drang ein schwaches Jaulen. Unglaublich, der Hund heulte noch immer. Und was war mit Tristan? Ich wagte mir nicht vorzustellen, in welcher Verfassung er war. Beinahe ängstlich öffnete ich die Wohnzimmertür.
Tristans Sessel bildete eine kleine Insel in einem Meer von leeren Bierflaschen. Eine hochkant gestellte Kiste lehnte an der Wand, und Tristan saß mit feierlicher Miene sehr aufrecht da. Ich stieg über die Flaschen hinweg.
«Nun, war es sehr schlimm, Triss? Wie fühlen Sie sich?»
«Könnte schlimmer sein, mein Lieber, viel schlimmer. Bald nachdem ihr abgefahren wart, bin ich zu den Drowers gegangen und habe ’nen Kasten Bier geholt. Das half mir über das Schlimmste hinweg. Nach drei oder vier Stunden ließ mich der Hund völlig kalt – ich habe sogar mitgejault. Wir hatten einen recht interessanten Abend. Übrigens kommt er jetzt zu sich. Schauen Sie mal.»
Der Hund hatte den Kopf gehoben, und in seinen Augen lag ein Ausdruck des Wiedererkennens. Das Geheul war verstummt. Ich ging zu ihm und streichelte ihn, und das Tier wedelte mit dem buschigen schwarzen Schwanz.
«So ist’s schon besser, alter Junge», sagte ich. «Und jetzt solltest du dich ein bißchen zusammennehmen. Du hast dem armen Onkel Tristan ganz schön zugesetzt.»
Der Hund reagierte sofort. Er richtete sich mühsam auf und machte ein paar schwankende Schritte. Dann brach er zwischen den Flaschen zusammen.
Siegfried erschien in der Türöffnung und blickte angewidert auf Tristan, der noch immer sehr gerade dasaß. Dann betrachtete er den Hund zwischen den Flaschen. «Was ist denn das für ein Tohuwabohu? Kannst du nicht auf den Hund aufpassen, ohne eine Orgie zu veranstalten?»
Beim Klang von Siegfrieds Stimme richtete sich der Neufundländer auf und versuchte in einem Anflug von Selbstvertrauen mit wedelndem Schwanz zu ihm zu laufen. Aber er kam nicht weit. Nach wenigen Schritten sackte er wieder zusammen und stieß dabei eine leere Flasche um, die langsam bis vor Siegfrieds Füße rollte.
Siegfried bückte sich und streichelte den glänzenden schwarzen Kopf. «So ein liebes, freundliches Tier. Bestimmt ist er ein großartiger Hund, wenn er seine fünf Sinne beisammen hat. Morgen früh wird er wieder ganz normal sein, die Frage ist nur, was wir heute nacht mit ihm machen. Wir können ihn nicht hier unten herumtorkeln lassen, sonst bricht er sich womöglich ein Bein.» Er blickte Tristan an, der jetzt noch steifer, noch aufrechter dasaß. «Weißt du, am besten nimmst du ihn mit in dein Zimmer. Jetzt, wo er glücklich über den Berg ist, wollen wir doch nicht, daß er sich verletzt. Ja, er soll die Nacht bei dir verbringen.»
«Vielen Dank, vielen herzlichen Dank», sagte Tristan tonlos, die Augen starr geradeaus gerichtet.
Siegfried warf ihm einen scharfen Blick zu und wandte sich zum Gehen. «Also gut, räume den Kram hier weg, und dann ab ins Bett.»
Tristan und ich schliefen Tür an Tür. Mein Zimmer war der Hauptraum, riesengroß, quadratisch, mit hoher Decke und einem von Pfeilern flankierten Kamin. Tristans Zimmer, der ehemalige Ankleideraum, war lang und nicht sehr breit, so daß man das schmale Bett an die hintere Querwand hatte quetschen müssen. Auf den glatten, gebohnerten Dielen lag kein Teppich. Ich legte den Hund auf einen Stapel Decken und wandte mich Tristan zu, der sich erschöpft auf sein Bett geworfen hatte.
«Er ist ganz ruhig – schläft wie ein Baby», sagte ich tröstend. «Ich denke, Sie werden jetzt Ihre wohlverdiente Ruhe haben.»
In meinem Zimmer zog ich mich rasch aus und stieg ins Bett. Ich schlief sofort ein. Wann der Lärm wieder anfing, kann ich nicht sagen, ich weiß nur, daß ich plötzlich hochfuhr, weil ein wütender Schrei in meinen Ohren gellte. Dann hörte ich ein Rutschen, einen dumpfen Schlag und noch einen Schrei aus Tristans Kehle.
Ich schrak vor dem Gedanken zurück, nach nebenan zu gehen – tun konnte ich sowieso nichts –, also kuschelte ich mich in die Decken und lauschte. Nach einer Weile döste ich ein, wurde aber jäh aus dem Schlaf gerissen, als weitere Schlaggeräusche und Schreie durch die Wand drangen.
Nach etwa zwei Stunden änderten sich die Laute. Der Neufundländer schien seine Beine wieder gebrauchen zu können, denn er wanderte im Zimmer auf und ab, wobei seine Pfoten ein regelmäßiges Tack– a– Tack auf dem Holzfußboden machten. Das ging unentwegt so weiter, und von Zeit zu Zeit brüllte Tristan, der schon stockheiser war: «Hör auf, zum Donnerwetter! Setz dich, verdammter Köter!»
Ich mußte wohl trotzdem fest eingeschlafen sein, denn als ich aufwachte, füllte graues Morgenlicht das Zimmer. Ich wälzte mich auf den Rücken und lauschte. Das Tack-a-Tack der Pfoten war noch immer zu hören, aber ganz unregelmäßig, als liefe der Neufundländer bald hierhin, bald dorthin, statt blindlings von einem Ende des Zimmers zum anderen zu stolpern.
Ich stand auf. Zitternd in der eiskalten Luft zog ich mein Hemd und die Hose an. Dann schlich ich zu der Verbindungstür und öffnete sie. Ich wurde fast umgeworfen, als sich zwei große Pfoten gegen meine Brust drückten. Der Neufundländer war hocherfreut, mich zu sehen, und schien sich hier schon ganz heimisch zu fühlen. Er wedelte ekstatisch mit dem Schwanz.
«Na, bist du wieder in Ordnung, Freundchen?» sagte ich. «Komm, zeig mal deine Wunde.» Ich untersuchte die Naht über den Rippen. Keine Schwellung und nicht einmal schmerzempfindlich.
«Wunderbar!» rief ich. «Du bist ja so gut wie neu.» Ich gab ihm einen scherzhaften Klaps, der einen Begeisterungsausbruch hervorrief. Das Tier sprang an mir hoch, umarmte und leckte mich.
Ich versuchte ihn abzuwehren, als ich ein jämmerliches Stöhnen aus dem Bett hörte. In dem trüben Licht sah Tristan gespenstisch aus. Er lag auf dem Rücken, hatte beide Hände in die Bettdecke gekrallt, und seine Augen leuchteten wild. «Nicht eine Minute Schlaf, Jim», flüsterte er. «Nicht eine einzige Minute. Hat einen herrlichen Humor, mein Bruder, läßt mich die ganze Nacht bei diesem schwarzen Satan. Beobachten Sie ihn nachher – ich gehe jede Wette ein, daß er zufrieden aussehen wird.»
Beim Frühstück ließ sich Siegfried die Einzelheiten von Tristans qualvoller Nacht erzählen und war sehr mitfühlend. Wortreich entschuldigte er sich für all die Aufregung, die der Hund dem Bruder bereitet hatte. Aber wie Tristan es vorausgesagt hatte: Er sah zufrieden aus.
Ein Triumph der ärztlichen Kunst
Diesmal machte ich mir ernstliche Sorgen um Tricki. Ich hatte mein Auto angehalten, als ich ihn auf der Straße mit seiner Herrin sah, und sein Aussehen erschreckte mich. Er war ungeheuer fett geworden und sah aus wie ein Luftballon mit vier Beinen. Seine blutunterlaufenen, wässerigen Augen hatten einen starren Blick; die Zunge hing heraus.
«Er war so teilnahmslos, Mr. Herriot», erklärte Mrs. Pumphrey hastig. «Er schien überhaupt keine Energie mehr zu haben. Ich dachte, er litte an Unterernährung, und daher habe ich ihm zwischen den Mahlzeiten immer ein paar Extrahäppchen zur Stärkung gegeben. Kalbssülze zum Beispiel, abends ein Schüsselchen Ovomaltine zum Einschlafen und natürlich Lebertran. Wirklich nicht viel.»
«Und haben Sie ihn mit Süßigkeiten kurzgehalten, wie ich es Ihnen riet?»
«Zuerst schon, aber dann kam er mir so entkräftet vor, und da mußte ich nachgeben. Er mag so gern Sahnetorte und Schokolade. Ich bringe es einfach nicht übers Herz, ihn darben zu lassen.»
Da lag der Hase im Pfeffer: Trickis einziger Fehler war seine Gier. Es kam ihm einfach nicht in den Sinn, Futter abzulehnen; er fraß zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ich fragte mich, was Mrs. Pumphrey ihm wohl noch alles gegeben hatte, ohne es zu erwähnen. Gänseleberpastete auf Toast, feine Butterpralinen – so etwas liebte Tricki.
«Hat er genügend Bewegung?»
«Nun, Sie sehen ja, er macht seine kleinen Spaziergänge mit mir, aber Hodgkin liegt mit Hexenschuß im Bett, und daher gab es in letzter Zeit kein Ringspiel.»
Ich bemühte mich, mit äußerster Strenge zu sprechen. «Hören Sie, Mrs. Pumphrey, wenn Sie sein Futter nicht drastisch reduzieren und er nicht mehr Bewegung hat, kann es ihn das Leben kosten. Sie müssen hart sein und ihn auf eine sehr strenge Diät setzen.»
Mrs. Pumphrey rang die Hände. «Ja, Mr. Herriot, ich weiß, daß Sie recht haben, aber es ist so schwer, so furchtbar schwer.» Sie ging mit gesenktem Kopf weiter.
Ich sah den beiden besorgt nach. Tricki wackelte in seinem Tweedmäntelchen neben Mrs. Pumphrey her. Er besaß eine ganze Kollektion solcher Mäntel – aus warmem Tweed- oder Schottenstoff für kalte Tage, aus imprägniertem Gabardine für Regenwetter. Matt und kraftlos zottelte er die Straße entlang. Ich vermutete, daß ich bald von Mrs. Pumphrey hören würde.
Der erwartete Anruf kam nach ein paar Tagen. Mrs. Pumphrey war verzweifelt. Tricki wollte nicht fressen, wies sogar seine Lieblingsgerichte zurück und hatte sich mehrmals übergeben. Er lag apathisch auf seinem Lager und atmete keuchend. Zum Spazierengehen hatte er keine Lust und auch zu nichts anderem.
Mein Plan stand bereits fest: Tricki mußte für einige Zeit von Mrs. Pumphrey getrennt werden. Ich schlug ihr vor, ihn für etwa vierzehn Tage zwecks Beobachtung zu uns zu geben.
Die arme Frau wurde beinahe ohnmächtig. Sie war noch nie ohne ihren Liebling gewesen und behauptete, er werde vor Sehnsucht vergehen, wenn er sie nicht jeden Tag sehe.
Aber ich blieb fest. Tricki war sehr krank, und dies war die einzige Möglichkeit, ihn zu retten. Ich hielt es für das beste, ihn gleich mitzunehmen, und so wickelte ich trotz Mrs. Pumphreys Gejammer den kleinen Hund in eine Decke und trug ihn hinaus zum Wagen.
Das ganze Haus war in Aufruhr. Dienstmädchen liefen hin und her, brachten sein Bett für den Tag, sein Bett für die Nacht, seine Lieblingskissen, Spielzeug und Gummiringe, Näpfe fürs Frühstück, für den Lunch, für das Abendessen. Da mir klar war, daß mein Wagen all diesen Kram unmöglich fassen konnte, fuhr ich kurzerhand los. Im letzten Augenblick warf Mrs. Pumphrey mit einem verzweifelten Schrei einen Armvoll kleiner Mäntel durch das Fenster. Bevor ich am Tor um die Ecke bog, blickte ich in den Spiegel: Alle waren in Tränen aufgelöst.
Ich sah auf das Mitleid erregende Tierchen hinab, das keuchend auf dem Beifahrersitz lag, und streichelte ihm den Kopf. Tricki machte einen tapferen Versuch, mit dem Schwanz zu wedeln. «Armer, alter Kerl», sagte ich, «du hast überhaupt keinen Mumm mehr, ich glaube, ich weiß eine Kur für dich.»
In der Praxis sprangen unsere Hunde wie wild um mich herum. Tricki blickte mit trüben Augen auf die lärmende Meute, und als ich ihn niedersetzte, blieb er regungslos auf dem Teppich liegen. Die anderen Hunde beschnüffelten ihn, stellten fest, daß er gänzlich uninteressant sei, und kümmerten sich nicht weiter um ihn.
Ich brachte Tricki in einer warmen Box unter, dicht neben dem Verschlag, in dem die anderen Hunde schliefen. Zwei Tage lang gab ich ihm kein Futter, aber sehr viel Wasser. Am Ende des zweiten Tages begann er Interesse für seine Umgebung zu zeigen, und am dritten Tag winselte er, als er die Hunde auf dem Hof hörte.
Ich öffnete die Tür, Tricki trottete heraus und wurde sogleich von Joe, dem Windhund, und seinen Freunden mit Beschlag belegt. Nachdem sie ihn spielerisch gestupst und gründlich inspiziert hatten, liefen sie in den Garten. Tricki folgte ihnen, leicht schwankend wegen seines Übergewichts, aber offensichtlich neugierig.
Später am Tag war ich zur Futterzeit anwesend. Ich sah zu, wie Tristan die Schüsseln füllte. Es gab das übliche stürmische Gedränge, das hastige Schlabbern und Schmatzen. Jeder Hund wußte, daß er sich beeilen mußte, wenn er beim letzten Teil der Mahlzeit keinen <Mitesser› haben wollte.
Als sie fertig waren, spazierte Tricki an den blanken Schüsseln vorbei und leckte in zweien von ihnen herum. Am nächsten Tag wurde ein Extranapf für ihn hingesetzt, und ich sah mit Freude, wie er sich daraufstürzte.
Von nun an machte er rapide Fortschritte. Er wurde überhaupt nicht medizinisch behandelt, sondern war den ganzen Tag mit den anderen Hunden zusammen und nahm an ihren freundschaftlichen Raufereien teil. Er fand das herrlich, wenn er hin und her gestoßen, geknufft und gepufft wurde. So entwickelte er sich sehr bald zu einem akzeptierten Mitglied der Meute, zu einem entzückenden, seidigen kleinen Geschöpf, das bei den Mahlzeiten wie ein Tiger um seinen Anteil kämpfte und nachts im alten Hühnerstall auf Rattenjagd ging. Er hatte noch nie soviel Spaß gehabt.
Währenddessen stand Mrs. Pumphrey schreckliche Ängste aus und rief täglich mindestens zehnmal an, um das neueste Bulletin zu erfahren. Ich wich ihren Fragen aus, ob seine Kissen auch regelmäßig gewendet würden und er je nach dem Wetter den richtigen Mantel trüge. Aber ich konnte ihr berichten, daß ihr kleiner Liebling ganz außer Gefahr sei und sich zusehends erhole.
Das Wort ‹erholen› löste bei Mrs. Pumphrey eine Lawine nahrhafter Liebesbezeigungen aus. Sie brachte regelmäßig frische Eier herüber, jedesmal zwei Dutzend, um Tricki zu kräftigen. Eine Zeitlang gab es für jeden von uns zwei Eier zum Frühstück, aber erst als die Flaschen mit Sherry eintrafen, dämmerte es uns, was für ungeahnte Möglichkeiten sich hier boten.
Der Sherry war von demselben köstlichen Jahrgang, den ich so gut kannte, und er sollte Trickis Blut anreichern. Der Lunch wurde jetzt eine feierliche Angelegenheit mit zwei Glas Sherry vor und weiteren während der Mahlzeit. Siegfried und Tristan wetteiferten in Trinksprüchen auf Trickis Gesundheit, und das Niveau ihrer Reden steigerte sich mit jedem Tag. Mir als Trickis Onkel oblag es, die Toasts zu erwidern.
Wir trauten unseren Augen nicht, als der Brandy kam. Zwei Flaschen Cordon Bleu, die Trickis Konstitution den letzten Schliff geben sollten. Siegfried brachte von irgendwoher bauchige Gläser zum Vorschein, die seiner Mutter gehörten. Mehrere Abende lang schwenkten wir in ihnen den köstlichen Alkohol und atmeten den Duft ein, bevor wir den Brandy ehrfurchtsvoll schlürften.
Die Versuchung, Tricki als Dauergast zu behalten, war groß, aber ich wußte, wie sehr Mrs. Pumphrey litt, und so fühlte ich mich nach zwei Wochen verpflichtet, ihr telefonisch mitzuteilen, Tricki sei wieder wohlauf und könne jederzeit abgeholt werden.
Wenige Minuten später fuhren dreißig Fuß glänzendes schwarzes Metall vor. Der Chauffeur riß den Wagenschlag auf, und ich konnte undeutlich die Gestalt von Mrs. Pumphrey erkennen, die sich im Innern des großen Wagens fast verlor. Sie hatte die Hände ineinandergekrampft, und ihre Lippen bebten. «Mr. Herriot, bitte, sagen Sie mir die Wahrheit. Geht es ihm wirklich besser?»
«Ja, es geht ihm ausgezeichnet. Bleiben Sie ruhig sitzen – ich hole ihn.»
Ich ging durch das Haus in den Garten. Die Hunde tollten auf dem Rasen umher, und der goldfarbene winzige Tricki jagte mit flatternden Ohren und wedelndem Schwanz bald hierhin, bald dorthin. Binnen zwei Wochen hatte er sich in ein gelenkiges Tier mit festen Muskeln verwandelt. Er hielt prächtig mit der Meute Schritt und streckte sich bei den großen Sprüngen so sehr, daß seine Brust fast den Boden streifte.
Ich trug ihn durch den langen Korridor nach vorn. Der Chauffeur hielt noch immer die Wagentür offen. Als Tricki seine Herrin sah, sprang er mit einem gewaltigen Satz von meinem Arm und sauste auf Mrs. Pumphreys Schoß. «Ooooh!» rief sie erschrocken, und dann mußte sie sich wehren, weil Tricki sie mit Zärtlichkeiten förmlich überschwemmte.
Während dieser Wiedersehensszene half ich dem Chauffeur, die Betten, Kissen, Mäntelchen, Freßnäpfe und Spielsachen herauszutragen – nichts davon war benutzt worden. Als der Wagen anfuhr, beugte sich Mrs. Pumphrey aus dem Fenster. Sie hatte Tränen in den Augen, und ihre Lippen zitterten.
«Lieber Mr. Herriot», rief sie, «wie kann ich Ihnen nur danken? Dies ist ein Triumph der ärztlichen Kunst!»
Lächeln unter Tränen
Ich sah noch einmal auf das Stück Papier, auf dem ich meine Besuche notiert hatte. «Dean, Thompson’s Yard Nr. 3. Kranker alter Hund.»
Darrowby hatte viele solcher Yards. Es handelte sich dabei um Gäßchen, die in einem Roman von Dickens hätten vorkommen können. Einige gingen vom Marktplatz ab, und viele lagen verstreut hinter den Hauptverkehrsstraßen in dem alten Teil der Stadt. Von außen sah man lediglich einen Bogengang, und ich war immer von neuem überrascht, wenn ich am Ende eines solchen schmalen Ganges plötzlich auf die ungleichmäßigen Reihen kleiner Häuser stieß, von denen nicht eines dem anderen glich und die sich über acht Fuß Kopfsteinpflaster hinweg in die Fenster blickten. Vor manchen Häusern gab es einen Streifen Garten, und Ringelblumen und Kapuzinerkresse wucherten über die holperigen Steine hinaus; aber am Ende der schmalen Gassen waren die Häuser in einem elenden Zustand. Einige standen leer, und ihre Fenster waren mit Brettern vernagelt.
Das Haus Nr. 3 lag an diesem Ende und sah aus, als werde es demnächst einstürzen. Von dem verfaulten Holz der Tür blätterten Farbschnitzel ab, als ich klopfte: Oben wölbte sich das Gemäuer beiderseits eines Risses gefährlich nach außen.
Ein kleiner, weißhaariger Mann öffnete. Aus einem hohlwangigen, von Falten durchfurchten Gesicht blickte ein Paar fröhliche Augen; er trug eine gestopfte Wolljacke, eine geflickte Hose und Hausschuhe.
«Ich wollte mal nach Ihrem Hund sehen», sagte ich, und der alte Mann lächelte.
«Ich bin froh, daß Sie kommen», sagte er. «Der alte Bursche macht mir Sorgen.» Er führte mich in ein winziges Wohnzimmer. «Ich lebe allein. Meine Frau ist vor einem Jahr gestorben. Sie hat sehr an dem Hund gehangen.»
Überall offenbarten sich die erbarmungslosen Zeichen der Armut: in dem abgetretenen Linoleum, dem feuerlosen Kamin, dem feuchtkalten, muffigen Geruch. Die Tapete hing in Fetzen von der Wand, und auf dem Tisch sah ich die bescheidene Abendmahlzeit des alten Mannes: ein Stückchen Speck, ein paar Bratkartoffeln und eine Tasse Tee.
Auf einer Decke lag mein Patient, ein nicht rassereiner Neufundländer. Er mußte seinerzeit ein großer, kräftiger Hund gewesen sein, aber die Spuren des Alters zeigten sich in den weißen Haaren rund um die Schnauze und in den fahlen, trüben Augen. Er sah mich ohne Feindseligkeit an.
«Er ist nicht mehr der Jüngste, stimmt’s, Mr. Dean?»
«Allerdings. Fast vierzehn, aber bis vor ein paar Wochen ist er noch wie ein junger Hund herumgaloppiert. Ein prächtiges Tier für sein Alter, mein guter Bob, und er hat nie in seinem Leben jemand gebissen. Die Kinder können alles mit ihm machen. Er ist jetzt mein einziger Freund – ich hoffe, Sie machen ihn bald wieder gesund.»
«Frißt er, Mr. Dean?»
«Nein, gar nichts, und das ist seltsam, denn er konnte ganz schön was verdrücken. Er saß bei den Mahlzeiten immer neben mir und legte den Kopf auf meine Knie, aber in letzter Zeit hat er das nicht mehr getan.»
Ich betrachtete den Hund mit wachsendem Unbehagen. Der Bauch war geschwollen, ich konnte die verräterischen Schmerzsymptome erkennen: das stoßweise Atmen, die verkniffene Linie der Lefzen, den ängstlichen Ausdruck in den Augen.
Als sein Herr sprach, schlug der Hund zweimal mit dem Schwanz auf die Wolldecke, und in den weißlichen Augen glomm ein flüchtiges Interesse auf, das aber sogleich wieder dem leeren, nach innen gewandten Blick wich.
Ich befühlte vorsichtig den Bauch des Hundes. Eine ausgeprägte Bauchwassersucht, und die gestaute Flüssigkeit erzeugte nun einen starken Druck. «Komm, alter Bursche», sagte ich. «Laß dich mal auf die Seite rollen.» Der Hund leistete keinen Widerstand, als ich ihn langsam auf die andere Seite drehte, dann aber winselte er und sah sich um. Ich betastete ihn ganz sanft. Durch den dünnen Muskel an der Flanke konnte ich eine harte, gewellte Masse fühlen, zweifellos ein Milz- oder Leberkarzinom, riesengroß und völlig inoperabel. Ich streichelte den Kopf des alten Hundes, während ich mich zu konzentrieren suchte. Dies war kein leichter Fall.
«Wird er lange krank sein?» fragte der alte Mann, und wieder klopfte der Schwanz beim Klang der geliebten Stimme. «Es ist so traurig, wenn Bob mir nicht nachläuft, während ich hier herumwirtschafte.»
«Tut mir leid, Mr. Dean, aber die Sache ist sehr ernst. Sehen Sie hier die große Schwellung? Sie wird von einem Tumor verursacht.»
«Sie meinen … Krebs?» fragte der kleine Mann leise.
«Ich fürchte, ja, und zwar in einem Stadium, in dem nichts mehr zu machen ist. Ich wünschte, ich könnte Ihrem Bob helfen, aber es ist hoffnungslos.»
Der alte Mann sah völlig verwirrt aus, und seine Lippen zitterten. «Dann muß er also sterben?»
Ich schluckte. «Ja, aber wir können ihn nicht einfach sich selbst überlassen, meinen Sie nicht auch? Er hat jetzt schon Schmerzen, und bald werden sie unerträglich sein. Wäre es nicht das beste, ihn einzuschläfern? Schließlich hat er ein schönes, langes Leben gehabt.» Ich bemühte mich in solchen Fällen immer, einen Ton munterer Sachlichkeit anzuschlagen, aber diesmal klangen die alten Klischees leer.
Der alte Mann schwieg. Dann sagte er: «Einen Augenblick bitte», und kniete sich mühsam neben dem Hund nieder. Wortlos strich er immer wieder über die graue Schnauze und die Ohren, während der Schwanz des Hundes auf den Boden klopfte. Lange kniete er so, und ich stand derweil in dem freudlosen Raum, ließ meinen Blick über die verblichenen Bilder an den Wänden, über die ausgefransten, schmutzigen Vorhänge und den schadhaften Lehnstuhl wandern.
Schließlich stand der alte Mann schwerfällig auf und schluckte ein paarmal. Ohne mich anzusehen, murmelte er:
«Gut, wollen Sie es jetzt tun?»
Ich füllte die Spritze und sagte das, was ich immer sagte:
«Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, er wird überhaupt nichts merken. Dies ist lediglich die Überdosis eines Betäubungsmittels. Es ist wirklich ein schmerzloser Tod.»
Der Hund rührte sich nicht, als ich die Nadel einführte. Während das Barbiturat in die Vene floß, wich die Angst aus seinen Augen, und die Muskeln begannen sich zu entspannen. Als die Injektion beendet war, hatte die Atmung aufgehört.
«Ist das alles?» fragte Mr. Dean heiser.
«Ja, das ist alles», antwortete ich. «Er hat jetzt keine Schmerzen mehr.»
Der alte Mann stand regungslos da, nur seine Hände krampften sich immer wieder ineinander. Als er sich schließlich mir zuwandte, leuchteten seine Augen. «Sie haben recht, wir konnten ihn nicht so leiden lassen, und ich bin dankbar für das, was Sie getan haben. Und was bin ich Ihnen schuldig, Sir?»
«Ach, das ist schon in Ordnung, Mr. Dean», sagte ich hastig. «Dafür nehme ich nichts. Ich kam sowieso hier vorbei.»
Der alte Mann sah mich erstaunt an. «Aber Sie können das doch nicht umsonst tun.»
«Lassen Sie’s gut sein, Mr. Dean, bitte. Wie ich schon sagte, ich kam sowieso hier vorbei.» Ich verabschiedete mich, verließ das Haus und ging durch den Torweg auf die Straße. Im Gedränge der Leute und in dem hellen Sonnenlicht sah ich immer nur das ärmliche kleine Zimmer, den alten Mann und seinen toten Hund. Als ich zu meinem Wagen ging, hörte ich hinter mir jemand rufen. Der alte Mann kam in seinen Pantoffeln aufgeregt angeschlurft. Auf seinen Wangen waren Tränenspuren zu sehen, aber er lächelte.