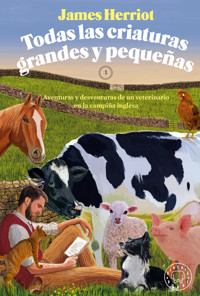9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Der Doktor und das liebe Vieh
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Der 1914 geborene Tierarzt James Wight ist unter seinem Pseudonym James Herriot ein ausgesprochenes Naturtalent launigen Erzählens. Auch in seinem vierten Buch über sein Leben als Tierarzt spürt man, dass er mit ganzem Herzen bei der Sache ist, dass er seinen Patienten, den Tieren, wie auch ihren Besitzern, die manchmal mehr seiner Behandlung bedürfen als die Vierbeiner, mit liebevollem Verständnis begegnet. Herriot berichtet auch über das veränderte Landleben, das nicht mehr so geruhsam verläuft wie in der guten alten Zeit. Er beobachtet mit Trauer, wie viele der kleinen Höfe verschwinden, weil ihre kauzigen Besitzer den Kampf aufgeben mussten. Aber er stellt doch auch mit tiefer Freude fest, dass es andere Dinge gibt, die so bleiben, wie sie immer waren: die schöne Landschaft der Yorkshire Dales mit ihren welligen Hügeln und Hochmooren, die Stille und Frieden verbreiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 336
Ähnliche
James Herriot
Von Zweibeinern und Vierbeinern
Neue Geschichten vom Tierarzt
Über dieses Buch
Der 1916 geborene Tierarzt James Wight ist unter seinem Pseudonym James Herriot ein ausgesprochenes Naturtalent launigen Erzählens. Auch in seinem vierten Buch über sein Leben als Tierarzt spürt man, dass er mit ganzem Herzen bei der Sache ist, dass er seinen Patienten, den Tieren, wie auch ihren Besitzern, die manchmal mehr seiner Behandlung bedürfen als die Vierbeiner, mit liebevollem Verständnis begegnet. Herriot berichtet auch über das veränderte Landleben, das nicht mehr so geruhsam verläuft wie in der guten alten Zeit. Er beobachtet mit Trauer, wie viele der kleinen Höfe verschwinden, weil ihre kauzigen Besitzer den Kampf aufgeben mussten. Aber er stellt doch auch mit tiefer Freude fest, dass es andere Dinge gibt, die so bleiben, wie sie immer waren: die schöne Landschaft der Yorkshire Dales mit ihren welligen Hügeln und Hochmooren, die Stille und Frieden verbreiten.
Vita
Unter dem Pseudonym James Herriot verfasste der 1916 geborene britische Tierarzt James Wight unzählige warmherzige Tierarztgeschichten. Er wuchs in Schottland auf, studierte in Glasgow Tiermedizin und erhielt eine Assistentenstelle in den Nord Yorkshire Dales. Sein Sohn übernahm später die väterliche Praxis, während seine Tochter Ärztin wurde. James Herriot starb am 23. Februar 1995 in Thirsk/Nordengland.
Impressum
Autorisierte Auswahl aus der 1981 unter dem Titel «The Lord God Made Them All» bei Michael Joseph Ltd., London, erschienenen Originalausgabe.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Februar 2022
Copyright © 1982 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«The Lord God Made Them All» Copyright © 1981 by James Herriot
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Covergestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
Coverabbildung Sam Ahmadi/Thinkstock
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-644-01040-6
www.rowohlt.de
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Für Zoe, mein schönes Enkelkind
Kapitel 1
Als das Tor auf mich fiel, wußte ich, daß ich wieder zu Hause war.
Meine Gedanken wanderten mühelos zurück, über die Zeit hinweg, die ich bei der Royal Air Force verbracht hatte, zu meinem letzten Besuch bei den Ripleys. Ich sollte ein paar «Kälber beschnippeln», wie Mr. Ripley am Telefon gesagt hatte. Mit anderen Worten, ich sollte sie mit Hilfe des unblutigen Burdizzo-Kastrators entmannen. Als die Botschaft mich erreichte, war mir klar, daß ein großer Teil des Morgens darüber vergehen würde.
Ein Besuch bei den Ripleys hatte etwas von einer Safari, denn Anson Hall, ihr Haus, lag am Ende eines von tiefen Furchen durchzogenen und durch nicht weniger als sieben Tore führenden Pfades, der sich durch die Felder wand.
Diese Gattertore waren einer der Flüche im Alltag eines Tierarztes, und wir in den Yorkshire Dales litten, bevor die elektrischen Viehzäune aufkamen, besonders darunter. Wir hatten uns damit abgefunden, daß wir auf vielen Farmen zwei oder drei solcher Tore öffnen mußten, aber sieben – das war zuviel. Und bei den Ripleys ging es zu allem Unglück nicht nur um die Zahl der Tore, sondern auch um ihren beklagenswerten Zustand.
Das erste, dicht an der Landstraße gelegen, war noch einigermaßen passabel – ein uraltes Ding aus rostigem Eisen. Als ich den Riegel zurückschob, schwang es, in den Angeln quietschend, freundlich auf. Es sollte das einzige bleiben, das von allein aufschwang, denn die anderen waren aus Holz und von der Sorte, die in den Dales «Schultergatter» genannt wird. Ich konnte mir gut vorstellen, wie sie zu diesem Namen gekommen waren, als ich sie jetzt der Reihe nach hochhievte und, die obere Latte auf der Schulter balancierend, aufschob. Sie hatten keine Angeln, sondern waren an der einen Seite oben und unten mit Bindfaden festgebunden.
Schon bei einem gewöhnlichen Gatter war das Öffnen ziemlich zeitraubend: man mußte mit dem Auto anhalten, aussteigen und das Ding hinter sich wieder schließen. Aber der Weg nach Anson Hall war ein hartes Stück Arbeit. Je mehr ich mich der Farm näherte, um so schlimmer war der Zustand der Tore, und ich keuchte vor Anstrengung, als ich das letzte Stück Wegs entlangholperte und auf Tor Nummer sieben zuratterte.
Es war das letzte und das fürchterlichste – ein bösartiges Ding mit einem eigenen, üblen Charakter. Jahrzehntelang war es immer wieder repariert und mit so viel Holz ausgebessert worden, daß von dem ursprünglichen Tor vermutlich kein Stückchen mehr vorhanden war. Aber es war gefährlich.
Ich stieg aus dem Wagen und ging ein paar Schritte darauf zu. Wir waren alte Widersacher, das Tor und ich, und so sahen wir einander eine Zeitlang schweigend an. Wir hatten in der Vergangenheit ein paar flotte Runden miteinander ausgetragen, und es bestand kein Zweifel, daß mein Gegner nach Punkten vorn lag.
Die Schwierigkeit lag darin, daß dieses Tor, abgesehen von seiner wackligen allgemeinen Beschaffenheit, nur an einer einzigen Stelle, in der Mitte, mit einer Strippe befestigt war.
Mit äußerster Vorsicht näherte ich mich ihm und machte mich daran, die Schnur, mit der es rechts zugebunden war, zu lösen. Diese Schnur war, wie ich erbittert feststellte, zu einem ordentlichen festen Knoten gebunden, und als ich ihn endlich gelöst hatte, griff ich hastig nach der oberen Latte. Aber es war bereits zu spät. Als ob es lebendig wäre, schwang der untere Teil auf mich zu und schlug mir grausam gegen die Schienbeine, und als ich nach der oberen Latte griff, um das Tor wieder ins Gleichgewicht zu bringen, donnerte mir der obere Teil gegen die Brust.
Es verlief alles genauso, wie es immer verlaufen war. Während ich es vorsichtig Zentimeter um Zentimeter aufschob, bekämpfte es mich und stieß mich oben und unten – ich war für dieses Tor nicht der richtige Gegner.
Und noch etwas anderes machte mir zu schaffen. Mr. Ripley stand in der Tür des Farmhauses und beobachtete mich wohlwollend. Und während ich mich abrackerte, stiegen zufriedene Rauchwölkchen von seiner Pfeife empor. Er rührte sich nicht von seinem Platz, bis ich über das letzte Stückchen Gras gestolpert war und vor ihm stand.
«So, Mr. Herriot, da sind Sie also gekommen, um mir ein paar Kälber zu beschnippeln.» Ein aufrichtiges freundliches Lächeln zog seine stoppligen Wangen in Falten. Mr. Ripley rasierte sich nur einmal in der Woche – am Markttag. Da ihn an den übrigen sechs Tagen nur seine Frau und sein Vieh zu sehen bekamen, brauchte er sich nicht jeden Morgen mit einem Messer im Gesicht herumzufahren, wie er mit einiger Logik erklärte.
Ich bückte mich und rieb mir meine verletzten Schienbeine. «Mr. Ripley, Ihr Tor da drüben ist glatter Mord! Erinnern Sie sich nicht mehr daran, daß Sie mir das letzte Mal, als ich hier war, in die Hand versprochen haben, Sie würden es reparieren? Sie haben sogar gesagt, Sie würden ein neues anschaffen! Es wäre an der Zeit, finden Sie nicht?»
«Ja, da haben Sie recht, junger Mann», sagte Mr. Ripley und nickte. «Das habe ich gesagt. Aber Sie wissen ja, das sind die Kleinigkeiten, die man nie getan kriegt.» Er lachte. Doch als ich das Hosenbein hochzog und eine lange Schramme an meinem Schienbein sichtbar wurde, erschrak er. «Oh, das ist ja eine Schande! Das ändert die Sache natürlich. Jetzt kommt ein neues Tor her, nächste Woche. Das garantiere ich Ihnen!»
«Aber Mr. Ripley, genau das haben Sie mir auch letztes Mal gesagt, als Sie mein blutendes Knie sahen. Genau das waren Ihre Worte. Sie sagten: Das garantiere ich Ihnen!»
«Ja, ich weiß, ich weiß.» Der Farmer drückte mit dem Daumen auf den Tabak im Pfeifenkopf und paffte. «Meine Frau liegt mir auch dauernd wegen meines schlechten Gedächtnisses in den Ohren. Aber keine Sorge, Mr. Herriot, diesmal werde ich es nicht vergessen. Es tut mir sehr leid, daß Sie sich Ihr Bein verletzt haben. Aber das Tor wird Ihnen keinen Kummer mehr machen. Das garantiere ich Ihnen.»
«Na gut», sagte ich und humpelte zum Wagen, um den Burdizzo zu holen. «Wo sind denn die Kälber?»
Mr. Ripley ging gemächlich über den Hof und öffnete die obere Hälfte der Schwingtür zum Stall. «Sie sind da drinnen.»
Ich blieb einen Augenblick wie angewurzelt stehen. Eine Reihe riesiger zotteliger Köpfe blickte mich über die Holzbalken hinweg gleichgültig an. Dann streckte ich einen zitternden Zeigefinger vor. «Meinen Sie die da?»
Der Farmer nickte zufrieden. «Ja, das sind sie.»
Ich ging weiter und sah in den Stall hinein. Es waren acht stramme Einjährige darin. Einige erwiderten meinen Blick mit sanftem Interesse, andere sprangen umher und wirbelten das Stroh auf. Ich drehte mich zu dem Farmer um.
«Das gleiche wie letztes Mal», sagte ich vorwurfsvoll.
«Was?» fragte er mit Unschuldsmiene.
«Sie haben mich hergebeten und gesagt, ich sollte ein paar Kälber kastrieren. Aber das hier sind keine Kälber, das sind Bullen! Letztes Mal war es das gleiche. Erinnern Sie sich? Die reinsten Monstren! Sie standen im selben Stall. Ich habe mir beim Zusammendrücken der Zange fast einen Bruch geholt! Und Sie haben versprochen, Sie würden mich in Zukunft kommen lassen, wenn die Tiere drei Monate alt sind. Sie haben gesagt: Das garantiere ich Ihnen!»
Der Farmer nickte ernst. Er nickte zu allem, was ich sagte. «Das stimmt, Mr. Herriot. Das habe ich gesagt.»
«Aber diese Tiere sind mindestens ein Jahr alt!»
Ripley zuckte mit den Schultern und sah mich mit einem traurigen Lächeln an. «Wie die Zeit vergeht! Schlimm, nicht wahr? Sie rast förmlich dahin.»
Ich ging zum Wagen zurück, um die Sachen für die örtliche Betäubung zu holen. «Also gut», brummte ich, während ich die Spritze füllte. «Wenn es Ihnen gelingt, sie einzufangen, werde ich sehen, was ich tun kann.» Der Farmer nahm einen Strick von einem Haken an der Wand und ging unter beruhigendem Gemurmel auf eines der großen Biester zu. Er traf mit überraschender Leichtigkeit das Maul und zog die Schlinge über die Hörner – gerade noch rechtzeitig, bevor das Tier nach ihm stoßen konnte. Dann schlang er den Strick durch einen Ring an der Wand und zog ihn stramm.
«Da haben Sie ihn, Mr. Herriot. War keine große Sache, was?»
Ich sagte nichts. Schließlich war ich derjenige, der mit den wirklichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben würde! Ich mußte nämlich am falschen Ende arbeiten, hübsch in Reichweite der Hufe. Und meine Patienten würden bestimmt nach mir treten, wenn es ihnen nicht gefiel, in die Hoden gepiekt zu werden.
Aber es half nichts, ich verpaßte einem nach dem andern die Betäubungsspritze in den Hodensack und nahm die Schläge auf Arme und Beine möglichst gleichmütig hin. Dann begann ich mit der eigentlichen Kastration, dem unblutigen Abdrücken der Samenstränge – zweifellos ein großer Fortschritt gegenüber der alten Methode, bei der man mit dem Messer einen Schnitt in den Hodensack hatte machen müssen.
Bei jungen Kälbern war es eine harmlose Angelegenheit von wenigen Sekunden. Aber bei diesen ausgewachsenen Kreaturen mußte man die Arme der Zange fast neunzig Grad öffnen, um den fleischigen Hodensack in den Griff zu bekommen – und das Problem war, daß man sie wieder zusammendrücken mußte.
Dank der Injektion spürten die Tiere wenig oder gar nichts, aber meine verzweifelten Versuche, die Zange zusammenzudrücken, schienen zum Scheitern verurteilt.
Es ist erstaunlich, was der Mensch alles vermag, wenn er zum Äußersten getrieben wird. Mir lief der Schweiß an der Nase herunter, ich keuchte und zitterte vor Anstrengung, aber langsam, ganz langsam kamen sich die Metallbacken der Zange näher und näher – bis sie schließlich zusammenstießen. Ich hatte mir angewöhnt, sicherheitshalber jeden Samenstrang zweimal abzuklemmen, und machte jedesmal eine kleine Pause, bevor ich die Prozedur weiter unten wiederholte. Als ich mit dem ersten Tier fertig war, lehnte ich mich schweratmend an die Wand und versuchte, nicht an die anderen sieben Biester zu denken, die ich noch vor mir hatte.
Es dauerte lange, sehr lange, bis ich beim letzten angelangt war, und ich wollte mich gerade wieder ans Werk machen, als mir eine Idee kam. Ich richtete mich auf und trat an die Flanke des Tieres.
«Mr. Ripley», sagte ich atemlos, «wollen Sie es nicht auch einmal versuchen?»
«Was?» Der Farmer hatte mir gleichmütig zugeschaut und Wolken blauen Rauchs vor sich hingepafft. Jetzt war ihm deutlich anzusehen, daß ich ihn aus seiner Gemütsruhe aufgeschreckt hatte. «Was meinen Sie?»
«Das ist jetzt das letzte Tier, und ich möchte, daß Sie mal sehen, wovon ich gesprochen habe. Ich möchte, daß Sie die Zange zusammendrücken.»
Er dachte eine Zeitlang über die Angelegenheit nach. «Und wer soll das Biest festhalten?»
«Das geht schon in Ordnung», sagte ich. «Wir werden es möglichst kurz am Ring anbinden, und ich bereite alles für Sie vor. Dann wollen wir mal sehen, wie Sie zurechtkommen.»
Er sah mich zweifelnd an. Aber ich war zu allem entschlossen und drängte ihn sanft zum Hinterteil des Tieres. Ich setzte den Kastrator am Hoden an und legte Mr. Ripleys Hände um die Hebel.
«So», sagte ich. «Fangen Sie an.»
Der Farmer holte tief Luft, spannte die Muskeln und begann, Druck auf die Metallhebel auszuüben. Nichts geschah.
Ich stand mehrere Minuten neben ihm. Sein Gesicht wurde rot, dann lila, die Augen quollen ihm aus dem Kopf, und die Adern auf seiner Stirn traten als blaue Wülste hervor. Schließlich stöhnte er auf und fiel auf die Knie.
«Nee, Junge, nee, das wird nichts. Ich kann es nicht.»
Er kam langsam wieder auf die Füße und fuhr sich mit der Hand über die Brauen.
«So, so, Mr. Ripley.» Ich legte ihm die Hand auf die Schulter und lächelte ihn freundlich an. «Und von mir erwarten Sie, daß ich damit fertig werde.»
Er nickte dumpf.
«Schon gut, macht nichts», sagte ich. «Aber jetzt haben Sie sicher verstanden, was ich meine. Es ist im Grunde eine Lappalie. Wenn Sie mich gerufen hätten, als es noch Kälber von drei Monaten waren, wäre ich in ein paar Minuten damit fertig gewesen. Verstehen Sie?»
«Ja, Mr. Herriot. Da haben Sie wohl recht. Wie dumm von mir. Ich werde zusehen, daß es nicht wieder vorkommt.»
Ich kam mir ausgesprochen raffiniert vor. Ich habe nicht oft Eingebungen, aber heute – diese Überzeugung stieg in mir auf –, heute hatte ich eine gehabt. Endlich hatte ich Mr. Ripley geschafft.
Das Gefühl der Heiterkeit gab mir zusätzliche Kraft, und ich beendete die Arbeit mühelos.
Als ich zu meinem Auto ging, strahlte ich, und meine Selbstzufriedenheit wurde noch größer, als der Farmer sich, während ich den Motor startete, zum Wagenfenster herunterbeugte.
«Also, ich danke Ihnen, Mr. Herriot», sagte er. «Sie haben mir heute morgen eine Menge beigebracht. Wenn Sie das nächste Mal kommen, habe ich ein hübsches neues Tor für Sie, und ich werde Sie nie wieder bitten, so große Biester wie die heute zu kastrieren. Das garantiere ich Ihnen.»
All das lag lange zurück, vor meiner Zeit bei der Air Force. Inzwischen versuchte ich, mich wieder ins Zivilleben zurückzufinden. In dem Augenblick, als das Telefon klingelte, machte ich mich gerade wieder mit etwas vertraut, was meinem Herzen besonders teuer war – mit Helens Kochkünsten.
Es war Sonntag, wir saßen beim Mittagessen, und es gab das traditionelle Roastbeef und Yorkshire-Pudding. Meine Frau hatte mir gerade einen Schlag Yorkshire-Pudding auf den Teller getan und goß Bratensaft darüber, einen schönen braunen Strom, der die Seele des Fleisches in sich hatte und einen Duft zum Träumen verbreitete. Ich war nahe am Verhungern, nachdem ich den ganzen Sonntagmorgen von Farm zu Farm geeilt war.
Mit einer großen Portion Yorkshire-Pudding und Bratensaft pflegten die sparsamen Frauen der Farmer die Mägen ihrer Lieben zu füllen, bevor das eigentliche Mahl begann – «Wer am meisten Pudding ißt, kriegt auch am meisten Fleisch», lautete ihre listige Ermunterung –, aber es schmeckte paradiesisch. Als ich den ersten Bissen kaute, dachte ich glücklich daran, daß Helen mir meinen Teller, sobald er leer war, wieder füllen würde – mit Fleisch, mit Kartoffeln und mit Bohnen, die morgens in unserem Garten gepflückt worden waren.
Das Klingeln des Telefons fuhr grausam in meine Träume hinein. Ich war entschlossen, mir dieses Mahl durch nichts verderben zu lassen. Auch der dringendste Fall konnte warten, bis ich es beendet hätte.
Trotzdem zitterte meine Hand, als ich den Hörer abnahm, und eine Mischung aus Angst und Unglauben erfüllte mich, als ich die Stimme am anderen Ende der Leitung hörte. Es war Mr. Ripley. Nein, bitte nicht! Nicht den langen Weg nach Anson Hall – nicht an einem Sonntag!
Die Stimme des Farmers drang donnernd in mein Ohr. Er gehörte zu den Leuten, die immer noch meinen, man müsse am Telefon kräftig brüllen, um sich auf eine größere Entfernung hin verständlich zu machen.
«Ist da der Tierarzt?»
«Ja, hier spricht Herriot. »
«Aha, dann sind Sie also aus dem Krieg zurück, ja?»
«Ja.»
«Also, ich wollte Sie bitten, daß Sie gleich herkommen. Einer meiner Kühe geht’s schlecht.»
«Was fehlt ihr? Ist es dringend?»
«Ja, das ist es ! Ich glaube, sie hat sich das Bein gebrochen.»
Ich hielt den Hörer ein Stück vom Ohr weg. Mr. Ripleys brüllende Stimme dröhnte in meinem Kopf. «Weshalb glauben Sie das?» fragte ich.
«Na, weil sie auf drei Beinen steht», schrie der Farmer zurück. «Und weil das andere so komisch rumhängt.»
O Gott, das klang wahrhaftig nach einem Beinbruch. Ich blickte traurig durchs Zimmer auf meinen vollen Teller. «Gut, Mr. Ripley, ich komme.»
«Sie kommen doch gleich, nicht? Gleich jetzt?» Die Stimme war ein mächtiges Donnern.
«Ja, ich komme.» Ich legte den Hörer auf, rieb mir das Ohr und drehte mich zu meiner Frau um.
Helen sah mich mit vorwurfsvollen Augen an. «Aber du brauchst doch sicher nicht sofort zu gehen?»
«Es tut mir leid, Helen. Aber diesmal ist es eine Sache, die ich nicht aufschieben kann.» Ich konnte mir nur zu gut vorstellen, wie das verletzte Tier sich ängstigte und litt. Vielleicht war es ein komplizierter Bruch. «Ich muß sofort los.»
Helens Lippen zitterten. «Gut, ich stelle das Essen in den Ofen, bis du zurückkommst.»
Als ich wegging, sah ich sie meinen Teller hinaustragen. Wir wußten beide, daß dies das Ende war: kein Yorkshire-Pudding überlebte einen Besuch in Anson Hall.
Ich fuhr so schnell ich konnte durch Darrowby. Der kopfsteingepflasterte Marktplatz schlief im Sonnenschein und atmete sonntäglichen Frieden. Die Bewohner der kleinen Stadt saßen offenbar alle beim Mittagessen. Die Mauern aus Feldsteinen draußen vor der Stadt flogen an mir vorbei. Als ich endlich die Stelle erreichte, wo der Weg zur Farm abzweigte, traf mich schier der Schlag.
Es war das erste Mal, daß ich wieder hierherkam seit meiner Entlassung vom Militär, und ich nehme an, daß ich erwartet hatte, irgend etwas anders als früher vorzufinden. Aber da war noch dasselbe alte eiserne Tor – nur daß es noch etwas mehr verrostet war. Mit wachsendem Unbehagen kämpfte ich mich durch die verschiedenen Tore, bis ich schließlich zum Tor Nummer sieben kam.
Es war nach wie vor das schreckliche Tor von damals ! Aber das kann doch nicht wahr sein, dachte ich, während ich unwillkürlich auf Zehenspitzen darauf zuging. Ich hatte so viel erlebt, seit ich es zum letztenmal gesehen hatte, ich war in einer anderen Welt gewesen, in der Welt des Militärs, ich hatte fliegen gelernt – und dieses klapprige Gebilde hatte den ganzen Krieg unbeachtet und unverändert überdauert!
Ich sah es mir aus der Nähe an. Ja, es war dasselbe wacklige Gattertor! Unglaublich! Aber jetzt bemerkte ich doch eine Veränderung. Mr. Ripley hatte, offenbar aus Angst, daß eine seiner Kühe dagegen stoßen und von dem alten Ding erschlagen werden könnte, das Holz mit Stacheldraht umwickelt.
Ich hoffte nur, daß die Zeit es zermürbt hatte und daß es nicht mehr so bösartig war wie früher! Vorsichtig löste ich die Schnur oben an der rechten Seite und nahm mit unendlicher Behutsamkeit die letzte Schlinge vom Pfosten. Ich dachte gerade, daß diesmal vielleicht alles gutginge, als es, jetzt nur noch an der linken Schnur hängend, mit altgewohnter Gehässigkeit auf mich zufuhr.
Erst traf es mich an der Brust, dann schlug es mir gegen die Beine, und der Stacheldraht drang durch meine Hosenbeine. Wütend versuchte ich, das Ding von mir wegzustoßen, aber es stieß auch weiterhin auf mich ein, und als ich mich, um meine Brust zu schützen, nach hinten beugte, glitten die Füße unter mir weg, und ich schlug zu Boden. Der Länge nach auf dem Rücken liegend, sah ich, wie das Tor sich mit einem weichen hölzernen Knurren auf mich senkte.
Ich hatte schon mehrere Male in der Vergangenheit beinahe unter dem Gattertor gelegen, war aber bisher jedesmal im letzten Moment wieder freigekommen. Ich versuchte, mich darunter hervorzuschlängeln, aber der Stacheldraht hatte mich fest im Griff. Ich saß in der Falle.
Ich spähte verzweifelt über die Holzlatten hinweg. Die Farm war höchstens fünfzig Meter entfernt, aber keine Menschenseele war in Sicht. Das war seltsam – wo war denn der Farmer? Ich hatte erwartet, daß er verzweifelt vorm Haus auf und ab ging und ungeduldig die Hände rang, aber der Hof war menschenleer.
Ich dachte daran, um Hilfe zu rufen, aber das kam mir dann doch zu albern vor. Es blieb mir nichts anderes übrig, als mit beiden Händen zuzupacken und mich selbst zu befreien, wobei ich versuchte, das Geräusch meines zerreißenden Anzugs nicht zu hören. Schließlich befand ich mich in Sicherheit.
Ich ließ das Gattertor liegen, wo es lag. Normalerweise mache ich alle Tore sorgfältig wieder hinter mir zu, aber es war kein Vieh auf den Wiesen, und im übrigen hatte ich fürs erste genug.
Ich klopfte kräftig an die Tür des Hauses. Mrs. Ripley öffnete mir.
«Da sind Sie ja, Mr. Herriot. Wunderbares Wetter, nicht?» sagte sie. Dabei sah sie mich mit dem gleichen freundlichen Lächeln an, das ich von ihrem Mann kannte. Sie trug eine Schürze um ihre üppige Taille und trocknete gerade einen Teller ab.
«Ja … ja … Ihr Mann hat mich angerufen, ich soll nach Ihrer kranken Kuh sehen. Ist er da?»
Sie schüttelte den Kopf. «Nein, er ist noch nicht wieder zurück. Ist sicher noch in den Füchsen und Hunden.»
«Was?» Ich starrte sie an. «Ist das nicht die Kneipe in Diverton? Ich dachte, es sei ein dringender Fall …»
«Ja, ja. Aber er mußte doch da hingehen, um Sie anzurufen – wir haben kein Telefon hier, verstehen Sie?» Ihr Lächeln wurde noch breiter.
«Aber … aber das ist doch schon über eine Stunde her. Er müßte doch längst wieder hier sein.»
«Das stimmt», sagte sie und nickte verständnisvoll. «Wahrscheinlich hat er ein paar von seinen Kumpanen getroffen. Sie sind dort jeden Sonntagmorgen. »
Ich fuhr mir mit den Fingern durchs Haar. «Mrs. Ripley, ich habe mein Sonntagsessen stehenlassen, um sofort herzukommen.»
«So? Wir haben schon gegessen», sagte sie, als ob ihre Worte ein Trost für mich wären. Und sie hätte es mir nicht zu sagen brauchen. Der köstliche Duft, der aus der Küche drang, war unverkennbar der von Roastbeef, und bestimmt hatte es vorher Yorkshire-Pudding gegeben.
Eine Zeitlang sagte ich nichts. Dann holte ich tief Luft. «Also, gut. Ich kann ja schon einmal nach der Kuh sehen. Wo ist sie, bitte?»
Mrs. Ripley deutete auf einen der Ställe auf der anderen Seite des Hofes. «Dort.» Und als ich mich anschickte, über den Hof zu gehen, rief sie hinter mir her: «Sehen Sie sich die Kuh ruhig an, bis er zurückkommt. Es wird sicher nur noch ein paar Minuten dauern.»
Ich fuhr zusammen, als ob ich einen Schlag mit der Peitsche auf die Schulter bekommen hätte. Das klang bedrohlich. «Nur noch ein paar Minuten» – in Yorkshire konnte das alles bedeuten, bis zu zwei oder drei Stunden.
Ich öffnete die obere Türhälfte und betrachtete die Kuh in der Box. Sie lahmte stark, aber als ich auf sie zuging, stellte sie das verletzte Bein auf den Boden.
Also war das Bein nicht gebrochen. Sie konnte sich zwar nicht mit ihrem vollen Gewicht darauf stellen, aber von dem typischen Baumeln des Beins war nichts zu sehen. Ich war erleichtert. Bei einem großen Tier bedeutet der Bruch eines Beins gewöhnlich, daß es getötet werden muß – kein noch so fester Gipsverband kann den Druck auffangen. Das Problem schien im Fuß zu liegen, aber ich konnte die Kuh nicht allein festhalten, um es herauszufinden. Ich mußte auf Mr. Ripley warten.
Ich ging in den nachmittäglichen Sonnenschein hinaus und sah über die sanft ansteigenden Felder hin zum Kirchturm von Diverton, der die Bäume überragte. Von dem Farmer war nichts zu sehen. Ungeduldig wanderte ich zwischen den Wirtschaftsgebäuden hin und her.
Ich betrachtete das Wohnhaus, und trotz meines Ärgers durchzog mich ein Gefühl des Friedens. Anson Hall war einst ein schönes Herrenhaus gewesen. Das Dach sah ziemlich verfallen aus, und einer der hohen Schornsteine hatte sich geneigt, als wäre er betrunken. Aber die mit Pfosten versehenen Fenster, die anmutig geschwungene Haustür und die Proportionen des Hauses inmitten der grünen Weiden, die sich bis zu den Feldern hinstreckten, waren ein erquicklicher Anblick.
Und dann die Gartenmauer. Einst mußten die sonnenwarmen Steine einen gepflegten Rasen mit leuchtenden Blumenrabatten umschlossen haben. Jetzt wuchsen dort nur Brennnesseln. Diese Brennesseln faszinierten mich: ein etwa hüfthoher Dschungel füllte jeden Zentimeter des Raumes zwischen Mauer und Haus. Bauern sind bekanntlich oft schlechte Gärtner, aber Mr. Ripley schoß in dieser Beziehung den Vogel ab.
Meine träumerischen Gedanken wurden durch einen Schrei der Hausherrin jäh unterbrochen. «Er kommt, Mr. Herriot. Ich habe ihn schon gesehen.» Sie kam ums Haus herum und deutete in Richtung Diverton.
Ihr Mann war auf dem Heimweg, das stimmte: ein schwarzer Punkt bewegte sich gemächlich durch die Felder. Wir beobachteten ihn zusammen etwa fünfzehn Minuten lang. Schließlich zwängte er sich durch ein Loch im Zaun und kam auf uns zu. Der Rauch seiner Pfeife wehte ihm um die Ohren.
Ich ging sofort zum Angriff über. «Mr. Ripley, ich habe lange auf Sie gewartet! Sie haben mich gebeten, sofort herzukommen.»
«Ja, ich weiß, ich weiß, aber ich konnte nicht gut fragen, ob ich mal telefonieren darf, ohne ein Gläschen zu trinken, nicht wahr?» Er legte den Kopf auf die Seite und strahlte mich an, unschlagbar in seiner Logik.
Ich wollte gerade etwas sagen, als er fortfuhr: «Und dann hat mir Dick Henderson einen spendiert, und da mußte ich ihm auch einen spendieren, und als ich gerade gehen wollte, fing Bobby Talbot an, über die Schweine zu reden, die er letzte Woche von mir bekommen hat.»
Seine Frau mischte sich ein. «Sieh einer an, dieser Bobby Talbot! Er fehlt nie in einem Wirtshaus, dieser Bursche. Ich möchte wissen, wie seine Frau es mit ihm aushält.»
«Ja, Bobby war da, natürlich. Das gönnt er sich schon.» Mr. Ripley lächelte breit, klopfte seine Pfeife am Schuh aus und fing an, sie wieder zu stopfen. «Und ich sage dir, wen ich noch gesehen habe – Dan Thompson. Ich habe ihn seit seiner Operation nicht mehr gesehen. Bei Gott, das hat ihn ziemlich mitgenommen – er hat ein bißchen den Boden unter den Füßen verloren. Sieht aus, als ob ihm ein paar Gläschen guttun würden.»
«So? Dan?» fragte Mrs. Ripley eifrig. «Das ist mal eine gute Nachricht. Soviel ich gehört habe, hat man geglaubt, er würde nicht mehr aus dem Krankenhaus rauskommen.»
«Verzeihung», unterbrach ich.
«Nein, nein, das war alles nur Gerede», fuhr Mr. Ripley fort. «Es war nur ein Nierenstein. Dan kommt wieder auf die Beine. Er hat mir erzählt …»
Ich hob die Hand. «Mr. Ripley, kann ich jetzt bitte die Kuh sehen? Ich habe noch nicht zu Mittag gegessen. Meine Frau hat mein Essen in den Ofen zurückgestellt, als Sie anriefen.»
«Oh, ich habe gegessen, ehe ich wegging.» Er lächelte mir beruhigend zu, und seine Frau nickte und lachte, wie um mich vollends zu beruhigen.
«Das ist ja großartig», sagte ich kühl. «Ich freue mich, das zu hören.» Aber ich sah, daß sie mich beim Wort nahmen. Sie hatten keinen Sinn für meinen Sarkasmus.
Mr. Ripley band die Kuh in der Box an, und ich hob ihren Fuß. Ich legte ihn auf mein Knie und kratzte den verkrusteten Dreck mit dem Hufmesser weg, und siehe da, schwach im Sonnenlicht glänzend, das schräg durch die Stalltür fiel, lag die Ursache des Problems vor mir. Ich griff mit der Zange nach dem Eisennagel, zog ihn aus dem Fuß und hielt ihn hoch.
Der Bauer beäugte ihn ein paar Sekunden lang, dann begannen seine Schultern leicht zu beben. «Einer meiner eigenen Schuhnägel. Hahaha. Also wirklich, das ist ja komisch. Ich muß ihn mir auf dem Kopfsteinpflaster ausgetreten haben, da hinten ist es manchmal ziemlich glitschig. Ein- oder zweimal bin ich schon beinahe auf den Hintern gefallen. Ich habe gerade neulich zu meiner Frau gesagt …»
«Ich muß jetzt weiter, Mr. Ripley», unterbrach ich ihn. «Sie wissen ja, daß ich noch nicht zu Mittag gegessen habe. Ich gehe nur schnell zum Wagen und hole eine Tetanus-Spritze für die Kuh.»
Ich gab ihr die Injektion, ließ die Spritze in meine Tasche fallen und war schon halb über den Hof, als Mr. Ripley hinter mir herrief.
«Haben Sie Ihre Kastrationszangen bei sich, Mr. Herriot?»
«Die Zange … ?» Ich blieb stehen und sah zu ihm hinüber. Das konnte ich nicht glauben. «Ja, habe ich. Aber Sie wollen doch sicher heute am Sonntag nicht Ihre Kälber kastrieren lassen?»
Der Farmer drehte am Rädchen seines alten Messingfeuerzeugs und hielt die lange Flamme an den Kopf seiner Pfeife. «Es ist nur eines, Mr. Herriot. Dauert nur eine Minute.»
Na gut, dachte ich, während ich den Kofferraum öffnete und den Burdizzo herausfischte, der wie immer auf dem Overall lag, den ich anzog, wenn eine Kuh kalbte. Darauf kam es jetzt auch nicht mehr an. Mein Yorkshire-Pudding war längst abgeschrieben, und das Fleisch und das herrliche frische Gemüse waren inzwischen mit Sicherheit verschmort.
Während ich über den Hof ging, flog am anderen Ende plötzlich eine Schwingtür auf, und ein riesiges schwarzes Tier stürmte heraus. Es blieb stehen, spähte wachsam im hellen Sonnenlicht um sich, stampfte den Boden und schlug schlechtgelaunt mit dem Schwanz. Ich starrte auf die Hörner, auf die gewaltigen Muskelpartien an den Schultern, auf die böse glitzernden Augen. Es fehlte nur ein Trompetenstoß, und ich hätte gemeint, ich befände mich auf der Plaza de Toros in Madrid und der Stierkampf begänne.
«Ist das das Kalb?» fragte ich.
Der Farmer nickte stolz. «Ja, das ist es. Ich habe gedacht, ich bring es lieber in den Kuhstall, da können wir es besser anbinden.»
Eine Welle der Wut schlug über mir zusammen, und einen Augenblick lang war ich drauf und dran, den Mann anzuschreien, aber dann fühlte ich seltsamerweise nur noch eine große Müdigkeit.
Ich ging zu ihm hinüber, so nahe an ihn heran, daß mein Gesicht vor dem seinen war, und sagte mit ruhiger Stimme: «Mr. Ripley, es ist sehr lange her, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, und Sie hätten reichlich Zeit gehabt, das Versprechen, das Sie mir damals gaben, einzulösen. Erinnern Sie sich? Sie wollten Ihre Kälber beschneiden lassen, solange sie noch jung sind, und Sie wollten das Tor reparieren. Und jetzt sehen Sie sich diesen großen Bullen an, und sehen Sie sich an, was Ihr Tor mit meinem Anzug gemacht hat.»
Der Farmer starrte mit echtem Interesse auf meinen zerfetzten Anzug und streckte die Hand aus, um einen klaffenden Riß an meinem Ärmel zu berühren.
«Oh, das tut mir aber leid.» Er sah zu dem Bullen hin. «Und ich schätze, der ist auch schon ein bißchen groß.»
Ich sagte nichts. Nach ein paar Sekunden wandte mir der Farmer den Kopf zu und sah mir in die Augen – die Entschlossenheit in Person, so schien es.
«Ja», sagte er, «das ist nicht recht. Aber ich will Ihnen was sagen. Kastrieren Sie diesen einen heute noch, und ich verspreche Ihnen, daß es nie wieder passiert.»
Ich setzte ihm den Finger auf die Brust. «Das haben Sie schon mehrmals gesagt. Meinen Sie es diesmal wirklich ernst?»
Er nickte heftig. «Das garantiere ich Ihnen.»
Kapitel 2
«Uh … Uh-hu-hu!» Das herzzerreißende Schluchzen riß mich vollends aus dem Schlaf. Es war ein Uhr nachts. Das Telefon an meinem Bett hatte geklingelt, und ich hatte erwartet, die brummige Stimme eines Farmers zu hören, bei dem eine Kuh kalbte. Solche nächtlichen Anrufe waren nichts Ungewöhnliches. Statt dessen hörte ich dieses schreckliche Heulen.
«Wer ist da?» fragte ich beunruhigt. «Was, zum Teufel, ist denn los?»
Schließlich hörte ich zwischen den Schluchzern eine männliche Stimme, die stammelte: «Hier ist Humphrey Cobb. Kommen Sie um Gottes willen her, Herr Doktor, und sehen Sie nach meiner Myrtle. Ich glaube, sie stirbt.»
«Myrtle?»
«Ja, mein armer kleiner Hund. Sie ist in einem fürchterlichen Zustand! Uh-hu!»
Der Hörer in meiner Hand zitterte. «Was fehlt ihr denn?»
«Oh, sie japst und keucht so schrecklich. Ich fürchte, es ist bald vorbei mit ihr. Kommen Sie bitte ganz schnell, Herr Doktor.»
«Wo wohnen Sie denn?»
«Cedar House. Am Ende der Hill Street.»
«Ich weiß Bescheid. Ich komme sofort.»
«Oh, vielen Dank, Herr Doktor. Myrtle macht’s bestimmt nicht mehr lange. Kommen sie bitte ganz schnell!»
Ich sprang aus dem Bett und tastete nach meinen Kleidern, die über dem Stuhl hingen. In der Eile stieg ich mit beiden Füßen in dasselbe Hosenbein meiner Cordhose und fiel der Länge nach hin.
Helen war die nächtlichen Telefonanrufe gewöhnt und wachte oft nur halb auf. Ich versuchte, sie nicht zu stören, indem ich mich anzog, ohne Licht zu machen – es drang immer ein Schimmer von dem Nachtlicht herein, das wir Jimmys wegen im Treppenhaus brennen ließen.
Aber diesmal war alles umsonst: als ich polternd zu Boden ging, fuhr Helen hoch.
«Was ist los, Jim? Was ist passiert?»
Ich kam wieder auf die Füße. «Schon gut, Helen, ich bin nur gestolpert.» Ich griff nach meinem Hemd.
«Wo willst du denn hin?»
«Ein dringender Fall. Ich muß mich beeilen.»
«Gut, Jim. Aber mit dieser Hektik bist du auch nicht schneller. Komm doch erst mal wieder zur Ruhe.»
Helen hatte recht. Ich war zu nervös – ich habe die Tierärzte, die stets die Ruhe bewahren, immer beneidet.
Ich lief die Treppe hinunter und durch den Garten zur Garage. Cedar House lag nur eine Meile entfernt, und so blieb mir unterwegs nicht viel Zeit zum Nachdenken. Aber als ich am Ende der Hill Street ankam, war ich ziemlich fest der Meinung, daß eine Störung, wie Humphrey Cobb sie beschrieben hatte, eigentlich nur durch einen Herzanfall oder eine plötzliche Allergie verursacht sein konnte.
Ich klingelte. Das Licht über der Tür ging an, und Humphrey Cobb stand vor mir. Er war ein kleiner rundlicher Mann in den Sechzigern mit einer spiegelnden Glatze.
«Oh, Mr. Herriot, kommen Sie rein, kommen Sie», stammelte er, während ihm die Tränen über die Wangen strömten. «Ich danke Ihnen, daß Sie extra aufgestanden und mitten in der Nacht zu mir gekommen sind, um meiner armen kleinen Myrtle zu helfen.»
Während er sprach, schlug mir eine Whiskyfahne entgegen. Und als er mir voran durch den Flur ging, bemerkte ich, daß er schwankte.
Mein Patient lag in einem Korb, der in der großen, wohlausgestatteten Küche neben dem Kochherd stand. Ein warmes Gefühl durchflutete mich, als ich sah, daß Myrtle ein Beagle war, wie mein eigener Hund. Ihre Schnauze stand offen und ihre Zunge hing heraus, aber ich hatte nicht den Eindruck, daß sie litt oder in akuter Gefahr war, und als ich ihr den Kopf streichelte, klopfte sie mit dem Schwanz auf die Decke.
Wieder erhob Mr. Cobb seine klagende Stimme: «Was werden Sie mit ihr tun, Mr. Herriot? Es ist das Herz, nicht? O, Myrtle, meine Myrtle!» Der kleine Mann beugte sich über seinen Liebling und ließ seinen Tränen freien Lauf.
«Wissen Sie, Mr. Cobb», sagte ich, «so schlecht kann es ihr eigentlich nicht gehen. Regen Sie sich doch nicht so auf, Mann. Beruhigen Sie sich, ich werde sie jetzt erst mal untersuchen.»
Ich hielt mein Stethoskop an die Rippen und hörte das stetige Klopfen eines wunderbar kräftigen Herzens. Die Temperatur war normal. Als ich den Bauch abtastete, fing Mr. Cobb wieder mit seiner Klagestimme an.
«Das schlimme ist», stieß er hervor, «daß ich das arme Tierchen vernachlässigt habe!»
«Was meinen Sie damit?»
«Na, ich bin den ganzen Tag in Catterick beim Pferderennen gewesen und habe gewettet und getrunken, ohne ein einziges Mal an mein armes Hündchen zu denken.»
«Sie haben sie die ganze Zeit hier im Haus allein gelassen?»
«Nein, nein, die Frau ist bei ihr gewesen.»
«Aha.» Ich spürte, daß ich langsam dem Geheimnis auf die Spur kam. «Und die Frau hat Myrtle Futter gegeben und sie in den Garten hinausgelassen?»
«Ja, sicher», sagte er und rang die Hände. «Aber ich hätte sie nicht allein lassen sollen. Sie hängt so sehr an mir.»
Während er sprach, fühlte ich, wie die eine Seite meines Gesichts vor Hitze zu kribbeln begann. Und plötzlich war mir alles klar.
«Sie haben sie zu dicht an den Ofen gestellt», sagte ich. «Sie japst, weil es ihr zu heiß ist.»
Er sah mich zweifelnd an. «Wir haben den Korb heute erst hierhergeschoben. Der Fliesenleger hat ein paar neue Kacheln auf dem Fußboden verlegt.»
«Sie werden sehen», sagte ich, «sobald Sie ihn wieder dahin schieben, wo er immer stand, wird ihr nichts mehr fehlen.»
«Aber, Herr Doktor», erwiderte er mit bebenden Lippen, «es muß mehr sein als nur das. Sie leidet. Sehen Sie sich ihre traurigen Augen an.»
Myrtle hatte wunderschöne große, schwimmende Augen, und sie wußte sie einzusetzen. Viele Hundeliebhaber glauben, der Spaniel könne die seelenvollsten Blicke von sich geben. Ich selber traue das eher den Beagles zu. Myrtle jedenfalls war eine Meisterin darin.
«Ach, da machen Sie sich mal keine Gedanken, Mr. Cobb», sagte ich. «Glauben Sie mir, es fehlt ihr nichts.»
Aber Mr. Cobb war immer noch unglücklich. «Wollen Sie nicht doch etwas tun, Herr Doktor?»
Das war eine der großen Fragen im Leben eines Tierarztes. Wenn man nichts «tat», waren die Leute nicht zufrieden. In diesem speziellen Fall war es so, daß Mr. Cobb dringender einer Behandlung bedurfte als sein Liebling. Allerdings wollte ich Myrtle nicht, nur um ihn zu beruhigen, eine Spritze geben. Deshalb holte ich eine Schachtel Vitamintabletten aus meiner Tasche und schob dem kleinen Tier eine hinten über die Zunge.
«Das wär’s», sagte ich. «Die Tablette wird ihr guttun. » Ich kam mir wie ein Scharlatan vor. Andererseits würde ihr die Tablette zumindest nicht schaden.
Mr. Cobb war sichtlich erleichtert. «Ah, das ist gut. Sie haben mein Gewissen beruhigt.» Er nahm Kurs auf einen üppig eingerichteten Salon und ging mit unsicheren Schritten auf einen Barschrank zu. «Wie wär’s mit einem Gläschen, ehe Sie gehen?»
«Nein, vielen Dank, wirklich», sagte ich. «Lieber nicht.»
«Ich brauche einen Schluck, um meine Nerven zu beruhigen. Ich war so aufgeregt.» Er goß sich einen kräftigen Schluck Whisky ins Glas und winkte mich zu einem Sessel.
Mein Bett rief nach mir, aber ich setzte mich trotzdem und leistete ihm Gesellschaft, während er trank. Er erzählte mir, daß er Buchmacher gewesen sei und erst seit einem Monat in Darrowby lebe. Aber obwohl er beruflich mit Pferderennen nichts mehr zu tun habe, versäume er kein einziges Rennen im nördlichen England.
«Ich genehmige mir ein Taxi und mache mir einen guten Tag.» Sein Gesicht strahlte, während er sich an die glücklichen Stunden erinnerte, dann zitterten seine Wangen einen Moment und der wehleidige Ausdruck kehrte in sein Gesicht zurück.
«Aber ich vernachlässige meinen Hund. Ich lasse ihn allein zu Hause.»
«Unsinn», sagte ich. «Ich habe Sie schon draußen in den Feldern mit Myrtle gesehen. Sie geben ihr viel Auslauf, nicht wahr?»
«O ja, wir machen jeden Tag lange Spaziergänge.»
«Na, dann hat sie doch ein gutes Leben. Sie machen sich unnötige Sorgen.»
Er sah mich mit strahlender Miene an und goß einen Schluck Whisky in sich hinein. «Sie sind ein guter Kerl», sagte er. «Kommen Sie, nehmen Sie wenigstens einen, bevor Sie gehen.»
«Also gut, aber nur einen kleinen, bitte.»
Während wir tranken, wurde er immer sanfter, bis er mich schließlich fast unterwürfig ansah.
«James Herriot», lallte er. «Ich vermute, das ist Jim, was?»
«Ja.»
«Dann werde ich Sie Jim nennen, und Sie nennen mich Humphrey.»
«Gut, Humphrey», sagte ich und trank das letzte Tröpfchen von meinem Whisky. «Aber jetzt muß ich wirklich gehen.»
Draußen legte er die Hand auf meinen Arm, und sein Gesicht wurde wieder ernst. «Ich danke dir, Jim. Myrtle ging es wirklich ziemlich schlecht. Ich bin dir sehr dankbar.»
Als ich nach Hause fuhr, wurde mir klar, daß ich es nicht geschafft hatte, ihn davon zu überzeugen, daß seinem Hund überhaupt nichts gefehlt hatte. Er war überzeugt, daß ich Myrtle das Leben gerettet hatte. Es war ein ungewöhnlicher Besuch gewesen, und während mir der Zwei-Uhr-nachts-Whisky im Magen brannte, kam ich zu dem Schluß, daß dieser Humphrey Cobb zwar ein recht komischer kleiner Mann war, daß ich ihn aber trotzdem mochte.
Nach dieser Nacht sah ich ihn häufig mit Myrtle über die Wiesen und Felder gehen. Wegen seiner fast kugeligen Gestalt schien es fast, als rollte er durch das Gras, aber er benahm sich immer vernünftig, außer daß er mir jedesmal überschwenglich dafür dankte, daß ich Myrtle den Klauen des Todes entrissen hätte, wie er sagte.
Dann plötzlich waren wir wieder am Anfang der Geschichte. Eines Nachts, kurz nach Mitternacht, klingelte das Telefon, und als ich den Hörer abnahm, hörte ich die weinerliche Stimme schon, bevor der Hörer mein Ohr berührte.