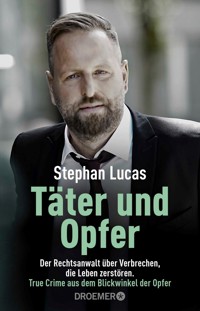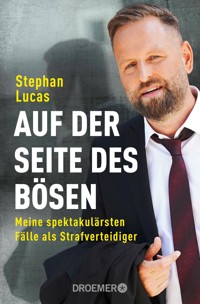
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Stephan Lucas steht auf der Seite des Bösen – denn er ist Strafverteidiger. Seine Fälle zeigen, wie nah das Böse manchmal ist: Da entwickelt sich ein harmloser Streit zum Gewaltverbrechen und ein unbescholtener Familienvater zum Totschläger; eine Mutter wird wegen fahrlässiger Tötung angeklagt, weil sie ein Kind überfahren hat; ein Junge wird mit intimen Fotos erpresst, die er einer Internet-Freundin geschickt hat. In diesen und vielen anderen Fällen streitet der Münchner Strafverteidiger für das Recht der Angeklagten. Und weiß um sein Risiko: "Ich muss damit leben, dass ich möglicherweise dazu beitrage, dass ein skrupelloser Vergewaltiger nach wie vor frei herumläuft."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Stephan Lucas
Auf der Seite des Bösen
Meine spektakulärsten Fälle als Strafverteidiger
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Spannender True Crime – in diesem Fall von Stephan Lucas, einem erfolgreichen Strafverteidiger, der aus dem Fernsehen (Richter Alexander Hold) und von den Kabarettbühnen (Garantiert nicht strafbar) bekannt ist.
Stephan Lucas steht auf der Seite des Bösen – denn er ist Strafverteidiger. Seine Fälle sind ebenso beklemmend wie schockierend, weil sie zeigen, wie nah das Böse manchmal ist: Da entwickelt sich ein harmloser Streit zum Gewaltverbrechen und ein unbescholtener Familienvater zum Totschläger; eine Mutter wird wegen fahrlässiger Tötung angeklagt, weil sie ein Kind überfahren hat; ein Junge wird mit intimen Fotos erpresst, die er einer Internet-Freundin geschickt hat. In diesen und vielen anderen Fällen streitet der Münchner Strafverteidiger für das Recht der Angeklagten. Und weiß um sein Risiko: »Ich muss damit leben, dass ich möglicherweise dazu beigetrage, dass ein skrupelloser Vergewaltiger nach wie vor frei herumläuft.« Diese Offenheit wirft ein neues Licht auf die Arbeit des Strafverteidigers, der weiß, wie es sich anfühlt, in Untersuchungshaft zu sitzen, und sich immer wieder fragt, wie es wohl sein wird, wenn er einem Mörder oder Vergewaltiger zum ersten Mal die Hand schüttelt. Vorurteile sind hier fehl am Platz – denn jeder, auch ein Mörder, hat ein Recht auf einen fairen Prozess. Das ist die Überzeugung von Stephan Lucas, die ihn antreibt, das Beste für seine Mandanten herauszuholen.
Über seine True-Crime-Geschichten urteilte Die Welt: »Seine Fälle fesseln die Leser.«
Inhaltsübersicht
Vorbemerkung
Widmung
Davongerast
Zuhälter im Netz
Hinrichtung eines Kinderschänders
Der Würger vom Freudensee
Papa hat dich lieb
Democlown
Durch Dick- und Dünndarm
Ein Hauch von String
Alles nach Drehbuch
Tausendmal berührt
Nachwort
Dank
Vorbemerkung
Die in diesem Buch geschilderten Fälle spiegeln die Erfahrungen und Erlebnisse des Autors wider. Jedoch wurden Namen und Ortsangaben geändert und Sachverhalte und Dialoge verfremdet, insbesondere um der anwaltlichen Schweigepflicht Rechnung zu tragen. Mag sich also die eine oder andere Begebenheit tatsächlich anders zugetragen haben, so sind doch alle Schilderungen, Vorkommnisse und Dialoge im Buch an die Wirklichkeit angelehnt oder hätten sich so zutragen können.
Meiner Mutter
Renate Rummel-Lucas
(1950–1986)
Davongerast
Der kleine Weg an den Gärten vorbei war für Christina Kluge und ihre fünfjährige Tochter Lisa eine schöne Abkürzung. Nach dem Kindergarten waren die beiden hier immer mit ihren Fahrrädern unterwegs. So brauchten sie zu ihrer Wohnung im Münchner Stadtteil Haidhausen nicht einmal zehn Minuten. Schon seit ihrem dritten Lebensjahr konnte Lisa Fahrrad fahren. Natürlich ohne Stützräder. Heutzutage starten die Kleinen schon im zweiten Lebensjahr mit dem Laufrad. So lernen sie von Anfang an, ihr Gleichgewicht zu halten. Später kommen eben noch zwei Pedale hinzu. Stattdessen Schritt für Schritt erst das eine und dann das andere Stützrad weglassen mag meiner Generation noch bekannt vorkommen, ist aber Schnee von gestern.
An jenem Nachmittag schien die Sonne. Lisa trug ein Sommerkleid mit vielen rosa Stickereien darauf und dazu Ballerinas. Mit ihren langen braunen Haaren sah sie aus wie eine kleine Prinzessin. Das mit der geschlechtsneutralen Erziehung hatten Christina Kluge und ihr Lebensgefährte Marcel Wendenburg schon früh aufgegeben. Kinder haben ihren eigenen Kopf. Und Lisa hatte von klein auf nichts von Blau-, Rot- und Gelbtönen wissen wollen. Auch Autos interessierten sie nicht. Sie spielte lieber mit Puppen, mochte es, sie an- und auszuziehen oder einfach selbst in wunderschöne, meist pinkfarbene Kleider zu schlüpfen. Am liebsten zog sie dann »Hochschuhe« an. So nannte Lisa Mamis High Heels. Ihr »Walk« war definitiv knick- und stolperfrei. Früh übt sich.
Lisa fuhr mit ihrem kleinen Bike neben Mama her. Dabei regte sie sich fürchterlich über ihren Kindergartenfreund Justus auf. Die ganze Zeit hatte er zuvor beim Vater-Mutter-Kind-Spiel herumgealbert. So hatte es ihr keinen Spaß gemacht. »Jetzt sei doch nicht so wütend, Tiger«, rief Christina Kluge ihrer Tochter zu. »Sag mir lieber mal, ob du nachher ein Vanille- oder ein Schokoeis haben magst.« Lisa wollte natürlich Schoko. Voller Vorfreude trat sie kräftig in die Pedale und raste mit Affenzahn voraus. Weiter vorne kam eine Straße, nicht viel befahren, aber ohne Ampel oder Zebrastreifen. Dort wartete Lisa immer brav auf ihre Mutter. Das war der Deal: bloß keine Straße alleine überqueren. Während die Mutter Lisa schmunzelnd nachschaute, überlegte sie, ob sie ihrer Tochter vor dem versprochenen Eis einfach eine Brotzeit auftischen oder vielleicht doch etwas aufwendiger eine Lasagne vorbereiten sollte.
»Lisa?« Warum hielt Lisa nicht an? Da war doch schon die Straße. »Liiii-saaaa!« Die 34-Jährige blieb mit ihrem Rad unwillkürlich stehen und fuhr einen Moment später wie von der Tarantel gestochen wieder los. Dabei brüllte sie unaufhörlich den Namen ihrer Tochter. Aber die reagierte nicht. Im Geschwindigkeitsrausch raste sie geradewegs auf die Straße zu, während Christina Kluge aus voller Kehle nach ihrer Tochter schrie.
Jörg Heinrich kam mit seinem roten Kleinwagen viel zu spät zum Stehen. Es gab einen lauten Schlag. Regungslos blieb er am Steuer sitzen und starrte stumm geradeaus. Er hatte Lisa zunächst nicht kommen sehen. Die Spurenauswertung ergab im Nachhinein, dass er mit einer Geschwindigkeit von 54 km/h unterwegs gewesen war, 4 km/h schneller als auf dieser Straße erlaubt. Mehrere Büsche hatten ihm den Blick auf den Weg zwischen den Gärten versperrt. Als das kleine Mädchen plötzlich wie aus dem Nichts vor seinem Fahrzeug auftauchte, legte er noch eine Vollbremsung hin. Vergebens.
Als Christina Kluge den Zusammenstoß sah, stieg sie eilig ab, warf ihr Fahrrad beiseite und rannte zu ihrer Tochter, die reglos auf der Straße lag. Sie beugte sich über sie, presste den kleinen Körper an sich und rief immer wieder verzweifelt ihren Namen. Jörg Heinrich blieb unterdessen mit unverändert starrem Blick in seinem Auto sitzen. Der Mittvierziger stand offenkundig unter massivem Schock. Mit zittrigen Händen wählte Christina Kluge auf ihrem Smartphone die 112. Sieben Minuten später war der Notarzt vor Ort, kurz danach auch die Polizei. An eine Vernehmung am Unfallort war nicht zu denken – weder die Mutter noch der Fahrer waren ansprechbar. Christina Kluge stieg zu ihrer kleinen Tochter in den Krankenwagen. Die beiden Polizisten fuhren später ebenfalls ins Krankenhaus. Zwei weitere Polizeibeamte, die mittlerweile am Unfallort eingetroffen waren, nahmen kurz die Personalien von Herrn Heinrich auf und fuhren ihn anschließend in ihrem Dienstfahrzeug nach Hause. Um seinen Kleinwagen kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. Das Fahrzeug wurde zu Beweiszwecken sichergestellt.
Noch auf dem Weg ins Krankenhaus erlag Lisa ihren schweren inneren Verletzungen.
Zwei Wochen später saß Christina Kluge bei mir in der Kanzlei. Vier Tage zuvor war ihre Tochter Lisa beerdigt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte nach erfolgter Obduktion den Leichnam des Mädchens freigegeben. Ihr Lebenspartner war zu dem Besprechungstermin nicht mitgekommen. Er hatte nach dem Unfall noch am selben Tag die gemeinsame Altbauwohnung verlassen und war in ein Hotel gezogen. Seither hatte der 42-Jährige seine Frau nicht öfter als unbedingt nötig getroffen, nur zur Vorbereitung der Trauerfeier und schließlich bei der Beerdigung selbst. Die Beisetzung der gemeinsamen Tochter hatte im engsten Familienkreis stattgefunden. Die Eltern von Marcel Wendenburg und sein zwei Jahre älterer Bruder Michael, der nahe Nürnberg lebte, waren aus Hannover angereist. Der Vater von Christina Kluge war seit drei Jahren Witwer. Geschwister gab es auf ihrer Seite keine.
Am Tag des schrecklichen Vorfalls hatte die Polizei Marcel Wendenburg persönlich zu Hause aufgesucht und ihn vom Tod seiner Tochter unterrichtet. Kurz darauf im Krankenhaus war er dann laut brüllend auf seine Freundin losgegangen. Die anwesenden Polizeibeamten hatten sofort eingegriffen und so eine mögliche körperliche Attacke auf die zierliche Frau verhindert. Schließlich hatte er sich wegziehen lassen, aber keine Ruhe gegeben. Lautstark hatte er Christina Kluge vorgeworfen, für den Tod der von beiden so geliebten Tochter verantwortlich zu sein. In seiner Wut hatte er ungeheure körperliche Kräfte freigesetzt. Als die Beamten ihn endlich fest im Griff hatten, war er weinend zusammengebrochen: »Ich will dich nicht mehr sehen. Ich geh. Ich tu’s für Lisa.«
All das erzählte Christina Kluge mir bei unserem Gespräch so genau wie möglich. Nach den ersten Sätzen, die sie mit zittriger Stimme herausgebracht hatte, weinte sie unaufhörlich. Es war unübersehbar, dass die Frau am Ende ihrer Kräfte war. Ich entschuldigte mich für einen Moment und verließ kurz das Besprechungszimmer. Irgendwo mussten in der Kanzlei doch Papiertaschentücher liegen. Leider fand ich keine, und meine Sekretärin war an diesem Nachmittag bereits nach Hause gegangen. So kam ich schließlich mit einer Küchenrolle und einem Glas Wasser zurück. Die Küchentücher waren mir etwas peinlich, aber was spielte das in dieser Situation für eine Rolle. »Dieser Mann, er war zu schnell gefahren.« Christina Kluge klang unfassbar traurig, war aber für einen Moment sehr gefasst. »Herr Lucas, ich möchte wissen, was ich jetzt noch für meine Tochter tun kann. Dazu brauche ich Ihre Hilfe.«
Was sie tun konnte, hatte ich ihr schnell erklärt. Gegen den Fahrer des roten Kleinwagens lief sicher ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung ihrer Tochter, und diesem Verfahren konnte sie sich als Nebenklägerin anschließen. So wäre sie in einem Prozess gegen Herrn Heinrich nicht einfach nur Zeugin, die vor Gericht den schrecklichen Unfall würde schildern müssen, sondern sie hätte auch eigene Rechte. Als Nebenklägerin würde sie im Prozess selbst Anträge stellen, Fragen an den Angeklagten und die weiteren Zeugen richten, Erklärungen abgeben und am Ende ein eigenes Plädoyer halten können. Dass sie dies alles nicht alleine schultern, sondern sich dabei anwaltlich vertreten lassen wollte, war vernünftig. Und für mich war es keine Frage, dass ich sie unterstützen würde.
Auch wenn ich in den meisten Fällen als Verteidiger auf der Seite des Bösen stehe, ist es für mich als Anwalt eine Selbstverständlichkeit, mich immer wieder auch für die andere Seite, die Seite der Opfer starkzumachen. Es hilft mir, nicht lediglich den juristischen Sachverhalt, sondern das wahre Leben dahinter zu erfassen und mir im Besonderen bewusst zu machen, dass jedem juristischen Streit tatsächliche, bisweilen tragische menschliche Schicksale zugrunde liegen. Diesen sollte ein Verteidiger mit dem notwendigen Respekt und Anstand begegnen, was nicht bedeutet, hierdurch den Kampf für die Rechte des Angeklagten zu vernachlässigen – im Gegenteil. Mancher Richter wird eher zum Zuhören und Verstehen geneigt sein, wenn im Prozess die Achtung vor den Geschädigten für alle spürbar ist.
An dem Tag unserer ersten Besprechung war es noch viel zu früh, um eine Prozessstrategie für meine neue Mandantin festzulegen. Was Frau Kluge sich als Nebenklägerin am Ende wirklich vom Strafverfahren erhoffen würde, war erfahrungsgemäß noch gar nicht einschätzbar. Auffallend selten wollen Opfer oder deren Hinterbliebene am Ende tatsächlich Vergeltung; jedenfalls steht ein solches Ansinnen fast nie an erster Stelle. Die Höhe der Strafe, die gegen den Täter verhängt wird, ist meist nicht entscheidend. Vielen Opfern und Hinterbliebenen geht es um Schadenersatz oder Schmerzensgeld. Und noch öfter steht die eigentliche Aufklärung der Straftat im Vordergrund. Bei einem Verkehrsunfall mag das noch relativ leicht sein; bei vorsätzlichen Taten wie Totschlag, Mord, Raubüberfällen oder Vergewaltigungen hingegen stehen Opfer oder Hinterbliebene vor vielen Fragezeichen.
Gerade Angehörige möchten in den meisten Fällen verstehen können, wie es zu der Tat gekommen ist, was im Kopf des Täters vorgegangen ist und im Nachhinein noch immer vorgehen mag. Manche hoffen sehnlichst, so künftig besser mit dem Geschehenen umgehen und irgendwann vielleicht sogar damit abschließen zu können. Tatsächlich mache ich oft die Erfahrung, dass eine engagierte und auf die Opferinteressen genau abgestimmte Nebenklage dabei hilfreich sein kann – mehr aber auch nicht. Die wenigsten Eltern können den gewaltsamen Tod ihres Kindes je begreifen und etwa zu einem Schlussstrich finden. Der Schmerz wird für immer bleiben. Allenfalls können sie lernen, ihn auszuhalten und mit ihm zu leben. Und jeder geht anders damit um. Gerade deshalb war es auch im Fall von Christina Kluge so wichtig, ihr Zeit zu geben. Nicht nur an diesem Tag, sondern auch im nächsten Gespräch und in weiteren noch folgenden Unterredungen. Ich würde mich langsam mit ihr an ihre Sorgen und Bedürfnisse herantasten und diese gemeinsam mit ihr ausloten, um auf diese Weise eine exakt auf sie abgestimmte Prozesslinie ausarbeiten zu können.
»Ganz gleich, was man diesem Mann am Ende vorwerfen und welche Strafe er mal bekommen wird: Es wird mich niemals beruhigen können«, sagte meine Mandantin, und mit Tränen in den Augen fuhr sie fort: »Jede Sekunde werfe ich mir vor, dass ich das alles hätte verhindern können – nein: müssen. Ich. Lisas Mama.« Christina Kluge wirkte unglaublich geschwächt. Die schulterlangen dunkelbraunen Haare ließen sie dabei noch blasser wirken, als sie es ohnehin schon war. Nächtelang wird sie wohl kein Auge zugetan haben.
Ich hörte ihr einfach nur zu. Auch das gehört zu meinem Beruf. Zuhören können, Menschen beruhigen, sie auch mal in den Arm nehmen. Ich bin kein Psychologe. Ich bin Jurist. Vor allem aber bin ich ein Mensch. Natürlich dürfen die Mandanten von mir erwarten, dass ich als Profi mit genügend Abstand die Sachverhalte, um die es geht, ganz nüchtern für sie juristisch aufarbeite und einschätze. Nur so kann ich als Verteidiger wie auch Nebenklägervertreter zu einer idealen Verfahrensstrategie gelangen. Doch sind all die Sachverhalte, mit denen mich meine Mandanten konfrontieren, zunächst einmal vor allem solche aus dem tatsächlichen Leben. Und niemand mag mir verdenken, dass ich sie zunächst einmal ganz genau so auffasse, nämlich als reale persönliche Erlebnisse und Schicksale. Und ich reagiere darauf, wie ich als Mensch reagieren möchte: mit viel Empathie.
»Ich weiß nicht, wie oft ich mir in den letzten Tagen Fotos von meiner Kleinen angeschaut habe«, fuhr Christina Kluge fort. »Manchmal kann ich nicht einmal weinen. Ich bin wie taub, denke, vielleicht ist meine Lisa ja noch am Leben. Und dann bettele ich darum, Lisa nur noch ein einziges Mal streicheln, sie sehen und sie riechen zu dürfen.«
Solche Sätze lassen mich auch nach meiner mehr als zwanzigjährigen Berufserfahrung nicht kalt. Es ist nicht aushaltbar traurig, was diese Frau Schreckliches erleben musste und welch einen harten Weg sie künftig noch vor sich haben wird. Unendliche Trauer gilt es zu bewältigen und die eigenen, völlig unjuristischen Vorwürfe gegen sich selbst zu ertragen und auszuhalten. Man mag in der Situation meiner Mandantin das Wort »hätte« geradezu verfluchen. Ein »hätte« bringt einen nicht nach vorne, ein »hätte« lässt sich aber auch nicht so einfach abstreifen.
Christina Kluge fühlte sich für den Tod ihrer Tochter persönlich verantwortlich. Sie wusste für sich, dass sie ihn objektiv »hätte« vermeiden können. Und sie hatte auch eine Vorstellung davon, wie das möglich gewesen wäre. Es geht dabei nicht in erster Linie um den Vorwurf, womöglich etwas falsch gemacht zu haben, sondern darum, es nicht einfach anders gemacht zu haben. Es geht um das, was man »hätte« anders tun können. Und diese Vorstellung schleicht sich immer wieder hinterhältig an, nachts in den Träumen, tagsüber in Gesprächen mit anderen. Und selbst wenn es Christina Kluge irgendwann gelingen sollte, sich nicht jedes Mal von Neuem mit theoretischen Alternativsachverhalten auseinanderzusetzen und sich mit schwersten Selbstvorwürfen zu quälen, so blieb da immer noch der Vater von Lisa. Und der würde mit seinem vernichtenden Urteil über sie wohl auch in Zukunft gnadenlos bleiben. Voller Wut und Verzweiflung, weil er zum Zeitpunkt des Unfalls nicht da gewesen war und nicht hatte einschreiten können, warf er seiner ehemaligen Freundin nun fast ohnmächtig all das vor, womit sie sich ohnehin schon selbst seelisch kaputtmachte, nämlich, dass sie sich anders »hätte« verhalten können und müssen. Wie sollte dieser ebenfalls von Herzen trauernde Mann jemals in der Lage sein, sich solche Vorwürfe gegen die Mutter aus tiefster Überzeugung für immer zu verbieten, wenn doch nicht einmal sie selbst es konnte?
Die Beziehung der beiden war bis zum Tod der gemeinsamen Tochter intakt gewesen. Sie hatten sich neun Jahre zuvor in München im Café Reitschule kennengelernt. Zwei, wie man es neudeutsch nennen mag, stylische Typen – als Paar hübsch anzusehen. Die Hochzeit hatten sie immer wieder hinausgezögert. Auch ein zweites Kind hatten sie eigentlich immer haben wollen, waren das Thema bislang aber wenig ambitioniert angegangen. Alles war bereits mit dem einen Kind so viel schwerer geworden. Waren sie früher an den meisten Tagen in der Woche mal gemeinsam, mal getrennt ausgegangen, wurde mit der Geburt der Tochter ihr, wie sie es immer genannt hatten, »gemeinsam egoistisches Leben« total auf den Kopf gestellt. Vor allem waren sie nun ständig zu Hause – und gingen sich bisweilen gehörig auf den Geist. Es ist das Schicksal vieler zugereister Eltern in München, dass die eigenen Eltern irgendwo weit weg wohnen. Geeignete Babysitter sind schwer zu finden und teuer; und wohl niemand möchte sein geliebtes Kind einfach dem Nächstbesten anvertrauen.
Christina Kluge und Marcel Wendenburg waren sich aber immer einig gewesen, dass das nur eine Phase sein würde, die sie im Nachhinein aber möglicherweise viel zu lange sehenden Auges hatten laufen lassen. Den Tod der gemeinsamen Tochter würde diese Beziehung jedenfalls kaum aushalten können. Das, was eine gute Partnerschaft im Falle schlimmer Schicksalsschläge normalerweise leisten sollte, nämlich für den anderen da zu sein, ist beim Verlust eines Kindes meist für die beiden Lebenspartner nicht umsetzbar. Wie auch? Sorgen zu teilen, das ist für die meisten spätestens dann schier unmöglich, wenn die Trauer des Partners auch die eigene ist. Beide leiden dann gleichermaßen und doch verschieden. Sie erleben das gemeinsame Schicksal aus unterschiedlicher Warte. Der Tod des eigenen Kindes ist unüberwindbar – und trotzdem muss das Leben irgendwann irgendwie weitergehen. Gemeinsam wird es aber so nicht klappen können. Ausgerechnet der letzte Halt, mit dem in solch tragischen Momenten der eine Partner dem anderen einen Funken Hoffnung spenden könnte, bricht plötzlich einfach so weg. Die Kluft, die Marcel Wendenburg mit seiner heftigen und anhaltenden Reaktion gegenüber seiner Frau aufgemacht hatte, würde nicht mehr zu überbrücken sein, mochte die Entfremdung und bereits vollzogene Trennung auch ganz sicher das Letzte sein, was im Sinne des verstorbenen Töchterchens gewesen wäre. »Und was mir die Kehle für immer zuschnürt, Herr Lucas: Ich konnte mich von meinem kleinen Engel nicht mal verabschieden.«
Nachdem Christina Kluge gegangen war, setzte ich mich sofort an den Schreibtisch und bereitete den Antrag vor, meine Mandantin in dem Verfahren gegen Jörg Heinrich als Nebenklägerin zuzulassen. Am nächsten Tag würde ich zunächst telefonisch abklären, ob die Sache überhaupt noch der Polizei oder bereits der Staatsanwaltschaft vorlag. Auch benötigte ich noch das Aktenzeichen. Zu dem geplanten Telefonat kam es jedoch nicht. Mein Schreiben sollte die Kanzlei nie verlassen.
Ein morgendlicher Anruf meiner Mandantin kam dem zuvor. Völlig aufgelöst meldete sich Christina Kluge auf meinem Handy: »Herr Lucas, ich war eben am Briefkasten. Die Polizei hat mich zur Vernehmung geladen. Nicht als Zeugin – als Beschuldigte!«
Meiner Mandantin wurde tatsächlich vorgeworfen, ihre Tochter Lisa fahrlässig getötet zu haben. Hatte ich mich eben noch für sie als Nebenklägervertreter bestellen wollen, so war ich in diesem Verfahren auf einmal nicht mehr Opferanwalt, sondern befand mich als Verteidiger auf der Seite des Bösen. Mit dieser Wendung um 180 Grad hatte ich im Traum nicht gerechnet. Erst recht musste das Christina Kluge völlig unvorbereitet getroffen haben. Jetzt galt es, sie dringend zu beruhigen. »Wenn Sie möchten, sehen wir uns gleich in meinem Büro.«
Laut polizeilicher Ladung sollte die Vernehmung drei Tage später stattfinden. »Herr Lucas, ich geh da nicht hin.« Nichts anderes hatte ich ihr raten wollen. Erst einmal musste ich Akteneinsicht nehmen. Wie konnten die Ermittler zu dem Schluss kommen, dass nicht Jörg Heinrich, sondern Lisas Mama für den Tod des Kindes strafrechtlich verantwortlich sein sollte? Da war es nur ein schwacher Trost, dass sie als Beschuldigte der polizeilichen Ladung keine Folge leisten, geschweige denn eine Aussage machen musste.
Galt noch bis Ende 2017, dass nicht nur der Beschuldigte, sondern auch jeder Zeuge eine polizeiliche Ladung ignorieren durfte, so hat sich die Gesetzeslage mittlerweile entscheidend geändert. Zeugen müssen seither bei einer polizeilichen Ladung, die im Auftrag der Staatsanwaltschaft erfolgt, zur Vernehmung erscheinen und der Polizei Rede und Antwort stehen. Schweigen dürfen sie nur dann, wenn sie entweder mit dem Beschuldigten verwandt oder verschwägert sind, oder wenn sie sich im Falle einer Aussage selbst belasten müssten. Verwandt bzw. verschwägert sind die Eltern, die eigenen Kinder, die Geschwister, die Großeltern und außerdem alle Schwägerinnen und Schwager und Schwippschwägerinnen und Schwippschwager, außerdem Ehegatten und Lebenspartner und Verlobte. Ob die Zeugin, die behauptet, mit dem Beschuldigten verlobt zu sein, tatsächlich verlobt ist, darüber wird bei der Polizei dann oft trefflich gestritten. Denn ein solches Eheversprechen wird manchen Strafverfolgern bisweilen etwas zu plötzlich aus dem Hut gezaubert. An sich – so ist es nun mal – reicht für eine Verlobung nämlich das bloße ernst gemeinte gegenseitige Versprechen, einander heiraten zu wollen. Dazu braucht es keine traditionelle Verlobungsfeier, nicht einmal einen Verlobungsring. Das gegenseitige Heiratsversprechen können sich die Partner auch unter Ausschluss jeder Öffentlichkeit beim gemeinsamen Abendessen geben oder kurz vorm Einschlafen, bei einem romantischen Spaziergang oder während einer rauschenden Fahrt in der Achterbahn. Die Polizei mag dann bisweilen resigniert äußern: »Kann ja jeder behaupten …« Und da ist natürlich auch was dran, hilft aber nichts.
Mit Gegenwind muss auch der Zeuge rechnen, der bei der Polizei alleine deshalb nichts sagen will, weil er sich nach seiner eigenen Einschätzung anderenfalls selbst belasten würde. Mancher Ermittler versucht die Bedenken ganz salopp vom Tisch zu wischen: »Wenn du – Polizisten duzen gerne! – nichts Strafbares gemacht hast, dann kann dir auch nichts passieren, und du musst reden.« Doch ganz so einfach ist es zum Glück nicht. Würde nur derjenige schweigen dürfen, der tatsächlich was Unrechtes getan hat, dann wäre ja immer automatisch klar, dass der, der von seinem Schweigerecht Gebrauch macht, etwas zu verbergen hat. Das kann es natürlich nicht sein. Und das Gesetz liest sich bei genauerem Studium auch anders: Es genügt für das sogenannte Auskunftsverweigerungsrecht bereits, dass ein Zeuge sich bei einer Aussage der bloßen Gefahr aussetzen könnte, sich verdächtig zu machen, selbst wenn er tatsächlich gar nichts Strafbares getan hat. Und eine solche Gefahr besteht schneller, als mancher denken wird. Bei einem Drogendelikt beispielsweise könnte der Zeuge sich schon dann verdächtig machen, wenn er wahrheitsgemäß zugeben müsste, den mutmaßlichen Dealer überhaupt zu kennen – woher auch immer. Also muss er dazu gar nichts sagen.
Die Beschuldigtenvernehmung von Christina Kluge sagte ich mit einem Einzeiler an die Polizei ab. Damit war der Termin zwar hinfällig, nur konnte das meine Mandantin nicht sonderlich beruhigen: »Herr Lucas, was wollen die bloß von mir?«
Die Antwort darauf gab es zwei Monate später in Form einer Anklageschrift. Darin warf die Staatsanwaltschaft Christina Kluge vor, zum Zeitpunkt des tragischen Unfalls ihre Sorgfaltspflicht verletzt und dadurch das für sie Vorhersehbare und Vermeidbare verursacht zu haben. Demzufolge hätte sie ihre fünfjährige Tochter nicht alleine mit dem Fahrrad vorausfahren lassen dürfen, weil das fahrlässig war. So sah es jedenfalls die Staatsanwältin.
Der Vorwurf der Fahrlässigkeit hat etwas Perverses. Im Strafrecht ist meist nur vorsätzliches Handeln strafbar. Der Täter muss – salopp ausgedrückt – die von ihm begangene Straftat persönlich gewollt haben. Bei einigen Delikten wie Körperverletzung und Tötung kann man sich allerdings ausnahmsweise auch dann strafbar machen, wenn man die Tat zwar nicht gewollt hat, sie jedoch hat vorhersehen und vermeiden können. Der Jurist spricht dann von Fahrlässigkeit. Und vor ihr ist niemand gefeit, ganz gleich, wie erfolgreich er sich bislang um Rechtstreue bemüht haben mag. Denn bei Fahrlässigkeitstaten werden solche Verhaltensweisen unter Strafe gestellt, die für sich genommen oft total harmlos und vor allem noch dazu in vielen Fällen erlaubt sind. Sie werden erst dann strafbar, wenn durch sie etwas Schlimmes passiert – etwas, was der Täter aber niemals mit seinem Verhalten hatte bewirken wollen. Wie der Autofahrer, der unachtsam die Tür öffnet und den vorbeifahrenden Radfahrer dadurch zu Fall bringt. Oder die Frau, die es sich abends auf der Couch gemütlich macht, eine Kerze anzündet – und sich, als sie wach wird, gerade noch aus der brennenden Wohnung retten kann. Je nach Schwere der Folgen begleiten die Selbstvorwürfe solche Menschen oft ein Leben lang. Und – quasi on top – werden sie auch noch als Straftäter kriminalisiert. Auch wenn es sich bei den Strafen meist um Geld- oder Bewährungsstrafen handelt – es sind nun mal Strafen nach dem Strafgesetzbuch.
Aber wie konnte die Staatsanwältin hier bloß ein fahrlässiges Verhalten von Lisas Mutter annehmen? Was war mit dem Fahrer des roten Kleinwagens? War nicht er es, der hier fahrlässig gehandelt hatte, indem er zur Tatzeit ganz einfach zu schnell unterwegs gewesen war? Und ich meine nicht nur die 4 km/h, um die er die Höchstgeschwindigkeit überschritten hatte; das war genau genommen nicht der Rede wert. Wie das Wort »Höchstgeschwindigkeit« jedoch unmissverständlich ausdrückt, setzt sie eine Grenze nach oben, nicht nach unten. So zwingen spielende Kinder am Straßenrand zu einer drastischen Reduzierung der Geschwindigkeit: Ein Autofahrer muss eben jederzeit damit rechnen, dass eines dieser Kinder unvermittelt auf die Fahrbahn laufen könnte. Und auch wenn keine Kinder zu sehen sein mögen, können parkende Autos am Straßenrand die Sicht verdecken und die Gefahr in sich bergen, dass Autofahrer ein plötzlich auftauchendes Kind viel zu spät sehen. Also runter vom Gas!
Im Fall von Lisa waren es keine Autos, sondern Bäume und dichte Büsche, die die Sicht auf den Weg, den das Kind mit seiner Mutter genommen hatte, behinderten. Herr Heinrich hätte deshalb womöglich viel langsamer fahren müssen als die erlaubte Höchstgeschwindigkeit, um dieser Verkehrssituation gerecht zu werden. So hätte Lisas Tod verhindert werden können. Und selbst wenn man ihm sein Fahrverhalten nicht vorwerfen wollte – wie kam hier stattdessen bloß meine Mandantin als Täterin ins Spiel? Ich verstand die Welt nicht mehr.
Bisweilen kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass manche Posten in der Justiz von zwar sehr tüchtigen, allerdings lebensfremden Kolleginnen und Kollegen besetzt werden. Und das kann in Strafsachen schnell fatale Folgen haben. Der Staat nimmt für seine Posten in der Justiz nur die Besten, also die mit den besten Noten. Und vor lauter Fleiß werden so manche von ihnen während des Studiums womöglich herzlich wenig vom Leben um sie herum mitbekommen haben. Denn nur wenigen ist es vergönnt, in der Ausbildung vor allem das Leben und die Gesellschaft zu studieren und dennoch Topnoten zu erzielen. Und schafft der eine oder andere diesen Spagat tatsächlich, dann wird er sich nicht immer für eine Laufbahn beim Staat entscheiden – leider.
Vielleicht hatte die sachbearbeitende Staatsanwältin den Fall aber auch einfach noch nicht in all seinen Facetten umrissen? In dieser Annahme hatte ich noch vor Erhebung der Anklage beantragt, das Verfahren gegen Christina Kluge einzustellen und stattdessen Ermittlungen gegen Herrn Heinrich aufzunehmen. Ausführlich hatte ich in meinem Schriftsatz dargestellt, weshalb meine Mandantin hier keine Sorgfaltspflichtverletzung begangen haben konnte. Dafür hatte ich mich in die schier uferlose Fachliteratur eingelesen und Erziehungsratgeber gewälzt. »Loslassen können« war der Tenor dieser Schriften. Ein Zögling im fortgeschrittenen Kindergartenalter müsse im Straßenverkehr nicht mehr prinzipiell an die Hand genommen werden, er dürfe sich von den Eltern hier und da entfernen, auch mal vorausgehen oder zurückbleiben. Wichtig sei es, zunächst für das Kind eine Routine entstehen zu lassen, indem die Erziehenden ihm das richtige Verhalten vorlebten und es mit ihm immer wieder besprächen und reflektierten. Das überzeugte mich. Doch welcher Autor wollte sich schon gerne in die Pflicht nehmen lassen? Gebetsmühlenartig wurde am Schluss sinngemäß dieser eine, alles relativierende Satz angefügt: »Natürlich lässt sich keine allgemeine Regel aufstellen. Eltern spüren am besten, wie weit ihr Kind schon ist und was ihm zugetraut werden kann.« Na, prima – danke für diese klare Position!
Hilfsweise beantragte ich daher, das Verfahren gegen Christina Kluge – wenn schon nicht wegen erwiesener Unschuld, dann doch wenigstens wegen geringer Schuld – einzustellen, meinetwegen auch gegen eine geeignete Auflage, beispielsweise die Zahlung eines kleinen Geldbetrags für einen guten Zweck. Dass meine Anträge leider nicht gefruchtet hatten, erfuhr ich nun mit dem Eingang der Anklage. Ob meine Mandantin für ihr Verhalten – oder besser gesagt: ihre Untätigkeit – zu bestrafen sein würde, sollte also erst im Rahmen einer Hauptverhandlung beim Amtsgericht geklärt werden. Ein Aktenvermerk in der Ermittlungsakte verriet außerdem, weshalb es nie zu einem Verfahren gegen Jörg Heinrich gekommen war: Die Staatsanwaltschaft hatte die Situation mit den Büschen nicht mit einer Sichtbehinderung durch parkende Autos gleichsetzen wollen. Der hinter dem Buschwerk versteckte Weg sei für den Fahrer des Kleinwagens im Zweifel nicht rechtzeitig erkennbar gewesen. Dass er sein Tempo der vorgesehenen Höchstgeschwindigkeit weitgehend angepasst hatte, sei daher Ausdruck korrekten Fahrverhaltens gewesen.
Und es kam für meine Mandantin noch dicker. Zwischenzeitlich hatte sich in dem nun gegen sie geführten Verfahren doch tatsächlich ihr Ex-Lebensgefährte Marcel Wendenburg seinerseits als Nebenkläger gemeldet. Als hinterbliebener Vater von Lisa hatte er dieses Recht. Er wollte in dieser Strafsache nun also genau diejenige Rolle einnehmen, die ursprünglich meine Mandantin von Herzen gerne hätte spielen wollen – in einem Verfahren gegen den Fahrer des Unglücksautos. Und nun war auf einmal alles anders. Nach dem Willen der Staatsanwaltschaft würde im anstehenden Prozess nicht der Fahrer des roten Kleinwagens, sondern meine Mandantin auf der Anklagebank sitzen, während ihr Ex als Nebenkläger aktiv gegen sie vorgehen würde.
Sieben Monate nach dem tragischen Tod der kleinen Lisa rief der Vorsitzende Richter um 9 Uhr in Saal 125 des Münchner Strafjustizzentrums die Strafsache Kluge auf. Der Zuschauerraum war bis auf den letzten Stuhl voll besetzt. In der ersten Reihe saßen Journalisten aus ganz Deutschland. Der Fall hatte bereits im Vorfeld viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen: in den Printmedien und in den sozialen Netzwerken. Was hatten die Mitmenschen meine Mandantin bereits öffentlich angeprangert, sich das Maul zerrissen, es besser gewusst! Auffallend oft redeten Menschen mit, die selbst gar keine Kinder hatten. Die mussten es ja – ironisch gesagt – am besten wissen, weil bei ihnen keine eigenen Erfahrungen unnötig den objektiven Blick auf das Thema verzerren konnten.
Befeuert wurden die seit Monaten anhaltenden Diskussionen in den sozialen Netzwerken zu allem Überfluss noch durch einen zuvor schon bundesweit veröffentlichten Printartikel mit der Überschrift: »Mutter lässt ihre fünfjährige Tochter in den Tod rasen.« Stimmungsmache vom Feinsten. Und die Reaktionen im Netz waren gnadenlos: »Hoffentlich kriegt diese Frau niemals mehr Kinder.« – »Zwangssterilisation!« – »Ab heute bin ich für die Todesstrafe« – »In der Hölle soll sie schmoren!« – »Hat diese Mutter denn kein Herz?«
Doch, sie hatte ein Herz. Und zwar ein ebenso großes wie gebrochenes. Aber wen von diesen schamlosen Besserwissern interessierte das schon? Als Jurist konnte ich mich damit arrangieren, dass die Sache mit Blick auf unser Strafgesetzbuch aufzuklären war. Mir war bewusst, dass moralische oder ethische Ansätze für sich alleine die ganze Angelegenheit nicht straflos machen konnten; sie würden aber sehr wohl bei der Frage der Strafzumessung eine wesentliche Rolle spielen. Doch das interessierte die Menschen im Netz nicht. In den neuen Medien lassen sie aus ihrer Anonymität heraus – mit Verlaub – gerne die Sau raus. Das kannten wir vor dem Aufkommen des Internets allenfalls aus dem Straßenverkehr. Umgeben von einem sicheren Blechkokon wüteten die Menschen da schon immer gerne aufs Extremste. Anders als im Straßenverkehr verwischen die Spuren im Internet nur leider nicht.
Daher musste Christina Kluge nun schon seit vielen Monaten all diese Tiraden aushalten. Und die kamen von allen Seiten. Es nutzte auch nichts, den Computer einfach nicht mehr hochzufahren. Die Leute schienen alle Bescheid zu wissen – vor ihrer Haustür, am Arbeitsplatz. Was half es da, dass sie von Gesetzes wegen bis zu einer etwaigen rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig galt?
Christina Kluge arbeitete als Assistentin der Geschäftsleitung bei einer der vier großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. 2300 Mitarbeiter in einem einzigen Gebäude. Wohl nirgends sonst konnte sich ihre Geschichte schneller verbreiten und regelmäßig zum Pausenthema einer jeden Abteilung gemacht werden. Wem konnte meine Mandantin noch vertrauen? Wem sich anvertrauen? Zu ihrem Papa hatte sie ein unterkühltes Verhältnis. Über persönliche Probleme hatte sie mit ihm nie zuvor gesprochen. Als Kind hatte sie ihn kaum zu Gesicht bekommen. Er hatte immer viel gearbeitet, die Erziehung war Sache ihrer Mutter gewesen. Und die hatte sie geliebt. Vor drei Jahren war Gerda Kluge jedoch an einer Hirnblutung gestorben. Sie war gerade auf dem Weg von der Küche ins Esszimmer gewesen und hatte das Essen reinbringen wollen, als sie plötzlich zusammenbrach.
Seit Lisas Tod war Christina Kluge sehr einsam und alleine. Trotzdem musste sie dem gesellschaftlichen, dem strafrechtlichen und dem selbst auferlegten Druck irgendwie standhalten – so nun auch im Sitzungssaal. Ihr gegenüber saßen die Staatsanwältin, die sie angeklagt hatte, der Nebenkläger, der in exakt dasselbe Horn blies, und vorne der Richter, der sie aller Voraussicht nach verurteilen würde. Und hinten im Saal hatten sich die sogenannte Öffentlichkeit und die Presse versammelt – all diejenigen also, die ihr neben dem Strafverfahren ihr Leben seit Monaten so verdammt schwer und unerträglich gemacht hatten. Und dann war da eben noch meine Person, Christina Kluges Verteidiger. Auf mich konnte sie sich verlassen. Bei mir konnte sie schon qua Gesetz sicher sein, dass ich mein ganzes Wissen über sie nicht gegen sie verwenden, dass ich nicht über sie herziehen würde, sondern – im Gegenteil – dass ich bedingungslos für ihre Rechte kämpfen würde.
Zu Beginn der Hauptverhandlung musste meine Mandantin ihre Personalien angeben, bevor danach die Staatsanwältin die Anklageschrift verlas. Es ist immer derselbe schematische Ablauf, wie ihn die Strafprozessordnung vorsieht. Der Vorsitzende Richter wies meine Mandantin schließlich darauf hin, dass sie das Recht habe, sich zur Sache zu äußern, und dass sie auch schweigen dürfe. Ich ergriff für sie das Wort.
Wie schon zuvor in meinem Schriftsatz an die Staatsanwaltschaft, mit welchem ich die Einstellung des Verfahrens beantragt hatte, machte ich wieder Ausführungen zur Sorgfaltspflicht, die meine Mandantin bei der Beaufsichtigung ihrer Tochter nicht oder allenfalls geringfügig verletzt habe. Dass der Richter aufmerksam zuzuhören schien, ermutigte mich: Auch in der Verhandlung könnte er mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft das Verfahren noch einstellen. Es wäre ein toller Erfolg, wenn das Verfahren auf diese Weise abgekürzt werden könnte und meine Mandantin so doch noch straffrei aus der Sache herausgehen würde. Allerdings hatte ich die Prozessstimmung leider falsch eingeschätzt. Im Anschluss an meine Ausführungen fragte der Vorsitzende nur trocken: »Sind Sie fertig, Herr Verteidiger?« Ich nickte freundlich. »Dann hören wir jetzt zunächst Herrn Heinrich, den Fahrer des Unfallfahrzeugs.«
Moment mal, hatte ich da etwas verpasst? Er wollte den Zeugen vernehmen? Erst mal war doch noch meine Mandantin an der Reihe! Als Angeklagte hatte sie schließlich das Recht, sich zur Sache einzulassen. So wie es der Richter selbst ihr zuvor ja auch richtig erklärt hatte. Und genau das hatte sie vor: Sie wollte Angaben zu dem Vorfall machen. Als ich das Wort ergriff, um den Vorsitzenden darauf hinzuweisen, fuhr der mir jedoch barsch über den Mund: »Sie sind jetzt nicht dran, Herr Verteidiger. Ich habe die Prozessleitung.«
»Das weiß ich doch«, erwiderte ich immer noch freundlich. »Und aus der Strafprozessordnung weiß ich auch, dass jetzt erst einmal meine Mandantin an der Reihe ist. Sie möchte sich zum Tatvorwurf äußern.«
Es interessierte den Richter offensichtlich nicht. »Das kann sie später tun. Und wenn Sie jetzt nicht Ihren Mund schließen, dann ergreife ich gegen Sie und Ihre Mandantin Ordnungsmaßnahmen.«
Wie bitte? Ich konnte nicht verstehen, was da gerade passierte. Das Gesetz sieht prozessual keine zulässigen Ordnungsmaßnahmen gegen Verteidiger vor. Allenfalls gegen die Angeklagte. Nur: Was sollte meine Mandantin bislang falsch gemacht haben? Sie hatte doch bisher nur still neben mir gesessen, bis auf ihre Personalien kein Wort von sich gegeben und ansonsten stumm darauf gewartet, endlich reden zu dürfen. Mein möglicherweise etwas unbequemes Verhalten konnte ihr nach keiner denkbaren Regel der Kunst angelastet werden. Dieser Richter hatte ganz eindeutig etwas gegen mich oder gegen die Mandantin oder gleich gegen uns beide. Hätte ich über seine forschen Sprüche vielleicht noch hinwegsehen können, so konnte ich jedenfalls nicht hinnehmen, dass meiner Mandantin einfach das Wort verwehrt wurde. Also beantragte ich, die Hauptverhandlung für ein »unverzügliches« Gesuch zu unterbrechen. Der Richter wusste, was damit gemeint war: Ich wollte mit der Mandantin die Möglichkeiten eines Ablehnungsgesuchs wegen Befangenheit des Richters besprechen. Wenn Anlass für die Vermutung besteht, dass der Richter voreingenommen ist, dann müssen Angeklagter und Verteidiger sofort reagieren, da duldet das Gesetz keinen Aufschub. Ein solches Gesuch muss sofort oder eben, juristisch ausgedrückt, »unverzüglich« vorgetragen werden.
»Jetzt nicht, Herr Verteidiger.« Bitte, wie? In solchen Momenten stoße selbst ich noch an Grenzen. Ich brauchte die beantragte Unterbrechung jetzt in diesem Moment, wenn ich nicht riskieren wollte, dass mir die Frist kaputtgeht. Und einfach den Prozess weiterlaufen lassen, das ging nun beim besten Willen nicht mehr. Welches Ergebnis hätte meine Mandantin bei diesem Richter zu erwarten? Er war offenkundig nicht bereit, unseren Argumenten für einen Freispruch Aufmerksamkeit zu schenken.
Also sagte ich noch einmal laut und deutlich: «Wir benötigen eine Unterbrechung – jetzt!« Als der Richter auch diesen Satz ignorierte und sich stattdessen an die Protokollführerin wandte und übertrieben freundlich sagte: »Bitte rufen Sie nun den Zeugen herein!«, musste ich handeln. Ich entschied – vielleicht etwas unkonventionell –, einfach unaufhörlich und lautstark weiter zu sprechen. Ich ratterte alle meine Überlegungen zum Befangenheitsgesuch mit laut erhobener Stimme runter, bis der Richter dem schließlich brüllend ein Ende setzte und eine 15-minütige Unterbrechung der Sitzung anordnete: »In dieser Zeit beruhigen sich jetzt gefälligst alle wieder!« Meinte er sich oder mich oder uns beide?
Eines war jedenfalls klar: Der Prozess hätte schlimmer nicht laufen können. Ich setzte mich an meinen Befangenheitsantrag und sortierte die einzelnen Argumente für eine Voreingenommenheit, die der Richter an diesem Morgen mit seinem Verhalten geliefert hatte.
Exakt nach 15 Minuten betrat er wieder den Saal: »Die Hauptverhandlung wird unterbrochen und ein Fortsetzungstermin von Amts wegen bestimmt.« Das hieß, für diesen Tag konnten wir nach Hause gehen, und das war erst einmal gut so. Denn heute wäre hier eindeutig nichts mehr zu retten gewesen. Jetzt konnte ich mein Befangenheitsgesuch in aller Ruhe in der Kanzlei fertigstellen und dann an das Gericht faxen.
Mit etwas mehr Abstand konnte ich das zuvor Geschehene noch weit weniger begreifen. Was hatte den Vorsitzenden bloß geritten? Er hatte mit seinem Verhalten eklatant gegen bestehende Verfahrensrechte verstoßen: Die Angeklagte nicht zu Wort kommen zu lassen und Ordnungsmaßnahmen gegen den Verteidiger anzukündigen, das war indiskutabel. Ich war gespannt auf die Stellungnahme, die der Richter selbst zu dem Antrag abgeben würde. Die ging noch am selben Tag per Fax bei mir ein: »Ich fühle mich in der Sache befangen.« Und zur Begründung: »Als der Verteidiger Stephan Lucas den Sitzungssaal betrat, erzeugte das bei mir eine Stimmung, die mich nicht mehr unvoreingenommen den Prozess führen ließ.«
Ich war baff. In meinem Verteidigerleben hatte ich bestimmt schon 200 Befangenheitsgesuche gestellt. Nur wenige waren erfolgreich gewesen, was aber nicht weiter schlimm war: Auch zurückgewiesene Befangenheitsgesuche erfüllen regelmäßig ihren Zweck. Sie sprechen einem Richter genau genommen seine Daseinsberechtigung ab, nämlich unabhängig und unvoreingenommen über einen Sachverhalt urteilen zu können. Dass ein Richter seine mangelnde Neutralität meist nicht zuzugeben bereit ist, liegt auf der Hand – es gehört zu seinem Selbstverständnis, dass er sich die Unparteilichkeit gewissermaßen mit der Robe überstreift. Treffen die im Antrag vorgetragenen Fakten allerdings zu, so wirken sie auf den abgelehnten Richter oftmals wie ein Blick in den Spiegel, wie ein letzter Aufruf zur Ordnung. Mit der Folge, dass er nun erfahrungsgemäß bemüht sein wird, mögliche erneute Entgleisungen zu vermeiden. Wer als Verteidiger stattdessen in einer solchen Situation die Stimmung lieber nicht mit einem Befangenheitsgesuch vergiften möchte, der übersieht, dass diese meistens bereits vergiftet ist. Jetzt einen deutlichen Pflock zu setzen, kann wie das berühmte reinigende Gewitter wirken. Aber dass unser Vorsitzender hier nun tatsächlich seine Befangenheit überhaupt nicht zu kaschieren versuchte und unumwunden einräumte, mit mir im Raum nicht frei und unabhängig agieren zu können, das war auch für mich eine neue Erfahrung – und zeugte im Übrigen von beachtlicher Größe. Dieser Richter war ohne jeden Zweifel befangen und hatte offenkundig kein Interesse daran, es noch einmal mit meiner Mandantin und mir zu versuchen. Dass er sich – anders als so mancher andere in dieser Situation – nicht trotzdem mit aller Gewalt bemühte, der Verhandlung erhalten zu bleiben, sondern das Feld für einen Kollegen räumte, war gut so. Weniger gut war, dass das Verfahren nun erst einmal für längere Zeit ausgesetzt wurde.
Als der Prozess von Neuem begann, lag Lisas Unfall mittlerweile mehr als 15 Monate zurück. Wir fanden uns nur zwei Säle weiter bei einem neuen Richter ein. Dieses Mal bekam Christina Kluge ausreichend Gelegenheit, genau zu schildern, wie alles abgelaufen war, auch wie sie ihre Tochter bewusst mit dem Rad hatte vorausfahren lassen. Der Richter hörte aufmerksam zu, stellte ergänzende Fragen. Er würde am Ende entscheiden müssen, ob Christina Kluge sich korrekt verhalten hatte oder ob ihr Verhalten als strafbare Verletzung ihrer Sorgfaltspflicht zu beurteilen war. Das war eine reine Bewertungsfrage. Meine Mandantin selbst konnte dafür nur die Fakten liefern. Und genau das wollte sie auch tun.
Die nächsten Stunden zogen sich für sie dann quälend hin. Der Fahrer des Kleinwagens schilderte als Zeuge, wie er den Aufprall erlebt hatte. Für Christina Kluge war es so, als erlebte sie all das Schreckliche ein zweites Mal. Schließlich kam auch Marcel Wendenburg zu Wort. Zum Unfall selbst konnte er natürlich nichts sagen, er war ja nicht dabei gewesen. Dafür wusste er zu berichten, wie er die Angeklagte sonst als Mutter erlebt hatte, er beschrieb sie, ohne mit der Wimper zu zucken, als gewissenlos und unachtsam. So oft habe er seine Tochter in Gefahrensituationen erlebt, während seine Ex am Handy »geklebt« oder sich lieber die Nägel lackiert habe. Es sei schon immer seine Sorge gewesen, dass dieses Desinteresse am eigenen Kind irgendwann in einer Katastrophe enden könnte.
»Gut gebrüllt, Löwe«, dachte ich und fragte ihn, warum eigentlich nie er, der Vater, die gemeinsame Tochter vom Kindergarten abgeholt hatte. Als Beamter bei der Agentur für Arbeit hatte er flexible Arbeitszeiten. Sein Arbeitstag begann oft schon morgens um 6 Uhr, sodass er bereits um 15 Uhr Feierabend hatte. Er war leidenschaftlicher Schwimmer, auf Leistungsniveau. Von meiner Mandantin wusste ich, dass der Sport für ihn an erster Stelle kam und ein Tag ohne Wasser ihn unausstehlich werden ließ. Seine Antwort fiel knapp aus: »Das hatten wir eben so aufgeteilt – tut hier auch nichts zur Sache.«