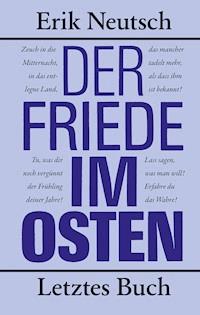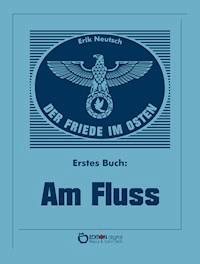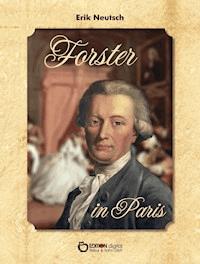7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erik Neutsch erzählt in diesem Buch die erregende Geschichte des Bergarbeiters Eberhard Gatt, der aufstieg mit dem Aufstieg seiner Klasse, der aus den Kupferschächten in die Redaktion einer Zeitung kam, der Macht ausübte, streng gegen sich und andere, der sein Leben einsetzte, wenn es Not tat, der einen Lehrer fand und ein Mädchen, das ihn liebte. Aber die Stärken des Mannes Gatt waren zugleich seine Schwächen. Er wusste zu wenig von den Schwierigkeiten des Kampfes, von der Kompliziertheit des Sozialismus. So verlor er in einer entscheidenden Situation das Vertrauen zu Ruth, der Frau, die ihn liebte, und er verlor sie. Und er verlor sich selbst, weil es ihm an Wissen fehlte, das Kommende zu erkennen. So finden wir ihn wieder auf Bahnhöfen und in Zügen, auf Zwischenstationen, denn ein Mann vom Schlage Gatts kann sich nicht wirklich verlieren, nicht hierzulande und in dieser Zeit. Es beginnt der mühsame Weg der Erkenntnis, der Selbsterkenntnis, der ihn wieder in die Nähe Ruths führt, die mittlerweile verheiratet, sich nun gestellt sieht zwischen zwei Männer. Sie alle, Gatt, Ruth, Weißbecher, der Erzähler haben die Frage zu beantworten nach den Möglichkeiten des Menschen, nach seiner Selbstverwirklichung. Ein Buch, voller äußerer und innerer Dramatik, eine bedeutsame erzählerische Leistung des Autors. Das Buch erschien erstmals 1973 im Mitteldeutschen Verlag Halle, das eBook ist die 16. Auflage. Der Deutsche Fernsehfunk drehte 1976 den gleichnamigen Film. INHALT: GATT LEBT. ICH WAR BERGMANN. WARUM GING ICH SPÄTER NICHT AUCH ZU RUTH? JEREM UND ICH. ER TRAT SOGAR SEINE STERNSTUNDEN IN DEN STAUB. EIN JAHR VERGING. DER ZUG SCHIEBT SICH UNTER DAS DACHGEWÖLBE EINES BAHNHOFS. IST DER MENSCH, WIE VON IHM GESAGT WIRD, EIN GEWOHNHEITSTIER ODER NICHT? SEITDEM SUCHE ICH GATT. RUTHS GESICHT IST VON ANSTRENGUNG SCHWER GEZEICHNET. HIER BEGINNT DIE ERZÄHLUNG RUTHS. DER GOTT DER TÜR, EINGANG UND AUSGANG, JANUS MIT DEN ZWEI GESICHTERN.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Impressum
Erik Neutsch
Auf der Suche nach Gatt
Roman
ISBN 978-3-86394-383-7 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien 1973 bei Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2012 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
GATT LEBT.
Gatt lebt also noch. Seit Jahren ging er mir nicht aus dem Sinn, wie ein Feind saß mir seine Geschichte im Nacken, und jetzt diese Nachricht. Jeremias Weißbecher rief mich an. "Hallo, alter Freund! Ich wollte dir einen Brief schreiben. Aber das dauert zu lange. Wir haben ihn gefunden. Fahr hin. Beeile dich. Ich komme nach..."
Zwar scheint ein Zeitalter zwischen damals und heute zu liegen, die Entfernung von Himmelskörpern zwischen unserer Begegnung in M. und meiner jetzigen Reise, die Welt hält keinen Tag still, doch nun, da ich mich jeder Einzelheit zu erinnern versuche, ist alles eine Denksekunde erst her. Ich sitze im Zug. Angetrieben durch die Erwartung, ihn wiederzusehen, zögerte ich keinen Augenblick, fuhr sofort zum Bahnhof und löste eine Karte. Wohin? Nach Mansfeld oder doch nur ins Ungewisse? Von Weißbecher weiß ich nur, daß er, Gatt, sich dort in der Nähe aufhalten muß. Vielleicht in E. Vielleicht in S.
Aber er lebt. Wird jedoch unsere Anstrengung nicht vergebens sein? Was ist ein Mensch? Ich entsinne mich, wie er den Atlas mit den Bildern in seiner Hand hielt, Bamberger Reiter, Kreidefelsen auf Rügen und Karten von Europa. Ich entsinne mich seiner Worte: Man müßte sich irgendwo als Punkt darauf eintragen, wie eine neue Stadt, schwarz oder rot... Und ich nahm auch die Manuskripte mit. Lose Blätter. Halbfertig. Kein Ende. Hier und dort schon mit GilbsteIlen versehen. Denn ich hatte es aufgegeben, noch weiter daran zu schreiben. Mir fehlte das Urteil, mir fehlte der Mut, über ihn zu urteilen, ein entscheidendes letztes Wort, mit dem vielleicht auch er gerechnet hatte.
Es ist Nacht. Die Räder hämmern über die Schienen. Draußen liegt die Erde unter dem Schnee, und weit oben, kann ich erkennen, sobald ich die Stirn fest an die Scheibe presse, flimmern die Sterne. Unendlichkeit. Nirgends ist die Welt zu Ende. Die Astronomen sagen, daß auch das Leben auf unserem Planeten nichts Außergewöhnliches sei. Irgendwo existiert die Vernunft noch einmal. Sie liegt nur noch außerhalb der Reichweite unserer Teleskope, außerhalb unseres heutigen Wissens. Also: Was ist der Mensch? Ein Gegenzug rast vorbei. Licht und Schatten. Lichtschatten. So nahmen wir damals Abschied. Im Gegenüber des Zuges glaubte ich Gatts Gesicht zu entdecken. Ich suchte ihn. Ich durchbohrte die Nacht mit meinen Blicken. Hinter einem der erleuchteten Fenster war ein Schattenriß aufgetaucht, seinem Profil sehr ähnlich. Doch die Lichtpunkte wurden kleiner. Bald verschwanden sie in der Dunkelheit.
Und später begann ich zu schreiben. Und jetzt halte ich die Fetzen des Geschriebenen auf den Knien und lese. Der Weg bis Mansfeld, wo ich Gatt wiederzufinden hoffe, ist noch weit.
Das Jahr war kalt, und folgerichtig kam der November mit nassen Nebeln. Die Fabrikdämpfe ätzten die Straßen, auf dem Pflaster lag Wasser wie geschmolzenes Blei. Grauheit, Gräue, milchigblasse Nebel, verschleierte Gegend, am Himmel eine Sonne, strahlenlos, die mehr einer abgegriffenen Aluminiummünze glich als sich selbst. Es war ein Jahr der Rechenschieber, und die Natur schien willfährig und sich danach zu richten. Mit ihren Nebeln zuerst, mit ihrer klammen Kälte. Wir glaubten schon, wir hätten die Logik neu erfunden. Nach unserem Willen sei alles zu messen, sogar der Mensch, seine Arbeit und seine Lust, das einmalige, für jeden von uns unwiederholbare Leben. Die dumpfen Nebel würden weichen, dachten wir, und das nächste Jahr würde von Wärme und Freundlichkeit strotzen, sobald wir es nur im voraus berechnet hätten. Ich war ein eifriger Vertreter dieser Theorie der gesteuerten Hoffnung.
Doch dann begegnete ich ihm. Während der Nebelzeit. Ein Mann im besten Alter, Ende der Dreißig, kein unbeschriebenes Blatt mehr, was ich zunächst, wie ich nun sagen muß, nur erriet. Denn erst später wurden meine Vermutungen bestätigt, hundertfach von ihm selbst und, nachdem ich einer der Spuren in seinem Leben nachgegangen war, eben jener, die zu Weißbecher führte, auch von ihm, dem Chefredakteur, Gatts einstigem Freund. Damals aber, als ich ihn zum ersten Mal bemerkte, konnte ich noch nicht ahnen, daß er mir um so rätselhafter werden würde, je näher ich ihn kennenlernte.
Er stand auf dem Bahnhof von M., für mich noch ein Fremder, und M., eine mittlere Kreisstadt, befand sich gerade im Aufbruch, kehrte ihr Unterstes zuoberst. Die Chemie färbte ihr Gesicht, und Forschung und Ökonomie prägten ihr Ansehen. Schon bestanden exakte Pläne, von elektronischen Gehirnen programmiert, den alten Stadtkern einzureißen, die winkligen Gassen, in denen der Schwamm nagte und die Ratten pfiffen, unter Hochstraßen zu bringen. Ringsum ragten Schlote und Destillierkolonnen auf, umklammerten hufeisenförmig die Stadt wie ein riesiges Gatter und ließen nur eine Lücke zum Fluß frei, dort, wo die Sümpfe und die dunklen Gehölze begannen, dahinter die Äcker und dahinter die anderen Städte... Die Fahrdämme waren seit langem überbelastet, hatten sich unter den Rädern krumm gebuckelt; sie würden sich dehnen müssen, und sie würden gedehnt werden, um auch dem Verkehr der Jahrtausendwende gewachsen zu sein. Bis dahin jedoch trugen die Schienenstränge, was die Straßen nicht fassen konnten. Und so war der Bahnhof dieser Stadt, wie in früheren Jahren vielleicht der Markt, der Ort ihres größten Gewimmels, besonders in jenem November.
Denn die Fahrpläne stimmten nicht mehr, hingen nur noch pro forma aus. In der gläsernen, hochkuppligen Vorhalle stauten sich täglich die Menschen, am dichtesten während der Zeit des Schichtwechsels, vom späten Nachmittag bis in den frühen Abend. Die meisten wußten nicht, wo sie sonst hätten warten sollen. Der öffentliche Garten, der unmittelbar vor den Schwingtüren angelegt war und im Sommer zu Spaziergängen einlud, troff vor Feuchtigkeit; seine Kieswege waren aufgeweicht, und die jungen Linden reckten kahl und starr ihre Zweige, so daß niemand wagte, sich hier noch auszuruhen. Das Restaurant und die Wartesäle hingegen waren überfüllt, und obwohl eine stickige Luft das Bleiben dort zur Qual machte, verteidigte doch jeder einen einmal erkämpften Platz bis zur Abreise. Nur die Halle, der Glasbauch, nahm jeden auf. Stundenlang oft standen die Männer und Frauen hier, frierend und müde, und warteten darauf, daß die knarrende Stimme im Lautsprecher sie erlöste, den Zug anmeldete, mit dem sie nach Hause fahren wollten, in ein Wohnnest, zur Familie, zu den Kindern. Aber die Züge hielten auf offener Strecke irgendwo im Nebel, irgendwo in der Dunkelheit, sie kamen nur mühsam voran.
Inmitten der Menge bemerkte ich sein Gesicht zum ersten Mal. An der Sperre. Neben dem eisernen Zaun, der die Halle von der Unterführung trennte, die die Bahnsteige miteinander verband. Heute weiß ich, daß er diesen Platz nie - bis zu jenem Augenblick jedenfalls nicht, da ich mich nach Ruth umschaute, seiner Frau - verließ, um es den anderen, den Reisenden, gleichzutun, um sich der Reise anzuschließen.
Sein Gesicht war eins unter vielen, und der Ausdruck seiner Augen, so will es die Erinnerung heute, unterschied sich in nichts von der Ungeduld in all den anderen Augen. Und dennoch, obwohl ich dafür keinen Grund mehr zu nennen vermag, fiel sein Gesicht mir besonders auf. Wie die gesamte Gestalt wirkte es hager, blaß und ein wenig ungepflegt. Den Schädel, der in der zugigen Halle meist unter einer Schiebermütze verborgen blieb, bedeckten strähnige Haare, die die Farbe von Schiefer hatten, grauschwarz, und die immer glänzten wie im Schweiße. Unter der hohen, kantigen Stirn und den buschigen Brauen lagen zwei bräunliche, von stark geädertem Weiß umgebene Pupillen, deren Blicke, wie ich später erfuhr, unangenehm stechen und zupacken konnten. Der Nasenrücken war glatt, der Mund schmal, die dünnen Lippen aber schimmerten so rot, daß sie auf mich den Eindruck machten, als fieberten sie. Kinn und Wangen waren eigentlich nie, jedenfalls nie während der Tage meiner Bekanntschaft mit ihm, glatt rasiert, immer überdämmerte sie ein bläulicher Schatten. Das alles aber hätte ich auch in anderen Gesichtern finden können, die Abgespanntheit, das Zucken in den Augen, die kleinen äußeren Unachtsamkeiten. Und wenn ich's mir jetzt, im nachhinein überlege, dann fiel mir sein Gesicht, so erstaunlich es klingen mag nach all dem Geschilderten, vielleicht nur deshalb auf, weil es mehr wartete, einfach nur mehr wartete als jedes andere.
Ich begann, ihn täglich zu beobachten, und bald wurde ich auch gewahr, daß ihn das Treiben in seiner Unlgebung nur wenig kümmerte. Die Kommandos der Lautsprecher erreichten ihn nicht, er rührte sich nicht vom Fleck. Die aufgewirbelte Menge flutete an ihm vorbei, er schien sie nicht einmal zu bemerken, er hielt sich nur mit beiden Händen, sobald das Gedränge ihn fortzuzerren drohte, an dem Eisenzaun fest. Er fuhr mit keinem Zug, empfing auch niemanden, der mit einem der Züge ankam. Er stand an der Sperre, reckte hin und wieder den Hals, um besser sehen zu können, und - wartete.
Meine Neugier kannte keine Geduld mehr. Kaum ein anderer hatte sie jemals so geködert wie dieser wartende Mann. Ich richtete es fortan ein, daß ich vor ihm auf dem Bahnhof eintraf, daß ich ihm folgen konnte, sobald er mit gebeugtem Rücken und hoch aufgeschlagenem Lederkragen die Halle betrat, erfuhr aber lange Zeit nichts, was ich nicht schon gewußt hätte: Er schüttelte die Nässe von sich ab, ging auf den Platz neben der Sperre und stellte sich dort auf, als zöge er auf Posten. So plötzlich und selbstverständlich dann, wie er gekommen war, entfernte er sich schließlich, meist nach einer halben Stunde, selten erst nach zweien oder gar dreien, wobei mir das System dieser Intervalle nicht einleuchten wollten. Manchmal warf er noch einen Blick in das überfüllte Restaurant, bevor er verschwand, meist trat er sofort durch die Schwingtüren hinaus ins Freie, krümmte den Nacken und zog den Kopf wieder zwischen den Kragen der Lederjacke. Ich spürte große Lust, ihm nachzugehen, zu erkunden, wo er wohnte, wie er lebte.
Eines Tages, dessen bin ich mir sicher, wäre ich dazu auch entschlossen gewesen, wenn ich nicht plötzlich - oder war es doch allmählich? - eine andere Entdeckung gemacht hätte.
Ich kannte inzwischen jede Geste, jede Regung in seinem Gesicht, und da fiel mir auf, daß er stets dann von einer kaum merklichen, aber doch innerlich sehr heftigen Unruhe geplagt schien, sobald im Lautsprecher die Züge aus der nahen Bezirkshauptstadt angekündigt wurden. Dann stemmte er sich mit seinen knochigen Fäusten auf die eiserne Querstange des Gitters und hob seinen Kopf so hoch als möglich über die Menge. Seine Augen nahmen einen stechenden Ausdruck an, ich folgte ihren Blicken und bemerkte eine Frau, deren Verhalten mir verriet, daß es zwischen ihr und ihm eine Beziehung gab.
Zunächst glaubte ich an eine Täuschung. Doch je länger ich die beiden beobachtete, desto auffälliger fand ich ihr Benehmen.
Die junge Frau scheute das Gedränge an den Barrieren. Sie tauchte aus der fahlbeleuchteten, schummrigen Tunnelhöhle auf, sobald der Strudel aus Menschenleibern seine größte Wucht verloren hatte. Festen Schritts stieg sie die Treppen hinauf, stockte aber fast immer, bevor sie den Fuß auf die letzte Stufe gesetzt hatte. Es war ihr anzumerken, daß sie in diesem Augenblick den Mann entdeckte, der am Gitter auf sie wartete. Jedesmal erschrak sie neu, und vielleicht hatte sie wieder und wieder gehofft, ihn nicht mehr zu treffen. Danach aber, ein wenig hastiger als zuvor und ein wenig ängstlich sogar, wie mir schien, eilte sie auf die Sperre zu, die am entferntesten lag. Manchmal geriet sie erst dadurch in den Sog, den sie bisher gemieden hatte, und sie kämpfte dagegen an, allerdings nur mit einer sanften, mißlingenden Gewalt. Einen einzigen stummen Blick hatte sie mit dem Manne getauscht, und sofort hatte sie ihr Gesicht abgewandt. Sie richtete ihre Augen auf die Fahrkarte, die sie zwischen schmalen, von weichem Handschuhleder überspannten Fingern hielt. Ihre kleine anfängliche Furcht verflog, wich einem abweisenden, beinahe hochmütigen Trotz. Sie mußte wissen, daß sie mit einem heißen Begehren betrachtet wurde, aber sie ging, ohne den Kopf zu wenden, aufrecht davon.
Das war dann stets die Entscheidung, eine Entscheidung, die sich täglich wiederholte. Er trennte sich von seinem Platz an der Sperre und schlich, auffällig nur einem Eingeweihten wie mittlerweile mir, in tiefer Ratlosigkeit davon.
Ich ahnte eine erregende Geschichte. Und immer öfter sann ich darauf, den Fremden zu stellen, ihn zu einem Gespräch mit mir zu zwingen. Die Gelegenheit dazu bot sich früher, als ich gehofft hatte.
Mehrere Wochen schon hatten meine Nachstellungen gedauert. Ihretwegen hatte ich täglich meinen Zug versäumt, manchmal auch den nächsten oder gar übernächsten, was außer mir freilich niemanden kümmerte, da es mich ohne Frau und Kinder in dieser Gegend verschlagen hatte und es also niemanden gab, der nach mir fragte. Du streunst umher, bist ein ewiger Wanderer, dachte ich von mir selbst, und vielleicht war es das, was mich insgeheim mit dem Manne verband. Denn ich fühlte, auch er war ruhelos. In den letzten Tagen ging er immer öfter in das Restaurant, besonders dann, wenn die Frau aus irgendeinem Grunde nicht mit dem Zuge eintraf. Die Nebel begannen sich zu lichten, manchmal stahl sich schon ein matter Sonnenschein in das kahle Gezweig der Linden, wurden nachts die Leuchtfeuer der Werke am Himmel sichtbar. Die Züge fuhren pünktlicher, und in der Gaststätte wurden die Tische schneller wieder geräumt.
Ich ging ihm nach. Auch diesmal war die Frau nicht gekommen. Wir - ich muß schon sagen: wir - hatten vergebens auf sie gewartet.
Er postierte sich nahe der Tür, drückte den Schirm seiner Mütze tief in die Stirn, als wollte er sein Gesicht darunter verstecken, und vergrub die Fäuste in den Taschen. Ich stand in seinem Rücken, schaute ihm über die Schulter, sah seinen Hemdkragen, der, was nun gar nicht zu meinem bisherigen Bild passen wollte, sehr sorgfältig, wie von Frauenhand gebügelt schien. Doch noch ehe ich länger darüber nachdenken konnte, wurden an einem der Tische zwei Stühle frei, und wir stürzten beide gleichzeitig darauf zu. Nun saß ich ihm gegenüber. Er nahm die Mütze vom Kopf, stülpte sie über den Lehnenholm und wischte sich mit der Innenfläche der Hand über die schweißnasse, bärtige Haut. Als die Serviererin kam, die mit ein paar belanglosen Worten verriet, daß sie ihn kannte, bestellte er Bier und Branntwein. Ich tat es ihm nach, und ich erreichte, da meine Bitte wie ein Echo klang, daß er mich mit seinen stechenden Augen musterte und wohl zum ersten Mal bemerkte.
Er umklammerte mit beiden Händen das Bierglas, trank daraus in kleinen Schlucken. Den Branntwein dagegen ließ er lange Zeit unberührt.
Und plötzlich sprach er mich an. Er atmete schwer, und seine Stimme klang rauh und spröde, so daß ich versucht war, mich statt seiner zu räuspern. "Wartest du auch auf einen Zug hier?" fragte er.
Das Du in seiner Anrede überraschte mich nicht, denn es war hier wie auf dem Arbeitsplatz üblich, auch einem Fremden gegenüber das vertrauliche Du zu gebrauchen. Ich verneinte und antwortete, daß ich nur vorübergehend hier zu tun hätte und bald die Stadt verlassen würde.
"Monteur?" forschte er weiter und wies mit einem leichten Nicken auf meine Hände, die, da sie damals rissig und von Hornhaut überzogen waren, meinen Beruf nicht verrieten.
Ich schüttelte den Kopf. Ich begegnete zum zweiten Mal seinen Augen aus unmittelbarer Nähe, und ich empfand, daß ihr Stechen von einem erbitterten, tief in die Seele gebrannten Mißtrauen herrührte. Sie glänzten wie im Fieber, und ich erschrak darüber.
"Ist ja auch gleich", sagte er nach einer Weile. "Eine gräßliche Gegend. Sie macht mich fertig. Gesundheitlich, verstehst du? Die Luft wird immer schwerer, und ich würde die Flucht ergreifen vor ihr... Würde ihr nicht länger meine Lungen zum Fraß vorwerfen... Wenn ich nur loskommen könnte von hier."
Ich wollte ihn fragen: Hält dich die Frau? Aber ein Geständnis, daß ich ihn beobachtet hatte, hätte wahrscheinlich unser Gespräch schon im Keime erstickt. Er kam mir auch zuvor, indem er zu sprechen fortfuhr: "Wenn du einer von denen bist, die ich nie wiedersehe, kanst du's ja wissen. Ich suche wieder ein Ziel, für das sich zu leben lohnt. Das bißchen Nahrungssuche, das Bett einer Frau, sie erfüllen mich nicht. Der Mensch ist kein Mensch, wenn er aufgibt zu kämpfen. Allein die Hoffnung, es könnte noch einmal anders werden, hält mich. Noch treibt sie mich weiter, doch manchmal fürchte ich schon, daß auch sie mich verlassen könnte. Ich habe mein Leben lang gekämpft. Wofür? Wozu? Ich weiß es nicht mehr. Ich würde die Welt zertrümmern, säh ich für mich einen Sinn darin. Dort bin ich. Denn wenn auch sie mich verläßt, die Hoffnung, wär ich ein alter Mann."
Ich horchte auf, hörte ihm zu: Sein Ton gefiel mir nicht. Doch erst im nachhinein, heute, da ich an dieser Stelle meiner Notizen angelangt bin, wundert es mich, weshalb er ausgerechnet mir, einem unter siebzehn Millionen, das Herz ausschüttete. Er tat nicht schön, weder mit mir noch mit sich, am allerwenigsten wohl mit sich, und nur, wo er bei besserer Einsicht sich selbst hätte strafen müssen, verfiel er in die uns allen eigene Schwäche, die manchmal so unangenehme Wahrheit angenehmer machen zu wollen. Was also war der Grund seiner Beichte? Allein das Bedürfnis dazu, glaube ich, das Loch in der Seele, das er nun spürte und stopfen wollte, mit der Zunge, mit Worten. Immer sucht dann ein Mensch den anderen.
Ich erfuhr, daß er Gatt hieß. Und ich gestehe, daß ich bald in eine Stimmung geriet, die sich sonderbar mischte aus Zorn und Mitleid, Abscheu sogar und Achtung. Vielleicht war es diese Unordnung meiner Gefühle, die mich so lange zaudern ließ, die Geschichte zu Ende zu bringen, sie aufzuschreiben und mitzuteilen. Doch nun?
Ich sitze im Zug und fahre nach Mansfeld. Gatt lebt. UND HIER BEGINNT SEINE ERZÄHLUNG.
ICH WAR BERGMANN.
Mein Vater auch. Und mein Großvater, ein störrischer Alter. Bergleute schreiben ihr Testament schon früh, kaum daß sie geheiratet haben. Angewöhnte Vorsicht. Die Rechnung der Angst mit dem Tod unter Tage. Mein Großvater tat es auch. Doch nach jedem Familienzwist, und er zankte sich oft, verwarf er die alte Niederschrift, seinen letzten Willen, und besann sich auf einen allerletzten. Er verteilte dann jedesmal neu seine spärlichen Habseligkeiten, mit einem so leidenschaftlichen Ernst allerdings, als sei er Abs oder Springer oder die Dresdner Bank und habe die halbe Welt zu vererben. Eins aber blieb immer. Stets verlangte er, Grubenlampen statt der Kerzen an seinem Sarg leuchten zu lassen.
Er nahm mich zu sich, als meine Mutter allein blieb mit vier Kindern am Rock, die nun von Ziegenmilch und Kartoffeln satt werden sollten. Drei Tage und drei Nächte, ohne zu schlafen, hatte sie ausgestanden. Vor dem Tor aus eisernen Lanzenspitzen. Das Tor mit den wimmernden, hohläugigen Frauen davor wirkte auf mich wie die gepanzerte Scheidewand zwischen Himmel und Erde. Noch lange, bis ans Ende meiner kindlichen Phantasie, hatte auch Petrus das wabblige, hilflose Gesicht des Schachtdirektors, der fortgesetzt zu trösten versuchte. Meine Mutter stand noch, nachdem das Wasser im Stollen längst wieder herausgepumpt worden war. Ich hab's von ihr, sie konnte die Hoffnung nicht loswerden. Man mußte sie mit Gewalt fortbringen, ihr die Arme auf den Rücken drehen und ihre verkrampften Kiefer mit Spritzen lösen. Trotz alledem, ich entsinne mich nicht, daß es irgendeinen in der Familie gab, der nicht sein Leben lang in den Berg ging. Bis zum Umfallen, bis zur Silikose spätestens. Ich komme aus dem Mansfeld, wo die Halden höher sind als die Kirchen. Schon unsere Ururahnen durchwühlten die rote Erde dort nach Kupfer. Vor fünfhundert Jahren und mehr. Auf den Knien, auf dem Bauch, wie die Maulwürfe brachen sie das Gestein auf. Redliche und geschundene Tagelöhner im Dienste von Grafen und Fürsten, in kleinen Privatgruben, deren Hügelreste du noch siehst, wenn du auf der Achtzig fährst, der Straße am Südhang des Harzes. Jetzt wachsen Birken darauf, Krüppelkiefern und Farne.
Ich bin der erste, der ausscherte, kein Bergmann blieb. Aber das war nicht die Angst. Zwei meiner Brüder fielen im Krieg, den dritten holte der Berg wie den Vater, und die Zähne meiner Mutter haben sich da für die Ewigkeit zusammengebissen. Mein Entschluß hing ab von der Zeit, die danach kam. Fünfundvierzig. Und von den Schüssen in die Lunge. Und von den Menschen, die für mich mehr als jeder andere die neue Welt bedeuteten, die Erneuerung der Welt. Ruth, von der ich noch immer nicht weiß, was sie dachte, als sie über mir lag, als ich ihr Haar auf meinen Lippen spürte. Jeremias Weißbecher, Jerem, Chefredakteur noch heute in Sachsen, und kein Mensch erfuhr je, warum und woher er diesen Namen hat. Schließlich Gabriel, ein Mann, der mich bis heute verfolgt, mir zusetzt, in meinen Nachtträumen mehr als in meiner täglichen Arbeit.
Doch ich will der Reihe nach erzählen. Denn Freunde und Feinde hat jeder, manchmal auch solche, die sich für das eine ausgeben, um das andere zu sein. Daran ist nichts zu ändern, jedenfalls heute noch nicht. Oft genug aber, je nachdem, was mit dir angestellt wird, ist das Leben selbst dein ärgster Widersacher. Was ist der Sinn des Menschen? Ich bin nicht sentimental. Ich bestreite, daß einer dafür kann, wie er lebt. Du wirst in die Welt hineingeworfen wie ein Stück Holz in einen brodelnden Fluß. Mit deiner Geburt, mit deinem Elternhaus. Als Kinder haben wir oft handtellergroße Schieferplättchen über das Wasser hüpfen lassen. Keins brachte es zu mehr als zu elf oder zwölf Sprüngen, dann verschwand es in der Tiefe. Also schwimme, geh unter oder tauch auf. Purer Darwinismus. Nur die Passendsten überleben... Doch ich bin kein Mitmacher, nein, ich nicht, und ich habe mich dagegen gewehrt. Bist du ein Roter? Bist du ein Weißer? Bist du einer von uns, und wirst du auch schweigen? Versuch's. Versuch aber nicht, mich zu trösten. Mitleid vertrage ich nicht. Und wir sehen uns niemals wieder, nicht wahr? Dein eigenes Leben kann dir im Weg sein. Es ekelt dich an. Stück Holz, der Fluß hat dich schwer gemacht, hat sich in dich gesaugt und vergräbt dich in seinem Morast. Zwar kann ich's noch immer nicht glauben. Ich will mich damit nicht abfinden. Nicht abfinden will ich mich. Denn wenn du versinkst im Nichtstun... Darauf steht der Tod.
Deutlich erkenne ich seine Stimme. Im Zug nach Mansfeld. Die Schrift wird laut und lebendig. Und ich starre hinaus in die Nacht, suche den Punkt im All, die Markierung der Achse, um die sich angeblich die Welt drehen soll, den winzigen Stern im Bild des Kleinen Wagens, und ich höre in mir die Worte, und ich kann sie nun heute, auf der Suche nach Gatt, noch weniger ruhig entgegennehmen als damals. Über den Tisch hinweg begegnete ich seinem Blick. Ich entsinne mich, daß die Augen Sokolows wie mit Asche bestreut sind, leergebrannt nach einem großen Leid, so daß man sich scheut, in sie hineinzusehen. Solche Augen hatte auch er, und das stumme Grübeln, das abwesende Dösen waren nur die äußeren Zeichen eines tief in die Seele gebrannten Schmerzes. Seine Hände begannen zu zittern, und er brach, als er sich eine Zigarette anzünden wollte, ein Streichholz nach dem anderen entzwei. Ich mußte ihm helfen. Aber wie? Hatte er selber sich nicht schon ausgeschlossen von jeder Hilfe? Mitleid vertrage ich nicht, und wir sehen uns niemals wieder. Ich habe geschwiegen, ja, ich vermochte nicht, ihm zu antworten, obwohl ich ahnte, wie nötig er eine Antwort brauchte, damals schon, eine Antwort auf die uralte menschliche Frage nach dem Verhältnis des Teils zum Ganzen. Die befreite Gesellschaft vermag dem einzelnen nur zu geben, was der einzelne in Freiheit der Gesellschaft zu geben bereit ist. Das ist das Prinzip. Das stocksteife Prinzip. Doch wäre ihm damit geholfen gewesen? Statt dessen, nachdem ich bereits zu schreiben begonnen, aber auch beim Schreiben kein Urteil gefunden hatte, ging ich zu Weißbecher. Ich gestehe, es kostete mich Überwindung. Ich hatte ihn, Jeremias, nur mit den getrübten Augen seines Widersachers gesehen. Danach jedoch bereute ich nichts. Ich sitze sogar im Zug, fahre auch in seinem Auftrag, und ich werde mein Wort brechen und mein Schweigen. Natürlich bin ich ein Roter. Ich bin einer von uns, und auch Gatt ist einer von uns. Also können wir nicht so tun, als lebten wir nebeneinander her. Das Recht auf Einsamkeit ist nicht unser Recht. Je länger ich darüber nachdenke, nachdenke, warum Gatt sich im Bahnhof von M. mir anvertraute, desto höher steigt meine Hoffnung. Ich glaube wieder daran, daß die Hoffnung zu steuern ist. Mir ist, als habe er damals unmittelbar nach seinen Worten - Stück Holz, der Fluß, nur die Passendsten überleben in sich - hineingehorcht, und sei erschrocken. Zwar fühlte er sich ausgestoßen und einsam. Diese eine Sekunde in seinem Leben, das Gefühl, am Ende zu sein, zwang ihn zum Sprechen. Doch in das Bekenntnis seiner Vereinsamung floh er nur, weil er sie letztlich verachtete und sich auch dagegen wehren wollte. Anders brauchte ich nicht nach Mansfeld zu fahren. Wenn Gatts tiefster Punkt, an der Sperre zu warten, noch immer bestünde, wäre er zugleich auch sein Totpunkt. Was aber hätte das Leben des Menschen für einen Sinn, wenn es sich nicht in Bewegung befände? Den Sinn eines Grabsteins... Ich gab ihm Feuer, als seine Hände zitterten, als er sagte: Darauf steht der Tod.
Wie bei einem Deserteur. Wie damals im Odenwald. lch hatte eine unbändige Lust zu leben. Und ich wollte nach Hause, obwohl ich wußte, daß es für mich kein Zuhause mehr gab. Meine Mutter war gestorben, und meinem Großvater hatten sie schon die Grubenlampen an den Sarg gestellt, als ich eingezogen wurde. Mit siebzehn Jahren. Da rollten die Sowjets schon auf die Oder zu und die Amerikaner auf den Rhein. Wir wurden hin und her geworfen, in die Zange genommen von zwei Panzerspitzen. Am Morgen verbluteten wir im Norden, am Abend im Süden. Es lagen nicht mehr als hundert Kilometer dazwischen. Großdeutschland war zusammengeschmolzen im Hitzetiegel der Granaten. Wir waren es auch. Unser Bataillon auf die Stärke von zwei Zügen. Manche von uns glaubten noch an die Wende, an die Wunderwaffe. Ich nicht. Wir besaßen nicht einmal mehr Kochgeschirre, Feldflaschen, das bißchen Blech. Wir tranken Regenwasser aus Stahlhelmen. Und wir weigerten uns, als der Kommandeur den letzten Gegenangriff befahl. Jeder gute Deutsche fällt. Was übrigbleibt, sind die Minderwertigen. Ich wollte leben, ich wollte nach Hause. Andere auch. Doch der Major baute sich vor der Front auf. Neben sich ein Dutzend Kettenhunde mit Maschinenpistolen. Und dann ließ er abzählen. Von eins bis fünf, von eins bis fünf, von eins bis fünf. Jeden fünften ließ er vortreten. Zwölf Mann, keiner älter als achtzehn. Er schickte sie in die Kiesgrube, und die Gendarmen knallten sie ab. Knallten sie einfach ab. Zwölf Jungen in der Kiesgrube, da lagen sie im gelben Sand. Solche, die sich geweigert hatten, und solche, die bis zuletzt noch vom Endsieg überzeugt gewesen waren. Abgeknallt. Unterschiedslos. Wir anderen scharrten sie ein. Doch einer hatte gerufen: "Herr Major, Sie sind das dreckigste Schwein, das mir je unter die Augen gekommen ist." Und ein anderer, ein Fähnrich: "Kameraden, sorgt dafür, daß dieses Unrecht gerächt wird."
Wir taten es. Zwei Stunden nach der Exekution kamen die Amerikaner. Sie drückten uns ihre Gewehrläufe in den Nacken und trieben uns auf Lastkraftwagen. Der Major fuhr im Jeep. Auf dem Schulhof eines Rhöndorfes, der hoch mit Stacheldraht umspannt war, luden sie uns aus. Wir lagen auf der blanken Erde. Aprilkälte. Es regnete, schneite. Ich sah immerfort die zerplatzten Schädel der Kameraden vor mir. Der ganze Schulhof stand voller Rotdorn. Seine Knospen waren wie Blutstropfen. Wir hatten keine Waffen mehr. Der Major war noch unter uns. Wir wußten, daß ihn die Amerikaner von uns absondern würden. Vielleicht in den nächsten Stunden schon. Aber wir konnten nichts unternehmen, bevor nicht die Nacht hereingebrochen war. Wir besaßen nur noch die bloßen Fäuste, und wir wollten die Kameraden rächen. Ein heiliger Auftrag. Von den Toten an die Überlebenden. Wir hätten den Major erwürgen können mit den Händen. Doch die Amerikaner wären nicht glimpflich mit uns umgesprungen. Mord. Wir standen noch unter dem Kriegsrecht, wenn die Armee auch gewechselt hatte. Und da kam die Nacht. Der Major ging pissen in die Toilette für Knaben. Sie befand sich in einer unübersichtlichen Ecke. Wir schlichen ihm nach, zerrten ihn nieder. Wir legten uns auf ihn, zwanzig Mann, dreißig. Auch die Offiziere. Die wohl aus Angst, ihnen könnte Gleiches geschehen. Auge um Auge. Zahn um Zahn. Wir lagen einer über dem anderen. Ein Berg von Menschen und unter uns der Major. Kaum ein Laut zu hören, höchstens mal das Gestöhn, von einem, der mit der Luft rang. Auf meiner Stirn fühlte ich Nagelschuhe, in meinen Leib drückte sich ein Koppelschloß. Die Last über mir preßte mir die Brust zusammen. Ich lag mit dem Rücken auf seinem Kopf. Ich spürte, wie er mir seine Zähne in den Rücken schlug. Aber wir harrten aus. Bis er sich nicht mehr bewegte. Bis wir annehmen konnten, daß er unter dem Gewicht unserer Körper erstickt war.
Das war mein letzter Toter im Krieg. Zwei Monate später wurde ich aus dem Lager entlassen. Die Amerikaner sagten mir, daß sie auch in Mansfeld stünden. Ich erhielt eine Bescheinigung in englischer und deutscher Sprache und wanderte und wanderte. über die Rhön, über den Thüringer Wald, in den Harz. Dahinter, wußte ich ja, liegt mein Zuhause. Eine Heimat von Verstorbenen, Erschlagenen, Gefallenen. Ich bin völlig abgemagert. Die Uniform hängt mir in Lumpen vom Leibe. In meiner Jacke zwischen den Schulterblättern hat sich Blut verkrustet. Ich habe den Rotdorn vor Augen, der längst verblüht ist. Auf den Wiesen wird schon das Heu gewendet. Nur ein paar Stiefel besitze ich noch, die was taugen. In der Gefangenschaft habe ich sie geschont. Wir lagen auf dem Schulhof wie die Ölsardinen in der Büchse. Täglich waren neue Gefangene hinzugekommen. Manchen schwemmte das Wasser den Bauch auf. Hunger. Keine Bewegung. Ödeme, sagten die Sanitäter. Hin und wieder hatte ich daran gedacht, die Uhr zu versetzen. An einen Posten. Gegen ein paar Fleischkonserven aus Chikago. Die leeren Büchsen vor dem Stacheldraht hatten mich geil gemacht. Weißblech, es blinkte in der Sonne wie ein gedeckter Tisch. Etikette darauf mit rosafarbenen Bildern, Wurst und Corned beef. Einem, der danach angeln wollte, wurde die Hand zerschossen. Die Uhr war ein Erbstück von meinem Großvater. Du weißt schon, das allerletzte Testament. Sie war aus massivem Silber. Aber ich behielt sie. Ich verstaute sie tief im Futter meiner Uniformjacke. Wenn ich sie gezeigt hätte, fürchtete ich, wäre sie mir abgenommen worden, ohne daß ich auch nur einen Bissen dafür gekriegt hätte. Und was war das schon, ein Bissen.
Je länger ich laufe, desto seltener begegne ich Amerikanern, weißen oder schwarzen. Der Harz ist erreicht. Aus meiner Jugend kenne ich viele Winkel darin. Trecks kommen, die nach dem Westen ziehen. In den Dörfern stehen die Villen leer, ihre schwarzen Fenster gähnen mich an. Hunde bellen. Die Leute sagen, daß die Russen das Land überfluten werden. Man warnt mich, aber es kümmert mich nicht. Ich gehe weiter. Ich sagte mir, schlimmer als bisher kann's nicht werden. Rotdorn und Schnee, blutige Schädel auf gelbem Sand, zu Unrecht Gerichtete. An einen Anfang glaube ich ohnehin nicht mehr. Das heißt, ich dachte überhaupt nicht darüber nach, wie es weitergehen soll in Deutschland. Und das Ende hatte ich schon hinter mir. Das große Ende... Schluß mit dem Krieg. Ich haßte ihn, wie ich nichts noch einmal in meinem Leben haßte. Allerhand Volk treibt sich auf den Straßen umher. Ausländer, Polen, Tschechen, Fremdarbeiter, wie sie genannt wurden, die menschenähnlichen Überreste von Hitlers Armee und Häftlinge. Ich gehe weiter. Mit mir geht es weiter. Jeder Schritt ist wie ein Hieb ins Fleisch. Berge, Wälder, Schüsse und Werwölfe. In einem Strohdiemen lagert eine Gruppe von Männern in blauweißer Sträflingskluft. Sie werden wohl auch nicht auf Sänften nach Hause getragen. Buffalo-Bill hebt seinen Sprit auch lieber für den Schwarzmarkt auf. Sie zwingen mich, mit ihnen Wassergraupen zu essen. Sie lachen sich halbtot, bärtige Knochengestelle, weil ich das Schlottern kriege und mit jedem Löffel die Hälfte der Suppe verschütte. Ich keuche mich schließlich davon. Und plötzlich, am Eingang des nächsten Dorfes, lauert mir einer auf und hält mir die Pistole vor den Bauch. Er fuchtelt mit dem Arm, redet wie aufgezogen. Uri, Uri, mehr verstehe ich nicht. Er deutet auf meine Stiefel und tastet mich ab und findet im Futter die schwere silberne Uhr. Ich muß die Stiefel hergeben. Und mit der Uhr reißt er mir auch noch die Jacke vom Leibe. Ich weiß nicht, was er mit dem Lumpen anfangen will. Aber ich bin froh, daß er nicht schießt. Heile Haut, nur ein bißchen wundgescheuert. Ich habe noch fünfzig Kilometer zu laufen. In Hemd und Hose und barfuß. Und als ich zu Hause ankomme, brech ich zusammen. Schlafe und schlafe und kotze. Weil mein Magen die Ziegenmilch nicht mehr verträgt, die der Nachbar mir einflößt. Mit einem Trichter, dessen Kanal er mir zwischen die Zähne klemmt.
Das ist meine Heimkehr. Ich verschlafe die Ankunft der Roten Armee. Ich verschlafe die Neueinteilung der Zeit. Mehr noch. Ich bin mutterseelenallein, heule in mein Bett hinein und denke, daß es nun erst recht keinen Anfang mehr gibt. Nicht für mich, einen spindeldürren Kerl von achtzehn Jahren. Auf dem Grab meiner Mutter wächst Rotdorn. Ich sehe ihn auch auf dem Grab meines Vaters, das mir im Traum als blutiger Hügel erscheint, auf den Gräbern meiner Brüder. Ich kann ihn nicht mehr ertragen. Ich lasse ihn später ausreißen und pflanze Efeu und Thujahecken. Totenblumen erschrecken mich nicht.
Doch mit achtzehn liegt das Leben noch vor mir. Mansfeld ist rot wie seine Erde, und die sowjetischen Truppen werden mit Blumen empfangen. Man singt die Internationale. Einer aus der Straße, in der ich wohne, wird Bürgermeister, einer aus der Grube Polizeikommandant. Die Herren von den Hütten und Schächten, auch der Petrus mit dem wabbligen, hilflosen Gesicht sind mit den Amerikanern über die Berge verschwunden. Und die sind nicht weit. Die Abendsonne färbt ihre Gipfel auf beiden Seiten der Grenze. Manchmal knattern nachts die Motoren, schlagen Türen. Verräter, Nazis werden geholt. Mansfeld hat gelitten und vergißt nicht. Aber bald steh ich auch den anderen gegenüber. Sie erklären, daß es nun weitergehen muß. Auf dem Wege zur Volksmacht. Brüder, zur Sonne, zur Freiheit. Ich fahr wieder ein, steig unter Tage. Die Karte für Schwerstarbeiter ist mir wichtiger als der Lohn. Man kann sich nichts dafür kaufen, kriegt alles nur zugeteilt. Ich spüre den Hunger im Bauch und noch mehr als den Hunger die Wut. Ich rackere mich ab. Jede Hand wird gebraucht, doch wir haben nur wenig Hände. Die, die arbeiten könnten, kletten sich an die Züge, fahren bis hinauf an die Nordsee. Wir leben im Hungerjahr. Ziegenmilch, als Brei gekocht, mit gemahlenem Weizen eine Delikatesse. Heringe tauscht man gegen Schnaps. Sie werden in Rucksäcken herangeschleppt, die von Salzlake triefen und stinken. Bremerhaven ist das Mekka der Schieber und Spekulanten. Ich aber höre, daß die Volksmacht das Kupfer braucht. Ich schufte im Berg Tag und Nacht, bis mir die Lunge rasselt. Kein Speck auf den Rippen. Und ich schreibe, weil meine Wut noch größer ist als der Hunger, einen Artikel. An die "Sächsische Volksstimme". Mehring, Marchlewski, die Linke. Doch davon erfahr ich erst später. Ich verlange, daß man die Heringsbändiger, wie sie heißen, in den Schacht schickt zu uns. In der Waschkaue kann sich keiner vor dem anderen verstecken. Dort ist jeder nackt. Prüfung der Wahrheit. Ob du einen vollen Wanst hast oder nur Wasser in den Beinen. Und wir brauchen jede Hand, wie gesagt. Und die Volksmacht braucht Kupfer.
Eines Tages spioniert mich einer aus, ein hutzliges Männchen. Es kommt in die Parteiversammlung. Ich bin inzwischen Mitglied. SED, wo denn sonst. In Mansfeld gehört es zum guten Ton, rot zu sein. Max Hölz, von dem sich die Alten noch heute Geschichten erzählen wie anderswo von Rübezahl, Brosowski, Koenen. Du siehst, ich habe Tradition auf dem Buckel. Ich trat ein, als die Kommunisten und die Sozialdemokraten zusammengingen. "Die Waffen nieder" war die Losung. Und vielleicht überzeugte mich die am meisten. Rotdorn... Der Mann aus Sachsen bringt eine Zeitung mit. Darin ist der Artikel gedruckt, an den ich mich kaum noch erinnere. Der Artikel und mein Name, Aufmachung auf der ersten Seite. Überschrift: Die Stimme des Volkes, Stichzeile: Eberhard Gatt, Arbeiterkorrespondent. Er drückt mir zehn Mark in die Hand. Ich quittiere. Aber der Schein ist für die Katz. Nicht mehr wert als ein Hering und ein Schwanz von einem Fisch. Und der Mann sagt zu mir: Genosse Gatt, die Redaktion ist der Meinung... Mithelfen soll ich, eine Zeitung zu schreiben. Ich soll mir die Finger krumm und lahm schuften wie vorher den Rücken. Weiter solche Artikel verfassen. Arbeiterfäuste, sagt er, auf dem Papier.
Ich sträube mich. Ich halte nichts davon, denn ich bin kein Schriftgelehrter. In den Berg will ich gehen und mein Geld mit ehrlicher Arbeit verdienen. Ich fordere nur, daß die anderen es auch tun. Mehr nicht. Wenn du die Schippe nimmst, antworte ich dem Männchen, oder den Hammer und Schiefer hackst, vielleicht tausche ich dann mit dir das Büro. Ich kann dir nicht sagen, wie lange ich mich zur Wehr setzte. Einen Monat, zwei. Der Genosse läßt nicht locker. Nach der dritten Parteiversammlung gebe ich allen Widerstand auf, hänge den Bergmannsberuf an den Nagel, die Lampe, die Kappe und geh in die Zeitung.
Das heißt, sie holen mich ab. In einem klapprigen Ford, der bei jeder Kurve auseinanderzufallen droht. Doch zum ersten Mal fahre ich Auto, streck mich ins Polster, ein Herrschaftsgefühl, und zum ersten Mal höre ich auch, was ein kollektiver Organisator, Propagandist und Agitator ist. Lenin. Die Presse. Ob ich will oder nicht. Parteiauftrag. Die Zeitung denen, die bisher von der Zeitung betrogen wurden. Ich bin Bergmann, wer ist mehr... Heute, Kumpel, siebzehn Jahre danach, müßte ich fragen: Wer ist weniger als ich?
Ein knapper Monat Redaktion genügt, und ich schlage Lärm. Ich habe dir nicht erzählt, wie mein Artikel über die Heringsbändiger aussah. Stimme des Volkes. Die Formulierung stammte nicht von mir. Man hatte sie eingeschmuggelt in die Überschrift und in sieben andere Stellen. Fettdruck, wiederholt bis zur Lächerlichkeit, als sei mein Gehirn eine Gebetsmühle. Anfangs war es mir nicht einmal aufgefallen. Ich hatte mich nur gewundert, wie gestelzt ich schreiben konnte. Vielleicht dachte ich damals, liegt es daran, daß dir der Zorn überschüssiges Blut in den Kopf getrieben hat. Bedingter Reflex. Stottern ist ein Versagen der Nerven, nicht der Zunge und schon gar nicht der Hand. Doch diese anmaßende Formel, Stimme des Volkes, erweckte mein Mißtrauen, als ich den ersten Artikel, der mir als Pflichtübung auferlegt war, trotz aller Verstümmelung im Druck wiederfand. Es war ein Interview.
Ich wurde in den ersten Wochen durch sämtliche journalistischen Genres gehetzt. Bericht, Reportage, Kommentar, Nachrichten. Nur die Knüller blieben mir vorenthalten. Denn die verlangten eine besondere Kunstfertigkeit und wurden deshalb nur von Künstlern gemacht, meist Männern mit Haarkränzen und Goldzähnen. Ich war auf den Hauptbahnhof gegangen. Längst fuhren die Züge wieder. Aber das Bahnhofsgelände war noch immer nicht enttrümmert. Es war von geborstenen Steinen übersät. Durch die Geröllhalden waren Schneisen gehackt worden. Unter den Rädern der Lokomotiven knirschten Mörtel und Glas, und der Wind fegte durch die zerlöcherten Dächer und wirbelte den Staub von den Schuttbergen. Ich fragte die Frauen nach ihrer Meinung. Trümmerfrauen. Und ich schrieb auf, was sie mir gesagt hatten. Dem Sinne nach kein Wort zuviel, aber auch keins zuwenig. Die eine seh ich noch vor mir wie heute. Das rußgeschwärzte verhärmte Gesicht wurde vom derben Stoff eines Kopftuches halb verdeckt. Sie trug viel zu weite Männerhosen und darüber aus geplünderter Fallschirmhülle einen selbstgeschneiderten Mantel, der keiner Bewegung nachgab.
Sie hatte mir geantwortet: "Ich habe drei Kinder zu Haus zwischen zehn und vierzehn. Sie betteln nach Brot, und ich krieg sie kaum satt. Deshalb muß ich Geld verdienen. Mein Mann ist noch nicht zurück." In der Zeitung stand: "Ich habe drei Kinder zu Haus. Sie wollen in Frieden leben. Deshalb helfe ich bescheiden mit, ein neues Deutschland aufzubauen." Auch lachte sie plötzlich begeistert, und ihre freie, selbstbewußte Stirn war nicht mehr rußig, sondern lediglich von den leichten Schweißtröpfchen heroischer Arbeit überhaucht. Eine andere hatte sich einen Rock aus weißer Fallschirmseide genäht. Die halbe Stadt schien sich aus den Vorratskammern der Elitetruppen versorgt zu haben. Er reichte ihr nicht einmal bis an die Knie, so daß sich alles nach ihr umdrehte und auf die nächste Bö wartete. Sie hatte erklärt: "Das hier ist nur eine Übergangslösung für mich. Ich klaube mir das nötige Kleingeld für den Anfang in München zusammen. Dann hau ich ab, kratze die Kurve." In der Zeitung las sich das etwa so: "Das hier ist eine Übergangslösung für mich. Bald werde ich die Spitzhacke mit dem Federhalter vertauschen. Ich will Neulehrerin werden und mir für das Geld, das ich hier verdiene, Bücher zum Studium kaufen." Ich kam mir vor wie ein Lügner. Ich wußte nicht mehr, woran ich bin.
Und weiß ich es denn? Auf der Suche nach Gatt. Beim Lesen des Manuskripts. Vier Jahre später. In einem leeren Abteil. In einem Zug, der durch die Nacht fährt, Schnee vor den Fenstern, Dunkelheit, nur hin und wieder ein Licht so weit wie das der Gestirne. Doch wem gehören die Worte, wem gehören die Sätze? Mir scheint, daß mein Fehler beim Schreiben schon darin bestand, Gatt nach dem Munde geredet zu haben, in dem verdammten naturalistischen Ehrgeiz, die Fakten für sich sprechen zu lassen. Fakten jedoch sind keine Kunst. Fakten sind lediglich Vorkunst. Und wenn ich ihm jetzt gegenübersäße wie damals in M., ich würde ihm von Leuten erzählen, gegen die sich die Trümmerfrau, die auf dem Bahnhof noch in eine Münchener Animierkneipe, in der Zeitung jedoch auf die Hochschule gehen wollte, ausnimmt, als sei sie die Mona Lisa. Wir alle, auch Gatt, sahen das Paradies des Menschen vor uns. Das Wintermärchen von Heine zählte zu unserer ersten Lektüre. Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Neulich las ich, es müsse jeder in seinem Leben einmal daran geglaubt haben, daß das Unmögliche möglich zu machen sei. Wieso nur einmal? Unsere Generation zeichnet die Ungeduld aus. Wir wollen mehr, wir wollen immer wieder mehr. Einer, der müde wird, der ist nicht nach unserem Sinn. Und manchmal im Eifer, im Übereifer, geschieht es dann, daß wir den Menschen zwingen wollen zu seinem Glück. Was also gilt, wenn die Vernunft siegen soll, die gewaltsame Korrektur einer unvernünftigen Meinung? Was ist die Mona Lisa vom Hauptbahnhof? Ein Fauxpas der Weltgeschichte. Nicht einmal das. Ja, ich muß mich erinnern, daß nicht Gatt erzählt, sondern daß ich es bin, der ihn erzählen läßt. Mir gehören die Worte. Und ich darf nicht warten wie er, in diesem Fall an der Sperre, die mir sein Stil setzt.
Ich kam mir vor wie ein Lügner. Ich durchschaute den Mechanismus der Redaktion noch nicht. Hoffte, die Trümmerfrauen würden niemals die Zeitung lesen. Grübelte, fühlte mich hinters Licht geführt und bebte vor Zorn. Dann wieder glaubte ich, wohl mehr um mich selbst zu beschwichtigen, es handle sich um einen der ebenso sagenhaften wie gefürchteten Druckfehler. So naiv war ich. Die halbe Zeitungsseite ein Druckfehler. Oder irgendein Setzer, ein verkappter Faschist, habe die Sätze den Frauen im Mund und mir unter der Hand umgedreht. Doch in der Besprechung wird das Interview gelobt. Meine Verbitterung nimmt nur zu. Ich folge, in Gedanken zunächst, dem Gang des Artikels. Wirtschaftsabteilung. Dritter Stock. In meinem Zimmer der brüchige Schreibtisch. Hier schrieb ich. Blick aus dem Fenster, und von gegenüber winken mir wieder die Mädchen aus der Kleiderfabrik zu. Da ich den Bleistift noch immer handhabte wie einen Bohrhammer, war mehrmals die Mine abgebrochen. Die deutsche Sprache ist wie Gestein, in das man hineinhämmern muß. Nachdem ich den Text aufs Papier gebracht hatte, Rückseiten von Kathreinertüten, ging ich zur Stenotypistin. Ich diktierte ihr in die Maschine. Sie unterbrach mich dauernd. Wechsle doch mal den Ausdruck, Genosse. Sagte, sagte, immerzu sagte... Nimm: erklärte: oder: gestand unter Erröten. Es gibt doch Leute, die nicht lesen, sondern nur die Wörter zählen, die sich auf einer Seite wiederholen... Vielleicht lag hier schon die erste Fehlerquelle. Ich zeige ihr den ausgedruckten Artikel. Sie bestreitet es zornrot, verlangt empört, daß ich mich sofort entschuldige. Danach dann hatte das Manuskript dem Abteilungsleiter vorgelegen. Er hatte nichts geändert. Von ihm wanderte der Artikel ins Sekretariat. Dort war einkorrigiert worden: Sie sollen im Frieden leben. Der Setzer, brav und bieder, kein Faschist, hatte die Korrektur nur gewissenhaft übernommen. Auf der Fahne dann, wiederum im Sekretariat, hatte man hinzugefügt: Deshalb helfe ich mit, ein neues Deutschland aufzubauen. Und auf dem Seitenabzug: bescheiden...
Ich schreibe die Wahrheit, sage ich. Schlage die Faust auf den Tisch. Ich lüge nicht. Ihr sitzt mit eurem breiten Hintern hier im Sessel und fälscht. Wenn's euch nicht paßt, daß ich die Wahrheit schreibe, geht selbst hin und fragt die Leute aus.
Koslowski, Leiter des Sekretariats, im Range eines Stellvertretenden Chefredakteurs, jung, aber mit grauen Schläfen schon, lächelt mich gelangweilt an. Er trommelt mit seinen gepflegten Fingernägeln auf die Glasplatte. Je mehr ich mich aufrege, desto heftiger klopft er. Foxtrott. Seine dünnen Lippen aber bleiben sich gleich. Ich sehe ein Grinsen. Ein paar Büroklammern hüpfen aus der Schale und beginnen zu tanzen. Er aber antwortet mit einer Ruhe, die mich aufbringt. Ich sehe rot. Und er? "Einverstanden. Kritik und Selbstkritik ist das Entwicklungsgesetz der neuen Gesellschaft. Du bist nicht parteilich genug gewesen. Dein Klassenstandpunkt läßt zu wünschen übrig. Das ist dein Fehler. Wir haben berichtigt, ohne dich vorher zu konsultieren. Das ist unser Fehler." Begreifst du den Unterschied? Nicht Fälschung, sondern Berichtigung. "Ab morgen bessern wir uns. Du schreibst parteilicher. Und wir informieren dich, sobald wir uns eine andere Meinung erlauben."
Du merkst es am Ton, an der kalten, herablassenden Höflichkeit. Von dieser Stunde an beginnt für mich ein Spießrutenlauf in der Redaktion. Die Peitsche ist die Grammatik. Mein Kopf wird wund davon. Es ist ein Schmerz, sage ich dir, der dich nachts aufschrecken und mit den Zähnen knirschen läßt. Ich bemühe mich redlich, parteilicher zu schreiben. Ich denke mir eine Methode aus, die es gestattet. Sobald ich wieder Leute zu interviewen habe, locke ich sie heraus. Zu einem Bekenntnis. Ich habe drei Kinder zu Haus. Damit sie satt werden, muß ich Geld verdienen. Sind Sie der Ansicht, frage ich dann, daß der Krieg nötig war, daß ein Hagel von Schutt und Asche über uns kommen mußte? Aber nein. Im Luftschutzbunker habe ich mir geschworen: Lieber ein Leben lang trockenes Brot, doch nie wieder Bomben. Möchten Sie nicht auch dafür sorgen, daß sich ein solches Grauen nie wiederholt? Natürlich, soweit das in meinen Kräften steht. Die kleinen Leute sind immer die Dummen. Glauben Sie nicht, daß auch Ihre Arbeit dazu beitragen könnte, ein friedliches Land zu schaffen? Ich hoffe es. Am Abend freue ich mich, wenn ich auf den Berg aus geborstenen Steinen blicke, den ich tagsüber abgeräumt habe. Ich brauche das Geld, aber es kommt ja von einer nützlichen Sache. Die Frau, mit der ich spreche, hat dann wirklich einen Schimmer von Hoffnung in den Augen.
Journalismus ist Schufterei. Mein Gehirn läuft sich Blasen auf der Suche nach Ideen. Wem sagst du das, Gatt? Ich selbst fürchte mich vor jedem Wort und noch mehr vor jedem leeren Blatt Papier, auf das ich ein Wort setzen soll. Weißes Papier gleicht den unerforschten Flecken auf einer Landkarte, mit der Spitze meiner Feder breche ich wie mit einem Buschmesser in Niemandsland ein. Das ist schlimmer, als wenn ich ein Dickicht zu zerschneiden hätte. Ich habe das Nichts. Und ich weiß, daß ich mich mit jedem Wort einen Schritt voranschlagen soll auf dem schmalen Pfad zur Wahrheit. Und du? Ich schinde mich, und ich bin leidlich zufrieden, sobald ich wieder einen Satz geschafft habe. Es ist, als hätte ich eine Spur von Kupfer aus dem Schiefer gehauen. Es blinkt, funkelt mich an. Was ich jedoch nicht einkalkuliere, sind die Intrigen, die hinter meinem Rücken gesponnen werden. Von Koslowski und, wie ich später erfuhr, von einer Gruppe um Koslowski.
Ich diktiere wie üblich meine Artikel der Sekretärin. Sie kennt sich besser als ich in der Rechtschreibung aus, und die meisten meiner Fehler übernimmt sie erst gar nicht. Manchmal bittet sie mich, ihr das Manuskript zu überlassen. Ich habe Angst davor. Ein solcher Antrag trifft mich jedesmal, als hörte ich von fern her ein Rauschen. Wassereinbruch. Den Stollen abdichten. Hoffentlich schaffen wir es. Aber auch sie weiß nicht genug. Ihre Schwäche sind die Kommas. In Grenzfällen der Groß- oder Kleinschreibung hadert sie stets mit dem Duden. Ich bekomme jeden Artikel zum Abzeichnen. Aber die Irrtümer, die auch ihr unterlaufen, übersehe ich. Das heißt, ich wage es gar nicht, sie als Irrtümer anzusehen. Ich habe schon eine riesige Hochachtung vor dem gewiß nur plump-vertraulichen Umgang der Sekretärin mit der Orthographie. Und dann ruft mich Koslowski an. Seine Stimme schnarrt. Über den Inhalt streitet er kaum noch. Lieber Genosse, wir hatten doch gütlich vereinbart, daß ich dich informiere, sobald ich mir Änderungsvorschläge gestatte. Es betrifft diesmal nur eine Kleinigkeit, die deutsche Sprache... Immer dieselbe zermürbende und erniedrigende Einleitung. Interesse trennt man Inter-esse. Denn das Wort stammt aus dem Lateinischen und bedeutet soviel wie dazwischensein, inter-dazwischen, esse-sein. Phantasie, mein Lieber, schreibt man mit Ph in diesem Falle, denn es handelt sich um die Bezeichnung für die menschliche Einbildungskraft. Fantasie mit F dagegen ist ein Musikstück, frei in der Form. Etwa so? Kennst du das? Er pfeift irgendeine Melodie durchs Telefon. Er weiß natürlich, daß ich sie nie gehört habe. Und er fragt mich: Bist du einverstanden, willigst du ein, Interesse Inter-esse zu trennen und Phantasie nicht mit F zu schreiben?
Ich bin's. Was sollte ich sonst sein? Ich fürchte mich nicht vor dem Augenblick, da eins meiner Manuskripte entdeckt wird. Ein Text, den die Stenotypistin noch nicht korrigiert hat. Es würde für mich sein wie ein Grubenunglück.
Die Stunde kommt. Die Freunde des Redaktionssekretärs schnüffeln ein paar handgeschriebene Seiten von mir aus. Sie fischen sie aus dem Papierkorb, lassen sie im Haus kursieren. Ich bin vorerst noch ahnungslos. Ich begegne nur spöttischen Blicken. Sie sind hinter mir her, und ich vermag sie nicht zu deuten. Die Stenotypistinnen stehen auf den Fluren und tuscheln. Bis eine absichtlich ein Blatt fallen läßt. Es taumelt vor meine Füße. Ich bücke mich, hebe es auf, starre auf eine Hektographie meines Artikels. Die Fehler sind mit roter Tinte unterstrichen. Ich kann dir die Zahl nicht mehr nennen. Unter einem dicken Querstrich jedenfalls das Urteil. Wie in der Schule. Rechtschreibung: Fünf. Zurückversetzt in die unterste Klasse.
Er preßte die Lippen zusammen, bis alles Blut aus ihnen gewichen war. Der Zorn über seine Demütigung überfiel ihn wieder wie damals. Nur langsam entspannte er den Mund. Und ich? Im Zuge nach Mansfeld bin ich auf seiner Seite.
Schluß. Ich pack meine Flebben jetzt, haue dem Kadermann meine Kündigung auf den Tisch. Endgültig Schluß. Von euch Sesselfurzern laß ich mich nicht schikanieren. Ich bin dir auf den Leim gegangen, Genosse Lockvogel. Staat und Macht. Die. Kommandohöhen