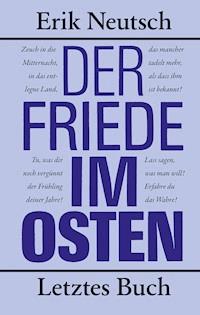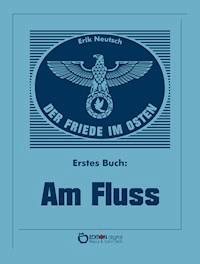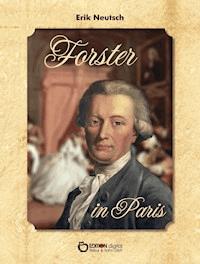7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ist es Mord, ist es Totschlag? Der allseits geachtete Facharbeiter Manfred Gütlein erschießt den Finanzdezernenten der Stadt, in der er wohnt, da er um seine Existenz fürchtet, auch um das Haus, das er sich zeitlebens erträumt und, unter Mühen, erbaut hat. Gewiss ist er der Täter, aber ist er nicht zugleich auch ein Opfer des Zusammenpralls zweier sich bisher feindlich gegenübergestandenen Gesellschaftsentwürfe ? Erik Neutsch, der in der DDR zu den meistgelesenen Schriftstellern gehörte, weil er in seinen Büchern die Intentionen vieler Menschen traf, geht in diesem Roman den Ursachen nach, die zu dieser Tat Gütleins führten. Mit weitgehend dokumentarischem Stil, ohne auf das Innenleben seiner Figuren zu verzichten. »Totschlag« ist eine erste Abrechnung mit dem, was - offenbar im Gegensatz zu ihm - andere als eine »geglückte« Vereinigung beider deutscher Staaten betrachten. Kritisch war er schon immer. Er bleibt dabei. Es gibt in diesem Roman keinen Bruch zwischen dem Autor Neutsch und seinen früheren Werken. Nach einer Zeit des Bedenkens und - wie er sagt - des »bewussten Schweigens« legt er in seinem erstmals 1994 erschienenen Roman wiederum ein Zeugnis seines erzählerischen Könnens vor. LESEPROBE: Schon in der ersten, dem Interview vorausgegangenen redaktionellen Meldung über eine vom Magistrat der Stadt einberufene Pressekonferenz war er mit seinen auch später für ihn typisch harschen Worten zitiert worden. Die Kaufverträge, erklärte er, die vor einem Jahr abgeschlossen wurden, entbehrten jeder Gesetzlichkeit und seien daher null und nichtig. Gott sei Dank, könne er da nur sagen, und zwar in Anbetracht des katastrophalen Finanzdefizits im städtischen Haushalt, sei bisher noch keine Eintragung in die Grundbücher erfolgt, was allein als Nachweis für die Rechtmäßigkeit von Besitz an jedem Quadratmeter Land zu gelten habe ... Das löste sofort Unruhe aus und erhob sich schließlich zu einem Aufschrei aller Betroffenen, der Häuslbauer in den Siedlungen ROSENGARTEN, AM HEIDERAND, VOGELSANG, in der Ortslage FREIIMFELD und selbstredend der FROHEN ZUKUNFT. Sein Echo hallte über die Telefone in die Amtsstuben des Finanzdezernats, blockierte für mehrere Tage die Leitungen, ließ bei jedem Anruf die Sekretärinnen erzittern, weil sie ihre Herren Bürovorsteher, die schon nicht mehr an die Apparate gingen, verleugnen und selber die Leute abwimmeln mußten, und überschüttete selbst die nun wirklich recht arg- und schuldlosen Putzfrauen dort, ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum
Erik Neutsch
Totschlag
Roman
ISBN 978-3-86394-779-8 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien 1994 im Dingsda-Verlag Cornelia Jahns. Querfurt.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
Auf Wunsch des Autors wurde nicht auf neue Rechtschreibung umgestellt.
© 2014 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Dieses Buch möchte als Mär verstanden werden, allerdings als eine deutsche: Nichts ist wahr oder alles. Personen und Handlung sind selbstredend frei erfunden. Sollten sich trotzdem Ähnlichkeiten mit der Wirklichkeit ergeben, so wäre es rein zufällig und bleibt Vermutung.
E. N.
1. Kapitel
Eines Tages, das war vorauszusehen - sofern man aufmerksam, nüchtern zwar, doch nicht ohne Anteilnahme, vor allem den Wandel der sozialen Verhältnisse in den neuen Bundesländern seit der Vereinigung beobachtete - hatte es zu einer solchen Bluttat kommen müssen, und zu hoffen blieb nur, daß sie nicht noch Schule machte! Sie war das Werk eines einzelnen, ja, eines Einzelgängers, lag also, obwohl durchaus vergleichbar, anders als ein Jahr zuvor der Fall Rohwedder, des damaligen Treuhandchefs, dessen Ermordung, wie bis heute vermutet, von einer extremistischen Terrorgruppe geplant und ausgeführt wurde, lag anders auch deshalb, weil sie nicht in einer Nacht-und-Nebel-Aktion erfolgte, sondern geradezu im klassischen Gewande, demonstrativ in aller Öffentlichkeit, sich abspielte.
So gibt es auch wenig zu recherchieren, zu enträtseln schon gar nicht, lediglich nachzuvollziehen, denn die Fakten liegen ebenfalls offen, vor aller Augen ausgebreitet und sind von Geheimnissen kaum umwittert. Dafür sorgte bereits die SATZ, die aus einem früheren SED-Organ hervorgegangene, mittlerweile von einem westdeutschen Medienkonzern aufgekaufte und gesteuerte Tageszeitung der Region, indem sie unentwegt berichtete. Zu Widersprüchen, eher Ungereimtheiten neigte sie nur in ihren Kommentaren, was jedoch dem ziemlich willkürlichen Ermessen der Redakteure überlassen blieb, etwa dann, wenn sie über die Motive des Täters nachzudenken versuchten. Übereinstimmung hingegen, und zwar total wie sonst selten auf ihren rund dreißig Seiten täglich, herrschte stets, sobald der Hergang und wohl auch die Genesis der Tat beschrieben wurden.
Weitere Quellen, woraus zu schöpfen sich anbietet, sind natürlich die Akten in Vorbereitung des Prozesses, soweit man an sie herankam und Einblick nehmen konnte, wobei kaum von Belang sein dürfte, daß Anklagevertretung und Verteidigung sich zumindest in einem Punkte frontal gegenüberstanden, sich nämlich jene auf Mord und diese auf Totschlag zu plädieren einrichtete, denn dergleichen Kontroversen sind ja allgemein üblich. Nicht üblich allerdings - und das zeigte sich hier ebenso wie in den Kommentaren der SATZ - war, wie das Motiv der Tat zu beurteilen sei. Das war neu. Bisher unbekannt, da in der deutschen, man muß genauer sagen: bürgerlichen Gerichtsbarkeit noch nie zuvor verhandelt, weshalb um Verständnis gebeten wird, wenn hier und dort - um der Gerechtigkeit zu dienen - auch Fiktives in den Zeugenstand gerufen wird.
Denkbar ist zweifellos, daß sich ein ähnlicher Fall, ob nun aus anderem Anlaß und mit anderem sozialen Hintergrund oder nicht, im Osten Deutschlands hätte zutragen können (oder noch zutrüge). Wäre das Motiv dasselbe, würde er sich zu dem hier geschilderten vollkommen kongruent verhalten, bis hin zur blutigen Katastrophe. Denn was zusammenprallte, war eine unterschiedliche Vergangenheit von über vierzig Jahren, eingeschlossen ein unterschiedliches Rechtsempfinden, sowohl beim Täter als auch beim Opfer, nach einem Leben beider auf dem Boden unterschiedlicher Gesetze.
2. Kapitel
Eines Tages also: 19. September 1991.
Im BÜRGERHOF von ***, einem Jugendstilgebäude, haben sich die Stadtverordneten zu einer turnusgemäßen Sitzung versammelt. Soeben wurde die Mittagspause beendet; die grünen Leuchtziffern der neuinstallierten Digitalanzeige über der breitgeflügelten Eingangstür des Plenarsaals springen auf zehn Minuten nach vierzehn Uhr. In den Bänken, die, bis auf die hinteren, für interessierte Zuhörer aus der Bevölkerung reservierten Reihen, nur spärlich besetzt wirken, kehrt allmählich Ruhe ein. Auf dem Podium, vor einem Triptychon, das die gesamte Stirnwand bedeckt und die Begrüßung König Heinrichs I. durch einst hier ansässige Landesfürsten und kirchliche Würdenträger darstellt, haben bereits der Präsident, seine Vertreter und einige Herren des Magistrats Platz genommen, unter ihnen Dr. Anselm Rothenburger, der Finanzdezernent der Stadt, Mitglied der SPD, der nach der CDU zweitstärksten Regierungspartei.
Zur selben Zeit, um 14:10 Uhr, betritt ein Mann den Saal, unbemerkt zunächst von allen Anwesenden, da man auch ihn für einen Gast aus dem Publikum hält. Er geht auf die freie Fläche unmittelbar vor dem Podium zu, zückt eine Pistole und feuert genau in dem Moment, als der Präsident die Konferenzglocke läutet, in kürzester Folge fünf Schüsse ab. Eine Kugel verfehlt ihr Ziel, schlägt in die Mitra eines Bischofs auf dem Gemälde ein. Die anderen vier treffen Dr. Rothenburger, in den linken Arm, in die Brust, eine zerschmettert sein Kinn.
Der Dezernent sackt vornüber zusammen, fällt mit dem Kopf auf den Tisch. Schreie durchgellen den Saal. Die Pistole poltert aufs Parkett, vor die Füße des Mannes, und der steht reglos, wie zur Statue versteinert.
3. Kapitel
In der Stadt sprach es sich noch am Abend herum, und selbstverständlich brachten es nächsten Tags die Zeitungen als knallige Meldung auf den Seiten eins. Zwar waren die Einwohner von ***, nach den Dezemberwahlen 1990 mit 187 624 angegeben (was freilich nicht mehr stimmen konnte, da noch immer an die hundert monatlich westwärts übersiedelten), an Verbrechen mittlerweile gewöhnt: Raubüberfälle auf Sparkassen, Vergewaltigungen, Diebstähle auf offener Straße, Einbrüche, Automarderei, Wirtschaftsdelikte größeren Ausmaßes, Schlägereien zwischen Neonazis und Linksradikalen, Gewalttaten gegen Ausländer und Prostituierte, auch an mysteriöse Leichenfunde gelegentlich - doch dieser Fall überschattete alle bisherigen.
Vielleicht, fragte man sich, hatte der Täter genau das beabsichtigt, und so wollte man zuallererst wissen, wer er denn sei. Dr. Rothenburger, sein Opfer, war ja den meisten Bürgern bereits ein Begriff. Seit dem Sommer hatte er sich in mehreren Interviews, bei denen es stets ums Geld ging und auf die noch zurückzukommen sein wird, zu Wort gemeldet, und auch in kommunalpolitischen Fernsehsendungen war sein Name erwähnt worden, sein Konterfei über den Bildschirm geflimmert.
Der Mann hingegen, der ihn erschoß, war bis dato ein unbeschriebenes Blatt. Er hieß Manfred Gütlein, war sechsundfünfzig Jahre alt, verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder.
Als er da stand, nach seiner Tat nun völlig reglos, erstarrt, machte er schon hierbei den Eindruck, als könne er keiner Fliege etwas zuleide tun. Von gedrungener Gestalt, mit gesenktem Kopf, den Blick auf irgendeinen imaginären Punkt auf dem Fußboden gerichtet. Wenig später wurde er abgeführt, und man konnte in sein Gesicht sehen. Die angegrauten Haare schütter, so daß die gelbliche Haut des Schädels hindurchschimmerte und als erstes die ungewöhnliche Größe der unbedeckten Ohren auffiel. Seine im Gegensatz zu der knöchernen Nase schwammig wirkenden Wangen waren von rosiger Farbe, wie bei einem, der regelmäßig sein Bier zu sich nimmt. Er schien zu schwitzen, obwohl der Raum trotz des hochsommerhaften Wetters draußen doch ziemlich kühl war. An den schmalen, fest zusammengekniffenen Lippen hingen ein paar Tropfen. Am meisten aber beeindruckten seine Augen. Unter buschigen Brauen ging von ihnen, grau wie die alten Pfennige, eine große Hilflosigkeit, gar Traurigkeit aus. So stellte sich wohl niemand die Augen eines Mörders vor. Bekleidet war Manfred Gütlein mit einer nach amerikanischer Farmermode rot und schwarz karierten Jacke über einem dunkelblauen Hemd mit aufgeknöpftem Kragen und einer leicht ausgebeulten Stretchhose aus beigebraunem Kord, was alles irgendwie nicht zusammenpaßte, wobei die Jacke jedoch, obgleich sich straff über seinem wohlgenährten Bauch spannend, ein gutes Versteck für die Waffe abgegeben hatte.
Äußerlich also war der Mann eine Allerweltserscheinung, eine von jener Art, die man, selbst wenn man öfter mit ihr zu tun gehabt hätte, im Vorübergehen auf Anhieb nicht wiedererkennt. Bleibt, worauf sich nun auch die Reporter stürzten, sein Leben zu skizzieren.
Manfred Gütlein - und von Jugend an, auch unter seinen Arbeitskollegen und nächsten Nachbarn in der Siedlung, wo er wohnte, nannte man ihn Freddi - war in einem Viertel der Stadt aufgewachsen, das von Mietskasernen, mehr noch wie Silos anmutenden, um die Jahrhundertwende erbauten Häusern geprägt wurde. In den Hinterhöfen lag seine Spielwelt, die, zwischen Mülltonnen, streunenden Katzen und ewig gierigen Ratten, der Phantasie nur wenig Raum bot, und wenn, dann wurde sie genährt von Kitschlegenden aus zerfledderten Dreigroschenheften. Es steht zu bezweifeln, ob er je in seiner Kindheit ein Stückchen heiler Natur sah, einen tieferen Wald beispielsweise, Felder und Wiesen mit dem Blick bis zu fernen Hügeln. Er war das dritte von fünf Geschwistern, die seine Mutter zuletzt allein großzog, da sein Vater, Soldat vom Frankreichfeldzug an, im Kessel von Stalingrad blieb, seither als verschollen galt. Nie erfuhr die Familie, wie er gestorben war. Freddi erinnerte sich seiner als eines recht sprunghaft handelnden Mannes, jedenfalls was seinen Umgang mit den Kindern betraf. Mal griff er rasch zum Riemen und prügelte sie wegen kleinster Verfehlungen, ein andermal überschüttete er sie mit Süßigkeiten, und zwar meist, wenn Lohntag war und er nach Alkohol roch. Trotz allem liebte er ihn, sprach in seinem nunmehr schon grauen Alter mit einer gewissen Dankbarkeit von ihm, denn unter seinem Begleitschutz waren er und seine Brüder manchmal doch über die Hinterhöfe und engen Straßenschluchten auf dem Schulweg hinaus gelangt, sei es auch nur bis zu der Schneise, mit welcher der mehrspurige Eisenbahndamm das Mietskasernenviertel von einer besseren Wohngegend trennte, um im Wildwuchs seiner Böschungen Löwenzahn, Klee und anderes Grünfutter für die hauseigenen Kaninchen zu sammeln. Als abgemacht galt auch, daß sie mit ihm kaum einen Jahrmarkt versäumten, die Rummelplätze besuchten, sobald sich dort die Zuckerbuden zeigten, Karussells, Achter- und Gespensterbahnen. Nur Freddis Schwester mochte er nicht, die Letztgeborene, und erst später wurde ihm klar, was seinen Vater abstieß: Sie war nicht seine leibliche Tochter. Lange nach dem Krieg, als sie ihre Söhne für erwachsen hielt, zog dann die Mutter mit einem Mann zusammen, einem abgehalfterten, einst für die sogenannte Heimatfront uk-geschriebenen Sicherheitsinspektor der Flugzeugwerke, in denen sie arbeitete, der, obgleich es Freddi mit Bestimmtheit nicht bis heute sagen konnte, durchaus der wirkliche Vater von Brigitte, seiner Schwester, hätte sein können.
In die Irrungen ihrer Ehe, gar in deren Geheimnisse weihte die Mutter ihre Kinder nicht einmal mit Andeutungen ein; sie klagte auch nicht. Von Photographien aus ihrer Jugend, Hochzeitsbildern und dergleichen, wußte Freddi: Sie muß schön und von Freiern umworben gewesen sein. Ihre Verschlossenheit, Sprachlosigkeit selbst gegenüber ihren Kindern lag vielleicht daran, daß sie fortgesetzt mit ihrem Schicksal haderte und eine Art verborgenen Stolz in sich trug, der sich mit dem Leben in den gesellschaftlichen Niederungen der Wohnsilos nicht abfinden wollte.
So blieben seine Beziehungen zu ihr bis zu ihrem Tode - sie starb vor vier Jahren - recht kühl, obwohl er sich eingestand, daß er ohne ihre Strenge nicht das geworden wäre, wofür er sich hielt: für einen »ordentlichen Menschen«. Frühzeitig schon hatte es ihn von ihr fortgetrieben, doch wohl mehr - um gerecht zu sein - von der allzu beengten Häuslichkeit als von ihr. In Liebesdingen wenig bewandert, von der alleinstehenden Mutter schon aus überkommener Scham nicht darin aufgeklärt, eher von seinen älteren Brüdern mit all den Fragwürdigkeiten eines solchen Unterrichts, demzufolge alles andere als ein Schürzenjäger, konnte es kaum verwundern, daß er sich bald, bei erster intimerer Gelegenheit, in ein Mädchen vergaffte, das ihm in vielem glich, in seiner Unerfahrenheit wie in seinem keineswegs unduldsamen, treumütigen Charakter. Sie hieß Inge, war zwei Jahre jünger als er, und nachdem sich bei ihr ein Kind anzeigte, heiratete er sie ohne zu zögern. Das geschah im Sommer sechsundfünfzig, und schon im Herbst darauf wurde seine Tochter geboren, sein »Goldsegen«, Simone, die, wie man sehen wird, ihm nun eine nicht sehr seriöse Presse zusätzlich anlastet.
Fritzgerald, sein Sohn, kam erst zehn Jahre später, neunzehnhundertsechsundsechzig, zur Welt. Da hatten Freddi und seine Frau bereits begonnen, sich ein eigenes Haus zu bauen, und zwar auf dem vom Liegenschaftsamt dafür freigegebenen Ödland zwischen zwei eingemeindeten Dörfern jenseits des Flusses, auf der Westseite der Stadt. Interessenten hatten sich genug gemeldet, doch sollten die Parzellen vor allem an kinderreiche Familien verteilt werden. Simone allein zählte da nicht. Also gingen sie fleißig ans Werk, zeugten ihren Sohn und ließen durchblicken, daß sie, immerhin beide im besten Alter, erst um die dreißig, für weiteren Nachwuchs schon noch sorgen wollten. Wenn es dann später nicht funktionierte (oder sie beide dem Funktionsausfall etwas nachhelfen würden), wer, dachten sie, welcher Ministerrat und sonstwie geartete Institution, könnte sie dafür zur Verantwortung ziehen? Hauptsache war, ihr Antrag würde genehmigt, und wenigstens hätten sie, vor aller Augen sozusagen sichtbar, mit Inges erneuter Schwangerschaft ihren guten Willen bekundet. Aus diesen rein taktischen Erwägungen, um zu dem erträumten, langersehnten Eigenheim zu kommen, erklärt sich der wohl doch etwas hohe Altersunterschied zwischen Tochter und Sohn. Allerdings brauchten sie ihren Entschluß, sich ein zweites Kind anzuschaffen, nie zu bereuen. Sowohl Simone als auch Fritzgerald bereiteten ihnen, von wenigen Querelen nach Trotzköpfchenart mal abgesehen, bis in die jüngste Zeit hinein bei weitem mehr Freude als Kummer. Sie studierte im entfernteren Halle Geschichte und Staatsbürgerkunde, wurde Lehrerin in einer noch entfernter gelegenen mecklenburgischen Kreisstadt, wo sie mit ihrem Mann und zwei Kindern allem Anschein nach traut und zufrieden lebte; er wählte einen technischen Beruf, diente drei Jahre in der Nationalen Volksarmee, beim Bodenpersonal einer Jagdfliegereinheit, war danach von seinem Betrieb auf eine Ingenieurschule delegiert worden mit der festen Zusicherung, nach dem Examen von ihm wieder eingestellt zu werden.
Ja, sie hatten Glück mit den beiden, konnten sich glücklich schätzen als Eltern. Er, gelernter Schlosser, doch seit langem bereits als Meister in der Maschinenfabrik am Orte tätig, ernst genommen von allen Seiten, Kollegen wie Vorgesetzten, hatte es, blickte er zurück, weiß Gott wirklich weit gebracht, und die Kinder, das war vorauszusehen, würden ihn darin sogar übertreffen.
So jedenfalls spiegelte sich in Freddis Gedanken noch bis vor kurzem, genauer: bis zur Mitte dieses Sommers, sein Leben. Es war, seit er sich von zu Hause getrennt, ziemlich geradlinig, ohne besondere Zwischenfälle verlaufen. Zwei tiefere Zäsuren, doch Höhepunkte zugleich, hatte es gegeben: Seine Hochzeit mit Inge und ihr Einzug in das Einfamilienhaus, das nun mitten in einer, sich von Jahr zu Jahr mehr ausdehnenden Siedlung mit ungemein gepflegten, sprießenden, blühenden Gärten stand.
Jetzt aber drohte ein dritter Einschnitt. Und der konnte verheerend sein.
4. Kapitel
Was sich am Morgen nach der Tat in den Zeitungen, obzwar im Fettdruck, doch noch relativ nüchtern las, fand zur selben Stunde im Grasmückenweg Nr. 16 schon seine rabiate Fortsetzung. Um sich gegenseitig in der Berichterstattung den Rang abzulaufen, hatten gleich mehrere Blätter ihre Reporter hierhergeschickt. Die Straße war von Autos blockiert, und vor Freddis Grundstück drängelte sich ein Haufe von etwa einem Dutzend Menschen, mit gezückten Notizblöcken die einen und schußbereiten Kameras die anderen, jeden Augenblick darauf bedacht, etwas Unvorhergesehenes, wenigstens ein Sensatiönchen einzufangen. Einer der Photographen kletterte gar über den Jagdzaun, schlich sich ums Haus, knipste wild durch die Gegend, bannte selbst den Hühnerstall und die Schuppen im Hof aufs Zelluloid; es war ja sein Job, und wer konnte wissen, wofür das noch einmal gut sein würde. Die Frau von Gütlein hatten er und andere ohnehin schon im Kasten; sie hatte, unvorsichtig, halb ängstlich, halb wütend, in gar keinem Fall jedoch auf diese Belagerung vorbereitet, ein Fenster geöffnet, sich hinausgelehnt und dieser Meute mit ein paar Worten zu erwehren versucht. Schnapp, klickten die Apparate. Da war sie verewigt. Nur in Kittelschürze und mit zornverzerrtem Gesicht. Das gab fast ein Titelbild ab.
Hagen Ducknitz von der SATZ verzog darüber freilich verächtlich den Mund. Es war nicht sein Gebaren, und immer noch hoffte er, daß sich die Konkurrenz aus dem Staube machte. Er wollte was Besseres, kam sich zu popelig vor, den Leuten, wie er sich ausdrückte, in die Unterwäsche zu schnüffeln, hatte eher ein Interview mit Frau Gütlein im Sinn. Dazu jedoch brauchte er sie für sich allein, und vielleicht rührte seine Denkart, seine Fairneß (oder täuschte auch sie?) noch von den Zeiten her, da er schon stellvertretender Chefredakteur der SATZ gewesen war, als sie noch VOLKSMACHT geheißen.
Tatsächlich, er hatte sich emsig gewandelt, den politischen Ballast von einst beiseite gekippt, seine Sozialismusgläubigkeit unter anderem, mit der er sogar noch Mitte Oktober neunundachtzig (und was für ein Esel war er gewesen!) das Kerzengeflimmer an der Sankt-Georg- Kirche mit seinen Artikeln gern ausgepustet hätte, und sich neuen Idealen verschrieben: free dom and democracy, nein, nicht jenen, die Brecht angeprangert, sondern der echten Freiheit, der wirklichen Demokratie, eben der deutschen, und so hielt er es nur für verdient, wenn er bis heute stellvertretender Chefredakteur zu bleiben gedurft hatte. Keiner mehr, der ihm wie früher die SED-Stadtleitung, deren Sekretariatsmitglied er gewesen, da fürs Lokale zuständig, ins Handwerk pfuschte, ihn gängelte, ihm schon das Maul stopfte, noch ehe er zu sprechen gewagt. Außerdem dreitausendfünfhundert Mark monatlich, rund das Doppelte seines Gehalts von damals, in harter Währung obendrein. Doch dafür mußte er allerdings auch etwas tun, zum Beispiel wie jetzt den Fall Manfred Gütlein übernehmen, der einen Dezernenten der SPD erschossen hatte, und so darüber berichten, daß sein oberster Dienstherr in Düsseldorf mit ihm zufrieden sein konnte. Seine große, einmalige Chance bestand darin: Er kannte den Mann von früher, den Kumpel Freddi.
Zunächst aber - und das hatten bereits der gestrige Abend und die Nacht gezeigt - gestaltete sich das Ganze noch wie ein Rätselraten, ein Puzzle um die Motive. Polizei und Justiz oblag es, die einzelnen Teile zusammenzufügen, doch Ducknitz hegte von vornherein Bedenken, ob das beiden so schnell gelänge, denn längst erwiesen sie sich, was sie nicht einmal selber leugneten, angesichts der Flutwelle von Kriminalität, die die neuen Bundesländer überschwappte, als völlig überfordert. Die Aufklärungsrate für Kapitalverbrechen, von Taschendiebstählen und ähnlichem Kleinkram ganz zu schweigen, spottete jeder Beschreibung, verlor sich im Osten wie in ein Niemandsland, betrug bei Banküberfällen knapp die Hälfte und bei Tötungsdelikten nur etwa siebzig Prozent. Das allerdings erhöhte die Chancen der Zeitungen, eigenmächtig zu recherchieren und für leserködernde Schlagzeilen zu sorgen.
Davon ging er aus, so auch jetzt, als er an einem anderen Fenster kurz das Wackeln der Gardine zu bemerken und dahinter die Frau wiederzuentdecken glaubte, jedenfalls den rötlichen, einer menschlichen Silhouette entsprechenden Schimmer, und überlegte, wie er seinen Konkurrenten rechts und links entrinnen und mit seinen Fragen zu ihr vordringen könnte. Geld war das Stichwort; er müßte ihr ein Honorar anbieten und zur Not die Summe solange steigern, bis es ihr die Zunge lockerte. Die Marktwirtschaft, hatte er schlicht gelernt, ihr Einmaleins, das darin bestand, für alles einen Preis zu fordern, würde wie allüberall so gewiß auch hier Tür und Tor öffnen. Je höher der Preis, desto niedriger die Moral, und seine Sache war es nicht, daran zu rütteln. Aber, begann er zu zweifeln, wälzten nicht auch seine Nebenleute schon ähnliche Gedanken in ihren Köpfen und handelten Geld gegen Leben?
Was jedoch seine Beobachtung betraf, so irrte er nicht.
Inge Gütlein stand am Fenster des zur Straße hin gelegenen Wohnzimmers, nachdem sie ihren Platz gewechselt, von der Küche hierher, sich auch umgekleidet, statt der Kittelschürze einen roten Pullover übergestreift hatte. Ihre innere Verfassung glich einem Beben, durchzuckte ihren Körper, sie schluchzte schniefend vor sich hin, konnte die Tränen nicht unterdrücken, starrte auf die da draußen, die nicht ans Umkehren dachten und noch immer ihr Haus photographierten.
Wenn doch ein Nachbar käme! Und warum fand denn keiner den Mut, die Plage dort zu vertreiben? Hatten sie nicht auch im Herbst vor zwei Jahren geschrien: Wir sind das Volk, von uns geht die Macht aus? Längst mußten sie doch bemerkt haben, wie ihr zugesetzt wurde. Von diesen Schmeißfliegen! Oder fürchtete sich auch Otto Kuhnt vor ihnen, der Rentner aus der Zwölf schräg gegenüber, Freddis Zuchtfreund, der ihr gestern als erster die Nachricht überbracht hatte?
Sie war wie gelähmt gewesen. Sie hatte von nichts geahnt. Und woher denn bloß hatte Freddi sich die Pistole beschafft?
Sie war in den Garten geflohen, verkroch sich unter der Laube, wollte niemanden sehen. Gerald weit fort in Nürnberg, Simone mit ihren eigenen Sorgen, zwar noch im Osten, doch keineswegs näher. Sie müßte beiden sofort ein Telegramm schicken. Sie fühlte sich unsäglich einsam, allein gelassen und nun wie ein wundes Tier gehetzt.
Da kauerte sie auf der Bank unter den Weinreben, die Freddi am Ende des Gartens, an der Grenze zur Querstraße und darüber hinaus zur Feldmark, über ein Spalier in zweieinhalb Metern Höhe wie ein Dach gezogen hatte, so daß es ein Einfaches war, wenn man sich nur auf die Zehen stellte und die Hände ausstreckte, die Trauben zu pflücken. Schlaraffenland taufte er den Ort. Er hatte diese Pflanzart aus dem Kaukasus mitgebracht, wohin er einmal von seinem Betrieb mit der Auszeichnung als Aktivist eine Reise erhalten und an einem Winzerfest teilgenommen hatte.
Hier saßen sie oft, von den ersten milden Tagen im Frühjahr bis in den Herbst hinein, die Freunde aus der Nachbarschaft, den Wegen mit Namen von Singvögeln: Grasmücken, Rotkehlchen, Kohlmeisen, den beiden Dichterstraßen, nach Theodor Storm und Wilhelm Raabe benannt, manchmal auch die Kollegen aus der Maschinenfabrik, und stets in Eintracht, wenn sie dann ihre Belange besprachen. Freddi - Inge könnte darauf einen Eid schwören - wurde von allen geachtet; er war, kam es trotzdem einmal zum Streit, der ruhende Pol in der Runde, und seine Meinung wog schwer. Wurde es spät an den Abenden und kühl, zündeten sie im Außenkamin die Birkenholzkloben an, wärmten sich am Feuer und wohl auch am Nordhäuser Korn, grillten Bratwürste auf dem Rost, hoben die Bierkrüge und tranken sich zu, zwar gelegentlich mehr als sie Durst verspürten, doch geschah es ebenfalls nur, empfand sie, dem geselligen Klima zuliebe sowohl in der Siedlung, die, kaum daß sie gegründet, FROHE ZUKUNFT hieß, als auch am Arbeitsplatz.
Von ihrem Garten aus sah man die Weite des Himmels, in klaren Nächten die Sternbilder kreisen und tagsüber, wovon Freddi noch mehr schwärmte, die Ferne unter der Sonne flirren bis zu den Kirchtürmen anderer Ortschaften. In seiner Kindheit von der Enge der Hinterhöfe fast erschlagen, atmete er, seit er das Haus gebaut, frische und freie Luft, und es verstrich keine Woche, in der er das nicht wenigstens einmal betonte. Nicht selten stieg er gar auf den Dachboden, öffnete die Luke, spähte hinaus wie von einem Wachturm und ergötzte sich an den dahinflitzenden Lichtern der in der Dunkelheit unsichtbaren Autos auf der Trasse, die im Bogen die Siedlung umging, nach Westen führte und sich erst am schwarzen Horizont in den Hügeln verlor.
Achthundertundfünfzig Quadratmeter umfaßte ihr Grundstück, im Winkel vor der Laube aus Wein mit einem Teich versehen, den Freddi, wie alles andere ebenfalls, in mühevoller Arbeit, bis auf ein paar Nachbarschaftshilfen, allein angelegt hatte. Auf dem kleinen Gewässer schwammen Zierenten, in seinem Schilf quakten manchmal auch Frösche, Libellen surrten darüber hin, und in der Voliere hielt er exotische, meist, weil winterfest, australische Sittiche, Brutpaare, deren Junge er an Liebhaber verkaufte.
Inge jedoch wußte, daß ihn weniger dabei die Einnahmen reizten, wenngleich das Geld die Haushaltskasse nicht unwesentlich aufbesserte. Viel wichtiger war ihm, er konnte im Verein seine Zuchtergebnisse präsentieren, die malvenfarbenen Schecken von Wellensittichen als seinen Erfolg feiern lassen. Sie verstand ihn, sie teilte seine Freude, an dem Heim, an dem Garten.
Der Kredit für das Haus war getilgt, und auch den Boden hatten sie noch während der letzten Tage der alten Regierung käuflich erwerben können. Doch seitdem wurde die Rechtmäßigkeit ihres Vertrages zunehmend in Zweifel gezogen. Schon hatten sich diejenigen Bürger der Stadt, denen es ähnlich erging, zusammengetan und mit Protestkundgebungen dagegen gewehrt...
Auf der Bank unter dem Weindach fand sie am gestrigen Abend der Polizist, der ihr die Vorladung ins Kriminalamt aushändigte. Um elf Uhr heute sollte sie sich dort melden. Wie aber würde sie unbelästigt an der Meute von Photoreportern vorbei auf die Straße gelangen? Jetzt hörte sie aus der Küche den Kuckuck rufen. Es war neun.
5. Kapitel
Das Land hinter dem westseitigen Steilufer des Flusses, zwischen den beiden in den dreißiger Jahren eingemeindeten Dörfern Baalau und Connewitz, hatte das Aussehen einer Wüstenei, als sich die ersten Leute hier einfanden, um es zu kultivieren: von Porphyrkuppen übersät, auf dem felsigen Untergrund, der nur schwer das Regenwasser durchsickern ließ, sumpfartige Tümpel, umwachsen von niedrigem, wirtschaftlich wertlosem Strauchwerk, Ginster und Weißdorn, und verkrüppelten Bäumen. Die Siedler nannten es ihr Klein-Kanada, bevor sie sich, als die Gegend nach ihren Wünschen Gestalt anzunehmen begann, mit Häusern und Gärten, auf die Bezeichnung FROHE ZUKUNFT einigten.
Nun dehnte sich die Siedlung in einem nahezu strengen Geviert bis an die Reste der ursprünglichen Landschaft aus, von der Bushaltestelle in der Connewitzer Straße über fast einen Kilometer die Theodor-Storm-Straße entlang, an deren nördlichem Ende schon die blaugestrichenen Planken der sowjetischen Kaserne zu erkennen waren, und die gleiche Strecke wieder über die parallel verlaufende Wilhelm-Raabe-Straße zurück, beide im Grundriß wie die Holme einer Leiter wirkend, deren Sprossen die Wege mit den Vogelnamen bildeten. Insgesamt betrug die Fläche gut zwanzig Hektar; darauf standen über hundert solcher Eigenheime wie die Gütleins eins besaßen, großzügiger die einen, bescheidener die anderen, und immer noch wurde gebaut, gab es vereinzelt auch noch brachliegende, wenngleich bereits mit Nutzungsrechten ausgestattete Grundstücke.
Die Siedlung glich zweifellos einer Idylle, war ein Fleckchen Himmel auf Erden für ihre Bewohner, und so verwundert es nicht, daß jeder auch jeden kannte, jedes aus dem Alltag sich abhebende Ereignis die Gemüter erregte.
Nein, einen Totschläger, gar einen Mörder hatte es in dieser braven Gemeinschaft von Bürgern noch nicht gegeben. Einen Selbstmord, ja, einen einzigen, doch der lag schon lange zurück, zehn Jahre inzwischen, und wie es dazu gekommen war, wußte ebenfalls jeder. Es betraf Holger Fahrmann aus dem Goldammernweg. Eines Tages, in der Morgendämmerung jenes fernen Winters, fand man ihn erhängt an dem Ahorn, einem der wenigen Bäume, die stärker als das Krüppelholz rundum gewachsen und nicht gefällt worden waren und der seine mächtigen kahlen Äste über den Hof breitete. Erst da jedoch wurde die ganze verteufelte Geschichte mit seiner Frau publik. Die Weiber klatschten es über die Gartenzäune, aber wie das so ist in solch einer Siedlung, jetzt wollte eine jede schon immer etwas mehr in Erfahrung gebracht haben als die andere.
Gudrun, sagten sie, war ein leichtlebiges Luder. Hübsch, aber von oben bis unten, von den Wimpern bis zu den Zehennägeln getuscht und gelackt. Gold um den Hals, um die Handgelenke, und an den Fingern mehrere Ringe, über dem Trauring sogar einen zweiten mit Brillanten. Das kastanienbraune Haar, ob lose oder zu Zöpfen geflochten, hing ihr bis an den Allerwertesten, schon das ein Blickfang für alle krummäugigen Männer. Doch gerade darauf schien sie es anzulegen, und wenn sie sich wirklich einmal, was sie anfangs noch ohne sich groß zu zieren getan hatte, im Garten zu schaffen machte, so trug sie, um sich ja keine Schrunden an ihrer zarten Haut zu holen, Gummihandschuhe. Davon brachte sie mehr als nötig aus dem Klinikum mit, denn sie war Krankenschwester und arbeitete im Schichtdienst. Jedenfalls gab sie das vor, wobei es kaum jemand aus der Nachbarschaft hätte überprüfen können. Merkwürdig blieb nur, daß sie oft auch nachts unterwegs war, ihren Schichten eine nächste oder gar übernächste anhängte, was sie - und man konnte es glauben oder nicht - mit Personalmangel begründete, es sei eben wieder einmal ihre Ablösung nicht erschienen. Um ihre vier Kinder indes, zwei Jungen und zwei Mädchen wie die Orgelpfeifen, im Alter zwischen zwei und acht, kümmerte sich die Oma, Fahrmanns Mutter, die auch den Haushalt besorgte. Wochentags brachte sie die drei jüngsten in der Krippe und im Kindergarten unter, die schon damals eingangs der Theodor-Storm-Straße lagen, sonntags war sie nicht selten mit den Enkeln allein.
Holger, ihr Sohn, dem zuliebe sie jedes Opfer auf sich nahm, war Schweißer. Er meldete sich als einer der ersten an die Trasse, ging nach Orenburg oder wo sonsthin ins weite Rußland, verpflichtete sich für mehrere Jahre und hoffte, sich nach seiner Rückkehr vom Ersparten und ohne die allgemein übliche vermaledeite Wartefrist ein richtiges Auto leisten zu können, Wartburg oder Lada, anders als der Trabant, den seine Frau jetzt fuhr. In dieser Zeit, munkelte man, muß es passiert sein, während andere jedoch meinten, es habe schon früher begonnen, sie sei bereits seit ihrer Ausbildung als Schwester hinter Ärzten und solchen, die es werden wollten, herscharwenzelt, und habe sie nicht auch Fahrmann einmal mit Beyer, dem Journalisten aus dem Falkenweg, ihrem Gartengegenüber, in den STEINEN, dem Rest Ödland hinter der Siedlung, beim Techtelmechteln erwischt? Woher auch sollte sie sonst all ihre Kettchen und Reifchen haben! Geld und Gold stinken zwar nicht, doch ihre Schmucksammlung roch verdächtig nach Freierslohn für gewisse Dienste. Später gar hieß es, sie sei auch, während Holger sich im fernen Ural Frostbeulen holte und von Mückenschwärmen habe plagen lassen, in Leipzig gesehen worden, zur Messe und in teuren Hotels, angesetzt womöglich von der alten Regierung, um für die Staatskasse dringend benötigte Valuta einzuheimsen.
So also, mokierten sich die Leute, sähen ihre Nachtschichten aus. Voll akzeptiert worden war sie nie von den Siedlern, im Gegensatz zu ihrem Mann, der als ein stiller und fleißiger Mensch und - für bedauernswert galt. Bei ihr jedoch konnte man ja nicht wissen, zu welchen illustren Geschäften sie noch fähig war.
Im Winter vor zehn Jahren nun kam Fahrmann aus der Taiga zu seinem letzten längeren Urlaub nach Haus. Weihnachten stand vor der Tür, und er sehnte sich nach seiner Familie, nach Gudrun. Irgend jemand jedoch muß es ihm da gesteckt, ihm von ihren Eskapaden während seiner Abwesenheit erzählt haben. Vielleicht war es die Mutter, die alte Frau, die danach dann durchdrehte und immerfort jammerte: Das wollte ich nicht, das habe ich nicht gewollt ... Nicht einmal einen Abschiedsbrief hinterließ er. Holger Fahrmann ging ins Magazin vor den Toren der sowjetischen Kaserne, kaufte sich dort seinen geliebten Wodka, zwei Flaschen Stolitshnaja, wie Augenzeugen bestätigten, ließ sich vollaufen, griff zur Wäscheleine und erhängte sich, drei Tage vor Heiligabend, an dem Ahorn in seinem Hof.
Gudrun Fahrmann kehrte wenig später der Siedlung den Rücken, zog mit ihren Kindern irgendwohin; niemand hörte noch etwas von ihr. Die Mutter fand Unterkunft in einer Heilanstalt; vor kurzem soll sie gestorben sein.
Was aber bedeutete schon diese Affäre, gemessen an der Tat, die im Mittelpunkt nun Freddi Gütlein sah?!
Einhundertundfünf Familien - und rechnete man sie mit all ihren Kindern und Kindeskindern zusammen, so wohnten jetzt an die sechshundert Menschen hier - waren aufgeschreckt, aufgestört wie ein Ameisenhaufen beim Einsturz, nervös wohl vor allem deshalb, weil es nicht irgendwer, sondern der Finanzdezernent war, dem der Anschlag gegolten hatte. Man glaubte den Grund zu kennen, ohne erst das Ergebnis der Ermittlungen abwarten zu müssen, und so herrschte nach dem neunzehnten September in den Häusern und Straßen nur das eine Gesprächsthema vor, und man beschwor auch wieder die Vergangenheit, hielt sich noch einmal vor Augen, wie es hier seinen beschwerlichen Anfang genommen hatte, in der Zeit, als anstelle der Gärten noch Wüste gewesen war.
In der Siedlung lebte ein nach Berufen bunt zusammengewürfeltes Völkchen, selbstverständlich männlichen und weiblichen Geschlechts (was das in Mode gekommene Innen bei jedem Wort überflüssig machen soll): Handwerker aller Art, Maurer und Zimmerleute, Tischler und Schlosser, Klempner, Elektriker, Verkäuferinnen und FriseurSen (wobei hier die Doppelung, wie sie auch Ducknitz in seinen Artikeln gebrauchte, angebracht wäre), Facharbeiter die meisten, etliche Ingenieure, zwei Lehrerinnen, die eine mit einem Lokomotivführer, die andere mit einem SED-Funktionär verheiratet, eine Richterin, zwei höhere Offiziere, ein Komponist, ein Zeitungsmann (jener Beyer), manche inzwischen schon Rentner, zwei »Verdiente Meister des Sports« - Langstreckenläufer, die olympische Medaillen geholt hatten - und vorn, an der Connewitzer Straße, in den sogenannten Intelligenzhäusern, Baujahr 1953 bereits, zwei Professoren der Medizinischen Akademie, ein Architekt, ein Werkleiter ... Die Liste ließe beliebig sich fortsetzen, doch würde sie nur das eine bestätigen: Gewiß, es bestand eine soziale Mischung, vielleicht sogar Schichtung, die aber bisher kaum in Erscheinung getreten war. Viel eher hatten sich Unterschiede im Praktischen gezeigt, so etwa, dachte man an die Erschließung, an die Urbarmachung des hiesigen Geländes. Da hatten die einen kräftiger zugepackt als die anderen (was jedoch quer durch die Berufsgruppen verlaufen war), hatten die einen goldene Hände bewiesen, während die anderen, an körperliche Arbeit weniger gewöhnt, teils mit höheren Geldbeträgen geholfen, teils aber auch dadurch, daß sie ihre Beziehungen hatten spielen lassen, etwa bei der Beschaffung von Baumaterial und Maschinen.
Letztere waren besonders gefragt, als die ehemalige Rollbahn, eine spatenstichdicke Betonplatte, im unteren Abschnitt der Siedlung, zertrümmert und hinweggeräumt werden mußte. Sie war der Kaserne angegliedert gewesen, die einst der Wehrmacht gehört und nach dem Kriege von den Sowjets besetzt worden war, hatte kleineren, einmotorigen Flugzeugen wie dem Fieseler Storch zum Starten und Landen gedient, dann jedoch kein militärisches Interesse mehr gefunden. Und trotzdem, entsann man sich, trotz aller aufgebotenen Technik war man nicht ohne Spaten und Schaufeln, Spitzhacken und Schubkarren ausgekommen, als man ihr damals auf den zähen, von Grasnarben inzwischen überdeckten Leib rückte. Diese Piste, ja, der Kampf gegen sie, wie sie es nannten (oder wenigstens bis in den Herbst neunundachtzig hinein noch genannt hatten), mit der Knochenarbeit und den Schmerzen in allen Gliedern, hatte wohl mehr als anderes das Gefühl ihrer Zusammengehörigkeit gestärkt, das Gefühl, aufeinander angewiesen zu sein, und hörte sich nun, heute, plötzlich erneut mit leiser Verklärung, an, als sei tatsächlich auf ihren Trümmern eine Art Schicksalsgemeinschaft gewachsen.
Manfred Gütlein, vom Professor im ferneren Teil der Raabestraße bis zum Maurer von nebenan geduzt und vertraulich Freddi gerufen, war einer der aktivsten beim Kampf gegen die Piste, aber auch später, beim Ebnen meterhohen Mutterbodens, beim Anbringen der Zäune, beim Pflanzen und sonstigen Werkeln, versagte er niemandem seine Hilfe. Wurde er nach den Gründen gefragt, winkte er ab, zeigte ein schiefes, verlegenes Grinsen, öffnete kaum seine schmalen Lippen, nuschelte: Ich bin nun mal so, bin so erzogen ... Nur wenige wußten, daß es gelogen war. Was jedoch die Rollbahn betraf, so handelte auch er nur aus Eigennutz. Je eher sie verschwand, desto besser war es für den Fortgang. Der Platz, auf dem sein Haus gebaut werden sollte, war vom Beton fast völlig versiegelt. Zwar ratterten Tag und Nacht darauf die Preßlufthämmer, krachten die Greifer ins Gestein, heulten die Motoren der Kipper, doch der Rest blieb ihm und Inge überlassen, wenngleich auch zu ihm, kaum daß sie sich kennengelernt, einander vorgestellt hatten, die künftigen Nachbarn und jetzigen Leidensgenossen kamen und Hand anlegten.
In allen freien Stunden, abends schon unterm Lampenlicht, an den Wochenenden in aller Frühe und bis in den späten Sonntag hinein, bei Regen und knalliger Hitze, Monat um Monat, zwei Jahre lang - sie schufteten, fühlten sich ausgemergelt, zermürbt, zerquetscht, doch immer wieder trieb es sie an, sie glichen tatsächlich Ameisen, sie wollten ihren Bau, das Haus, und nichts würde sie davon abhalten.
Einmal, ziemlich am Anfang, geschah es, daß Inge Blutungen bekam, während sie bereits schwanger war. Sie riefen nach der Ärztin, die soeben im Falkenweg ihre Villa bezogen hatte, die Schnelle Hilfe jagte heran, Inge lag mehrere Wochen straff in der Klinik, nachdem sie mit Spritzen behandelt worden war, und Freddi mußte sich von der Oberin und dem Doktor die bittersten Vorwürfe anhören: Unverantwortlich sei das, in ihrem Zustand ihr diese Schwerstarbeit zuzumuten, und ob er denn nicht wisse, was für ein gebrechliches Ding ein Mutterleib sei ... Er duckte sich, schuldbewußt, wagte nicht aufzublicken, suchte für seine Augen einen imaginären Fixpunkt auf dem Fußboden und ging bedeppert davon. Danach besuchte er täglich, sofort nach der Arbeitszeit, seine Frau am Krankenbett und - fuhr anschließend hinaus, mit der Buslinie sieben über den Fluß, zur Connewitzer Straße, hastete auf die Baustelle, plackte sich fortan ohne sie, bis Gerald geboren war. Doch sie - und nicht einmal die sechs Wochen Urlaub nach ihrer Entbindung wartete sie ab - schob den Kinderwagen vom einen Ende der Stadt ans andere, begleitete ihn wieder, Simone am Rocksaum, um ihm draußen wenigstens die Suppe zu wärmen, in der Baubude einen Kaffee zu kochen, und zwischendurch stillte sie den Jungen.
Den Beton, sagten sie, hätten sie Platte für Platte, Klotz für Klotz mit ihren Händen zerkrümelt, »besiegt« mit nichts als ihrem Glauben, der Berge versetzt habe. Abgekippt lag er auf einer Mülldeponie, und auch der Schotter war beiseite gekarrt, allerdings sorgfältig zur Halde getürmt, weil man ihn noch brauchte, wieder verwenden wollte, um Straßen und Wege zu befestigen. Ringsum schlugen die Bagger tiefe Gruben in den steinigen Grund, hoben die Kellerhöhlen aus, die Fundamente wurden gegossen, die Wände hochgezogen. Zwar waren jetzt mehrere Baubrigaden im Einsatz, doch gab es kaum einen Siedler, der in dieser Phase nicht ebenfalls seine »Eigenleistungen« - wie das Wort dafür lautete - einbrachte, sich mit dem, was seinem Beruf entsprach, nützlich machte, bei Maurer-, Metall- und Malerarbeiten half, selber putzte, sägte, hämmerte oder elektrische Leitungen installierte. Aber auch gemeinsame Ruhestunden gönnte man sich inzwischen, mit Imbiß und Umtrunk, jedesmal - und das immer öfter -, wenn wieder ein Richtfest gefeiert wurde. Später, sobald erst einer sein Heim bewohnte, trug der, nicht selten meterdick, Muttererde auf, zusammengeklaubt von den Genossenschaftsbauern der angrenzenden Dörfer, erneut mit Karren und Schaufeln (auch die Kinder packten mit an), später pflanzte man Bäume und Sträucher, ein jeder nach seiner Fasson, Koniferen oder Obstbäume, Blumen, Gemüse. Mitte der siebziger Jahre nahm die Siedlung endlich ihre Gestalt an und zeigt seither jenes Gesicht, das sie bis heute prägt: meist zweistöckige Häuser mit Satteldächern, Mansarden und Erkern und abgeschrägten Zimmern im Obergeschoß, ab und an auch ein größerer Bau, ohne protzig zu sein, im Bungalowstil oder als Villa, und allesamt umgeben von schmucken Gärten.
Die Zeit verging, die Menschen wurden älter und die Bäume höher, die einen kamen in die Rente und die anderen zu reicheren Erträgen. Schon ragten die Blautannen bis zu den Giebeln auf, und an den Obstbäumen reiften, schwer, so daß ihre Aste gestützt werden mußten, die Früchte. Da geschah es zum ersten Mal, beginnend im Rotkehlchenweg, der der sowjetischen Kaserne am nächsten lag, daß Äpfel und Birnen geplündert wurden. Lange blieb es ein Rätsel, wer die Diebe wohl sein könnten, und weil Ole Gingel aus Nummer 8, der auf seinem Grundstück eine Art Plantage unterhielt, unter den Raubzügen am meisten zu leiden hatte, legte er sich auf die Lauer. Die Bäume waren sein Heiligtum, nach der Ernte in jedem Herbst verkaufte er zentnerweise das Obst an den staatlichen Handel, das Kilo Pflaumen für vier Mark, ließ es anschließend von seinen Söhnen und anderen Eingeweihten, da die Preise subventioniert waren, für zwei Mark wieder zurückkaufen, brachte erneut seine Pflaumen, das Kilo zu vier Mark, in die Annahmestelle, sammelte es für zwei wieder ein und wiederholte den Vorgang solange, bis den Früchten Blessuren drohten. So war sein Eifer auf der Jagd nach den Tätern nur allzu verständlich, wurde er doch um ein selten lukratives Geschäft betrogen, und bald bekam er sie auch, in der Dachkammer wie auf dem Anstand sitzend, vor sein Fernglas. Es waren Soldaten, kein Zweifel, Rotarmisten, die nachts über die blaue Planke stiegen, in seinen Garten drangen und Taschen und Beutel mit seinen Mirabellen und Emma Leppermann, Cox Orangen und Clapps Lieblingen füllten. Er schlug Alarm, blies zum Protest, und, sonderbarerweise, schlossen sich ihm nicht nur Leidensgefährten an, sondern auch der ansonsten etwas kauzige, eher zurückgezogen lebende Komponist aus dem entfernteren Kohlmeisenweg, der jedoch aus anderem Grunde. Es sei ein Abwasch, sagte er auf der eiligst einberufenen Versammlung, und nichts gegen die deutsch-sowjetische Freundschaft, aber ihn störe seit langem die Beschallung, die aus den Lautsprechern der Kaserne mit Kampf- und Volksliedern auf sein Studio niederprassele, ihn hindere, eigene Töne und Melodien zu finden, womit er schöpferisch pleite zu gehen drohe und was wohl ebenfalls einem Diebstahl gleichkomme, wenn auch einem geistigen, einem Kunstraub gewissermaßen. Das leuchtete ein, und so wurde eine Abordnung gewählt, die dem Kommandanten der Garnison eine kompakte, von der Musik bis zum Obstklauen reichende Klageschrift überbringen sollte. Ihr gehörten Professor Haarschmidt an, der Mediziner, er, weil möglicherweise sein Titel Respekt einflößte, vor allem aber, weil er beinahe fließend russisch sprach, Ole Gingel, sowohl als Tatzeuge als auch Hauptgeschädigter, und Freddi Gütlein, der in jeder Beziehung neutral war, zum Beispiel nicht einmal einer Partei anhing, jedoch in der Siedlung wegen seiner Allround-Hilfsbereitschaft großes Ansehen genoß.
Was bis dahin nur die kühnsten Optimisten für möglich gehalten hatten, wurde dann wahr: Nach der Übergabe der Petition dudelten die Lautsprecher nur noch an Staatsfeiertagen der Sowjets, und die Diebereien fanden ein Ende, das allerdings, wie die Siedler erst später erfuhren, indem die Soldaten drakonisch bestraft wurden, diese kaum zwanzigjährigen Burschen aus allen Weiten Asiens, mit Prügeln und Dunkelhaft. Das, nein, das hatten die Anwohner nicht bezweckt. Für ein paar Handvoll Pflaumen, Äpfel und Birnen, klagten sie nun, wiegelten ab und schüttelten die Köpfe, eine derartig mittelalterlich anmutende Spießrutenei an noch halben Kindern, Milchgesichtern, nur weil ihnen und ihren Kameraden der Magen geknurrt hatte. Ole Gingel zwar versteckte sich in seinen Vollbart und schwieg, aber der Professor und Freddi machten sich so ihre Gedanken.
Im nachhinein aber zählte eine andere Erfahrung, blieb als Moral von der Geschicht’: Kapituliere nicht. Ja, sie waren sich einig gewesen und hatten nur deshalb, weil EINIGKEIT MACHT STARK, selbst bei den Sowjets, den Freunden (den Besatzern, sagt man heute), Erfolg gehabt. Ganz gegenteilig verhielt es sich dann mit dem »Katzen-und-Hunde-Krieg« im Grasmückenweg, in der unmittelbaren Nachbarschaft der Gütleins, was so lange noch gar nicht zurücklag. Zunächst, es gab hier, wie in keiner Straße sonst, einen ausgesprochenen Nummernsalat, der davon herrührte, daß die Häuser nicht in der Reihenfolge der Grundstücke, mit den geraden Zahlen auf der einen und den ungeraden auf der anderen Seite wie üblich, beziffert worden waren, sondern nach dem Zeitpunkt ihrer Fertigstellung, und so wohnten nicht etwa die Leute aus Nr. 14 und Nr. 12 Zaun an Zaun, sondern, in diesem Fall, die aus der 14 und 11. Frau Kusch, die energische Witwe, besaß vier Katzen und fütterte darüber hinaus, indem sie sie im Garten zu den Mahlzeiten einlud, noch ein Dutzend herrenlose, räudig umherstreunende Artverwandte, die, einmal angelockt, von sonstwoher an ihre Näpfe eilten. Das gab ein Huschen und Kuschen, Miauen und Kauen, vor allem jedoch ein Fressen, nicht nur der in Milch aufgeweichten Brötchen in den Satten, sondern auch der Vögelchen in den Hecken, im Frühjahr während und nach der Brut, im Winter, wenn sich zu den einheimischen Meisen, Gimpeln und Finken an den Futterhäuschen als Gäste aus dem Norden auch noch die Grünlinge, Zeisige, Berghänflinge gesellten, und das, so jedenfalls empfand es Rudi Hagenau aus Nr. 14, der Maurer, Freddis Nachbar, sprach aller Wegenamen in der Siedlung hohn.
Also setzte er, obendrein Taubenzüchter und demzufolge außerordentlich vogellieb, nachdem er das Treiben nebenan zwei Winter hindurch eher stoisch geduldet, dann aber zunehmend in Rage geraten war, im dritten seine beiden Hunde, einen Dobermann und einen ungemein fuchtigen, nahezu tollwütigen Terrier, auf die Katzen an. Jedesmal nun, wenn Frau Kusch vom Fenster im Obergeschoß, in das sie nach dem Tod ihres Mannes gezogen war, sozusagen vom Himmel auf die Erde herab ihr freundliches Werk betrachtete und sich gerade als Wohltäterin an der verlassenen, mißhandelten Tierwelt zu fühlen begann, ließ er Max und Bobbi von der Kette. Der
Dobermann, größer als sein Kumpan, lief zwar nur am Zaun hin und her, stapfte einen Pfad in den Schnee und bellte, das freilich, was das Zeug hielt. Der Terrier hingegen hatte längst eine Lücke zwischen den Latten entdeckt (oder hatte nicht Hagenau sie eigens für ihn geschaffen?), flitzte kläffend hindurch und fuhr wie der Wirbelwind mitten durch die Versammlung auf Nr. 11. Das wiederholte sich, eine Woche lang etwa, Tag für Tag. Frau Kusch, im Stil ihrer Katzen, fauchte Hagenau an, und der, Max gleich, seinem stämmigen Dobermann, knurrte zurück. An Diplomatie war schon nicht mehr zu denken, bald flogen die ersten Schimpfwörter, und das war der Ausbruch des Krieges. Die Witwe entsann sich, daß ihr Mann ein Luftgewehr hinterlassen hatte, lud es und brannte damit aus dem Fenster ihres Schlafzimmers Nachbars Kötern eins aufs Fell, nein, schoß ganze Magazine mit Bleikugeln auf sie leer. Bobbi, der Terrier, jaulte unter dem Trommelfeuer wie von Sinnen, ergriff, ebenso blitzartig, wie er gekommen war, die Flucht und wedelte, wenngleich nicht minder fuchsteufelswild, mit dem Schwanz, während der Dobermann, der dergleichen nicht aufweisen konnte, nur einen Stummel am Steiß besaß, erschrocken sein Gebell einstellte und zu winseln anhob. Das ärgerte Rudi, sowohl das unwürdige Verhalten seiner Hunde, noch mehr die Schande, die sie ihm damit zufügten, als erst recht das triumphierende Gelächter der alten Geiß auf ihrem Schießstand, und der Streit eskalierte. Er rächte sich, indem er sich Marderfallen besorgte, sie mit Fleischködern ausstattete und dicht an der Grenze zur Nr. 11 auslegte. Zu seinem Unglück erschlugen die eisernen Bügel nicht nur einige der verwilderten Katzen, sondern auch eine von Rasse, die schöngezeichnete Marmormiez der Frau Kusch. Wenige Tage später fand er dann seine Hunde hingestreckt im Zwinger. Die kriegerische Witwe hatte ein paar Bockwürste mit Rattengift präpariert und einen ihrer Enkel angestiftet, sie den Tieren vorzuwerfen.