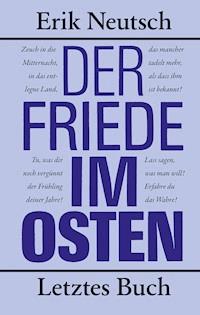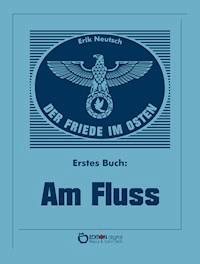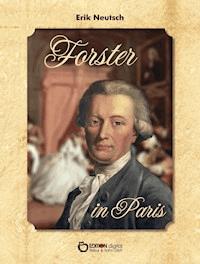7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Der Friede im Osten
- Sprache: Deutsch
Nahe der Grenze zur CSSR, in den Wäldern des Erzgebirges, begegnen wir Achim Steinhauer wieder, dessen Lebensweg eine überraschende Wende genommen hat: Vom Drang nach Selbstbehauptung erfüllte Jahre als Gleisbauer, Fernfahrer und Mitarbeiter einer Vogelwarte liegen hinter ihm seit jenem Abschied aus Eisenstadt. In dieser Zeit hat er zu schreiben begonnen, eine Erzählung wird publiziert, die er mit Soldaten und Offizieren in einem Feldlager der NVA nach den Ereignissen vom August 1968 diskutiert. Doch in diesen Tagen erfuhren er und Ulrike auch von Ilse Lutters plötzlichem Tod. Was ist geschehen? Ins Zentrum dieses Romans von Erik Neutsch rückt die Geschichte um Frank Lutters Ehe. Er hat promoviert und befindet sich im Aufstieg. Bohrend sind die Fragen, wieweit ihm dabei seine Frau und Lina Bonk, die Journalistin, zu helfen vermögen, und – hat die Freundschaft zwischen ihm und Achim Steinhauer noch eine Chance? Nahe der Grenze – der Titel des Buches wird zum Bild für die inneren und äußeren Vorgänge, die der Leser miterlebt. Das fesselnde Buch erschien erstmals 1987 beim Mitteldeutschen Verlag Halle – Leipzig. INHALT: Das Lager im Gebirge Doktor Lutter Familiensache Neue Aussicht Wechsel Das Lager im Gebirge (Fortsetzung) Die Fessel Schlag ins Wasser Flucht Wie ein Tonbandstopp Abschied vom Gebirge
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Impressum
Erik Neutsch
Der Friede im Osten. Viertes Buch
Nahe der Grenze
ISBN 978-3-86394-400-1 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1987 bei Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
Auf Wunsch des Autors wurde nicht auf neue Rechtschreibung umgestellt.
© 2013 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
ERSTES KAPITEL: Das Lager im Gebirge
Welch ein Unruheherd ist die menschliche Seele, die zu befrieden wir kein Mittel scheuen, aber welche Mittel wir auch immer anwenden und uns gegenseitig vorschreiben: diese Unruhe ist nicht zu bändigen, und erneut bricht der Aufstand im Menschen los.
Johannes R. Becher (1950, 14. April, in seinem Tagebuch)
Wir schrieben das Jahr 1968.
Im Sommer hatten zwei Divisionen der Nationalen Volksarmee, in Übereinstimmung mit den vereinigten Streitkräften des Warschauer Paktes, den Auftrag erhalten, die Grenzen der Republik zur Tschechoslowakei zu sichern. Am Abend des 20. August wurden sie schließlich in erhöhte Gefechtsbereitschaft versetzt. Über Nacht verließen sie ihre Konzentrierungsräume, die sie angesichts der Ereignisse in unserem Nachbarland bereits Wochen zuvor bezogen hatten, und rückten in Richtung Süden vor, den Gebirgen entgegen. Wie alle alarmierten Einheiten, so erreichte auch das aus der Garnison Halle stammende 27. Mot.-Schützen-Regiment in nur wenigen Tagen den ihm neu zugewiesenen Standort. Mit seiner Spitze drang es bis an die obere Bockau am Fuße des Auersberges vor, ehe ihm hier, schon die Kämme vor Augen, die die Grenze nach Böhmen bilden, der Befehl zum Halt erteilt wurde. Seitdem hatte es in einem Terrain von Höhen und Tälern mit unübersehbaren Wäldern, auf der Karte etwa in dem Oval zwischen den Städten Auerbach, Schwarzenberg, Johanngeorgenstadt und Klingenthal zu erkennen, sein Lager aufgeschlagen.
Als Achim Steinhauer dort eintraf, spät im September und im Dauerregen, schien jedoch die größte Gefahr, die wieder einmal den Frieden bedroht hatte, gebannt zu sein. Dennoch blieb die Lage kritisch, und so mußten sich unsere Soldaten noch auf längere Zeit im Erzgebirge wie in einem Warteraum einrichten. Sie lebten unter Gefechtsbedingungen.
Auch Achim nahm davon Kenntnis, bemerkte es schon bei seiner Ankunft an den unterschiedlichsten Zeichen. Wie mit Bernd Höllsfahrt brieflich vereinbart, war er von ihm am Bahnhof von Aue abgeholt worden, und zwar im Auto des Regimentskommandeurs, einem Wartburg mit der soeben erst neukreierten Karosserie und von graugrüner Farbe. Obwohl der Wagen und erst recht seine Nummer jedem Angehörigen der Einheit vertraut sein mußten, wurde er trotzdem, lange bevor sie das Lager erreichten, mitten in der Kurve einer steil aufsteigenden Straße von einer Feldwache mit anschlagbereiten Maschinenpistolen gestoppt. Man forderte sie auf, das Fahrzeug zu verlassen. Da es schon dämmerte, blitzte eine Stablampe auf und leuchtete das Wageninnere ab. Höllsfahrt nannte zwar die Parole und fügte ein paar erklärende Worte hinzu, aber der Postenführer verlangte trotzdem Achims Ausweis, um ihn gründlich zu kontrollieren.
Bernd Höllsfahrt also, im Range eines Oberleutnants inzwischen, hatte ihn hierher eingeladen.
»Deine Erzählung«, hieß es in einem seiner Briefe, »hat auch bei uns die Gemüter erregt. Es wäre deshalb schön, wenn Du einmal kommen würdest, um mit uns darüber zu diskutieren. Ich bitte Dich darum (wenn ich's so nennen darf) im Namen unserer alten Freundschaft. Wir ersaufen hier fast im Regen, und unsere Genossen könnten eine Ermunterung dringend gebrauchen ...«
Da hatte er Professor Beesendahl unterrichtet, daß sich seine Ankunft im Institut noch verzögern würde, und war gefahren. Natürlich fiel ihm sofort auch ein, daß es dieselbe Strecke war, auf der Ulrike gelegentlich reiste, um ihre kränkliche Mutter und (doch die wohl weniger) ihre Schwester zu besuchen. Hundshübel befand sich in der Nähe. Später erfuhr er, ein Stück des Dorfes würde bald der mächtigen Talsperre weichen müssen, die zwischen ihm und Eibenstock erbaut werden sollte. Hoffentlich, dachte er, fällt den Fluten dann auch dieses gottverdammte Haus zum Opfer, das für Ulrike zum Gefängnis geworden war. Und hatte er nicht in dieser Gegend einmal am schon von Goethe bewunderten Filzteich die goldgelb blühenden Trollblumen entdeckt?
Es regnete unaufhörlich. Immer dichter wurden die Wälder, verschlammter und immer schwieriger zu passieren die Wege. Der Fahrer hatte trotz aufgeblendeten Scheinwerferlichts alle Mühe, für die Räder, die mehrmals durchzudrehen drohten, griffigen Untergrund zu finden. Auch die Dämmerung sank immer tiefer. Doch so dunkel war es noch nicht, als daß nicht Achim in einer Schneise zwischen den Fichten, obwohl hinter aufgeschütteten Wäldern halb verborgen und mit Tarnnetzen überspannt, die Panzer erspäht hätte. Er machte sogar ihren Typ noch aus und erkundigte sich bei Höllsfahrt, ob er sich nicht geirrt hatte. Der schüttelte den Kopf. Stimmt. T 54.
Nach einer erneuten, jetzt jedoch eher routinemäßigen Kontrolle gelangten sie endlich auf eine Wiese, die, soweit es das diffuse Licht der an Kabeln aufgehängten und im Wind schaukelnden Lampen zu erkennen gab, von mehreren großräumigen Zelten umstellt war. Vor einem davon hielt der Wagen. Sie stiegen aus, schienen bereits erwartet worden zu sein. Denn kaum verstummte der Motor, kam ihnen, was Bernd ihm noch hastig im Flüsterton zusteckte, der Regimentskommandeur bis unter die Plane entgegen, die den Zelteingang überdachte. Der Mann, schätzte Achim, ein Oberst, war in seinem Alter. Er fühlte sich von ihm mit seltsam taxierenden Blicken empfangen.
Bernd Höllsfahrt nahm militärische Haltung an, führte die rechte Hand an seine Feldmütze und erstattete Meldung.
Der Oberst dankte, winkte dann aber ab. »Lassen Sie es gut sein, Genosse Oberleutnant. Ich denke, wir wollen es weniger formell angehen. Wir sind - wie ich unlängst sogar in der Zeitung lesen konnte - in derselben Partei, und so heiße ich Sie fürs erste herzlich willkommen, Genosse Schriftsteller.«
»Nein, ich bin keiner.« Achim glaubte sofort, er habe zu schnell geantwortet, hätte wohl erst den Gruß erwidern sollen, was er nun nachholte. Dennoch, er empfand sich wirklich nicht als Literat. Zuviele Bedenken verbanden sich für ihn mit diesem Wort.
»Ich habe etwas geschrieben, was vielleicht nicht ganz unnütz ist. Doch von Beruf bin ich Biologe.« Ja, sein Weg hatte ihn wieder dorthin geführt, wozu ihn sein Studium einst befähigt hatte.
»Bitte, treten Sie ein.«
Es war das Stabszelt, ausgelegt mit einem Fußboden aus roh zusammengezimmerten Brettern, unter denen das Gras wucherte. Durch die Ritzen ragten hier und dort vergilbte Halme. In seiner Mitte war aus mehreren Tischen eine Tafel in Hufeisenform aufgebaut worden, an der etwa zwei Dutzend Gäste bequem Platz finden konnten. Soeben waren Soldaten vom Küchendienst dabei, sie mit weißen Tischtüchern und Geschirr einzudecken. Anschließend trugen sie das Abendbrot auf, Platten mit Aufschnitt und diverse Getränke.
Oberst Dehmols, wie der Kommandeur hieß, ließ sie gewähren. Achim wußte aus den Briefen Bernds, daß zunächst ein Gespräch zwischen ihm und den Führungsoffizieren des Regiments vorgesehen war, ehe er in den kommenden Tagen verschiedene Einheiten besuchen sollte. Auch Dehmols, nun schon längst nicht mehr mit dem seltsamen Blick in seinen braunen Augen, erinnerte ihn jetzt daran, als sie sich in einer Ecke des Zeltes auf ein paar, freilich schon leicht lädierten Sesseln gegenübersaßen. Auf die Planen über ihren Köpfen trommelte der Regen. »Wir haben noch Zeit, bis meine Genossen hier eintreffen. Neunzehn Uhr dreißig war befohlen. Möchten Sie unterdessen einen Erfrischungstrunk? Kaffee? Oder doch lieber einen Kastell?«
Achim nickte zu beidem, und während der Kommandeur, der inzwischen Höllsfahrt und die Soldaten verabschiedet hatte, an die Tafel ging, um selbst die Getränke zu holen, überließ er sich seinem Schweigen. Er fühlte sich ungewohnt in seiner Rolle. Gewiß, sie schmeichelte ihm, doch ein solcher Empfang machte ihn noch immer verlegen. Was eigentlich war denn anders geworden seit damals, seit seiner Parteistrafe vor sechs Jahren, seiner Demission von Eisenstadt? Er wußte nur, es war ihm wiederum nichts geschenkt worden, im Gegensatz zu allem, was einst Lutter von ihm behauptet hatte. Er hatte sich durchgebissen, ja, durchgebissen - das war es. Stück um Stück auch mit dieser Erzählung, die nach ihrem Erscheinen dann mit einem Preis ausgezeichnet worden war und derentwegen er nun ebenfalls eine Einladung hierher zur Armee erhalten hatte. Doch geschrieben hatte er sie von ihren wohl mehr als einem Dutzend Anfängen bis ans bittere, wenn auch erlösende Ende nur für sich. Er hatte sich freigeschrieben mit ihr, und am allerwenigsten war ihm in den Sinn gekommen, sie drucken zu lassen und mit ihr seinen Namen ausgestellt zu sehen. Was allerdings danach mit ihr (und ihm) geschehen war, würde selbst für ihn ein Geheimnis bleiben. Nein, sprechen konnte er darüber nicht. Weder anderswo noch vor den Offizieren, die in diesem Moment in nur kurzen Abständen das Zelt betraten, unter ihnen auch wieder Höllsfahrt. Er war ja schon auf die Frage von Dehmols soeben, wie man Schriftsteller wird, in ein ziemlich hilfloses Gestammel verfallen.
Der Gefechtsstand des Regiments - denn um nichts anderes handelte es sich bei der Gruppe von Zelten am Rande der Lichtung - befand sich, wie Achim nächsten Tags erkennen konnte, als für einen Augenblick der bleigraue Himmel über ihm aufriß, in einer sich lang dahinstreckenden Senke zwischen zwei Bergkuppen, dem Zeisiggesang und dem Brückenberg. Obwohl für ihn in Eibenstock ein Hotelzimmer reserviert worden war, zog er es vor, bei der Truppe zu bleiben und für die Dauer seines Besuchs mit den Politoffizieren die Unterkunft zu teilen. So hatte er im Zelt übernachtet, auf einer Pritsche wie sie, zwischen Höllsfahrt und Major Seydewitz. Er war todmüde gewesen, sofort in einen tiefen Schlaf gesunken, und gewiß hätte er sich nach dem ausgedehnten und anstrengenden Abend gestern gern noch länger in die Wolldecken verkrochen, wenn er nicht Punkt sechs vom rabiaten Geschrill einer Trillerpfeife, dem Signal zum Wecken, aufgeschreckt worden wäre.
Sofort begann ein Hasten und Jagen um ihn herum. Die Männer, was er ihnen bei ihren Chargen kaum zugetraut hatte, folgten unverzüglich den Kommandos des OvD, warfen sich in ihre Trainingsanzüge und eilten zum Frühsport hinaus ins Freie. Ein wenig verwirrt und fragend sah er noch Höllsfahrt an. Der aber lachte. »Nein, nein, so war unsere Einladung nicht gemeint. Wenn du Lust hast, hau dich noch einmal hin und penn weiter.«
Achim jedoch fürchtete, bliebe er liegen, sich zu sehr als Zivilist aufzuführen. Er stand ebenfalls auf und lief zumindest mit den Männern an den Bach, der das Tal durchrieselte, um sich in ihm zu waschen. Die Kühle des Wassers tat ihm wohl. Er frottierte sich scharf, bis die Haut brannte und der letzte Rest Müdigkeit aus seinen Gliedern gewichen war. Bald darauf aber hätte es schon genügt, sich lediglich in den Regen zu stellen. Der Himmel öffnete sich wieder wie eine riesige Dusche.
Oberst Dehmols hatte Bernd Höllsfahrt, der die Funktion des FDJ-Sekretärs im Regiment ausübte, damit beauftragt, Achim zu betreuen. Eigentlich wäre es die Aufgabe von Major Seydewitz gewesen, dem Kulturoffizier. Doch diese Verschiebung der Kompetenzen hatte, was sich demnächst noch zeigen würde, ihre Gründe und lag nicht allein daran, daß Bernd und er sich seit langem kannten.
Die Lesung im 2. Bataillon war erst für den Abend angesetzt worden. Bis dahin hatten sie reichlich Zeit, und Achim wollte sie nutzen, um die Soldaten während ihres Dienstes kennenzulernen. Auch in den folgenden Tagen verfuhren sie so. Er freute sich darauf, empfand es als einen besonderen Glücksumstand, fortan mit Bernd zusammenzusein, dem Bruder Erichs, seines Freundes seit Ewigkeit. Dem war er zwar lange nicht mehr begegnet, zum letzten Mal vor etwa einem Jahr, als er seine Mutter besucht und zugleich in Eisenstadt irgendeine Formalität hatte regeln müssen. Das war, entsann er sich, nachdem er seinem Fernfahrerleben ade gesagt hatte und bereits als wissenschaftlicher Mitarbeiter in die Vogelschutzstation im Luch an der unteren Havel eingetreten war. Schon auf dem Weg von Aue in die Wälder hatte er von Bernd die neusten Nachrichten über Erich erhalten. Halka erwartete das zweite Kind. Und er hatte gedacht: Julia ist inzwischen fast zwölf, Soja fünf.
Die Bataillone und ihre Kompanien lagen weit verstreut über das Gebirge. Mit Feldtelefonen und Sprechfunkgeräten hielten sie Verbindung zueinander.
»Wirst du mir auch kein X für ein U vormachen?« fragte er Bernd.
»Auf gar keinen Fall. Wenn's dich beruhigt: Ich bin wie Erich.«
Sie fuhren in einem Geländewagen, einem zum Jeep umgebauten Trabant mit Planverdeck. Bernd steuerte ihn selbst. Auf einem der Kämme, hinter Carlsfeld, wo sich in Weitersglashütte der Divisionsstab befand, schon nahe den rot-weißen Grenzpfählen zur tschechischen Grenze, bat Achim um eine Verschnaufpause. Ihn lockte der Ausblick, über Fichten und Vogelbeerbäume hinweg, ins Tal nach Eibenstock. Später las er die Zeilen von Kleist, die diese Landschaft beschrieben: Die ganze Gegend sieht aus wie ein bewegtes Meer von Erde ...
Der Regen hatte ausgesetzt. Doch alles Gras und Gebüsch um sie herum troff noch feucht und war klamm von Nässe.
Da rückte Bernd zum ersten Mal mit der Geschichte von Major Seydewitz heraus. »Militärisches Geheimnis? Ich glaube nicht, Achim. Obwohl ... Das Ministerium wittert manchmal schon Fahnenflucht, wenn einer aus der Truppe nur unerlaubt pinkeln geht.«
Seydewitz laufe Gefahr, sich zu verrennen. Befehlsverweigerung? Feigheit gar vor dem Feinde? Offenbar könne er sich nicht mit den Maßnahmen identifizieren, die die Warschauer Vertragsstaaten eingeleitet haben.
Nach seinem letzten und - wie bei ihnen allen seit Monaten - bisher einzigen Kurzurlaub vergangener Woche drehte er durch. »Hast du ihn nicht beobachtet, gestern abend? Während es sonst doch recht temperamentvoll verlief, saß er da und mimte den Beleidigten.«
»Ich fand ihn nur still. Doch was will das schon bedeuten. Mancher redet wie ein Wasserfall, ohne was zu sagen. Andere ringen um jedes Wort oder schweigen lieber und denken wenigstens nach. Die sind mir sympathischer.«
Im Stabszelt des 2. Bataillons, wie auf den ersten Blick zu erkennen, herrschte eine tiefe Betroffenheit. Es schien, als hätten Höllsfahrt und Achim mit ihrer unvermittelten Ankunft soeben jäh einen Streit zwischen den Offizieren unterbrochen. Mit nur schwer verhohlener Erregung standen sie sich um einen Tisch gegenüber. Bereits von draußen waren laute, von Zorn geschärfte Stimmen zu hören gewesen, und jetzt fand der Kommandeur erst nach einigem Zögern die Standardfloskeln zur militärischen Begrüßung. Nur allmählich verlor sein breites, gutmütig wirkendes Gesicht die hektische Röte. Mehrmals schluckte er noch, um seinen Ärger zu unterdrücken, bevor er sich zu einer Erklärung entschloß:
»Soldat Gladisch. Dritte Kompanie. Erstes Diensthalbjahr. Vor einer knappen Stunde entdeckten ihn seine Genossen im Wald. Sie haben ihn noch rechtzeitig abgeschnitten und - retten können. Er hing an einem Baum.«
Ein Oberleutnant, von kleiner Statur zwar, doch ungemein drahtig, seinem straffen Aussehen nach mit jedem Zoll ein Militär, fügte sofort hitzköpfig hinzu: »Den werd ich mir vornehmen, den Mann. Bis jetzt habe ich noch aus jedem in meiner Einheit einen Soldaten gemacht.«
»Halten Sie doch endlich die Klappe, Oberleutnant Gerstfeld!« schrie ihn ein Hauptmann an, der Stabschef.
Höllsfahrt mahnte zur Besonnenheit und ließ sich berichten.
Jener Rekrut war der Sohn eines Bäckermeisters, der in Weißenfels eine private Konditorei mit angeschlossenem Café betrieb. Als einziges Kind seiner Eltern, war er von ihnen stets verhätschelt und getätschelt worden. Das hatte sich schon öfter auf sein Verhalten ausgewirkt, so daß er nicht selten auch zur Zielscheibe von brutalen Scherzen mancher seiner Kameraden geworden war. Er selbst hatte kurz vor seiner Einberufung im Mai eine Lehre als Gärtner beendet.
»Und wo befindet er sich jetzt?« fragte Höllsfahrt.
»Ab mit dem Sankra. Ins Lazarett.«
Oberleutnant Pisocki, der Politstellvertreter im BatailIon, begleitete ihn. Zur ärztlichen Untersuchung. Doch sei sie gewiß nur eine Vorsichtsmaßnahme, so daß mit der Rückkehr der beiden bis zum Abend gerechnet werden könne.
Damit schien das besondere Vorkommnis, wie es im Soldatendeutsch heißt, vorerst vergessen. Achim aber ließ es noch keine Ruhe. Nachdem Höllsfahrt ihn vorgestellt hatte und Kompaniechef Gerstfeld abgetreten war, kam er darauf zurück und wagte eine Frage: »Sagen Sie bitte, Genosse Major, könnte ich mit dem Soldaten Gladisch einmal sprechen?«
Der Kommandeur allerdings zeigte sich davon dermaßen überrascht, daß es ihm die Zunge lähmte. Mit ziemlich verdatterten Blicken suchte er Höllsfahrt um Rat an und hob und senkte unschlüssig seine geflochtenen, mit einem Stern besetzten grauen Schulterstücke auf der Sommerdienstuniform.
Höllsfahrt half dem Major aus der Klemme. »Komm«, wandte er sich fordernd an Achim, »wir müssen weiter.«
Draußen jedoch, wieder im Jeep, verkniff er nur mühsam ein lautes Gelächter, kicherte. »Menschenskind, was bist du naiv, Achim. Wie konntest du ihn so in Verlegenheit bringen. Natürlich darfst du nicht mit dem Soldaten sprechen. Du, ein Zivilist! Das fehlte noch ... Dazu gar einer, der Geschichten schreibt! Aber tröste dich. Wir werden es arrangieren. Nur ... In Zukunft, wenn du solche Extrawürste gebraten haben willst, wende dich an mich, verstanden?«
»Zu Befehl, Genosse Oberleutnant!« schloß sich Achim mit leichter Ironie dem militärischen Ton an.
»Danke. Rühren. Und machen Sie sich's bequem«, klang es auf gleiche Weise zurück.
Dann zündete Bernd den Motor und gab Gas.
Es war gegen elf. Zeit, ans Mittagessen zu denken. »Wollen wir in einem der Lokale hier absteigen? Zwischen Morgenröthe-Rautenkranz und Tannenbergsthal kenne ich eine Gaststätte mit hervorragender Küche ...«
»Namen haben die Nester hier«, sann Achim, »wie geschaffen für Grimmsche Märchen. Schon ein Blick aus dem Wagen genügt, und man glaubt, gleich müßten Rotkäppchen und der Wolf auftauchen ...«
»Übrigens, die Leute hier mögen uns. Zunächst waren sie zwar schockiert, als wir unsere Stellungen bezogen. Doch es dauerte nicht lange. Inzwischen brauchst du nur mit dem Finger zu schnippen, und sie versorgen dich mit allem. Die Sessel und Tische im Regiment zum Beipiel, obwohl schon ein wenig abgeschabt - ein Geschenk des Bürgermeisters von Eibenstock. Und jetzt, da immer noch nicht abzusehen ist, wann wir unser Lager hier abbrechen, wollen uns die Bauern, bei diesem Sauwetter, Blockhütten an Stelle der Zelte aufbauen. Also, was ist? Hirschbraten mit Pilzen, Rotkohl und Klößen?«
»Und was ißt die Truppe?«
»Wieder Erbsensuppe womöglich, mit Speck. Aus der Gulaschkanone.«
»Erbsensuppe.«
»Aber der Speck schmeckt vielleicht schon ranzig.«
»Ein Grund mehr, den Hirschbraten mit zivilen Maronen und pazifistischem Schmorgemüse zu verschmähen.«
Nun wurden die Wälder immer unwegsamer. Höllsfahrt hielt mehrmals an und orientierte sich an der Karte. Er suchte den Schießplatz des Regiments, der schon kurz nach ihrer Ankunft angelegt worden war. Zu ihm war heute die 2. Kompanie des Bataillons zu Übungen ausgerückt.
Nach einer erneuten Abzweigung mit scharfen Kurven, die streckenweise steil bergab führten, begann für den Jeep eine holprige Fahrt, so daß er sich jetzt seinen Namen: Geländewagen redlich verdienen mußte. Bernd hatte alle Hände und Füße voll zu tun, war ständig beim Kuppeln, Schalten, Bremsen und verfluchte mehrmals sich selbst, weil er keinen anderen Weg gewählt hatte. Hier konnte von dem bewegten Meer von Erde, wie es Kleist einst gesehen, keine Rede mehr sein. Hoch und bizarr ragten zur Linken die Hänge auf, kahlgescheuert durch jede Art Witterung, nur noch von den in Stürmen eiskalter Winter schief gestellten, verkrüppelten Fichten bewachsen und immer wieder ihr nacktes Gestein zeigend, schroffe Felswände aus Granit. Zur Rechten hingegen, zwei Armlängen nur von Achim entfernt, dehnten sich tiefe Schluchten, deren Grund jedoch nicht zu erkennen war, da sie ein dichter, milchiger Nebel verhängte, über dem wie auf einem stillen und starren Gewässer, spitzen Wollmützen ähnlich, die schwarzen Wipfel der Nadelbäume schwammen. Wenn wir hier abstürzen, dachte er, kein Mensch wird uns je finden. Das liebliche Erzgebirge - hier wirkte es unheimlich und bedrohend.
Da war er zum ersten Mal froh, als es wieder zu regnen begann oder wohl eher zu tropfen. Sie hatten die Nebelgrenze durchstoßen, und auch Bernd, schien ihm, atmete hörbar auf. Vor ihnen lag eine unbewaldete Fläche, der man noch die Spuren der Rodung ansah. Zwischen den Stubben und Gestrüppresten gefällter Bäume zogen sich mehrere Gräben hin. Ihnen gegenüber standen vor einer weißgetünchten Mauer Schießscheiben, geformt wie die Silhouetten menschlicher Oberkörper. Irgendein Mechanismus bewegte sie, ließ sie zur Seite klappen und wenig später wieder in die Richtung der Schützen schwenken, die sich in lockeren Gruppen über das Gelände verstreut aufhielten. Rufe hallten über den Platz, übertönt jedoch vom ständigen Geratter des Dauerfeuers aus Maschinenpistolen.
Keine Frage, sie waren am Ziel, gerade noch rechtzeitig, um gemeinsam mit den Soldaten Essen fassen zu können. Doch es gab keine Erbsensuppe, wie von Bernd prophezeit, sondern Makkaroni mit Tomatensauce und Schinken.
Sie folgten den anderen und suchten unter ein paar an Pfählen aufgespannten Zeltbahnen Schutz vor dem Regen. Geschälte, von Rinde und Harz befreite Fichtenstämme dienten ihnen zum Sitzen. Die Kochgeschirre klapperten, und vorerst bildeten nur deftige Schimpfkanonaden auf das Wetter die einzige Unterhaltung.
Dann aber, nach genossener Mahlzeit und bei heißem Tee, drehten sich die Gespräche, wie schon am gestrigen Abend im Regimentsstab, wieder um die Ereignisse im Nachbarland.
Eine Meldung der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS, empfangen aus einem Kofferradio, bot den Anlaß. Terrorakte nach wie vor gegen Kommunisten. Im Motorenwerk von Ceske Budejovice waren Flugblätter aufgetaucht, die unverhohlen zum Mord an Parteifunktionären aufriefen. Denkmäler für die Soldaten der Roten Armee, die im Kampf für die Befreiung der Tschechoslowakei von den Faschisten gefallen waren, wurden geschändet. Der einheimische Rundfunk jedoch, die Presse und das Fernsehen schwiegen dazu wie eh und je. Von einigen führenden Persönlichkeiten wurden deren Redakteure sogar für ihr angeblich besonnenes Verhalten gelobt.
»Was soll daraus noch werden?« fragte, stellvertretend wohl für alle, ein Gefreiter, wobei er eine Zigarette nach der anderen aus der Schachtel zog und wegwarf, zum Schluß auch die Streichhölzer, da alles zerweicht war. »Findet sich da denn keiner, der endlich durchgreift?«
Ein anderer, ein Unteroffizier, hatte besser vorgesorgt. Er bot dem Gefreiten eine Zigarette aus einer Blechbüchse an und gab ihm zugleich Feuer, indem er aus seinem aus einer Patronenhülse gefertigten Feuerzeug eine Flamme aufspringen ließ. »Eine einmal verfahrene Karre ziehst du eben so leicht nicht wieder aus dem Dreck. Das beste ist, du läßt es erst gar nicht soweit kommen.«
»Wir aber stehen hier Gewehr bei Fuß und setzen vor Nässe schon Schimmel an.»
Auch noch beim Waffenreinigen, nachdem Achim und Bernd sich unter die Soldaten eines anderen Zuges gemischt hatten, flackerte das Thema wieder auf. Jemand erinnerte an das Schicksal der sowjetischen Panzerbesatzung in einem Dorf kurz vor Prag. Nach einer Havarie hatte sie versucht, mit erhöhtem Tempo wieder den Anschluß an ihre Kolonne zu erreichen. Plötzlich sah sie sich hinter einer scharfen Straßenbiegung Frauen und Kindern gegenüber, die dort, wie sich später herausgestellt hatte, von Konterrevolutionären zusammengetrieben worden waren. Der Fahrer riß im letzten Moment den Panzer zur Seite. Der stürzte einen Abhang hinunter, überschlug sich mehrmals. Alle vier Besatzungsmitglieder fanden den Tod.
»Und auch schon umgelegt haben sie welche.«
»Uns aber wurde befohlen, falls es zum Einmarsch käme: Nicht provozieren lassen. Nicht schießen.«
»Na, hör mal«, erwiderte wieder jener mit dem braungebrannten Gesicht, wie man es nur von Bauarbeitern oder Bauern kennt. »Wenn du neben mir abgeknallt wirst, meinste, ich würde aus lauter Höflichkeit dann den Stahlhelm ziehen und Dankeschön sagen für den Empfang? Nee, Freund. Die Knarre hoch und nischt wie Feuerwerk.«
Der Zugführer, ein Unterleutnant, der erst vor kurzem die Offiziersschule absolviert hatte, schwieg zu allem. Bernd Höllsfahrt aber war vom Ton solcher Gespräche weniger erbaut. Zwar verstand er den Zorn, die Empörung, mehr noch die Besorgnis, die aus jedem Wort klang, was wohl auch zeigte, daß die Moral der Truppe ungebrochen war, doch in seiner Funktion durfte er das eine und andere nicht unwidersprochen hinnehmen.
»Ich bitte Sie, Genosse Seinig«, wandte er sich mit Namen an den Gefreiten mit dem Bauerngesicht. »Gott sei Dank ist es noch lange nicht soweit. Sie aber beschwören den Ernstfall. Als befänden wir uns im Krieg mit der CSSR. Vergessen Sie nicht, sie ist ein sozialistischer Staat und mit uns verbündet.«
»Gerade deswegen«, wehrte sich Seinig, über seine Maschinenpistole gebeugt, deren Gehäuse er jetzt wieder zusammensetzte, »weil ich, seit wir hier liegen, nichts davon bemerke. Sie freilich sind der Efdejotnik des Regiments, Genosse Oberleutnant, und müssen deshalb so sprechen. Ich aber bin ein freier Mann. In einem halben Jahr mustere ich ab. Ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist, wie zu Hause in meiner Brigade. Die Freunde, die Sowjets, sie können einem doch leid tun in Prag. Immer nur Disziplin. Immer nur lächeln. Trotz aller Hetze, aller Schmutzkübel, die über sie gegossen werden. Trotz aller Schüsse aus dem Hinterhalt. Nochmals. Wenn einer meinen Kumpel angreift, zu Hause oder hier, dann ballere ich zurück.«
»Haben Sie nicht vor einem Monat, als Sie erfuhren, worum es ging, den Antrag gestellt, Kandidat der Partei zu werden?«
»Ja. Aber nicht, um den Märtyrer zu spielen. Nicht, um mich wie die Panzersoldaten vom Leben zu verabschieden. Von meiner Frau und meinem Sohn.«
Höllsfahrt diskutierte noch weiter, bis zu dem Befehl, die Reinigung der Waffen zu beenden. Achim aber hörte schon nicht mehr hin. Er sah, wie Bernd sich vergebens plagte, den Unmut der Soldaten zu dämpfen, sie, was die Ereignisse in der Tschechoslowakei betraf, zu einem gerechteren, weniger nur von Gefühlen geprägten Urteil zu bewegen. Er rief die Geschichte an, argumentierte mit allem, was ihm dabei zur Verfügung stand, doch ohne sichtlichen Erfolg. Und so wirkte er schließlich nervös, überhastet, fuhr sich immer öfter mit der Hand über die Stirn und gespreizten Fingern durch sein blondes, von der Feuchtigkeit klebrig gewordenes Haar.
Doch auch Achim spürte den Druck dieser Situation. Eine merkwürdige, von innerer Unruhe und sprunghaft von hier nach dort wechselndem Nachdenken erfüllte Stimmung beschlich ihn. Zweifellos, die Härte solcher Worte erschreckte ihn: Die Knarre hoch und nischt wie Feuerwerk ... Ich ballere zurück ... Krieg - Frieden. Wieder war es seine Empfindsamkeit gegenüber solchen aufs Ganze der Menschheit gehenden Begriffe, die ihn aufwühlte. Haben wir den Krieg noch vor der Haustür? Haben wir den Frieden bereits gerettet? Da störte ihn kaum noch, daß er nun doch seine Hose mit Harzflecken von den Fichtenstämmen besudelt hatte. Ulrike würde ihre Mühe haben, sie zu säubern.
Kurz vor dem Abend, zurückgekehrt in den Bataillonsstab, verständigte er Bernd, daß er sich noch ein wenig die Füße vertreten wolle. Er habe Lampenfieber. Ja, nach allem, was er heute erlebt habe. Er wolle sich konzentrieren, und dabei helfe ihm wahrscheinlich am besten ein Gang allein durch den Wald.
Bernd warnte ihn vor der bald hereinbrechenden Dunkelheit und bot ihm seinen Regenumhang an.
Spätestens, nachdem Professor Beesendahl ihn gerufen hatte, wußte er, daß ihm ein neuer Anfang bevorstand. Der wievielte war es in seinem Leben? Diesmal jedoch, dachte er, muß es endgültig sein. Er fühlte sich mit der Republik gewachsen, groß geworden, und ein wenig, glaubte er, sei sie es wohl auch mit ihm. Also sollten sie sich nicht länger wie zwei närrische Kinder benehmen, die sich vor ihren Eltern eifersüchtig und mißtrauisch bewachten, obgleich sie Geschwister waren, aufeinander angewiesen, einer nicht ohne den anderen würde auskommen können.
Bist du mein Vaterland? fragte er, wobei er, in Gedanken verloren, nicht einmal merkte, daß es ihm laut von den Lippen schlüpfte. Ja! scholl es zurück. Wenn du bloß nicht immer so störrisch und selbstsicher wärest. Halt doch endlich dein Maul, befahl er dem Echo, seiner anderen inneren Stimme. Das bin ich nicht, bin eher von Zweifeln besessen, und die sind es, die auszuräumen du mir helfen solltest ... Zugleich aber spürte er, daß es ihm auch in Zukunft nicht gelingen würde, über seinen Schatten zu springen. Zuviel blieb da noch unerledigt, unbewältigt, barg sogar schon die Gefahr, sich als Stückwerk für die Ewigkeit einzurichten.
Wenn bereits das der Sozialimus sein soll, dachte er, meiner ist es nicht. Oder hätte er sonst seine Erzählung geschrieben? Schon ihr Titel klang für manche wie eine Provokation: DER GRIMM. Andererseits aber: Gab es nicht auch genügend Leute im Lande, die ähnlich empfanden wie er? Wäre es sonst denn möglich gewesen, daß er, noch dazu als Debütant, als ein bisher unbekannter Autor, mit einem Preis ausgezeichnet worden wäre?
Noch immer galt, er mußte sein Leben - Schicksal nannten es manche - in die eigenen Hände nehmen. Die Republik, das liebe Mütterchen, konnte ihm dabei nur den Boden unter den Füßen ebnen.
Doch gerade das hatte sie ihm lange verweigert. Oder - war er nur ungerecht, ihr gegenüber befangen und trug selber daran Schuld?
Achim stapfte durch den Wald, in dessen Tiefe es allmählich trübe und düsterer wurde. Die Dämmerung senkte sich auf die Wipfel, und hier unten, im Grund zwischen den mächtigen Fichtenstämmen, war sie beinahe schon dicht wie die Nacht. Er hatte nicht mehr auf die Wege geachtet, ging jetzt Pfaden nach, die offenbar vor ihm wechselndes Wild durch das Dickicht getreten hatte, Schweine oder Rehe. Immer öfter stieß er sich an verdeckten, von Moos überwucherten Wurzeln; niederhängende, verdorrte Zweige schlugen ihm ins Gesicht, und er erinnerte sich plötzlich der Warnung Höllsfahrts. Er mußte umkehren, ja. Er suchte den ohnehin grauen, nun mehr und mehr verblassenden Schimmer des Tages im Nadelgeflecht über seinem Kopf und hoffte auf die Lichter des Lagers, um sich nach ihnen richten zu können.
Wenn er einen Begriff nennen sollte, der mit einem Wort seinen Zustand in den letzten Jahren beschrieb, so würde er sagen: Es war meine Reisung oder: meine Fahrschaft. Doch beide gab es natürlich nicht. Sie existierten in keinem Wörterbuch.
Ihm war zumute, als habe er sich fortwährend umhergetrieben, ein Vagabundendasein geführt. Immerzu war er auf Achse gewesen, auf Reisen, über Landstraßen und Autobahnen, mit nur kurzen Rasten in fremden Betten billiger Hotels, meist aber nicht einmal dort, sondern auf Parkplätzen, in der Koje der engen Kabine.
Im Norden war er dann hängengeblieben, nach einer Bewerbung auf eine Annonce in der Zeitung, in jener Stadt, die wie aus einem einzigen roten Backstein von Riesengröße gemeißelt zu sein schien, auf einem Berg obenan mit dem Dom aus frühgotischer Zeit. Er war Trappen und Schnepfen nachgepirscht, hatte die Brutkolonien der Graureiher beschrieben, in den Seggen der Feuchtwiesen Nester von Kampfläufern aufgespürt und, nachdem er sie zum ersten Mal in seinem Leben gesehen, Blaukehlchen gefangen und beringt.
Hier wäre er vielleicht zur Ruhe gekommen, zu seinem Hüsung, und die Reisung wäre beendet gewesen ... Wenn ihm nicht ständig wieder die Trennung von Ulrike zugesetzt hätte, von ihr und den Töchtern. Alles Laufen und Schlangestehen in den Ämtern dort nach einer Wohnung für die gesamte Familie in einem der Havelorte war fehlgeschlagen. Schon deswegen mußte er Beesendahl dankbar sein. Dessen Brief mit dem Angebot einer Stelle im Institut der Akademie der Wissenschaften glich einer Erlösung. Er holte ihn zurück nach Halle, nach Haus zu Weib und Kindern.
Zuvor aber hatte er GRIMM entdeckt. Den oder die, seinen oder ihren Grimm? Eine junge Frau jedenfalls, nicht überdurchschnittlich hübsch, alles andere also als ihrer äußeren Erscheinung nach ein Mannequin, geschieden, mit Kind und dem Allerweltsnamen Gabriele, abgekürzt Gabi. Daraus war eine Erzählung geworden, und seit sie Ende vergangenen Jahres erschienen war, gedruckt in einem handlichen Leinenband von 120 Seiten vorlag, spukte sie in den Köpfen so mancher Leser, auch von Kritikern der hiesigen Literaturlandschaft. Es hatte in den Zeitungen eine hitzige Debatte darüber begonnen, im Zusammenhang mit noch einigen anderen Büchern der letzten Zeit. Sie reichte, was das Urteil in Rezensionen und Leserzuschriften betraf, vom Hosianna bis zum Kreuziget-ihn! Einer forderte, den Autor, der, wie er gehört habe, Mitglied der SED sei, aus der Partei auszuschließen. Ein anderer entgegnete darauf eine Woche später, man solle jenem Dogmatiker künftig alles Reden und Schreiben in der Öffentlichkeit verbieten.
Nein, Achim konnte nicht sagen, daß ihn ein solcher Aufstand um Grimm - den oder die - dort in der entlegenen Vogelschutzwarte am Gülower See kaltgelassen hätte. Anfangs fürchtete er sich sogar, die Zeitungen aufzuschlagen, das Zentralorgan beispielsweise zum Wochenende, wenn es mit seiner Beilage »Die gebildete Nation«, dem umfangreichen Kulturteil, aufwartete. Was für teuflische Dinge würden ihm darin jetzt wieder unterstellt werden? Papier ist geduldig. Doch wieviel Dummheiten durften sich Kritiker eigentlich erlauben, ehe es ungeduldig wurde?
Er konnte sich denken, daß auch seine Kollegen, die Ornithologen in Gülow, die Artikel lasen, und manchmal kam er sich vor, als zeigten sie mit Fingern auf ihn, sobald er ihnen den Rücken kehrte. Gewiß, daran war er gewöhnt. Nie war es anders gewesen in seinem Leben. Zwar hatte er stets danach gestrebt, ein Gleicher unter Gleichen zu sein, ein Mit-Glied in einer Kette von Gleichberechtigten, doch immer wieder war er davon auch abgebracht worden, sah er sich in die Ausnahme gedrängt in der Gesellschaft von Kleingeistern. Nein, er durfte sich nicht beklagen, verhöhnt und angefeindet zu werden, solange er sich einer als allgemein gültig betrachteten Norm widersetzte und - in diesem Falle -mit einer Erzählung die Öffentlichkeit provozierte.
Wohl die meisten seiner Zeitgenossen hüteten sich davor, legten sich selber Fesseln an. Selbst wenn sie die Versuchung dazu spüren sollten, würden sie sie schon im nächsten Augenblick weit von sich weisen. Sie gingen brav ihrem bürgerlichen Beruf nach, warfen Reusen und Fangnetze aus, zählten die Vögel darin und beringten sie, und das einzige, was ihnen des Schreibens wert war, erschöpfte sich darin, zu katalogisieren, Karteien anzufertigen, genau Buch zu führen über das Gewicht der Tiere, die Spannweite ihrer Flügel, die Körpermaße, ob bei Gans oder Goldhähnchen, von der Schnabelspitze bis zu den Schwanzfedern. Sie empfanden sich als Wissenschaftler, manchmal nur als die Registraturen von Gottes ohnehin über jede Kritik erhabener Schöpfung, und als solche mußte es ihnen sowieso unbotmäßig, ketzerisch erscheinen, auch noch anderweitig, gar in der Literatur, Phantasie zu verschwenden.
Aber war es das denn, was er tat: Literatur?
Es hatte ihn nichts weiter gedrängt, als die Geschichte über einen Menschen loszuwerden, Gabi Grimm, dreiundzwanzig Jahre alt, verraten von der Gesellschaft, in der sie lebte, die sie liebte, die ihr jedoch das Recht verweigerte, das ihr nach allen Gesetzen zustand. Deswegen mußte er doch kein Schriftsteller sein, ein Dichter schon gar nicht. Sollten sie ihn einen Chronisten nennen, das würde ihm reichen.
So war seine Antwort gestern an Dehmols keineswegs nur gespielte Bescheidenheit gewesen: Ich habe etwas geschrieben, was vielleicht nicht ganz unnütz ist. Doch von Beruf bin ich Biologe.
Er konnte es wieder mit gutem Gewissen von sich behaupten, seit ihn Beesendahl aufgestöbert und zu einem Gespräch eingeladen hatte.
Für den Professor war es ein leichtes gewesen, die Spur seines einstigen Schülers (und wohl auch zeitweiligen Widersachers unter dem Regime von Schultz-Dürr in der Biologie an der Leipziger Universität) wieder aufzunehmen. Achim hatte hin und wieder in Fachzeitschriften Aufsätze über seine feldornithologischen Beobachtungen veröffentlicht, sie mit seinem Namen gezeichnet und, wie dort üblich, seine volle Adresse dazu angeben müssen. Der Frühling dieses Jahres war für ihn von besonderer Ergiebigkeit gewesen. In schier unübersehbaren Schwärmen hatten sich im Luch an der unteren Havel Entenvögel und Limikolen auf dem Durchzug befunden. Die Mitarbeiter der Station notierten für Ende März Tausende und Abertausende von Stock-, Krick-, Knäk-, Spieß-, Pfeif- und Löffelenten oder wie sie sonst alle heißen mochten. Doch nein, für ihn besaß jede Art ihre eigene Bewandtnis, war jede von speziellem wissenschaftlichem Interesse. Er selbst zählte an einem einzigen Tag, ausgerüstet mit den besten Präzisionsgeräten, so daß ein Irrtum ausgeschlossen war, auf dem Gülower See an die zweitausend Reiherenten, dreihundert Tafelenten und zwanzig der gewöhnlich in Baumhöhlen nistenden Schellenten. Hinzu gesellten sich riesige Mengen von Bleßgänsen, Lachmöwen ohnehin, auch einige hundert Singschwäne. Das alles erbrachte den eindeutigen Beweis dafür, daß das Havelluch, nach jüngsten Planungen bereits der Melioration zugeopfert, ein unentbehrliches, unersetzliches Rastgebiet für Wasservögel war.
Ein entsprechender Artikel seinerseits erregte Aufsehen in Fachkreisen, fand den Beifall all jener, die sich zwar schon seit langem gegen die Willkürmaßnahmen wehrten, das Biotop zugunsten ackerbaulicher Nutzung zu verändern, sich jedoch bisher nur auf Vermutungen hatten stützen können. Und schließlich, was ihm dann sogar den Zorn des Landwirtschaftsministeriums eintrug, bestärkte er dieselben Leute, von ihren Gegnern als Umweltfanatiker verunglimpft, auch noch mit einem zweiten Bericht, einer Studie, in der er für die Gegend um den Gülower See das Brutvorkommen des Kampfläufers nachwies, was bis dahin in diesem Teil Deutschlands niemand mehr für möglich gehalten hatte.
Bevor er zu seiner Entdeckung gelangte, wobei er später dann mehrere Nester, von Blättern und Halmen überzogen und vortrefflich getarnt, zwischen Schlankseggen, Pfeifengras, Hahnenfuß und Sumpfdotterblumen aufspürte, waren ihm die balzenden Hähne von Philomachus pugnax (nach Linné natürlich) aufgefallen. Ihr Gebaren bot ihm ein Naturschauspiel von einmaliger Faszination. In der Morgensonne flogen die Männchen einem erhöhten Platz zu, einer Deichkrone, und begannen sofort mit ihren Angriffen, liefen in geduckter Haltung aufeinander zu und sprangen sich gegenseitig an. Das wiederholte sich mehrmals. Doch so gefährlich die Kämpfe zunächst auch aussahen, sie waren in Wirklichkeit viel harmloser. Offenbar dienten sie den drosselgroßen Vögeln nur dazu, sich gegeneinander ihre aufgeplusterten Federkragen zu zeigen, die sogenannten Kapuzen. Es war ein reines Imponiergehabe, das die Hähne da vorführten, ein jeder etwa mit dem Anspruch, als der prächtigste zu erscheinen. Denn in seiner Färbung glich kein Gefieder einem anderen. Allen gemeinsam waren vielleicht nur das dunkle Braun der Oberflügel und das Grau der Schwänze mit schwarzen Flecken und weißer Unterseite. Die Kapuzen aber schillerten unterschiedlich in sattem Schwarzblau, Rost- oder Haselnußbraun, Cremegelb, waren manchmal gesperbert oder gescheckt. Und jener Hahn schließlich, der sich am Ende als Sieger durchsetzte, prangte in einem fuchsigen, grell in der Frühsonne leuchtenden Rot.
Spätestens bei der Schilderung dieser Balzspiele hatte Achim seine literarischen Ambitionen nicht verleugnen können. Beesendahl, wie er danach von ihm erfuhr, las sie mit Vergnügen und entsann sich, daß der Autor mit jenem Studenten identisch sein mußte, der ihn einmal, in grauer Vorgenetikzeit, wegen seiner Behauptung der Vererbungstheorie mit der noch herrschenden und vergötterten Lehrmeinung Lyssenkos befehdet hatte.
So schrieb er ihm. Und Achim, zumal er zwar in Halle wohnte,- doch zugleich fernab in jener aus rotem Backstein gemeißelten Stadt wochenlang von Frau und Kindern getrennt war, nahm sein Angebot an und besuchte ihn.
Das Institut lag auf den Höhen jenseits der Saale, die auf der einen Seite vom Petersberg und auf der anderen von den ersten Halden des Mansfelder Landes begrenzt werden.
Er dachte noch, bevor er sich mit der Fähre über den Fluß setzen ließ, daß er eigentlich seine Geschichte über den Grimm (oder die Grimm) nie anders empfunden hatte als seinen Bericht über die Kampfläufer. Exakt beschrieben, überprüfbar, mit naturwissenschaftlicher Akribie erforscht, und der einzige Unterschied zwischen beiden bestand darin, daß es sich hier um einen in Deutschland relativ selten gewordenen Brutvogel handelte, der selbstverständlich keine Seele besaß, hingegen dort um einen Menschen aus Fleisch und Blut, mit Sehnsüchten und dem Drang, sich selber zu verwirklichen.
Die Saale floß unter ihnen, wand sich, vom Osten kommend, in einem Bogen nordwärts Wettin entgegen, dem einstigen Stammsitz aller sächsischen Dynastien, die (und auch das sollte man im Gedächtnis haben) selbst England, Portugal und Bulgarien mit Fürsten beliefert hatten, erwies sich hier immer noch so romantisch wie von Eichendorff und dem Griechen-Müller besungen. Sie durchschnitt den blanken Porphyr, war beiderseits von felsigen Ufern umgeben. Und dahinter, mit der dunklen Wolle der Heide am Horizont, tat sich die Stadt Halle auf, fast noch mit all den Türmen von den Kupferstichen Mellingers und Merians. Doch nein, auch die Hochhäuser wuchsen dort schon in den Himmel, die der Neustadt und des Thälmannplatzes, überragten inzwischen sogar die alten Wahrzeichen, den Roten Turm und die vier Türme der Marktkirche.
Irgendwie, wenngleich diesmal nicht von ihm allein bewirkt, hatte sich Beesendahl hier wiederum eine Idylle geschaffen, die Achim sofort an den Garten in Leipzig erinnerte. Auch stand das Institut hoch auf einem Berg, lag nicht im Tal wie die Villa an der Elster. Doch hier ließ es sich forschen. Man lebte in gesegneter Ruhe und befand sich trotzdem nicht weit entfernt vom Puls der Zeit, der Leuna hieß oder Mansfeld.
»Gut, daß Sie gekommen sind«, sagte er, als Achim sein Arbeitszimmer betrat. »In medias res. Ihr Artikel über die Enten ... Noch mehr, Ihre Beschreibung, Ihre - bin ich versucht, es zu nennen - Poesie des Kampfläufers ... Glauben Sie denn, das macht die Biologie aus und könnte auf Dauer gerade Sie befriedigen? Ich hege daran meine Zweifel. Zwar, Intelligenz besitzen Sie. Aber davon war ich schon überzeugt, als wir uns zum ersten Mal begegneten, Sie noch ein forscher Student, ich schon ein von der Partei getadelter, von ihr hinausgeschmissener alter Mann. Kurzum. Ich brauche Mitarbeiter mit Ihrem Verstand und auch - mit Ihrer Phantasie. Was mich beeindruckt hat, das ist, mag es Ihnen jetzt auch nach meiner Zurechtweisung anfangs als Widerspruch erscheinen, Ihre Unbedingtheit in der Frage, ob der Gülower See ein Opfer der derzeitigen Landwirtschaftskonzeption werden soll oder nicht doch, einleuchtend nach Ihrem Engagement, gesicherter Rastplatz für Limikolen und Enten, also Naturschutzgebiet. Das ist - jedenfalls für mich - ein Akt recht selten gewordener Zivilcourage. Demzufolge, ich bitte Sie, lieber Genosse Steinhauer, in meinem Institut eine Stellung anzutreten. Über die Modalitäten, das Was und Wie könnten wir uns ja einigen ... Hoffe ich ...«
»Ich danke für Ihr Vertrauen«, entgegnete Achim. »Doch ich muß Sie davon informieren, daß ich für die Forschung vielleicht gar nicht tauge. Es kann sein, mir mangelt es an der dafür notwendigen Konzentration. Einerseits, ja, zieht es mich zur Naturwissenschaft. Andererseits aber drängt es mich auch zur Kunst ... Oder sagen wir weniger hochtrabend: Ich möchte Geschichten schreiben ...«
»Geschenkt. Ich kenne Ihre Erzählung. Deshalb, weil ... Nein, ich muß mich Ihnen anders erklären. Auf meine Weise tue ich das, was andere, beispielsweise Ärzte, sogar die berühmtesten, ebenfalls in ihrer Freizeit praktizieren. Von ihnen weiß man, sie pflegen Hausmusik. Ich jedoch, da ich nie Gelegenheit hatte, ein Instrument zu erlernen, flüchte mich in die Literatur. Ich lese. Goethe, Faust, ja, auch den immer wieder. Thomas Mann, Anna Seghers und und ... Aber auch jüngere Autoren. Also sehe ich kein Hindernis darin, wenn Sie sich literarisch betätigen würden. Im Gegenteil. Ich empfände es sogar als eine schöne, weil sinnvolle Ergänzung für Sie und - möglicherweise - für uns. Nur müßte eins von vornherein klar sein: Sie schreiben weiterhin Ihre Geschichten, doch erst, sobald Sie mit bestem Gewissen mir gegenübertreten und sagen können, daß Sie Ihre Forschungsaufträge im Institut erledigt haben. Könnten wir uns darauf festlegen, stünde weder dem einen noch dem anderen etwas im Wege ... Hand drauf?«
Das war Beesendahl, wie er leibte und lebte. Achim sah keinen Grund, sein Angebot auszuschlagen.
Doch der Professor stellte ihm auch eine Promotion in Aussicht. Vielleicht sogar, hatte er laut gesonnen, mit einer Dissertation über Philomachus pugnax, den Kampfläufer. Über gewisse Erbanlagen, die, was ja nicht auszuschließen sei, die unterschiedlichsten Farbspiele bei den Hähnen hervorrufen.
Achim aber dachte soeben über einen längeren Essay nach, der den Suizid von Kommunisten betraf. Majakowski, Fadejew ... Seit dem Selbstmordversuch Manfred Kühnaus war ihm dieses Thema nicht mehr aus dem Sinn gekommen, hatte sein Kopf es ständig bewegt und umkreist.
Er mußte jetzt umkehren. Der Wald umhüllte ihn dunkel und dicht. Ein Blick auf die Leuchtziffern seiner Armbanduhr ließ ihn erschrecken und trieb ihn an. Ihm blieb höchstens noch eine Stunde bis zu der Lesung im 2. Bataillon.
Er suchte die Lichter des Lagers. Und noch ein Gedanke befiel ihn: War er nicht hier wie dort, am Gülower See ebenso wie in seiner Geschichte, die DER GRIMM hieß, auch in den Wäldern des Erzgebirges wie sonst in seinem Leben, lediglich auf Beobachtung aus gewesen? Die Kampfläufer ... Gabi, jetzt die Armee ... Er beschrieb sie nur. Die anderen hingegen, selbst die armseligsten Kreaturen, handelten.
Er sah sich im Zwiespalt. Und vielleicht war es das, was er im nächsten Moment den Soldaten würde sagen müssen.
Die Lichter des Lagers tauchten auf und wiesen ihm den Weg. Im Bataillon erwartete ihn voller Ungeduld bereits Höllsfahrt.
Die Soldaten wirkten müde und abgekämpft. Ihn wunderte es nicht, zog er ihren seit Wochen im Dauerregen äußerst monotonen, fast stupiden, wie eine Schwerstarbeit verrichteten Dienst in Betracht. So war es auch heute gewesen. Ich weiß, ich weiß, winkte er ab, das alles gehört dazu, um die Gefechtsbereitschaft aufrechtzuerhalten. Mir steht es auch nicht zu, Kritik zu üben, und dennoch: Es kann zu nichts anderem führen, als die Sinne abzustumpfen ... Die einen hatten zum soundsovielten Mal die Stellungen getarnt, ihre Schützenpanzerwagen und leichten Geschütze gewartet, die anderen im Dreck auf dem Schießplatz gelegen, die dritten schließlich, die Neueingestellten, sich beim Exerzieren durch und durch nasse Klamotten geholt. Er hatte von vornherein darum gebeten, daß nur diejenigen kommen sollten, die sich tatsächlich für seine Geschichte - oder hatte er in diesem Falle nicht doch von Literatur gesprochen? - interessierten. Um Gottes willen, Bernd, beschwor er Höllsfahrt, macht daraus bloß keine Pflichtveranstaltung oder - wie es bei euch heißt - eine Maßnahme, womöglich gar eine mit abgekartetem Spiel, zuvor befohlenen Fragen.
Trotzdem waren aus dem 2. Bataillon noch weit mehr Männer als in Kompaniestärke erschienen. Sie hatten sich in dem Großraumzelt versammelt, das solchen und ähnlichen Zwecken diente und über dessen Planendach nun eintönig trommelnd der Regen und hin und wieder polternd der Wind lief. Auf Holzbänken hockten sie dicht gedrängt, teils in ihren vom Schmutz wieder gesäuberten, doch oft noch klammen Sommeruniformen, teils, sofern die Zeit zum Trocknen der Kleider nicht gereicht hatte, in Trainingsanzügen. Ihre Leiber dampften; die ganze Unterkunft roch nach Moder und Feuchtigkeit. Ein Hüsteln und Schnaufen ging durch die Reihen, als Achim zur Stirnfront an den Tisch schritt, neben einer Leselampe Platz nahm und sich vorstellen ließ. Er blickte in die Gesichter, sah Erwartung darin und war zugleich selber voller Spannung auf das Kommende. Doch dieses Gefühl kannte er; es war immer dasselbe. Jedesmal beschlich ihn Unsicherheit, wenn er sich mit seiner Erzählung unter Zuhörer wagte und ihnen nun wie hier unausweichlich Auge in Auge gegenübersaß. Ja, er hatte sogar das Abendbrot verschmäht. Es hätte ihm nicht geschmeckt, nur im Halse gewürgt, so sehr plagte ihn Lampenfieber. Auch wußte er jetzt, daß er den Soldaten keine allzu langen Passagen aus seinem Text anbieten durfte. Er sollte sich auf Proben beschränken, die Fabel erläutern und dann vor allem Wert auf die Diskussion legen. Ein paar Szenen allerdings brauchte er zum Vorlesen, um sich an seine eigene Stimme zu gewöhnen und damit ihr und sich Festigkeit zu verleihen.
Später konnte er sich über den Erfolg nicht beklagen. Was ihn jedoch, noch lange nach der Veranstaltung, am meisten beschäftigte, waren zwei Dinge. Erstens wurde er gefragt, und zwar von jenem Gefreiten mit dem vom Wetter gegerbten Gesicht, der auf dem Schießplatz so unverhohlen seiner Empörung Luft gemacht hatte, ob er selber schon einmal gedient habe. Das mußte er natürlich verneinen. Er versuchte es mit seiner Generation zu erklären, verwies auf den Jahrgang, dem er angehörte, der für die damalige Wehrmacht noch zu jung gewesen und für die heutige Armee schon zu alt sei. Immerhin sei er inzwischen achtunddreißig. Doch irgendwie glaubte er, an den Reaktionen darauf, eine leichte Enttäuschung zu spüren. Also sei er wohl doch keiner, mochte es heißen, der über militärisches Leben mitreden könne. Es traf ihn insofern hart, als er sich selber ja kurz zuvor noch, bei seinem Gang durch den Wald, in der unverbindlichen Rolle eines Beobachters gesehen hatte. Nun, da er Offenheit, Ehrlichkeit stets für die stärksten Argumente hielt, verriet er auch diese Stimmung, in die er sich versetzt fühlte, und so war es als erster wohl Oberst Dehmols, der ihm während des anschließenden Imbisses im Stabszelt darauf antwortete: »Was nicht ist, Genosse Steinhauer, kann ja noch werden. Bei Ihrer Begabung ... Hätten Sie denn nicht Lust, auch einmal ein Buch über die Volksarmee zu schreiben? Es gibt, vergleicht man dazu beispielsweise die sowjetische Literatur, bei uns viel zu wenig Autoren, die sich diesem Thema widmen ...«
Zweitens war ihm die ganze Zeit über Major Seydewitz aufgefallen. Zwar hatte er ebenfalls die Veranstaltung besucht, saß jedoch, obwohl seiner Dienststellung als Kulturoffizier gemäß in der ersten Reihe, wie in die Ecke gedrückt, war still geblieben, hatte sich wie ein Unbeteiligter benommen. Nur einmal schien es, als habe er sich zur Diskussion melden wollen, unterließ es aber. Das geschah, als die Sprache wieder auf die Ereignisse in der Tschechoslowakei kam, Achim um seine Meinung darüber gebeten wurde, wie er zu seinen Kollegen im Nachbarland stehe, jenen, die die berüchtigten 2000 Worte verfaßt hatten und sich bis heute noch hier und dort in Verlagen und Redaktionen ganz in deren Geist aufführten. »Nein«, sagte er, »sehen Sie, ich fühle mich nicht als ein Kollege von Schriftstellern. Eine einzige Erzählung habe ich veröffentlicht, hundertundzwanzig Seiten, mehr nicht - was bedeutet das schon im Vergleich zu wirklich großen Autoren. Und wenn ich die Maßnahmen der Staaten des Warschauer Vertrages beurteilen soll, so nicht als Literat, sondern als Kommunist. Da aber halte ich es mit Lenin: Wir werden mit den Opportunisten endgülig brechen; und der ganze klassenbewußte Teil des Volkes wird mit uns sein im Kampf, nein, nicht um eine Verschiebung der Machtverhältnissen sondern um den Sturz der Bourgeoisie, um die demokratische Republik vom Typ der Pariser Kommune, um die revolutionäre Diktatur des Proletariats.« Es gelang ihm sogar, diese Sätze, da sie sich einst beim Studium tief in sein Gedächtnis geprägt hatten, fast wörtlich aus »Staat und Revolution« zu zitieren.
Seydewitz also hatte geschwiegen. Und Dehmols fragte ihn später, ob er sich nicht denken könne, für eine gewisse Zeit freiwillig in der Nationalen Volksarmee zu dienen. Was sie beide betreffe, so seien sie vom selben Jahrgang, und ihn wie die meisten Führungsoffiziere des Regiments habe die Partei neunzehnhundertsechsundfünfzig damit beauftragt, Soldat zu werden und die Landesverteidigung aufzubauen.
Achim aber sagte weder zu noch lehnte er ab. Diesmal, entgegen seiner Art, drückte er sich vor einer Antwort, denn was er auch immer an Einwänden vorgebracht hätte, sie wären ihm vielleicht als faule Ausreden ausgelegt worden. Vor allem ging es ihm um Ulrike, genauer: gegen eine erneute Trennung von Ulrike. Seine Fahrschaft der letzten Jahre war es, die ihn zaudern ließ, und sosehr er sich fast schon verpflichtet fühlte, angesichts der hiesigen Umstände erst recht, zum Schutze des Sozialismus auch das Waffenhandwerk zu erlernen, so wenig war er umgekehrt bereit, sein unstetes Leben, sein Vagabundendasein auch nur um Monate zu verlängern. Ich will nicht, dachte er, ich will nicht. Er hämmerte es sich ein. Abgesehen davon, daß er, würde er einen solchen Entschluß fassen, sich vorher mit Ulrike hätte beraten müssen.
Beesendahl hatte ihn endlich zurück nach Halle geholt. Und mit welchem Versprechen, welcher Chance! Mit der größten Hoffnung für ihn auf eine wissenschaftliche Laufbahn. Er durfte auch ihn nicht enttäuschen, was zweifellos geschähe, wenn er ihn nochmals um einen Aufschub bäte für seinen Eintritt in das Institut der Akademie.
Andererseits freute er sich, konnte er ein gewisses Glücksgefühl nicht leugnen. Darüber, daß er so plötzlich in allen Belangen die Qual der Wahl hatte, daß ihm offenbar nun, nachdem er, mit Schimpf und Schande sogar in der Presse, von seiner Funktion im Eisenwerk abgelöst worden war, nach sieben mageren wieder mindestens sieben fette Jahre winkten. Als Autor einer immerhin preisgekrönten, die Gemüter bewegenden literarischen - nein, einfach nur: erzählerischen Leistung. Desgleichen schon beinahe mit dem Thema für eine Dissertation in der Tasche. Und jetzt auch noch mit dem verlockenden Angebot, sich in der Armee zum Reserveoffizier ausbilden zu lassen.
Stimmte denn da nicht alles? Alles, was er in seiner Sucht nach Schöpferischem sowohl gesellschaftspolitisch als auch wissenschaftlich und künstlerisch stets erstrebt hatte? War die Welt nicht wieder in Ordnung? Bat ihn das Mütterchen Republik nicht gar um Verzeihung, indem es ihn auf so unterschiedliche Weise umwarb?
Zugleich aber wußte er ja, daß ihn nichts so dringend erwartete wie sein Zuhause.
Wenige Tage vor seiner Abreise hierher war er von Frank Lutter angerufen worden. Obwohl sie in derselben Stadt wohnten, wenngleich in verschiedenen Gegenden, waren sie sich jahrelang aus dem Weg gegangen, hatten ihre Begegnungen dem Zufall überlassen. Das rührte noch her von Franks Denunziation, wie es sowohl Mutter Hanna als auch Erich Höllsfahrt einmal genannt hatten. Ulrikes Urteil war sogar noch schärfer ausgefallen: Gut, es ist seine Sache, und letztendlich muß er damit leben. Aber an dir, seinem von ihm immer wieder hoch und heilig beteuerten Freund, wurde er zum Verräter ...
Nein, er hatte ihr darin nicht folgen können. Ja, es sträubte sich in ihm, ihrer Absolutheit - wieder einmal ihrem moralischen Rigorismus beizupflichten. Du kennst nur das Entweder-Oder. Und ich wundere mich, wieso du damit überhaupt Pädagogin sein kannst.
Ach, lassen wir das ... Sie stritt nicht. Sie war froh, wenn er wieder bei ihr und den Kindern weilte, Julia und Soja spürten, was ein Vater ist, wovon sie denn auch ausgiebig Gebrauch machten, sich an ihn hängten. Meist blieb er dann für längere Zeit, bummelte, mit Duldung der Gewerkschaft, seine Überstunden ab. Das war so, als er noch beim Gleisbau in den Braunkohlegruben gearbeitet hatte, später als Fernfahrer, und es änderte sich auch nicht, nachdem er in der Vogelschutzstation des Havelluchs eine Anstellung fand. Sie wollte sich mit banalem Gezänk wie diesem keinen ihrer wenigen Abende zu zweit vergällen, zumal sie tagsüber unterrichtete und sich auch sonst ihrem Beruf voll widmete.
Als dann vor einer Woche im Korridor das Telefon klingelte, ging sie an den Apparat, da die Anrufe ohnehin gewöhnlich ihr galten. Er vernahm vom Wohnzimmer aus ihre Antworten, jedoch ohne Genaueres daraus zu erfahren. Sie klangen nur seltsam stockend. Ihre Stimme schien zu beben. Und er glaubte herauszuhören, daß sie irgend jemandem, was ihr nie gelegen hatte, ihr Beileid aussprach.
Sie kam zurück. War völlig verstört. Ihr dünnes Haar, worunter sie selber am meisten litt, vertrüge mal wieder, hatte er soeben noch gedacht, eine Kaltwelle. Er hatte in ihm, auffälliger als bei seinem letzten Besuch, graue Fäden entdeckt, zugleich jedoch bemerkt, daß ihre Figur noch immer wirkte wie vor zwanzig Jahren, nichts von ihrer Gestrafftheit eingebüßt hatte. Wie tat sie das bloß? Sie lebte nicht nach Diät, trieb in ihrer Schule Sport, ja, doch keineswegs übermäßig. Ulrike wog hundertundzwei Pfund, und dabei würde es wohl bis in alle Ewigkeit bleiben.
Sie setzte sich. Er grübelte, wann er diesen Ausdruck in ihrem Gesicht zum letzten Mal gesehen hatte. War es, als sie sich plötzlich, so kurz vor dem Abitur, schwanger gefühlt hatte? War es, nachdem Lutter und er den Fötus verscharrt hatten, dort in Graubrücken, wo heute die Neubaublöcke standen? Wann war es, wann ...?
Ulrike, wußte er, weinte nur selten.
»Lutter«, schluchzte sie jetzt und preßte wie in einem Krampf ihr Taschentuch gegen die Augen. »Lutter hat angerufen ...« Nach einer Pause dann, in der sie sich offenbar erst fassen mußte: »Ilse ist tot.«
»Ilse?« fragte er nur gedehnt. Und auch er spürte, wie sich etwas in ihm verkrampfte.
»Frank bittet uns, seine Kinder zu uns zu nehmen, Robert und Clara. Er wisse nicht, wem er sie sonst anvertrauen soll.«
»Und was hast du geantwortet?« Doch im selben Moment wurde ihm schon bewußt, daß seine Frage überflüssig war. Ulrike würde nie jemandem ihre Hilfe verweigern.
»Ja. Selbstverständlich. Ich will mein Bestes versuchen.«
Seitdem versorgte sie vier Kinder. Frank war gekommen und hatte seinen Sohn und seine Tochter in ihre Obhut gegeben. Über Ilse sprach er nur wenig. Andererseits wollten sie ihn nicht drängen. Er sei auf Dienstreise gewesen, sagte er, sei erst spät in der Nacht zurückgekehrt und habe sie tot im Bett gefunden. »Du kannst dir vorstellen, Alter, Obduktion, und inzwischen habe ich nicht nur die Ärzte auf dem Hals.«