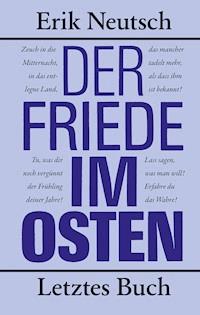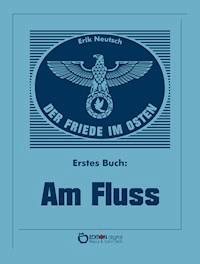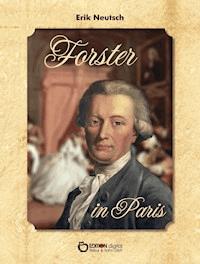8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erik Neutschs Geschichtsepos handelt von dem in den Jahren der Reformation und der Bauernkriege schöpferisch tätigen Maler Mathias Grünewald, sichtbar gemacht an seinem genialen Hauptwerk, dem „Isenheimer Altar“. Alles, was von diesem neben Dürer und Cranach größten Künstler jenes Zeitenumbruchs bekannt ist, blieb rätselhaft: sein wirklicher Name, seine Herkunft, die Entstehungsgeschichte seiner Bilder und Altäre. Dabei stand er als Hofmaler des Kardinals Albrecht von Brandenburg, Erzbischofs von Mainz, Magdeburg und Halberstadt, bis zu seiner Flucht nach Halle an der Saale an höchst exponierter Stelle. Erik Neutsch sucht in seinem mit großem Atem und sprachlich brillant erzähltem Roman nach den Wurzeln und Kräften, die Grünewalds Werk beflügelt haben, nach den Quellen seines über die Jahrhunderte fortwirkenden Schaffens und den Ursachen seines erzwungenen Scheiterns. Allegorisch versucht er dabei auch auf die stets aktuelle Frage zu antworten, wie sich Künstler im gesellschaftlichen Umbruch verhalten und zu welchen Leistungen sie, ohne sich selbst zu verraten, fähig sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 585
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum
Erik Neutsch
Nach dem großen Aufstand
Ein Grünewald-Roman
ISBN 978-3-95655-211-3 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 2010 im Verlag Janos Stekovics, Dößel
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
Auf Wunsch des Autors wurde nicht auf neue Rechtschreibung umgestellt.
© 2016 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Vorwort
Vieles, was Aufklärung geben kann über diesen oder jenen Verlauf der Geschichte, auch über Verstrickungen von Personen in die Gewalt der Ereignisse, findet sich oft erst nach Jahren, manchmal gar erst nach Jahrhunderten, und dann formt sich ein Bild, das allem bisher Geglaubten, Behaupteten und teils längst als gesichert Angesehenen entgegensteht. Weniger mag es vielleicht die Überlieferung historischer Fakten betreffen als vielmehr den Menschen, den einen und unverwechselbaren, der in seiner Zeit zu leiden, niederzustürzen oder zu überleben hatte. Der Zufall - oder bleibt es nicht oft genug doch der fleißigen Arbeit eines wahrheitsliebenden Chronisten zu danken? - bringt’s an den Tag, unvermittelt, plötzlich, und alles Begutachten, Urteilen, Schauen gerät in ein anderes Licht.
So auch geschah es, als 1991 und danach, mit dem restaurativen Bestreben, die alten Verhältnisse wieder zu ordnen, die Bestände der vor fast vierhundertundfünfzig Jahren gegründeten Marienbibliothek in Halle neu gesichtet wurden. Man war auf der Suche nach Handschriften der Reformatoren, Luthers, Wincklers, Müntzers vielleicht, und Humanisten wie Melanchthon - und stieß im untersten Verlies auf eine, die von Johan Glaser stammt, Bornmeister der Salzquellen einst, Promotor beim städtischen Rat und vor allem lange Zeit Kanzleischreiber im Dienste Kardinal Albrechts.
Glaser starb 1552. Sein Protokoll, wie wir es heute wohl nennen würden, abgesegnet übrigens von dem damals sehr einflußreichen Finanz- und Handelskaufmann Hans Schenitz, ist nahezu pedantisch geführt, wurde jedoch nie an den eigentlichen Auftraggeber, den Kardinal, dem die Stadt längst zuwider geworden war, abgeschickt. Glaser muß es geheimgehalten haben, und erst seine Erben aus der marktnahen, später in Brüderstraße umbenannten Prüfel, wo er im Hause »Zum Weißen Hirsch« wohnte, an der Stelle der heutigen Nummer 15, überließen es offenbar nach seinem Tode der schon erwähnten Marienbibliothek.
Die Aufzeichnungen Glasers beziehen sich allein auf den Maler Mathis, der über die Jahrhunderte hinweg irrtümlich Grünewald genannt wurde, den Schöpfer - unter anderem - des Isenheimer Altars, in Wirklichkeit aber, wie die Forschung belegen konnte, Neithardt hieß, geschrieben auch Nithardt, und der später seinem Namen den des Gothardt hinzufügte, nachdem ihm einer seiner Geistesverwandten, Johannes de Indagine, eine dem Doktor Faustus ähnliche Gestalt zu Beginn des 16. Jahrhunderts, dazu geraten hatte.
Auch darüber ist in der Akte zu lesen, deren erster Eintragung am 21. Juni 1527 erfolgte, jenem Tag, an dem Johan Glaser die Ankunft des Meisters Mathis Gothardt-Nithardt in Hall, d. i. Halle an der Saale, erwartete.
Erstes Kapitel
Sei getreu bis an den Tod,
so will ich dir die Krone des Lebens geben.
(Offenbarung 2/10)
Soll man den Worten Johan Glasers glauben (und nichts spricht zunächst dagegen), so muß Meister Mathis achtundvierzig Jahre alt gewesen sein, als er im Spätfrühling von 1527, Hals über Kopf, wohl mitten in der Nacht und in einem wilden Ritt, zu Pferde Frankfurt am Main verließ. Nichts außer dem Nötigsten nahm er mit, dazu etwas Wegzehrung und seinen Wappenring, der ihn als hochgestelltes Mitglied dereinst am Hofe des Kardinals Albrecht auswies. Alles andere, was ihm noch gehörte, ließ er in Kästen und Truhen verpackt zurück, bei Hans von Sarbrücken, dem Seidensticker und Wirt der Herberge »Zum Einhorn« in der Barfüßergasse, bei dem er zuletzt Asyl gefunden hatte. Selbst sein Testament, in dem er seinen gesamten Nachlaß auf seinen Adoptivsohn Andreas überschrieben hatte, blieb dort verwahrt.
Glasers Aufzeichnungen geben Auskunft darüber, daß er bereits am ersten Tage, nachdem ihn ein Jahr später, Ende August, die Krankheit befallen hatte und das Schlimmste befürchten ließ, auf dieses Testament den größten Wert legte. Immer wieder, heißt es, habe er von seinem Sohn gesprochen und ihn liebevoll Endres genannt, was dem Namen einen welschen Anklang verliehen und womöglich aus jener Zeit herstamme, in der er im Elsaß geweilt und daselbst für das Antoniterkloster zu Isenheim den Altar geschaffen habe. Denn schließlich sei der Knabe ja auch dort zur Welt gekommen.
Die Flucht aus Frankfurt, so nach den wiederholten Aussagen des Meisters, sei aus zweierlei Gründen erfolgt. Zum einen habe der Kardinal immer entschiedener und schon unter Androhung härtester Strafen vom Rat der Freien Reichsstadt die Auslieferung aller Aufrührer gefordert, die sich in ihr seit dem Gottesgericht wider die mörderischen Bauern versteckt hielten. Und zum anderen habe er, Mathis, sich daraufhin, nachdem ihm bereits ein ähnliches Angebot aus Magdeburg aus der Hand geschlagen, der Werbung des Kaufherrn Schenitz entsonnen, der ihm noch kurz zuvor versichert habe, er könne fortan hier, in Hall und im Solde der Stadt, als Wasserkunstmeister wirken und sein Leben in Ansehen und pekuniär vollkommen unbesorgt verbringen. Was er dann male, nun freilich ohne die Aufträge der Heiligen Römischen Kirche, das liege allein in seinem Ermessen. Auch darüber könne man reden, sobald es spruchreif sei...
Mathis hatte angenommen. Und was hätte er denn auch sonst tun sollen, nachdem der Kardinal ihm sein gesamtes Vermögen in Seligenstadt geraubt, er gerade noch mit dem Sack und Pack, was auf ein Wäglein gepaßt, die schützenden Mauern Frankfurts erreicht hatte und der Kurie als Widergott galt? Er, ein Ketzer, Lutheraner, Bauernfreund, ein Ausgestoßener nach dem großen Aufstand!
Achtundvierzig, und er fühlte sich in den besten Jahren, die besten, die einem Manne zuteil werden konnten. Vielleicht würden sie noch mit der Gnade des Allmächtigen bis zu den Sechzigern reichen. Und danach?
Mathis lag auf dem Bett, in seiner Kammer bei Rumpe. Ihn hatte ein teuflischer Schwindel ergriffen. Am Abend, als er aus dem Kanal gekommen war, gekrochen. Aus dem Dreck und der Seuche. Von den Ratten, die dort wimmelten, pfiffen und heckten.
Heinrich Rumpe ließ ihn seit Monaten bei sich wohnen. Er verehrte ihn. Er hatte auf seiner Wanderschaft die Gemälde des Altars in der Kirche zum Klosterhospital von Isenheim im Entstehen gesehen. Nie würde er, selbst wenn der Kardinal nun auch ihn verfluchen sollte, seiner Bewunderung für den Meister abtrünnig werden. Mathis war für ihn, im Malerischen, im Einsatz und im Gestalten der Farben, mit ihrer Leuchtkraft, dem Feuer, der genialste seinesgleichen, genialer als Cranach aus Wittenberg und der Nürnberger Dürer, der ohnehin immer nur, mit unübertroffenem Können zwar, kühl und genau, zu zeichnen verstand.
Mathis, so jedenfalls schien es Rumpe, erfaßte überdies wie kein anderer den Geist der Zeit, die Herkunft des Menschen, seine Mühsal in diesen Jahren, gelegen zwischen dem Gestern und dem Heute. Sein Heiland am Kreuz. Ein Geknechteter, ein Geschundener. Sebastian... Auf der linken Tafel der vorderen Schauseite. Vielleicht sah der Meister in ihm sein Ebenbild? Hatte auch er sich damals schon so empfunden? Von Pfeilen durchbohrt... Und später erst recht? Am Hofe Albrechts und zunehmend unter der wankelmütigen Herrschaft seines Fürsten leidend? Aber zog er denn nicht auch die tödlichen Geschosse aus seiner Brust? Sich zu befreien? Wenngleich blutüberströmt von Wunden?
Seine Freunde waren gekommen, nachdem Heinrich Rumpe, tief erschrocken beim Anblick des Meisters,sofort nach ihnen geschickt hatte. Als erster traf Johan Glaser ein, da er nur knappe fünfzig Ruten von der Prüfel die Bergstadt hinauf bis zu dem Hause nahe dem Steintor zu laufen brauchte, etwas später dann Hans Plogk, wegen des weiteren Weges vom Schlamm hierher, und Gabriel Tuntzel gar war erst nach längerem Suchen gefunden worden, außerhalb seiner Werkstatt, im »Kühlen Brunnen«, wo er noch für Schenitz bis in die Nacht hinein an seinen allseits begehrten, kunstvollen Türen im Inneren des Palastes hatte arbeiten wollen.
Mathis schien abwesend. Sein Atem ging keuchend; er lag mit geschlossenen Augen da. Als er sie endlich öffnete, Glaser sich über ihn beugte, um sich seines Zustandes zu vergewissern, ihn fragte: »Erkennt Ihr mich?«, erwiderte Mathis, ohne darauf einzugehen, mit hauchender Stimme: »Sagt, welche Zeit haben wir? Und ist nicht heute der Siebenundzwanzigste, der Donnerstag, an dem wir den Schacht vor der Körberpforte wieder schließen wollen?«
Seine Stirn glühte.
»Ich fühl mich zum Sterben elend.«
»Gemach, gemach«, entgegnete der recht dickleibige Tuntzel, dessen kurzgeschnittenes schwarzes Haar ihm jetzt, plattgedrückt von der Nässe, um den Kopf wie ein Pilzhut anlag. »Es ist das Übliche, eine Erkältung. Bei diesem scheußlichen Wetter aber auch. Seht mich an. Ich bin durch den Regen gewatet, der nun wie im Wutanfall über die tagelange Hitze gekommen ist, und durchgeweicht bis auf die Knochen. In einer Woche, bei Lindenblüten und Senfwickeln, seid Ihr wieder genesen.«
Mathis sagte: »Nein, nein. Es kommt von den Ratten ...«
Hans Plogk sah sich veranlaßt, obwohl er, so wie der Meister auf ihn wirkte, dessen Furcht durchaus teilte, Tuntzel beizupflichten. Weit jünger als er, fiel es ihm keineswegs schwer. Er lächelte sogar und schüttelte seine blonden Locken. »Aber, aber - wer wird denn gleich den Teufel an die Wand malen.«
»Die Finsternis um mich her ... Es ist mir zu dunkel«, stöhnte Mathis. »Ich bitt’ Euch, schlagt Licht.«
Verwundert blickten die Männer sich an. Durch die beiden Fenster drang noch immer ein milder Schein vom Tag, und der Raum war eher in eine freundliche Dämmerung getaucht. Finsternis jedenfalls hüllte ihn nicht ein.
Dennoch folgte Heinrich Rumpe der Aufforderung, griff nach dem Feuerstein und dem Zunder und entbrannte damit die Kerzen auf dem Tisch in der Mitte.
Viel heller wurde es dadurch nicht, aber die Flammen beleuchteten nun sein Gesicht. Es war, als würde ein Schleier von ihm gezogen. Schweiß bedeckte seine Haut, und man konnte deutlich erkennen, wie eingefallen und grau sie war. In seinem um Oberlippe, Wangen und Kinn mäßig gestutzten Bart glitzerten hirsekorngroße Tropfen. Fieberschübe rüttelten ihn. Und sprach er denn nicht auch schon, als sei ihm der Geist verwirrt?
»Hebt mich an, meine Freunde. Es eilt, ich muß in die Bronnröhren zurück. Die Stadt braucht die Wasserkunst bis zum Winter. Ehe die Saale erneut überschwemmt. Sie muß entseucht werden.«
Mathis versuchte selbst, sich aufzustützen. Doch seine Worte hatten ihn Kraft gekostet. Er fiel zurück in die Kissen. Rumpe holte eine Kanne mit Wasser, tauchte ein Tuch hinein und kühlte ihm die Stirn. Mathis schloß wieder die Augen. Sie wußten nicht, ob er schlief.
In der Wohnung Rumpes, im Stockwerk unter der Kammer, in der sie den Meister vorerst der Wache einer Magd überließen, hielten die Männer, nun unter sich, mit ihren Befürchtungen nicht länger zurück. Allen vieren legte die bange Frage sich auf die Lippen, und Glaser sprach sie als erster aus. Ob es nicht doch der Schwarze Tod sei, fragte er, der ihn bedrohe. Im Thal, in den Hütten, gab es bereits die ersten Fälle.
Auch in Frankfurt hatte vor zwei Jahren, kaum daß Mathis in der Stadt Zuflucht gefunden, eine Seuche gewütet, das Schweißfieber. Es sei, wurde vermutet, von englischen Seefahrern über den Rhein und den Main hereingeschleppt worden. In wenigen Stunden schon nach der Ansteckung starben die Menschen, unter Herzstörungen und Pulsschwäche dahingerafft, und es war ein Glockenläuten von allen Türmen. Panik befiel die Bürger.
Hans von Sarbrücken stand vor ihm, mit bleichem Gesicht unter der Kolbe, so als blicke auch er bereits dem Tod in die Augenhöhlen, bettelte und bedrängte ihn. Da er doch wisse, daß er, der Meister, noch aus dem Klosterspital zu Isenheim ein Büchlein mit alten Rezepten bewahre, darin von den Kräutern des Heils die Rede, beschwöre er ihn zu helfen, damit die Not gelindert würde, und auch Peter Hock, der Ratsherr, nachdem er davon erfahren, kam und sagte: »Macht uns Salben, Mathis. Die Stadt wird es Euch danken, es soll Euer Schade nicht sein. Nicht anders als meinen Bruder, den Henne, Euren Vertrauten aus Seligenstadt, wird sie Euch aufnehmen wie unseresgleichen, Euch ebenso Schutz gewähren vor Eurem einstigen Herrn, zumal der Kurfürst jetzt ohnehin Frankfurt hat absperren lassen, weil er furchtet, das Fieber könnte ins Mainzische schwappen, vor allem aber in seine verruchte Residenz nach Aschaffenburg.«
Ruckus, der Schneider, der aber wohl eher sein Tun ans Branntweinbrennen hängte, das Torhansel genannt wegen seiner Wohnung im Wachthaus des Allerheiligentores, besorgte ihm eine Waschküche und dazu einen Sieder, Lorenz Schnefenberger, den er als einen der verläßlichsten, gar pfiffigsten in dem Gewerbe lobte. Sein langjähriger, väterlicher Freund indes, Johannes de Indagine, von Albrechts Gnaden noch zu besserer Zeit zum Dechanten des Leonhardstiftes berufen, schoß ihm eine Summe Gulden vor, um die Kessel und Pfannen zum Kochen der Heilmittel kaufen zu können. Und so ward aus Meister Mathis mit einem Schlage ein Seifensieder.
Wie bald aber bereute er schon, daß er sich zu diesem Geschäft hatte überreden, schlimmer, empfand er: erniedrigen lassen.
Das war nicht sein Handwerk, wie überhaupt seine Art nicht. Er einst ein Wappenträger am Hofe, geehrt und geachtet in allen Landen, vom Elsaß bis Sachsen und Schweden. Wie viele Gotteshäuser schmückten seine Altarbilder, wie viele der hohen Herren hatten sich von seinen Gemälden beglücken lassen! Doch nun stand er bereits frühmorgens zwischen dem Römerberg und dem Dom auf dem Markt, mitten im Gewimmel des Volkes, das angesichts der galoppierenden Krankheit wenigstens noch seinen Tanz haben wollte, lärmte und Possen riß. So waren die Menschen. Und er? Die Seife verkaufte sich nicht von allein. Er mußte an seinem Stand mit einer Lautstärke, die seine Stimme überforderte, so daß er bald heiserte, die Ware anpreisen. Hört, ihr Leute, hört, ich bringe euch frohe Kunde ... Zwar hatte Peter Hock dafür gebürgt, daß er seine Becher, gefüllt mit dem schmierigen, Fett und Wachs beigemischten Extrakt der Kräuter, mit dem Reichsadler siegeln durfte, als Zeichen der Güte, doch wollten die Leute wissen, was sich hinter seinen Worten verbarg, was in dem Medicamentum steckte. Brunnenkresse, Spitzwegerich, Klee und Mohn, dazu eine Prise Faulbaumrinde. Den Rest seiner Mixtur verschwieg er jedoch, die Blätter des Roten Fingerhuts.
Viel mehr, dachte er, ist es gewiß die Enge, in der die Menschen hier lebten, die sie anfällig machte. Der Schmutz und der Kot, ihre Scheu vor dem Wasser, der salzig verkrustete Schweiß auf ihrer Haut, das Ungeziefer in ihren Lumpen, ihr Urinieren freiweg in den Nischen und Gassen. Schon das Gedränge, das ihn umgab, nachdem sich herumgesprochen, seine Salben wirkten wie Zaubermittel gegen das Fieber, ekelte ihn. Unmittelbar neben ihm bot ein Bauer von den Feldern hinter dem Main Rüben, Zwiebeln und verschiedene Sorten noch unreifen Kohls feil, der, so schrie er es aus, besonders die Därme glätte, sie, würde er täglich genossen, von allen verderblichen Gasen entlüfte. Um zu beweisen, daß es die volle Wahrheit sei, ließ er laut seine Winde blasen, hob dabei jedesmal seinen Rock, wodurch sich ringsum ein übler Gestank verbreitete. Dieses Gebaren zog die Narren und Backöfner an, die Ärmsten der Armen, und mit derben Sprüchen und unflätigem Gejohl versuchten sie, es ihm nachzumachen. Ohne deinen Kohl, höhnten sie, schon ein knurrender Magen genügt! Mehrmals rief der Marktmeister die Stadtknechte zu Hilfe. Die kamen und prügelten mit Knüppeln die Rottung auseinander und, nützte auch das nichts, griffen etliche gar zu ihren Degen. Einmal wurde auch Mathis von einem Stockschlag getroffen, aus Versehen, gewiß, und man bat ihn um Verzeihung, aber er holte sich eine blutende Wunde über der Stirn.
Fortan schickte er Lorenz Schnefenberger auf den Markt. Doch er hätte ihn dringender an den Kesseln gebraucht, die Heilseife zu sieden. Nun tat er es selbst während der Stunden, in denen der Geselle abwesend war. Dann quälte er sich in dem stickigen Dampf, das Atmen fiel ihm schwer, und die scharfen Essenzen der Kräuter im brodelnden Sud beizten ihm in die Augen, die Küche verschwamm vor seinen Blicken, derart, daß er zu erblinden wähnte. Kehrte der Lümmel zurück, mit strahlendem Gesicht und breitem Lachen zwar - hoha!, ich hab uns wieder reich gemacht, Meister, als war ich der Tetzel mit seinem Klingelkasten merkte Mathis hingegen bald, daß er von ihm betrogen wurde. Immer seltener stimmten die Rechnungen, es fehlten nicht nur Heller und Pfennige, sondern Groschen. Und schon mahnte Sarbrückens Frau Brigitte, sie könne ihm Speis und Trank auf Dauer nicht umsonst gewähren, er schulde ihr für einen ganzen Monat bereits das Entgelt für die Mahlzeiten. Und wie sollte er jemals Indagine die geliehene Summe zurückerstatten?
Mathis gab auf. Er begann mit seinen seltenen, bisher als Geheimnis gehüteten Farben zu handeln, die er aus seiner Werkstatt in Seligenstadt gerettet hatte, und verkaufte nach und nach die eine und andere Substanz. Hier käme er ohnehin nicht zum Malen. Zwar hatte er sich, da seine Leidenschaft ihn trieb, erneut zu einem Gemälde entschlossen. Wiederum zeigte es den Heiland am Kreuz, doch im Hintergrund diesmal, auf dem kahlen Hügel von Golgatha, ein bizarr ins Bild ragender Baum, an dem sich Judas erhängt hatte. Wer aber würde es ihm abnehmen? Mit dieser Szenerie? Von Angesicht zu Angesicht Gottes Sohn und der Verräter ... Er besaß keinen Auftraggeber mehr, und die Kurie würde ihn wohl gar der Häresie bezichtigen.
Wie ein Wink des Himmels erschien es ihm da, als eines Tages, ohne sich vorher angekündigt zu haben, Hans Schenitz ihn besuchte. Schon war es im Frühjahr, die Stadt vom Schweißfieber längst befreit. Vor ihren Toren, an den Ufern des Mains beiderseits und auf den Inseln, Sankt Bartholomäus gegenüber, blühten die Wiesen und Hecken. Mathis war noch einmal zum Fluß gegangen, um am Orte seine Zeichnungen von den Mühlwerken zu überprüfen, die er auf Bitten Magdeburgs, das man hier noch gelegentlich Maidburg nannte, angefertigt hatte, und da er sich nun seines Auftrags entledigt fühlte, nahm er sich Zeit, den ersten Blumen nachzuspüren, die sich der Sonne entgegenreckten, zückte sein Skizzenbuch und den Silberstift und bannte sie aufs Papier, den Huflattich, die wilden Veilchen. Das müsse er fest- halten, dachte er, sofort in Farbe, wenn er sich wieder in seiner Dachkammer befand, diesen Kontrast zwischen dem leuchtenden Gelb und dem sanften, samtigen Violett. Blatt um Blatt füllte er mit seinen Strichen, war es zufrieden und kehrte heim zu Sarbrücken ins »Einhorn«.
Dort, kaum daß er die Tür geöffnet, empfing ihn schon Schenitz. Er hatte, obwohl in Eile, auf ihn gewartet, und fürs erste erschrak Mathis. Mit seiner Anwesenheit hatte er wahrlich am wenigsten gerechnet, und hinzu kam sein Mißtrauen, das er diesem Manne gegenüber seit langem hegte. Er kannte ihn von Halle, war ihm oft begegnet im Gefolge des Kardinals, und hielt sich denn Schenitz nicht auch für dessen Finanzrat? War er nicht sein Speculateur oder Vermittler, was sich beides wohl gleichblieb, in den Geldsachen Albrechts mit den Fuggern? Galt er nicht gar als dessen unterwürfige Schranze, winselte oder kläffte, je nach Laune und Bedarf von Ihro Gnaden, wie dessen Hofhund? Was, folglich, hatte er hier zu suchen, wenn sein Herr und Gebieter schon von der Stadt Frankfurt die Auslieferung all jener verlangte, die mit den Bauern und Luther gegangen waren, also auch seiner Person, zumal er über den Wittenberger hinaus, furioser als Cranach, den Ideen des Erasmus, Huttens, neuerdings auch des Thomas Morus anhing, den dräuenden Weissagungen Birgittas von Schweden nach wie vor, und sich mit Leib und Seele, unter Verlust all seines Besitzes, auf die Seite der Gerechten, des gepeinigten Volks geschlagen hatte? Sogar die Schriften der Täufer versetzten ihn seit geraumem in Unruhe, quirlten durch seine Gedanken, so daß er selbst bereits fürchtete, ihrem schismatischen Sog wie dem eines reinigenden Strudels in trübem, fauligem Wasser zu erliegen? Was also mochte Schenitz von ihm wollen?
Der aber verbeugte sich ehrfurchtsvoll, setzte sein Barett ab und bat ihn, unter vier Augen sprechen zu dürfen. Mit Sarbrücken mußte er sich schon einig geworden sein, denn der drückte sich sofort von hinnen. An einem Tisch in einer hinteren Nische des Schankraums, vor sich zwei zinnerne Kannen mit Bier, nahmen sie Platz. Schenitz trank an, wischte sich den Schaum vom Munde, und Mathis konnte nicht anders, als seinen unverhofften Besucher zu beobachten.
Er war ein ungewöhnlich gut aussehender Mann, ganz im Sinne seines Namens, den er lieber wie Schönitz ausgesprochen hörte, war jung, glühend in seiner Beredsamkeit. Mathis wußte, er war nicht älter als dreißig, eher darunter, und trotzdem umgab ihn bereits eine Aureole geschäftlichen Erfolgs. Sein bartloses Antlitz von ovaler Ebenmäßigkeit, die Lippen nicht zu breit, nicht zu schmal geschwungen, wenngleich sie sich manchmal, anläßlich einer spöttischen Bemerkung etwa, im rechten Mundwinkel unangenehm schieften. Die Nase scharf gegratet, fast steil die beiden Gesichtshälften teilend, und dann die Augen, unter wohlgeformten dunklen Brauen, kühlen Blicks, abwägend, gar berechnend. Er trug eine Schaube, bei seinem Stande allgemein üblich, doch mit kostbarem Pelzbesatz vom Hermelin. Ihre Ärmel reichten ihm nur bis zu den Ellenbogen. Ab dort bis über die Knöchel seiner Handgelenke war er mit einem vielfach geschlitzten, in allen erdenklichen Farben gemusterten Seidengewand bekleidet. An seinen Fingern steckten mehrere Ringe, von Gold und mit Steinen. Mathis erkannte Rubine und Opale.
»Ich bin gekommen«, sagte Schenitz, im Gegensatz zu seiner äußeren Erscheinung fast bescheiden, sehr bedächtig, »um Euch zu bitten, in Halle die Wasserkunst zu richten. Ihr seid, wie auf anderen Gebieten so auch auf diesem, ein Meister Eures Fachs. Ich vernahm, Magdeburg wolle Euch dingen. Wir aber, mit der störrischen, verschlungenen Saale, haben es weitaus schwieriger. Auch möcht’ ich Euch nicht verhehlen, daß mir die Bändigung des Flusses persönlich sehr am Herzen liegt. Meine neue Heimstatt geht ihrem Ende entgegen. Ihr könnt Euch vielleicht erinnern. Dort am Markt. Und ich will mir sauberes Wasser in meine Bäder holen.«
»Es tut mir leid«, entgegnete Mathis. »Ich bin seit einiger Zeit mit Maidburg verabredet. Soeben schloß ich die Zeichnungen der Mainmühlen nach ihrer Natur ab.«
»Das aber ist ja bereits geklärt. Denkt nicht, daß ich mit leeren Händen kam und in Frankfurt untätig gewesen sei. Weitz, der Euch dafür geworben, würde selber den Auftrag für Magdeburg übernehmen. Ihr hingegen, Meister Mathis, könntet Euch, falls Ihr bereit wäret, auf vortreffliche Weise dem Zugriff unseres ehedem gemeinsamen Herrn, des Kardinals, entziehen.«
»Und wie soll das vonstatten gehen?« fragte Mathis, hellhörig geworden, doch noch immer voller Argwohn.
»Nichts einfacher als das. Ihr verpflichtet Euch zu uns nach Hall. Alles andere, das überlaßt nur meiner Sorge. Mein Einfluß ist nicht ohne Respekt in den Amtsstuben des Rates.«
»Aber was wird mich erwarten in Eurer Stadt?«
»Auch dafür wüßten wir schon eine Lösung. Der Vertrag muß natürlich an Ort und Stelle geschlossen werden. Bei Glaser, den Ihr ja ebenfalls kennt, könntet Ihr vorerst wohnen. Bis sich Besseres findet. Aber auch in seinem Haus könntet Ihr bereits walten und gestalten, wie Euch beliebt.« Danach schwieg er kurz, setzte die Kanne an seine Lippen, fügte aber sogleich, mit besagt schiefem Munde, neben einer höhnischen Bemerkung eine Art Ultimatum hinzu: »Albrecht ist vom Jagdfieber besessen. Doch da er nie ein guter Schütze war, legt er jetzt überall seine Fallen aus, um seiner Beute dennoch habhaft zu werden. Mit dem Eisen. Ich will Euch nicht verschrecken. Aber wenn er - und ich traf ihn vor Tagen erst in Aschaffenburg - weiterhin so auf Vergeltung sinnt und rast, seid Ihr hier nicht mehr zu retten. Halle hingegen meidet er, weil, wie Ihr wißt, es ist lutheranisch.«
Mathis erbat sich Bedenkzeit. Was ihm an alledem am meisten zu schaffen machte, ja, empörte, war das Verhalten von Kaspar Weitz, dem Baumeister. Er hatte ihm doch die Contrafeiung der Mainmühlen angetragen, unbedingt von seiner Hand die Risse haben wollen, und warum verriet er ihn jetzt so schnöde? Wozu hatte er nun mit nahezu sklavischer Genauigkeit die Pläne für Magdeburg angefertigt, wenn seine Mühe sich doch nicht lohnte? Da fühlte er sich erneut betrogen.
Ehe er aber noch länger seiner Enttäuschung nachgehen konnte, kaum daß Schenitz sich von ihm verabschiedet hatte, durchlief ganz Deutschland ein Gerücht, das jedoch bald Bestätigung fand und in allen Städten und Dörfern Entsetzen auslöste: Winckler, der Hofprediger am Neuen Stift zu Halle, war, nachdem ihn der Kardinal in seine Residenz nach Aschaffenburg befohlen hatte, auf seiner Heimreise in den Wäldern des Spessarts ermordet worden ...
Albrecht, was nunmehr ans Licht kam, hatte von ihm gefordert, dem Glauben Luthers abzuschwören und auf Knien vor ihm zu bereuen, daß er gegen das Sakrament der Weihe verstoßen, indem er den Zölibat gebrochen und sich verheiratet hatte. Winckler aber ließ sich nicht beugen. Und somit hielt es jedermann für beschlossen, die Bluttat sei auf die Intrigen des Kardinals zurückzuführen, sei, wenn nicht gar auf sein Geheiß, so doch mit seiner Billigung geschehen.
Auch Mathis dachte nicht anders. Er kannte, wie auch von Schenitz erwähnt, was ihn zunächst verwundert hatte, den tückischen Charakter Albrechts, seinen Jähzorn, sobald ihm etwas zuwiderlief; er hatte selber darunter zu leiden gehabt. Und so gab ihm der Meuchelmord den letzten Anstoß, Frankfurt zu verlassen.
In aller Hast begann er, seinen Nachlaß zu ordnen, nachdem er auch Indagine in sein Vertrauen gezogen. Der riet ihm ebenfalls zur Flucht, war mit ihm einer Meinung, daß seines Bleibens hier nicht länger ohne Gefahren wäre, er sich erneuter Verfolgung ausliefern würde. Auch ihn depressiere die Herrschsucht, diese allzu irdische Immoralität Seiner Eminenz, der es die kasuistischen Maximen des Florentiners Machiavelli offenbar mehr angetan hatten als die Zehn Gebote, und er gedenke bereits, Sankt Leonhard den Rücken zu kehren und sich der Kaplanei im stillen Niederursel anzunehmen. Mit seiner Hilfe auch, da Mathis sich kaum noch einen Blick vorauszuwerfen getraute, darauf, was ihm künftig in dieser grimmigen Zeit voller Verworrenheit und Verderbnis beschieden sei, verfaßte er ein Testament und legte eine Liste an, in die er zwar Punkt für Punkt, doch wie der Zufall sie ihm in die Hände spielte, jene Habseligkeiten eintrug, die ihm, nun in Laden, Truhen und Kisten buntgewürfelt verpackt, noch verblieben waren. Als seinen alleinigen Erben setzte er Andreas ein, seinen Sohn, und bat unter Zeugen Hans von Sarbrücken, all die Sachen zu verwahren bis, ja, bis ...? Er wußte nicht, ob er sie jemals wieder zu Gesicht bekäme. Zwar hoffte er, sie eines Tages nach Halle überführen zu können, sobald er sich dort eingerichtet und die Wirrnis in den deutschen Landen sich beruhigt habe, doch Gewißheit, nein, Gewißheit besaß er nicht. Gottvertrauen, vielleicht, Gottvertrauen. Sofern ein Vogel es ebenfalls haben konnte. Denn er war vogelfrei, nicht minder als die Gefiederten nur eine Kreatur in ihrer flüchtigen Schar unter dem Himmel. Er betete. Herr, der du mich erschaffen, dem ich zeit meines Lebens gedient habe, gib mir Kraft, gewähre mir deine Gnade ... Mir und dem Endres. Nun würde er nicht einmal mehr Gelegenheit finden, ihn wiederzusehen und zum Abschied zu umarmen. Er fühlte den Schmerz, den Stich in sich wie beim Tode Gelas vor einem Jahr. Ihr war das Herz in der Brust erstorben, nachdem der Kardinal über ihn, seinen Maler, den Stab gebrochen. Beim Meister Rücker in Seligenstadt, der sein Brot nun ebenfalls eher als Schreiner denn als geschätzter Bildschnitzer wie einst erwerben mußte, wußte er den Knaben zwar in bester Obhut, aber ihm war es seither keinen winzigen Augenblick vergönnt gewesen, selber als sein Vater ihm die junge Seele zu wärmen. Das waren die bittersten Stunden, spiegelten sich in seinen Gedanken die Bilder von Gela und Endres, und das geschah, je näher der Aufbruch rückte, zu jeder Stunde.
An einem Montag nach Pfingsten war es soweit. Man schrieb den Zehnten im Juni, und es versprach, ein heißer Tag zu werden. Er hatte am Abend zuvor noch in der Kirche Sankt Leonhard, die unweit der Barfüßergasse lag, die Andacht besucht und sich von Indagine den Segen erteilen lassen. In der Nacht, doch wohl schon, als es zu dämmern begann, trat er in den Hof des Hauses »Zum Einhorn«, wo Peter Hock ihm heimlich eins seiner Pferde untergestellt hatte. Mathis nahm nur das Nötigste mit, die Wegzehrung, sein Skizzenbuch, auf das er in gar keinem Fall verzichten wollte, Kleider, einige Decken, die Schaube, allsamt verstaut im Reisesack, den er am Sattelknopf befestigte. Auch den Degen trug er und in einem Lederbeutel, mit einer Schnur um den Hals geschlungen, dicht am Leib, nebst dem Münzgeld seinen Wappenring aus purem Gold. In die Herzstelle des am Oberrand leicht geschwungenen und zum Fuße hin spitz zulaufenden blautingierten Schildes war silberweiß das Bildnis des Lammes eingeprägt, schräg über der Schulter das Kreuz haltend. Oberhalb der Figur, von der rechten zur linken Flanke und den Ort streifend, spannte sich der Regenbogen, nach der Genesis des Alten Testaments das Zeichen Gottes für den Bund, den er zwischen sich und allem Leben auf Erden geschlossen hatte. Über der Spitze am Schildfuß waren die Initiale seines Namens in einer Form, bei der mitten ins M gesetzt nur wenig niedriger das G stand, eingraviert: M G N.
Bevor er sich in den Sattel schwang, streichelte er dem Falben über die dichte Mähne, tätschelte seinen Hals und raunte ihm ins aufmerksam lauschende Ohr: Bring uns fort, mein Braver, so schnell deine Füße dich tragen. Verlaß mich nicht.
Hans Ruckus, der windige Schneider, war eingeweiht. Als letzten Dienst erwies er dem Meister, daß er, wenn auch mit dessen Silbergroschen, die Wachtknechte im Torhof von Allerheiligen bestach, was Mathis allerdings half, die Dunkelheit zu nutzen und ungehindert passieren zu können.
Er ritt gen Osten, der über den Hügeln aufschimmernden Sonne zu, gab, als er die offene Landschaft vor sich sah, dem Pferd die Sporen, beugte sich im Galopp tief über seinen Nacken. Er spürte die Kühle des Morgens durch Wams und Hemd bis auf seine Haut dringen, doch er überließ sich dem Jagen, wollte Weite gewinnen, Raum hinter sich legen, damit ihm die Häscher des Kurfürsten, die überall in der Gegend lauerten, nicht noch den Weg abschnitten. Ja, er hatte einen guten Zeitpunkt gewählt. So früh war es noch, daß er nicht einmal den ersten Bauern begegnete, die wohl bald zu ihrem Scharwerk auf den Feldern würden aufbrechen müssen. Fest im Sattel, wie in einem mit dem Pferde, tastete er sich dann auf schmalen Pfaden durchs Gebirg, trabte im Bogen um Hanau, wo er erst recht Albrechts Schergen vermutete, und trachtete, noch vor Sonnenuntergang Gelnhausen zu erreichen. Dort, in der Reichsstadt, hatten ihm Peter und Henne Hock geraten, könne er bei den Rüdigers, ihren Verwandten, Unterkunft finden, ohne dem Zugriff des Kardinals ausgesetzt zu sein. Ihnen solle er auch das Pferd anvertrauen, sie würden es sich bei passender Gelegenheit zurückholen. Wie er dann aber weiterkomme, müsse er selber erfragen.
Er näherte sich der Stadt vom Süden. Von einer bewaldeten Höhe herab sah er sie plötzlich vor sich liegen und unten im Tale die Kinzig fließen. Er wollte auch hier, noch immer auf der Hut vor bösen Überraschungen, die Dämmerung abwarten, bevor er sich nach Gelnhausen wagte. Vielleicht, dachte er, ist es gar ganz in der Nähe, hier an der Handelsstraße nach Leipzig und Sachsen geschehen, wo Winckler ermordet wurde.
So gönnte er sich eine Rast, denn ihm blieb noch Zeit, und band den Falben an einen Baum.
Der Blick ins Tal überwältigte ihn, ließ ihn fast vergessen, daß er sich auf der Flucht befand. Vor der Stadt, auf einer Insel inmitten des Flusses, erhoben sich die mächtigen, aus wahrhaft trutzigen Buckelquadern errichteten Gemäuer der Kaiserpfalz Barbarossas. Die Fachwerkgiebel und der alles wuchtig überragende Bergfried waren in ein seltsam goldgelbes Licht getaucht, das die sinkende Sonne vom Westen her über sie goß. Welch malerische Pracht breitete sich da vor seinen Augen aus! O hätte er doch seine Farben! Wie könnte er dann seiner Stimmung jetzt, die dem heraufziehenden Schatten des Abends glich, Ausdruck verleihen!
Statt dessen nichts, nichts. Zwar versuchte er, mit dem Silberstift das Erschaute festzuhalten. Doch ihm geriet nur ein kläglicher Abklatsch. Er fühlte sich, als sei er gefesselt. Seine Hand zeichnete, warf die Striche aufs Blatt, aber deren Blässe, ihr monotones Grau vermochten nichts von dem wiederzugeben, was sonst sein Geist in feurigem Rot, in schrillem Gelb und besänftigendem Blau zwischen Himmel und Hölle zu erfassen suchte. Die Pfalz von Gelnhausen, nein, sie würde er nicht wie einst das Straßburger Münster auf seinem Maria-Schnee-Altar malen, den Prophezeiungen der Birgitta für die Kirche folgend, als gespaltenes Bauwerk, nein. Sie stand anders vor ihm, empfand er, wie die feste Burg Gottes, als ein Fels der Rettung auf seiner Flucht.
Der Falbe wieherte, schnaufte, scharrte mit den Hufen im Geröll. Mathis schnürte sein Skizzenbuch zu und griff, um eine Kleinigkeit noch zu essen, nach Brot und Käse. Das Tier, dachte er, mahnt mich. Reit in die Stadt vor der Dunkelheit. Laß genug sein des Meditierens, bevor der Teufel sich dir in die Brust wühlt. Und du, mein braver Gesell, sollst bald deinen Hafer zu fressen kriegen. Du hast ihn dir redlich verdient.
Jetzt, da er vom Berge herabstieg, sich dem Fluß und der Pfalz zwar anfangs noch zögernd, doch bald, das Pferd unter sich zum Trab ermunternd, mit jedem Hufschlag zusehends näherte, erinnerte er sich plötzlich seines letzten Blickes, den er auf Seligenstadt geworfen. Es war im Morgengrauen am Sonntag Misericordias Domini gewesen, ohne daß er noch die Messe, wie vorgehabt, besucht und ihm Trost zugesprochen worden wäre im Psalm: Ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich ... Gela hatte es das Herz gebrochen, der Kardinal ihn, wie in ihrem allerletzten Gespräch angedroht, nachdem er ihn zur Subordinatio, zum Abschwur ins Aschaffenburger Schloß befohlen, sofort all seiner Güter beraubt, und so war er vor einem Jahr so sehr in Eile gewesen, daß er über Nacht von seinen Gehilfen am Ladplatz Truhen und Kisten mit allem, was von einigem Wert und er retten zu können glaubte, auf ein Floß stapeln ließ, und war über den Main gesetzt. Wäre er zur Landseite hin, durch die Sumpfaul, den Wehrturm im Süden, oder das Tor gen Steinheim geflohen, hätte er fürchten müssen, den noch immer mordenden, folternden, brandstreifenden Rittern und Reisigen des Feldhauptmanns Frohwein von Hutten und des Markgrafen Ansbach, des Augenausstechers, die seit Monaten im Odenwald und im Spessart die Dörfer abfackelten, in die Hände zu fallen. Sie höhnten der Misericordia, kannten keine Barmherzigkeit nach dem Willen des Herrn, sondern machten gnadenlos Jagd auf die geschlagenen Bauern, köpften und spießten sie.
Am gegenüberliegenden Ufer erwartete ihn damals der Wagen, mit zwei Pferden im Gespann und bereit, sein Zusammengerafftes aufzunehmen, und nun blickte er ein letztes Mal zurück. Auch dort sah er die Pfalz, mitsamt der Stadt sich soeben aus dem Dunst über dem Main erhebend, das Palatium der Staufer, wegen der Farbe seiner Sandsteinquadern das Rote Schloß genannt, doch weit kläglicher als sein Gegenstück hier in Gelnhausen, schon von den Spuren der Vergänglichkeit geprägt, vom Verfall nicht nur seiner Mauern bedroht, sondern auch seines einstigen Ruhms. Hoch und mächtig hingegen überragten es die Türme der Benediktinerabtei, von Sankt Laurentius und dem Maintor. O Gott, und er erkannte sogar das gestreckte, gedrungene Schindeldach von Mehlwaage und Fleischscharn, in deren Nähe er soeben, vor dem ersten Hahnenschrei, seine Werkstatt verlassen hatte, und wie es nun schien, für immer. Die Hälfte seines Lebens hatte er sie betrieben, anfangs nur spärlich eingerichtet und mit wenigem Hausstand, nachdem er als junger Maler, fünfundzwanzig Jahre alt, von seiner Wanderschaft entlang dem Rheine bis Holland ins Fränkische zurückgekehrt war, zuletzt von Dürer aus Nürnberg kommend, der ihm geraten, sich seßhaft zu machen. Mathis hatte sich Seligenstadt auserkoren, denn schon war Graf Berthold von Henneberg, Kurfürst und Erzbischof von Mainz, der nicht fern in Aschaffenburg residierte, seiner hohen künstlerischen Gaben gewahr geworden, und auch die Stadt lockte ihn mit einem günstigen Angebot. Freilich dauerte es dann bis zur Amtseinweihung Uriels von Gemmingen, daß er zum Hofmaler Seiner Eminenz bestallt wurde. Aber Seligenstadt war ihm stets sein liebster Aufenthaltsort geblieben, obgleich er hatte in Kauf nehmen müssen, oftmals sogar über längere Zeit, in der Fremde zu weilen und zu arbeiten: in Aschaffenburg, was noch anging, im Gefolge Albrechts später in Halle und besonders in Isenheim am Fuße der Vogesen.
Doch er hatte ja auch Gela bewegen können, ihm mit dem Sohn hierher zu folgen und fortan sein, wenngleich unstetes, Leben zu teilen. In Isenheim, dachte er, in Isenheim hat mir mein Stern geleuchtet und in Seligenstadt die Sonne unseres gemeinsamen Glücks. Bis Albrecht... Bis Albrecht, die Furie Roms, es zerbrach...
Vor den Wällen der Stadt, wo er zusammen mit Henne Hock einen Graben gepachtet hatte, dessen Zufluß aus dem Ellensee kam, in den Gärten ringsum, mit den Obstbäumen, Blumenbeeten und Bienenstöcken, war ihr zweites Zuhause. Weit dehnte sich vor ihren Augen die Mainniederung, über die westwärts sich wälzende Flut hinweg, die nicht selten jedoch gebändigt und ruhig, spiegelglatt dahinglitt, bis zu den sanft ansteigenden, in der Ferne türkis schimmernden Bergen. Mathis hatte mit einem Wehr das Wasser gestaut und über dem Grabenlauf eine Mühle erbaut, um zwischen ihren Steinen die Grundstoffe seiner Farben zermahlen und aus dem Pulver die unterschiedlichsten Pigmente gewinnen zu können. Dem Porphyr und der böhmischen Erde entzog er das Grün, den Behenwurzeln das Blau. Der Lapislazuli bediente ihn mit reinstem Ultramarin, verkohlte Schweineknochen aus China ergaben ein tiefes Schwarz, und die erst jüngst im Handel aus Spanien erworbenen, getrockneten und zu Erbsenform verklumpten Schildläuse, die Cochenilles,hinterließen ein Karminrot, heller und strahlender, als es ihm je zuvor zu extrahieren gelungen war.
Sobald es ihnen in ihrer Gasse nahe dem Markt zu eng wurde, zu stickig unterm Gebälk ihres Fachwerkhauses, schon allein wenn die ersten Blüten sich zeigten und die Sonne zu wärmen begann, zog es sie an den Graben, und während es Mathis nicht lassen konnte, über Spülbecken und Reibschüsseln gebeugt, in der Mühle seine Pulver zu schlemmen und, trat ihre Reinheit endlich zutage, mit Talg und Ölen zu verbreien, ergötzten sich Gela und Endres im Garten beim Spiele. Er hörte ihre Stimmen von draußen, vernahm ihre Fröhlichkeit, und ihm war zumute, so verriet er es auch gelegentlich seinem Freund Henne, als könnte er noch so alt wie Methusalem werden und für immer die Christenheit mit seinen Bildern erfreuen.
Doch war es nur das, was ihn trieb? War auf Erden denn nicht das Reich Gottes schon gespalten? Im Lande stund auf der Bauer, der Mönch aus Wittenberg nagelte seine Thesen an die Schloßkirche daselbst. Und Rom, der Papst, die Kurie? Sie vermochten alldem nichts weiter entgegenzusetzen als ihr Dogma, ihr hohles Getön von Unfehlbarkeit, das wie aus leeren Weinfässern klang. Die Bürger indes, sie wurden zur Sprachlosigkeit verdammt, die Kossäten und Knechte ins Halseisen gepreßt, gepeinigt bis aufs Blut.
Da malte Mathis ihnen eine Fahne, und als die Seligenstädter an einem Maientag zu ihm kamen, voran ihr Ratsschreiber Ulrich Schmotzer, ihm überbrachten, daß im Steinheimer Schloß sich die wilden Reiter Wilhelms von Hohenstein, des Kardinals Statthalter in Aschaffenburg, eingenistet hätten, zwar eingesperrt vorerst und umringt, sie jedoch nach wie vor darauf sännen, das Maintal zu kujonieren, schloß er sich ihnen an. Man stand unter Waffen, gereizt bis zur Weißglut und fest in dem Glauben, wie ihn das über ihren Häuptern im Winde wehende Tuch verkündete: Nichts als die Gerechtigkeit Gottes! Breit über dem Spruch prangte der Regenbogen, das Bekenntnis des Mathis Gothardt zum Bunde, und dagegen fruchteten auch die beschwörenden, labernden Worte von Kanonikus Reitzmann nicht mehr, mit denen er ihm ins Gewissen zu reden trachtete: »Hütet Euch vor dem Pöbel, Meister. Fliehet den Aufruhr. Selbst der Doktor Martinus hat die Rebellen bereits verflucht, in Reue über seine eigenen Sünden. Steche, schlahe, würge sie, schreibt er, wer da kann! Wiederum, was auf der Bauren Seiten umkommt, ein ewig Höllenbrand ist... - Hier, ich kann es Euch zeigen.«
Es war im Gasthaus »Zum Riesen«, wo sich beide begegneten. Dort im Keller wurde der Kanonikus mit etlichen anderen, die man für Partheigänger Roms und der Fürsten ansah, gefangengehalten. Verstohlen und furchtsam, ob auch keine der Wachen sie beobachtete, schaute er sich um und zog, nachdem er sich sicher zu sein glaubte, aus dem tiefen Versteck seines Gewandes eine, wie es schien, noch druckfrische Flugschrift. Mathis warf einen flüchtigen Blick darauf und las auf dem Titelblatt: Wider die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern ...
Brüsk wandte er sich ab, verließ den Kanonikus ohne Gruß, ohne ein Wort. Mit einem galligen Gefühl der Enttäuschung, doch anders, als von Reitzmann beabsichtigt und gewünscht. Seine Enttäuschung, all seine Bitterkeit galt nicht ihm, sondern Luther.
Am Tage zuvor bereits hatte sich wie mit der Eile der um Pfingsten tosenden Frühlingsstürme in der Stadt die Nachricht verbreitet, daß Bischof Wilhelm, der Statthalter, in Aschaffenburg zwei Schiffe habe ausrüsten lassen, voll beladen mit Archivalien aus der kurfürstlichen Kanzlei und Kostbarkeiten aus Albrechts Reliquiensammlung, begleitet an Deck von etlichen Pfaffen und Hofdienern. Sie wollten sich, hieß es, mitsamt den Akten und Schätzen über den Main nach Steinheim in Sicherheit bringen und dadurch den Heerhaufen der Bauern unter Florian Geyer und Götz von Berlichingen zuvorkommen, die inzwischen vom Spessart und dem Odenwald herab gegen die Residenz des in Halle weilenden Kardinals rückten. Spätestens am Abend müsse man damit rechnen, daß die Fracht Seligenstadt passiere. Die Bürger, vom niedrigsten Zunftgesellen bis zum höchsten Magistratsherrn, waren sich wie selten einig darin, diesen Bubenstreich des verhaßten Wilhelm von Hohenstein zu vereiteln, zumal sie vermuteten, unter den Akten befänden sich Schuldbriefe, Urkunden über Zinsforderungen und andere drückende Lastzuweisungen.
Auch Mathis wurde um Rat gebeten, gefragt, wie man zu Werke gehen könne. Er kenne sich ja in der Wasserkunst ebenfalls aus, habe Pumpen und Mühlen mit Seilzügen gebaut, sei also vertraut mit Winden und all ihrem Zubehör, und ob nicht mit Tauen die Schiffe aufzuhalten wären. Nein, zu diesem Zwecke sei schon ein solcher Gedanke völlig abwegig, das Hanfzeug würde zerfetzt wie Papier. Hingegen hülfe mit höchster Wahrscheinlichkeit eine eiserne Kette, armdick in den Gliedern, von jener Art, wie sie in Bergwerksschächten benutzt würde, um die Körbe mit dem Erz zu fördern. Die Schmiede wußten sie zu finden, spannten sie quer durch den Fluß, vom Ladplatz zum anderen Ufer, und legten so, unsichtbar unter Wasser, eine unüberwindbare Sperre an.
Als die Schiffe dann kamen, wurden sie gerammt, schwankten auf den Wellen und trieben breitseits gegen die Kette. Nur mit Not vermochten sich die geistlichen und weltlichen Schranzen des Kardinals und seines Bischofs, darunter Kanonikus Reitzmann, an Land zu retten. Dort wurden sie, pitschnaß, mit Hohngelächter und Spottliedern empfangen und vorerst im Keller des Gasthauses »Zum Riesen« gefangengesetzt. Die Akten warf man auf dem Ladplatz zu einem Haufen zusammen und zündete ihn an. Der Brand, zum Freudenfeuer erhoben, loderte hoch in den Abendhimmel. Noch bis spät in die Nacht hinein umtanzten Burschen und Mädchen die Glut, ehe sie vollends verglomm, und weithin war ihr immer wiederkehrender Gesang zu hören, dessen Text wohl soeben erst entstanden sein mochte:
Da fahrn drei Pfaffen über den Main
und kommen in unsre Stadt hinein.
Da sollen sie gleich gebraten sein
und schmecken uns als wie ein Schwein.
Nach diesem Vorfall, erst recht nach dem schroffen Verhalten von Mathis ihm gegenüber tags darauf, wandte Reitzmann sich, für alle Zeit gedemütigt fühlend, von ihm ab. Er wurde zu seinem erklärten Feind. Und auch der Kardinal verzieh ihm später nie diese Tat.
Das Land, mit dem Blick über den Main, wie er es durch die Fenster seiner Mühle am Ellengraben weit vor sich hingestreckt sah, hatte ihn stets, wo immer in der Fremde, vor Augen begleitet. So auch diesmal, als er sich entschloß, die beiden Flügel der vorderen Schauseite seines Altars vom ursprünglichen Entwurf, der allein in zwar abgestuften, doch ineinander verlaufenden Grautönen gedacht war, zu lösen und die beiden Heiligen, Antonius und Sebastian, wie das übrige in Farbe zu gestalten. Es war seine letzte Handlung; nach fast vier Jahren endlich, nur mit kurzen Unterbrechungen, würde das Werk vollbracht sein. Da überkam ihn, indes er sich tief erschöpft fühlte, zugleich die freudige Genugtuung, mit all seinem Können, seiner Glaubenskraft und ehrlichen Gewissens vor sich selber, etwas sehr Tröstliches, Nützliches für die Kranken und Irren im Hospital, nein, weit über sie hinaus, für die gesamte gegeißelte Christenheit auf Gottes Erde geschaffen zu haben. Und warum sollte er da nicht die Engel mit der Siegkrone für den Märtyrer über der Flußniederung bei Seligenstadt schweben lassen, seiner Heimat, nach der er sich jetzt mit jedem Tag mehr zurücksehnte?
Sebastian stand, trotz seiner Schmerzen unter der Folter, erhaben und kühn, zum Aufbruch bereit, den Blick noch fragend auf Christus am Kreuz gerichtet, umwallt vom Zinnoberrot des durchscheinenden Tuches wie von einer Fahne, und was nicht alles hatte er in dieser Figur gewagt! Da bedurfte es jetzt in dem Fenster über Sebastians Haupt einer Landschaft in lichten Farben, sanft, grün, mit gedämpftem Gelb und einem bläulichen Schimmer über den Bergkuppen am oberen Bildrand, als tauche sie aus einem zarten Dunstschleier, wie ihn der Fluß so oft trug. Mathis wollte es Gela zeigen, er malte das Bild auch für sie. Sieh an, sollte es heißen, hierhin werden wir gehen und glücklich sein, bis daß der Tod uns scheidet ...
Wie oft hab ich dich selber genommen von deiner Natur, Geliebte, in Kreide und auf den Tafeln. Deine Züge, ewig verbunden sind sie mit diesem Werke. Man wird dich erkennen noch in der Flut der Jahre, die sich einst über uns wirft, die nach uns kommt, wenn wir beide darin schon längst versunken sind. Und auch der Sebastian wird es sein, denn ich habe mich ins Portrait gesetzt und bin über meinen Schatten gestiegen. Auf dem Sockel zu seinen Füßen, und das sei mein allerletzter Strich, er stehe wie eingemeißelt, trage ich meinen Namen ein, überwinde die Scheu, als eitel zu gelten. Ich bin kein Sklave der Kirche, von diesen Bildern kann man es lesen. Ich tue es den Italienern und Dürer nach. M G N, Mathis Nithardt, der sich Gothardt nennt. Auch das soll sein!
Er entsann sich, ein einziges Mal nur zuvor hatte er sich selbst konterfeit. Das war, als er noch ein Lernender in der Werkstatt des Meisters Simon in Würzburg gewesen, ein von der Malkunst besessener Bursche von achtzehn Jahren, und auch dort hatte er sich wie hier vor einem Fenster gespiegelt, dahinter Tal und Berge. So, stellte er sich damals vor, würde er auf Wanderschaft gehen, seinen Weg suchen durch die Gebirge am Rhein, deren Gestalt er jedoch bis dahin nur vom Erzählen kannte.
Ja, er hatte auch da schon von sich gefordert, nichts in seinem Gesicht zu vertuschen, obwohl gewiß noch im naiven Bestaunen des Natürlichen, und alles andere wäre ihm vorgekommen, als hätte er die Schöpfung betrügen wollen. Heute aber war es längst der ausgeprägte Sinn in ihm, die Wissenheit, die ihn lehrte, alles abzulehnen, was den vorgegebenen Zeichen zwischen Himmel und Erde widersprach. Ihre Geheimnisse durften nicht die Farben schlechthin, so bunt sie auch glimmerten, nach außen kehren, sondern es mußte ihr Ausdruck sein, die Form, der Geist, der ihnen innewohnte. Nicht um die Schönheit ging es ihm, sondern um die Wahrhaftigkeit. Darüber hatte er schon mit Meister Dürer gestritten, während seines Weilens in Nürnberg, obwohl er ihn verehrte. Aber er mochte ihm nicht folgen in seiner Bewunderung des Italienischen. In Deutschland, schien ihm, sei alles anders als in der Nähe des Apostolischen Stuhls, hier wuchsen auch keine Pinien, hier wuchsen Kiefern und Erlen und Buchen.
Mathis erinnerte sich, daß er auf seinem Jugendbildnis schon damals nicht die Warze verschwiegen hatte. Sie ward ihm bereits im Mutterleib auf die linke Wange gegeben, und dorthin gehörte sie auch, wenngleich sie nun im Spiegel auf der rechten Seite erschien. Er malte die Bartstoppeln um Oberlippe und Kinn, überdeutlich, damit auch nichts von seinem Antlitz in diesem Augenblick verlorenginge. Es war wie ein Rausch in ihm, der ihn jedesmal befiel, sobald er erst alles Geschehen um sich vergaß und sich nur noch der Arbeit widmete. Weder konnte noch wollte er ihn zügeln, als müsse er sich rechtfertigen, um Verzeihung bitten für die Ekstase, mit der er über die Jahre den gesamten Altar, Bild für Bild, Pinselstrich für Pinselstrich, in ein Licht gesetzt hatte, das nur das seinige war und in das er sich selbst einbezogen wissen wollte.
Als er sich aber, allein und erschöpft, in den Scherensessel fallen ließ und die beiden Tafeln nebeneinandergestellt betrachtete, kamen ihm plötzlich Zweifel. Auch das kannte er. Zunächst vermochte er nicht zu sagen, was ihm an Sebastian und Antonius mißfiel. Doch dann, je mehr er sich in den Anblick der Szenen vertiefte, wurde ihm bewußt: Sie wirkten, als seien sie seitenverkehrt gemalt. Der Greis Antonius, ja, als Verkörperung des erstarrten Glaubens, gehörte der Kreuzigung rechts zugeordnet und Sebastian links, er, der zu den neuen Ufern der Christenheit aufbrach. Wie nur hatte er das übersehen können! Wie auch wäre sonst seine Botschaft zu verstehen, wenn sich die beiden Köpfe, der des sterbenden Heilands und der des gegen seine Feinde sich wehrenden Märtyrers, nicht einander zuneigten?
Der Meister, so läßt sich dem Bericht Johan Glasers entnehmen, habe mehrmals davon gesprochen, daß er wohl deshalb fast einem Irrtum aufgesessen wäre, weil er sich beim Übermalen der Steingrautöne noch an den alten Entwurf gehalten habe. Denn die Flügel mit dem Antonius und dem Sebastian seien von ihm als erste konzipiert worden, wobei er die beiden Heiligen statuarisch, wie Skulpturen aufgefaßt habe in der Absicht, mit ihnen lediglich das Mittelbild zu umrahmen, um es seines Ausdrucks nicht zu berauben. Sie sollten nichts weiter darstellen als das, wofür sie galten, zumal im Klosterspital zu Isenheim, Sankt Antonius als der Schutzpatron gegen den Veitstanz und das nach ihm benannte Antoniusfeuer, das furchtbare Fieber, Sankt Sebastian als Nothelfer gegen die Pest und die sich immer mehr ausbreitende Franzosenkrankheit. Indessen aber, nachdem er zum Schluß zu diesen Tafeln zurückgekehrt sei, habe sich während der Jahre in ihm selbst eine Wandlung vollzogen, und es sei wie ein Zwang gewesen, der ihn geführt, als hätten im Umgang mit der Farbe die Pinsel in seiner Hand sich selbständig gemacht und seinen neuen Erkenntnissen unterworfen. Denn nun habe er den Sebastian wie sich selbst gesehen und ihn nicht mehr allein als den Heilung spendenden Gottesknecht empfunden. Nein, er sei über diesen Charakter hinausgewachsen, so daß er ihm auch nicht mehr das qualvolle Dulden unter der Folterung durch die mauretanischen Schützen habe abnehmen wollen. Es sei ihm im Gegenteil, weniger bewußt als vielmehr inspiriert, der Gedanke gekommen, ihn wider alle Überlieferung als einen Mann zu zeigen, der sich wehrt, der die Pfeile aus seinen blutenden Wunden reißt, sich von den Fesseln befreit, um wieder zu den Menschen zu gehen und den Anbruch einer neuen Zeit, wie von der Birgitta beschworen, zu verkünden, einer Zeit ohne Drangsal, Habgier und Fronschaft. Als Rest seines anfänglichen Entwurfes seien allein die Säulen übriggeblieben, doch nunmehr in anderer Bedeutung. Ihre Funktion bestehe jetzt darin, die beiden Flügel gegen den Mittelteil abzugrenzen, da ja weder Antonius noch Sebastian Zeugen des grausigen Geschehens auf dem Kalvarienberge haben sein können und sie nur, wäre die Zuordnung andersherum, der übermenschlichen Größe des Opfertodes Jesu Christi entgegengewirkt, sie geradezu entweiht hätten. Er danke Gott, daß ihm diese Erleuchtung noch zugefallen, bevor sein Lehrer und Gönner Guido Guersi, der Präzeptor des Antoniter-Chorstifts, gekommen sei, um den Wandelaltar abzusegnen.
Bei ihm hatte sich Mathis nie in eine solche Abhängigkeit gezwängt gefühlt, wie sie ihm später von Albrecht auferlegt worden war, und er fragte sich oft, welche Ursache es dafür gehabt haben könnte. Daß er sich, Guersi, angeregt durch die höchsten Ordensbrüder, die zwar ihren Sitz weitab in der französischen Dauphine hatten, jedoch zum Mainzer Hof enge Beziehungen unterhielten, zum Stifter des Altars erklärte und, wider Erwarten, seinem Maler trotzdem sehr viel Platz für seine künstlerischen Intentionen einräumte, konnte der Grund allein nicht gewesen sein. Sein Vorgänger im Amt, der dem Niklas Hagenauer aus Straßburg bereits den Auftrag erteilt hatte, den Schrein und die Skulpturen zu schnitzen, galt als ebenso verschwendungssüchtig und prunkliebend wie der Kardinal. Überdies gaben die Äbte und Chorherren gleich ihm, Albrecht, da sie fast sämtlich, wie der Sizilianer Guersi, aus dem gefleckten Italien stammten, dem anderen, von dort herkommenden Denken den Vorzug, der Umanista, und zwar auch in der Kunst. Ein Unterschied allerdings bestand: Guersi war um Jahrzehnte älter als Albrecht, deshalb gewiß gereifter, weiser. Womöglich lag es daran und auch, weil er eben ein Italiener von Geburt war und nicht nur ein Anbeter, ein Plagiator des Italienischen, daß er der Toleranz mehr zuneigte als jener Kurfürst, dem als Jüngling bereits vom Hause Brandenburg die Mitra eines Erzbischofs erkauft worden war. Albrecht, dieser Albrecht trat, wie einst der Täufer aus der Wüste Juda, aus dem Sand ums märkische Cölln auf, ausgedörrt und lechzend und demzufolge mit einem unstillbaren Durst nach Wohlleben und Genuß. So jedenfalls war es Mathis erschienen, sarkastischer von Mal zu Mal, wenn er ihn aus nächster Nähe bei seinen rauschenden Festen beobachtet hatte.
Guersis hingegen gedachte er stets in Dankbarkeit, bis zu dessen Tod, nur wenige Monde nach der Einweihung des Altars, und noch weit darüber hinaus. Der greise Stiftsherr hatte ihm nicht einmal nachgetragen, daß er sich mit den Bauern und Bürgern eines Sinnes befunden, als in Rufach an der Lauch, zwei knappe Wegstunden von Isenheim entfernt, der Aufstand ausbrach und er von dort Gela mitbrachte, mit der Begründung, sie solle ihm künftig, und nicht mehr nur im geheimen, als Model für seine Frauengestalten dienen.
Schon des öfteren hatte Guersi ihm bei der Arbeit zugeschaut. Nun aber tat er es mit besonderer Neugier, bald auch mit einem verschmitzten, nahezu fraternisierenden Augenzwinkern, nachdem er bemerkt hatte, daß das Mädchen, die blonde Schönheit, schwanger ging. Mathis konnte nicht länger umhin, als ihm zu beichten, doch der Präzeptor ließ es bei seinen ersten Worten bewenden und winkte ab. Er möchte sich nur von ihm die Bestätigung einholen, ob er sie, was er, wenn ihn sein Blick nicht täusche, vermute, denn auch wahrhaftig liebe. Und sei es der Fall, so hätte er gern gewußt, wie sie beide sich den Fortgang vorstellten. Eine Unterkunft, ja, im Kloster, die wäre ohne viel Aufhebens zu arrangieren, dafür ließe sich ein stilles Gemach schon finden. Aber ...! Sie sei die Tochter eines Hörigen und er ein Maler bei Hofe, sozusagen nur ausgeliehen von den Mainzern, so daß Ihro Gnaden, der Erzbischof, wohl bald wieder seine Hand nach ihm ausstrecken wird, und das eine wie das andere schließe aus, selbst wenn er für sie den Jungfernzins zahle, daß er sie eheliche. Und sollte auch das Kind, das sie unter dem Herzen trägt, von ihm sein, wie wolle er dann verfahren? Maestro, Maestro! Die Heilige Römische Kirche ist voller Ingrimm gegen die Unzucht, und sie wird, kommt das Menschlein zur Welt, es als eine Frucht der Sünde betrachten und ihm die Taufe verwehren. Also, dessen eingedenk solltet Ihr Euch entscheiden, ob Ihr es durchkämpfen wollt oder nicht. Doch wie ich Euch kenne, seid Ihr ein gottesfürchtiger Mann und kein solch ein Nequam, ein Hansen. Guersi, schon wie ein Vater zum Sohne, gab ihm mit auf den Weg, sie beide, Gela und er, sollten sich nur fortan einander in Treue üben, und riet ihm, das Kind zu adoptieren, es anzunehmen als das, was es sei, sein eigen Fleisch und Blut. Dann würde der Herr sie auch ohne das Sakrament der Ehe willkommen heißen. Denn vor dem Allmächtigen, sagte er, zählen nicht die Eide, die sterblich sind wie alles auf dieser Welt und leicht gebrochen werden können, sondern die Taten in Christo.
Von Isenheim zurück am Hofe, im Gefolge des Erzbischofs und späteren Kardinals, dessen Schalten und Walten bald mehr denn des Kaisers in Deutschland war, sah Mathis, immerzu auch ins Licht gesetzt von dem sternedeutenden Indagine, wie sich die Weissagungen der Birgitta über den Verfall der Kirche zu erfüllen begannen. Und als Maximilian starb, wurde das Reich erst recht von der römischen Plage heimgesucht, so als hätten bereits die Engel die erste der sieben Schalen des göttlichen Zorns über ihm ausgeschüttet. Mathis, weilte er fern von Seligenstadt, um den immer ehrgeizigeren Befehlen seines Fürsten nachzukommen, verzehrte sich, je länger jedesmal seine Abwesenheit dauerte, in Sehnsucht nach Gela und Endres, obwohl er sie daheim in Geborgenheit zu wissen glaubte. Dennoch, ihm stand das Schicksal Jörg Ratgebs vor Augen, des Heilbronner Malers, wovon er Kunde erhielt, von seinem vergeblichen Ringen mit dem Herzog um die Auslösung seiner in Leibeigenschaft gefangenen Frau, und so fürchtete er vor allem, daß auch Gela, bei ihrer Herkunft, Leid zugefügt werden könnte. Er trug noch den Trost Guersis im Herzen, daß Gott ihrer Liebe auch ohne Sakrament wohlgesonnen sei, und sie lebten danach. Aber zugleich entging ihm ja nicht, wie Albrecht sich den Teufel um Sittlichkeit scherte, weder seinem Keuschheitsgelübde gehorchte noch sich band, statt dessen orgiastische Feste feierte, völlte, am Wein sich ertränkte und hurte. Er sammelte seine Maitressen wie Kunstschätze, wechselte sie gar mehrmals wie die Seidenstickereien auf seinem Ornat, bevor ihn Mathis darin malen durfte. Schon als achtzehnjähriger Domherr in Mainz, untertan noch dem Uriel von Gemmingen, hatte es mit der Bäckerstochter Ursula Riedinger angefangen und fand mit der verwitweten Agnes Pleß in Halle noch längst kein Ende. Gelegentlich geschah es sogar, daß er ihn, indem er ihm seine Unterworfenheit zu spüren gab, mit einem vielsagenden Lächeln danach fragte, ob denn seine Gesellin Angela auch in Natur wirklich so liebreizend anzuschauen sei wie auf dem Konterfei der Maria in seinem Schnee-Altar.
Albrecht hielt den Tetzel in Diensten, schickte ihn, ausgestattet mit allen Vollmachten seiner drei Bistümer, in die Städte, um unter Androhung der ewigen Verdammnis den Ablaß zu erhandeln. Im Namen Roms, hieß es ex officio in der Bulle, des Papa sanctus, zu Nutz und Frommen des neu zu erbauenden Petersdoms, doch stand nicht er selber, Albrecht, dahinter und bereicherte sich an den Dukaten, Gulden und sächsischen Silbertalern, sobald die Kästen geleert und die klingende Münze gezählt wurde, damit er seinen Gläubigern, den Fuggern, genügen und fürderhin seinem Kulte mit den Reliquien frönen konnte?
Es war schon längst ein Murren im Lande, gegen Rom, gegen ihn. Und als der Mönch in Wittenberg seine Thesen anschlug, fand es lautstarken Widerhall allerorten und erhob sich zum Aufschrei.
Von Indagine hatte sich Mathis, da er des Lateinischen nicht allzu mächtig war, die »Trias Romana« Ulrich von Huttens, des Ritters und Poeta laureatus, vortragen lassen. Begierig las er ein Jahr später, nachdem sie ins Deutsche übersetzt worden war, den »Vadiscus oder die römische Dreifaltigkeit« selber. Und trank er daraus denn nicht auch wie aus dem Born eines klaren Gebirgswassers? Wurde ihm nicht das Gesprächsbüchlein zur Quelle erneuter Inspiration?
Wie oft hatte er schon in seinen Bildern die Dreieinigkeit, Gottvater, den Sohn und den Heiligen Geist, zu erfassen versucht. Jetzt, jetzt!, rief es in ihm, jetzt sei es an der Zeit, auch dem Werke Satans, der Verderbnis der Kirche den Spiegel vorzuhalten. In seinen Gedanken wuchs, Huttens Schrift und Luthers Thesen gleich, ein aufrührerischer Plan. Führte er ihn fort, sollte er alles Bisherige in seinem Schaffen übertreffen. Schon fand er bei sich einen Titel. Die Dreieinigkeit des Bösen würde er es nennen, die »Höllische Trinität«. Und wenn er dieses, von ihm als Schild gegen den Verrat der Sündenpäpste am Glauben gerichtete, die Borgias und Medicis anprangernde Gemälde eines Tages enthüllte, würde er wie der Poet von sich sagen können: Ich hab’s gewagt mit Sinnen.
Kaum wieder zu Haus in Seligenstadt, griff er zu Papier und Kreide, wählte bewußt für das Blatt eine bräunliche Färbung, damit auch das Grau der Wischtöne, mit dem er die Figuren plastisch zu schattieren gedachte, zur Geltung käme.
Es war die Habgier, die er zu zeichnen begann. Ein lang und länger sich streckender Kopf mit überaus hoher Stirn und kantigem, brutal vorgerecktem Kinn, vom Schädel herab schon gelichtete, klebrige Haarsträhnen hinter das ebenfalls in die Länge gezerrte Ohr fallend. Die Nase scharfgratig, spitz wie ein Geierschnabel, und die Lippen verkniffen, höhnisch verzogen. Die Augen unter buschigen Brauen, mit einem eisigen, stechenden Blick. So sah er den Geiz, die Raffsucht, die über Leichen ging wie der Bel zu Babel, um das Hab und Gut, selbst das der Ärmsten unter den Menschen zu verschlingen.
Links daneben setzte er die Wollust, fett, mit feister Wange und schwabbligem Doppelkinn. Er zeigte das Gesicht im Profil, grell beleuchtet, um es zu entlarven, halboffenen Mundes und mit fäulnisbefleckten Zähnen. Auf dem Nasenrücken quoll blasig ein Geschwür als Mal der syphilidischen, gallischen Seuche. Mit blödem Ausdruck, fast schon blind, stierten die Augen gegen den Bildrand, doch wohl auch darüber hinaus, in die Leere, in ein Nichts. Es war, als wiederholten sich hier alle Laster der Männer und Weiber von Sodom und Gomorrha.
Dann wischte er mit den Fingerkuppen einen Schatten zwischen dem ersten und dem dritten, rechtshin gerichteten Gesicht, so daß es wirkte, als wüchse die Hoffart unmittelbar aus den Nackenwirbeln des Habgierigen. Auch sie sah er von der Seite, bannte sie in ein Antlitz, das verdüstert lag unter der Nacht der Gottlosen. Das Haar wild über die Augen wuchernd, als wollten die sich dahinter verstecken, ihre Blicke unerkannt bleiben. Fratzenhaft die Züge um Nase, Mund und Kinn. So konnte nur einer sein, der dem Herrn zuwiderhandelte, ihn verriet und verfluchte, ein Judas Ischariot.
Um den gemeinsamen Leib des Dreikopfes legte Mathis als deutliches Zeichen dafür, wem seine Abscheu galt, eine Kutte mit Kapuze. Dann umgab er die Häupter mit einer Gloriole. Doch nein! Sofort korrigierte er sich. Statt ihrer ließ er jetzt einen Halbkranz flammenden Höllenfeuers auf sie niederzüngeln.
Zweites Kapitel
Wo warst du, guter Jesus, wo warst du?
Warum kamst du nicht, meine Wunden zu heilen?
(Gebet)
Der Kurfürst und Kardinal, Primas Germaniae wie bereits zur Zeit Kaiser Maximilians so auch unter dessen Nachfolger Karl, dem er in entscheidenden Maße zur Inthronisierung verholten, hatte eine Post eingerichtet, bestehend aus reitenden Boten, die es gestattete, innerhalb nur zweier Tage Nachrichten von Aschaffenburg nach Halle und umgekehrt zu befördern. Davon zehrten sowohl Hans Schenitz als auch Johan Glaser, indem beide recht schnell in Kenntnis gesetzt wurden, daß Mathis am zehnten Juni aus Frankfurt geflohen war und sie nun täglich ab Mitte des Monats mit seiner Ankunft rechnen konnten, falls er es sich nicht noch anders überlegt und entschlossen hätte, nach Magdeburg zu gehen.
Hans Schenitz jedoch war sich da ziemlich sicher. Er kam die paar Schritte von seinem Palast, dem »Kühlen Brunnen«, herüber zum Haus »Weißer Hirsch« in der Prüfel und sagte es Glaser in voller Überzeugung von seiner diplomatischen wie finanziellen Ausstrahlungskraft. Er habe ja Mathis vor kurzem noch selber in Frankfurt gesprochen und ihm ein Angebot gemacht, das alles, was sich Magdeburg je leisten könnte, in den Schatten stelle. Der Meister sei so gut wie am Ende gewesen, dem Bettelstab nahe, während ihn Albrecht zugleich mit seiner Haßliebe verfolge, die weit gefährlicher sei als die gewöhnliche Rache gegen die Aufrührer, wie man sie jetzt allenthalben bei Fürsten und Grafen antrifft, und also könne er gar nicht anders, als hier im trotzig den Reformatoren zugewandten Halle Schutz zu suchen.
Sie saßen nahe dem mit glasierten Kacheln ummauerten Kamin, der wohl eher zum Vorzeigen eines gewissen Reichtums denn zum Heizen diente, erst recht um diese Jahreszeit, die mit schwüler Luft vor den bleiverglasten Fenstern stand, Glaser auf der Ofenbank, Schenitz auf einem breiten, bequem mit Kissen gepolsterten und kunstvoll geschnitzten Lehnen versehenen Stuhl, den der Hausherr natürlich ihm, seinem hohen Gast, sofort überlassen hatte. Mit Befriedigung nahm Schenitz auch wahr, daß an den holzvertäfelten Wänden einige Teppiche hingen, die er seinem Wirte vor noch gar nicht langer Zeit aus den Niederlanden besorgt und verkauft hatte. Auf dem einen war in der gleichen Gestalt, wie über dem Hauseingang in Stein gehauen, das Wappen der Familie Glaser eingewebt, der zum Sprung ansetzende Hirsch.
»Es bleibt uns vorerst nichts weiter übrig«, sagte er, »als abzuwarten. Doch eigentlich bin ich gekommen, Verehrtester, um Euch die Kunde von unserem gnädigen Kurfürsten zu überbringen, die soeben mit der letzten Post bei mir eintraf. Der Brief ist an mich gerichtet, aber er enthält für Euch einen wichtigen, wenngleich delikaten Auftrag. Seine Eminenz erinnert sich Eurer vertraulichen Dienste in seiner Privatkanzlei und pocht auf Eure Verschwiegenheit. Ihr seiet ihm ein vorzüglicher Schreiber gewesen, einer, der ihm in Mainz und Aschaffenburg von Herzen fehle. Und nun bittet er, nein, befiehlt Euch, ihm wiederum in bewährter Weise zur Hand zu gehen. Kurzum, Ihr möchtet genauestens Buch führen über das Tun und Lassen Gothardts, sobald er sich bei uns meldet. Vor allem wünscht er sich Eure Notizen darüber, welcher Handlungen er fürderhin fähig ist, was er spricht, was er denkt, nachdem er sich auf die Seite der fränkischen Bauern geschlagen und sich ihm, dem Kardinal, widersetzt hat. - Doch was rede ich. Ihr seid ja selber wie selten jemand der Schrift kundig. Also lest die Zeilen, die Euch betreffen.«
Damit überreichte er ihm zwei mit steilen Lettern engbeschriebene Blätter gebütteten Papiers, und während Glaser den Text in sich aufnahm, ihn mehrmals schweigend durchging, machte Schenitz sich ein Vergnügen daraus, ihn zu beobachten.
Er war ein hagerer Mann mit gekrümmtem Rücken, was womöglich, obwohl er erst Anfang Vierzig sein konnte, an seiner jahrelang, stets über Akten mit Feder und Tinte, gebückt ausgeübten Schreibarbeit lag. Allerdings, mit seinem scharfen Blick, als prüfe er eine Ware, sah dieser Kaufherr und Bankier, den bereits manche den Fugger von Halle nannten, auch die Devotion an ihm, wußte er doch von seiner Katzbuckelei vor jedem, der ihm mächtiger erschien als er. Bei Gott, da hatte Albrecht eine gute Wahl getroffen. Glaser, der von Aschaffenburg zugewandert war, hatte sich ja ständig emporgedient. Bald war er zum Bornmeister der Salzquellen berufen und stets wiedergewählt worden. Die Gunst des Kardinals, die er als dessen Sekretär genossen, hatte ihm gar das Amt eines Thalvorstehers eingebracht. Er trat als Promotor beim städtischen Rat auf und urteilte über die Anträge jener, die sich um eine Neubürgerschaft in Halle bewarben, so erst jüngst fobst Kämmerer, der Goldschmied, und Donat Behme, der Buchbinder. Selbstverständlich würde Albrecht auch diesmal mit ihm zufrieden sein können. Glaser hatte ihm ja auch schon den seinerzeit vielgerühmten, ausführlichen Bericht über den außergewöhnlichen Erfolg, wie er meinte, seines Ablaßfestes in Halle verfaßt, und erst vor einem Jahr war er vom Kardinal damit beauftragt gewesen, auf diskretem Wege eine größere Geldsendung von Aschaffenburg an ihn, Hans Schenitz, zu überbringen, was er exakt erledigt und wofür sie ihm beide höchstes Lob gezollt hatten.